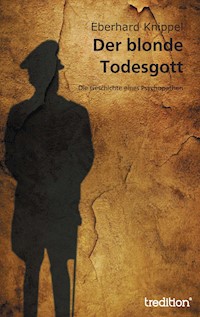
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dies ist die Geschichte des Judenjungen Simon und seines verrückten Leidensgefährten Augustin, die sich im Frühjahr 1942 in einem Keller der Millionenstadt Prag vor der Gestapo versteckt halten. Augustin bildet sich ein, der berühmte Heurigensänger gleichen Namens aus dem Wien des Jahres 1679 zu sein. Ihre verzweifelte Lage spitzt sich dramatisch zu, als die anonyme Gefahr in Gestalt eines SS- Offiziers, der die Wohnung über ihrem Versteck bezieht, konkrete Form annimmt: Reinhard Braumann, groß, drahtige Statur, blondes, streng gescheiteltes Haar, psychopathische Züge. SS- Standartenführer im Sicherheitsdienst des Reichssicherheitshauptamtes und zuständig für besonders schwierige Aufgaben. Scharfsinn und Skrupellosigkeit, Gnadenlosigkeit und Pragmatismus verbinden sich bei ihm in idealer Weise mit fast unbegrenzten Kraftreserven, brennendem Ehrgeiz, Mut und Kaltblütigkeit. Was ihn besonders gefährlich macht: Er ist auf der Jagd nach dem Mitwisser des bestgehüteten Geheimnisses des Führers und Reichskanzlers Adolf Hitler, nämlich die an ihm im Jahre 1918 im Reservelazarett Pasewalk vom Greifswalder Psychiater Edmund Forster vorgenommene und angeblich immer noch fortdauernde Hypnose. Er muss unbedingt herausfinden, was die Bewohner des Kellers unter ihm darüber wissen und wer sich hinter dem verrückten Augustin wirklich verbirgt. Für die Lösung dieses brisanten Falles hat er sich eine außergewöhnliche Methode ausgedacht, eine teuflische Mischung aus Hoffnung, Enttäuschung und Angst. Es beginnt der ungleiche Kampf Mann gegen Mann, Psychopath gegen wehrloses Opfer, bei dem es nach dem genialen Plan Braumanns nur einen Sieger geben kann, nämlich ihn selbst. Doch nach dem Attentat auf Reichsprotektor und Sicherheitschef Heydrich, eine der schillerndsten und widersprüchlichsten Figuren des Dritten Reiches, überschlagen sich die Ereignisse. Braumann lädt eine schwere Schuld auf sich, die ihn verfolgen wird und die er in diesem Leben nicht abtragen kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 353
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
www.tredition.de
Der Autor
Eberhard Knippel, geboren 1947 in Berlin, ist Naturwissenschaftler und hat viele Jahre in Grundlagenforschung und angewandter Forschung gearbeitet. Nun hat er sich der Literatur zugewandt. Nach dem beachtenswerten Debüt mit dem Roman Amina und der Erzählung Der Tempel ist Der blonde Todesgott seine dritte Arbeit.
Widerstrebende Seelen ruhen in des Menschen Brust, viele Dämonen liegen angekettet in der Tiefe der menschlichen Existenz und warten auf ein ganz bestimmtes Ereignis, das sie befreit und an die Oberfläche bringt.
Die Geschichte des jüdischen Schülers Simon Stein und seines Gegenspielers, des SS- Standartenführers Reinhard Braumann, spielt während der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Sie ist erfunden, gleichzeitig aber auch eingebettet in die realen historischen Zusammenhänge und schließt Personen und Geschehnisse der Zeitgeschichte ein, wie sie dem aktuellen Stand der Forschung entsprechen.
Eberhard Knippel
Der blonde Todesgott
Die Geschichte eines Psychopathen
www.tredition.de
© 2013 Eberhard Knippel
Umschlaggestaltung: Bartlomiej Zalewski
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
ISBN: 978-3-8495-7393-5
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Inhaltsverzeichnis
Erster Teil: Die Zuflucht
Zweiter Teil: Der blonde Todesgott
Dritter Teil: Das stille Lächeln
Anhang
Erster Teil
Die Zuflucht
Prolog
Undurchdringliche Dunkelheit umgab mich, kein Laut drang an mein Ohr, es herrschte eine unheimliche Stille. Ein ungeheurer Druck lastete auf mir, ich versuchte mich zu bewegen, doch es gelang mir nicht. Die Last über mir drohte mich zu erdrücken, und ich hatte das Gefühl zu ersticken. In Bruchteilen einer Sekunde durchzuckte mich ein Gedanke, ein undenkbarer Begriff, das Grauen der menschlichen Existenz an sich: Ich war lebendig begraben.
Dieses unbeschreibliche Grauen mobilisierte meine letzte Energie. Ich geriet in Panik und stemmte mich mit ganzer Kraft gegen den schweren Gegenstand über mir. Er war kalt und weich und gab nach, als ich ihn berührte. Mit großer Mühe gelang es mir, ihn etwas zur Seite zu bewegen. Durch einen schmalen Spalt traf mich ein Strahl trüben, milchigen Lichts und ich erkannte nun die Gegenstände, die mich umgaben, genauer.
Mein Herzschlag stockte: Es waren Leiber, menschliche Körper, kalt und starr. Der Verstand weigerte sich, diese Entdeckung zu akzeptieren, doch die Wirklichkeit belehrte mich eines Besseren. Soweit ich durch den schmalen Spalt auch blickte, überall sah ich menschliche Körper, einer über dem anderen, neben dem anderen, in seltsamen Verrenkungen, mit angewinkelten Armen und Beinen und aufgedunsenen Bäuchen. Sie lagen so, als seien sie in aller Eile in diese schreckliche Grube geworfen worden. Alle lagen durcheinander, Frauen auf Männern, Männer auf Frauen, auch ein Kind war darunter. Es lag auf der Brust seiner Mutter.
Plötzlich wurde die unheimliche Stille unterbrochen, es raschelte neben mir. Soweit es mir möglich war, drehte ich meinen Kopf in die Richtung, aus der das Geräusch kam – und blickte in kleine, rotgeränderte Augen, die mich neugierig anstarrten. Die feinen Witterhaare der Ratte waren starr aufgerichtet, sie schien zu spüren, dass sie nun, unter der Masse der sich auflösenden toten Leiber, plötzlich etwas Lebendigem gegenüberstand. Sie schien genauso erschrocken zu sein wie ich, doch die Erstarrung dauerte nur Sekunden. Ich hob abwehrend meinen Arm, sie reagierte sofort, huschte über die toten Körper hinweg und war augenblicklich im trüben Dämmerlicht verschwunden.
Unter großer Anstrengung versuchte ich, meinen Kopf noch weiter zu drehen. Da sah ich neben mir einen alten Mann liegen, zerfurchtes Gesicht, eingefallene, starre Züge, dunkle Augenhöhlen, die Augen unnatürlich weit aufgerissen, als könne er das Geschehene noch immer nicht begreifen. Soweit ich es in der Dämmerung erkennen konnte, war seine Haut merkwürdig dunkel verfärbt, aus dem halb geöffneten Mund ragte eine blaue Zunge. Eine wahrhaft groteske Maske des Grauens.
Halb fasziniert, halb entsetzt von diesem Anblick glitt mein Blick weiter an seinem Körper hinab, ganz automatisch, wie von einem inneren Zwang gelenkt. Sein Hals lag bloß, und daraus ragte eine blauschwarze Beule hervor, aus der dicker Eiter quoll. Die Ratte, schoss es mir durch den Kopf, und meine Lippen formten sich tonlos zu einem Schrei, zu diesem schrecklichen, lähmenden, alle Hoffnung auslöschenden Wort: die Pest.
Zu dem namenlosen Schrecken, dass ich lebendig begraben war, gesellte sich nun auch das Grauen dieser neuen Erkenntnis: Ich lag, lebendig wie ich war, in einer Grube unter lauter Pestleichen, alle im Endzustand der Seuche, die sie dahingerafft hatte, in der Zersetzung begriffen. Ja, in der Zersetzung, denn ich wusste: Hatten sie ihr Leben erst einmal ausgehaucht, wurden ihre Körper ein willkommener Brutplatz für Insekten aller Art, aus deren Eiern Larven schlüpften, die sich an der toten Substanz gütlich taten.
Und erst die Millionen und aber Millionen von Pesterregern, die sich in den vereiterten Pestbeulen sammelten. Jede intensive Berührung mit einem einzigen Pestkranken, das wusste ich, führt unweigerlich zum Ausbruch der Erkrankung; wie sicher war dieser Ausbruch dann erst hier, wo Dutzende von Pestleichen neben und über mir lagen. Selbst wenn es mir gelänge, mich durch die übereinander liegenden Berge aus toten, starren Körpern an die Oberfläche zu kämpfen, war ich keineswegs gerettet. Schon jetzt hatte ich die Erreger in mir, ja, ich meinte ihren Pesthauch geradezu zu spüren, wie sie in meinem erschöpften Körper ihre Arbeit begannen, effizient und erbarmungslos, wie die Natur es ihnen eingegeben hatte. Und so wurde mir immer klarer, dass ich verloren war.
Angstschweiß trat mir ins Gesicht, Hunderte Tröpfchen perlten auf meiner Stirn. Alles, was ich jemals über diese furchterregende Seuche gehört hatte, stand wie im Zeitraffer vor meinen Augen. Gestalten mit Schnabelmasken bewegten sich zwischen den Toten, räuchernd und sich zu ihnen hinabbeugend in einem aussichtslosen Kampf. Die Toten wiederum drehten sich im wilden Tanz, irre, schamlos, und in ihrer Mitte der Meister persönlich, der Gevatter Tod, sein Knochengesicht zu einer grinsenden Maske verzerrt, allwissend, allmächtig. Er winkte mir zu, kam heran und flüsterte: „Komm’ her Geselle, tanze mit uns, du gehörst nun dazu.“ Er kam noch näher heran, legte seine kalte Knochenhand auf meinen Arm und zog mich in den Kreis der Totentänzer.
Da erwachte ich. Oder sollte ich besser sagen, ich befand mich nun in einem undefinierten Dämmerzustand, in der Schwebe zwischen Wirklichkeit und Traum? Jeder Mensch kennt diesen Zustand, die Traumwelten haben einen noch nicht vollständig losgelassen, sodass das wirkliche Leben nur zögernd von uns Besitz ergreift. Man könnte in solchen Augenblicken nicht mit Sicherheit sagen, was Traum ist und was Wirklichkeit, denn alles, was zum eigenen Leben gehört, alle Gewissheiten und Gefühle, mit denen man am Vortag eingeschlafen ist, gelangen erst nach und nach wieder ins Bewusstsein.
In einem solchen Dämmerzustand ist es sehr wichtig, womit einen die Realität empfängt. Sind es Signale, die wir mit positiven Inhalten verbinden, oder solche, die negative Empfindungen hervorrufen. Es herrschte zwar wieder völlige Dunkelheit, wie in meinem Traumgrab, wieder war die Luft stickig und ich atmete schwer. Doch ich war immerhin nicht lebendig begraben, sondern hörte ………………… Bach. Musik für Solovioline, eine der dreißig Variationen aus der Partita in d-moll, wie ich von meinem Leidensgenossen, dem lieben, aber leider etwas verrückten Augustin wusste.
Doch die genaue Bezeichnung der Musik war mir gleichgültig, denn sie war mir ohnehin zur Lieblingsmusik geworden, nicht nur deshalb, weil sie für mich eine wesentliche Verbindung zur Außenwelt darstellte, nein, sie war überhaupt nicht von dieser Welt, weder von der feindlichen dort draußen, noch von unserer hier unten. Sie schien direkt vom Himmel zu kommen. Jedenfalls kam es mir so vor, denn in den Augenblicken, wo ich sie hörte, konnte ich die Welt um mich herum vergessen, und das war viel in einer Zeit, in der unser Leben ständig in Gefahr war und nur das zeitweilige Vergessen einen vor dem Verrücktwerden bewahren konnte.
Nie habe ich so intensiv wie in jenen Tagen empfunden, dass Sebastian Bach dem Ursprung der Musik näher war als jeder andere Mensch, und seit dieser Zeit ist jede Musik für mich mit seiner auf eine unerklärliche Art verbunden. Ich jedenfalls konnte vollständig in ihr aufgehen. Und so ging es mir auch jetzt, kurz nach dem Erwachen. Der böse Traum hatte sich in der Unendlichkeit dieser Musik aufgelöst, und seine Bedrohlichkeit war einem angenehmen Gefühl des Geborgenseins gewichen, das durch die regelmäßigen Atemzüge des armen Augustin neben mir noch verstärkt wurde.
Alles schien gut, wenigstens für diesen Augenblick. Doch als ich noch diese beruhigenden Gedanken hatte und mich ganz von der Musik treiben ließ, brach sie so plötzlich, wie sie eingesetzt hatte, ab. Und als ob es nicht schon gereicht hätte, aus meinem schönen Musiktraum gerissen worden zu sein, geschah nun etwas, das ich nur allzu gut kannte: Ich war in einen neuen Albtraum geraten, der eine hatte den anderen abgelöst, nur dieser hier war ganz real, aus ihm konnte ich nicht erwachen.
Von einer Sekunde zur anderen befiel mich eine dieser gefürchteten Angst- und Panikattacken. Mein Herz begann zu rasen, und ich hatte das Gefühl, mein Hals sei zugeschnürt und ich würde keine Luft mehr bekommen. Alles erschien mir plötzlich verändert, die Dunkelheit war noch beklemmender als sonst und die Schritte waren plötzlich so laut, als ginge jemand neben mir auf und ab. Ja, diese Schritte über mir, diese verfluchten Schritte, sie waren die Ursache für meine Attacken, das wusste ich nur allzu genau.
Schritte, werden Sie sagen, was sind denn schon Schritte. Zu jedem Menschen gehören Schritte, einer geht wie der andere, was ist schon dabei. Doch glauben Sie mir, Sie täuschen sich gewiss. Kein Schritt eines Menschen gleicht dem eines anderen. Und ich wette mit Ihnen, dass die Schrittfolge eines beliebigen Menschen geradezu einzigartig ist und Sie seine Schritte aus Tausenden anderen Schritten heraushören.
Schritte können einen schon in den Wahnsinn treiben, insbesondere solche von Menschen, die Stiefel tragen und feste Gewohnheiten haben wie der Bewohner der Räume über unserem Versteck. Die Schritte begannen an einer beliebigen Stelle des Zimmers, immer in der gewohnten Art, immer der gleiche wippende Schritt, der harte Klang der Absätze, der zeitliche Abstand des Aufsetzens. Und sie endeten stets an einer markanten Stelle des Raumes, direkt über unserer Schlafstelle. Hier verharrten sie für eine kleine Weile, immer die gleiche Zeit, man konnte den Sekundenzeiger einer Taschenuhr danach stellen. Wenn man den Atem anhielt, war es ganz ruhig, kein Laut war zu hören, so, als hätte es diese Schritte nie gegeben.
Doch plötzlich, nach einem bestimmten Schema, setzten die Schritte wieder ein und entfernten sich von der besagten Stelle, um nach kurzer Zeit, genau in der gleichen Weise, wieder zu ihr zurückzukehren, wiederum zu verharren und sich dann zu entfernen. Die Prozedur wiederholte sich Dutzende Male, bis der Spuk plötzlich vorüber war und wieder die Musik einsetzte oder aber vollkommene, unheilverkündende Stille eintrat.
Nun können solche Schritte an sich natürlich harmlos sein. Viele Dinge sind unter bestimmten Umständen harmlos, unter anderen hingegen gewinnen sie an Dynamik und können zu einer Gefahr werden, mitunter sogar zu einer tödlichen. So war es in unserem Fall. Der verrückte Augustin und ich hatten uns vor der Gestapo versteckt, irgendwo in der Millionenstadt Prag des Jahres 1942, denn die deutsche Besatzungsmacht hatte etwas gegen Geisteskranke und Juden. Und als ob das noch nicht gereicht hätte, wollte es der Zufall, dass die Wohnung über unserem Kellerversteck von der SS konfisziert wurde und vor kurzem dort ein strammer Standartenführer eingezogen war und es sich behaglich machte. Somit saßen wir in der Falle, denn ein Verlassen unseres Verstecks war natürlich viel zu gefährlich.
Doch auch das reichte unserem Schicksal noch nicht, denn genau die Stelle über unseren Köpfen, wo die Schritte immer innehielten, war ein tödlicher Punkt. Dort befand sich nämlich ein geheimer Einstieg in unser Kellerverlies, zwar in aller Eile noch gut getarnt durch einen Teppich, worauf eine Kommode stand, doch zu allem Unglück arbeitete der SS- Standartenführer für den berüchtigten Sicherheitsdienst der SS im Reichssicherheitshauptamt, und der war dafür bekannt, hinter alle Geheimnisse zu kommen, jedenfalls hinter die meisten, es war alles nur eine Frage der Zeit.
All diese Zufälle ergaben ein tödliches Gemisch, das zu jeder Zeit explodieren konnte. Und so werden wir weiterhin die Luft anhalten, wenn die Schritte genau über unseren Köpfen verharren, wir werden jedes Mal aufs Neue zittern und nach Luft ringen, und wenn die Schritte sich dann wieder entfernen dieses unglaubliche Gefühl der Erleichterung spüren, Sekunden nur, unbeschreibliche Sekunden, geschenkte Zeit, bis die Schritte sich wieder nähern, unerbittlich verstummen und über uns stehen bleiben, unendlich lange Zeit, und alles von vorn beginnt.
Wir sind unserem Schicksal auf Gedeih und Verderb ausgeliefert, und das Schicksal heißt, dem jungen, bösen Todesgott dort oben zu gehören, der solche himmlische Musik auf seiner Geige spielt, obwohl er doch ein Teufel ist, der seinen Daumen nur zu senken braucht und der nur ein Urteil kennt: den Tod, sofort oder später, etwas später. Wenn, ja wenn er den geheimen Einstieg in unser Versteck entdeckt. Oder eben nicht, das ist unsere Chance, vielleicht zehn Prozent. Aber eine andere gibt es für uns nicht. Wir sind auf diese zehn Prozent angewiesen, unser beider Leben hängt an diesen zehn Prozent wie ein totes Insekt an einem hauchdünnen Spinnweben.
Doch die Zeit arbeitet gegen uns, jede quälend lange Sekunde zwischen zwei Stiefelschritten bringt uns einer Entdeckung unwiederbringlich näher, dem unsagbaren und undenkbaren Ende. Das Schicksal aber, meint mein Freund Augustin immer, schert sich nicht darum, ob es undenkbar ist oder nicht, es geht unbeirrt seinen Weg, jetzt und in alle Ewigkeit.
Ein und ein halbes Jahr früher: Am Tag des Einmarsches der Wehrmacht in Paris nimmt sich ein deutscher Emigrant im Hotel Trianon in der Rue de Vaugirard das Leben. In seinem Nachlass befinden sich brisante Papiere, die das Dritte Reich verändern könnten, denn sie gewähren einen einzigartigen Einblick in die Psyche Adolf Hitlers, des Führers und Reichskanzlers des Deutschen Reiches und mächtigsten Mannes Europas. Die Jagd auf das Staatsgeheimnis Nummer eins beginnt. SS- Gruppenführer Reinhard Heydrich, der Chef des Berliner Reichssicherheitshauptamtes, schickt einen seiner besten Agenten in die französische Hauptstadt.
Der jüdische Junge in seinem Versteck in Prag und der Agent des deutschen Sicherheitsdienstes – noch ahnen sie nicht, dass ihre Leben auf schicksalhafte Weise miteinander verknüpft sind. Beide haben ihre Träume und kämpfen ihren Kampf, doch jeder auf einer anderen Seite der Front.
1
Dies ist eine Geschichte von Menschen und ihrer Verführbarkeit und inneren Größe, von Menschen voller Eitelkeit und Gier nach Macht, Lust und ihrem kleinen Glück, geschlagen mit Blindheit und getrieben von verzweifelter Hoffnung. Und doch ist es keine alltägliche Geschichte, denn jede Geschichte ist einmalig wie auch jeder Mensch einzigartig ist.
Böiger Wind peitschte feine Regentropfen durch die Grachten von Amsterdam. Der alte Mann hatte Mühe, sich vor der Nässe zu schützen. Den Mantelkragen hochgeschlagen, den Hut tief in der Stirn kämpfte er sich schwer atmend voran, scheinbar ohne Ziel, immer nur vorwärts. Für nichts hatte er Augen, nicht für die wenigen Passanten, die wichtige Erledigungen aus ihren warmen Wohnstuben getrieben hatten, nicht für die bizarren Wolkenfetzen am Himmel, die der Wind vor sich her trieb, und auch nicht für die ersten Lichter, die den Spätnachmittag ankündigten.
Der alte Mann war aufgewühlt, denn er hatte gestern eine Postsendung erhalten, die seine Vergangenheit jäh wieder aufleben ließ. Immer und immer wieder stand ein Bild vor seinen Augen, das er einst irgendwo gesehen hatte. Kein anderes war so voller Spannung gewesen wie dieses, einer Spannung zwischen zwei extremen Polen, nämlich abgrundtiefer Bösartigkeit und völliger, blinder Vertrauensseligkeit. Ein Kardinal in rotem Gewand sitzt in weltfremder, ja geradezu schmerzhaft anmutender Ahnungslosigkeit in einem Sessel, während hinter ihm sein Mörder mit hassverzerrtem Gesicht schon die Hand mit dem Dolch erhoben hat. Der Betrachter erwartet jeden Moment den tödlichen Stoß. Wenn es ein Bild gab, das seine damalige Situation in ihrer ganzen Dramatik erfasste, dann war es dieses.
Doch durch die Post hatte sich plötzlich alles verändert, denn alles war anders, als er bisher dachte. Damals, während des Krieges, hatte er sich als Jude vor der Gestapo verstecken müssen, um der Deportation in ein Konzentrationslager zu entgehen. Die alten Bilder standen wieder vor seinen Augen: das dunkle, feuchte Kellerverlies, sein Leidensgefährte, der verrückte Augustin, sein geliebter Schutzengel Libena, der beide unter Lebensgefahr versorgt hatte, dann der geheimnisvolle Unbekannte, der ihm letztlich die Flucht ermöglichte, und die quälende Ungewissheit über das Schicksal seiner Freunde aus dieser Zeit, die ihn ein Leben lang verfolgte.
Bis gestern, als er dieses Tagebuch las, von dessen Existenz er nichts gewusst hatte. Erst jetzt fügte sich alles zu einem Ganzen, das aber ganz anders war als das, woran er bisher glaubte. Die beiden Menschen, die er in seinem Leben am meisten geliebt hatte, waren tot, seit über 50 Jahren, hingerichtet nur wenige Minuten nach seiner Flucht. Und er hatte nichts geahnt, die ganzen Jahre nicht. Das machte ihm am meisten zu schaffen.
Und so ging das nun schon seit Stunden, der alte Mann irrte immer durch die gleichen Gassen, er sah nicht die Menschen, denen er begegnete, und spürte nicht den Regen auf seiner Haut. Doch plötzlich blieb er stehen. Er fröstelte und zog seinen Hut tiefer ins Gesicht. Dann ging er zielgerichtet auf den Eingang eines imposanten Gebäudes zu und verschwand in dessen Inneren. Es war das Rijksmuseum.
Er eilte durch die hohen, Respekt einflößenden Räume und blieb schließlich vor einem Bild Rembrandts stehen, das den Titel „Die Judenbraut“ trägt. Es zeigt das alttestamentarische Paar Isaak und Rebecca auf der Flucht. Lange Zeit stand der alte Mann mit dem markanten Gesicht unter silbergrauem Haar, den grauen Augen und buschigen Brauen, seinen Hut in der Hand, andächtig vor dem Bild, ganz versunken in das großartige Kunstwerk. Doch plötzlich schreckte er aus der Versenkung, denn ein Mann mittleren Alters hatte sich zu ihm gesellt und betrachtete das Bild ebenfalls aufmerksam. Nach einiger Zeit des Schweigens wandte er sich an seinen Nachbarn.
„Das Bild ist einzigartig, nicht wahr? Diese Farben: feuerrot und sonnengelb, beleuchtet von einem aus der Höhe herabfallenden Strahl, und über allem weht ein Hauch von Bronze. Dieses Bild sagt Dinge, für die es einfach keine Worte gibt.“
„Man muss schon mehrmals gestorben sein, um so zu malen“, erwiderte der alte Mann.
„Wieder ein Zitat. Van Gogh. Es gibt wirklich nichts, was nicht schon einmal gedacht oder gesagt wurde. Darf ich fragen, ob Sie ein Rembrandt- Spezialist sind?“
Der alte Mann lachte. „Ich bin Schriftsteller, mich interessiert Rembrandt so wie mich Bach und Mozart interessieren.“
„Für einen Laien wissen Sie aber gut Bescheid. Ich unterhalte mich, ehrlich gesagt, lieber mit klugen Laien als mit dummen Kollegen, die sich einbilden, schon alles zu wissen.“
Der Fremde lächelte hintergründig, ein offenes, sympathisches Lächeln, wie der alte Mann fand. „Übrigens, ich heiße Graf, Matthias Graf, Kunsthistoriker aus Bremen. Und ich freue mich immer, wenn ich irgendwo auf der Welt einen Landsmann treffe.“
„Simon Stein“, stellte sich der alte Mann seinerseits vor. „Ich lebe in New York, wenn ich nicht gerade auf Reisen bin.“
„Was führt Sie denn ins alte Europa? Lassen Sie mich raten: Sie sehen sich jetzt Rembrandt in Holland an, um dann nach Wien zu fahren und sich Mozart und Beethoven anzuhören. Recht so, Künstler muss man dort erleben, wo sie gewirkt haben.“
Stein lachte. „Keine schlechte Idee, aber eigentlich bin ich aus einem anderen Grunde hier. Ich habe mich meiner Vergangenheit gestellt.“ Er machte eine kleine Pause und betrachtete sein Gegenüber eingehend, so als prüfe er dessen Eignung, Zeuge seines inneren Kampfes zu werden, dieses überaus intimen Ringens um seine Identität. Der offene Blick des Kunsthistorikers ermunterte ihn, und die überbordende Fülle an widerstrebenden Gefühlen in seinem Inneren zwang ihn geradezu weiterzureden. „Ich bin vor meiner eigenen Vergangenheit geflohen. Wie Ahavser. Sie kennen Ahavser?“
„Sie meinen den legendären Juden, der zu ewiger Wanderschaft verurteilt war, weil er Jesus von Nazareth auf dessen letzten Weg nach Golgatha Rast und Erfrischung verweigert hatte?“
„Ja, er ist die Symbolfigur für das jüdische Schicksal, eine Legende nur, doch manchmal sind Legenden sehr lebendig, sie treiben uns um.“ Stein überlegte einen Augenblick. „Aber vielleicht kann man Legenden ja auch umdeuten, um ihnen ihre große Brisanz zu nehmen. Vielleicht war meine Flucht vor der Vergangenheit nicht nur der unbewusste Versuch einer Verdrängung, sondern ein Ausdruck des menschlichen Bedürfnisses nach Veränderung.“
„Einer Veränderung zum Guten?“
„Vielleicht.“ Stein räusperte sich. „Ich bin Jude. Wenn Sie das nicht wissen, verstehen Sie meine Geschichte nicht. Heute ist es einfach, so etwas zu sagen, es kommt einem leicht über die Lippen. Aber es gab Zeiten, da konnte dieses Bekenntnis das Todesurteil bedeuten.“
„Sie meinen damals im Dritten Reich?“
Stein nickte, und wieder überwältigte ihn die Erinnerung, wie gestern beim Studium der neuen Dokumente. Er konnte seine Erregung kaum verbergen. „Ich hatte eine Vergangenheit, bis gestern. Jeder Mensch braucht eine Vergangenheit, doch plötzlich ist alles ganz anders. Können Sie sich vorstellen, wie mir zumute ist?“
Graf sah ihn verständnislos an, er konnte ihm nicht folgen.
„Wie sollten Sie auch, Sie kennen ja meine Geschichte nicht.“ Und mehr zu sich selbst fuhr Stein mit leiser Stimme fort. „Man darf nicht versuchen, die Dinge festzuhalten, die man verloren hat. Dann verliert man sie unwiederbringlich ein zweites Mal.“
„Aber wir haben doch die Erinnerung daran.“
Stein lächelte gequält. „Hat unsere Erinnerung wirklich noch etwas mit unserer wirklichen Vergangenheit zu tun? Glauben Sie das? Wir selbst verfälschen unsere eigene Erinnerung mit der Zeit immer mehr, weil wir zu eng mit ihr verbunden sind. Bei jemand anderem sind unsere Erinnerungen wahrscheinlich besser aufgehoben.“
„Nicht umsonst erzählen die Menschen gern Geschichten.“
„Ja, Geschichten erzählen. Sie haben Recht, ich möchte Geschichten erzählen, was soll ein Schriftsteller auch anderes tun? Ein unbestimmtes Gefühl in seinem Inneren drängt ihn dazu. Aber meine eigene Geschichte aufschreiben, das möchte ich nicht, ich bin zu eng mit ihr verbunden. Ich muss sie jemand anderem überlassen, das bin ich den Menschen schuldig, die darin eine Rolle spielen, und das verlangt auch die Wahrhaftigkeit.“
Es entstand eine Pause. Stein musterte seinen Gesprächspartner, er wirkte angespannt, so als überlege er etwas. Dann sagte er kurz entschlossen: „Ich mache Ihnen ein Angebot und überlasse Ihnen die Rechte an meiner Geschichte mit allen daraus entstehenden Honoraren. Das Buch wird sich gut verkaufen, Sie werden es nicht bereuen.“
„Und die Gegenleistung dafür? Sie werden sicher verzeihen, aber bei soviel Uneigennützigkeit werde ich misstrauisch.“
„Ich verlange nichts von Ihnen, außer dass Sie mir zuhören.“
Graf überlegte kurz. „Auch ich mache Ihnen einen Vorschlag. Hier in der Gegend gibt es ein Cafe“, wo man sich ungestört unterhalten kann. Auf dem Weg dorthin lasse ich mir Ihren Vorschlag durch den Kopf gehen. Sind Sie damit einverstanden?“
„Gut, ich bin sicher, Sie werden annehmen.“
Als sie das Museum verließen, hatte sich das Wetter etwas beruhigt. Die tief hängenden Wolken ließen nun größere Lücken frei, durch die der dunkelgraue Abendhimmel von Zeit zu Zeit durchschimmerte. Es regnete nicht mehr. Die Dämmerung hatte eingesetzt, und die Straßenlaternen mit ihrem gelben Licht warfen die ersten Schatten dieser Nacht.
Die beiden Männer gingen schweigend nebeneinander her. Beide hatten eine Entscheidung zu treffen: der eine, ob er den Fremden an seinem Schicksal teilhaben lässt, der andere, ob er das Angebot des alten Mannes annehmen sollte. Als sie das Cafe“ nach gut zehn Minuten erreicht hatten, war ihre Entscheidung gefallen. Der alte Mann wollte das Wagnis eingehen, einem wildfremden Menschen seine Lebensgeschichte anzuvertrauen. Er hatte Angst, dass sie ihm aus den Händen glitt, denn er konnte und wollte sie nicht allein tragen, dazu fehlte ihm die Kraft.
Stein betrat das Cafe“. Der Kunsthistoriker aus Bremen folgte ihm, er wusste nicht, was ihn in den nächsten Stunden erwartete. Doch das Angebot faszinierte ihn, er würde darauf eingehen. Das Cafe“ war nicht sehr groß, und obwohl es nur spärlich beleuchtet wurde, konnte man schon beim Betreten einige separate Bereiche erkennen, was Stein sehr entgegenkam. Sie fanden einen Zweiertisch am Fenster, aus dem man auf eine Seitengasse blickte.
„Sie nehmen ein Bier?“, wandte sich Stein an sein Gegenüber.
„Nein, ich bevorzuge Kaffee, denn ich vermute, der Abend könnte noch sehr lang werden.“
„Ihre Befürchtung ist durchaus berechtigt, ich werde aber alles in meinen Kräften Stehende tun, mich kurz zu fassen.“
Graf nickte aufmunternd. „Ich möchte Sie keinesfalls drängen, wir haben alle Zeit der Welt.“
Der alte Mann lächelte dankbar. „Ich glaube, Ihnen eine Erklärung schuldig zu sein. Sie haben sicher bemerkt, dass ich etwas verwirrt bin. Gestern erhielt ich nämlich eine Nachricht, die mein Leben auf den Kopf stellt. Ich weiß nun plötzlich Dinge, die ich mein ganzes Leben lang nicht gewusst habe, sehr wichtige Dinge, und das macht mich betroffen. Die beiden Menschen, denen ich mein Leben verdanke und die ich neben meinen Eltern am meisten geliebt habe, sind tot. Schon sehr lange, seit über fünfzig Jahren, und ich habe davon nichts gewusst.“
„Sie erfuhren das erst nach so langer Zeit?“
„Ich weiß es erst seit gestern. Nach dem Krieg versuchte ich, die schrecklichen Erlebnisse zu vergessen. Ich war jung, gerade neunzehn, und außerdem weit weg in Amerika. Später habe ich mich bemüht, Licht in das Dunkel meiner Vergangenheit zu bringen. Doch der Kalte Krieg machte den Versuch zunichte, die Behörden der Tschechei waren wenig kooperativ, und meine persönlichen Nachforschungen blieben erfolglos. Ich fuhr nach Prag und suchte nach dem Haus, in dem ich mich damals versteckt hatte, suchte nach Zeitzeugen, die das Geschehen hätten aufklären können. Doch alles war verändert, niemand konnte sich erinnern, denn ganz andere Leute wohnten jetzt dort. Was blieb, war die quälende Ungewissheit.“
„Wenn ich Sie richtig verstanden habe, änderte sich dieser Zustand erst vor kurzer Zeit.“
„Mit der Wende in den osteuropäischen Staaten und Russland. Einige Archive sind jetzt zugänglich.“
„Und das Ergebnis Ihrer Recherche erreichte Sie gestern.“
Stein nickte. „Ich hätte versuchen müssen, hartnäckiger zu sein und mich nicht mit dem Misserfolg zufrieden zu geben. Dass ich es die ganze Zeit nicht wusste, kann ich irgendwie verschmerzen, dass ich es aber nicht gefühlt habe, hier drinnen, das verzeihe ich mir nie.“ Der alte Mann schlug sich an die Brust und blickte Graf durchdringend an. „Und was noch schlimmer ist, ich fühle mich irgendwie schuldig, dass sie sterben mussten und ich überlebte. Ich hatte kein Recht zu leben.“
„Jeder hat ein Recht zu leben“, warf Graf ein.
„Vielleicht. Die Menschen suchen immer nach der Schuld, bei sich selbst oder bei anderen, dann fühlen sie sich besser.“
„Fühlt man sich nur dann gut, wenn man sich oder anderen eine Schuld zuweist, stimmt etwas nicht mit dem eigenen Selbstwertgefühl. Sagen wir besser, jeder hat eine Verantwortung, der er gerecht werden muss.“
Stein lächelte anerkennend. „Das ist ein wahrhaft salomonischer Satz. Denn Schuldzuweisungen können nämlich gefährlich werden. Damals waren die Juden an allem Schuld, Juden und Geisteskranke, Zigeuner und Bolschewisten, überhaupt alle „Untermenschen“. Und davon gab es viele. Zu diesen Andersgearteten zu gehören, war gefährlich im Reich der „Herrenmenschen“, man konnte leicht zur Seite geschafft werden, leicht zu einer Nummer im Lager werden, zu einer Nummer ohne menschlichen Inhalt.“
Stein hielt inne, seine Erinnerung hatte ihn endgültig eingeholt. „Ich wollte damals aber keine Nummer sein, das wusste ich sehr genau, obwohl ich mit meinen sechzehn Jahren noch nicht viel begriffen hatte. Aufgewachsen in einem wohlhabenden Elternhaus und weitgehend abgeschirmt von der Außenwelt, war ich ein verwöhntes, sehr empfindsames und verträumtes Einzelkind. Ich las Goethe, Hegel und Karl May, spielte leidlich Klavier, war ein ausgezeichneter Schachspieler und sah mit Begeisterung Schillers „Räuber“ im Theater, doch vom eigentlichen Leben wusste ich nicht viel.
Mein Vater, ein allseits gebildeter und geachteter Mann, der vom Leben sehr genaue Vorstellungen hatte, praktizierte als Arzt. Und meine Mutter war der gütige Typ, der sich der Autorität ihres Mannes klaglos unterwarf und überall den Ausgleich suchte. Alles in allem strahlte unser Heim ein Gefühl von Schutz und heimeliger Geborgenheit aus, was ich zur damaligen Zeit jedenfalls so empfand.
Bis dieses als so selbstverständlich empfundene Gleichgewicht durch die Machtergreifung der Nazis empfindlich gestört wurde. Nicht dass ich die Aufmärsche und das zackige Gehabe auf den Straßen als Siebenjähriger nicht mit einer gewissen Begeisterung aufgenommen hätte. Mein kindliches Gemüt wurde erst durch ein konkretes Ereignis auf den Boden der braunen Tatsachen zurückgeholt. Ich hatte bis dahin in der Schule keine Probleme mit meinen Kameraden gehabt. Wenn ich auch deutliche Züge eines Einzelgängers trug, so schloss ich mich doch nie völlig aus der Gemeinschaft aus und war allgemein akzeptiert. Insbesondere hatte ich bis zu diesem Zeitpunkt noch keine großen Ungerechtigkeiten und Gehässigkeiten erfahren.
Das sollte sich an diesem Tag allerdings mit einem Schlage ändern. Überall, ob an meinem Spind im Sportraum oder auf der Toilette, las ich das mit Kreide eilig dahingeschmierte Wort Jude, und als ich unseren Klassenraum betrat, empfing mich der lautstarke Chor einiger Schüler, darunter auch meine Freunde, der immerzu „Juden raus!“ skandierte. Obwohl ich mit meinen sieben Jahren die ganze Tragweite dieses Geschehens noch nicht erfasste, erschütterte mich doch vor allem die Tatsache, dass mir auch meine Freunde in den Rücken gefallen waren. Ich war maßlos enttäuscht und verunsichert. Mein Klassenlehrer, ein Studienrat der alten Schule, riet mir dazu, vorläufig nicht mehr zur Schule zu kommen.“
Stein machte eine kurze Pause. „Heute, nach so vielen Jahren, ist solch eine Geschichte leicht erzählt. Man muss sich aber nur einmal vorstellen, wie verheerend eine solche Demütigung auf das Gemüt eines Siebenjährigen gewirkt haben muss.“
„Das ist zweifellos ein elementares Ereignis, insbesondere für ein Kind, aber was sagte Ihr Vater dazu?“
„Mein Vater war empört und konnte die Welt nicht mehr verstehen. Er war Jahrgang 1902 und hatte deshalb im ersten Krieg noch nicht gedient. Doch er liebte sein Vaterland über alles, wie er immer wieder betonte, er war ganz selbstverständlich Teil dieses Landes und hatte nach seinem Selbstverständnis dort seine Pflicht zu erfüllen, wo er hingestellt war. Zwar missbilligte er die rüden Methoden der Nazis, die waren ihm immer zuwider gewesen. Was waren die neuen Machthaber mit ihrem lauten Geschrei schon gegen einen Planck, Einstein oder Robert Koch, hörte ich ihn oft sagen. Doch die braune Bewegung hatte nun einmal die Macht, und sie war die Autorität, der man sich aus vaterländischem Pflichtgefühl unterordnen musste. Es gäbe ja schließlich noch Gesetze. Trotz eindeutiger Anzeichen, die auch er bemerkt haben musste, äußerte er wiederholt die Ansicht, die Juden sollten einmal in den deutschen Ostgebieten angesiedelt werden, gut, aber ihnen werde dort schon nichts Schlimmes geschehen.
Doch seine Proteste gegen meine Ausgrenzung in der Schule bewirkten erwartungsgemäß nichts, er war ja selbst ein Ausgegrenzter. Im Gegenteil, nur wenige Tage später wurde ich Augenzeuge, wie ein Trupp bewaffneter SAMänner unsere Arztpraxis stürmte und meinem Vater erklärte, er dürfe vom nächsten Tage an als Nichtarier seine ärztliche Tätigkeit nicht mehr ausüben. Als er lautstark dagegen protestierte und sich zur Wehr setzte, wozu es schon einigen Mutes bedurfte, hängten sie ihm kurzerhand mit Gewalt ein Pappschild um den Hals, auf dem Jude stand.“
Stein fixierte sein Gegenüber mit grauen, wachen Augen. „Sie mögen diese Szene für ein Klischee halten, für eine dieser Einengungen: Die Nazis waren alle grobe, sadistische Schlägertypen.“
„Menschen können alle vorstellbaren Rollen einnehmen, manchmal sind Klischees eben auch nur die Wahrheit.“
„Ich habe es selbst erlebt. Dabei waren doch die meisten Anhänger der Nazis Menschen wie Sie und ich. Viele widerstrebende Seelen wohnen in des Menschen Brust, viele Dämonen liegen angekettet in der Tiefe der menschlichen Existenz und warten auf ein ganz bestimmtes Ereignis, das sie befreit und an die Oberfläche bringt.“
„Und dieses Ereignis war die braune Bewegung.“
„Sie sagen es. Ich werde jedenfalls dieses Bild meines Vaters nicht vergessen und meine Gefühle, die mich damals überfluteten. Ich wollte anschreien gegen dieses Unrecht, aufspringen und ihm zu Hilfe kommen. Doch ich war wie gelähmt, ich konnte ihn nicht beschützen. Diese Hilflosigkeit gegen Willkür und Ungerechtigkeit prägte sich mir ein, ich hatte geschwiegen, wo ich hätte helfen müssen.“
„Sie hätten ihm nicht helfen können.“
„Natürlich nicht, aber ich hätte es versuchen müssen. Diese Feigheit hat mich ein Leben lang verfolgt. “
Stein schwieg einen Augenblick. Es entwickelte sich mit diesen Erlebnissen aber, so glaube ich heute, ein gewisser Trotz und eine Aufsässigkeit heraus, die Ungerechtigkeiten jedes Mal bei mir auslösten und die sich bis heute erhalten haben. Je größer die Herausforderung, umso größer der Trotz.
Mein vorlautes Mundwerk und diese Aufsässigkeit waren es auch, die mich für eine Nacht in die Keller der Gestapo brachten, eine lange Nacht, die sich wie ein roter Faden durch mein ganzes Leben zog. Am nächsten Tag wurde ich mit der dringlichen Verwarnung entlassen, meine Zunge im Zaum zu halten und mir meiner Verpflichtung bewusst zu sein, in diesen Schicksalszeiten meine ganze Kraft für Führer und Vaterland einzusetzen. Ein zweites Mal würde es nicht so glimpflich ausgehen.“
„Zog Ihr Vater die Konsequenzen aus diesen Ereignissen, ich meine, hat er jemals an Auswanderung gedacht?“
„Er zog sich in seine wissenschaftlichen Studien zurück und sah weiterhin seinen natürlichen Platz in seinem Heimatland. Die Machthaber wechseln, pflegte er zu sagen, das Land aber bleibe. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob er im Stillen darüber nachgedacht hat, wir haben nie darüber gesprochen. Doch selbst wenn er eine Auswanderung erwogen hätte, eines Tages war es zu spät. Die Nazis erteilten für Juden keine Ausreisegenehmigungen mehr, sie verfolgten inzwischen ganz andere Pläne. Meine Eltern wurden eines Tages zu einem Sammelplatz befohlen, in Güterwagen verladen und landeten schließlich nach langer Irrfahrt in Auschwitz. Sie hatten keine Chance.“
„Haben sie überlebt?“
„Nein. Ich erfuhr es von Verwandten nach dem Krieg. Mich hatten sie schon im Winter 1941/42 bei Freunden in Prag untergebracht, zur Vorsicht, wie sie mir sagten. Eines Tages würden wir wieder vereint sein.“
„Als ob sie etwas geahnt hätten.“
„Vielleicht. Warum sie selbst blieben, werde ich wohl nie erfahren.“
Stein verstummte, sein Blick war nach innen gekehrt. Der Kunsthistoriker ahnte, dass er einen besonders wunden Punkt im Leben dieses alten Mannes berührt hatte. Jedes weitere Wort würde jetzt fehl am Platze sein, und so schwieg auch er.
„Man kommt nie darüber hinweg“, hörte er Steins belegte Stimme, „nie. Man arrangiert sich nur irgendwie. Aber auch das ist nicht selbstverständlich, ich kenne Leute, die sind damit nicht fertig geworden und durchgedreht, einfach durchgedreht. Man liest immer, da wurden so und so viele Juden ins Gas geschickt, so und so viele Zigeuner, so und so viele Russen. Doch das waren alles Menschen, aus Fleisch und Blut, die haben das mit richtigen Menschen gemacht. Mit Menschen.“
Grafs Blick wanderte zu seinem Gesprächspartner. Das Gesicht des greisen Schriftstellers schimmerte fahl, alles Leben war daraus gewichen. Doch plötzlich richtete er sich auf und wies mit der Hand auf die Tasse seines Gegenübers. „Ich rate Ihnen, noch einen Kaffee zu bestellen und vielleicht ein Stück Kuchen dazu, denn wir befinden uns erst am Anfang dieser etwas längeren Geschichte.“
Graf winkte dem Kellner und bestellte Kaffee und Weinbrand, Appetit auf Kuchen hatte er nicht.
„Seit meiner Ankunft in Prag war ich auf der Flucht. Man versteckte mich im Kellerverlies des Gartenhauses einer befreundeten Pfarrerfamilie, die wir schon lange kannten. Ich war gerade sechzehn geworden, und was mein Leben in den sieben Monaten meiner „Gefangenschaft“ wirklich prägte, wurde mir erst viel später, lange nach dem Krieg bewusst. Es war vor allem die Angst, die alles bestimmende Angst um das bisschen Leben, gerade weil man so jung war. Das ist angeboren, dagegen kann man nichts tun, auch wenn man sich noch so sehr abzulenken versucht.
Doch das war nicht einmal das Schlimmste. Das Schlimmste war die konkrete Angst vor der Quälerei in einem Lager oder in den Folterkellern der Gestapo. Diese Art von Angst würgte einen, paralysierte, sie lauerte allgegenwärtig im Hintergrund und konnte einen jederzeit überfallen. Die Angst hatte einen idealen Nährboden: drei mal vier Meter im Quadrat, dunkel, feucht und stickig; wenn wir ganz still waren, hörten wir die Ratten unter dem Gitter des Abflusses umherhuschen. Irgendwann roch alles nach Buchsbaum und Verwesung, man konnte sich nicht dagegen wehren.
Sechs Schritte in die eine, acht in die andere Richtung, hundertmal am Tag, oder in der Nacht, wir wussten es oft nicht genau. Eingesperrt! Da begreift man instinktiv, was das ist: Freiheit. Heutzutage wird viel darüber gesprochen, und jeder meint sie genau zu kennen. Doch die meisten sehen nur das, was sie sehen wollen, ihre eigene kleine Freiheit. Und so verkommt dieser Begriff immer mehr zu einer leeren Worthülse.“
„Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit, welche erhabenen Worte. Jedes kostbare Menschengut verkommt zur hohlen Phrase, wenn es gedankenlos verwendet wird“, warf Graf ein.
Steins Blick schweifte aus dem Fenster auf die nur schwach beleuchtete Gasse. Ein rauer Wind peitschte das Pflaster und verfing sich in den Baumkronen. „Damals in unserem Keller, da war die Freiheit lebendig, wenn auch nur als ihr Gegenteil, die Unfreiheit. Sie war ein Kind der Angst und Hoffnungslosigkeit und wir klammerten uns an sie wie zwei Ertrinkende an ein kostbares Stück Treibholz. Aber das alles wusste ich erst später. Damals, in meiner ersten Nacht im Keller, war ich zu erschöpft, um irgendeinen klaren Gedanken zu fassen. Außerdem fieberte ich. Von einer Minute zur anderen fiel ich in einen unruhigen Erschöpfungsschlaf. Als ich erwachte, flackerten Erinnerungen vor meinen Augen. Ich sah mich als kleinen Jungen im elterlichen Garten, ich sah meinen Lateinlehrer an seinem Katheder sitzen, erkannte das zynisch lächelnde Gesicht des Gestapobeamten in jener Nacht meines Arrests und schließlich meinen Vater mit dem Judenschild um den Hals. Es waren nur Minuten, aber mir erschien es wie eine Ewigkeit.
Dann kehrte die Wirklichkeit langsam zurück. Eine kalte Nässe kroch mich an und verstärkte meinen Schüttelfrost. Ich erinnerte mich nun allmählich an die letzten Tage meiner Flucht, sah mich mit meinem Fluchthelfer über die grüne Grenze zur Tschechei kriechen, völlig durchnässt und immer auf dem Sprung und in der Gefahr, einer deutschen Grenzkontrolle in die Hände zu fallen. Dann die Fahrt mit einem Lieferwagen nach Prag.
Und jetzt hier. Ich war in Sicherheit, das wusste ich, aber wo? Ich hielt meine Augen geschlossen, aus Angst davor, was ich vielleicht sehen würde, wenn ich sie öffnete. Und begann, meine Umgebung zu ertasten. Da waren eine Matratze, auf der ich lag, und eine Decke, die mich einhüllte. Mehr konnte ich mit geschlossenen Augen nicht erkunden. Es half nichts, ich musste die Augen öffnen, wenn ich wissen wollte, wo ich mich befand.
Mit erheblicher Anstrengung gelang es mir. Doch ich sah nichts, es herrschte völlige Dunkelheit um mich herum. Vorsichtig erhob ich mich und kroch, vom Fieber geschwächt, auf allen Vieren ins Dunkle. Der Boden war feucht und kalt. Da stieß ich gegen etwas Weiches und erschrak heftig. Ich kniete nieder und ertastete dieses Etwas, das da im Dunklen lag. Es war warm und weich. Als ich mich niederbeugte, hörte ich leise, aber regelmäßige Atemzüge: ein Mensch, etwas Warmes und Lebendiges in dieser kalten, toten Dunkelheit, die mich ankroch wie ein schuppiges Reptil.
Mit einem tiefen Seufzer der Erleichterung legte ich mich wieder auf mein Nachtlager. Ich war nicht allein, diese Entdeckung tat gut, unendlich gut in diesem unwirtlichen Dunkel. Der kurze Ausflug hatte mich völlig erschöpft, und ich fühlte, wie die Kräfte mich verließen. Ein gütiger Gott breitete den Mantel des Vergessens über mir aus. Das Letzte, was ich wahrnahm, bevor ich in einen unruhigen Schlaf fiel, war leise Geigenmusik. Ich konnte mir nicht erklären, woher diese Musik kam, aber sie war so lieblich und engelsgleich, dass sie nur direkt vom Himmel kommen konnte.“
2
Stein hatte die Augen geschlossen, als versuche er, sich die Musik von damals wieder ins Gedächtnis zu rufen. Sein Gesicht war vollkommen entspannt. „Das erste, was ich beim Erwachen wahrnahm, war das Geräusch der Ratten unten im Abfluss. Ein sehr charakteristisches Geräusch übrigens, das man aus allen Geräuschen heraushört, wie ich später noch feststellen sollte. Der Schlaf hatte mich etwas erfrischt, und ich fühlte mich besser als am Tag zuvor. Langsam öffnete ich die Augen; ein schwacher Schein trüben Lichts empfing mich, so dass ich nun die Umrisse meiner neuen Zuflucht, die am gestrigen Abend noch vollständig im Dunklen gelegen hatten, erkennen konnte.
Der Raum war nicht sehr groß und ziemlich niedrig. An der gegenüberliegenden Wand befand sich kurz unterhalb der Decke eine kleine Luke aus Milchglas, die nur spärliches Licht hereinließ. Sie stand halb offen, und so konnte ich die Ursache für das Dämmerlicht erkennen: Es war eine kleine Tanne, die direkt vor der Fensteröffnung stand. Im Gegensatz zum gestrigen Abend wehte nun ein schwacher Hauch frischer Winterluft durch den Raum. An der rechten Wand, direkt neben meinem Lager, verlief ein Heizungsrohr, das angenehme Wärme verströmte und für eine verschlagene Temperatur im Keller sorgte. Die Tür befand sich zur linken Hand. Auf die Türen muss man als erstes achten, dieser dringende Rat meines Fluchthelfers hatte sich mir besonders tief eingeprägt. Ob im Restaurant oder Museum, selbst in einer Kirche musste man sich immer in der Nähe der Ausgänge aufhalten, um bei Razzien von Polizei oder Gestapo rechtzeitig verschwinden zu können.
Nun wusste ich also, wohin es mich verschlagen hatte. Es war alles in allem kein gemütliches Asyl, aber es bot doch immerhin Schutz, dicke Steinwände trennten mich von der Welt dort oben, wo die Gefahr hinter jeder Ecke lauerte. Beruhigt und dankbar schloss ich wieder die Augen. Da hörte ich ein leises Gemurmel. Ich wandte meinen Kopf zu meinem Leidensgenossen, den ich inzwischen ganz vergessen hatte, und beobachtete ihn unter halb geschlossenen Augenlidern. Er saß in einer leicht gekrümmten Haltung auf seinem Nachtlager und wiegte den Oberkörper hin und her. Seine Lippen bewegten sich in einem fort, und ich spürte, dass er etwas mit sich auszumachen hatte, etwas, das wichtig für ihn war, und dass ich ihn jetzt nicht stören durfte.
Nach einer Weile formte sich das Gemurmel, von dem ich bisher kein einziges Wort verstanden hatte, zu einem Summen, ja, er summte ein Lied vor sich hin: „O du lieber Augustin, alles ist hin……Jeder Tag war sonst ein Fest, und was jetzt? Die Pest, die Pest. Nur ein großes Leichenfest, das ist der Rest. O du lieber Augustin, leg nur ins Grab dich hin, ach, du mein liebes Wien – alles ist hin……..“.
Genau an dieser Stelle, ich weiß es heute noch so genau wie damals, wurde ich von einem schweren Hustenanfall geschüttelt. Mein Bettnachbar blickte erstaunt auf und wandte mir sein Gesicht zu: fast kahler Sperberkopf, blaue Augen in tiefliegenden Höhlen, hervorstehende Wangenknochen, eine markante Nase, Dreitagebart, vielleicht um die fünfzig.
„Das hört sich aber gar nicht gut an, mein junger Freund.“ Er wiegte teils bedächtig, teils nachdenklich seinen Kopf. „Liegt hier nun neben mir, das Jüngelchen, und der alte Augustin merkt es nicht einmal. Hast du denn auch einen Namen?“
Mein Leidensgefährte hatte eine angenehme, dunkle Stimme, und seine Augen blitzten schelmisch. Er war ganz anders, als ich ihn mir noch am Vorabend im Dunklen vorgestellt hatte. Ich nannte ihm meinen Namen.





























