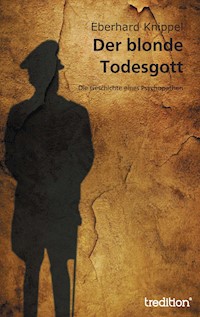3,90 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Rätselhafte Dinge geschehen in der Umgebung von Florenz. Menschen verschwinden spurlos und werden wenig später in seltsamen Körperhaltungen tot aufgefunden: immer paarweise, ein Mann und eine Frau, und genau fünf Tage nach ihrer Entführung. Haben diese grauenhaften Morde mit dem unerklärlichen Verschwinden der Rossi-Akten aus der Polizeistation in G. zu tun, jenen geheimnisvollen Dokumenten, die Auskunft über die Zusammensetzung einer legendären Gewürzmischung geben, welche die Welt schon einmal an den Rand des Abgrunds brachte? Ist das Wissen um die erotisierende Wirkung der Gewürze nun in der Hand eines unberechenbaren Psychopathen, der Macht über die Menschen erlangen will, genau so wie schon vor hundertfünfzig Jahren das Gewürzgenie Cesare Rossi? Die Legende besagt: Von Geburt an verunstaltet, wurde der zum Gespött seiner Umgebung und zog sich verbittert in seine eigene Welt zurück. Schon bald reifte in ihm ein ebenso kühner wie teuflischer Plan, sich an seinen Mitmenschen zu rächen; auf einer Reise nach Indien entdeckt er die magische Kraft der Gewürze - und plötzlich geschieht Seltsames, das niemand erklären kann: Das erotische Verlangen der Menschen steigert sich ins Unermessliche, ja geradezu Groteske und macht sie zu hemmungslosen, manipulierbaren Erotomanen. Und eine der unglaublichsten Begebenheiten, von denen je berichtet wurde, nimmt ihren Lauf. Als es endlich gelingt, den Fluch dieser Legende zu brechen und den Serienmörder zur Strecke zu bringen, atmen die Menschen auf. Doch schon bald beginnt der Albtraum der Ritualmorde von vorn, und ein neuer Fluch legt sich über das Land: der Fluch der falschen Töne.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 700
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
www.tredition.de
Der Autor
Eberhard Knippel, geboren 1947 in Berlin, ist Naturwissenschaftler und arbeitete lange Zeit in der medizinischen Forschung. Nun hat er sich der schöngeistigen Literatur zugewendet. Aus seiner Feder stammen bereits die Romane Amina und Der blonde Todesgott sowie die Erzählung Der Tempel.
…denn mögen auch in gewisser Hinsicht und für leichtfertige Menschen die nicht existierenden Dinge leichter und verantwortungsloser durch Worte darzustellen sein als die seienden, so ist es doch für den frommen und gewissenhaften Geschichtsschreiber gerade umgekehrt: nichts entzieht sich der Darstellung durch Worte so sehr und nichts ist doch notwendiger, den Menschen vor Augen zu stellen, als gewisse Dinge, deren Existenz weder beweisbar noch wahrscheinlich ist, welche aber eben dadurch, dass fromme und gewissenhafte Menschen sie gewissermaßen als seiende Dinge behandeln, dem Sein und der Möglichkeit des Geborenwerdens um einen Schritt näher geführt werden.
ALBERTUS SECUNDUS
Aus dem Roman Das Glasperlenspiel von Hermann Hesse,
Suhrkamp, Frankfurt am Main 1958.
Eberhard Knippel
Der Fluch der bösen Gene
www.tredition.de
© 2015 Eberhard Knippel
Umschlaggestaltung: Bartlomiej Zalewski
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
ISBN 978-3-7323-3066-9 (Paperback)
ISBN 978-3-7323-3067-6 (Hardcover)
ISBN 978-3-7323-3068-3 (e-Book)
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Inhaltsverzeichnis
Erster Teil: Die Auferstehung
Zweiter Teil: Das Monster kehrt zurück
Dritter Teil: Der Fluch der falschen Töne
Vierter Teil: Der Gesang der Gewürze
Anhang: Weitere unglaubliche Geschichten
Alhambra
Der Fluch
Die Diva
Der Entschluss
Wien neunzehnhundertvierzehn
Der Solitär
PROLOG
Der Tod hat ein Gesicht: scharf geschnittene Züge, ein markantes Profil, kühn gebogene Nase und dunkle, fast schwarze Augen, in deren abgründiger Tiefe sich Dämonisches mit ungeheurer Willenskraft paart. Der Tod trägt eine weiße Mütze und versteht sich auf eine hohe Kunst. Er bereitet Speisen mit solcher Vollkommenheit, dass die Menschen, die sie genießen, einem unstillbaren erotischen Rausch ihrer Sinne verfallen, der sie vollständig willenlos macht. Der Tod hat einen Namen, er heißt Cesare Rossi. So wie der Sand im Stundenglas verrinnt die Lebenszeit, und Cesare Rossi, der Tod mit der weißen Mütze, bestimmt, wann die letzte Stunde schlägt.
Heute kennen ihn nur noch wenige Menschen, denn seine Kunst ist vergleichbar einer Seifenblase, einem zarten, durchsichtigen Traumgebilde, das sich in der Weite des Raumes auflöst, sobald man nach ihm greift. Es ist die hohe Kunst des kulinarischen Genusses, der ungewöhnlich feinen, übersinnlichen Wahrnehmung aller nur denkbaren, durch Gewürze verursachten Geschmacksvarianten, die dem normalen Sterblichen versagt bleibt. Und gerade dies ist das Teuflische an den Gewürzen: Sie sind scheinbar harmlos, Millionen Menschen nehmen sie täglich zu sich, und doch ruht in ihnen ein furchtbares erotisierendes Potential, das die Welt verändern wird, wenn es erst einmal geweckt ist.
Ich würde mein geheimes Wissen um dieses Geschehen niemals der Öffentlichkeit preisgeben, wenn ich nicht genau wüsste, dass sich irgendwo auf der Welt ein Irrer versteckt hält, der die Idee aufgegriffen hat und an der Wiederentdeckung dieses Potentials arbeitet, nämlich einer Gewürzmischung, die den Menschen vollkommen willenlos und somit manipulierbar macht. Woher ich das weiß, fragen Sie? Nun, schon damals, als das Gewürzmonster Cesare Rossi noch lebte, erkannten weitsichtige Beamte in der Polizeistation von G. die Brisanz dieses Falles. Sie hielten die Angelegenheit geheim und bewachten die Dokumente rund um die Uhr, vierundzwanzig Stunden lang, und dies geschieht bis zum heutigen Tage. Die Papiere werden nicht eine Sekunde aus den Augen gelassen, täglich um zehn Uhr vormittags genauestens kontrolliert, und trotzdem hatte ein Unbefugter Einblick in die Unterlagen. Eines Tages bemerkte nämlich ein Beamter, dass ein Blatt im Papierstapel verschoben war, um genau drei Millimeter. Ansonsten gab es keinerlei Spuren, alles war so wie sonst.
Ein genialer Coup, und gerade das beunruhigt mich, denn dieses Genie ist dem Geheimnis auf der Spur, das die Welt verändern wird, und eines Tages wird es die Gewürzmischung mit der optimalen erotisierenden Wirkung finden. Vielleicht kann meine Veröffentlichung dies verhindern, das ist meine Hoffnung. Eine andere gibt es nicht.
Erster Teil
Die Auferstehung
1
Es war eine ausgeklügelte Mechanik, präzise und zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk, ein verzweigtes System aus Seilen und Rollen, das sich Stockwerk um Stockwerk in die Tiefe schlängelte, bis es sich schließlich in der Finsternis verlor. Die Vorrichtung verband den geheimen Zugang zur Burgruine von G., der sich abseits der schon lange zugemauerten Haupteingänge hinter einer undurchdringlichen Hecke verbarg und deshalb längst in Vergessenheit geraten war, mit einem kleinen Glöckchen, das sich in einem der beiden noch bewohnten Räume des Gemäuers befand.
Das Glöckchen hatte einen sehr feinen, kristallklaren Klang, und man musste ein gutes Gehör haben, um den Ton überhaupt wahrzunehmen. Der Mann, der dort unten lebte, hatte ein gutes Gehör und das außerordentliche Gespür für eine drohende Gefahr dazu, vielleicht als Ausgleich für seine sonstigen Gebrechen: ein Lungenleiden, einen leichten Gehfehler und schwache Augen. Doch hören konnte er wie ein Luchs, und das war die wichtigste Eigenschaft in dieser schaurigen Unterwelt. Denn das Glöckchen schlug dank einer raffinierten Technik nur dann, wenn die Geheimtür im oberen Stockwerk der Ruine bewegt wurde, wenn also Gefahr drohte. Bisher hatte sich das Glöckchen noch nie bewegt, und der Eremit vier Meter unter der Erde hätte mit jedem um seinen Kopf gewettet, dass sich dies auch in Zukunft nicht ändern würde.
Wer die vergessene Geheimtür einst fand und die mechanische Vorrichtung erdachte, war genial. Vielleicht war er auch nur verrückt, jedenfalls stand eines fest: Wer diese Technik beherrschte, beherrschte auch das unterirdische Reich, das schon seit Jahrhunderten keines Menschen Fuß mehr betreten hatte. Hier unten blieb alles verborgen, hier gedieh all das, was für menschliche Augen nicht bestimmt war, was Ruhe und Abgeschiedenheit zum Reifen brauchte, ehe es in der Menschenwelt eingesetzt werden konnte. Hier unten blieb derjenige verborgen, der das Licht der Öffentlichkeit scheute, hier hatte er Zeit und konnte warten, bis sich die Wogen geglättet hatten und seine Untaten in Vergessenheit geraten waren. Ein idealer Platz für Genies, die die Welt zu verändern trachteten, aber gleichermaßen auch für Psychopathen, die ihre Wahnideen verwirklichen wollten. Hier hatten sie dafür alle Zeit der Welt, denn kein Einwohner von G. kam je auf den Gedanken, dass in diesem verfallenen Gemäuer ein Mensch hausen könnte.
Das Auffälligste an dem unterirdischen Gewölbe, das also, was man noch vor allem anderen wahrnahm, war der Geruch, ein scharfer, süßlicher, strenger und betäubender Geruch, der einem anfangs den Atem verschlug, der aber, nachdem man sich länger im Raum aufgehalten hatte, scheinbar an Intensität verlor und schließlich nur noch unterschwellig wahrgenommen wurde.
Ansonsten war alles ruhig hier unten, es herrschte eine bedrückende Grabesruhe. Nur zwei Geräusche unterbrachen die eisige Stille. Das erste Geräusch entstand jedes Mal beim Aufprall eines Tropfens auf der Wasseroberfläche eines zur Hälfte gefüllten Kruges, in so regelmäßigen Abständen, dass man den Sekundenzeiger einer Uhr danach stellen konnte. Das zweite war ein leises, aber regelmäßiges rasselndes Geräusch, wie es manchmal bei Lungenkranken zu beobachten ist.
Der Bewohner dieses unterirdischen Reiches saß im Schatten eines ölgetränkten, schwarzen Tuches, das von der Gewölbedecke herabhing, sodass nur die schemenhaften Umrisse seines Gesichts und des Körpers sichtbar waren. Das Schreibpult vor ihm war dagegen in einen grellen Lichtkegel getaucht, der von der einzigen Glühbirne an der Decke erzeugt wurde. Ab und zu beugte der Mann seinen Kopf tief über das Pult und betrachtete mit einem seltsamen Gerät, welches er vor den Augen trug und das halb Brille, halb Lupe war, ein Dokument.
Der Raum war niedrig, dafür aber sehr groß, sodass die äußeren Begrenzungen im Dämmerlicht verschwammen. Gegenüber dem Schreibpult befand sich ein grober Bretterverschlag, wie wir ihn von typischen Kellern in alten Bürgerhäusern kennen. Im Halbdunkel zur rechten Hand war eine Tür zu erkennen, die in einen weiteren bewohnten Raum zu führen schien. Ein Holztisch mit vier Stühlen und ein Doppelbett vervollständigten die spärliche Einrichtung. In einer Ecke des Raumes stand eine Art Altar. Auf einem eigens zu diesem Zweck gezimmerten Holzgerüst prangte das Portrait einer jungen Frau, das von einem Meer künstlicher, weißer Lilien eingerahmt war. Auf dem Boden stand eine Kerze, die Tag und Nacht brannte, soweit man hier unten überhaupt von einem Tag sprechen konnte.
Das auffallendste Möbelstück jedoch war ein Regal, das unmittelbar neben dem Schreibpult stand und auf dem in offenen Porzellanschalen, die mit kleinen Pappschildern sorgfältig beschriftet waren, die unterschiedlichsten exotischen Gewürze aufbewahrt wurden.
Der Mann am Schreibpult richtete sich plötzlich auf und setzte die Lupenbrille ab. Dann strich er sich eine Strähne seines wirren, dunkelblonden Haares aus der Stirn und rieb seine blauen Augen – große, unschuldige Kinderaugen, vielleicht das einzig Auffällige in diesem ansonsten glattrasierten, zeitlosen Gesicht. Einem Gesicht, das man im Alltag übersehen würde, an dem man auch beim zweiten Mal achtlos vorüberging und das man sich trotzdem nicht merkte, eines von jenen Alltagsgesichtern, die sich perfekt ihrer Umgebung anpassten und in der Masse untergingen, von dem man überzeugt war, dass man es zuvor noch nie gesehen hatte.
Sein Blick wanderte durch den Raum und blieb an dem Regal mit den Gewürzen hängen. Und obwohl er die Schilder mit den exakten Bezeichnungen mit seinen schwachen Augen aus dieser Entfernung nicht sehen konnte, kannte er sie doch alle auswendig. Sogar ihre Reihenfolge wusste er genau, sein photographisches Gedächtnis hatte sich alles eingeprägt: Oben links stand Halud, die Gelbwurz, mit ihrer knolligen Wurzel, welche die Form brauner Finger hatte, gefolgt von Muskat und Ingwer. Irgendwo in der Mitte, ja dort, in der dritten Schale von links, lauerte Chili, dieses feurige Gewürz, das erst den Geschmack in die Welt brachte und dessen zerstörerische Kräfte der Überlieferung nach so reinigend waren wie der Tanz des Gottes Shiva. Dem Chili folgten der orangegelbe Safran, der gelbbraune Zimt und der blumig würzige Koriander. Den Abschluss in der unteren rechten Ecke des Regals bildeten Kardamom, Nelken und der Bockshornklee mit seinen hornähnlichen Früchten. Das allerletzte Gewürz aber, das sich von allen anderen unterschied, war Asafötida, das unheilvolle und gefährliche, welches die Herzen versteinerte.
Der Mann schnupperte mit seiner empfindlichen Nase den betäubenden, scharf- süßlichen Geruch der Gewürze, der den ganzen Raum erfüllte, er sog ihn tief in seine Lungen, leckte sich genüsslich die Lippen und schmeckte ihren Geschmack auf seiner Zunge. Und wie er dies tat, sah er Bilder vor seinen Augen: Shiva erschien ihm und drehte sich im kosmischen Tanz, und um ihn herum zerfiel die Welt in Schutt und Schlamm. Der Feuergott Agni aber erschien in seinem Wagen, gezogen von vier roten Pferden. Von seinen Fingerspitzen tropfte heißer Chili.
Und der Mann horchte angestrengt in sich hinein. Er hörte dort eine feine Melodie, einen Gesang aus tausend Kehlen, den Gesang der Gewürze. Ja, er hörte ihn in der Tat, diesen Gesang, nur er konnte ihn überhaupt wahrnehmen, nur er allein. Denn er hörte ausgezeichnet, hörte wie ein Luchs, besser als jeder andere Mensch. Das war es, was er wirklich konnte. Was scherte ihn seine kaputte Lunge, was scherten ihn sein schleppender Gang und seine schwachen Augen. Er hatte soeben den Gesang der Gewürze gehört, sie waren ihm wohlgesonnen und standen auf seiner Seite, sie unterstützten seinen Plan. Sein Plan wird ihm gelingen, er wird die Menschen demütigen, wie sie ihn, den Krüppel, gedemütigt haben, und er wird sie beherrschen. Die Gewürze waren mit ihm, keiner konnte ihn jetzt noch aufhalten. Keiner.
Oh, wie hasste er die Menschen, die ihn verspotteten, solange er denken konnte, ihn, den hilflosen Krüppel, erbarmungslos und ohne Gnade. Er musste es ihnen heimzahlen, er musste sie beherrschen. Dieser Gedanke brannte in ihm und füllte ihn ganz aus. Sie sollten ihn nicht länger demütigen, und jetzt wusste er auch endlich wie. Seine Augen blitzten. Der Zufall hatte ihm das Geheimnis in die Hände gespielt, zufällig erfuhr er damals von der Geheimakte Rossi auf dem Polizeirevier in G., diesem hochexplosiven Papier, von dem Gewürzgenie vor einhundertfünfzig Jahren eigenhändig verfasst. Alles Wichtige über die Gewürze sollte darin stehen, vor allem aber die Zusammensetzung der Gewürzmischung, die ihm die ersehnte Macht über die Menschen gab und jenen legendären erotischen Rausch der Sinne erzeugte, der alle ihre Hemmungen vollständig aufhob und sie zu seinen Werkzeugen machte.
Das Gesicht des Mannes verzog sich zu einer starren, grinsenden Maske. Er dachte an den Polizeibeamten, der damals Nachtschicht hatte und den Tresor bewachte, wie er schon seit einhundertfünfzig Jahren bewacht wurde. Genial hatte er ihn außer Gefecht gesetzt, der Beamte war sanft entschlummert und konnte sich später an nichts mehr erinnern. Er schien sogar fest davon überzeugt zu sein, auf ganz natürliche Weise und nur für kurze Zeit eingenickt zu sein. Und er selbst hatte währenddessen genug Zeit gehabt, dem Schlafenden den Schlüssel zu entwenden, den Tresor zu öffnen und die entscheidende Seite mit der genauen Dosierung der Teufelsmischung zu studieren. Jede Zahl und jedes Komma, alle wichtigen Informationen waren nun in seinem Kopf gespeichert, für niemanden sichtbar und jederzeit von ihm abrufbar.
Nur einen winzigen Fehler hatte er sich geleistet, und darüber ärgerte er sich noch heute. Als er die Seite mit der Rezeptur in den Tresor zurücklegte, kontrollierte er ihre genaue Lage nicht noch ein zweites Mal, sodass sie um zwei oder drei Millimeter verschoben war. Dadurch war der Coup nicht mehr perfekt gewesen, so wie es geplant gewesen war, und die Polizei konnte zumindest vermuten, dass jemand Fremdes Einblick in die Akte gehabt hatte und sie für seine Zwecke nutzen konnte.
Egal, er verfügte nun über die Formel und brauchte nur noch die einzelnen Gewürze im richtigen Verhältnis unter die Speisen zu mischen, wie es der geniale Rossi schon damals getan hatte. Nur die Versuchspersonen fehlten ihm noch, an denen er die Wirkung der Mischung testen wollte, bevor er sie im großen Maßstab einsetzte. Er brauchte sie, wie die Wissenschaftler ihre Ratten brauchten. Bei diesem Gedanken erstarrten seine Gesichtszüge mit den unschuldigen blauen Kinderaugen wieder zu dieser grinsenden Maske, die seinem Gesicht jenen diabolisch- gnadenlosen Ausdruck verlieh, der dem Betrachter unwillkürlich das Blut in den Adern gefrieren ließ. Er musste jetzt in Ruhe darüber nachdenken, wie vorzugehen war, wie er an das Menschenmaterial kam, das er für seine Experimente benötigte.
In diesem Augenblick durchbrach ein langgezogener Ton die Stille des unterirdischen Gewölbes, ein Ton, der wie das Heulen eines hungrigen Wolfes klang. Jedem Uneingeweihten wäre dieser Ton durch Mark und Bein gefahren, dem Höhlenbewohner jedoch schien dieses Geräusch vertraut. Er stand ohne Hast auf und ging auf die Tür zu, die in den anderen bewohnten Raum führte. Beim Gehen zog er das rechte Bein leicht nach, was ein eigenartiges, schlurfendes Geräusch verursachte.
Er öffnete die Tür und betrat das Nebengelass. Dieser Raum war wesentlich kleiner als der Hauptraum und fast vollständig unmöbliert. Nur in der Ecke neben der Tür stand eine Holzkiste, die mit einem Deckel verschlossen war. Von der Decke hing eine einzelne Glühbirne, die den Raum in ein grelles Licht tauchte.
Das erste, was man an dem einzigen Bewohner dieses Raumes registrierte, war sein riesiger Kopf, ein Kopf, der im Vergleich zu seinem Körper zweifellos überproportioniert war. Das Wesen saß in einem karierten Ohrensessel, der sowohl zu ihm als auch zu seiner kargen Umgebung in einem seltsamen Kontrast stand. Sein faltenloses Gesicht war zeit- und geschlechtslos, weder männlich noch weiblich. Das einzig Auffällige darin waren das stark herabhängende rechte Augenlid, welches das Auge größtenteils verdeckte und dem Gesicht einen seltsam starren Ausdruck verlieh, und die Farbe der Augen: Sie waren von einem durchdringenden Blau. Ansonsten hatte das Gesicht den gelblich- wächsernen Ausdruck eines Menschen, der schon lange nicht mehr die Sonne gesehen hat. Der Körper steckte in einem viel zu großen schwarzen Anzug. Das Wesen saß reglos in seinem Sessel und schien den Besucher nicht zu registrieren.
In der Ecke hockte ein großes, schwarzes Tier mit einem massigen Kopf auf einem ebensolchen Körper, der ihm etwas Unheimliches und Bedrohliches verlieh, was durch das entblößte Gebiss und die herunterhängenden, als Lappen ausgebildeten Lefzen noch unterstrichen wurde. Das Tier kam seinem Herrn erwartungsvoll entgegen. Der tätschelte ihm das Fell, schlurfte zur Kiste neben der Tür und entnahm ihr ein mittelgroßes Stück Fleisch, das er dem Hund hinwarf. Der, offensichtlich ziemlich hungrig, machte sich leise knurrend über den Brocken her und hatte ihn in kurzer Zeit vollständig verschlungen. Treuherzig blickte er auf seinen Herrn und verlangte mehr.
Doch der blieb hart, er konnte keinen satten und trägen Hund brauchen, der für niemanden eine Gefahr darstellte. Am angriffslustigsten und gefährlichsten waren Hunde, die ständig Hunger hatten, nicht zu viel, nicht zu wenig. Auf das Maß kam es an. Der Hund hatte die Absicht seines Herrn verstanden und verzog sich in seine Ecke. Ja, das Tier war scharf, es konnte jederzeit zuschnappen, wenn er es wollte. Doch das reichte ihm nicht, er wollte mehr, das Tier musste Schrecken verbreiten, wenn es für seine Pläne taugen sollte, der Herzschlag musste einem stocken, wenn man es nur aus der Ferne sah. Es musste besonders in der Dunkelheit die Leute in Angst versetzen, und inwieweit ihm dies gelingen würde, wollte er jetzt begutachten.
Er streckte sich nach der Decke und schraubte die Glühbirne aus der Fassung. Das Licht erlosch, und im gleichen Augenblick leuchteten die Augen und Lefzen des Tieres in der Dunkelheit auf und verliehen ihm etwas erschreckend Geisterhaftes. Auf das Allerweltsgesicht mit den großen Kinderaugen legte sich ein zufriedener Zug. Die phosphoreszierende Emulsion war gut, sehr gut sogar. Sie leuchtete stark und unterstrich so die Gefährlichkeit des Tieres.
Der Mann stand noch einige Zeit still da und genoss den Anblick der Bestie. Dann schloss er sorgfältig die Tür, setzte sich wieder an das Schreibpult und fuhr mit der Lektüre fort. Doch mit der Ruhe war es nun vorbei, er konnte sich nicht mehr auf den Text konzentrieren. Unablässig überschwemmten ihn seine Gedanken und Phantasien, die abwegigen, gefährlichen, die er so liebte, nach denen er ganz verrückt war und die ihn so beherrschten, dass er sie bald in die Tat umsetzen musste.
2
Die toskanische Ortschaft G. liegt abseits der großen Verkehrsströme auf einer Anhöhe zwischen zwei Tälern. Sie ist von einer sanften Hügellandschaft umgeben, deren Gehöfte, Olivenhaine und Zypressenalleen sich so vollkommen zu einem Gesamtbild zusammenfügen, dass man meinen könnte, ein genialer Maler habe hier sein Gemälde nach den höchsten Ansprüchen der Ästhetik komponiert. Schon die Etrusker hatten den Hügel bewohnt, bis sie später von den Langobarden vertrieben wurden. Die mittelalterliche Stadtmauer mit ihren drei stattlichen Toren war noch gut erhalten und schützte mit ihren Wehrtürmen die aus grauer Vorzeit stammenden, eng aneinander gelehnten Häuser, die ihr Alter schon lange nicht mehr verleugnen konnten.
Das Zentrum des Städtchens bildete die geräumige Piazza del Popolo, die der Palazzo Comunale mit seinem schlanken Glockenturm und einige weitere Palazzi mit ihren einst prächtigen Loggien und Türmchen säumten. In ihrer Mitte plätscherte der reich verzierte Brunnen eines frühen venezianischen Meisters. Ein besonderes Schmuckstück des Stadtbildes war Santa Maria Assunta, eine romanische Kirche mit schönen Glasfenstern, die noch aus dem zwölften Jahrhundert stammte. Die Fresken im Inneren des Kirchenschiffes stellten die Lebensstationen des heiligen Hieronymus dar und wurden von Kennern und Besuchern wegen ihrer farbigen Lebendigkeit und ihres guten Zustandes geschätzt.
Neben der Kirche, an die alte, von üppigem Efeu umrankte Friedhofsmauer gelehnt und umsäumt von einer Reihe stattlicher, schwarzgrüner Zypressen, lag der schattige und verträumte Friedhof des Ortes. Er hatte in seiner viele hundert Jahre währenden Geschichte schon so manches Bemerkenswerte und Seltsame erlebt, darunter waren auch einige spektakuläre Ereignisse gewesen; doch keiner der Einwohner von G. hätte sich an diesem zwölften Juli 2008 vorstellen können, dass ein unmittelbar bevorstehendes Ereignis alles bisher Bekannte weit in den Schatten stellen sollte.
So beeindruckend die Piazza del Popolo mit ihren repräsentativen Palazzi und die Kirche Santa Maria Assunta auch waren, so wurde das Stadtbild doch vor allem von der mächtigen Burgruine geprägt, die sich im äußersten Nordosten an die Stadtmauer lehnte. Nach ihrer Zerstörung durch eine Belagerung im sechzehnten Jahrhundert war sie nicht wieder aufgebaut worden und fristete nun ihr freudloses Dasein als Nistplatz und Aufenthaltsort verschiedener einheimischer Vögel und Fledermäuse.
Zu ihren Füßen erstreckte sich ein Park mit uraltem Baumbestand und schon längst verwilderten Sträuchern und Hecken, der ein beliebter, weil verschwiegener Ort für Jungverliebte war. Gerade bei Vollmond oder wenn eilig dahinjagende Wolkenfetzen die bizarr aufragenden Reste des alten Gemäuers plötzlich freigaben und das Mondlicht sie in ein gespenstisches Licht tauchte, lief selbst aufgeklärten Besuchern ein Schauer über den Rücken und sie mussten unwillkürlich an all die Hexen und Ketzer denken, die hier einst im Namen der heiligen Inquisition ihre letzten Tage verbracht haben sollten. Einige Leute hatten auch schon hinter vorgehaltener Hand berichtet, dass an manchen Tagen ein schauriges Heulen zu hören gewesen sei, zwar leise und seltsam gedämpft, als käme es aus den untersten Tiefen des verfallenen Gemäuers, doch dafür umso geheimnisvoller. Ob daran ein Körnchen Wahrheit war oder es sich nur um das Phantasieprodukt nervenschwacher Zeitgenossen handelte, konnte nie geklärt werden.
Heute fristete die Bevölkerung von G. ein eher beschauliches und unaufgeregtes Dasein, denn wer wollte bestreiten, dass die Stadt in ihrer Geschichte schon weit bessere und bedeutungsvollere Tage gesehen hatte. Nach und nach fand man sich mit seiner Bedeutungslosigkeit ab, nur noch selten geschah etwas, das die Stadt in Aufregung versetzt hätte, und die einzige Abwechslung in das tägliche Einerlei brachten die wenigen Touristen, die über die Piazza del Popolo schlenderten oder im „Gallo Nero“ den von Signor Casoni persönlich servierten „Fagiano tartufato“ genossen, einen in der ganzen Gegend berühmten Fasan mit Trüffeln und Schinken.
Und so legte sich mit der Zeit ein Schleier der Erstarrung über die ganze Stadt, und jede Geschäftigkeit versank in einer unbarmherzigen Routine. Alles funktionierte irgendwie von selbst, nichts unterschied sich mehr voneinander, ja selbst die Menschen schienen austauschbar zu sein und fühlten sich so manches Mal in jenes absurde Theater versetzt, von dem die folgende Anekdote erzählt wird: Ein Schauspieler spielte einst über viele Jahre immer dieselbe Rolle, und so stand er fast jeden Abend auf der Bühne. Als man ihn schließlich in ein anderes Haus berief, fiel niemandem auf, dass die besagte Rolle nun von jemand anderem gespielt wurde. Es war geradezu so, als hätte der Mann niemals auf der Bühne dieses Theaters gestanden, ja als hätte er überhaupt nicht existiert.
Ähnlich ging es den Bewohnern von G.; seit Menschengedenken wurde die Post von Signor Bottone ausgetragen, das Bier im „Gallo Nero“ von Signor Casoni ausgeschenkt, frisches Obst und Gemüse von Signora Minarelli auf dem Wochenmarkt angeboten, die Apotheke in der Via di San Marco von Signor Terrani geführt, und im Kolonialwarenladen um die Ecke verkaufte seit Urzeiten Signora Spagnoli ihre Waren. Natürlich kannte sie jeder, diese unverwechselbaren Originale, doch jene, die sie von Zeit zu Zeit vertraten oder mit ihnen zusammenarbeiteten, kannte schon keiner mehr so genau. Sie gehörten zum ewigen Spiel, niemand achtete auf sie und keiner erinnerte sich ihrer. Sie waren Leute ohne Gesicht und ohne Eigenschaften.
Doch gerade darin liegt ein Problem. Wenn in einer solchen Postkartenidylle wie der Toskana, in diesem Paradies, von dem die Nordlandbewohner vermuten, hier könne gar nichts Böses geschehen, doch einmal etwas Böses passiert, dann fallen die bekannten und oft sympathischen Gesichter aus dem Raster der Verdächtigen heraus, weil man ihnen ein Verbrechen gar nicht zutraut. Befindet sich der Täter hingegen unter den Gesichtslosen, also den Menschen ohne Eigenschaften, erinnert man sich nicht an ihn. Und so brauchte es erst das besondere Gespür eines Kriminalbeamten und einen denkwürdigen Zufall, um Licht in das Dunkel des brutalen Verbrechens zu bringen, das die Bevölkerung von G. schon bald wie die Apokalypse des Johannes aus heiterem Himmel treffen sollte.
3
An der Küstenstraße nach Livorno, unweit der Ortschaft Castiglioncello, liegt an schroffem Hang eine Reihe malerischer Grundstücke, die einen einzigartigen Blick auf das Ligurische Meer bieten. Je nach Witterung schimmert die Wasseroberfläche strahlend blau oder smaragdgrün durch die üppigen Büsche herauf, und wenn die Sonne am Abend über dem Horizont steht, taucht sie die Landschaft in ein zartes Rot. Die Anziehungskraft dieser Idylle ist so groß, dass selbst Einwohner aus dem fernen Florenz an diesem Ort Ruhe und Entspannung von der Hektik des städtischen Treibens suchen.
Auf einem dieser Grundstücke stand das Sommerhaus der Familie Corena. Signor Corena war Chef der Kriminalpolizei in Florenz und als solcher ein weit über seine Fachkreise hinaus bekannter Mann. Die Nachbarn des Grundstücks in Castiglioncello schätzten vor allem die Ruhe, die das Ehepaar Corena ausstrahlte, und seine verbindliche Art. Der Kommissar war vor allem dafür bekannt, alte und besonders wertvolle Bücher und Drucke zu sammeln und sich in seiner Freizeit stundenlang in seine extra dafür eingerichtete Studierstube zurückzuziehen, um sich als Ausgleich für seine aufreibende berufliche Tätigkeit mit ihnen zu beschäftigen. Die Studierstube war für ihn ein sehr intimer Ort, wo er Stunden verbrachte und sich nur ungern stören ließ, kurz: Er gehörte zu jenen Menschen, die sich beschäftigen konnten und deshalb nur selten Schwierigkeiten machten.
An einem Samstag im Juni des Jahres 2008 beschäftigte ihn gerade ein wichtiger Fall in der Dienststelle in Florenz, sodass er seine Frau bat, mit den beiden Kindern schon ins Sommerhaus vorauszufahren, wohin er so bald wie möglich nachkommen wolle. So kam es, dass der fünfjährige Daniele und seine zwei Jahre jüngere Schwester Corinna schon bald nach ihrer Ankunft auf dem Grundstück umhertollten. Nichts entging dabei ihrer kindlichen Neugier und Aufmerksamkeit, und so hielt Daniele schon nach kurzer Zeit triumphierend ein kleines Päckchen in die Höhe, das er auf einem Baumstumpf in der Nähe der Terrasse gefunden hatte.
„Schau mal, was ich gefunden habe“, rief er aufgeregt und lief seiner Schwester entgegen. „Das gehe ich gleich der Mama zeigen“, fügte er mit kindlichem Ernst hinzu und lief mit seinem Fund ins Haus.
„Sieh Mama, was ich gefunden habe!“ Mit diesen Worten stürmte er in die Küche, wo Signora Corena in eine Illustrierte vertieft war. Verwundert schaute sie auf.
„Ein Päckchen. Wo hast du das denn her?“
„Es lag auf dem Baumstumpf neben der Terrasse.“
„Na, dann zeig mal her!“ Die Signora nahm das Päckchen entgegen und wog es in ihrer Hand. „Sehr schwer ist es nicht.“
Sie sah auf das Etikett mit der Anschrift. „Es ist für Papa bestimmt, das dürfen wir nicht öffnen.“
„Oh schade, vielleicht zeigt uns der Papa ja später, was drin ist.“
Schon bald wich die Neugier wieder dem kindlichen Spiel, und erst am Abend, als sich das schmiedeeiserne Gartentor wie von Geisterhand öffnete und Signor Corena mit seinem Wagen auf das Grundstück fuhr, kam ihnen das Päckchen wieder in den Sinn und sie stürmten ihrem Vater entgegen.
„Papa, Papa, ein Paket, wir haben ein Paket!“
Und noch bevor der Kommissar die Kinder wie üblich mit einem Kuss auf die Wange begrüßen konnte, zogen sie ihn schon ins Haus, wo das Päckchen auf dem Wohnzimmertisch lag. Signor Corena sah ein, dass er dessen allseits erwartete Öffnung nun nicht länger hinausschieben konnte, und so riss er das Packpapier auf und wickelte es aus. Es kam eine Pappschachtel zum Vorschein, die durch einen Deckel verschlossen war. Arglos hob er ihn hoch.
Doch kaum hatte er in die Schachtel hineingeblickt, hielt er schlagartig in seinen Bewegungen inne und starrte auf den Gegenstand im Inneren, ja er musste geradezu zwanghaft darauf starren. Die Signora und die beiden Kinder schauten ihn fragend an und traten einen Schritt näher. Doch auch ihnen erging es nicht anders als dem Kommissar, und nun starrten alle vier sekundenlang völlig reglos auf das unheimliche Ding vor ihnen, das auf einer weißen Papierserviette ausgebreitet lag.
Daniele war der erste, der aus seiner Starre erwachte. „Was ist das, Mama?“ Instinktiv kuschelte er sich enger an seine Mutter.
„Ein Auge, mein Kind, ein richtiges Auge.“
Sie schaute unsicher zu ihrem Mann hinüber, als könne sie es immer noch nicht glauben. Ein heimlicher Schauer durchlief ihren Körper.
Signor Corena hatte sich in der Zwischenzeit aus seiner Schockstarre gelöst. Noch immer schaute er auf die Erscheinung vor ihm.
„Ja, es ist ein richtiges Auge, ein anatomisches Präparat. Ich habe so etwas bisher auch nur auf Bildern gesehen, aber ich glaube, es ist ein Zyklopenauge.“
„Was für ein Auge?“ Daniele sah seinen Vater fragend an, dann musste er wieder auf das Auge blicken. „Warum starrt es uns so an?“
Und wirklich, das Auge schien tatsächlich zurückzustarren und die Familie Corena zu fixieren. Man wollte sogar meinen, es verfolge einen mit seinem Blick, wenn man einen Schritt zur Seite trat und seinen Standort wechselte. Es war ziemlich unheimlich.
„Das Zyklopenauge“, versuchte Signor Corena zu erklären, „ist eine Fehlbildung bei der Entwicklung des kindlichen Kopfes im Mutterleib. Beide Augäpfel sind miteinander verwachsen und liegen in nur einer Augenhöhle.“
„Eine traurige Laune der Natur“, bemerkte seine Frau. „Aber wer schickt uns so etwas, und was hat das zu bedeuten?“
„Ja, wer schickt so etwas?“ Der Kommissar machte ein nachdenkliches Gesicht. „Ich weiß es nicht und kann es mir auch noch nicht erklären. Darüber muss ich erst in Ruhe nachdenken.“
Mit diesen Worten ergriff er die Schachtel mit dem Zyklopenauge und verschwand schweigend in seiner Studierstube. Dort angekommen konnte er nicht umhin, an die furchtbaren, menschenfressenden Riesen mit nur einem Auge mitten auf der Stirn zu denken, die Zyklopen. Gedankenverloren entnahm er seiner Jackentasche eine kleine Lupe, die er immer bei sich trug, und betrachtete damit das Präparat eingehend. Es war zweifellos professionell hergestellt, wie er selbst als Laie erkennen konnte. Aber wo kam es her? Irgendwer muss es doch vermissen. Er studierte die Musterung auf dem Augapfel und entdeckte dort einige Besonderheiten, die in seinem Gedächtnis haften blieben. Behutsam legte er das Präparat auf den Tisch zurück und lehnte sich in seinen Stuhl zurück.
Sollte er auf dieses ungewöhnliche „Geschenk“ reagieren? Sofort entbrannte sein Jagdinstinkt, doch schon im nächsten Augenblick siegte sein Rationalismus. Noch war mit diesem seltsamen Auge keine Straftat verbunden, er hatte in der Tat Wichtigeres zu tun. Und schon stand sein Entschluss fest: Er würde abwarten, vielleicht war es wirklich nur ein makabrer Scherz, der sich als harmlos herausstellte. Wenn man auf alles Ungewöhnliche reagieren wollte, käme man gar nicht mehr zu seiner Arbeit.
Langsam stand der Kommissar auf, nahm die Pappschachtel mit dem Auge vom Schreibtisch und trat an eines der bis zur Decke reichenden Regale heran. Er entnahm ihm einige wertvolle Folianten und Drucke, stellte die Schachtel in die Lücke und wollte diese gerade wieder schließen, als ihm einfiel, dass er die Schachtel noch gar nicht eingehender untersucht hatte, weil seine Aufmerksamkeit vollständig von ihrem Inhalt in Anspruch genommen worden war. Schnell holte er das Behältnis wieder hervor, nahm das Zyklopenauge heraus und untersuchte den Schachtelboden. Und hier entdeckte er etwas, was ihm schlagartig bewusst machte, dass dieser makabre „Scherz“ in Wirklichkeit ein richtiger Fall war, den er nicht einfach negieren konnte. Er fand nämlich einen Zettel mit einer Botschaft darin, die ihn sofort in ihren Bann zog. Er strich das gefaltete Papier glatt und las.
„Sehr geehrter Signor Corena, ich erlaube mir, Ihnen als Kunstkenner ein Angebot zu unterbreiten. Bisher hat der Mensch die Kunst gemacht, sie entsprang seinem Geist, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Somit war sie von ihm getrennt. Ich aber liefere Ihnen die wahre Kunst, Menschenbilder-Kunstwerke, die mit dem Menschen verschmolzen, ja selbst Menschen sind. Damit ist der Mensch an sich zum Kunstwerk geworden: Der Mensch beherrscht nun den Menschen. Sie werden von mir hören!
Ein Menschenbeherrscher
P.S. Die seherischen Fähigkeiten dieses dritten Auges sollen Ihnen helfen, die vor Ihnen liegenden Fälle zu lösen. Viel Erfolg! Sie werden ihn brauchen.“
Der Kommissar legte das Papier nachdenklich auf den Schreibtisch. Nun hatte er unversehens einen neuen Fall. Noch war er rätselhaft, noch verstand er ihn nicht zu deuten. Doch er hatte ein ungutes Gefühl, wenn er daran dachte. Der Absender des Briefes war ihm unheimlich, wahrscheinlich musste er ihn ernst nehmen. Und er konnte im Kampf gegen diesen Verrückten, denn um einen solchen handelte es sich zweifellos, die Kraft und Stärke der einäugigen Zyklopen tatsächlich gebrauchen. Bei diesem Gedanken überflog ein Lächeln sein Gesicht. Er stand auf und versteckte die Schachtel mit dem Auge hinter den Folianten im Regal. Hier, an seinem intimsten Ort, wähnte er den Fund sicher.
4
Die dumpfen Bässe zerteilten den dämmrigen, durch farbige Lichteffekte gespenstisch beleuchteten Raum und verschmolzen mit der wogenden Masse der sich im Rhythmus der aufreizenden Klänge bewegenden menschlichen Körper. Das durchdringende Vibrieren war selbst noch hinter den geschlossenen Türen auf der Via Mannelli zu spüren.
Doch die Anwohner hatten sich schon längst an diese ausgelassenen, lärmigen Wochenenden gewöhnt, wenn die Jugend aus G. und den umliegenden Dörfern im „Dolce Vita“ die Nacht zum Tag machte. Die jungen Leute brauchten schließlich ihre Disko, das leuchtete auch dem übellaunigsten Bewohner ein, und nur wenige, besonders eigenwillige und unbelehrbare Zeitgenossen erregten sich an jedem Samstag aufs Neue über den ruhestörenden Lärm; doch das taten sie aus guten Gründen hinter vorgehaltener Hand, denn sie spürten in ihrem Inneren sehr wohl, dass die Natur hier nur ihr Recht einforderte. Bei diesem oder jenem mochte auch eine Spur von Neid mitschwingen, sei es, weil man selbst das jugendliche Alter längst überschritten hatte und solche Dinge für einen nicht mehr in Frage kamen, oder weil man sich in seinem Leben überhaupt vom Liebesglück vernachlässigt sah.
Wie dem auch sei, die jungen Leute im „Dolce Vita“ kümmerten solche Überlegungen wenig. Sie genossen in vollen Zügen das, was solche Veranstaltungen ihrem Publikum gemeinhin boten: ein hochexplosives Gemisch aus Rhythmus, Bewegung, menschlicher Nähe und Geborgenheit und ein unstillbares erotisches Verlangen. Die emotionale Erregung bei der gemeinsamen Bewegung, die erste zarte Berührung, der erste Kuss. Hier geschah das, woraus die Träume des Lebens gemacht waren und die Sehnsüchte und geheimen Wünsche. Die sich erfüllten oder im Rhythmus der wogenden Masse untergingen. Bis zum nächsten Wochenende. Neues Spiel, neues Glück, man hatte ja alle Zeit der Welt.
Erst war es nur ein kurzer, flüchtiger Blick gewesen, der ihre Aufmerksamkeit fesselte. Für wenige Augenblicke, dann war er im wogenden Chaos wieder verschwunden. Doch dieser Blick hatte sie seitdem nicht mehr losgelassen. War es die aufgeladene Atmosphäre, war es der Cocktail, an dem sie seit einer Stunde lustlos nippte, oder hatte dieser Blick etwas zu bedeuten? Lucia wusste es nicht, sie wusste nur eines: Sie musste diese Augen suchen; solche Augenblicke waren selten, sie hoben sich von allen anderen Augenblicken ab, den langweiligen, nichtssagenden, die einen im Inneren nicht anrührten, die nichts anders waren als Kulisse, nur potentielle Möglichkeit, dass etwas geschehen könnte.
Sie erhob sich und musterte die Schar der Tanzenden genauer. Irgendwo in dieser schwankenden Masse mussten sie sein, diese Augen, die sie vorhin fixiert hatten, für diesen einen kurzen Moment. Doch es war unmöglich, in dem ewigen Auf und Ab der verschlungenen Leiber etwas Bestimmtes zu erkennen, schon gar nicht, wenn man es bewusst suchte. Da spürte sie plötzlich etwas in ihrem Rücken. Es hatte sich etwas verändert, irgendetwas, das sie anging, das mit ihr zu tun hatte. Sie kannte dieses Gefühl, es war ihr siebter Sinn, wie sie es nannte, vielleicht ein Erbe aus ferner Vorzeit, das ihr ein gutmeinender Vorfahre mit auf den Weg gegeben hatte. Sie konnte sich dieses Gefühl nicht mit dem Verstand erklären, doch sie wusste, sie konnte sich darauf verlassen, denn es hatte sie noch nie getäuscht. Sie wollte sich schon umdrehen, doch in diesem Moment spürte sie eine Hand auf ihrem Arm, die sie unaufhaltsam in den Strudel der Tanzenden zog.
Und dann war sie mitten im Gewühl und Getümmel, ihm ganz nah, diesem Unbekannten mit den sprechenden Augen. Sie hing an seinem Blick, mehr wollte sie in diesem Augenblick auch nicht, nur diesen Blick und ein Gefühl von Nähe, dieses Urgefühl der Geborgenheit, nach der sich jeder Mensch sehnt. Noch war alles neu und unbestimmt, und sie wusste nicht, was daraus werden würde. War es eine gewöhnliche Niete, die sich in die endlose Reihe aller anderen Nieten einordnen würde, oder war es diesmal ein Treffer, ein Hauptgewinn gar? Das Leben war ein ewiges Spiel, und das war ein gutes Gefühl.
Bis jetzt hatte sie Distanz zu ihm gewahrt. Nur einmal hatte sie sich etwas enger an ihn geschmiegt, als der Rhythmus plötzlich langsamer wurde, langsam und irgendwie melancholisch. Eine unendliche Traurigkeit war über sie gekommen, wie eine geschmeidige Wildkatze hatte sie sie angefallen, eine Traurigkeit, die ganz von innen kam und gegen die sie sich nicht wehren konnte.
Es war ein Lied von Nick Cave gewesen, eines dieser melancholischen Lieder, bei denen man unwillkürlich schwach wurde. Alle melancholischen Typen mochten es, es war die Hymne der Melancholischen. Wenn man Nick Cave erst einmal gehört hatte, kam man nicht mehr von ihm los. Diese Art Musik war genial für Nachtstunden, wenn man sich ganz seinem Schmerz hingeben wollte.
„Just remember that death is not the end.”
Nick Cave und Kylie Minogue. Der Trost des Lebens schlechthin, in einem einzigen Satz. Einfach genial.
„When you’re sad and when you’re lonely
And you haven’t got a friend
Just remember that death is not the end…”
Der Text ging unter die Haut, er passte zur Musik und die Musik passte zu ihm, dem Unbekannten, zu seinen Augen, zu der ganzen Stimmung hier, zu diesem Abend. Doch wie alles, das irgendwie passte im Leben, war auch dieses Lied viel zu schnell zu Ende gegangen, und der Typ am Pult legte wieder den üblichen Hardrock auf.
Als Lucia ihrem Tanzpartner schließlich mit einer Geste zu verstehen gab, dass sie nun erst einmal genug getanzt hätten und eine Pause brauchten, ergriff er wiederum wortlos ihre Hand und zog sie durch das dichte Gedränge zum Ausgang. Auf der Straße empfing sie ungewohnte Stille. Und ein Anflug von Verlegenheit, denn nun standen sie sich plötzlich allein gegenüber. Nur vereinzelt gingen um diese Stunde noch Menschen vorüber. Es war eine laue Sommernacht, eine von jenen Nächten, die man nie mehr loslassen möchte, und das Mädchen war hübsch, verdammt niedlich mit seinem Muttermal am Hals, fand der junge Mann.
„Ich bin Piero“, stellte er sich vor.
„Lucia“, erwiderte sie.
Beide lächelten etwas verlegen.
„Wollen wir noch zusammen irgendwo hingehen?“, fragte Piero.
Sie nickte. Solche direkten Typen, die nicht immer um den heißen Brei herumredeten, gefielen ihr. Sie wollte jetzt noch nicht allein sein, vielleicht später, viel später.
„Vielleicht fahren wir noch in den Stadtpark an der Burgruine. Diese Gegend kenne ich gut, dort gehe ich jeden Morgen joggen.“
Und ohne ihre Zustimmung abzuwarten, machte er auf dem Absatz kehrt und schlenderte quer über die Straße, wo ein dunkelblauer Fiat unter einer ausladenden Kastanie abgestellt war. Lucia folgte ihm. Als Piero das Auto erreicht hatte, sagte er lachend.
„Darf ich vorstellen? Pinoccio, wir sind unzertrennlich, außer…..“, er machte eine kurze Pause und sah Lucia spitzbübisch an, „außer, wenn er mich im Stich lässt.“
Er kramte in seinen Hosentaschen, zog die Autoschlüssel hervor und öffnete die Beifahrertür.
„Darf ich bitten?“
Lucia ließ sich auf den Beifahrersitz fallen. Sie hatte keine Ahnung von Autos, aber dieses hier war schon alt, uralt, das merkte sogar sie. Doch sie mochte es trotzdem oder vielleicht gerade deshalb, sie wusste es nicht so genau. Jedenfalls passte es zu Piero und zu diesem Abend, wie die Musik von Nick Cave. Und als sie mit Pinoccio und Piero durch die nächtlichen Straßen von G. fuhr, kam ihr das so vor, als hätte sie ihr ganzes Leben nie etwas anderes getan.
Die Geschichte zieht ungerührt von unseren Wünschen und Hoffnungen ihre Bahn und fragt nicht nach Sinn und Gerechtigkeit. Was in früheren Tagen von großer Wichtigkeit war, verfällt mit der Zeit und versinkt schließlich in der Bedeutungslosigkeit. Anderes hingegen gewinnt an Gewicht und wird schließlich über die Landesgrenzen hinaus bekannt und berühmt. Und so hatte auch die Burg von G. eine wechselvolle Geschichte hinter sich. Von ihrer stattlichen Anhöhe aus kontrollierte sie einst die wichtigen Handelswege der Toskana und verhalf somit auch der Stadt zu einem gewissen Wohlstand.
Mit der Zeit verlor die Burg jedoch mehr und mehr an Bedeutung, und nachdem sie im Zuge einer Belagerung geschliffen und nicht wieder aufgebaut worden war, ragten die Ruinen über der Stadt empor und wurden zu ihrem Wahrzeichen. Und wenn ihr auch keine eigentliche Aufgabe mehr zukam, so hatte sie für die Einwohner von G. doch ihre Bedeutung nicht gänzlich verloren. Sie gehörte zur Stadt wie die Piazza del Popolo und der Turm der Kirche Santa Maria Assunta und war längst Teil der Identität ihrer Bewohner.
Und so war es zu einer guten Tradition geworden, dass sich die Liebespaare der Stadt im Stadtpark zu Füßen der Burgruine trafen, um so manches Schäferstündchen an diesem verschwiegenen Ort miteinander zu verbringen. Immer schwang dann auch etwas Geheimnisvolles und Unheimliches mit, insbesondere dann, wenn helles Mondlicht die Ruine in ein gespenstisches Licht tauchte, so als hätte der Maler Caspar David Friedrich seine Hand im Spiel gehabt, oder wenn ein Herbststurm um das Gemäuer fegte und seltsame Geräusche verursachte. Ab und zu hörte man dann die Stimme eines Käuzchens oder den Flügelschlag einer Fledermaus.
Manche meinten sogar, das Heulen eines Wolfes oder Hundes gehört zu haben, kurz: Es herrschte dort eine spezielle, knisternde Atmosphäre, welche die Phantasie der Besucher anregte und die Liebespaare noch enger zusammenrücken ließ. Wenngleich natürlich jedermann in unserem aufgeklärten Zeitalter wusste, dass es keine Gespenster gab und die unheimlichen Geräusche, die manchmal zu hören waren, eine natürliche Ursache haben mussten. Es gab aber trotzdem die stille Übereinkunft, der Ruine nicht allzu nahe zu kommen, sei es, weil in jedem Menschen noch ein Rest an Aberglauben steckt, der selbst mit dem schärfsten Verstand nicht zu unterdrücken ist, oder dass man eben diesem Verstand nicht restlos traute.
Die Ruine betreten konnte man ohnehin nicht mehr, seitdem die einzigen beiden Zugänge vor Jahren zugemauert worden waren. Selbst die ältesten Bewohner der Stadt konnten sich nicht erinnern, dass es jemals anders gewesen wäre. So hatte seit Menschengedenken keines Menschen Fuß mehr das geheimnisvolle Gemäuer betreten, und es würde aller Voraussicht nach auch bis ans Ende aller Tage so bleiben.
Als Lucia und Piero den Stadtpark an der Burgruine erreichten und aus dem Auto stiegen, stand der volle Mond unnatürlich hell und groß am nachtschwarzen Himmel. Alles war still, nur ab und zu hörte man das Knacken eines Zweiges. Sie blieben stehen und küssten sich, dann schlenderten sie eng umschlungen in den Park hinein. Ihre Schritte klangen auf dem Waldboden seltsam hohl.
Plötzlich wurde die Stille durch das leise, aber deutlich zu vernehmende Heulen eines Hundes unterbrochen, das aus der Tiefe der Burgruine zu kommen schien. Das Paar blieb stehen und lauschte. Lucia drückte die Hand ihres Begleiters fester, ihr war unheimlich zumute. Doch Piero lachte nur und beruhigte sie. Vor langer Zeit sei in der Burg eine Kindsmörderin mit ihrem Hund eingemauert worden, erzählte er ihr. Doch das sei natürlich alles nur ein Ammenmärchen, niemand geistere in Wirklichkeit hier herum, und die Geräusche, die sie eben gehört hätten, wären alle natürlicher Art. Und wie zur Bestätigung ihrer Harmlosigkeit nahm er ihren Kopf in beide Hände und küsste sie.
Lucia beruhigte sich langsam und schmiegte sich eng an ihren Freund, doch ganz geheuer war ihr nicht zumute. Dann setzten sie ihren Weg fort. Sie waren noch nicht weit gegangen, als sie vor sich auf dem Gehweg einen hellen Gegenstand schimmern sahen. Neugierig bückte sich Piero und hob ihn auf. Doch als er ihn näher betrachtete, erstarrten seine Gesichtszüge. Lucia sah ihn fragend an.
„Das ist eine meiner Socken, die ich immer morgens beim Joggen benutze. Ich habe sie schon heute früh zu Hause vermisst, als ich sie anziehen wollte.“
Er überlegte einen Augenblick.
„Aber wie kann das sein?“
„Du hast sie beim Laufen hier im Park verloren“, versuchte Lucia den Fund zu erklären.
„Das ist unmöglich, ich ziehe mich immer schon zu Hause um, bevor ich zum Laufen hierher fahre. Ich kann sie nicht im Park verloren haben.“
„Aber irgendwie muss sie ja hier hergekommen sein.“
„Ja schon, doch ich weiß nicht wie, ich finde keine Erklärung dafür.“
„Dann hat sie eben jemand gestohlen.“
„Gestohlen?“ Piero lachte laut auf. „Hier lebt irgendwo ein Mensch unter uns, der fremden Leuten die Socken stiehlt, gebrauchte noch dazu. Vielleicht ein Sockenfetischist? Das glaubst du doch selbst nicht.“
Sein Gesicht wurde wieder ernst.
„Nein, irgendetwas stimmt hier nicht.“
Während Piero noch über den seltsamen Fund nachdachte, zupfte ihn Lucia zaghaft am Ärmel.
„Komm, wir wollen umkehren und zum Auto zurückgehen. Ich habe Angst.“
In diesem Augenblick ertönte wieder das langgezogene Heulen eines Hundes, nur diesmal war es lauter und näher als beim ersten Mal und ganz deutlich zu vernehmen. Sie machten kehrt, beschleunigten ihre Schritte und hasteten den Weg zurück zum Parkplatz. In den nächsten Minuten geschah nichts Außergewöhnliches, es war nur das Geräusch ihrer Schritte auf dem Waldboden und ihre beschleunigte Atmung zu hören. Weit konnte es nicht mehr sein, in der Ferne sahen sie schon, wie sich die Bäume langsam lichteten.
Als sie links in einen Seitenweg einbogen, um den Rückweg abzukürzen, blieben sie plötzlich wie angewurzelt stehen. Vor ihnen auf dem Weg saß ein Hund. Man sah nur seinen Schatten und die groben Umrisse, denn das Mondlicht konnte das dichte Blätterdach der Bäume nicht vollständig durchdringen. Der Hund hatte im Vergleich zu seinem Körper einen massigen Kopf, und die Augenpartie und seine Lefzen leuchteten in der Dunkelheit in einem seltsam phosphoreszierenden Licht. Sein Maul war leicht geöffnet, und man konnte sein kräftiges Gebiss erahnen. Das Tier saß ruhig da, nur ein leises Knurren ließ auf seine Gefährlichkeit schließen.
Es waren nur wenige Sekunden, die Lucia und Piero ungläubig auf diese unwirkliche Erscheinung starrten, dann kam ihnen schlagartig die Erkenntnis: Dies hier war kein Gespenst, kein Spuk, es war nichts Unwirkliches, sondern etwas ganz Reales, nämlich ein gefährliches Tier. Und noch in dem Augenblick, wo diese Erkenntnis Lucia ins Bewusstsein drang, spürte sie, dass sich hinter ihr im Wald etwas verändert hatte. Der siebte Sinn, schoss es ihr durch den Kopf. Sie wollte sich umdrehen und Piero noch etwas sagen, doch es hatte sie eine Art Lähmung erfasst. Das Letzte, was sie bewusst wahrnahm, war ein Luftzug in ihrem Nacken und ein leises rasselndes Geräusch, das sie sich nicht erklären konnte. Dann versank alles in lautloser Dunkelheit.
5
Wenn sich der Abend langsam über die Stadt senkt, füllt sich der Gastraum der Taverne „Gallo Nero“ an der Piazza del Popolo mit seiner Kundschaft: Angestellten aus den umliegenden Büros, Künstlern, die ihre Arbeit in den Ateliers kurz unterbrechen, um ihre Kräfte für die Nachtarbeit aufzufrischen, Handwerkern aus den nahen Werkstätten und Bauern aus der Umgebung. Sie bestellen je nach Gusto eine Flasche Wein oder ein Glas Bier und verzehren ihre Pizza oder Lasagne mit gutem Appetit. Alle wollen nur das eine: Abstand gewinnen vom beschwerlichen Alltag, die abendliche Ruhe genießen und sich über ihre Probleme oder die Neuigkeiten des Tages austauschen, kurz: Sie wollen zusammensein. So ist es seit Menschengedenken, solange es den „Gallo Nero“ gibt, und so wird es immer sein.
Die gute Seele der Taverne ist Signor Casoni, ein älterer Herr mit grauen Schläfen und lebhaften, dunklen Augen, der zum Inventar gehört wie die Theke mit den sorgfältig polierten Zapfhähnen oder der Messingleuchter, der schon einmal bessere Tage gesehen hat.
Es war ein Tag wie jeder andere, mit all seinen Ritualen und Eigentümlichkeiten, welche die Menschen so liebten und ohne die sie nicht leben konnten. Und doch war etwas anders an diesem Abend, dem vierten Tag seit dem Verschwinden der beiden jungen Leute, was, wie konnte es anders sein, das Gesprächsthema Nummer eins in G. war. Denn so etwas hatte es hier noch nicht gegeben. In einer kleinen Stadt wie dieser kannte jeder jeden, und die Anteilnahme am Schicksal der Verschollenen konnte größer nicht sein. Piero, der Musiker und Bandleader, immer aufgelegt zu einem flotten Spruch, und Lucia, die nette Bedienung aus dem Cafe‘ „Santini“ in der Via Seneca.
Jemand wollte von dem geheimen Rossi- Papier gehört haben, das schon seit hundertfünfzig Jahren im Tresor der Polizeiwache liege und auf das ein Einbrecher es neulich abgesehen gehabt hätte. Der diensthabende Beamte sei kurz eingenickt, habe aber sofort nach dem Erwachen nach dem Tresorschlüssel in einer Geheimtasche seiner Uniformjacke gegriffen und ihn auch dort gefunden. Der Tresor selbst schien unberührt. Und doch, als die Rossi- Dokumente wie jeden Tag auf ihre Vollständigkeit überprüft wurden, sei festgestellt worden, dass das entscheidende Blatt um zwei Millimeter verschoben war. Der Täter könnte sich also Zugriff auf das Dokument verschafft haben, das sei nicht völlig auszuschließen.
Was denn da so Wichtiges drinstehe in diesen Papieren, wollte jemand wissen. Worauf Signor Casoni, der Wirt des „Gallo Nero“, die Legende vom Gewürzmonster Cesare Rossi zum Besten gab, die nur noch die älteren Bewohner der Stadt kennen würden. Der Conte Rossi habe vor über hundert Jahren gelebt. Er sei ein verwachsener Gnom gewesen, der von seinen Mitmenschen gehänselt und verspottet wurde und deshalb auf furchtbare Rache sann. Er reiste nach Indien und lernte dort die Geheimnisse der Gewürze kennen. Nach Hause auf sein Landgut nahe G. zurückgekehrt, habe er mit den Gewürzen experimentiert und dabei ihr großes Geheimnis entdeckt: nämlich dass die richtige Mixtur, unter unverdächtige Speisen gemischt, den Menschen alle Hemmungen nehme und einen gigantischen erotischen Rausch in ihnen erzeuge, der in maßlosen Orgien gipfele.
In der Gaststube war verhaltenes Gelächter zu vernehmen. So etwas hätte doch durchaus auch etwas für sich, ließ sich jemand vernehmen. Wenn er an die vielen tristen Abende in den hiesigen Ehebetten denke, könne eine solche Mixtur doch das Nachwuchsproblem lösen und die Nation vor dem Untergang retten. Lautes Gelächter. Alle sprachen durcheinander, sodass sich Signor Casoni erst einmal lauthals Gehör verschaffen musste, bevor er weitersprechen konnte.
Es war damals so wie heute, resümierte er. Alles ging gut, solange es eben gut ging. Doch Rossi wollte mehr. Eines Tages erhöhte er die Dosis, und alles nahm ein böses Ende. Was damals geschehen sei, wollte jemand wissen. Der Wirt zuckte mit den Schultern, das wisse er auch nicht so genau. Es sei nur überliefert, dass das Gewürzmonster und seine Geliebte ein grausames Ende fanden. Kein Mensch wisse, wo sie verscharrt seien. Seitdem, so erzählten die Leute früher, liege ein böser Fluch auf den Gewürzen.
Ein Gast warf erheitert ein, er esse jeden Tag Chili und Pfeffer, und eine Menge Paprikaschoten, doch mit seinem Eheleben klappe es trotzdem nicht. Der ganze „Gallo Nero“ stimmte in das Gelächter ein. Dann möge er halt noch mehr Gewürze fressen, dann klappe es auch mit der Nachbarin, rief jemand gut gelaunt dazwischen. Wieder lachte der ganze Saal, und eine witzige Bemerkung folgte der anderen.
Und obwohl doch heutzutage niemand mehr an böse Flüche glaubte, blieb bei den meisten Gästen ein leichtes Unbehagen zurück, wenn sie an die beiden Vermissten dachten. Hatte ihr Verschwinden etwas mit dieser Geschichte zu tun? Vor allem aber: Wie sollte man sich davor schützen, selbst spurlos zu verschwinden? Das hier sei der erste Fall dieser Art in G., bemerkte jemand, das könne nur ein Verrückter gewesen sein, einer, der von außerhalb komme, aus Florenz oder Livorno oder sonst wo her, jemand aus G. sei es bestimmt nicht gewesen.
Die Gäste nickten zustimmend. Das war einfach nicht typisch für diese Gegend. Die Polizei würde den Täter sicher bald verhaften, und dann hätte der Spuk ein für alle Mal ein Ende. Das leuchtete den meisten ein und nahm dem Fall seine Schärfe. Gewiss würde sich alles bald klären, man selbst hatte damit ohnehin nichts zu tun und die anderen Gäste und die Einwohner von G. auch nicht. Und das war immerhin ein gutes Gefühl.
6
Lucia erwachte. Alles um sie herum war dunkel. Was sie als Erstes wahrnahm, war der süßliche, schwere Geruch, der sie betäubte und Kopfschmerzen verursachte. Wo war sie? Sie konnte sich an nichts Genaues erinnern, nur Bruchstücke des gestrigen Abends standen ihr vor Augen: die Disko, Piero, der Spaziergang im Stadtpark. Sie horchte angestrengt in die Dunkelheit. Da war es wieder, dieses leise, rasselnde Geräusch, das sie gestern Abend als Letztes wahrgenommen hatte. Sie hörte es nun ganz deutlich. Und dazu ein Schlurfen, das entsteht, wenn jemand sein Bein nachzieht.
Wo war sie? Wenn nur dieses undurchdringliche Dunkel nicht wäre. Das einzige, was sie erkennen konnte, waren schmale, senkrechte Lichtstreifen, wie sie sie von den Bretterverschlägen im Keller ihres Hauses kannte. Instinktiv versuchte sie, sich zu bewegen, die Hände, den Kopf, ihre Beine. Es funktionierte, sie spürte nur eine Schwäche in den Beinen und ab und zu einen Schwindel im Kopf. Wo war sie? Sie tastete sich vorwärts und kroch auf die senkrechten Lichtspalten zu. Der Raum hinter der Bretterwand war hell beleuchtet. Sie sah einen Mann auf und ab gehen, der das rechte Bein etwas nachzog und dadurch das schlurfende Geräusch verursachte. Er hatte ihr den Rücken zugekehrt. Und wieder hörte sie jenes rasselnde Geräusch, welches sie von gestern kannte und das von diesem Menschen auszugehen schien.
Wo war sie? Und wer war der Mann? Ihr Blick schweifte im Raum umher und blieb an dem Altar hängen, an dem Bild mit dem Frauenportrait und den weißen Lilien, einem ganzen Meer von weißen Lilien, und schließlich an der Kerze, die in irgendeinem Luftzug flackerte. Der Mann hatte sich inzwischen an ein Schreibpult gesetzt. Er saß im Schatten eines schwarzen Tuches, das tief von der Gewölbedecke herabhing, sodass seine Gesichtszüge nicht zu erkennen waren. Seine Hände hingegen wurden von einem grellen Lichtkegel beleuchtet, den eine Glühbirne an der Decke erzeugte. Sie spielten mit einem seltsamen Gegenstand, der halb Lupe, halb Brille war und dessen Gläser durch ein verknotetes Gummiband zusammengehalten wurden. Der Mann schien etwas zu überlegen, doch plötzlich setzte er sich die Lupenbrille auf und begann, in einem Buch zu lesen, das auf dem Pult lag. Dabei beugte er ab und zu seinen Kopf vor, sodass er in den Lichtkegel der Glühbirne geriet.
Lucia starrte auf das wächserne Gesicht des Mannes, doch sie konnte nichts Charakteristisches darin erkennen, es ließ sich niemandem zuordnen. Die Augen fehlten, sie waren durch die Lupenbrille verdeckt. Ansonsten herrschte eine gespenstische Ruhe, nur das Geräusch von Wassertropfen war zu hören, es zerteilte die schleichende, unendliche Zeit in endliche Stücke. Und dieses verdammte, unheimliche, ständig wiederkehrende Rasseln, das Lucia sich nicht erklären konnte.
Da wurde die Stille plötzlich durch ein langgezogenes Heulen unterbrochen. Lucia zuckte heftig zusammen, es war das gleiche Heulen, das sie gestern im Stadtpark gehört hatten. Sie tastete nach Piero, beugte sich über ihn und hörte seine regelmäßigen Atemzüge. Er schlief. Unsanft rüttelte sie ihn.
„Hörst du, der Hund heult wieder“, flüsterte sie.
Es dauerte eine Zeit, ehe Piero zu sich kam.
„Wo sind wir hier?“
„Ich weiß nicht, da draußen sitzt ein Mann.“
Piero dachte angestrengt nach und versuchte sich zu erinnern. In diesem Augenblick durchdrang ein weiteres Mal dieses unheimliche Heulen die Dunkelheit, und Lucia presste sich noch enger an ihren Freund.
„Der Hund. Erinnerst du dich an gestern, der leuchtende Hundekopf im Park? Es ist das gleiche Heulen.“
„Ja, genau das gleiche. Was soll das alles bedeuten?“
Sie schwiegen, nur ihre Atemzüge waren zu hören.
„Was ist das für ein Schlurfen da draußen?“, wollte Piero wissen.
„Der Mann, er zieht ein Bein nach, er wandert jetzt wieder.“
Die Stille wurde durch das Schlagen einer Tür unterbrochen. Das Heulen, das vorher in unregelmäßigen Abständen zu hören war, verstummte. Nun war es grabesstill, man hörte keinen Laut, kein Schlurfen, kein Rasseln. Eine unheimliche Ruhe lag über dem Gewölbe.
„Das Licht ist aus, siehst du?“, flüsterte Lucia. „Es scheint nicht mehr durch die Spalten.“
„Wo sind wir?“, sinnierte Piero. „Ich kann mir das alles nicht erklären.“
„Ich weiß es nicht“, gestand Lucia und schlang ihre Arme fester um ihren Freund. „Aber es macht mir Angst. Der Mann da draußen macht mir Angst, er wirkt so unheimlich.“
Mit einem Ruck richtete sich Piero plötzlich auf.
„Jetzt kann ich mir denken, wo wir sind. In der Burgruine, ganz nahe am Stadtpark, fünf Meter unter der Erde.“
„Aber dort unten wohnt doch längst keiner mehr. Die Eingänge sind seit ewigen Zeiten zugemauert.“
„Vielleicht gibt es aber doch noch einen Eingang, den keiner kennt.“
„Außer einem, dem da draußen.“
„Was hat der mit uns vor?“
„Ich weiß nicht, vielleicht klärt sich ja alles auf.“
„Vielleicht, vielleicht auch nicht. Solange können wir nicht warten.“
Piero griff in seine Tasche und zog sein Handy hervor. Matt leuchtete es im Dunklen auf, wie ein Hoffnungsschimmer in dieser trostlosen Einöde.
„Verdammt, kein Empfang!“
„Ein Funkloch?“
„Ja, wahrscheinlich. Das hier ist das Ende der Welt.“
Als nächstes förderte Piero sein Feuerzeug zutage.
„Wir müssen erst einmal unser Gefängnis erkunden, vielleicht gibt es hier eine Tür und ein Schloss, das man aufbrechen kann. Dann können wir versuchen, von hier wegzukommen.“
Piero stand auf und tastete sich zur Bretterwand vor. Seit dem Verlöschen des Lichts war vielleicht eine Viertelstunde vergangen, und immer noch herrschte diese Grabesstille. Das Feuerzeug flammte auf und warf flackernde Schatten in den Raum. Die Umrisse des Bretterverschlages wurden sichtbar. Es war ein Raum von etwa vier mal fünf Metern. Die eine Wand bildeten die Holzleisten, die anderen Wände waren aus Stein und völlig kahl. Keine Lampe und kein Lichtschalter waren weit und breit zu sehen. In die Bretterwand war eine schmale Holztür eingelassen, die aber von einem mächtigen, verrosteten Vorhängeschloss gesichert war.
Lucia sah Piero verzweifelt an.
„Das kriegen wir nie auf.“
Ihr Freund nickte. „Uns bleibt nichts anderes übrig, als die Nacht abzuwarten und uns wieder hinzulegen. Vielleicht können wir etwas schlafen.“
Sein Blick wanderte zu Lucia. Im flackernden Licht des Feuerzeuges sah er in ihre vor Schreck weit aufgerissenen Augen, die auf die Bretterwand gerichtet waren. In einer Spalte zwischen zwei Brettern, direkt vor ihnen, schimmerte ein Auge, ein seltsames blaues Auge, dessen schlaff herabhängendes Lid fast die ganze Augenpartie bedeckte. Es blickte starr auf die beiden Gefangenen, als sei es an der Bretterwand fixiert und ließe sich nie mehr entfernen. Nach einigen Sekunden der Schockstarre wandte sich Lucia abrupt von diesem schaurigen Anblick ab und warf sich an Pieros Brust. Sie zitterte am ganzen Körper.
„Was ist das?“, schluchzte sie. „Was ist das?“
Piero hob instinktiv seinen Kopf, der in Lucias Haaren geruht hatte, und blickte auf die Stelle, wo das Auge gewesen war.
„Es ist weg, Lucia, die Erscheinung ist weg.“
Zögernd drehte sie ihren Kopf zu den Holzlatten, das Auge war wirklich verschwunden. Lucia lehnte ihren Kopf an Pieros Schulter und begann zu schluchzen.
„Ich halte das nicht mehr aus!“
Piero streichelte ihr Haar, dann gingen sie zu ihrem Lager zurück, das lediglich aus einer auf dem kalten, feuchten Steinfußboden ausgebreiteten Decke bestand. Nachdem sie sich hingelegt hatten, löschte Piero das Feuerzeug. Augenblicklich umfing sie wieder Dunkelheit und eine bedrückende Stille, die wehtat und an ihren Nerven zehrte. In dieser unwirklichen Unterwelt schien es nur zwei lebendige Wesen zu geben, und das waren sie beide.
„Ich kann nicht schlafen!“
„Ich auch nicht, aber wir wollen wenigstens ein wenig ruhen.“
Er zog sie fest an sich und küsste sie auf die Stirn. Eng umschlungen starrten sie in die Dunkelheit. Das einzige Geräusch, das die quälende Stille unterbrach, waren jetzt nur noch die Wassertropfen.
„Zähle die Wassertropfen, dann schläfst du vielleicht ein. Mehr können wir im Augenblick nicht tun“, schlug Piero vor.
„Früher, als ich ein kleines Mädchen war, habe ich vor dem Einschlafen immer Schäfchen gezählt“, flüsterte Lucia und drückte ihren Freund fest an sich.
„Aufstehen!“
Eine barsche Stimme durchbrach die Stille und katapultierte die Entführten in Sekundenschnelle aus ihrem leichten, unruhigen Schlaf in die Wirklichkeit. Lucias Blick glitt vorsichtig an der Gestalt empor, die einem Schatten gleich vor ihnen stand. Durch die weit geöffnete Tür in der Bretterwand fiel das grelle, erbarmungslose Licht einer Glühbirne.
„Aufstehen!“, wiederholte die Gestalt. In der Stimme schwangen eine Spur Ungeduld und Grobheit mit. Die Gestalt trat in den Schatten und machte den Weg in den beleuchteten Raum frei. Lucia und Piero gingen durch die Tür, das grelle Licht blendete sie.
„Setzt euch dort an den Tisch!“, befahl die Stimme in ihrem Rücken. Die Entführten gehorchten. Erst jetzt vernahmen sie wieder das rasselnde Geräusch, welches sie schon von gestern kannten. Zusammen mit dem Schlurfen bildete es eine eigenartige Geräuschkulisse, die zu dem unheimlichen Aufenthaltsort perfekt zu passen schien. Der Unbekannte blieb eine Weile in ihrem Rücken stehen, vollkommen still und ohne ein Wort zu sagen. Nur das leise Rasseln zeugte davon, dass sich in dem Raum noch ein dritter Mensch aufhielt.