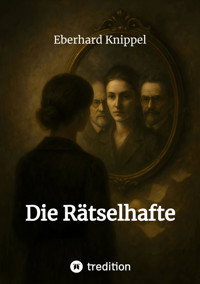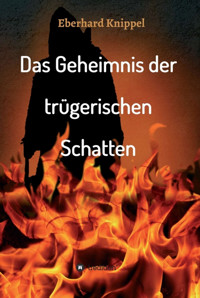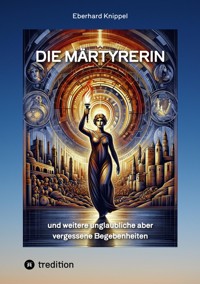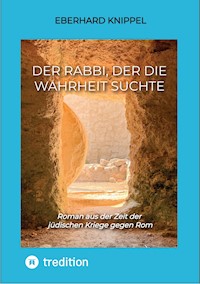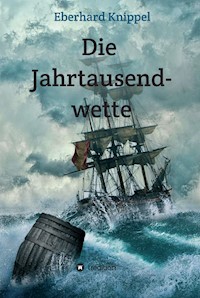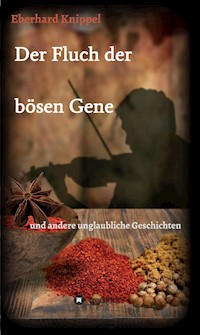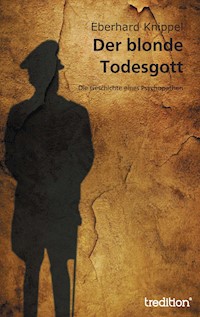1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Für den alternden Organisten Matteo Carteri bedeutet Musik alles, was ein erfülltes Leben ausmacht. Seit dem Unfalltod der Tochter sorgt er für seinen Enkel Titus. Er sieht seine Bestimmung darin, ihn in das große Geheimnis der Musik einzuführen und ihm deren Mystik und Leidenschaft zu erschließen, die sein späteres Leben so wunderbar bereichern können. Doch seit einiger Zeit plagt ihn eine Sorge, denn Titus kann zunehmend schlechter hören. Die ärztliche Diagnose bestätigt die schreckliche Gewissheit: Sein Enkel muss schon bald damit rechnen, sein weiteres Leben in völliger Taubheit zu verbringen. Doch Matteo wäre nicht der kreative Musiker, wenn er dem Unglück nichts entgegenzusetzen hätte. Er beschließt, in der kurzen noch verbleibenden Zeit Titus den magischen Geist der Musik erleben zu lassen, die Quintessenz dessen, was große Musik ausmacht. Und so reist er mit seinem Enkel durch die Konzertsäle Europas. Sie hören die Heroen der abendländischen Musik von Bach über Beethoven und Mozart bis zu Strawinsky und Mahler. Kurz: das Höchste, was der künstlerische kreative Geist zu erschaffen vermag. Erschöpft von dieser Aufgabe, stirbt Großvater Matteo kurz darauf in den Armen seines Enkels. Wird sich sein Vermächtnis bei Titus erfüllen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 127
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Der Autor
Eberhard Knippel wurde 1947 in Berlin geboren. Er ist Naturwissenschaftler und arbeitete lange Zeit in der medizinischen Forschung. Nun hat er sich als freier Autor der Belletristik zugewendet. Von ihm erschienen bereits die Romane Amina, Der blonde Todesgott, Der Fluch der bösen Gene, Das Geheimnis der trügerischen Schatten, Die Jahrtausendwette und Der Rabbi, der die Wahrheit suchte.
Außerdem liegen die Erzählung Der Tempel, der historische Erzählband Die Märtyrerin und die Kurzgeschichten Chronik der Liebe vor. Letztere erschienen mit dem Roman Der Fluch der bösen Gene in einem Band.
Eberhard Knippel
Der Blick in die Unendlichkeit
Impressum
© 2025 Eberhard Knippel
Satz & Layout: Andreas Grohn
Covergrafik von ChatGPT, OpenAI
Druck und Distribution im Auftrag des Autors: tredition GmbH, Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Deutschland
ISBN Softcover:
978-3-384-58716-9
ISBN Hardcover:
978-3-384-58717-6
ISBN E-Book:
978-3-384-58718-3
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig.
Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter:
tredition GmbH, Abteilung "Impressumservice", HeinzBeusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Deutschland.
Kontaktadresse (EU-Produktsicherheitsverordnung): [email protected]
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
Das Spiel der Violine
Die Verheißung
Die Hiobsbotschaft
An der schönen blauen Donau
Die Musikstadt Wien
Johann Sebastian Bach
Georg Friedrich Händel
Wolfgang Amadeus Mozart
Ludwig von Beethoven
Franz Schubert
Giuseppe Verdi
Gustav Mahler
Igor Strawinsky
Sergej Prokofjew
Arnold Schönberg
Das Vermächtnis
Krieg und Tod
Die Welt ist Klang
Ausgewählte Literatur
Der Blick in die Unendlichkeit
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
Das Spiel der Violine
Bibliography
Ausgewählte Literatur
Der Blick in die Unendlichkeit
Cover
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
Das Spiel der Violine
Wien, im Frühjahr 1936. Der alte Mann mit dem noch vollen, silbergrauen Haar, das seine südländischen Wurzeln verrät, blickt aus einem Fenster des Küsterhauses auf die Kirche, die langsam im Dunkel der Abenddämmerung versinkt. Es ist seine Kirche, so jedenfalls empfindet er es, zumindest seit jener Zeit, als er sich im Kirchspiel als Organist beworben hatte. Und das ist nun schon fast fünfundzwanzig Jahre her.
Matteo Carteri weiß, dass er den Zenit längst überschritten hat, was sein Orgelspiel angeht und natürlich auch sein ganzes Leben. Er möchte hier alt werden, und am liebsten wäre es ihm, wenn er eines Tages beim Orgelspiel das Zeitliche segnete. Dann könnte er immerhin sagen, seine sehnlichsten Wünsche und Träume hätten sich in seinem Leben erfüllt, sich nämlich mit Musik zu beschäftigen, Musik zu hören, welche zu machen und ganz in ihr aufzugehen.
Musik war für ihn weit mehr als nur die Werke alter Meister zu hören und sie auf der Orgel zu spielen, das heißt, den Noten Leben einzuhauchen, sodass die Musik mit ihm selbst, mit seinem Inneren verschmolz. Sie war die eigentliche universelle Sprache der Menschen und wirkte so unmittelbar auf die Seele wie keine andere Kunst, weil sie uns das Wesen der Welt direkt erschloss.
Vor allem aber war sie Klang, der Klang, der am Anfang der Welt war und sie begleitete, damals wie heute und für alle Zeiten. Und wir, die Menschen, hatten das Glück, Klang und Musik, dieses Echo des Urklangs, für eine endliche Zeit begleiten zu dürfen, ohne sie auch nur annähernd zu verstehen. Das, was wir in uns aufnahmen, war recht eigentlich eine Symphonie fantastique.
Die Dunkelheit war nun endgültig hereingebrochen. Matteo aber blieb trotzdem am offenen Fenster stehen und starrte bewegungslos in die Nacht. Gedankenverloren strich er sich über seinen kurz gestutzten Bart. Eigentlich konnte er doch mit seinem Leben zufrieden sein. Er dankte Gott, dass der ihm eine gewisse Gelassenheit mit auf den Weg gegeben hatte. Er sah vor allem das, was gut und gelungen war, jammerte nicht über Dinge, die misslangen oder sich nicht so entwickelten, wie er es erwartete. Nichts, das hatte er vom Leben gelernt, stand ihm zu, so wie es die meisten Menschen verinnerlicht hatten und was sie meist in die offenen Arme der Unzufriedenheit trieb.
Gewiss, auch er musste in der Vergangenheit schwere Schicksalsschläge hinnehmen wie im letzten Jahr den Unfalltod seiner Tochter Sophia und seines Schwiegersohnes. Aber selbst diese Tragödie hatte etwas Tröstliches: Von einem Tag auf den anderen war er nun für seinen Enkel Titus verantwortlich. Er beschloss damals, ihn zu sich zu nehmen und fortan sein Leben zu begleiten. Das war er ihm und seinen Eltern schuldig.
Und entwickelte sich ihr Verhältnis zueinander nicht prächtig? War es nicht geradezu ein Glück, den wissbegierigen Jungen behutsam zu formen und ihm die Welt zu erklären? Diese neue Aufgabe als Großvater füllte ihn zunehmend aus, insbesondere dann, wenn es darum ging, Titus für die Welt der Musik zu begeistern. Das, was er sich schon früher so manches Mal gewünscht hatte, nämlich seinem Enkel die Musik nahezubringen, wurde nun, nachdem er bei ihm wohnte, Wirklichkeit. In den letzten Jahren war ihr Kontakt eher spärlich gewesen, als Titus noch bei seinen Eltern in Palermo lebte.
Was Matteo in seiner neuen Rolle als Großvater besonders erfreute, war die Beobachtung, dass sein Enkel ein gewisses Interesse, ja eine besondere Begabung für die Musik zeigte. Und so war in ihm der Entschluss gereift, Titus zukünftig im Fach Klavier zu unterrichten, und später einmal vielleicht sogar im Orgelspiel, was ihm naturgemäß vor allem anderen am Herzen lag.
Nachdem Matteo einen letzten Blick in die Dunkelheit geworfen hatte, dorthin, wo er die Kirche wusste, zog er die Gardine zu und tat das, was er jeden Abend tat: Er sah noch einmal nach seinem Enkel, ob alles in Ordnung war und er schon schlief. So stieg er also die Treppe hinauf und öffnete behutsam die Tür zum Zimmer des Jungen. Leise trat er an dessen Bett, hörte die regelmäßigen Atemzüge und wollte schon das Licht löschen, als sein Blick auf den Nachttisch fiel, wo ein aufgeschlagenes Buch lag.
Neugierig geworden, womit sich Titus gerade beschäftigte, beugte er sich hinunter und überflog die Seite. Es war ein alter Gedichtband von Hermann Hesse, der den Großvater schon ein ganzes Leben begleitet hatte. Aufgeschlagen war das Gedicht vom Spiel der Violine. Matteo kannte es auswendig. Er schloss die Augen und erinnerte sich der ersten Strophe.
Eine Geige in den Gärten
Weit aus allen dunklen Talen
Kommt der süße Amselschlag,
Und mein Herz in stummen Qualen
Lauscht und zittert bis zum Tag.
Behutsam legte er das Büchlein wieder auf den Nachttisch, löschte die Leselampe und verließ den Raum. Er stieg die Treppe hinab und setzte sich in seinen Lesesessel im Wohnzimmer. Tränen der Rührung benetzten seine Augen. Da hatte sich der Junge doch heimlich den Gedichtband aus seinem Bücherregal geholt, „Eine Geige in den Gärten“ gelesen, sich mit dem Text beschäftigt, wie er ihn kannte, und war friedlich darüber eingeschlafen.
Während Matteo darüber nachdachte, kam ihm zu Bewusstsein, dass gerade dieses Gedicht von Hesse neben der „Toccata“ und dem „Orgelspiel“ dasjenige war, das er am meisten liebte. Ihm war kein anderes Gedicht bekannt, welches das Wesen und die Quintessenz der Musik so treffend und allgemeingültig beschrieb. Und wieder murmelte er die nächsten Zeilen halblaut vor sich hin.
Eine Geige in den Gärten
Klagt herauf mit weichem Strich,
Und ein tiefes Müdewerden
Kommt erlösend über mich.
Fremder Saitenspieler drunten,
Der so weich und dunkel klagt,
Wo hast du das Lied gefunden,
Das mein ganzes Sehnen sagt?
In diesem Augenblick wurde es dem alten Mann immer klarer, dass nichts die Magie der Musik treffender ausdrückte als dieses Gedicht, ihre Wirkung auf den Menschen, dieses Transzendentale, was das irdische Leben durchdrang und den Urklang fast körperlich spüren ließ, der Kosmos und Erde verzauberte.
Und plötzlich, nach seiner Ahnung und Vermutung, die unbedingte Gewissheit: Der Junge hatte wirklich das Zeug und die Begabung, einmal ein tüchtiger Musiker zu werden und die Musik zu einem Teil seines Lebens zu machen.
Aber Matteo wäre nicht der kreative Orgelspieler, wenn er sich nicht zugleich überlegt hätte, wie das praktisch zu verwirklichen sei. Er würde seinem Enkel nicht nur Klavier- und Orgelunterricht erteilen, was er ohnehin schon vorhatte, sondern ihn gleichzeitig in allem unterrichten, was das Wesen der Musik ausmachte.
Doch plötzlich hält er inne. Parallel zu diesen hellen Gedanken legt sich ein dunkler Schatten auf sein Gemüt. Hatte er nicht seit einiger Zeit bemerkt, dass Titus immer schlechter hören konnte? Erst war es nur eine Vermutung gewesen, die er immer wieder verdrängte. Ach was, hatte er sich nicht geirrt, war er nicht nur zu kritisch, er mit seinem absoluten Gehör?
Doch plötzlich kann er diese heimlichen Gedanken nicht mehr wegwischen, sie türmen sich vor ihm auf und lassen ihn nicht mehr los. Er muss zusehen, dass dieser Zustand sich nicht weiter verschlechtert, sondern zum Stillstand kommt und bestenfalls wieder rückgängig gemacht wird. Und so steht sein Entschluss schon bald fest: Er wird in der nächsten Zeit mit Titus zu einem Hals-NasenOhren-Spezialisten gehen und ihn untersuchen und therapieren lassen. Er möchte kein Risiko eingehen. Auf solche Art beruhigt, legt sich wieder ein entspannter Zug auf das Gesicht des Organisten. Wie hatte schon Beethoven einst treffend bemerkt? „Ich will dem Schicksal in den Rachen greifen. Ganz niederdrücken soll es mich gewiss nicht.“
Die Verheißung
Die Töne der Orgel erfüllten den ganzen Raum. Bis in die entferntesten Winkel des Kirchenschiffes schwangen sie sich empor, von gekalkten Wänden zurückgeworfen und sich verlierend im gedämpften Licht des Spätnachmittags. Doch immer wieder entstanden neue Töne, die alten, eben verklungenen ersetzend, an sie anknüpfend, sie fortführend und verbindend zu einem Neuen und Ganzen, das mit dem alten Gemäuer zu einer einzigen, großartigen Klangkulisse zu verschmelzen schien.
Der Organist, der das Instrument in so vollkommener Weise zum Klingen brachte, saß mit geschlossenen Augen vor dem Manual und griff nach einem unsichtbaren Plan, der aus seinem tiefsten Inneren zu kommen schien, mit traumwandlerischer Sicherheit in die Tasten.
Es war ein Mann in den Siebzigern mit noch vollem, ergrautem Haar, kurz gestutztem Bart und feinen Gesichtszügen, die nun völlig entspannt waren. Alles in allem machte er den Eindruck eines Menschen, der in Frieden mit sich und der Welt lebte. Nur derjenige, der in Gesichtern zu lesen verstand, der geübt war in den Zeichen, die das Leben im Gesicht eines Menschen hinterlässt, konnte die Spur eines Zweifels in den ebenmäßigen Zügen erkennen.
Doch plötzlich hielt der Organist in seinem Spiel inne. Wie es feinsinnigen Menschen eigen ist, schien er mit all seinen Sinnen zu spüren, dass sich etwas im Raum verändert hatte. Er öffnete die Augen und wandte seinen Kopf dem Eingang der Kirche zu. Und richtig, seine Sinne hatten ihn nicht getäuscht, denn er war nicht mehr allein. Im Eingang stand Titus, sein Enkel. Er musste schon eine Weile dort gestanden haben.
Ein Lächeln überzog das Gesicht des Orgelspielers. Zum einen ging ihm stets das Herz auf, wenn er mit Kindern zu tun hatte. Da klangen so viel Unschuld und Unbefangenheit in solchen Begegnungen mit, so viel Aufrichtigkeit und Anteilnahme, vor allem aber so viel Unverdorbenheit, dass er sich immer in die Welt seiner eigenen Kindheit zurückversetzt fühlte, in die Zeit der großen Entdeckungen und Abenteuer, kurz: in eine Zeit, die den Erwachsenen verloren gegangen war und an die man nur je und je erinnert wurde, wenn man mit einem solchen unschuldigen Wesen zusammen war.
Zum anderen war dieses Kind natürlich ein besonderes, es war immerhin sein Enkel, sein eigen Fleisch und Blut, den er abgöttisch liebte. Ein wohliger Schauer durchfuhr ihn. Titus war aus eigenem Antrieb in die Kirche gekommen; das hatte er in der kurzen Zeit, wo er bei ihm wohnte, noch nie getan. Ihn zog, das fühlte Matteo, die Musik dorthin, die Orgel, sein Spiel.
Was ihn aber besonders freute war, dass sein Enkel sich gerade von Johann Sebastian Bach, den er eben gespielt hatte, so angezogen fühlte, von der berühmten Toccata und Fuge in d-Moll, die der Musikwelt als das Symbol der Bachschen Orgelmusik schlechthin galt, obwohl die Urheberschaft des Meisters nicht zweifelsfrei erwiesen war. Doch wer sollte solche vollendeten Harmonien, Akkorde, schnellen Läufe und Arpeggien geschaffen und anschließend mit dieser vierstimmigen Fuge in so vollendeter Weise verknüpft haben wenn nicht Bach persönlich?
Wie ein Blitz aus heiterem Himmel stürmt diese Musik auf den Zuhörer hinab, trifft ihn mitten ins Herz. Und so musste es auch Titus ergangen sein, der jetzt noch immer, als die Musik schon längst verklungen war, wie angewurzelt im Eingangsbereich stand und den Klängen der Orgel zu lauschen schien.
Freudig gab Matteo seinem Enkel zu verstehen, er solle doch hinaufkommen und sich die Orgel einmal genauer anschauen. Schüchtern, die mächtige Orgel bestaunend, stieg Titus zu seinem Großvater empor. Der begrüßte ihn freudig.
„Hat dir die Musik gefallen?“, fragte er.
Das Kind nickte nur stumm, schließlich meinte es: „So eine schöne Musik habe ich noch nie gehört. Wer hat sie gemacht?“ Es sah seinen Großvater fragend an.
„Der Komponist heißt Johann Sebastian Bach. Er lebte vor über zweihundert Jahren und ist nach allgemeiner Auffassung einer der genialsten Komponisten und begnadetsten Organisten überhaupt.“
„Und einer der bescheidensten“, fügte er hinzu. „Einmal, als er in der Leipziger Thomaskirche das Publikum mit seinem herrlichen Orgelspiel begeistert hatte, fragte ihn im Anschluss einer seiner Bewunderer, was denn das Geheimnis seines einmaligen Spiels sei. Bach wehrte bescheiden ab und bestritt, dass es da irgendein Geheimnis gebe. Man müsse nur die rechten Tasten zur rechten Zeit mit der rechten Stärke drücken, dann spiele die Orgel ganz von selbst die schönste Musik.“