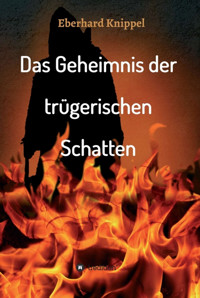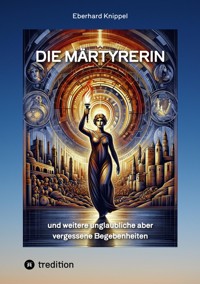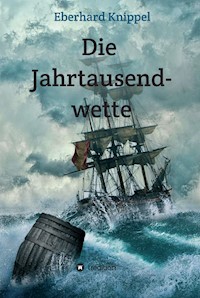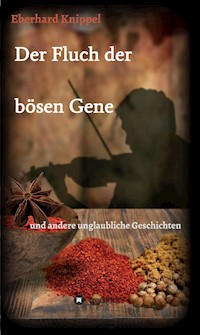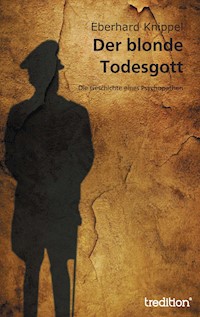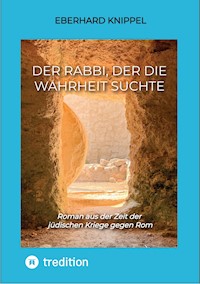
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das Buch beschreibt die Suche des Rabbi Jeruhda ben Jochai nach dem inneren Kern des Lebens, nach dem, was es eigentlich ausmacht. Es ist der ewige Kampf zwischen Vernunft und Leidenschaft, der in der erbitterten Auseinandersetzung zwischen Judäa und Rom im ersten und zweiten Jahrhundert nach Christus seinen Ausdruck findet. Wird ihm der Ausbruch aus der einseitigen und unausgewogenen Sicht der Dinge, die dem friedlichen Zusammenleben so vehement entgegensteht, gelingen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 432
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Der Autor
Eberhard Knippel wurde 1947 in Berlin geboren. Er ist Naturwissenschaftler und arbeitete lange Zeit in der medizinischen Forschung. Nun hat er sich der Belletristik zugewendet.
Von ihm erschienen bereits die Erzählung Der Tempel sowie die Romane Amina, Der blonde Todesgott, Der Fluch der bösen Gene,Das Geheimnis der trügerischen Schatten und Die Jahrtausendwette.
Gelobt sei der Name Jahwes, unseres Herrn, der seinen Segen denen spendet, die nach Wahrheit dürsten.Was aber ist Wahrheit? Gibt es nicht Tausende Wahrheiten, weil doch jeder Mensch seine eigene Wahrheit hat?
Welche aber ist die richtige? Ist es die, welche die Mächtigen uns verkünden, auf dass das Volk glaube, was ihm erzählt wird? Nein, diese ist es nicht, denn deren Wahrheit wird die Zeiten nicht überdauern, sie riecht nach Moder und Verwesung. Man kann nicht ungestraft die Realität durch das eigene Wunschdenken ersetzen. Der Wahrheit nähert man sich nur, wenn man sich seine eigenen Gedanken über die Welt macht und Widerspruch und Zweifel hegt an dem, was dem Volke als Wahrheit verkündet wird.
Jehuda ben Jochai,
Gelehrter und Doktor an der Hochschule zu Jawne
Eberhard Knippel
Der Rabbi, der die Wahrheit suchte
Roman aus der Zeit der Jüdischen Kriege gegen Rom
Impressum
© 2022 Eberhard Knippel
Satz & Layout: Andreas Grohn
Covergrafik von Pisit Heng bei Unsplash.com
Druck und Distribution im Auftrag des Autors/der Autorin:
tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Deutschland
ISBN Softcover:
978-3-347-59910-9
ISBN Hardcover:
978-3-347-59911-6
ISBN E-Book:
978-3-347-59912-3
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor/die Autorin verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine/ihre Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors/der Autorin, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung "Impressumservice", Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Deutschland.
Inhaltsverzeichnis
Vorgeschichte
Prolog
Die beiden Pole
Widerstand
Aufruhr
Jotapata
Das Ende wird der Anfang sein
Triumph und Untergang
Der Wandel
Bathsheba
Abschied0
Die Verschwörung
Zwei Falken und eine Taube
Kaiser Hadrian
Der geheimnisvolle Unbekannte
Die gescheiterte Hoffnung
Betar
Was vom Leben bleibt
Epilog
Über den historischen Roman
Dramatis personae
Vorgeschichte
Die religiöse Geschichtsschreibung der Thora beginnt mit den Erzvätern Abraham, Isaak und Jakob und reicht bis ins zweite Jahrtausend v. Chr. zurück. Historisch gesichert ist, dass nach der Landnahme Kanaans ein einheitliches Reich unter den Königen David und Salomon entstand, das später in die beiden Staaten Israel und Juda zerfiel. Nachdem Israel von den Assyrern erobert wurde, fiel Juda dem babylonischen Herrscher Nebukadnezar zum Opfer, der den ersten Tempel in Jerusalem zerstörte und die Elite des Landes nach Babylon deportierte. Nach ihrer Rückkehr fiel Palästina unter persische, ägyptische und syrische Kontrolle, bevor das Gebiet nach einer kurzen Phase der Unabhängigkeit infolge des Makkabäeraufstandes unter die Dynastie der Hasmonäer kam. Seit dem Jahre 6 v. Chr., nachdem der römische Feldherr Pompejus Jerusalem erobert hatte, stand das Land unter der Herrschaft Roms und war Teil des Imperiums Romanum.
Als identitätsstiftendes Zentrum des jüdischen Volkes galt als jeher der Tempel, der ihrem Gott Jahwe geweiht war. Drei Tempel errichteten sie in Jerusalem, nachdem sie über Jahrhunderte die Stiftshütte, ein bewegliches Heiligtum, mit sich geführt hatten. Den ersten Tempel ließ König Salomo erbauen; er existierte vierhundert Jahre, bis er bei der Eroberung Jerusalems vom babylonischen Herrscher Nebukadnezar zerstört wurde.
Nachdem die Juden aus ihrem babylonischen Exil heimgekehrt waren, errichteten sie ihren zweiten Tempel, der dem salomonischen aber in keiner Weise ebenbürtig war. Erst weitere sechshundert Jahre später ließ Herodes der Große, König von Judäa, Galiläa und Samaria, den dritten Tempel in Jerusalem bauen, der die beiden ersten in allen Belangen bei Weitem übertraf. Schon aus der Ferne kündete das in strahlendem Weiß und Gold gehaltene Heiligtum vom Ruhm des einzigen Gottes Jahwe und dem Stolz seines auserwählten Volkes.
Sorgfältig getrennt von dem öffentlich zugänglichen Bereich, der auch vom einfachen Volk genutzt werden konnte, lag der heilige Bezirk, den zu betreten nur ausgesuchten Priestern vorbehalten war. Das Allerheiligste, welches allein der Hohepriester am Jom Kippur, wenn Jahwe sich dem gläubigen Volk zeigte, betreten durfte, lag in der Mitte des Tempels und war nur durch einen Vorhang von seiner Umgebung getrennt. Die antike Welt rätselte, was sich wohl hinter dem Vorhang verbergen mochte, doch die Priester hüteten ihr Geheimnis streng. Sie behaupteten, der Raum wäre leer, da ihr Gott unsichtbar sei.
Der Tempel in Jerusalem war das religiöse Zentrum und die geistige Heimat aller Juden, wo immer sie sich in aller Welt auch aufhielten. Dieses Heiligtum einte sie und gab ihnen Halt und Richtung für ihr Leben. Bis zu jenem historischen Tag im zweiten Regierungsjahr des römischen Kaisers Vespasian, als auch dieser dritte Tempel im Ersten Jüdischen Krieg dem Erdboden gleichgemacht wurde und das Volk von einem Tag auf den anderen sein religiöses Zentrum verlor.
Die Juden waren von allen Völkern im Imperium Romanum das widerspenstigste und am wenigsten integrierte Volk, was innerhalb eines historisch kurzen Zeitraums von siebzig Jahren zu drei Aufständen gegen Rom führte(66 – 70 n. Chr., 115 – 117 n. Chr. in der Diaspora und 132 – 135/36 n. Chr.). Obwohl eine endgültige, befriedigende Erklärung für die außerordentliche Gewalt und Brutalität in der Beziehung zwischen Juden und der römischen Staatsmacht in jener Zeit noch aussteht, könnte ein Grund für das antigriechische und antirömische Potential im Judentum der Antike an einem Alleinstellungsmerkmal der jüdischen Religion gelegen haben. Während die Erhebungen anderer Völker gegen Rom meist auf wirtschaftliche und andere weltliche Ursachen wie etwa schlechte Lebensbedingungen durch zu hohe Steuern und Abgaben oder Willkür der Besatzungsverwaltung zurückgeführt werden konnten, waren die beiden jüdischen Kriege und der Diasporaaufstand nicht nur der Verelendung großer Teile der Bevölkerung und der sozialen Ungleichheit im Allgemeinen geschuldet, sondern ganz wesentlich auch religiös motiviert. Denn allein die jüdische Religion war im Gegensatz zum Polytheismus der Antike monotheistisch. Ihr Gott Jahwe war einzig, es gab keine Götter neben ihm, und er galt als ein kämpferischer Gott, der den Juden im heiligen Krieg gegen ihre Feinde beistand und ihnen zum Sieg verhalf. Rom tolerierte in der Regel die Religionen der unterworfenen Völker, erwartete jedoch als Gegenleistung die Anerkennung des Kaisers als weltliches und religiöses Oberhaupt. Sich dieser Forderung zu fügen, also außer Jahwe auch einen fremden weltlichen Herrscher über sich zu dulden, waren die meisten Juden nicht bereit. Dies könnte ein wichtiges Motiv für den Hass auf die römische Besatzungsmacht gewesen sein.
Das damals mit dem Heiligen Krieg verbundene Märtyrertum sowie die ausgeprägte Endzeiterwartung und der unerschütterliche Glaube an einen Messias, der kommen und die Juden aus ihrem Elend erlösen würde, untermauerten darüber hinaus die prinzipielle jüdische Ablehnung der römischen Besatzungsmacht.
Vor diesem Hintergrund könnte allein die Ankündigung Kaiser Hadrians, das zerstörte Jerusalem als römisch-griechische Stadt Aelia Capitolina wieder aufzubauen, mit Nichtjuden zu besiedeln und auf den Trümmern des Herodestempels ein dem Jupiter geweihtes Heiligtum zu errichten, der berühmte Tropfen gewesen sein, der das Fass zum Überlaufen brachte und den Bar-Kochba-Aufstand auslöste. Dieses Ereignis erinnert an eine ähnliche Situation dreihundert Jahre zuvor, als der Seleukidenherrscher Antiochus Epiphanes rigoros gegen den jüdischen Glauben vorging und den Tempel in Jerusalem ebenfalls seiner ursprünglichen Bedeutung entfremdete und dem Zeus widmete.
Die Folge war der Makkabäeraufstand, der dazu führte, dass die Juden seit der Zerstörung ihres ersten Tempels durch Nebukadnezar das erste und vorläufig letzte Mal, diesmal für siebzig Jahre, unabhängig wurden, wenn man von der kurzen Zeit des Bar-Kochba-Aufstandes einmal absieht. Dieses Geschehen war noch in lebhafter Erinnerung und trug mit hoher Wahrscheinlichkeit als zusätzliche Motivation zur Erhebung bei.
Prolog
Irgendwo in einer Höhle im Judäischen Gebirge. Man schreibt das Jahr 135 n. Chr. Der Rabbi Jehuda ben Jochai, Gelehrter an der Hochschule zu Jawne und Mitglied des Hohen Jüdischen Rates, mit seinen sechsundachtzig Jahren gebrechlich an Körper und Seele, aber hellwach im Geiste, starrt in die Dunkelheit.
Gewiss, auch er, obwohl Askese gewohnt, leidet unter dem Durst. Und er weiß, die Zeichen des Hungers werden stärker, sie werden in der Gewissheit, mit der jeden Morgen die Sonne aufgeht, unerträglicher. Dann sind es nicht nur die seelischen Qualen, die drohende Niederlage der Aufständischen, die Rache der Römer und die Bilanz des eigenen Lebens, die einen umtreiben, dann wird es der Körper sein, der rebelliert, die Organe, die ihre Arbeit nicht mehr verrichten, der Schmerz, der entsteht, wenn sich der Hunger durch die Eingeweide frisst. Wasser und Nahrung gehen zu Ende, der Ring, den die römischen Truppen um die Höhlen gezogen haben, wird immer enger, die Ortschaften liegen in Trümmern. Und damit gibt es keine Hoffnung mehr auf Nahrung. Wenn die Wasserrationen aufgebraucht sind, zählt das Ende nach Tagen.
Jehuda ertappt sich in letzter Zeit immer öfter dabei, das Ende herbeizusehnen. Er ist ein schwacher Greis, und seine Tage sind ohnehin gezählt. Er darf sich ein Ende der Qualen wünschen. Ein Ende ohne Folter, ohne Kreuzigung, vielleicht ist das mehr, als man gerechter Weise erhoffen darf. Noch hat er einen Rest an Energie, noch die Kraft, klare Gedanken zu fassen. Er weiß nicht, wie lange das währt. Wenn er noch einmal, wahrscheinlich zum letzten Mal, das Fazit seines Lebens ziehen will, dann muss er es jetzt tun. Er darf es nicht mehr aufschieben.
Wo sind die stolzen Zeiten des weisen Rabbi Jehuda ben Jochai hin? Jetzt liegt er da, zusammengekrümmt auf einer Handvoll Stroh, die fiebrigen Augen in tiefen Höhlen, der zerzauste Bart besudelt mit Speichel und Blut. Sein ganzer Körper schmerzt; er bringt ihn in eine Stellung, die den Schmerz erträglicher macht. Jetzt darf, nein, jetzt muss er sich die wichtigste Frage stellen, ohne die er sein Leben nicht beschließen kann. Hat dieses sein Leben einen Sinn gehabt, einen Sinn, der über den einfachen Erhalt hinausgeht?
In seinem fiebrigen Traum zogen vorüber Ereignisse des bitteren Kampfes der Juden gegen die römische Besatzung, gegen das Fremde, Frevelhafte, das die jüdische Seele befleckte. Ganz besonders eines drängte sich nun in den Vordergrund, und obwohl er es nicht selbst erlebt hatte, war es doch für ihn lebendige Geschichte, die als Symbol stand für den fanatischen jüdischen Widerstandsgeist auch des gegenwärtigen Aufstandes unter dem Feldherrn Simeon bar Kosiba, genannt Bar Kochba, dem Sternensohn.
Dieser Geist war aus den zahlreichen fundamentalistischen Strömungen der Vergangenheit gespeist: den Makkabäern und Essenern bis hin zu den Zeloten, die in Israel keine andere Herrschaft duldeten als die Jahwes. Und schließlich den Sikkariern, welche lieber starben, als die heiligen Gebote zu brechen. Diese Gefühle waren so stark, dass sie selbst ihn, den geläuterten Greis, den Vernunftbegabten, noch jetzt am Ende seiner Tage nicht gänzlich losließen.
Der Rabbi sammelte seine Gedanken. Die Geschichte war die folgende: Sie fiel in die Zeit von Herodes, der auch der Große genannt wurde, dem König von Judäa, Galiläa und Samaria, der für seine großartigen Bauten wie den Tempel und den Königspalast in Jerusalem ebenso bekannt war wie für seine Grausamkeit. Jehuda schauderte noch immer bei dem Gedanken an dessen letzten teuflischen Plan, die angesehensten Männer Judäas in die Rennbahn Jerichos einzusperren, um sie bei seinem Tode hinrichten zu lassen. Damit das Volk bei seinem Begräbnis auch wirklich weinen möge.
Diesen besagten Herodes nun erreichte kurz vor seinem Tode die Nachricht, dass einige junge Eiferer, angestachelt von den Reden zweier Schriftgelehrter und in der festen Überzeugung, die Zeit sei nun herangereift, um die Ehre Gottes zu retten, den goldenen Adler zerstört hatten, der auf Befehl des Herodes über dem Tempeltor angebracht worden war. In ihren Augen eine Todsünde, da nach den Gesetzen der Väter keine Bildnisse lebender Wesen den Tempel zieren durften.
Vor Herodes geführt, versicherten sie angesichts des sicheren Todes, das Gesetz der Väter habe sie zu diesem Schritt gezwungen, und sie selbst gingen freudig in den Tod, da ihnen zukünftig erst das wahre Glück beschieden sei. Wie lebendig diese Haltung bei vielen jüdischen Kämpfern auch heute unter Bar Kochba noch war, zeigte sich gerade jetzt in Anbetracht des sicheren Unterganges. Selbst ihn überfiel sie von Zeit zu Zeit, und er musste die ganze Kraft seines Verstandes und seiner Erfahrung aufbringen, um sich von ihr nicht überwältigen zu lassen.
Doch schon damals nach dem ersten verlorenen Krieg vor über fünfzig Jahren hatte er gefühlt, dass er eine persönliche Entscheidung treffen müsse, nachdem die Truppen des römischen Feldherrn Titus den Tempel in Jerusalem zerstört hatten. Zu einem Zeitpunkt also, da die Niederlage der Juden für immer besiegelt schien, er aber noch mit jeder Faser seiner Seele am reinen, unverfälschten Glauben hing und jede Einschränkung der Freiheit des Willens und des Glaubens ablehnte.
Sollte er dem weisen Rabbi Jochanan ben Sakkai folgen, der diese Niederlage nicht nur vorhergesehen hatte, sondern nun, da der reale Judenstaat zerschlagen war, einen geistigen Staat errichten wollte, der das Überleben der Religion und des authentischen Judentums überhaupt erst sicherte? Oder dessen Nachfolger im Sanhedrin, dem Hohen Jüdischen Rat, Großdoktor Gamaliel, der mit unerbittlicher Strenge auf die Einhaltung der Regeln und Gesetze achtete, also letztlich den gleichen Weg verfolgte wie sein ehrwürdiger Vorgänger? Oder gar Rabbi Akiba, dem Heftigen, Charismatischen, der die gegenteilige Auffassung vertrat? Ohne staatliche Strukturen kein Judentum. Die Errichtung eines geistigen Staates, an dem sich die Juden in aller Welt ausrichten sollten, sei Verrat am Volke selbst. Und der deshalb später die Aufständischen unterstützte und deren Anführer Bar Kochba für den Messias hielt.
Diese schwere Entscheidung hatte am Ende das Leben selbst gefällt. Bizarre Gedankenfetzen flackerten wie aufgescheuchte Krähen im Gehirn des Alten, Bilder seiner Kindheit zogen an ihm vorüber: Galiläa, seine erste Begegnung mit den Römern, die Jugend in Jerusalem, die Stunden mit seinem Freund Natan, dem Ungestümen, der ihn zu den Aufständischen geführt hatte. Und schließlich Bilder aus der Zeit seines Kampfes für die Zeloten, die „Eiferer“, von der Belagerung Jotapatas und Jerusalems durch die römischen Truppen, dem Hunger und der Entbehrung, und endlich die düsteren Bilder des Zusammenbruchs, der Zerstörung des Tempels durch die Besatzer, der bitteren, totalen Niederlage der Juden.
Und plötzlich tauchte es wieder auf, dieses grauenhafteste aller Bilder, welches ihn sein ganzes Leben verfolgt hatte. Nun war es auch in dieser Höhle und füllte sie bis in den letzten Winkel aus. Kein Raum war mehr für anderes, wie ein Fels legte es sich auf Jehuda und schnürte ihm die Luft ab. Diese furchtbaren Schreie, das Abschlachten, das Blut, das bedrohliche Knistern der brennenden Balken, bevor sie von der Decke des Tempels herabstürzten. Und sein Gelübde in dieser Flammenhölle, wenn Jahwe ihm nur das Leben ließe, er würde etwas daraus machen.War jetzt die Stunde gekommen, wo Jahwe wissen wollte, ob er seinen Schwur gehalten hatte? Würde er jetzt vor dem Angesicht des Herrn erscheinen müssen, um Rechenschaft abzulegen?
Doch das unruhig zuckende Herz beruhigte sich wieder, die Gedanken kamen zurück, und mit seinen Gedanken die Geschichte, die er in dieser letzten Stunde mit Jahwe teilte, nur mit ihm. Der Herr hatte ihm einen Fingerzeig gegeben, ihm eine kurze, letzte Frist eingeräumt, um sich ihm zu erklären und sein Versprechen einzulösen, das er ihm damals im Tempel gegeben hatte. Und Jehuda fuhr hastig fort, seine Geschichte zu erzählen, denn Jahwe hatte ihn zur Eile gemahnt und er wusste nicht, wie viel Zeit ihm noch blieb.
Er erzählte Jahwe von dem Wunder, das er an ihm getan hatte; denn es war damals etwas geschehen, das er nie für möglich hielt: sein langer, zäher Gesinnungswandel vom Absoluten zum Relativen, vom Alles oder Nichts zum Kompromiss, zur Anerkenntnis der Tatsache, dass das Leben im Wesentlichen aus Grautönen besteht, nicht aus Schwarz oder Weiß, sondern aus Grautönen, die allesamt schwer zu ertragen waren, die einen irritierten, verunsicherten, aber eben der Realität entsprachen und nicht dem eigenen Wunschdenken, dessen Bestätigung einem so wohl tat. Und schließlich die Erkenntnis, dass diese Haltung zu einem friedlicheren Zusammenleben der Menschen führte und damit zu weniger Leid.
Doch was hatte das alles bedeutet, was hatte dieser Wandel für Konsequenzen in seinem Leben gehabt, welche Reaktionen bei den radikalen Aufständischen, seinen ehemaligen Kameraden, ausgelöst? Jehuda ben Jochais Gedanken blieben an Josef ben Matthias, Priester der Ersten Reihe in Jerusalem, hängen, später als Flavius Josephus bekannt, der als Befehlshaber der jüdischen Aufstandsarmee in Galiläa am Großen Jüdischen Krieg teilgenommen und dem römischen Feldherrn Vespasian tapfer die Stirn geboten hatte im Kampf um die Festung Jotapata, aber plötzlich zu den Römern übergelaufen war und deshalb trotz seiner Verdienste in den Augen aller national gesinnten Juden, und das waren nun einmal die meisten, als ewiger Verräter galt.
Er war zwar ein Verräter, der sich den Flaviern in die Arme geworfen hatte, der aber später von dem herrsch- und rachsüchtigen Kaiser Domitian auch gedemütigt wurde und ihm furchtlos entgegengetreten war. Wie hatte auch er selbst damals beim Triumphzug in Rom den Flavius Josephus verachtet. Und dann war er selbst ein Stück weit in die Richtung dieses Verachteten gegangen. Er, Jehuda, hatte sein Volk nicht verraten wie dieser, das hätte er niemals getan, doch er war in der zweiten Hälfte seines Lebens auf die Römer zugegangen und hatte sich vom harten Widerstand verabschiedet. Es gab genug Juden, die ihn wegen seiner Kompromisshaltung verachteten. Doch während des Bar-Kochba-Aufstandes gab es auch etliche, die ihm heimlich beipflichteten. Vielleicht hatte Flavius Josephus ebenfalls diesen Weg der Vernunft gewollt, doch er war in die falsche Richtung gegangen.
Dieses gute, stolze Gefühl, das Gesetz der Väter streng eingehalten und gegen alle Widerstände bis zum letzten Blutstropfen verteidigt zu haben, ach, wie bahnte es sich doch immer wieder seinen Weg durch die kühle, erstarrte, fade Welt des Verstandes, der sich nüchtern an die Fakten hielt, der immer wieder versuchte, die Realität auch durch die Augen des Kontrahenten zu sehen, der Kompromisse suchte um des Friedens und des Ausgleichs willen, auch dort, wo es scheinbar nur Gegensätze gab. Der zwar logisch war, aber eben fade und im besten Falle eine Genugtuung des Verstandes erzeugte und nicht jenes überwältigende Gefühl des Herzens und der Freude, das einen empor riss in himmlische Sphären, das einen bis in die Haarwurzeln packte und ganz und gar ausfüllte.
Wie es vor Zeiten dem König Saul erging, der Israel, von der Armee der Philister umzingelt, in aussichtsloser Lage sah und verzweifelt Rat von Jahwe suchte. Doch der Herr schwieg, und so holte sich der König den so dringend benötigten Rat heimlich bei der Totenbeschwörerin von En-Dor. Deren Botschaft aber, die sie von dem verstorbenen Propheten Samuel erhielt, war niederschmetternd: Israel werde von den Feinden besiegt, und er selbst, Saul, gemeinsam mit seinen Söhnen in der Schlacht fallen. Trotz dieser offensichtlichen Aussichtslosigkeit zog er, ganz von jenem leidenschaftlichen Hochgefühl erfüllt und seiner Vernunft beraubt, am nächsten Tag in das Gemetzel, und alles geschah, wie ihm vorhergesagt wurde. Der Sog der Emotionen war zu stark, als dass die Vernunft eine Chance gehabt hätte. Ganz so wie bei den Zeloten, als sie nach ihrem Sieg über den römischen Feldherrn Cestius Gallus bei Beth Horon das Imperium herausforderten.
Und gerade deshalb, weil dieses Hochgefühl so überwältigend und einfach war, erfasste es die Menschen zehnmal stärker als der Gedanke des Ausgleichs und zähen Kompromisses, alle Bedenkend hinwegfegend, alles Grauen vor dem Blut und dem Elend, das die Kompromisslosigkeit in den meisten Fällen nach sich zog. So hatte dieses heiße Gefühl auch ihn in seiner Jugend erbarmungslos vereinnahmt, und noch dann, als er sich mit gewaltiger Anstrengung gegen das Gefühl gestellt hatte, mit allem Verstand und der Kraft der Vernunft, war es zwar gezähmt, aber nie ganz besiegt gewesen. Selbst jetzt noch, angesichts der nahen Niederlage des gegenwärtigen Aufstandes, geisterte es durch das Gemüt des Alten und fraß sich trotz inneren Widerstandes durch alle Verstandesschichten.
Dieses Gefühl war einfach übermächtig, und plötzlich durchzuckte eine Frage die fieberhafte Gedankenwelt des greisen Jehuda ben Jochai, der in einer Höhle im Judäischen Gebirge begann, sein Leben zu vollenden: ob denn der menschliche Verstand überhaupt jemals in der Lage sein würde, das überwältigende, alles mitreißende Gefühl der Einfachheit und Kompromisslosigkeit auf Dauer zu zähmen. Einen Augenblick lang war der alte Mann verunsichert, es war ihm, als erschiene ein Schriftzug wie von Geisterhand an der gegenüberliegenden Höhlenwand, wie damals das berühmte Menetekel beim Gastmahl des Belsazar in Babylon: „Mene mene tekel upharsin“, das dessen baldigen Tod und den Untergang seines Königreiches prophezeite. Ein Fluch lag damals auf Belsazar, zu schwer wog sein Frevel, von Gefäßen aus dem Tempelraub in Jerusalem gespeist zu haben.
Nun, in dieser Höhle im Judäischen Gebirge, war es eine andere Botschaft, ein klares, deutliches, energisches Nein. Niemals wird die menschliche Vernunft das Gefühl ganz besiegen, nie wird sie in der Lage sein, das süße Gift der Macht, der Leidenschaften und der einfachen Erklärungen auf Dauer zu zügeln. Jetzt nicht und nicht in aller Zukunft.
Alles sträubte sich in dem alten Mann gegen dieses endgültige Nein, seine tiefste innere Überzeugung stemmte sich diesem Nein entgegen. Seine Überzeugung nämlich war die Quintessenz aus seinem Leben: Selbst wenn alles aussichtslos schien, die Menschen mussten immer wieder aufs Neue versuchen, der Vernunft zum Durchbruch zu verhalfen, so wie auch er es stets versucht hatte. Wenn auch, wie er nun am Ende seines Lebens mit Bitterkeit erkannte, nur eine Minderheit Vernunftsgründen überhaupt zugänglich war. Doch im Grunde ihres Herzens sehnten sich die meisten Menschen nach Frieden. Das war seine geheime Hoffnung, mit der er nun aus dem Leben schied.
Worin also lag nun der tiefe Sinn seines Lebens? Ohne jeden Zweifel darin, dass es bei ihm eine Entwicklung gegeben hatte, vom unumstößlichen Widerstandsdenken seiner Jugend angesichts der römischen Besetzung seiner Heimat hin zu der Einsicht, dass eine vernünftige Kooperation mit den Römern die Verhältnisse zwar nicht grundlegend änderte, der jüdische Gedanke, die jüdische Kultur jedoch als steter Tropfen den römischen Stein höhlen konnte, wie auch die griechische Kultur in die römische eingeflossen war und beide Kulturen voneinander profitierten und sich ergänzten. Und was vielleicht noch schwerer wog, der Ausgleich vermied die Ströme von Blut und die endgültige Vernichtung der jüdischen Staatlichkeit, die ein offener Aufstand gegen die Übermacht unwiderruflich nach sich zog.
Und doch, war allein der Verzicht auf Gewalt es wirklich wert gewesen, dafür den reinen Glauben zu opfern, die Einfachheit, das gute Gefühl? Noch ein allerletztes Mal baute sich der Zweifel vor ihm auf, groß und bedrohlich, spaltete seine Seele wie Blitze den Himmel spalten. Doch nur für einen jener kurzen, aber entscheidenden Augenblicke, die die Weichen für eine neue Zukunft zu stellen vermochten. Diese Weichen waren nun für immer gestellt, und angesichts des nahen Todes und der endgültigen Niederlage der Juden unter ihrem Anführer Bar Kochba war es für den alten Mann nun unumstößliche Gewissheit, dass er in seinem Leben richtig entschieden hatte. Das war der Sinn, nach dem er sein ganzes Leben auf der Suche gewesen war und der es ihm nun ermöglichte, im Einklang mit Jahwe und der Welt sein Leben zu vollenden.
Da lag er nun zwischen Himmel und Erde, der Doktor Jehuda ben Jochai, der rebelliert hatte gegen das römische Joch und den das Leben lehrte, der Gewalt abzuschwören um der Vernunft willen, der angetreten war, Verstand und Gefühl zu versöhnen und dafür mit den Mächtigen dieser Welt gesprochen hatte, mit dem römischen Kaiser Hadrian ebenso wie mit den Feldherren Severus und Bar Kochba, mit den religiösen Führern der Juden Rabbi Akiba und dem Großdoktor Gamaliel, und der sein zähes Ringen um Kompromiss und Dialog mit dem Verlust seiner Tochter teuer bezahlt hatte. Und mit dem zwiespältigen Gefühl, sowohl der einen wie der anderen Partei nicht wirklich zuzugehören. Der die Schriften der Juden, Griechen und Römer studiert und darin doch nicht der Weisheit letzten Schluss gefunden hatte. Dieser Jehuda ben Jochai war nun endgültig am Ende seines langen Weges angelangt und bereit, seine letzte Reise anzutreten. Den Rest des großen Werkes mussten die übernehmen, die nach ihm kamen.
Die beiden Pole
Man sagt, wenn jemand stirbt, zieht noch einmal sein ganzes Leben wie ein Theaterstück im Zeitraffer an ihm vorüber, vor allem die Dinge, die ihn besonders bewegt und bis in die letzten Tage nicht losgelassen haben. Niemand weiß es genau, denn wer hat schon Sterbende im Augenblick ihres Sterbens befragt.
Die Skeptiker werden antworten, was sei am Leben eines Menschen schon so bedeutend, als dass es am Ende noch spektakulär in Erinnerung gerufen werden müsste. Das mag stimmen, wenn es da nicht die berühmten Ausnahmen gäbe, die Menschen nämlich, welche Bedeutendes in ihrem Leben bewegt haben, die mal segensreich, mal unheilvoll in den Lauf der Geschichte eingegriffen und sich in unkösbare Widersprüche verstrickt haben, die sie bis zu ihrem seligen Ende umtreiben.
Zu diesen Ausnahmen mögen die beiden Kontrahenten des Bar-Kochba-Aufstandes, der jüdische Rabbi Akiba und der römische Kaiser Publius Aelius Hadrianus, gehört haben, allein schon wegen der besonderen Tragweite, die der Ausgang des Kampfes zeitigte, nämlich dass der jüdische Staat ausgelöscht und erst achtzehn Jahrhunderte später wieder neu errichtet wurde. Der Dritte im Bunde, Simeon bar Kosiba, genannt Bar Kochba, hat sicher auch zu diesen Ausnahmemenschen gehört wie Akiba und Hadrian, wenn das Schicksal ihn nicht dazu bestimmt hätte, bei der Erstürmung der Festung Betar durch die Römer im Kampf zu fallen.
Der Tod Rabbi Akibas, der den Bar-Kochba-Aufstand befeuerte
Feuchte, stickige Luft lastet auf der Dunkelheit und macht das Atmen schwer. Mühsam hebt und senkt sich der magere Brustkorb des Delinquenten, mühsam auch bahnen sich die Gedanken ihren Weg durch das Hirn des Fünfundachtzigjährigen. Nur ein Schatten seiner einstigen Größe ist dieser Körper, doch der Geist hat ihn noch nicht endgültig verlassen. Noch existiert er, der geistig-religiöse Mittelpunkt des Bar-Kochba-Aufstandes, den die Römer den Zweiten Jüdischen Krieg nennen. Doch er, Rabbi Akiba, weiß, seine Tage sind gezählt, und er ertappt sich gelegentlich dabei, dieses Ende herbeizusehnen. Lieber ein schnelles Ende als das sinnlose, quälende Warten in diesem feuchten Verlies.
Was bezwecken die Römer mit der Folter, die ihm nun bevorsteht? Sie brauchen kein Geständnis mehr, er muss niemanden verraten, der Kampf ist endgültig vorbei. Die Juden liegen am Boden, zertreten, geschwächt, gedemütigt. Für die Römer hat er schlicht auf der falschen Seite gestanden, er hat den Aufstand befeuert wie kein anderer außer Bar Kochba selbst. Doch der ist in Betar gefallen; die eine Symbolfigur des jüdischen Widerstandes ist also vernichtet, vernichtet auch das Schwert, das sich gegen Rom erhob.
Doch der Geist, der diesen Widerstand gebar, aus dem er sich speiste, lebt noch.Und dieser Geist hat einen Namen: Rabbi Akiba. Gefangen zwar, gedemütigt, dahin vegitierend in diesem feuchten Keller, aber immer noch wach, ungebrochen, ein möglicher Funke für neuen Widerstand und neue Erhebung. Die Römer können gar nicht anders, als auch ihn zu richten, seine Identität auszulöschen, wenn sie den jüdischen Widerstand ein für alle Mal aus der Welt schaffen wollen.
Und das wollen sie, das muss Kaiser Hadrian wollen, einen endgültigen Schlussstrich unter die Unruhe ziehen, welche die Juden mit ihrem Aufstand ins Imperium trugen. Zumal dieses Volk ihm mit der zweiten Erhebung in Judäa einen dicken Strich durch seine Rechnung machte, als Friedenskaiser in die Geschichte einzugehen. Und wer steckte hinter all dem? Wer hatte mit seiner Entscheidung, Bar Kochba als den Messias anzuerkennen, ganz wesentlich den Widerstand angefacht, obwohl dieser nach menschlichem Ermessen zum Scheitern verurteilt war? Wer hatte all die ausgedehnten Reisen unternommen, die jüdischen Gemeinden in Syrakus, Karthago, Rom, Athen und Ephesus bis hinab nach Antiochia und Mesopotamien aufgesucht und heimlich für den Aufstand gegen Rom geworben? Er selbst war es gewesen, Rabbi Akiba.
Zugegeben, er war in der letzten Phase seines Lebens, was den Kampf gegen die römische Besatzung anging, sehr unbeugsam, hatte den Bar Kochba schon früh als den Messias anerkannt und rote Linien gezogen, die die Römer und gemäßigten Juden nicht überschreiten durften. Doch niemand solle einmal sagen, er habe nicht versucht, den militärischen Konflikt mit Rom zu verhindern; er hat mit den Besatzern gesprochen, bis zum Kaiser hinauf, er ist bei Quintus Tineus Rufus, dem ehemaligen römischen Präfekten Judäas, mit dem ihn einst eine Hassliebe verband, ein- und ausgegangen und hat mit ihm über die Thora diskutiert. Gewiss, es war zwischen ihnen zu erregten Auseinandersetzungen gekommen, der grobe, ungehobelte, aber bauernschlaue Militär hatte sich oft einen Spaß daraus gemacht, ihn mit dem Rücken an die Wand zu drängen. Immer wieder machte er sich über seine, Akibas, penible Art lustig, jedes Zeichen und jede Verzierung im Text der Thora ernst zu nehmen und zu interpretieren. Diese Arbeitsweise beruhte auf seiner Grundüberzeugung, dass Jahwe die Thora dem Moses auf dem Berg Sinai eigenhändig übergeben hatte, und deshalb auch jeder Buchstabe und jede kleinste Verzierung von Bedeutung sei und bei der Interpretation berücksichtigt werden müsse.
Diese seine Überzeugung war auch bei den Lehrern an der Hochschule in Jawne nicht unumstritten, obwohl seine Autorität und sein Ruf als Geistlicher und Wissenschaftler sowohl bei Juden als auch bei Römern außer Frage stand. Seine Gegner, insbesondere die Rabbinen Jochanaan, Jischmael und Joshua ben Chananja, vertraten die entgegengesetzte These, dass die Heilige Schrift nämlich die Sprache der Menschen spreche und deshalb nicht jeder Buchstabe und jedes Zeichen einer gesonderten Interpretation bedurften.
Quintus Tineus Rufus nun, der grobschlächtige Römer und Machtmensch, machte sich die letzte These zu eigen, und so kam es des öfteren zu heftigem Streit zwischen ihnen, denn keiner von beiden wollte dem anderen nachgeben. Eines solchen Tages erinnerte sich Rabbi Akiba noch deutlich, und sein Gesicht verzog sich zu einem verklärten Schmunzeln, als er jetzt daran dachte. Der Präfekt war an diesem Tage außer sich über die Hartnäckigkeit seines Gesprächspartners. Schwer atmend stapfte er im Audienzzimmer seiner Residenz auf und ab, mit breitem, federndem Schritt, das grobe Gesicht vom Zorn errötet, fassungslos, dass ihm, dem ersten Mann der Provinz Judäa, ein Jude so frech zu widersprechen wagte. Plötzlich trat der Römer ganz nah an ihn heran, so dass er ganz deutlich die Ausdünstungen von dessen Körper spürte. Seine Augen, in denen ein Feuer aus Empörung, Arroganz, aber auch heimlicher Hochachtung loderte, fixierten das bärtige Gesicht des Rabbi, und bedrohlich leise kamen die Worte aus seinem Mund.
„Weißt du Jud' denn überhaupt, warum ich in dieser lausigen Provinz bin?“
Er machte eine wohldurchdachte Pause, bevor er fortfuhr. „Weil es hier immer noch zu viele von euch gibt, die sich gegen Rom erheben wollen. Doch ihr Juden seid, wie ich zugeben muss, keine dummen Bauerntölpel wie die Barbaren an unserer Nordgrenze, ihr seid schlau, und man muss sehr achtgeben, dass ihr nicht aus dem Ruder lauft. Ich kenne eine Menge römischer Politiker und Militärs, die sagen, man hätte euch damals im ersten Krieg viel wirksamer bekämpfen müssen, euch von dieser palästinensischen Erde ganz vertilgen sollen, damit ihr in aller Zukunft keinen Schaden mehr anrichtet und das Imperium ins Wanken bringt.“
Und nach kurzer Überlegung presste er zwischen den Zähnen hervor: „Ihr Juden könnt von Glück reden, dass es mich gibt, der noch bereit ist, zwischen Römern und Juden zu vermitteln. Aber auch meine Geduld hat Grenzen, und ich rate euch dringend, keine weitere Erhebung gegen Rom anzuzetteln. Dann wird meine Antwort sehr heftig sein.“
Der Präfekt sah seinem Gast scharf in die Augen; er spürte wohl, dass er ihn nicht einzuschüchtern vermochte. So wandte er sich denn von ihm ab und nahm seine Wanderung durch den Raum wieder auf.
„Dabei habt ihr doch durchaus gute und gemäßigte Leute, die zu einer vernünftigen Politik fähig sind. Wie hieß doch gleich das frühere Oberhaupt eurer Hochschule in Jawne zu Zeiten von Titus und Domitian?“
Quintus Tineus Rufus kramte in seinem Gedächtnis, und noch bevor Akiba antworten konnte, war ihm der Name schon eingefallen.
„Gamaliel, richtig. Mit dem konnte man vernünftig reden, habe ich mir sagen lassen, und ohne Umschweife auf den Punkt kommen; der verfolgte ein klares Ziel und war zu Kompromissen bereit. Vor allem aber soll er schlau gewesen sein. Er hätte ein Römer werden können, aber er war eben auch ein typischer Jud', hat das Angebot des Kaisers abgelehnt, römischer Staatsbürger zu werden und den Goldenen Ring des Zweiten Römischen Adels zu empfangen. Verstehe einer euch Juden.“
Der Präfekt war inzwischen stehen geblieben und wandte das Gesicht wieder seinem Gast zu: „Nehmt meine Gutmütigkeit nicht für Schwäche“, warnte er nochmals. „Ich werde mit harter Hand regieren, denn wenn ich euch nachgäbe, würdet ihr schon bald wieder euer freches Haupt gegen Rom erheben und unsere ausgestreckte Hand ausschlagen.“
Für einen kurzen Augenblick zuckte ein flüchtiger Gedanke durch Akibas Hirn. Könnte der ehemalige Präfekt ihm in seiner jetzigen Lage vielleicht noch helfen? Doch sofort erkannte er die Unsinnigkeit solcher Überlegungen. Sein Schicksal würde in Rom entschieden, von Kaiser Hadrian persönlich, und nicht hier in der Provinz.
Und schon riss das Gedankenkarussell den erschöpften Alten zum nächsten Ereignis, das er nun ganz deutlich vor seinem inneren Auge sah. Denn nicht nur sein Verhältnis zur römischen Besatzungsmacht war in den letzten Jahren problematisch gewesen, sondern auch jenes zu seinem Kollegen an der Hochschule in Jawne, insbesondere nach dem Ausbruch des Bar-Kochba-Aufstandes und seiner eindeutigen Parteinahme für den militärischen Kampf gegen Rom. Nachdem sich die Niederlage abzeichnete, waren seine Gegner stärker geworden und die permanenten Spannungen hatten sich noch verschärft.
In Betar tagte der Hohe Rat der Juden und beriet über ein letztes Angebot des römischen Feldherrn Severus zu einer Kapitulation der Aufständischen. Es ging hoch her in dieser denkwürdigen Sitzung so kurz vor dem Ende, erinnerte sich Akiba. Der Wortführer der Gemäßigten, Rabbi Jochanaan, hatte ihn wegen seiner einseitigen, antirömischen Rhetorik scharf angegriffen. Die anderen Völker hätten sich längst in das Imperium Romanum integriert, da könne doch ein kleines Volk wie das der Juden nicht einen solchen hartnäckigen Widerstand leisten, einen Kampf auf Leben und Tod, der schon unzählige Opfer gefordert hätte und Judäa über lange Zeit in der Bedeutungslosigkeit versinken ließe. Ganz abgesehen davon, dass er die Juden massenhaft zu Sklaven mache. Der Preis für die Freiheit sei viel zu hoch, als dass man den Widerstand aufrecht erhalten könne. Die Juden müssten das Kapitulationsangebot der Römer annehmen.
Um dem Tumult seiner Anhänger, der diesen Worten folgte, zu begegnen, hatte er sich zu Wort gemeldet. Er, der von Vielen wie ein Heiliger verehrt wurde, der sich für den Kampf entschieden und Bar Kochba schon früh als den Messias anerkannt hatte und dies auch heute noch tat. Entschieden, feurig hielt er dem Gegenspieler unter dem Beifall seiner Anhänger entgegen, Jahwe sei mächtiger als alle Götter der Römer zusammen. Wir, die Juden, seien das auserwählte Volk, das die Zeiten überdauert habe. Jerusalem wird noch stehen, wenn Rom längst zu Asche zerfallen ist. Niemals werde sich das Volk der Juden einem fremden Herrscher beugen.
Empört hatte ihn Joshua ben Chananja nach diesen Worten unterbrochen: „Wer wollte deinen Worten widersprechen, verehrter Meister“, rief er, „aber bist du denn blind? Gehe zur Stadtmauer und blicke in die Ebene Saran! Sie ist vollständig bedeckt von den Zelten der römischen Legionäre. Die Niederlage der Juden ist so sicher wie Jahwe unser Gott ist. Unsere Brüder und Schwestern da draußen werden massakriert oder in die Sklaverei getrieben. Gegen diese Tatsachen helfen nun, im Angesicht unserer bitteren Niederlage, keine noch so hehren Worte mehr.“
Jahwe sei allmächtig, wenn er nur wolle, werde die Erde die Römer verschlingen, hatte er, Akiba, den Gemäßigten entgegengeschleudert, den Zauderern, die dem Glauben und seinen heiligen Überzeugungen nur die nackten Tatsachen entgegenhielten, dass die Römer dieses Mal den jüdischen Staat endgültig zerschlagen, Jerusalem mit der heidnischen Stadt Aelia Capitolina überbauen und das Volk der Juden in alle Welt zerstreuen würden. Und, hatte er Chananja entschieden entgegnet, selbst wenn alles so käme, wie dieser prophezeie, werden die Juden ihren Glauben bewahren und einst nach Jerusalem zurückkehren. Werft euch, statt zu zweifeln und wehzuklagen, in die ausgebreitete Arme des Herrn!
Seine Anhänger hatten ihm zugejubelt, Bar Kochba aber schlug das letzte Friedensangebot der Römer aus und die Gemäßigten unter den Verteidigern der Festung Betar mussten sich geschlagen geben. Das Ende war bekannt.
Und doch, trotz dieses Widerstandes in den eigenen Reihen und der vollständigen Niederlage des Aufstandes war seine konsequente Haltung richtig gewesen. Das Judentum ohne Staat, nur mit dem geistigen Gebäude der Thora im Mittelpunkt, wäre auf Dauer nicht überlebensfähig. Da mochten seine Kollegen Großdoktoren Jochanan ben Sakkai und Gamaliel noch so viele Argumente hervorgekramt haben, dauerhaftes Judentum ohne Staat, ohne Polizei und Arme, ohne Verwaltung und Gerichtsbarkeit konnte es nicht geben.
Solche Gedanken hatten Kaiser Hadrian natürlich nicht gefallen, denn sie waren nur gegen die römische Macht durchzusetzen. Und das bedeutete Widerstand und Erhebung, verbunden mit der potentiellen Möglichkeit, dass andere Völker des Imperiums Romanum von diesem aufrührerischen Geist der Eigenständigkeit und Freiheit angesteckt würden.
Vielleicht hätte er das Gericht der Römer umgehen können, indem er sich nach der Niederlage Bar Kochbas zurückgezogen und den Judenerlass Hadrians, der das Lehren der Thora verbot, für sich akzeptiert hätte. Doch das würde nicht seinem Wesen entsprochen haben. Man dürfe nicht nur existieren, hatte er immer wieder gepredigt, man müsse etwas tun und seiner Bestimmung folgen. Und seine Bestimmung war es, die Thora, das geistige Judentum, zu lehren. Er hatte sich trotz strengsten Verbots nicht davon abhalten lassen, was schließlich zu seiner Verhaftung führte. Er hatte die Römer bewusst provoziert.
Und außerdem: Neun Doktoren, mit denen er im Verteidigungsrat in Betar gesessen hatte, waren auf Befehl Roms hingerichtet worden. Er selbst war als ihr Oberhaupt und geistiger Anstifter allen Übels dazu bestimmt worden, diesen neun Hinrichtungen beizuwohnen. Er sollte der Letzte sein. Waren seine Kameraden schon zu Märtyrern geworden, wie konnte er da nicht den Tod erleiden.
War auch diese Entscheidung also richtig gewesen? Ja, und immer wieder ja, er war seinen Weg gegangen, aufrecht und in fester Überzeugung, und er würde ihn auch weitergehen bis zum bitteren Ende, er konnte nicht anders. Wenn auch die eigentlichen körperlichen Qualen noch bevorstanden. Er hatte darum gebeten, dass seine Schüler der Folter beiwohnen durften, um Zeugnis abzulegen von deiner Standhaftigkeit und Gottestreue. Sie fragten ihn, warum er das alles auf sich nehme, und er hatte ihnen geantwortet, es heiße in der Schrift, du sollst deinen Herrn lieben bis zum Tode, da könne er ihn doch jetzt nicht im Stich lassen.
Nun, Akiba war entschlossen, seinem Weg zu folgen. Und doch konnte er nicht verhindern, dass kalte Angst ihm die Kehle schnürte und sich das bevorstehende Grauen wie ein zäher Schleim lähmend auf Körper und Seele legte. Da gewahrte er den flackernden Schein eines Lichts. War es Zufall oder Absicht, die Römer erlösten ihn von seiner Seelenpein und holten ihn zum Verhör.
Es braucht eine Zeit, bis die römischen Legionäre den uralten Rabbi in die Höllenmaschine eingespannt haben. Sein stummer Blick begegnet denen seiner Schüler. Gleich kommt der entscheidende Augenblick: Wird er den unmenschlichen Qualen widerstehen können, wenn die Eisenspitzen in sein Fleisch eindringen und es in Fetzen vom Körper ziehen? Wird er Jahwe mit seiner ganzen Seele lieben können, auch wenn sie ihm diese Seele rauben? Jetzt ist die Gelegenheit gekommen, es zu beweisen, den Römern, seinen Schülern und Jahwe selbst. Warum sollte er jetzt aufgeben und diese einmalige Gelegenheit ungenutzt lassen?
Im nächsten Augenblick jagt ein Feuersturm durch seinen ganzen Körper und betäubt die Sinne. Bunte Gedankenfetzen flattern in seinem Hirn. War all das, was geschehen ist, es wert, solche unmenschlichen Schmerzen zu erleiden? Gut, wenn er jetzt durchhält, geht er in die Geschichte ein als der Geradlinige, Aufrichtige, der den reinen Glauben nicht nur zu predigen, sondern auch zu leben verstand, als einer, der kein Kleingeist war, der seinen Pfad aus Feigheit verließ.
Doch in den Augen seiner Gegner ist er auch einer, der den Tod Tausender Menschen zu verantworten hat. In diesem qualvollen Zustand des Körpers aber sind die Botschaften nicht mehr klar und eindeutig, alles vermischt sich, verschwimmt, wird komprimiert und zerfällt wieder in einzelne Bruchstücke, die sich überlagern: Berge von Leichen, die Gesichter Ben Sakkais und Gamaliels, furchterregende Fratzen römischer Legionäre. Aber nein, nur jetzt nicht aufgeben, alles ist nur dazu bestimmt, ihn ins Wanken zu bringen.
In einem letzten Willensakt rafft sich Rabbi Akiba noch einmal auf. Alles war richtig und gut gewesen, was er gemacht hatte, es war nicht alles umsonst, auch diese Qualen nicht, alles hatte seinen Sinn und formte sich jetzt am Ende zu einem guten Ganzen. Und richtig, zwischen den Feuerblitzen, die seinen geschundenen Körper durchzuckten, gewahrte er ein helles, gleißendes Licht. Jahwe hatte ihn noch nicht verlassen.
Mit letzter Kraft stöhnte er laut, bäumte sich auf und schrie das Schma Jisrael, das jüdische Glaubensbekenntnis, seinen Folterern entgegen. Mit den beide Worten“Jahwe Echad“, das Wesen ist Gott, das Wesen ist einzig, sank er zu Boden. Jahwe war ein streitbarer Gott, doch er konnte auch gütig sein. Die Schmerzen überstiegen das Maß, das ein Mensch ertragen konnte. Und so nahm er seinen treuen Diener zu sich, den unbequemen Streiter, der zum Schluss keine Kompromisse mehr kannte, sondern nur das reine, unbefleckte Judentum. Und der damit doch so schwere Schuld auf sich geladen hatte.
Der Tod Kaiser Hadrians, der den Bar-Kochba-Aufstand niederschlug
Tibur, dreißig Kilometer nordöstlich von Rom, im Sommer des Jahres 138 unserer Zeitrechnung. Nur weg aus diesem hektischen, lärmigen, vor allem aber stickigen Rom, wo man in den Sommermonaten kaum atmen konnte. Denn Hektik hatte er, Kaiser Hadrian, auf seinen ausgedehnten Reisen genug. Wenn er schon einmal in der Hauptstadt weilte, wollte er wenigstens Ruhe haben, Ruhe und etwas Beschaulichkeit. Und er wollte durchatmen können.
So war es zum Bau der Sommerresidenz in Tibur gekommen. Ganz zurückziehen konnte er sich allerdings auch hier nicht, denn die Politik machte keine Pause, und Regierungsgeschäfte mussten zu jeder Zeit erledigt werden. Also ließ Hadrian vor den Toren Roms ein repräsentatives Anwesen mit Theater, Stadion, Bibliotheken und einem prächtigen Palast, wo auch Gericht gehalten wurde, errichten. Die Außenanlagen waren von zahlreichen Brunnen, Wasserbecken, Teichen und Wasserläufen geprägt, denn der Kaiser liebte das Wasser. Dies war nicht nur seinem ästhetischen Empfinden geschuldet, sondern auch seinem Bestreben, ein gesundes Mikroklima mit guter Luft und erträglichen Temperaturen zu schaffen.
Nur die zahlreichen Bediensteten störten ihn bei der Arbeit, denn er arbeitete viel, aber sie störten ihn auch in seiner freien Zeit. Überall liefen sie geschäftig umher und verursachten Lärm. Das Ergebnis ihrer Arbeit allerdings, das gab er unumwunden zu, war die perfekte Organisation der Kaiserresidenz. Und so überlegte er, ob man das gleiche Ergebnis auch ohne den störenden Lärm erreichen könne. Da kam ihm eine geniale Idee. Man müsste das gigantische Kellerlabyrinth so ausbauen, dass alle Dienstleistungen geräuschlos unter der Erde erfolgen konnten. Gesagt, getan. Fortan wimmelte es nur im Unsichtbaren und Unhörbaren, wie von Geisterhand, und doch geschah alles, wie er es wünschte, und gestört fühlte er sich auch nicht mehr. Wenn er einmal ganz für sich sein wollte, um dem politischen Alltag wenigstens für Stunden zu entfliehen, besuchte er seine Privatvilla, die abgesondert auf einer Insel in einem künstlichen See lag.
Viel zu selten hatte er dieses Paradies in Tibur bisher genutzt, zu oft war er unterwegs gewesen und zu zögerlich war es errichtet worden. Das bedauerte er sehr, denn jetzt war es zu spät. Er war todkrank, und seine Zeit lief unaufhaltsam ab. Die Tage wurden zur Qual und die Nächte, in denen er keinen Schlaf fand, quälten ihn noch mehr. Selbst die im Vergleich zu Rom bessere und kühlere Luft brachte keine Linderung mehr. Doch was konnte ihm überhaupt noch eine Linderung seiner Schmerzen bringen? Da kam ihm der rettende Gedanke: Baiae, seine Sommerresidenz direkt am Golf von Neapel, dieses einmalige Refugium, wo immer ein kühler Luftzug vom Meer her wehte. Und er gab Befehl, nach Baiae aufzubrechen. Eines ahnte er in diesem Augenblick genau. Dies war seine letzte Station auf dieser Erde, bevor er ein Gott wurde. Er würde niemals mehr nach Rom und Tibur zurückkehren.
Es gibt Orte auf dieser Welt, die scheint der Herrgott nur zu einem Zwecke geschaffen zu haben, nämlich den Menschen einen flüchtigen Blick ins Paradies zu gewähren. Einmal an diesen Orten einen Sonnenaufgang zu erleben, verleiht auch dem Normalsterblichen einem Hauch von Exklusivität und Unsterblichkeit, vor allem aber eine gewisse Gelassenheit, die Widrigkeiten des Lebens zu ertragen.
Einer dieser Orte war Baiae zur frühen römischen Kaiserzeit, ein Juwel am Golf von Neapel und berühmt für sein mildes Klima und den einzigartigen Panoramablick, der bei guter Sicht bis zum geheimnisumwitterten Vesuv reichte. Wenn man sich dem Ort vom Wasser her näherte, fiel der Blick zunächst auf die Marmorpaläste der römischen Hocharistokratie am Ufer, dann auf die ausgedehnten Gärten und Badeanlagen, Brunnen und Treppen am Hang, immer wieder unterbrochen von weiteren Privatvillen, und schließlich auf den Tempel des Merkur und die Kuppeln der Kaiserthermen, die alles überragten.
Hier, wo immer ein frischer Luftzug vom Meer her wehte, tummelte sich die römische Gesellschaft, wenn die Hitze in Rom unerträglich wurde. Caesar hielt sich in Baiae auf, Neros Gemahlin Poppäa kurte hier, und der Kaiser selbst ließ in diesem Ort seine Mutter Agrippina ermorden. Viele Herrscher der frühen Kaiserzeit hatten in Baiae ihre Villen: Claudius, Nero, Caligula und jetzt, im Jahre 138 n. Chr., der gegenwärtige Pontifex maximus, Kaiser Hadrian. Auch ihn hatte es in den letzten Wochen seines Lebens aus seiner Villa in Tibur hierher ans kühlende Meer gezogen, in der Hoffnung auf Linderung der Qualen, die ihm seine schwere Krankheit verursachte. In der Hoffnung auch, dass es ihm wenigstens hier vergönnt sei zu sterben, dass die Götter so gnädig wären, ihn, den lebensmüden Kaiser, vom Leben zu erlösen, das schon längst kein selbstbestimmtes mehr war.
„Warum darf ich nicht sterben?“
Dieser schauerliche Satz aus röchelnder Kehle klingt nach, erfüllt das Halbdunkel des ganzen Raumes und setzt sich in jedem Winkel fest, unheilvoll, die Welt anklagend. Die Hand noch mit schwindender Kraft umklammert, die ihm soeben den Dolch entwand, den er sich in die Brust stoßen wollte, sinkt der Kaiser erschöpft in die Kissen. Auch dieser Versuch ist also gescheitert; der Wille war stark, dies zu tun, diesem qualvollen, nutzlosen Leben ein Ende zu setzen und diesen fürchterlichen Schmerzen zu entkommen. Doch er war schon zu schwach gewesen, seine Kraft war aufgebraucht.
Da liegt er nun, im zweiundsechzigsten Jahr seines Lebens, von Schweiß überströmt, ein Schatten einstiger Anmut und Eleganz, die legendäre Körperkraft und Ausdauer, die er im Felde und bei der Jagd erworben hatte, längst versiegt. Der Kaiser ringt nach Luft und starrt machtlos auf die Hand mit dem ihm eben entwundenen Dolch, die sich seinem Griff nun vorsichtig entzieht.
Es ist seltsam, ein Wink von ihm, ein Wort nur, und jedermann im Reich könnte auf seinen Befehl hin sterben. Doch für ihn selbst gilt das nicht. Auf niemandem am Hofe kann er sich noch verlassen, keiner will auf sein Wort hören, keiner seinem Befehl folgen und Hand an den Kaiser legen. Allen voran sein Adoptivsohn und Nachfolger, der brave, korrekte und gutmütige Antoninus Pius, der in seinem Auftrag die Amtsgeschäfte in Rom führt. Der achtet streng darauf, dass der Pontifex eines natürlichen Todes stirbt, denn auch nur der leiseste Verdacht, er habe Hand an den amtierenden Kaiser gelegt, könnte ihn als Vatermörder denunzieren und wäre somit tödlich für seine weitere Karriere. Hadrian sieht Antoninus schon vor seinem geistigen Auge nach diesem nächtlichen Zwischenfall an sein Krankenlager eilen, sieht dessen vorwurfsvollen Blick, den er immer weniger ertragen kann.
Alle Versuche, seinem qualvollen Leben ein Ende zu setzen, sind mit dem heutigen Tage endgültig gescheitert. Der Sklave, dem er befahl, ihm das Schwert ins Herz zu stoßen, floh, weil er sich dieser Tat nicht schuldig machen wollte. Auch sein Leibarzt, den er um den Gnadenstoß bat, gehorchte ihm nicht und suchte stattdessen den Freitod. Gab es denn wirklich niemanden am ganzen Hofe, der Erbarmen mit ihm hatte?
Wie er mit dem greisen Stoiker Euphrates, der ihn, den Kaiser, kürzlich um Erlaubnis bat, den Schierlingsbecher trinken zu dürfen, um seinem Leben ein Ende zu setzen. Er erteilte ihm die Erlaubnis ohne Zögern. Nur er selbst durfte eine solche Gnade nicht erfahren. War das der Preis für dieses Amt, für diese Machtfülle, der Herrscher über alle Völker zu sein von Britannien bis zum Euphrat, von Dakien bis zum Nil? Forderten die Götter damit ihren Tribut für all die Gunst, die sie ihm in seinem Leben erwiesen hatten?
Der Kaiser klammerte sich unwillkürlich an diesen Gedanken. Eigentümlich, so dachte er bei sich, obwohl er doch soeben eine herbe Enttäuschung erfahren hatte, die schlimmste Enttäuschung seines Lebens, die bittere Erkenntnis nämlich, nicht sterben zu dürfen, und diese Erkenntnis ihn bis an die Grenze belastete und aufwühlte, fühlte er sich doch in diesem Augenblick so frei und gut wie lange nicht mehr. Auch die permanenten Schmerzen schienen ihm in diesem Augenblick nichts anhaben zu können. Mit seltener Klarheit trat ihm noch einmal sein Leben vor Augen, und in der instinktiven Angst, ein solcher Augenblick werde niemals wiederkehren, suchte er eine Ordnung in die wirren Bilder zu bringen, die ihn nun überfluteten, und einen Sinn darin zu finden.
War dieses entsetzliche Nichtsterbenkönnen etwa die Folge des Fluches, den sein neunzigjähriger Schwager Servianus gegen ihn ausgestoßen hatte, bevor er gemeinsam mit seinem Neffen Fuscus hingerichtet wurde? Der Kaiser Hadrian, der ihn zum Tode verurteilte, sollte nicht sterben dürfen. Wie dem auch sei, die Sache mit seinem Schwager lag ihm im Magen, insbesondere deshalb, weil der Senat diesen Befehl missbilligt hatte, gerade jetzt zum Ende seiner Amtszeit, wo er sich doch stets um gute Beziehungen zum Senat bemüht hatte.
Versonnen ließ der Princeps seine Gedanken schweifen, sah vor seinem geistigen Auge die große Halle des Friedenstempels, wo die Senatssitzungen stattfanden: dieser gewaltige, ehrwürdige Ort, der Bedeutung Roms und des Kaisers durchaus angemessen. Überall, wohin man blickte, erinnerten riesige Skulpturen und Gemälde an Roms geistige Größe, an den Wänden standen die Bildnisse der großen Denker, bildenden Künstler und Dichter, die neben den Feldherren Rom zu dem gemacht hatten, was es jetzt war: das mächtigste Imperium aller Zeiten. Und jeder römische Senator, so war es der Brauch, huldigte vor den Sitzungen der Skulptur der Friedensgöttin und brachte ihr ein Opfer dar.
Doch der Friedenstempel war in der kalten Jahreszeit auch ein unwirtlicher Ort. Der Kaiser sah sie vor sich, die Berufenen Väter des Senats, allen voran die verwöhnten Aristokraten, wie sie sich in ihren Purpurmänteln und Festkleidern um die Kohlebecken scharten, um ihre von der Kälte erstarrten Finger zu wärmen. Denn die Sitzungen begannen oft schon früh am Morgen, weil die Beschlüsse nur dann Gesetzeskraft erlangten, wenn sie zwischen Sonnenaufgang und -untergang gefasst worden waren.
Mürrisch und gereizt durch solche Widrigkeiten der Natur mochte, so war oft sein Eindruck gewesen, mancher Senator die kaiserlichen Gesetzesvorhaben ungnädig behandelt und Widerstand geleistet haben. Doch auch sie mussten, wenn auch nur zähneknirschend anerkennen, dass er ihnen mehr Freiheiten gewährt hatte als die meisten seiner Vorgänger. Wenn er nur an Nero und Domitian dachte. Es war ein verdammt riskantes Spiel gewesen, die Machtbalance zwischen Kaiser und Senat aufrecht zu erhalten, den eines war allen Senatoren gemein: Sie hassten nichts mehr, als dass man ihren Handlungsspielraum einschränkte und sie den Eindruck gewannen, sie seien überlistet worden und hätten nicht selbst entschieden, sondern in Wahrheit der Princeps im Palatin.
Wenn er in Rom residierte, besuchte er regelmäßig die Senatssitzungen und hatte auch persönlichen Kontakt zu Senatoren, denen er, wenn nötig, finanziell großzügig unter die Arme griff. Dass er sich in politischen Angelegenheiten lieber von seinen engsten Vertrauten beraten ließ als vom Senat, das konnten einem die Herren nun wirklich nicht verübeln.
Wenn dieses Verhältnis zum Senat nur nicht schon zu Beginn seiner Herrschaft durch zwei Ereignisse belastet gewesen wäre. Zum einen wollten die Gerüchte nicht verstummen, Trajan habe ihn auf seinem Sterbebett gar nicht oder zumindest nicht aus freiem Willen adoptiert und so zu seinem Nachfolger auf dem Kaiserthron bestimmt. Obwohl er dies selbst für ein böses Gerücht hielt und seine Gattin Sabina, Plotina, die Gattin Trajans, und sein früherer Vormund Attianus, die neben des Kaisers Leibdiener am Sterbebett die einzigen Zeugen gewesen sein sollen, ihm hoch und heilig versicherten, Trajan habe ihn aus freiem Willen und im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte als Sohn und Nachfolger bestimmt, gab es doch immerhin die umstrittene Tatsache, dass Plotina und nicht Trajan das Adoptionsdokument unterschrieben und an den Senat geschickt hatte. Der Fakt, dass Trajans Leibdiener, ein junger und gesunder Mann, nur wenige Tage nach des Kaisers Ableben selbst auf ungeklärte Weise zu Tode kam, fachte die Gerüchteküche weiter an.
Nun, wie immer man diese Angelegenheit auch interpretieren mochte, als die Unfähigkeit des sterbenden Kaisers Trajan, seine Hand zur Unterschrift zu führen, oder als geschickten Schachzug der beiden anwesenden Frauen, die dem geliebten Verwandten und Ehemann Hadrianus diese höchste Ehre gegen den Willen des Kaisers angedeihen lassen wollten, die Sache war nicht mehr aufzuklären. Beide Frauen hatte ihr Geheimnis ins Grab genommen.