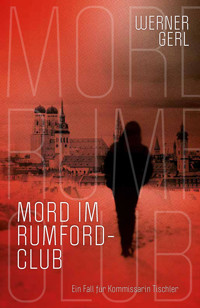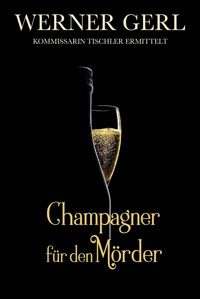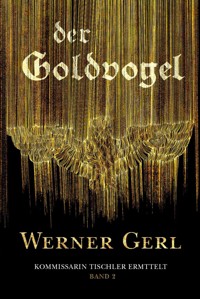2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Sepp Holm ist ein gestandener Bayer und Kryptologe, also Fachmann für Rätsel jeglicher Art. Er konnte alle lösen, nur eines nicht: Am Tag vor Weihnachten verschwand seine Freundin Eleonore. Auch ein halbes Jahr später ist Holm keinen Schritt weiter. Als ein Freund ermordet wird, muss Holm den spektakulären Fall um die schwarze Perle lösen. Dabei lernt er Kommissar Strater und Dr. Johanna Watten kennen, deren Einliegerwohnung zu seinem Münchner Domizil wird. Mit ihrer Hilfe findet er eine Spur von Eleonore. Und diese führt ihn zu einem fabelhaften Kriegsschatz aus dem 19. Jahrhundert und einem mächtigen Gegner... Der bayerische Sherlock Holmes löst seine Fälle dank seiner brillanten Kombinations- und Beobachtungsgabe und düpiert dabei ein ums andere Mal die Polizei. Dabei bildet Holm mit Dr. Johanna Watten ein spannungsreiches Duo: der lederhosentragende Niederbayer vom Land trifft auf die mondäne Kunsthistorikerin.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Werner Gerl
Das Geheimnis der weißen Soldaten
Ein Fall für den bayerischen Sherlock Holmes
Inhaltsverzeichnis
Prolog
1. Die schwarze Perle
2. Das Testament des Generals
3. Der gehörnte Künstler
4. Das Duell der Hirschen
5. Der Buckelwal-Flüsterer
6. Die Leiche ohne Kleidung
7. Das Grab der Geliebten
8. Enzianblüten
Impressum
Werner Gerl
Das Geheimnis der weißen Soldaten
Ein Fall für den bayerischen Sherlock Holmes
Prolog
Es grenzte an ein Wunder, aber das Testament hatte all die stürmischen Jahre überlebt. Auch wenn Eleonore lediglich einen Ausdruck vor sich liegen hatte, bildete sie sich ein, den Mief alter Dokumente zu riechen. Natürlich hätte sie lieber das Original nach Hause genommen, doch das Archiv wollte es nicht herausrücken. Die bürokratischen Regeln ließen das nicht zu.
Obwohl bewandert in den Handschriften des 19. Jahrhunderts, stellte das Testament eine Herausforderung dar. General von Kehlenstein hatte es selbst verfasst, allerdings zu einer Zeit, als ihn der Krebs schon von innen aufgefressen hatte. So war die Schrift zittrig, fahrig, an manchen Stellen krakelig, ja nahezu unlesbar. Eleonore begann mit der Transkription. Sie legte das Faksimile auf ihren Schreibtisch neben den Laptop. Mühsam kämpfte sie sich Zeile für Zeile durch den Text. Verwischte oder unkenntliche Buchstaben markierte sie mit einem X.
Für die erste von fünf Seiten brauchte sie fast eine Stunde. Die Mühe hatte sich allerdings gelohnt, es traten keinerlei Verständnisschwierigkeiten auf. Jedes unleserliche Wort konnte durch den Kontext erschlossen werden. Freilich stand in dieser Ouvertüre nichts von Belang, zumindest nichts, was sie nicht schon wusste. Der General erging sich in Beschimpfungen seiner Söhne, die er wahlweise als Schmarotzer, Blutsauger oder Taugenichtse bezeichnete. Hinweise auf den Schatz – oder wenigstens dessen Existenz - fand Eleonore nicht, hatte das aber auch nicht erwartet. Denn diese mussten subtil, versteckt, verklausuliert sein, zumindest nicht für jedermann ersichtlich.
Auf der zweiten Seite stolperte sie schnell über einen Satz. „Mein größtes Geheimnis hat Mira ins Grab genommen.“ Eleonore war wie elektrisiert. Wer war diese Mira? Eine Geliebte? Eine Dienstbotin? Möglicherweise auch eine Stute? Der General war ein Pferdenarr und gab diesen Tieren zeit seines Lebens den Vorzug vor Menschen. Eine Spur. Das war eine Spur. Eleonore fühlte, wie es in ihr pulsierte, wie sie in Hochstimmung geriet.
In diesem Moment klingelte es an der Tür. Ausgerechnet jetzt. Sie war in einem Flow und wollte nicht gestört werden. Deshalb beschloss sie, nicht zu öffnen. Doch der Besucher war hartnäckig und hörte nicht auf zu läuten.
Genervt stand sie auf und ging zur Tür. Kaum hatte sie diese geöffnet, zuckte sie zusammen. Wer stand hier vor ihr? Ein Penner? Der Mann trug einen schäbigen Mantel und zerrissene Hosen und stank wie eine Horde Iltisse. Offensichtlich war er einfach durch das Gartentor gegangen. Sie wies ihn zurecht, das sei Hausfriedensbruch. Sofort hob der Obdachlose entschuldigend die Hände und trat zwei Schritte zurück. Sie fühlte sich dennoch gestört, ja belästigt. „Morgen ist Weihnachten, Lady, und ich würde mir gern eine warme Mahlzeit kaufen.“
Oder eine Flasche Schnaps, die macht auch warm, dachte sich Eleonore. Kurzerhand griff sie zu ihrer Handtasche, die an der Garderobe hing, nahm ihr Portemonnaie heraus und gab dem Obdachlosenlosen einen Zehner. Dann wünschte sie ihm frohe Weihnachten und verschloss die Tür.
Schnell ging sie in ihr Büro zurück. Das Testament, all ihre Gedanken kreisten um das Testament. War der General doch kein Aufschneider? Sie würde keine Ruhe geben, bevor sie nicht das komplette Dokument entschlüsselt hätte. Mit Schwung ging sie in ihr Zimmer und erstarrte plötzlich zur Salzsäule. Ein Mann saß in ihrem Stuhl und grinste sie an.
„Hallo Ellie, lange nicht mehr gesehen.“ Seine Stimme war noch genauso rau wie früher. Plötzlich wurde die Tür hinter ihr geschlossen. Er war nicht allein gekommen. Eleonore wurde schwarz vor Augen, aber sie fing sich schnell wieder. Sie hatte immer befürchtet, dass er sie finden würde.
„Du hast etwas, das mir gehört“, sagte er und ging auf Eleonore zu. Mit der rechten Hand griff er ihr unter den Unterkiefer. „Und das möchte ich wieder haben.“
1. Die schwarze Perle
Der Fasan glotzte wie zu seinen besten Lebzeiten, doch seine Brust war zerfetzt, die Federn rund um das Einschussloch fransig und verbrannt. Ein viel zu großes Projektil hatte ihn erlegt. Es ragte ein wenig heraus, ein besonders morbider Scherz. Denn wenn man auf die Kugel drückte, begann der Vogel laut und heiser zu krächzen und die zerrupften Schwanzfedern wackelten. Der Feldhase dagegen war der Länge nach halbiert, allerdings alles andere als fachmännisch. Am Bauch hingen einige Gedärme heraus, flankiert von ein paar Rippen. Allein dieser Anblick genügte, um bei den meisten Betrachtern einen unheiligen Ekel zu erzeugen, gepaart mit dem Charme des Todes und des Verfalls. Mich hatte „Vanitas IV“ vom ersten Moment an fasziniert.
Das Bild bestand ausschließlich aus echten Materialien. Ob Moose, Farne, Gräser, Maiskolben, alle waren sie vom Künstler selbst gesammelt worden. Sogar der Granatapfel stammte aus seinem Garten. Er war in der Mitte so angeschnitten, dass das Fruchtfleisch wie eine klaffende Wunde aussah. Allerdings roch das Kunstwerk nicht nach Natur oder gar nach Waldesfrische, sondern nach einem ganzen Chemiebaukasten. Lösungsmittel, Lacke, Kleber waren nötig, um die einzelnen Bausteine zu konservieren und zu befestigen. Es sollte schließlich – Vergänglichkeit hin oder her – nicht gleich beim Transport in sämtliche Atome zerfallen.
Zumal ein üppiger Preis zu erwarten war, denn bereits das Grundgebot lag bei 50.000 Euro. Die Bilder des mysteriösen Künstlers Calu waren seit einigen Jahren auf dem Kunstmarkt en vogue und galten als glänzende Wertanlage, auch wenn es bei einigen seiner Werke bereits Zerfallserscheinungen gegeben hatte.
Die Versteigerung des Bilds markierte den perfekten Schlusspunkt der Auktion. Es oblag mir als Expertin, ein paar einführende Worte zu verlieren. Als ich meinen Vortrag anstimmte, kam noch ein Mann herein.
Er fiel sofort auf, passte sein Dresscode doch so überhaupt nicht zu dieser Auktion. Ich gebe zu, sein Anblick irritierte mich, brachte mich allerdings nicht aus dem Konzept. Ich dachte mir, jemand sollte ihn aufklären, dass das Oktoberfest erst in drei Monaten begänne. Er vergrub seine Hände in der speckigen Hirschlederhose, die ein Erbstück seines Vaters und damit älter als er selbst war, wie ich später erfuhr. Das weiße Hemd im Landhausstil hatte er bis zu den Ellbogen hochgekrempelt.
Ich redete weiter, hatte aber ein Auge auf den bajuwarischen Spätankömmling. Er hatte eine Meerschaumpfeife im Mund. Allerdings war sie kalt, er kaute nur darauf herum. Mit wachen Augen und leicht gehobenen Augenbrauen blickte er sich um, ohne sich zu setzen. Offensichtlich suchte er jemanden.
Nach meiner Einführung übernahm Heribert Wehrhagen wieder das Zepter. Ich bewegte mich an den Rand des Podests und beobachtete den vermeintlichen Wiesnbesucher. Er setzte sich neben einen dicklichen Mann mit Vollbart, was erstaunte, da mittlerweile zahlreiche Stühle frei waren und man normalerweise nicht neben einem Fremden Platz nimmt. Wenn mich mein Eindruck nicht trog, missfiel es dem Bärtigen, plötzlich einen Nachbarn zu haben. Er spielte mit seinem Smartphone, ein leider nicht unübliches Verhalten in Auktionshäusern, hielt jedoch das Display so, dass der Lederhosenträger keinen Blick darauf werfen konnte.
Die ersten Gebote gingen ein. Schnell war die 100.000 Euro-Marke erreicht. Insgesamt sechs Interessenten überboten sich und trieben den Preis nach oben, was mich mit großer Befriedigung erfüllte, schließlich stand ich nicht nur für die Echtheit des Gemäldes gerade, Calu hatte mich persönlich auserwählt, den Verkauf zu regeln. Persönlich hieß in diesem Fall allerdings per E-Mail. Niemand wusste, wie der toskanische Künstler aussah. Einmal, es hatte sich ein Problem ergeben, hatten wir wenigstens miteinander telefoniert. Ich sprach fließend Italienisch, hatte jedoch mit seinem starken toskanischen Akzent zu kämpfen.
325.000 Euro waren geboten. Mir wurde fast schwindlig. Der Künstler hatte mir nämlich eine Provision von 10 Prozent der Verkaufssumme versprochen. Für manchen Kunsthistoriker war dies bereits ein Jahreseinkommen. 400.000 bot ein Galerist aus Berlin. Doch seine Konkurrenten ließen nicht locker. Schließlich endete das Wettbieten bei 840.000 Euro. Mir wurde ganz blümerant zumute. Meine Provision hatte schwindelerregende Höhen erreicht. Damit könnte ich mir meinen Traum erfüllen. Ich gebe zu, es ist ein sehr oberflächlicher Traum und ein Kunstliebhaber wie ich könnte auch sein Geld in Kultur investieren. Aber ich wünschte mir nichts sehnlicher als den roten Porsche 911, den ganz klassischen mit Ledersitzen. Endlich konnte ich ihn mir leisten. Genau genommen wieder leisten.
„840.000 zum Ersten, zum Zweiten…“, stimmte Heribert Wehrhagen an und hob den Hammer.
„Dürfte ich etwas anmerken?“ Mister Lederhose hatte für seine Frage wenigstens die Pfeife aus dem Mund genommen.
„Nein. Was erlauben Sie sich? Unverschämtheit“, echauffierte sich der Auktionator.
„Ich erlaube mir die Unverschämtheit, Sie darauf hinzuweisen, dass sich dieses Bild kurz nach seinem Verkauf selbst zerstören wird“, merkte der Modell-Bayer trocken an.
Ein Raunen setzte ein, das schnell in einen kleinen Tumult mündete. Doch Heribert Wehrhagen sorgte mit dem Holzhammer für Ruhe. „Können wir nun mit der Versteigerung fortfahren?“, sagte er unwirsch und strich sich durch das Haar.
„Keineswegs.“ Der potentielle Käufer des Bilds war aufgestanden und hatte sich zu Wort gemeldet. Mit einer einfachen Geste sorgte er für Ruhe. Der Mann war äußerst elegant gekleidet und hatte eine bemerkenswert hohe Stirn, die ihm etwas Arrogantes verlieh. Doch zeugte sein Auftreten auch von unerschütterlichem Selbstbewusstsein. „Erst will ich wissen, wie der Herr auf diese Idee kommt, das Bild könne sich selbst zerstören. Ich bin schließlich kein Trottel und zahle fast eine Million für Bio-Müll.“
Spätestens seit Banksy sein Bild „Girl with a Balloon“ teilweise schredderte, nachdem es für 1,2 Millionen Euro bei Sotheby’s verkauft worden war, wusste jeder in der Kunstwelt, dass man höllisch aufpassen musste. Doch es gab auch andere bedenkenswerte Fälle. So fällt von einem Anselm Kiefer Bild immer wieder das Stroh herunter. Die Sammler solcher Bilder sind zugleich deren Restauratoren.
„Wir sind hier doch nicht bei den Montagsmalern. Heribert, diesen Herrn wollen wir nicht länger dulden“, widersprach Frau Wehrhagen, die in der ersten Reihe saß. Sie war ungeschminkt und machte überhaupt einen naturbelassenen Eindruck. Allerdings trug sie ein schwarzes Kleid von Prada und ihr Blick wie ihre kerzengerade Körperhaltung hatten etwas Aristokratisches.
Zu meinem Erstaunen stand nun der Bayer auf und ging nicht hinaus, sondern schnurstracks auf Heribert Wehrhagen zu.
„Wenn Sie mich rauswerfen, erzähle ich ihrer Frau, dass Sie ein Verhältnis mit Ihrer Optikerin haben“, flüsterte er ihm ins Ohr.
„Sie infamer Mensch“, schäumte der Auktionator, allerdings mit gedämpfter Stimme, damit niemand seine Worte hörte. „Ich betrüge meine Frau nicht. Wir sind seit über 30 Jahren glücklich verheiratet.“
Im Saal hatte wieder ein Raunen und Reden, ein Stimmenwirrwarr eingesetzt, was den beiden ermöglichte, ihre heimliche Unterredung fortzuführen. Nur ich konnte sie hören, wenn ich mich konzentrierte. Der potentielle Käufer stand jedoch immer noch reglos da und beobachtete aufmerksam das heiße Gespräch. Er kam mir bekannt vor, ich konnte zu dem Zeitpunkt aber das Gesicht keinem Namen zuordnen.
„Nanana“, fuhr Holm fort. „Ihr oberster Hemdknopf ist parallel genäht, die anderen Knöpfe über Kreuz. Das heißt, sie rissen sich ihr Hemd vor Lust vom Leib und so spontan macht man das nach über 30 Jahren Ehe nicht mehr.“
Heribert Wehrhagen spürte den warmen Atem des lästigen Besuchers an seinem Ohr. „Und der Knopf reißt gleich noch einmal aus, weil mir der Kragen platzt.“ Tatsächlich ging seine Gesichtsfarbe bereits ins Puterrote.
„Sie riechen nach Speck und Eiern, haben also ein üppiges Frühstück eingenommen. Ihre Frau aber ist Vegetarierin, vielleicht sogar Veganerin“, fuhr der Bayer fort.
„Wie kommen Sie darauf?“, stotterte von Wehrhagen.
„Ihre voluminöse Handtasche steht offen und daraus spitzt ein Päckchen mit Vitamin B12 Tabletten hervor. So etwas nimmt kein Fleischesser. Und ihre Frau Gemahlin macht mir nicht den Eindruck, dass sie so tolerant ist und Sie in ihrem Haushalt Fleisch essen lässt.“
„Das beweist noch gar nichts“, zischte der Auktionator.
„Heribert, wirf diese impertinente Person endlich hinaus.“ Frau Wehrhagen hatte sich zu den beiden gesellt. Sie wollte, dass endlich wieder Ruhe einkehrte und die Versteigerung beendet werden konnte.
„Gleich Schatzilein, kümmere du dich doch bitte um die Leute.“ Frau Wehrhagen drehte sich um und sprach ein paar beruhigende Worte zu den Anwesenden. Niemand hatte das Haus verlassen, obwohl die Versteigerung im Prinzip vorbei war. Doch alle waren neugierig, ob an den Anschuldigungen des Besuchers mit der Krachledernen etwas dran sei.
„Überführt haben Sie aber Ihre leicht getönten Linsen. Ein Blaustich. So eine Modetorheit würde Ihnen Ihre biologisch-dynamische Frau nicht durchgehen lassen. So etwas macht man doch nur, wenn man auf die Optikerin steht.“ Der Bayer lächelte und hob erwartungsvoll die Augenbrauen. Heribert Wehrhagen atmete schwer. Schließlich straffte er sich.
„Das ist kein Eingeständnis, aber im Namen der Wahrheit will ich Sie anhören“, raunte er. Dann klatschte er in die Hände und bat um Gehör. Frau Wehrhagen und auch der Käufer setzten sich wieder auf ihren Platz. Nach wenigen Augenblicken kehrte gespannte Stille ein.
„Nun, ich denke, es ist ganz offensichtlich, dass hier eine spektakuläre Bildzerstörung geplant ist“, hob der Bayer an. Jetzt konnte ich nicht mehr länger an mich halten und schritt ein.
„Offensichtlich ist gar nichts, außer dass Sie in eine große Auktion platzen und uns hier mit Ihren wilden Thesen aufhalten“, sagte ich energisch. Dieses Landei stand zwischen mir und meinem Porsche, das konnte ich nicht zulassen.
„Hat hier jemand Angst um seine fette Provision?“, fragte er mich provozierend und heimste ein paar Lacher ein.
„Nein, aber ja, ich bin die verantwortliche Kunstexpertin. Watten, Dr. Johanna Watten“, stellte ich mich vor.
„Wie das Kartenspiel, sehr schön. Holm, Sepp Holm ist mein Name.“ Er streckte mir seine Rechte entgegen, mit der Linken hielt er seine Meerschaumpfeife. Widerwillig nahm ich sie an, aber ich konnte mir vor so vielen Leuten keine Blöße geben. Dann trat ich kurz hinter das Bild und tastete den Rahmen ab.
„Hier ist kein versteckter Schredder oder dergleichen. Die Leinwand ist auf ein stabiles Holzgestänge aufgezogen. Wie bitteschön soll dieses Kunstwerk vernichtet werden? Sie Wichtigtuer!“ Das letzte Wort war zweifellos unprofessionell, aber ich konnte mich kaum beherrschen.
„Frau Doktor Kunstexpertin schaut auf der falschen Seite. Stellen Sie sich doch neben den Wichtigtuer und machen Sie Ihre Augen auf!“ Am liebsten hätte ich ihm das Gesicht zerkratzt. Aber ich tat, wozu er mich aufgefordert hatte. Mit verschränkten Armen stand ich da und betrachtete das Bild. Es maß etwa eineinhalb auf zwei Meter. Von den Motiven war es an ein barockes Vanitas-Gemälde angelehnt, allerdings bestand es aus Naturmaterialien.
„Schauen Sie sich die Tiere an. Und zwar den Fasan, den Feldhasen, den Krebs und die beiden Wachteln. Fällt Ihnen etwas auf?“
Ich musterte die unterschiedlichen Kreaturen und konnte beim besten Willen nichts Besonderes erkennen, abgesehen von der Tatsache, dass sie tot und konserviert auf einer Leinwand befestigt waren. Also zuckte ich mit den Schultern. „Was sollte ich denn bemerken?“, fragte ich ihn.
„Im Prinzip nichts. Diese Tiere sind in ihren Maßen geblieben wie zu Lebzeiten. Und nun wenden Sie Ihren Blick auf die Bachforelle.“ Der Fisch war zweifellos das seltsamste Tier. Es befand sich im rechten oberen Eck und hatte das Maul weit aufgerissen. Obwohl ich mich für einen sehr genauen Beobachter halte, musste ich wieder die Waffen strecken.
„Ihnen fällt wirklich nichts auf? Betrachten Sie den Bauch. Er ist unnatürlich gewölbt, eine solche Bachforelle finden Sie in ganz Deutschland nicht.“
Nun, meine Kenntnisse der heimischen Süßwasserfische hielten sich in Grenzen, aber dass dieser Körper voluminöser war als zu Lebzeiten, konnte man durchaus erahnen.
„Wollen Sie damit andeuten, dass in dem Bauch ein Zerstörungsmechanismus versteckt ist?“, fragte ich zögerlich. Welchen anderen Schluss sollte sein Hinweis sonst zulassen?
Holm ging nicht auf meine Replik ein. „Und nun schauen Sie sich die Umgebung des Mauls genau an!“
Dieser Aufforderung konnte ich nicht ohne Weiteres nachkommen, schließlich befand sich der Fisch rund 80 Zentimeter über meinem Kopf. Kurzerhand schnappte ich mir einen leeren Stuhl aus der ersten Reihe, stellte mich darauf und musterte die Gegend um das Fischmaul.
„Schwarze Spritzer. Ich sehe schwarze Spritzer, die wie eine kleine Kaskade aus dem Maul kommen.“
„Sehr gut. Ich vermute, der Künstler hat einen kleinen Testlauf für sein Vorhaben durchgeführt. In dem Fischbauch ist eine Pumpe mit einer Säure. Um welche es sich dabei handelt, entzieht sich bedauerlicherweise meiner Kenntnis, in Chemie war ich noch nie ein Genie.“
Ich stieg vom Stuhl herunter und schüttelte den Kopf. „Unmöglich.“
„Wieso?“ Holm blickte mich erstaunt an. „Was ist daran unmöglich?“
„Unmöglich, dass Sie diese Spritzer aus der Entfernung gesehen haben. Auch das beste Auge ist nicht imstande, so etwas Kleines wahrzunehmen.“
„Das ist richtig“, pflichtete Holm bei. „Ich habe dieses Detail erst aus der Nähe gesehen, der aufgeblähte Fisch fiel mir jedoch vorher auf.“
„Aber er ist doch kein Hinweis darauf, dass das Bild zerstört werden soll, Sie Scharlatan!“ Ich war ungehalten, möglicherweise auch, weil ich meinen Porsche den Bach hinuntergehen sah.
„Nun, der Scharlatan hat einen gewichtigen Beweis für die Richtigkeit seiner These.“ Holm blieb völlig ruhig. Meine Beleidigungen perlten an ihm ab. „Und das, werte Frau Watten, Doktorin und Kunstexpertin, hätten Sie auch sehen können.“ Dann wandte er sich den Besuchern zu und deutete auf den dicklichen Mann mit dem Vollbart. „Darf ich Ihnen vorstellen, das ist Calu, der sagenumwobene Künstler.“
Sogleich brach ein mittelprächtiger Tumult aus. Der potentielle Käufer stand auf und beschimpfte den Vollbärtigen, der mächtig ins Schwitzen kam. Calu? Diese schmerbäuchige Witzfigur sollte der berühmte Künstler aus der Toskana sein? Zugegeben, dieser Holm hatte bislang mit allem Recht. Aber wie konnte er Calu identifizieren? Von ihm existierten keine Fotos, zumindest keine aussagekräftigen. Nur ein paar verschwommene oder dunkle Aufnahmen.
Doch ich konnte die Nagelprobe durchführen. Kurzerhand ging ich zu dem angeblichen Künstler. Seine Augen funkelten wütend hinter einer dicken Hornbrille. Sein mächtiger schwarzer Bart zitterte.
Ich beugte mich ganz nah zu ihm und flüsterte in sein Ohr, dass ich mich für die Unannehmlichkeiten entschuldigte, es sei sicher alles nur eine Verwechslung. Ich sprach Italienisch.
„Keine Ahnung, was dieser Verrückte da will“, entgegnete der Bärtige auf Deutsch. Und das mit einem schwäbischen Einschlag. Doch die Stimme ließ keine Zweifel zu. Das war der Mann, mit dem ich wegen des Bildes telefoniert hatte. Ich schreckte auf, was meinem Gegenüber nicht verborgen blieb. Er wusste, dass ich ihn erkannt hatte.
Plötzlich sprang er auf, riss sich den angeklebten Bart vom Gesicht und die mit Fensterglas bestückte Hornbrille und schrie: „Ihr Kunstkakerlaken, Schmeißfliegen des Marktes, ich verachte euch. Ihr Darmparasiten im Hintern der Bourgeoisie, ihr Horden hirntoter Paviane. Ich spucke auf euch. Kunst ist für euch nur eine Aktie, ein Spekulationsobjekt, an dem ihr eure Eier wärmen könnt.“ Er spuckte Gift und Galle, der Schweiß lief ihm in schnellen Perlen von der Stirn. Der Bauch war also vermutlich echt und nicht ausgestopft. „Das, das ist es, was ihr verdient.“ Sogleich hielt er sein Handy hoch und tippte wild darauf ein.
Im nächsten Moment schoss ein Strahl aus dem Maul der Bachforelle. Es begann zu zischen und zu dampfen. Die Säure fraß sich durch die dicke Schicht aus Kunstlack und löste die Pflanzen in Nichts auf. Einen besonders skurrilen Anblick bot der Feldhase, bei dem zuerst das Ohr abschmolz. Er sah aus wie ein angebissener Schokoosterhase.
Das Publikum war von dem Schauspiel ergriffen. Natürlich hatten alle ihre Handys gezückt und fotografierten oder filmten wie wild das Spektakel. Möglicherweise konnte man damit sogar noch ein bisschen Geld verdienen. Auch ließ sich niemand nehmen, den rasenden Calu zu fotografieren. Mit dessen Anonymität war es nun vorbei, außer er trug eine Maske unter der Maske, was ich mir jedoch schwerlich vorstellen konnte. Mit meinem Porsche war es auch vorbei, aber wenigstens lebte der Traum davon weiter.
Nach kurzer Diskussion hatten die Wehrhagens darauf verzichtet, die Polizei einzuschalten. Im Prinzip war auch niemand zu Schaden gekommen, Calu hatte schließlich nur sein eigenes Bild zerstört. Schnell verließen die Besucher das Auktionshaus, nur Holm wollte partout nicht gehen. Genauso wie der potentielle Käufer. Er kam auf uns zu, allerdings nicht allein. Im Schlepptau hatte er zwei Männer, deren Oberkörper in jahrelangem Fitnesstraining gestählt worden waren, sodass sie fast ihre obersten Hemdknöpfe sprengten. Der gute Mann war also eine bedeutende, vermutlich auch reiche Persönlichkeit, sonst würde er sich kaum zwei Gorillas leisten. Als er mich sah, huschte ein charmantes Lächeln über sein Gesicht. Bislang war es eher maskenhaft ernst. Seine Aufmerksamkeit galt jedoch Holm, dem er die Hand reichte.
„Hendrik Wormann“, stellte er sich vor. „Ich möchte mich bei Ihnen bedanken, Herr…“ Er sprach mit einer sanften Stimme, die mir die Gehörgänge kitzelte. Sehr angenehm, er hätte eine romantische Sendung im Radio moderieren können.
„Holm. Ich bin Sepp Holm“, stellte sich der Bildentlarver vor.
Wormann zuckte kurz mit der Wimper, dann lächelte er wieder. Ich war hin und weg von seiner Aura. Attraktiv war dieser Mann keineswegs, aber er hatte eine Ausstrahlung! Ich fühlte mich gleich ganz wacklig auf den Beinen.
„Sie haben mir viel Geld und Ärger erspart“, fuhr Wormann fort. „Gern würde ich mich einmal dafür erkenntlich zeigen.“ Dann griff er in die Innentasche seines weißen Sommeranzugs, nahm ein Silberetui mit Visitenkarten heraus und gab eine Holm. „Bitte zögern Sie nicht, mich anzurufen. Ein bescheidenes Mahl bei mir zuhause wäre das Mindeste, was ich für Sie tun kann. Es wäre mir eine Ehre, Sie und“, nun wandte er sich plötzlich mir zu und schaute mich mit seinen funkelnden, hellblauen Augen an, "vielleicht auch die charmante Kunstexpertin begrüßen zu dürfen.“
Ich musste damit kämpfen, nicht rot anzulaufen. Denn mir war nun klar geworden, um wen es sich handelte. Das war Wormann, der Wormann, der Milliardär und Mäzen, Kunstsammler und Philanthrop, der sich wie kaum ein Zweiter für krebskranke Kinder in der ganzen Welt einsetzte. Ich konnte mir zwar schwerlich vorstellen, mit diesem Holm, diesem bajuwarischen Urviech irgendwohin zu fahren, aber für einen Abend bei Hendrik Wormann hätte ich auch gemordet, vielleicht würde ich dann sogar Monsieur Lederhose in Kauf nehmen.
Wormanns Sammlung war eine Legende. Seine Villa am Tegernsee ließ manch renommiertes Museum alt aussehen, so munkelte man zumindest. Der Milliardär besaß römische Abgüsse griechischer Skulpturen, babylonische und assyrische Schätze genauso wie Perlen der klassischen Moderne. Aber er unterstützt auch talentierte Künstler mit üppigen Schecks, damit sich diese vom Druck des Broterwerbs befreien und sich ihrer Kunst widmen können.
„Ihren Dank nehme ich gern an, auch die Einladung, nur muss ich Sie ein wenig vertrösten. Ich habe nämlich ein dringliches Problem, dessen Lösung keinen Aufschub duldet.“
„Dann erwarte ich Ihren Anruf, wenn sie Ihr Rätsel gelöst haben“. Mit einem Nicken verabschiedete er sich von Holm, um sich noch einmal mir zuzuwenden. „Und Sie müssen unbedingt mitkommen.“
Einen Augenblick schwebte ich über dem Boden und spürte einen Tsunami an Glückshormonen über meinen Körper schwappen. Aber Frau Wehrhagen holte mich schnell wieder in die Realität zurück. Denn sie forderte lauthals die Security auf, den Störenfried hinauszubefördern, doch Holm tippte mit dem Mundstück seiner Pfeife nur auf den obersten Hemdknopf ihres Gemahls und schüttelte den Kopf. Mit einer abwehrenden Geste stoppte der Auktionator die Wachleute.
„Was wollen Sie noch?“, grollte Wehrhagen.
„Ich werde dieses Haus erst verlassen, wenn ich ein paar Antworten bekommen habe.“
„Sie sind also nicht nur gekommen, um Unruhe zu stiften und eine Auktion zu sprengen?“, schäumte Frau Wehrhagen.
„Nein, ich suche jemanden“, fuhr Holm fort. Dann entnahm er der Gesäßtasche seiner Lederhose sein Handy, wischte ein wenig herum und zeigte uns ein Foto seines Freundes. „Haben Sie diesen Mann gesehen?“
Da ich der kompletten Auktion beigewohnt hatte, erkannte ich den Mann sofort. „Natürlich. Borislav Januesz. Er hat eine schwarze Perle gesteigert. Und das für ziemlich viel Geld“, erklärte ich.
„Dann ist ja alles geklärt“, sagte Wehrhagen und wies die Security an, Holm hinauszubegleiten. Die beiden ziemlich gut gebauten Wachleute packten Holm unter den Armen und führten ihn so schnell ab, dass er kaum mehr zum Protestieren kam. Ich hatte noch einige Formalitäten zu regeln und verabschiedete mich etwa eine halbe Stunde später. Zu meiner Verwunderung sah ich draußen Sepp Holm, wie er lässig an einem Laternenpfahl lehnte. Offensichtlich wartete er auf mich. Die Pfeife hatte er weiterhin im Mund, allerdings kam immer noch kein Rauch heraus.
„Sie müssen mir helfen“, sagte er ohne große Vorrede.
„Ich? Ihnen? Wissen Sie, dass Sie mich um 84.000 Euro Provision gebracht haben?“, entgegnete ich empört. Dann wandte ich mich um und ging Richtung Viktualienmarkt. Ich wollte noch Oliven, Gemüse und Trüffelkäse kaufen. Doch Holm ließ sich nicht abschütteln.
„Vergessen Sie doch das Geld. Denken Sie daran, welche Schwierigkeiten ich Ihnen erspart habe. Außerdem hätte Ihr tadelloser Ruf enorm gelitten, denn letztlich würde man Sie für die Zerstörung des Bildes verantwortlich machen, weil Sie den Mechanismus nicht erkannten. Wer weiß, ob Sie nicht auf eine Million Schadensersatz oder mehr verklagt worden wären.“
Der Einwand war berechtigt, aber ich war immer noch wütend und nicht für solche Argumente zugänglich. Dennoch blieb ich abrupt stehen und keifte ihn an. „Lassen Sie mich doch in Ruhe. Außerdem, woher wollen Sie etwas von meinem tadellosen Ruf wissen?“
Holm hielt nur kurz sein Smartphone hoch. „Ich hatte genügend Zeit, Herrn Google über Frau Dr. Watten zu befragen.“
„Sie spionieren mir also nach? Und tschüss“, sagte ich mit bitterer Verachtung, drehte mich um und stakste los. Doch Holm lief mir wieder hinterher. Der Kerl war wie eine Schleimbeutelentzündung. Nervig und man kriegt sie so schnell nicht los.
„Mein Freund Borislav ist verschwunden. Und ich fürchte, es ist ihm etwas passiert. Dafür brauche ich Ihre Hilfe“, bat er mich inständig. Naja, wenn jemand so bettelt, kann man kein Herz aus Stein besitzen. Also beschloss ich, ihn anzuhören? Nur wo, war die Frage. Auf dem Viktualienmarkt herrschte dichtes Gedränge. Die Blasmusik spielte, Einheimische wie Touristen kauften sich Spezialitäten an den Ständen oder eine frische Halbe im Biergarten. Wir entschieden uns, in das nahe Stadtcafé zu gehen, wo es ruhiger war. Holm marschierte vorher noch in die Metzgerei Klobeck und kaufte sich zwei Leberkässemmeln, die er dick mit süßem Senf beschmierte. Eine Konversation war so während des Gehens kaum möglich, weil Holm ständig den Mund voll hatte.
Am Stadtcafé bekamen wir noch einen sonnigen Platz mit Blick auf das Jüdische Museum. Holm reinigte auf klassische bayerische Art mit dem Handrücken seinen Mund von Senfrückständen und Semmelbröseln. Die Erfindung der Serviette war eine zivilisatorische Errungenschaft, die offensichtlich nicht bis in sein Heimatkaff vorgedrungen war.
„Also, wie kommen Sie darauf, dass Ihr Freund verschwunden ist?“, fragte ich ihn, während ich die Getränkekarte studierte.
„Es ist so: ich wohne bei Borislav zur Untermiete, wenn ich in München bin. Mein Hauptwohnsitz befindet sich in einem Dorf nahe Dingolfing. Wenn mich das Landleben anödet, komme ich gern in die Landeshauptstadt, um festzustellen, dass mich das Großstadtleben schnell genauso anödet. Aber das nur nebenbei. Also, ich kündige mein Kommen zwei Tage vorher an, sodass Borislav ein wenig Zeit zum Nachdenken hat. Er ist nämlich nie zu Hause, wenn ich komme, er hinterlässt mir allerdings Hinweise, wo er sich befindet.“
„Hinweise?“, fragte ich nach und stutzte.
„Ich liebe Rätsel, meine liebe Frau Dr. Watten. Einen schnöden Zettel mit Ort und Uhrzeit würde ich als Schmähung verstehen und Satisfaktion verlangen.“ Holm grinste. Seine Diktion war erstaunlich. Er drückte sich teils sehr gewählt und mit einer arg altbackenen Sprache aus, wie ein Gentleman aus der Vergangenheit, er hatte aber auch diese bayerische Färbung, die so gar nicht zu Wörtern wie Satisfaktion passte. Ich hatte den Eindruck, er redete mit mir so hochdeutsch, wie er konnte. Und in seinem niederbayerischen Kuhdorf derbes Bayerisch. „Borislavs Wohnzimmer sieht genauso aus wie bei meinem letzten Besuch. Nur sind ein oder zwei Details anders. Und diese liefern mir den Hinweis, wo sich Borislav befindet.“
„Moment“, hakte ich nach, „Sie wollen doch nicht behaupten, dass Sie das Zimmer genau abgespeichert haben.“
„Doch, ich habe ein eidetisches Gedächtnis“, sagte Holm trocken, was wegen der bayerischen Färbung ein wenig amüsant klang.
„Aber es verändern sich Dinge in einem Wohnzimmer und wenn es nur die Fernsehzeitung ist“, wandte ich ein.
„Touché, aber diese erkenne ich als notwendige Veränderungen. Man muss für diese Hinweise kein Kryptologe wie ich sein, beileibe nicht. Ich widme nämlich mein Leben schwierigeren Rätseln. Borislav hat es mir diesmal einfach gemacht. Eine Karte mit Mittagsgerichten und fünf Ringe aufeinandergestapelt, das war wahrlich babyleicht. Schon fast ein Affront.“
Ich blickte Holm entgeistert an. Glücklicherweise kam genau in diesem Moment die Bedienung. Ich orderte einen Verdejo, genau die Stärkung, die ich jetzt brauchte. Holm bestellte ein Augustiner vom Fass.
„Eine Halbe geht. Nun, Sie haben selbstverständlich in der Zwischenzeit erraten, wo sich Borislav mit mir treffen wollte“, fuhr Holm fort. „Fünf Ringe erinnern an…“ Er blickte mich durchdringend an und erinnerte mich an meinen Physiklehrer in der Oberstufe, als mich dieser über Quantenmechanik ausfragte und ich nicht einmal die Fragen verstand.
„Olympia“, sagte ich zögernd.
„Genau. Und was sagt der Stapel?“
Ich überlegte kurz und dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen. „Natürlich Mittagessen im Drehrestaurant im Olympiaturm.“
Holm klatschte kurz anerkennend in die Hände. „Sehr schön. Tatsächlich war ich Punkt halb eins dort, aber von Borislav keine Spur. Er hatte aber einen Tisch für uns reserviert. Also wartete ich eine Zeit und versuchte ihn auch auf dem Handy zu erreichen, doch er ging nicht ran. Deshalb kam ich zur Auktion. Das war sein anderer Hinweis.“
„Und wie sah der aus?“, fragte ich neugierig.
Holm lächelte. „Borislav ist ein Muster an Integration. Neben einer Weißwurst lag ein Bild vom Oktoberfest. Darauf waren sich zuprostende Menschen zu sehen, die so ähnlich gewandet waren wie ich. Drüber stand der Spruch ‚Oans, zwoa, drei gsuffa“ – nur das ‚gsuffa‘ war durchgestrichen.“
„Na, dann ist ja alles klar“, lachte ich ironisch, denn ich hatte nichts verstanden.
„Eben. Die Weißwurst wird vor dem Zwölfuhrläuten verzehrt, also beschreibt dieses Rätsel, wo er sich vormittags befindet. Und wo spielt das ‚Eins, zwei, drei‘ schon eine Rolle, außer bei einer Auktion? Mir war klar, dass Sie das sofort verstehen.“
Ich wusste nicht, wie ironisch das gemeint war. Glücklicherweise brachte gerade die Bedienung die Getränke. Ich lächelte Holm an und hob mein Glas, allerdings ohne ein Prosit der Gemütlichkeit anzustimmen.
„Und nun sind Sie an der Reihe. Was hat Borislav heute bei der Versteigerung gemacht?“ Holm lehnte sich in seinen Stuhl zurück und nahm einen kräftigen Schluck von seinem Bier. Seine weiterhin kalte Pfeife hatte er auf den Tisch gelegt.
Also drehte ich die Uhr ein paar Stunden zurück. Oder ein paar Wochen? Es war nicht einfach, den Beginn dieser Geschichte festzulegen. Ich entschied mich, die Geschichte der schwarzen Perle am 19. Mai anfangen zu lassen, also vor knapp einem Monat. Da ereignete sich etwas Überraschendes, etwas, mit dem ich nicht mehr gerechnet hatte. Es war ein stürmischer, ungemütlicher Frühlingstag. Vom Kirschbaum schneite es nur so die Blütenblätter herab, als es an der Tür klingelte. Spontan bekam ich nie Besuch und der Postbote konnte es so spät am Nachmittag nicht mehr sein.
Ich erkannte ihn sofort, obwohl ich ihn seit acht Jahren nicht mehr gesehen hatte. Doch das Gesicht seines Vaters vergisst man nicht, auch wenn es stark gealtert war. Er trug eine abgewetzte schwarze Regenjacke und eine zerfranste Jeans. Seine Augen lagen in dunklen Gruben, sein Stoppelbart war aschgrau wie sein spärliches Kopfhaar. Nur wenige Büschel waren ihm übriggeblieben, obwohl er früher stolz auf sein dichtes Haar war. Neben sich hatte er einen silbernen Hartschalenkoffer mittlerer Größe stehen.
„Verzeih mir, dass ich so plötzlich auftauche“, sagte er mit brüchiger Stimme.
Ich war zu perplex, um einen Gefühlsausbruch zu bekommen oder meinen Vater wenigstens zu umarmen. Deshalb bat ich ihn nur stotternd herein. Umständlich zog er Schuhe und Jacke aus, er wirkte gebrechlich, obwohl er erst 59 war.
Wir gingen ins Wohnzimmer. Weiterhin hatte ich auf Berührungen verzichtet. Es war zu viel Porzellan kaputt gegangen zwischen uns. Ich bot ihm Kaffee und Schokokekse an, er wollte aber nur Wasser und einen Schnaps. Egal welchen, Hauptsache mindestens 40 Prozent, das waren seine Worte.
Den extrem alten Armagnac gönnte ich ihm nicht, was ich später bereute. An diesem Tag bekam er einen 6 Jahre alten schottischen Whisky, der auch kein schlechtes Tröpfchen war. Zittrig nahm er das Glas in beide Hände. Seine Augen schimmerten trüb.
„Ich weiß, dass ich dich enttäuscht habe“, sagte er schließlich.
„Aus mir ist auch ohne dich etwas geworden“, entgegnete ich kühl. Vielleicht zu kühl, aber man baut sich seine Mauer, seine Schutzmauer, um den Verlust nicht zu spüren. Und diese Mauer ist über die Jahre dick und fest geworden. Andererseits hatte ich ein erfülltes Leben und auch die Wunde, die die Vaterlosigkeit zweifellos in meiner Seele geschlagen hatte, war für mich vernarbt.
Die Geschichte meiner Eltern ist schnell erzählt. Als ich eingeschult wurde, verlor mein Vater seine Arbeit. Statt sich eine neue zu suchen, verlegte er sein Betätigungsfeld vom Gärtnern auf den Überfall von Geldtransporten und wurde gleich beim ersten Versuch geschnappt. Meine Mutter ließ sich scheiden, während er seine Strafe absaß. Es war schwer für sie als Alleinerziehende, uns im teuren München durchzubringen, doch die materiellen Entbehrungen machte sie durch ein Übermaß an Herzenswärme wieder wett.
Nach seiner Entlassung hatte ich nur noch sporadischen Kontakt zu meinem Vater. Immerhin fand er wieder eine Stellung als Landschaftsgärtner, konnte später sogar seine eigene Firma gründen, die jedoch nach wenigen Jahren Konkurs anmeldete. Dann verschwand er. Ohne ein Wort. Und nun stand er Knall auf Fall vor meiner Tür.
Er habe sich so geschämt, weil er wieder versagt hatte, gestand er mir. Deshalb sei er ins Ausland verschwunden, habe ein kärgliches Leben geführt und nun wolle er Frieden schließen. Mit mir, mit meiner Mutter, mit allen. Die schütteren Haare, das totenkopfähnliche Gesicht, die steifen, ungelenken Bewegungen, ich hatte es schon erwartet. Und beim dritten Schnaps offenbarte er sich: Mein Vater hatte Krebs. Auch noch Bauchspeicheldrüsenkrebs. Praktisch unheilbar. Die Chemotherapie hatte er beendet, seine letzten Tage wollte er dazu nutzen, seinen Seelenfrieden zu finden. Nun brachen bei mir alle Dämme und Sturzbäche an Tränen rannen meine Wangen hinab. Vater setzte sich neben mich, legte seinen Arm um mich und fuhr mir durchs Haar.
Als ich mich wieder gefangen hatte, erzählte er weiter. Er habe seine Wohnung aufgegeben, seine ganze Habe verkauft und sei zurück nach München gekommen. Für das Flugticket sei das letzte Geld draufgegangen. Alles, was er noch besaß, befand sich in dem Rollkoffer. Deshalb fragte er mich, ob er bei mir schlafen könne, was kein Problem darstellte, schließlich hatte ich seit Leopolds Tod Platz genug. Er bekam sein eigenes Schlafzimmer. Ich brachte ihn gegen 22 Uhr ins Bett, als er bereits erschöpft war und kaum mehr die Augen offen halten konnte. Außerdem hatte er eine halbe Flasche Whisky getrunken. Die Schmerzen, sagte er entschuldigend, seien ohne die Chemotherapie nicht auszuhalten. Schnaps könne sie wenigstens lindern.
An diesem Abend setzte ich mich vor den offenen Kamin und starrte noch lange in die Flammen, sinnierte über mein Leben, meine Vergangenheit. Ich beschloss, einen Schlussstrich zu ziehen, meinem Vater alles zu verzeihen und ihm in den letzten Tagen beizustehen, ja, sie zu versüßen, wenngleich ich jede Menge Arbeit zu erledigen hatte. Einiges musste einfach hinten anstehen. Am nächsten Morgen weckte ich meinen Vater mit frischen Butterbrezen und Kaffee. Er hatte große Schmerzen, wollte es sich aber nicht anmerken lassen.
„Du kannst dir so viel Medizin nehmen, wie du brauchst“, sagte ich zu ihm und zeigte auf den Schnapsschrank. Dann fuhr ich in die Galerie, in der ich halbtags arbeitete. Als ich am späten Nachmittag nach Hause kam, lag Vater betrunken auf der Couch im Wohnzimmer und schlief. Das Kissen war mit ausgefallenen Haaren übersät. Ich deckte ihn zu und ging in mein Arbeitszimmer.
Abends frischten wir einige Erinnerungen auf, tauschten Anekdoten aus meiner vermeintlich glücklichen Kindheit aus. Ich wusste oft nicht, ob ich lachen oder weinen sollte, mir war fast den ganzen Abend über zu beidem zumute. Der Abend war noch jung, als mein Vater ins Bett gehen wollte. Die Krankheit hatte ihn zu sehr geschwächt. Selbst das Atmen fiel ihm schwer.
Als er sich mühevoll den Schlafanzug angezogen hatte, wollte ich gerade das Zimmer verlassen, doch er rief mich noch einmal zu sich. Auf dem Nachtkästchen stand eine kleine samtene Schmuckschatulle. Er öffnete sie und ich staunte nicht schlecht, als ich eine große, etwas unförmige schwarze Perle darin sah. Ich nahm sie in die Hand, sie war schwerer als erwartet und glänzte tiefschwarz. Was für ein wunderschönes Kleinod. Die Perle hatte ein kleines Loch in der Mitte, befand sich also einmal an einer Kette. Ich fühlte mich ein wenig wie Gollum mit dem Ring und hätte am liebsten „Mein Schatz“ gesagt, doch das wäre pietätslos gewesen, schließlich gehörte mir das Schmuckstück noch nicht.
„Diese Perle ist das einzige Kostbare, das ich dir hinterlasse. Pass gut auf sie auf, denn sie ist wertvoller, als sie aussieht. Ich erzähle dir eine Geschichte dazu. Geschichten mochtest du doch immer so gern von mir.“ Er stöhnte mehr, als dass er sprach. Deshalb sagte ich zu ihm, er solle mir die Geschichte morgen erzählen. Dann deckte ich ihn zu und löschte das Licht.
Als ich am nächsten Morgen wieder mit Butterbrezen und Kaffee die Treppe zu meinem Vater hinaufging, freute ich mich auf die versprochene Geschichte. Doch sie fiel aus. Er sah so ruhig, so entspannt aus im Tod. Mein Vater hatte den Kampf gegen den Krebs endgültig verloren. Ich setzte mich an sein Bett und hielt lange seine Hand, gab mich der Trauer aber auch der nostalgischen Erinnerung hin. Dann rief ich meine Mutter an. Sie lebt mittlerweile in Tirol, kam aber noch am selben Tag nach München. Der Tod wischt alle Zwistigkeiten weg und lässt uns verzeihen, was wir zu Lebzeiten nicht verzeihen konnten.
Natürlich nächtigte meine Mutter bei mir. Das Haus, das ich von meinem viel zu früh verstorbenen Mann geerbt hatte, hatte im ersten Stock mit einem Gäste-WC und einem großen Schlafzimmer eine Art Einliegerwohnung. Wenige Tage nach dem Tod meines Vaters passierte etwas Seltsames. Wir kamen gerade von einem Termin beim Bestattungsunternehmen zurück. Ich ging in die Küche, um Kaffee zu kochen, und meine Mutter zog sich auf ihr Zimmer zurück. Sie war müde und wollte sich hinlegen, kehrte jedoch nach ein paar Minuten mit ernster Miene zurück. „Der Koffer“, stotterte sie, „der Koffer von deinem Vater ist weg.“
Mich durchzuckte es. Ein Einbrecher? Allerdings hatte ich keinerlei Spuren eines gewaltsamen Eindringens entdecken können. Sofort eilte ich in das Gästezimmer und überzeugte mich selbst davon. Der Koffer, wir hatten ihn in der Ecke gegenüber dem Bett platziert, war tatsächlich weg. Und mit ihm alle Habseligkeiten meines Vaters. Außer der schwarzen Perle.
Diese hatte ich nämlich in meiner Handtasche, da wir vormittags bei einem Juwelier waren, um das Schmuckstück von einem Experten prüfen zu lassen. Im Internet fand ich einen Namen, einen Goldschmied und Schmuckhändler, der dezidiert den An- und Verkauf von schwarzen Perlen annoncierte. Berthold Loos war ein schmallippiger Mann mit trüben Augen, aber feinen Händen. Man konnte sich gut vorstellen, dass er selbst wunderbare Stücke herzustellen vermochte.
Er hielt die Perle zunächst gegen das Licht, dann rieb er sie und biss sogar ein wenig darauf herum, was ich zugegebenermaßen sehr gewöhnungsbedürftig fand. Zu guter Letzt legte er sie unter ein Mikroskop und betrachtete sie eingehend. Dann nickte er.
„Die Perle ist zweifellos echt. Ein schönes Stück. Vermutlich eine Naturperle aus der Südsee. Ich tippe auf 19. Jahrhundert. Aufgrund ihrer ungewöhnlichen Größe würde ich den Wert auf 250 Euro taxieren. Wenn Sie wollen, kaufe ich Ihnen das schöne Stück ab. Ich bin mir sicher, dass ich schnell einen Interessenten dafür habe.“
Aber ich lehnte ab. Es war das Erbe meines Vaters. Letztlich das einzige, was mir von ihm blieb. Denn den Koffer hätte ich mitsamt Inhalt weggeworfen, wäre er nicht gestohlen worden. Darin befanden sich nur abgetragene Kleidung, ein Kulturbeutel und ein paar unbedeutende Habseligkeiten.
Nach dem Einbruch benachrichtigten wir die Polizei. Sie untersuchte das Haus oberflächlich auf Spuren und nahm das Protokoll auf. Allerdings merkte ich, dass man uns nicht glaubte. Verständlich, denn es gab bei mir zuhause einige bedeutende Kunstwerke von beachtlichem Wert. Warum sollte also jemand einen alten Koffer stehlen und die wertvollen Bilder hängen lassen? Ein Profi zumal, denn die Spurensicherung fand keine Hinweise auf einen Einbruch.
Zwei Tage später wurde es allerdings wirklich mysteriös. Die Beerdigung meines Vaters fand auf dem Ostfriedhof in Haidhausen statt. Ein paar alte Freunde waren gekommen, auch zwei oder drei mir unbekannte Menschen, von denen wir mutmaßten, sie hätten mit Vater gesessen. Knast verbindet. Auf einen Leichenschmaus oder eine Kremess, wie man in Bayern sagt, verzichteten wir. Dafür gingen meine Mutter und ich noch etwas essen, kamen also erst bei Dunkelheit nach Hause.
Und nun geschah etwas noch Seltsameres. Als ich aufsperrte, ging das Licht nicht an. Der Schreck fuhr mir durch die Glieder. Erst vor kurzem hatte man bei mir eingebrochen und nun versank das Haus in Finsternis. Meine Mutter krallte sich an mir fest. Sie verlangte, dass wir die Polizei riefen, aber ich nahm all meinen Mut zusammen und ging in die Wohnung, Mutter dagegen schimpfte mich eine Närrin und verließ augenblicklich das Haus Richtung Straße.
Geheiligt sei die Taschenlampe am Handy. Vorsichtig ging ich in das Wohnzimmer. Auch dort herrschte Stromausfall. Klar, dachte ich mir, ich hatte Waschmaschine und Trockner in Betrieb, als wir das Haus verlassen hatten. Da konnte schon einmal die Sicherung durchbrennen, alles bereits erlebt. Also ging ich in den Keller, wo sich der Sicherungskasten befand. Das Herz schlug mir bis zum Hals. Eine Wohnung sieht beim fahlen Licht einer Taschenlampe ganz anders aus. Hinter jedem Schatten lauert die Gefahr. Langsam ging ich Stufe für Stufe nach unten, blieb immer wieder stehen, um in die Dunkelheit hineinzuhorchen. Doch nichts, kein Geräusch war zu vernehmen. Im Keller angekommen hastete ich durch den Gang. Gegenüber der Waschküche in einem von mir nur selten benutzten Abstellraum befand sich der Sicherungskasten. Es lag, wie ich vermutet hatte, am Hauptschalter. Ich musste ihn nur nach oben drücken und schon ging das Licht an. Erleichtert atmete ich auf. Kein Einbrecher, es war nur die Sicherung. Und kaum dass ich wieder ruhig geworden war, erlebte ich die nächste Überraschung.
„Der gestohlene Koffer stand im Keller“, sagte Holm plötzlich. Er hatte mir geduldig zugehört, dabei sein Bier ausgetrunken und gelegentlich auf seiner Pfeife gekaut.
„Ja“, entgegnete ich verblüfft, „aber wie kommen Sie darauf?“
„Nennen Sie es Intuition, aber fahren Sie bitte fort.“ Holm winkte der Bedienung und orderte ein zweites Helles. Ich hatte vor lauter Erzählen ganz das Trinken vergessen und bemerkte, dass ich einen trockenen Mund hatte. Mein Weißwein war bereits warm, dennoch nahm ich einen großen Schluck, bestellte mir aber noch Mineralwasser.
„Wie war das möglich?“, fuhr ich fort. „Wie kam der Koffer in diesen Kellerraum? Hatte ich ihn dort abgestellt und es einfach vergessen? Das war möglich und die wahrscheinlichste Erklärung. Ich betrachtete ihn eingehend. Von außen waren keinerlei Spuren zu sehen, dass etwas mit ihm geschehen war. Allerdings muss ich hinzufügen, dass er nicht zugesperrt war.
Ich legte ihn vorsichtig auf den Boden und öffnete ihn. Nichts. Kein Anzeichen, dass er durchwühlt worden wäre. Kopfschüttelnd ging ich nach oben und holte meine Mutter von der Straße. Sie fiel mir gleich um den Hals, so erleichtert war sie, dass mich keine Einbrecher ermordet hatten. Dann berichtete ich ihr, was ich gefunden hatte. Auch sie war perplex und konnte sich das rätselhafte Geschehen nur so erklären, dass ich den Koffer geistesabwesend in den Keller gestellt hatte. Ja, sie war sich plötzlich nicht einmal sicher, ob sie es nicht selbst gewesen war. Also riefen wir die Polizei an. Oberwachtmeister Degen, der den Einbruch aufgenommen hatte, war noch missmutiger als beim ersten Mal. Bereitwillig legte er den Fall zu den Akten. Mutter atmete auf, ich hatte allerdings weiterhin ein mulmiges Gefühl. Auch wenn es die plausibelste Erklärung war, dass Mutter oder ich den Koffer im Keller deponiert hatten, blieb der Zweifel. Die nagende Ungewissheit, ob es nicht doch einen Menschen gab, der wie ein Phantom bei mir ein- und ausging. Aber aus welchem Grund? In dieser Nacht beschloss ich auf jeden Fall, mich vom Erbe meines Vaters komplett zu trennen. Seine Habseligkeiten wanderten in die Altkleidersammlung und in die Tonne, die schwarze Perle dagegen in ein Schließfach. Sofort am nächsten Tag bereitete ich die Versteigerung des Schmuckstücks vor.
Ich meldete mich bei dem Goldschmied und bat ihn, mir seine Expertise schriftlich zu geben, das war für die Auktion unerlässlich. Er zeigte sich erfreut über meinen Anruf und meinte, er habe einen Kunden, der eine beträchtliche Summe für die schwarze Perle zahlen wollte, ein Sammler und Liebhaber. Ich überlegte kurz hin und her, aber da ich den Verkauf schon angemeldet hatte, wollte ich keinen Rückzieher machen. Frau Wehrhagen konnte in diesen Angelegenheiten sehr nachtragend sein.
Bis zur Auktion verlief mein Leben auch nicht in ruhigen Bahnen, da mich ein gewisser Calu auf Trab hielt, aber an die Perle mit all ihren Begleiterscheinungen verschwendete ich kaum einen Gedanken. Ganz im Gegenteil, ich war so auf Vanitas IV fokussiert, dass ich sie fast vergessen hätte.
Am Morgen des heutigen Tages holte ich das letzte Erbstück meines Vaters aus meinem Bankschließfach. Von der Auktion erwartete ich wenig. Das Mindestgebot lag bei 100 Euro. Ihr Freund hob sogleich die Hand und bot 120 Euro. Postwendend hörte man 150 Euro. Der zweite Interessent war ein Mann Mitte 20, dunkle Haare, bis über die Ohren rasiert, stechender Blick und ein Schlangen-Tattoo am Hals. Er trug einen billigen Anzug und eine schwarze Krawatte, wirkte aber wie hineingezwängt. Die Zeiten, in denen Auktionen nur von den Reichen, Schönen und Adeligen bevölkert wurden, sind zwar vorbei, aber dieser junge Mann war ein Fremdkörper. Donald Trump könnte eine Perücke aufsetzen, die ihm bis zum Hintern reicht, er würde trotzdem auf der Hippie-Party auffallen. Barba non facit philosophum, ein Bart macht noch keinen Philosophen.
Was sich fortan entwickelte, wäre mir in meinen kühnsten Träumen nicht eingefallen. Borislav Janeusz und der junge Mann überboten sich wechselseitig und trieben die Summe für die Perle in schwindelnde Höhen. Bei sage und schreibe 15.500 Euro erhielt schließlich Ihr Freund den Zuschlag. Der überbotene junge Mann machte sich daraufhin sofort vom Acker, und das mit einer Miene, als hätte er einen Weltkrieg verloren, während Borislav Janeusz die schwarze Perle in Empfang nahm und die Formalitäten erledigte. Er verließ etwa gegen halb zwölf das Auktionshaus. Das war die Geschichte der schwarzen Perle.“
Holm schüttelte den Kopf. „Sie ist noch lange nicht zu Ende.“ Dann brummte er vor sich hin, keine Worte, er klang mehr wie ein paar Hummeln im Honigrausch. Außerdem machte er ruckartige Bewegungen mit dem Kopf, verharrte dann aber plötzlich wieder regungslos. Dann stand er auf und ging eine Runde um den Jakobsplatz. Als er sich wieder setzte, fuhr er sich über das Kinn und nahm einen Schluck von seinem Bier.
„Ich glaube, ich weiß was passiert ist, zumindest bis zu einem bestimmten Punkt. Aber ich habe noch keine Ahnung warum. Was ist das Rätsel der schwarzen Perle?“
Ich zuckte mit den Schultern. Für mich war diese Geschichte auch ein Mysterium. Im Prinzip war ich froh, dass sie zu Ende war. Außerdem hatte ich eine enorme Summe dabei verdient. Sie kompensierte ein wenig den Ausfall meiner Provision. Eigentlich hatte ich kein Interesse, die Angelegenheit weiter zu verfolgen, ich wollte einen Schlussstrich ziehen. Es beschlich mich allerdings das Gefühl, Holm würde für eine Fortsetzung sorgen.
„Die schwarze Perle birgt ein Geheimnis, das für manche Leute von unschätzbarem Wert ist. Davon ist auszugehen. Einer dieser Menschen erfährt sehr schnell, dass Ihr Vater mit seinem Schatz wieder in der Stadt ist. Möglicherweise haben sie direkten Kontakt. Diese Person X möchte mit Ihrem Vater eine Übereinkunft treffen, doch dieser stirbt vorher. Da seine Erbin keine Ahnung vom Wert der schwarzen Perle hat, schickt Person X einen äußerst talentierten Einbrecher. Er wartet, bis das Haus leer ist, verschafft sich mithilfe seines perfekten Picking-Werkzeugs Zugang und nimmt den Koffer mit. Doch der gewünschte Gegenstand befindet sich nicht darin. Also wartet er wieder auf eine günstige Gelegenheit, nämlich die Beerdigung, um den für ihn und seinen Auftraggeber wertlosen Koffer zurückzubringen. Und zwar so, dass man am ersten Einbruch zu zweifeln beginnt. Er deponiert den Koffer in einem Abstellraum und schaltet die Hauptsicherung aus. Auf diese Weise sollten Sie unauffällig zum Koffer geführt werden. Dabei begeht er jedoch einen Fehler. Seinen ersten, allerdings einen amateurhaften.“
Ich stutzte. Mir war nichts aufgefallen. Und auch dem wirschen Oberwachtmeister Degen nicht.
„Unser Einbrecher drehte das Licht in dem Kellerraum an, vermutlich wollte er sich einen genauen Überblick verschaffen. Als er dann die Sicherung ausschaltete, vergaß er, selbiges mit dem Lichtschalter zu tun. Sie hatten zumindest berichtet, dass Sie den Koffer sofort gesehen hatten, weil das Licht anging. Das dürfte nicht passieren, wenn wirklich die Sicherung ausgefallen wäre.“
„Sie haben Recht“, nickte ich. „Das war mir überhaupt nicht aufgefallen. Vermutlich war ich so erleichtert über die Helligkeit, dass mir nichts seltsam vorkam.“
„Nur zu verständlich. Wer hat keine Angst in der Dunkelheit“, sagte Holm ohne einen Hauch von Ironie. Dann lehnte er sich zurück und starrte in den weißblauen Sommerhimmel. „In der Zwischenzeit wurde eine zweite Person auf die schwarze Perle aufmerksam. Beiden Parteien muss klar gewesen sein, dass Sie das Schmuckstück nicht zuhause aufbewahrten, ein weiterer Einbruch also sinnlos war. Sie mussten es also auf der Auktion ersteigern.“
„Sie meinen, Ihr Borislav und dieser Bieter mit dem Schlangen-Tattoo sind hinter der Perle her?“, fragte ich skeptisch.
„Nein, beide sind lediglich Strohmänner, die echten Interessenten wollen unerkannt bleiben.“
So etwas ist bei Auktionen nicht unüblich.