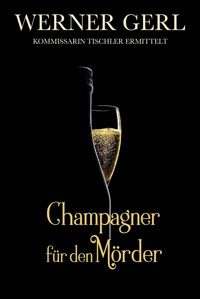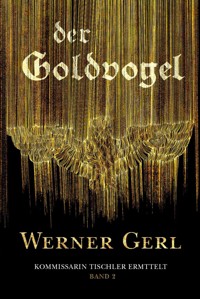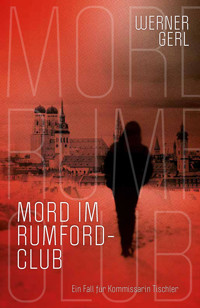
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein Mord. Ein Verrat. Ein blutiges Rätsel - Kommissarin Tischler ermittelt wieder Eine Blutlache mit Goldstaub. Der Geschichtsprofessor Karl Gregorius, der Vorsitzende des altehrwürdigen Rumford-Clubs, liegt tot in seinem Gartenhaus – erschlagen mit einer legendären Madonnenfigur. Im Hals des Toten steckt eine Keramikscherbe mit Judasmotiv und grausiger Botschaft: Dies war nur der erste Mord! Eine blutige Schnitzeljagd beginnt und führt die Münchner Kommissare Barbara Tischler und Ralf Mangel immer tiefer in die Vergangenheit ihrer Stadt. Zwielichtige Antiquitätenhändler, kommunistische Studentenbünde, amoklaufende Journalisten und DDR-Flüchtlinge – alles weist auf das geschichtsträchtige Jahr 1989. Doch der Mörder scheint den Kommissaren immer einen Schritt voraus zu sein und die Ermittlung wird zum Wettlauf gegen die Zeit …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
Werner Gerl
Mord im Rumford-Club
Kommissarin Tischlers vierter Fall
Werner Gerl: Mord im Rumford-Club
Kommissarin Tischlers vierter Fall
Alle Rechte liegen beim Autor Werner Gerl. Jede Verwertung ist nur mit seiner Zustimmung zulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen. Und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Coverdesign: volkverlag.de
Impressum:
Werner Gerl
Agnes-Bernauer-Straße 157f
80687 München
Über meine Website www.wernergerl.de können Sie sich über meine anderen Bücher und Projekte informieren.
1. Kapitel
Prolog
Prag, 14.8.1989
Die ersten Flüchtlinge waren bereits vom Lobkowicz-Palais verschluckt worden. Und sie würden nie mehr in den real existierenden Sozialismus ausgespuckt werden. Der Himmel über Prag war an diesem Tag bedeckt, manchmal drängte sich die Sonne erfolgreich durch die dünne Wolkenschicht, blinzelte kurz, um dann wieder zu verschwinden. Der Himmel diesseits des Eisernen Vorhangs aber verfinsterte sich mit jedem Tag.
In Ungarn hatten sie den Grenzzaun zu Österreich abgebaut. Medienwirksam lächelnd hatten im Juni Gyula Horn und Alois Mock ein Loch herausgeschnitten, das Loch in die Freiheit, wie es in den westlichen Medien hieß. Ein Loch ins Verderben, wie Genosse Mielke dagegen meinte. Ein Loch zumindest, das sich kaum mehr stopfen ließ. Schon quollen erst die Ständige Vertretung in Ostberlin und dann die Botschaft in Budapest über vor Republikflüchtigen. Eine Schande, eine Demütigung. Und Prag würde als Nächstes fallen, wenn sie nichts dagegen unternähmen. Der Dominoeffekt. Nach Prag wäre Warschau an der Reihe. Deshalb müsste der bereits kippende Dominostein Prag eine Stütze bekommen, einen Pfeiler, auf den Verlass war und der jedem Sturm standhielt.
Und der Pfeiler hatte einen Namen und ein Gesicht. Hauptmann Grotzek zog noch einmal das Foto von Petr Bogol aus seiner abgewetzten grauen Leinenjacke. Entschlossene blaue Augen blickten ihn daraus an, umrahmt von dunkelblondem, militärisch korrekt geschorenem Haar, ein glattrasiertes kantiges Kinn und hohe Wangenknochen. Bogol war ein Schrank von einem Mann, ein ehemaliger Eishockeyspieler, der den Lockrufen aus Amerika widerstand. Lieber roten Borschtsch mit Kameraden genießen als sich an den Fleischtöpfen des Klassenfeindes zu überfressen, das war seine Überzeugung. Und nach seinem frühzeitigen Karriereende, weil ihm bei der Weltmeisterschaft ein Finne das Knie zertrümmerte, diente der Genosse pflichtbewusst in der Armee.
„Genosse, kleine Planänderung. Ich übernehme Bogol“, sagte Grotzek mit gedämpfter Stimme. „Allein.“ Klaus Stinger war wie vom Blitz getroffen. „Wie? Was?“, stammelte er verdattert. „In den Instruktionen hieß es ausdrücklich, dass wir die beiden Ziele gemeinsam anzugehen haben, um ….“
Mit einer kurzen Handbewegung und einem scharfen Blick brachte der Hauptmann seinen rangniederen Genossen zum Schweigen. „Mittlerweile bin ich jedoch zur Überzeugung gekommen, dass wir beide Ziele gleichzeitig in Angriff nehmen. Ich führe die Operation mit Bogol durch und Sie kümmern sich um Dostál.“
„Aber …“, versuchte Stinger zu widersprechen. Seine Kehle schnürte sich zu, sein Mund wurde trocken wie nach einem langen Lauf.
„Kein Aber. Das ist ein Befehl.“ Hauptmann Grotzek ließ keine Diskussion aufkommen. Er hatte sich kurzfristig umentschieden und dabei blieb es. „Genosse Stinger, ich muss Sie nicht erinnern, dass unsere Mission von höchster Wichtigkeit für unser sozialistisches Vaterland ist.“ Im Gegensatz zum pathetischen Inhalt klangen die Worte erstaunlich emotionslos. „Die Anweisungen kommen von ganz oben, vom Genossen Mielke. Vergessen Sie das nicht.“
„Ich werde meinen Auftrag pflichtbewusst ausführen“, entgegnete Stinger mit brüchiger Stimme. Auftrag, hallte es in seinen Ohren wider. Das klang so harmlos, als müsste er einen Brief übergeben oder ein paar Stunden Wache schieben. Doch sein Auftrag war ein Mord, ein perfider Mord. Jaromir Dostál hatte auch noch drei Kinder, zwei Mädchen und einen Jungen. Aber er war ein Verräter. Gekauft vom MAD, um wegzuschauen, um alle Republikflüchtlinge in die Botschaft zu lassen. Man hatte es ihm eingetrichtert: Dostál war ein Judas, der eliminiert werden musste. Dafür hatte er einen vergifteten Ring mit einem kleinen Stachel. Nur ein kleiner Pieks und der Verräter würde binnen weniger Stunden sterben. Und sollte er den Handschlag verweigern, dann hätte Stinger noch eine Geheimwaffe im Gepäck. Der Überläufer musste sterben. Unbedingt.
Nur hatte Stinger noch nie einen Menschen getötet. Alles andere schon, Infiltration, Überwachung, Diskreditierung und auch mehrmals Folter. Aber nur die sogenannte weiße Folter, die keine sichtbaren Spuren hinterlässt, sondern nur Wunden auf der Seele. Und diese heilen oft nie. Viele konnten nach ihrem Aufenthalt in dem Stasigefängnis nie wieder richtig schlafen.
Doch ein Mord, ein kalt geplanter, vorsätzlicher Mord war eine ganz andere Nummer. Stinger bemerkte, wie er feuchte Hände bekam, wie er zittrig wurde. Krampfhaft bemüht, sich seine Unsicherheit nicht anmerken zu lassen, ging er plötzlich viel zu schnell.
„Langsam, Genosse“, bremste ihn Grotzek. „Wir wollen doch nicht auffallen.“
Richtig. Sie waren als Zivilisten hier, keine Uniformen, keine Waffen, außer den beiden tödlichen Injektionen. Für Westdeutsche hätte man sie aber nicht halten können, dafür sorgte die Kleidung, die den ganzen Charme der Sowjetunion versprühte. Sie war aus grobem Stoff gewirkt, den man im Westen nicht einmal für Pferdedecken verwendet hätte. Und Stinger trug ein grellgelbes T-Shirt zu seiner braunen Jacke. In der Bundesrepublik hätte man über die Farbe gewitzelt, sie würde Augenkrebs verursachen. Selbst die Prager identifizierten sie als DDR-Bürger. Zu den Westdeutschen raunten sie im Vorbeigehen nämlich „Tauschen, tauschen“. Die tschechoslowakische Krone wurde offiziell im Kurs von 1 zu 5 gewechselt, in Toiletten und Hinterhöfen war aber auch 1 zu 15 oder sogar 1 zu 17 möglich, wenn ein Prager unbedingt D-Mark brauchte. Stinger und Grotzek fragte niemand, ob sie Lust auf eine kleine illegale Wechselaktion hätten.
Betont langsam näherten sie sich dem barocken Lobkowicz-Palais. Darin befand sich die westdeutsche Botschaft. Von dort hatte man einen atemberaubenden Blick auf den Hradschin, den Burgberg, das Wahrzeichen Prags. Überrest des Feudalismus, einer untergegangenen Zeit. Aber ging nicht auch die Zeit des Sowjetkommunismus langsam zu Ende? Diese Frage quälte Klaus Stinger seit Wochen, wenn nicht seit Monaten. Wohin führte Gorbatschows Weg? Was blieb von der DDR, wenn alle Menschen flüchteten? Was sollte er tun? Mira war hochschwanger. In welche Welt würde sein Kind hineingeboren werden?
„Machen Sie sich locker, Genosse.“ Die Aufforderung klang aus Grotzeks Mund wie ein Befehl und riss Stinger aus seinen Gedanken. „Sie müssen aussehen wie ein potenzieller Republikflüchtling, nicht wie ein Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit.“
Stinger schaltete in den Schlendergang und ließ betont lässig seine Arme baumeln, was ihm selbst völlig lächerlich vorkam. Grotzek dagegen folgte seinem eigenen Vorschlag nicht. Er war für jeden DDR-Bürger, der seit Jahrzehnten mit der allgegenwärtigen Bespitzelung lebte, von Weitem schon als Mitglied der Firma Horch und Guck, wie die Stasi im Volksmund hieß, zu identifizieren. Die braune Reisetasche trug er mit festem Griff, als würde sein Leben davon abhängen. Auf gewisse Weise tat es das auch.
Stinger kannte den genauen Inhalt nicht. Geld befand sich darin, aber er wusste weder die Menge noch die Währung, vermutete aber D-Mark oder Dollar. Und Dokumente, unter anderem weitreichende Einsatzpläne. Denn es ging darum, mit Hilfe von Petr Bogol eine schlagkräftige Einsatztruppe aufzubauen, um die Republikflucht über die Prager Botschaft einzudämmen, vielleicht sogar ganz zu unterbinden. Der frühere Eishockeyspieler sollte einige Kollegen überreden, mit Härte gegen Ausreisewillige vorzugehen, gleichzeitig aber noch eine paramilitärische Einsatzgruppe rekrutieren, die schon in einem Radius von 200 Metern um die Botschaft Ostdeutsche abfängt, um sie davon zu überzeugen, in ihrem sozialistischen Vaterland zu bleiben. Mit welchen Mitteln sie das taten, war ihnen überlassen. Tote sollte es nach Möglichkeit nicht geben, hatte Mielke gesagt, aber ansonsten sollte die volle Härte, mit der man bislang so erfolgreich die Republikflucht bekämpft hatte, angewendet werden.
Der Auftrag war streng geheim. Nicht einmal Erich Honecker wusste davon. Auch nicht die anderen Mitglieder des Politbüros und des Zentralkomitees. Der Genosse Mielke war davon überzeugt, dass die Auflösungserscheinungen in der DDR nur mit Gewalt aufzuhalten waren. Er hätte auf die Demonstranten in Leipzig schießen lassen, war aber zurückgepfiffen worden. Also nahm er keine Rücksicht mehr auf die Parteigrößen und zog die Operation Lobkowicz im Alleingang durch.
Sie näherten sich der Botschaft über die Rückseite, also über den großen barocken Garten, der mit seiner geometrisch zugeschnittenen Kleinhecke noch von absolutistischer Naturbeherrschung zeugte. Trotz seines feudalen Protzes wirkte das Palais an diesem bedeckten Augusttag heruntergekommen und trist. Ein gut zwei Meter hoher Metallzaun trennte das sozialistische Prag vom Herrschaftsgebiet der Bundesrepublik. Keine Spitzen, kein Drahtverhau, kein Strom, nichts, was das Klettern über die Grenze zwischen den Systemen erschweren könnte. Niemand würde sich von diesem lächerlichen Zaun abhalten lassen. Außer die Sicherheitskräfte würden ihn packen oder mit dem Schlagstock behandeln.
„Ich sehe Bogol“, flüsterte Grotzek, als sie sich noch rund 50 Meter vor dem Palais befanden. „Halten Sie Ausschau nach Dostál!“
„Zu Befehl, Herr Hauptmann“, entgegnete Stinger, der seine eigene Unsicherheit mit militärischem Gehorsam überspielen wollte. „Was machen wir, wenn wir unsere Operationen beendet haben? Wo treffen wir uns?“
Stinger blickte seinen Vorgesetzten an. Nur für einen Bruchteil einer Sekunde entglitten Grotzek die Gesichtszüge. Und bevor er antworten konnte, wurde Stinger schlagartig klar, was der Hauptmann vorhatte. Er, der immer einen Plan hatte, der immer alles korrekt machte und als besonders detailversessen galt, sollte sich keinen Gedanken darüber gemacht haben, wie sie gemeinsam den Rückzug antraten? Unmöglich. Rechnete Grotzek einfach damit, dass Stinger als Mörder von Dostál gleich nach der Tat verhaftet und in einem Prager Gefängnis verschwinden würde? Oder führte der Hauptmann etwas anderes im Schilde? Wollte er selbst mit dem Geld in die bundesdeutsche Botschaft fliehen und das sinkende Schiff DDR verlassen?
Plötzlich lief Grotzek los und gab so eine Antwort. Ihm war klar geworden, dass ihn Stinger durchschaut hatte. Noch 50 Meter fehlten ihm zu einem neuen Leben. Den Zaun würde er problemlos überwinden. Er war ein guter Läufer, aber etwas aus der Übung. Außerdem rauchte er ein Päckchen Juwel 72 täglich. Doch er spurtete, als wäre der Leibhaftige hinter ihm her. Belustigte wie erstaunte Augenpaare verfolgten das Wettrennen der beiden zur Botschaft. Und sie sahen, wie wenige Meter vor dem Zaun der jüngere Hintermann zu einer Blutgrätsche ansetzte und den anderen zu Fall brachte. Im Fußball hätte es dafür die rote Karte gegeben, im echten Leben wechselte die Reisetasche den Besitzer. Grotzek knallte mit dem Kopf noch gegen den Betonsockel unterhalb des Zauns und blieb regungslos liegen.
Auch die Sicherheitskräfte um die Botschaft waren auf den kleinen Kampf aufmerksam geworden. Zwei Uniformierte gingen auf Stinger zu. Ohne nachzudenken, packte dieser die Reisetasche – sie war wesentlich schwerer, als Stinger erwartet hatte – und warf sie auf das Botschaftsgelände. Mit einem Sprung war er schon in der Mitte des Zauns und hangelte sich an zwei Metallstäben hoch. Ein Uniformierter schimpfte auf Tschechisch und packte Stingers Fuß, doch der stieß kräftig zu und landete sanft auf dem grünen Rasen der bundesdeutschen Botschaft. Sofort schnappte er sich die Reisetasche und hielt sie fest umklammert. Dann blickte er sich schweratmend noch einmal um. Grotzek umklammerte mit einer Hand einen Gitterstab und zog sich hoch. Blut lief ihm aus einer Platzwunde über das Gesicht, das zu einer Fratze verzerrt war.
„Du bist des Todes, Stinger“, grollte er, dann fiel er bewusstlos zu Boden.
Es war ein sonniger Augustmorgen. Nach den vielen Regenfällen der letzten Tage genoss Maik Koller das warme Licht auf seiner Haut, als er zur Gartenlaube schlenderte. Er winkte schon von weitem mit der Papiertüte, um zu zeigen, dass er die versprochenen frischen Croissants dabei hatte. Der Laimer Traditionsbäcker Bonert war bekannt für seine buttergelben, saftigen Hörnchen, die auch einem französischen Gaumen schmeichelten. Und je nach Gusto konnte man sie süß mit Erdbeermarmelade oder Johannisbeergelee genießen oder herzhaft mit Schinken oder Gruyère.
„Schön, dass dich Karl auch zum Frühstück eingeladen hat“, sagte Bertl Mahler, als Maik Koller am Eisentor der Gartenanlage angekommen war.
Scherzhaft streckte ihm Koller den Ellbogen zur Begrüßung hin. Seit im Zuge der Coronapandemie das Händeschütteln außer Mode gekommen war, etablierte sich diese Spaßvariante des Servussagens.
„Ein bisschen jugendlicher Elan schadet nicht“, grinste Koller, dessen Deckhaar noch von grauen Stellen verschont geblieben war. „Ich glaube, Karl will über neue Mitglieder mit uns reden. Und die sollten meines Erachtens den Altersdurchschnitt senken und nicht heben.“
„Ich verbitte mir jede Altersdiskriminierung“, lächelte Mahler und öffnete das Tor zur Gartenanlage. „Aber du hast schon Recht. Ein bisschen Blutauffrischung kann unserem Club nicht schaden.“
Der Tag versprach sonnig und heiß zu werden. Nachdem die erste Augustwoche zum Vergessen war und nicht den Namen Sommer verdiente, machte schon der Sonntag seinem Namen alle Ehre. Und an diesem Montag sollte es sogar richtiges Badewetter werden.
Koller und Mahler gingen über den knirschenden Kies den Hauptweg entlang. Der süße Duft von Dahlien und Lilien mischte sich mit der frischen Morgenluft. Nach wenigen Metern bogen sie nach links in den Rosenweg, der mit einem grünen Grasteppich aufwartete und üppig wuchernden Hecken, sodass man hintereinander gehen musste.
Der Garten von Karl Gregorius lag inmitten dieses kleinen Dschungels. So waren die Parzellen geschützt vor neugierigen Blicken und jeder Schrebergärtner konnte tun und lassen, was er wollte. Nur zu laut sollte er nicht sein.
„Ich hoffe, heute gibt es Kaffee und nicht gebräuntes Wasser“, raunte Koller augenzwinkernd, als sie das Gartentor von Gregorius‘ Parzelle erreicht hatten. Der Clubvorsitzende war bekannt dafür, besonders herzschonenden Kaffee aufzusetzen.
„Am besten, wir setzen ihn selber auf“, entgegnete Mahler. Dann öffnete er das gusseiserne Tor und beschritt den gepflasterten Weg. Der Hausherr war nicht zu sehen, was aber nicht weiter verwunderlich war, denn dieser interessierte sich nicht für Gartenbau, sondern nur für das Häuschen.
„Karl, wir sind’s!“, rief Koller aus, doch es rührte sich nichts.
„Vielleicht schläft er noch“, meinte Mahler, als er an der Eingangstür angekommen war.
„Unwahrscheinlich. Der steht doch mit den Hühnern auf. Und die Vorhänge sind auch nicht zugezogen“, entgegnete Koller.
„Du hast Recht.“ Sogleich klopfte Mahler laut. „Aufwachen, die Frühstücksboten sind hier!“
„Der Croissant-Express!“, ergänzte Koller grinsend. Doch wiederum drang kein Geräusch aus dem Gartenhäuschen.
Mahler zuckte mit den Schultern. „Dann gehen wir einfach rein.“ Er drückte die Klinke und öffnete die Tür. Schnell sahen sie, warum Karl Gregorius keine Antwort gegeben hatte. Und ihnen war klar, dass er nie wieder eine Antwort geben würde.
„Hat dich jetzt doch Corona erwischt?“, fragte Ralf Mangel seine Chefin. Diese hatte nämlich zum wiederholten Mal an diesem Morgen lauthals geniest.
„Ich bin doppelt gepiekst, kann doch eigentlich nicht sein!“, sagte Barbara Tischler verschnupft und schnäuzte sich kräftig. „Aber ich mache einen Test. Sicherheitshalber.“ Sogleich stand sie auf und ging zum Wandschrank.
„Man kann auch doppelt geimpft an Covid erkranken“, belehrte sie Mangel.
„Ich weiß“, stöhnte die Kommissarin leise. Denn sie wusste, was folgen würde.
„Impfdurchbruch nennt man das. Bei Johnson & Johnson …“
„Ist in Ordnung, Ralf“, bremste die Oberkommissarin ihren wichtigsten Mitarbeiter. Dessen lexikalisches Wissen war legendär, seine Neigung zu detaillierten Kurzvorträgen aber auch. Und diese gingen seiner Vorgesetzten regelmäßig gehörig auf den Senkel. „Reden wir lieber über das Wetter. Oder das Essen. Was gab’s denn gestern im Hause Mangel?“
„Salat mit Putenstreifen“, brummte der gebürtige Hallertauer, der sich in seinem Mitteilungsdrang ausgebremst fühlte.
Tischler nahm sich die Schachtel mit den Selbsttests und ging zurück zu ihrem Schreibtisch. Sie griff sich ein Röhrchen und tröpfelte Pufferlösung hinein, ohne die Zahl der Tropfen zu zählen. Dann riss sie die Verpackung mit dem sterilen Tupfer auf und drehte ihn mehrfach in jedem Nasenloch. Sofort kitzelte es in ihrer Nase und sie musste wieder kräftig niesen.
„Legal in der Öffentlichkeit popeln zu können, das ist ja das Schönste an den Tests, aber es juckt so scheußlich!“
Schließlich drehte sie den Tupfer im Röhrchen und gab drei Tropfen auf die Testkassette. Sogleich begann die Reaktion und bald war der Kontrollstreifen zu sehen.
„Ich hab eine interessante Doku auf Arte gesehen. Über Kanada. Das ist mein Lieblingsland“, erklärte Mangel. „Hast du gewusst, dass die Schwarzbären in British Columbia oft nur den besonders fettigen Teil der Lachse essen und den Rest liegen lassen? Das liefert den Bäumen eine Riesenportion Phosphor, deshalb können sie so groß werden.“
„Hochinteressant!“, merkte die Kommissarin an, die kaum zugehört hatte. Dann kratzte sie sich an den Unterarmen. Diese juckten seit gestern Abend.
„Unglaublich!“, fuhr Mangel fort, der nun in seinem enzyklopädischen Wesen war, schließlich hatte ihn die Kommissarin aufgefordert, von seinem Wochenende zu erzählen. „Der Königslachs kann über 50 Kilo erreichen.“
„Deshalb habe ich noch nie einen bei Heidi Klums Hühnerparade gesehen. Die sind zu fett für den Laufsteg“.
Mangel schaute seine Chefin entgeistert an. „Ich verstehe dich nicht. Ein Fisch ist doch höchstens auf dem Landesteg. Und dann ist er tot.“
Das Klingeln des Telefons bewahrte Barbara Tischler vor der Peinlichkeit, einen mäßigen Witz erklären zu müssen.
Ein solcher Betrieb herrschte normalerweise nicht an einem Montagmorgen in der Gartenkolonie. Mehrere Polizeiautos parkten auf dem bekiesten Hauptweg. Die ganze Kapelle der Spurensicherung war bereits aufgeschlagen und hatte sich an die Sicherung des Tatorts gemacht, als Mangel und Tischler mit ihrem Dienstwagen vorfuhren und diesen in einer Seitenstraße abstellten. Der 56-jährige Karl Gregorius sei ermordet in seiner Gartenlaube gefunden worden. Mehr wussten die beiden noch nicht von dem Fall.
Die Kommissarin genoss die warme Sonne auf ihrer Haut, spürte aber immer noch das Jucken an den bereits vom Kratzen geröteten Unterarmen. Diese waren auch für ihren Kollegen gut sichtbar, denn wegen der angenehmen Temperaturen hatte sie ihre Lederjacke auf dem Rücksitz liegen lassen.
„Schaut mir nach Allergie aus!“, meinte Ralf Mangel. Tischlers Coronatest war negativ. Also musste eine andere Erklärung für die Symptome seiner Chefin her.
„Ich bin auf so Vieles allergisch“, stöhnte die Kommissarin.
„Auf was denn? Pollen? Gräser?“, fragte Mangel nach. Sie gingen gemessenen Schrittes zur Gartenanlage.
„Nein. Auf Reality-TV, Techno-Musik, unseren bundesdeutschen Paragraphendschungel und die Ex-Frau meines Freundes. Von allem bekomme ich Stresspustel. Aber niesen muss ich nicht.“
„Ach, du verarschst mich doch wieder“, entgegnete Mangel leicht angesäuert.
„War nur ein Scherz, Ralf“, beschwichtigte die Kommissarin. „Mir sind keine Allergien bislang von einem Arzt diagnostiziert worden, wenn du das meinst.“
Am Eingangstor stand eine Wachpolizistin. Die Kommissare zeigten ihre Ausweise und ließen sich den Weg zu dem Tatort zeigen. Dann gingen sie den grünen Pfad zwischen den üppigen Hecken zu dem Gartenhäuschen. Dort war ein weiterer Polizist postiert, der sie passieren ließ. Die Kommissarin blieb stehen und stutzte ob des Anblicks, der sich ihr bot.
„Ein Gärtner aus Passion hat sich hier aber nicht seine Oase geschaffen“, meinte Tischler. Denn die grüne Fläche bestand zum Großteil aus einem Rasen mit den üblichen Ingredienzien wie Löwenzahn, Disteln und Gänseblümchen. In einer Ecke stand ein Apfelbaum, an dem einige kleine Früchte hingen, in der gegenüberliegenden befanden sich mehrere brache Beete, in denen sich Unkraut nach Lust und Laune verbreiten konnte. Die Umrandung bestand aus einer struppigen Ligusterhecke. Dafür war der Weg zum Gartenhäuschen sowie eine Freifläche mit Tisch und Stühlen gepflastert. Dort saßen zwei Polizisten und zwei weitere Personen.
„Eher ein Bayer aus Leidenschaft“, entgegnete Mangel. An dem erstaunlich großen und frisch gestrichenen Holzhäuschen hing eine Bayernfahne. Sie bestand an den Flanken aus zwei goldenen Löwen. Zwei gegenüberliegende Wappenteile zeigten die weiß-blaue Raute, die anderen beiden einen weiteren goldenen Löwen auf schwarzem Grund. Darüber leuchtete eine majestätische Krone.
„Ein Monarchist. Wahrscheinlich wieder so ein Ludwigianer, so ein Kini-Verehrer, der von der guten alten Zeit schwadroniert, die es nie gegeben hat“, seufzte Tischler, die mit dem Kult um den Märchenkönig Ludwig II. nichts anfangen konnte.
„O mei“, schüttelte Mangel den Kopf. „Da lästert eine Ahnungslose!“
„So? Dann klär mich mal auf, Herr Geschichtslehrer!“
„Das ist doch nicht die Fahne vom Königreich Bayern, sondern vom Kurfürstentum Bayern.“ Mangel verdrehte die Augen. Für ihn war das derart offensichtlich, dass es für ihn unbegreiflich schien, wie man die beiden Wappen verwechseln konnte. „Bayern ist im Rahmen des Dreißigjährigen Kriegs 1623 zum Kurfürstentum erhoben worden.“
„Das weiß ich auch“, log Tischler, die bei bayerischer Geschichte in der Schule immer in Tiefschlaf verfallen war.
„Schön, dann kannst du mir ja das Herzstück des Wappens erklären!“ Mangel schaute seine Chefin erwartungsvoll an.
„Aber natürlich.“ Sie ging ein paar Schritte näher zu dem Gartenhäuschen. Inmitten des Wappens befand sich noch ein weiteres Emblem. „Das ist ein rotes Schild mit einer goldenen Kugel, auf der ein Kreuz aufgepflanzt ist.“
„Du hast aber keine Ahnung, was das bedeutet“, grinste Mangel.
„Natürlich nicht. Und wenn du es mir nicht sofort sagst, verwandle ich mich in eine bayerische Löwin und fresse dich!“
Mangel lachte laut auf. „Das kann ich nicht riskieren. Du siehst den goldenen Reichsapfel auf rotem Schild. Der steht für das Erztruchsessenamt, das ursprünglich der Heidelberger Pfalzgraf führte. Aufgrund dieser Würde war er ja Bestandteil des Kurkollegs, durfte also den König wählen. Und weil sich Friedrich V. im Dreißigjährigen Krieg zum böhmischen König aufgeschwungen hatte und nach seiner Niederlage bei der Schlacht am Weißen Berg in Reichsacht fiel, gingen das Amt und das Wappen auf den bayerischen Herzog über. Verstanden?“
„Ja, Herr Lehrer. Ich frage mich nur, warum jemand eine Kurfürstenfahne aufhängt. Dazu noch eine so große. Da verstehe ich ja eher noch die Monarchisten mit ihrem Kinigedöns.“
Mangel zuckte mit den Achseln. „Keine Ahnung, wir werden’s noch erfahren.“ Dann straffte er sich. „Aber Babs, du unterschätzt Ludwig II. Ein ewig Rätsel …“
„Soll er sich und anderen sein und bleiben“, stöhnte die Kommissarin, „solange er mir meine Ruhe lässt.“
In dem Moment kam ein groß gewachsener Mann in weißem Overall aus der Holzhütte und ging lächelnd auf die Kommissarin zu.
„Barbara, es ist mir eine Freude, dich wiederzusehen“, sagte Paul Siewert, der Leiter der Spurensicherung. „Auch wenn der Anlass jedes Mal ein trauriger ist.“
„Wie traurig ist er diesmal?“, fragte Tischler und streckte ihm zur Begrüßung den Ellbogen entgegen.
Lachend erwiderte Siewert die coronagemäße Begrüßung, wurde dann aber ernst. „Mord ist immer traurig. Und dieser wartet auch noch mit einem seltsamen Detail auf. Aber sieh selbst.“
„Wir dürfen schon rein?“ Mangel war freudig überrascht.
„Aber nur mit Handschuhen und Kondomen an den Füßen.“
Nachdem sich die beiden Kommissare präpariert hatten, um keine Spuren zu verwischen, betraten sie das Gartenhäuschen und erlebten eine Überraschung. Im Gegensatz zum ungepflegten Grünbereich war das Innere wie ein historisches Museum eingerichtet. Die Wände waren voll mit historischen Zeichnungen und Fahnen. Zudem befanden sich zwei Vitrinen in dem Raum mit Gegenständen aus dem 18. Jahrhundert. Orden, reichlich verzierte Zinnkrüge, Porzellanfiguren. In einer Ecke stand ein Soldat in bayerischer Paradeuniform. Er hatte ein Bajonett in der Hand, das sich Tischler genauer anschaute. Vermutlich war es zwar nicht geladen, aber das aufgepflanzte Messer glänzte wie neu und war als Stichwaffe zu gebrauchen. Hatte es Gregorius nicht mehr geschafft, sich damit zu wehren?
An der Rückwand hing zentral das Porträt eines mittelalten Mannes in leuchtend roter Uniform und grauen, nach hinten gekämmten Haaren, einem schmalen Gesicht, dünnen Lippen und einem ernsten Blick, der auf eine seriöse Persönlichkeit schließen ließ. Zumindest wollte der Porträtierte so erscheinen.
„Das ist aber kein bayerischer Kurfürst!“, stellte Tischler trocken fest.
Mangel atmete laut auf. „Ich hab’s gewusst, dass du den wieder nicht kennst. Das ist Benjamin Thompson, in Bayern besser bekannt als Graf Rumford.“
„Doch, der sagt mir was“, meinte die Kommissarin und strich sich übers Kinn. „Hat der nicht den Englischen Garten angeleiert?“
„Bei dir ist doch noch nicht Hopfen und Malz verloren“, grinste Mangel.
„Der ist aber schon eine Weile tot“, unterbrach Siewert. „Ich glaube, wir sollten uns dem Frischverstorbenen zuwenden.“
„Du hast Recht“, stimmte Tischler zu und sah erst jetzt einen Fuß in einem braunen Filzpantoffel. Die Leiche lag hinter dem massiven Holztisch und war beim Eintritt in das Häuschen kaum zu sehen. Plötzlich stand ein Mann hinter einem der Lederstühle auf.
„Um Himmels willen. Der Tote ist wiederauferstanden!“, entfuhr es Tischler.
„Seien Sie nicht schon wieder albern“, entgegnete Doktor Bertram. Der Rechtsmediziner war ein humorfreier Mediziner, den die Kommissarin gern mit spitzen Bemerkungen provozierte. „Hier ist etwas Schreckliches passiert“, sagte er ernst.
Tischler und Mangel gingen um den Tisch herum und schauten sich die Leiche an. Karl Gregorius lag starr und steif am Boden. Aus seinem Gesicht war längst jegliche Farbe gewichen wie aus seinem Leib das Leben. Die Augen waren weit aufgerissen, auch der Mund stand offen, als wäre Gregorius im Tod noch überrascht, dass er sterben musste. Neben dem Kopf lag eine dünne Lesebrille mit verbogenem Gestell. Der Tote trug abgewetzte graue Sommerhosen, ein weißes T-Shirt und eine dünne Strickjacke.
Barbara Tischler war abgebrüht, erfahren, ein Profi. Trotzdem ließ sie der Anblick einer Leiche nie kalt, vor allem wenn die Todesursache Mord war. Darauf ließ die Blutlache um den Kopf schließen. Und noch ein weiteres schreckliches Detail. Im Hals des Toten steckte eine Keramikscherbe.
„Was haben Sie herausgefunden?“, fragte Tischler den Arzt.
Bertram kniete sich neben die Leiche. „Das Opfer ist nicht durch den Stich in den Hals gestorben. Dieser wurde ihm post mortem zugefügt.“
„Dann ist dieser Splitter eine Botschaft“, rief Mangel fast freudig aus. Er hatte ein Faible für mysteriöse Details bei Mordfällen. Und er liebte Thriller und Serienkillerromane, ganz im Gegensatz zu seiner nüchternen Vorgesetzten.
„Das müssen Sie herausfinden“, entgegnete der Arzt. Dann drehte er vorsichtig die Leiche an der Schulter um. „Tödlich war der Schlag auf den Hinterkopf mit einem stumpfen Gegenstand.“
„Und mit was für einem? Mit einem Hammer oder einem Baseballschläger?“, fragte Mangel nach.
„Wohl kaum“, schaltete sich Siewert ein. „Wir haben nämlich Goldstaub in der Wunde gefunden.“
„Dann wurde er mit einem Gegenstand aus Gold erschlagen?“ Tischler schüttelte erst ungläubig den Kopf, hielt dann aber inne. „Das klingt im ersten Moment seltsam, aber wenn man sich diesen musealen Raum genau anschaut, nicht mehr.“
„Stimmt“, pflichtete Siewert bei. „Ich weiß zwar nicht, um welchen Gegenstand es sich gehandelt hat, aber ich bin mir ziemlich sicher, woher ihn der Mörder hat.“ Er deutete auf eine der beiden Vitrinen. Sogleich gingen die beiden Polizisten mit ihm dorthin. „Im Gegensatz zu der anderen Vitrine war diese nicht verschlossen. Und wenn man das oberste Brett anschaut …“
„Dann sieht man eindeutig, dass in der Mitte ein Exponat fehlt“, ergänzte Tischler. Zwischen einer historischen Soldatenfigur und einer Bronzestatue der Bavaria befand sich eine Lücke, die nicht durch Nachlässigkeit zu erklären war, denn die Vitrinen waren akribisch eingerichtet, die Abstände der Exponate genau austariert.
Siewert nickte.
„Gibt es Fingerabdrücke?“, fragte Tischler den Leiter der Spurensicherung.
„Nein. Die Vitrine wurde sorgfältig abgewischt. Keine professionelle Arbeit, aber es genügt, um die klassischen Spuren zu verwischen. Ob wir brauchbare DNA-Proben gefunden haben, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen.“
„Brauchen Sie mich noch?“, fragte Doktor Bertram. „Ich habe noch einen Termin.“
„Ganz kurz“, entgegnete Tischler. „Ich würde gern ein bisschen die Tat rekonstruieren, soweit uns das bereits möglich ist. Der Mörder nimmt also einen goldenen Gegenstand aus der Vitrine und erschlägt damit hinterrücks das Opfer.“
„So muss es gewesen sein“, nickte Bertram.
„Das legt den Schluss nahe, dass das Opfer den Angriff nicht erwartet hatte.“
„Für die logischen Folgerungen sind Sie zuständig“, sagte Bertram patzig.
„Danke, ich habe Sie auch gern. Sie können gehen. Wann darf ich mit Ihrem Bericht rechnen?“
„Wenn ich fertig bin“, brummte Bertram an der Tür und verschwand.
„Wenn unser Opfer also einen Schlag von hinten bekommen hatte“, fuhr Tischler fort, „müsste er doch auf das Gesicht beziehungsweise auf den Bauch gefallen sein“, führte Tischler an.
„Wieder richtig“, pflichtete diesmal Siewert bei. „Die Blutlache neben dem Kopf ist verwischt. Der Mörder hat das Opfer eindeutig umgedreht und ihm dann diese Tonscherbe in den Hals gerammt.“
Tischler ging zur Leiche und kniete sich neben dem Kopf nieder. Dann schaute sie sich eingehend die Verwundung am Hals an. Trotz des breiten Schnitts war wenig Blut ausgetreten, was darauf hindeutete, dass sie dem Opfer einige Zeit nach dem tödlichen Schlag hinzugefügt worden war. „Die Scherbe ist tief in den Hals gedrückt. Man sieht nicht viel mehr als den Rand. Aber ich glaube, ich erkenne darauf eine Figur. Die Scherbe könnte also von einem bemalten Teller oder etwas Ähnlichem stammen.“
„Das glaube ich auch“, meinte Siewert.
„Habt ihr Reste davon in diesem Raum gefunden?“, fragte Tischler nach.
Siewert verneinte.
„Das ist seltsam. Das passt nicht zusammen.“ Tischler stand auf und fuhr sich durch das Haar. „Der Mörder nimmt als Waffe einen Gegenstand von hier, was auf eine spontane Tat hindeutet, vielleicht sogar eine Affekthandlung. Aber er bringt diese Tonscherbe mit, die er dem Toten als Botschaft in den Hals steckt, was wiederum für einen geplanten Mord spricht. Das ist ein Widerspruch.“
„Stimmt. Aber Widersprüche sind dazu da, sie aufzulösen“, wandte Mangel ein.
„Dann lass uns an die Arbeit gehen.“
2. Kapitel
Barbara Tischler wollte sich noch ein wenig in der Hütte umsehen. Allein. Zumindest mehr oder weniger allein. Zwei Mitarbeiter der Spurensicherung kümmerten sich noch um die Randbereiche, sie waren dabei allerdings kaum zu hören. Die Kommissarin ließ die Stille des Tatorts auf sich wirken. Und dessen Aura. Gregorius hatte kein Interesse an Gartenarbeit, dafür ein gesteigertes an Geschichte, vor allem, soweit Tischler das beurteilen konnte, an bayerischer Geschichte. Und bei diesem Hobby war er penibel und zudem der Direktor und Kurator seines eigenen Museums.
Auch schien er nicht zu den Sozialhilfeempfängern zu gehören. Die Kleidung war nachlässig, abgetragen. Tischler vermutete, dass Gregorius Single war, ob aus Überzeugung oder weil er geschieden oder verwitwet war. Aber das Interieur stammte samt und sonders nicht aus dem IKEA-Katalog. Der massive Tisch war eine Antiquität, ebenso die zwölf Stühle. Barbara Tischler war keine Expertin für Möbelgeschichte, sie ordnete die stilvoll verzierten wie filigranen Stücke aber dem Biedermeier zu.
Nachdem sie langsam den Raum abgegangen war, kniete sie sich noch einmal neben den Toten. „Warum hat dich jemand von hinten erschlagen?“, murmelte sie vor sich hin. Sie betrachtete die Keramikscherbe, die wie ein kleines Pizzastück aussah. Unter dem getrockneten Blut zeichnete sich die Kontur einer Person ab. Dann beugte sich Tischler vor. Vielleicht befand sich ja noch etwas auf der Unterseite, eine Gravur oder ein Herstellungsdatum. Und plötzlich durchzuckte es die Kommissarin, als hätte sie einen Stromschlag bekommen. Was zum Teufel war das?
„Kann ich jetzt gehen?“, hauchte Bertl Mahler. Er war kreidebleich, der Schock saß ihm sichtlich in den Knochen. Kein Wunder, Karl Gregorius war ein langjähriger Freund von ihm.
Mangel nickte. „Wir haben ja Ihre Angaben und Personalien. Sollten wir noch etwas wissen wollen, melden wir uns.“
Sogleich verließ Mahler den Garten und eilte zum Ausgang. Er wollte nur noch weg.
„Ich kann gern noch bleiben. Zwar kannte ich Karl nicht so gut wie Bertl, aber ein bisschen was könnte ich Ihnen schon noch erzählen. Einfach ein bisschen Background. Wenn Sie wollen.“ Maik Koller war auch mitgenommen, aber offensichtlich nicht geschockt. Sein Gesicht wies eine hochsommerkonforme Bräune auf, er zitterte nicht und sprach auch mit fester Stimme. Seine Anspannung erkannte man am ehesten noch darin, dass er sich häufig durch das mittellange aschblonde Haar strich.
„Gern“, entgegnete Mangel. „Das Gartenhäuschen war also der Treffpunkt des Rumford-Clubs.“
„Genau“, nickte Koller. „Wir treffen uns turnusmäßig immer am ersten Freitag im Monat. Sommer wie Winter. Derzeit gibt es zehn Mitglieder. Platz hatten wir für zwölf. Wir waren also auf der Suche nach frischem Blut. Kandidaten und Kandidatinnen gab es mehrere. Darüber wollte Karl heute mit uns beim Frühstück sprechen.“
„Warum mit Ihnen?“, fragte Mangel nach.
Über Kollers Gesicht huschte ein Lächeln. „Ich bin quasi der Novize und Bertl ein Gründungsmitglied. Karl wollte tendenziell jüngere Leute in den Club holen, Bertl nicht. Ich glaube, ich war als Verstärkung für den Vorsitzenden gedacht. Da gab es eine 27-jährige Bewerberin, ein echt kluges Mädchen, die die Welt mit der Brille von heute sieht. Aber beruflich war sie – in Anführungszeichen – nur Kassiererin bei Edeka. Karl konnte damit leben, Bertl hatte aber diesen Bildungsdünkel.“
„Gut. Ich denke aber, dass wir die Bewerber und Bewerberinnen als Verdächtige vorerst ausschließen können. Haben Sie eine Idee, wer ein Interesse daran haben könnte, Karl Gregorius zu töten? Hatte er Feinde?“
Koller zuckte mit den Schultern. „Ich kann es mir kaum vorstellen. Aber letztlich kannte ich ihn zu wenig. Soweit ich weiß, führte er seit dem Tod seiner Frau vor drei Jahren ein privat zurückgezogenes Leben. Bei den Mitgliedern im Club ist er beliebt und wird von allen als Oberhistoriker respektiert. Immerhin ist er Professor für bayerische Geschichte an der LMU. Mit seinem Wissen kann sich keiner messen. Sicher, er konnte ein wenig ruppig sein, herrisch, ja autoritär auf eine – sagen wir – veraltete Weise. So ein bisschen die graue Eminenz, die keinen Widerspruch duldete. Dann war er aber auch wieder sanftmütig und ein Freigeist vor dem Herrn.“
„Das ist meine Chefin auch manchmal“, flüsterte Mangel augenzwinkernd. Offensichtlich hatte er Angst, sie könnte seine spitze Bemerkung hören. „Obwohl sie kein alter weißer Mann ist.“
Koller grinste kurz, wurde dann aber wieder ernst. „Im Club hatte Karl definitiv keine Feinde. Wie gesagt, ein sonderlich ausgeprägtes Privatleben hatte er nicht, zumindest behauptete er immer, die Nächte allein zu verbringen. Allerdings …“ Koller hielt inne und wägte den Kopf auf und ab.
„Allerdings?“, fragte Mangel nach. „Jeder Hinweis bringt uns weiter.“
„Naja, Sie haben ja die historischen Devotionalien und Schätze gesehen, mit denen das Clubhaus ausstaffiert ist.“ Er hob die Hände, als wollte er jede Schuld von sich weisen. „Ich weiß nicht, aus welchen Kanälen die alle stammen.“
„Sie meinen, ob jeder Gegenstand legal erworben wurde?“, stutzte der Kommissar.
„So in etwa. Es gibt einen großen Schwarzmarkt für historische Gegenstände und Antiquitäten, zumindest einen Graubereich zwischen legal und illegal.“ Koller wischte sich den Schweiß von der Stirn. Es war bereits sommerlich heiß und sie standen direkt in der Sonne. „Und Karl war nicht nur in Auktionshäusern unterwegs, wenn Sie wissen, was ich meine.“
Mangel nickte.
„Und mit diesen Menschen ist nicht zu spaßen“, fuhr Koller fort.
„Das ist eine Spur. Eine gute Spur sogar.“ Mangel tippte eifrig in sein Notebook. „Wissen Sie mehr über seine Händler beziehungsweise Kontakte?“
Koller strich sich übers Kinn und wiegte den Kopf hin und her. „Nicht wirklich. Ich kann mich nur erinnern, dass er einmal von einem Jesko erzählt hat, der mit interessanten Objekten handelte, dem aber nicht zu trauen war. Und …“ Koller hielt inne und atmete tief durch. „Karl hatte kurz darauf ein blaues Auge und wirkte auch ansonsten etwas ramponiert.“
„Sie glauben, dieser Jesko hat ihn verprügelt?“
Koller zuckte mit den Achseln. „Das kann auch Zufall gewesen sein. Aber ja, ich glaube, dieser Historienhändler hat Karl ziemlich zugesetzt.“
„Wie lange ist das her?“, fragte Mangel nach.
„Ein halbes Jahr etwa. Februar oder März. Mehr weiß ich aber wirklich nicht.“
„Wir prüfen das nach“, sagte Mangel und tippte weiter seine Notizen.
„Und hier habe ich auch etwas, das es zu überprüfen gilt.“ Mangel schrak zusammen. Er hatte nicht mitbekommen, dass sich seine Chefin angeschlichen hatte. Sie hielt die Tüte mit der Scherbe in der Hand, die in Gregorius‘ Hals gesteckt hatte. Sie war mehr oder weniger vom Blut gesäubert.
„Hast du mal wieder Spuren vernichtet?“, rutschte es Mangel raus.
„Keine Angst, mir haben die Jungs von Siewert geholfen. Alles ist sauber.“ Dann zeigte sie die Bildseite der Scherbe. „Unsere Vermutung, dass es sich um ein Stück eines bemalten Wandtellers handelt, hat sich bestätigt, würde ich sagen.“ Mangel und auch Koller schauten sich die Figur genau an, die auf dem Ausschnitt zu erkennen war. Man sah einen Mann in einem einfachen altertümlichen Gewand, sein Gesicht abgeschnitten.
„Ich vermute, es handelt sich um eine biblische oder antike Szene“, meinte Mangel. Mit ein bisschen Glück können wir bestimmen, wie das ganze Bild aussieht.