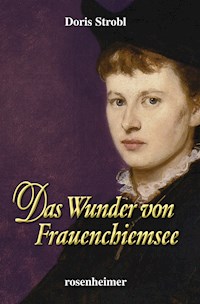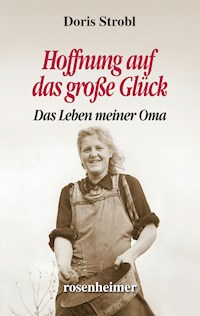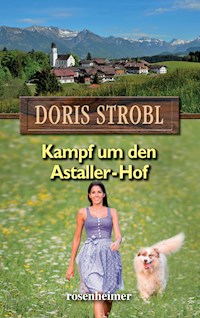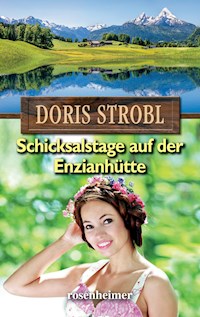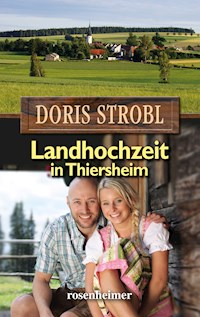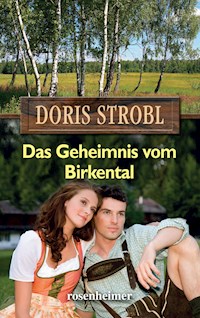
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rosenheimer Verlagshaus
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Korbinian Leitner ist nach dem Tod seines Sohnes verbittert und sieht für seinen Hof keine Zukunft mehr. Seine Tochter Bärbl würde das Erbe gerne antreten. Einer Frau möchte Korbinian den Hof aber nicht übergeben. Der geplante Autobahnanschluss des Dorfes scheint ihm einen Ausweg zu bieten, denn sein Land würde als Baugrund einen guten Preis erzielen. Bärbl hingegen schließt sich der Protestbewegung gegen den Autobahnbau an. Auf einer Demonstration lernt sie den Sägewerkbesitzer Leo Burger kennen. Die beiden verlieben sich ineinander, ohne zu ahnen, dass ihre Familien durch ein dunkles Geheimnis miteinander verbunden sind.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
LESEPROBE zuVollständige E-Book-Ausgabe der im Rosenheimer Verlagshauserschienenen Originalausgabe 2012
© 2015 Rosenheimer Verlagshaus GmbH & Co. KG, Rosenheimwww.rosenheimer.com
Titelfoto: © J-Wildman – www.istockphoto.com (oben)und Studio von Sarosdy, Düsseldorf (unten)Lektorat: Iris Erber, AistersheimSatz: Satzpunkt Ursula Ewert GmbH, Bayreuth
eISBN 978-3-475-54337-1 (epub)
Worum geht es im Buch?
Doris Strobl
Das Geheimnis vom Birkental
Korbinian Leitner ist nach dem Tod seines Sohnes verbittert und sieht für seinen Hof keine Zukunft mehr. Seine Tochter Bärbl würde das Erbe gerne antreten. Einer Frau möchte Korbinian den Hof aber nicht übergeben. Der geplante Autobahnanschluss des Dorfes scheint ihm einen Ausweg zu bieten, denn sein Land würde als Baugrund einen guten Preis erzielen. Bärbl hingegen schließt sich der Protestbewegung gegen den Autobahnbau an. Auf einer Demonstration lernt sie den Sägewerkbesitzer Leo Burger kennen. Die beiden verlieben sich ineinander, ohne zu ahnen, dass ihre Familien durch ein dunkles Geheimnis miteinander verbunden sind.
1
Nachdenklich saß Korbinian auf einer alten Bank, die am Feldweg auf einer Anhöhe stand. Hier war sein Lieblingsplatz. »So weit ich schau’n kann, gehört das alles mir«, murmelte er leise vor sich hin. Sein Blick schweifte über die vielen Felder und Wiesen bis ganz weit in die Ferne zum kleinen Birkenwald. »Aber für wen brauch ich’s denn noch?« Die Sonne schien, aber sie hatte nicht mehr die Kraft des Sommers. Fröstelnd stand Korbinian auf und ging weiter. Schlohweiße Haare hatte er, und sein Gang war langsam und schleppend. Wer ihn so sah, wusste, dieser alte Mann hatte schon viel erlebt und erlitten. Für die Schönheit der Landschaft hatte er keinen Blick mehr. Für ihn war der Anblick selbstverständlich. Die kleinen Dörfer, die vielen Wälder, die sanften Hügel und die Auen am Flussufer der Igst. Schon immer hatte er in Igstdorf gelebt. Er war hier geboren und aufgewachsen wie schon acht Generationen vor ihm.
Sein Heimatort hatte nicht viele Einwohner. Eine Kirche, ein Wirtshaus, einige alte Bauernhöfe und viele neue, kleine Einfamilienhäuser gehörten dazu. Seit Generationen lebten die Leitners hier. Durch fleißiges Arbeiten und sorgfältiges Haushalten hatte jede Generation der Leitners den Landbesitz vergrößern können. Wie man in Bayern so schön sagt, wurde »das Sach’ zusammengehalten«. Mit Respekt sprach man vom Leitner-Bauern, der sich zum größten Getreidebauern im Birkental entwickelt hatte. Dazu hatte Korbinian viel beigetragen. In den Siebzigerjahren fanden viele Bauernhöfe keine Nachfolger mehr. Die Söhne und Töchter hatten keine Lust, für den geringen Ertrag so schwer zu arbeiten wie die Väter. Korbinian bewies Weitsicht und kaufte Acker um Acker auf. Ihm war klar, dass nur große landwirtschaftliche Betriebe überleben würden. Die Zeit der Kleinbauern und Selbstversorger schien damals langsam, aber sicher zu Ende zu gehen. Das Leben eines Bauern hatte sich grundlegend verändert. Wenn er an die schwere körperliche Arbeit dachte, die er noch als Kind zu leisten hatte und in den Jahren nach dem Krieg – das konnte man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Seine Frau Kathi und er hatten ein Leben lang schwer und viel gearbeitet. Der ganze Lebensinhalt war das gewesen. Beim Kathreintanz waren sie sich näher gekommen. Er war erstaunt gewesen, dass sich eine wohlhabende Bauerntochter für ihn interessierte. Korbinian hatte sich heftig in die sieben Jahre jüngere Frau verliebt. Da war er schon über dreißig Jahre alt gewesen. So oft es ging, trafen sie sich. Sein Vater Binian und seine Mutter Kreszenz planten den Rückzug aufs Altenteil. Sie machten aber zur Bedingung, dass Korbinian endlich heiraten würde. Natürlich sollte auch ein Hoferbe geboren werden. Korbinian war auf Brautschau gegangen und hatte genau beobachtet, welche Frau zu ihm und zum Hof passen würde. Die Eltern blieben selbstverständlich auf dem Hof wohnen. Sie zogen zwar ins Austragshäusel, das um die Jahrhundertwende gebaut worden war, trotzdem war es wichtig, eine Frau zu finden, mit der alle gut auskommen würden. Freilich hatte Korbinian schon mit der einen oder anderen Magd eine Liebeständelei gehabt. Aber zum Heiraten kam nur eine Bauerntochter infrage, das war ihm schon klar. Er kannte die Erwartungshaltung seines Vaters. Auch in den Siebzigerjahren herrschten noch strenge Regeln. Korbinian und Kathi blieb nicht viel Zeit zum Kennenlernen. Sie waren beide in ihre Arbeit eingespannt. Unbeobachtet freie Zeit zu verbringen, war in den kleinen Dörfern fast unmöglich.
Schnell wurde da geratscht und getuschelt. Alles, was sich vor den Augen der Dorfgemeinschaft abspielte, wurde genau registriert und mit entsprechenden Kommentaren bedacht. Nur was hinter verschlossenen Türen geschah, das drang nicht nach außen. Aber da hatten dann die Eltern ein wachsames Auge, dass vor der Hochzeit nicht zu viel Intimität stattfand. Kathi und er waren sich sehr schnell sicher, dass sie zusammengehörten. Als sie seinen Heiratsantrag annahm, musste er seinen ganzen Mut zusammennehmen. Dann hielt er bei Kathis Vater um ihre Hand an. Der hatte gesagt: »Ja, das sind die modernen Zeiten. Wird mir nix anders übrig bleiben, als die Zustimmung zu geben. Aber du weißt schon, früher wär so eine Verbindung wohl nicht zustand’ gekommen.«
Das war Korbinian schon klar. Denn sein Besitz reichte bei Weitem nicht an den Reichtum von Kathis Familie heran. Doch es war allgemein bekannt, dass Korbinian fleißig war und sein Geld nicht ins Wirtshaus trug. Und Kathi war sehr starrköpfig. Was sie sich in den Kopf gesetzt hatte, das bekam sie auch.
Was waren das für glückliche Zeiten gewesen! Wochen vorher war der Hochzeitslader von Haus zu Haus gezogen und hatte die Einladung zum großen Fest ausgesprochen.
Korbinian schloss die Augen. Er hörte, wie die Musik aufspielte. Er sah sich mit der strahlenden, jungen Kathi im Arm über den Tanzboden wirbeln. Was war das für ein schöner Tag gewesen! Kathi sah in ihrem weißen Brautdirndl so bezaubernd und begehrenswert aus. Gerade jetzt spürte er den gleichen Stich in seinem Herzen wie damals. Es war eine der letzten ganz großen Bauernhochzeiten gewesen. Kathis Vater hatte sich nicht lumpen lassen. Den großen Saal vom Postwirt hatte er gemietet, mit dem Tanzboden und dem großen Speiseraum.
Es waren über einhundertfünfzig Gäste gekommen.
Natürlich gab es Neider, als man den gut bestückten Brautwagen sah, der von zwei prächtigen Rössern durch das Dorf gezogen wurde. Auch das Barvermögen, das sie mit in die Ehe brachte, war nicht unerheblich gewesen. Im Wirtshaus hatte man Korbinian dann darauf angesprochen. »Gell, kennst den Spruch auch: Die Liab geht, das Sach bleibt.« Als junger Mann war Korbinian ein Heißsporn gewesen, so hatte es gleich eine ordentliche Rauferei gegeben. Er ließ sich nichts gefallen und nichts nachsagen.
Alle hatten sich immer seinem Willen gefügt, das war er so gewohnt. Sein Leben war eingebettet in feste Rituale. Jede Jahreszeit stellte eine andere Anforderung an seine Arbeit. Aber eines war immer gleich: Unter der Woche wurde gearbeitet, am Sonntag ging man in die Kirche. Der Sonntag war ihm immer heilig und auch die einzige Abwechslung, die er in seinem Leben zuließ. »Ich habe nie einen Urlaub machen wollen, wozu auch? Wo kann es schöner sein als zu Hause?«, dachte er. »Aber die Kathi«, sinnierte Korbinian, »war sie wirklich glücklich mit mir?« Er wusste es nicht genau, sie hatten nie darüber gesprochen. Seine Frau hatte zu keiner Zeit Wünsche geäußert oder Ansprüche angemeldet. Sie hatte die Arbeit im Haus und im Stall erledigt. Sie war eine gütige und freundliche Frau gewesen, den zwei Kindern eine gute Mutter. War er ein guter Vater gewesen? »Ach, Kathi«, dachte Korbinian und sah hoch zum Himmel. »Wenn du nicht dort droben bist, wer dann?« Viel zu früh war sie verstorben, mit neunundfünfzig Jahren war sie bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Erst nach ihrem Tod, hatte er gemerkt, welche Stütze sie ihm ein Leben lang gewesen war.
Wie selbstverständlich sie für ihn gesorgt hatte! Auch wenn sie nicht viel miteinander gesprochen hatten, waren sie doch sehr innig verbunden gewesen. Nun hockte er alleine auf der Bank vor dem Haus. Niemand saß mehr neben ihm und hielt seine Hand. Solange Kathi ihre Hand in seine legte, war ihm das nie bewusst aufgefallen. Erst als sie nicht mehr da war, merkte er das Fehlen dieser Geste. Vier Jahre war das jetzt her. Vier lange, einsame Jahre. »Nach Rom wollte sie«, erinnerte er sich. Als sie wie jeden Abend die Zeitung durchgeblättert hatten, hatte sie ihm eine Anzeige vom Pilgerbüro gezeigt. Fünf Tage Rom mit Papstaudienz. »Das wäre doch ein schönes Geschenk zu meinem sechzigsten Geburtstag«, rief sie begeistert. »Jetzt, wo wir einen deutschen Papst haben, wäre das doch die Gelegenheit, nach Rom zu fahren.« Aber Korbinian protestierte.
»Ich steig in kein Flugzeug!«
»Das ist doch das Schöne«, sagte sie, »es ist eine Busreise. Wir müssen uns um gar nichts kümmern. Wir steigen ein und dann ist alles organisiert.« Dann schwärmte sie weiter. »Die Spanische Treppe, das Forum Romanum, das Kolosseum, die vielen Kirchen. Und der Petersdom, den wollte ich schon immer mal sehen. Der muss ja gewaltig sein.« Sie blickte von der Zeitung hoch und fragte dann: »Magst du nicht gern den Papst persönlich sehen? An einem Vormittag ist der Besuch des Vatikans mit einer Audienz eingeplant.«
»Ich weiß nicht, Kathi, in so einer großen Stadt, mit so vielen Menschen ... ich glaub, das mag ich nicht. Dieses Gedränge, dieser Lärm, und bestimmt ist die Luft recht schlecht.«
»Ach Korbinian, noch nie in meinem Leben hab ich in einem Hotel übernachtet. Das allein würde mich schon interessieren. Frühstück ist auch dabei und Abendessen. Einmal im Leben nur hinsetzen und sich bedienen lassen. Das stell ich mir so schön vor!«
»Na, na, durchgelegene Betten und dreckige Badezimmer, wie man es in den Fernsehberichten immer sieht. Das muss ich nicht haben! Und in Rom gibt’s auch so viele Taschendiebe. Nein, da muss ich nicht hin.«
»Schade«, hatte sie nur gemurmelt.
Er war nicht mehr darauf eingegangen und damit war das Thema erledigt. Denn er wusste ganz genau, alleine wäre sie nie gefahren. Nach ihrem Tod fand er in ihrem Nachtkästchen einen Reiseführer von Rom. Da saß er dann auf ihrem Bett, mit dem Bücherl in der Hand und vergoss bittere Tränen. Ach, wenn sie doch noch leben würde. Überall würde er jetzt mit ihr hinfahren. Sogar in ein Flugzeug würde er steigen.
Das war auch etwas, was immer noch an ihm nagte, dass er ihr diesen letzten Wunsch nicht erfüllen wollte. Sicher, sie hätte die Reise nicht mehr erlebt, da sie vorher verunglückt war. Doch die Vorfreude wäre doch auch schön für sie gewesen.
Vroni, die Hauswirtschafterin, die kurz nach Kathis Tod auf den Hof gekommen war, konnte Kathi nicht ersetzen. Dennoch sorgte sie für einen geregelten Ablauf im Haus. Vroni hatte sich auf eine Anzeige gemeldet, die Korbinian im Gemeindeblatt aufgegeben hatte. Sie war Witwe, Mitte fünfzig und selbst Mutter von zwei erwachsenen Söhnen und lebte allein in einer Wohnung ganz in der Nähe des Leitnerhofes. Sie war erleichtert, nicht mehr so weit zur Arbeit fahren zu müssen. Sie hatte lange Jahre als Haushälterin bei einer Industriellenfamilie in Grünwald bei München gearbeitet. Doch je älter sie wurde, umso anstrengender war ihr die tägliche Fahrt in die Stadt geworden. Sie war froh, jetzt für Korbinian sorgen zu können. Ihre mütterliche Art tat Korbinian sehr gut. Auch wenn er es nie zugegeben hätte, Vroni hatte wieder etwas Normalität in sein Leben gebracht. Sie war eine rundliche, gemütliche Frau, die ausgezeichnet kochen konnte und den Haushalt gut im Griff hatte. Sie verwöhnte Korbinian mit seinen Lieblingsgerichten. Dampfnudeln, Apfelpfannkuchen und Apfelstrudel mochte er besonders gerne. Dann scherzte sie mit ihm und nannte ihn einen »G’schleckerten«. Obwohl sie manchmal den Eindruck hatte, dass er ihre Mühe gar nicht wahrnahm, ließ sie es sich nicht nehmen, mit Liebe und Sorgfalt zu kochen. Meistens gelang es ihr durch ihre resolute, aber doch freundliche Art, ihn aus seinen traurigen Stimmungen zu reißen und ihm neuen Lebensmut zu geben. Er schätzte ihre Anwesenheit, doch er dachte niemals daran, sich auf eine neue Beziehung mit einer Frau einzulassen. Oder gar noch mal zu heiraten, das kam ihm niemals in den Sinn.
Er blieb stehen, sein Atem ging schwer. Seine Gedanken schweiften wieder in die Vergangenheit zurück. Er hatte auch noch Andreas verloren, seinen einzigen Sohn. Sein Bub, der Hoferbe, war tot. Er sah die bunt gefärbten Bäume. Er hörte, wie das trockene Laub, das der Wind vom Mischwald herübergeweht hatte, unter seinen Füßen raschelte. »Jetzt ist es Herbst geworden«, raunte er fast verwundert. Für diese Jahreszeit hatte er die Übergabe des Hofes geplant. Andreas war gerne Landwirt gewesen. Schon immer hatte er fleißig mitgearbeitet. Nun sollte der Bub den Betrieb nach seinen eigenen Vorstellungen führen. Korbinian war bereit, mit seinen siebzig Jahren dem Sohn Platz zu machen. Das war die natürliche Ordnung. So wie ihm sein Vater eines Tages den Hof überlassen hatte. Er hatte sich schon mit dem Gedanken angefreundet, in das kleine Austragshäusel zu ziehen. Er hatte begonnen, seine Sachen zu ordnen und auszusortieren. Alles, was er nicht mehr brauchte, sollte entsorgt werden.
Dann war Andreas im Frühjahr gestorben. »Er war erst fünfunddreißig!«, schrie Korbinian unvermittelt. Er hob seinen Kopf zum Himmel und rief zornig: »Gott, warum hast du mir das angetan? Warum hast du mir den Andreas auch noch genommen?« Er merkte, dass Tränen in seine Augen stiegen und kämpfte dagegen an.
»Tapfer sein, tapfer sein, es hilft ja nichts«, redete er fast beschwörend auf sich ein.
Nach einem starken Wintersturm im Januar hatte er mit seinem Sohn im Birkenwald prüfen wollen, ob die Bäume Schaden genommen hatten. Es war ein klarer, aber bitterkalter Tag. Reif lag auf den Feldern, und der eisige, schneidende Wind war sehr unangenehm. Sie waren es beide gewohnt, weite Strecken zu gehen. Doch Andreas blieb schon nach kurzer Zeit stehen. Korbinian wurde ungeduldig und trieb zur Eile an. »Andreas, jetzt geh doch nicht so langsam, es ist kalt und wird schnell dunkel. Wir kommen ja gar nicht voran. Komm jetzt, geh zu!«
Stumm hatte Andreas genickt und war etwas schneller gegangen. Als Korbinian nach einigen Minuten das Wort an ihn richten wollte, war er wieder ein paar Meter hinter ihm. »Ja wo bleibst denn?«, drängelte Korbinian. »Hast gestern Abend zu viel Bier getrunken oder keine Lust heute?« Er wartete, bis ihn sein Sohn eingeholt hatte. Als er schwer atmend neben ihm stand, fiel dem Vater das bleiche, fahle Gesicht auf. »Vater, ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Ich hab keine Kraft mehr, schon länger bin ich immer so schnell müd’«, flüsterte Andreas. Dann lehnte er sich schwer atmend an einen Baum und schloss die Augen. Korbinian war furchtbar erschrocken. So hatte er den Sohn noch nie erlebt. »Ruh dich ein bisserl aus«, riet er ihm. »Wir hören für heute auf und fahren zurück.« Auf dem Weg zum Auto musste er den Sohn stützen. Dann saß Andreas mit geschlossenen Augen auf dem Beifahrersitz. »Ich fahr dich jetzt sofort zum Doktor«, beschloss Korbinian. Andreas flüsterte: »Ach, was wird der schon finden. Ich lege mich daheim ins Bett und ruh mich aus. Wie die Großmutter immer gesagt hat, wenn sie sie sich krank gefühlt hat: Sieben Tage kommt’s, und sieben Tage geht’s.« Korbinian stimmte zu, aber er machte sich so seine Gedanken. Andreas fühlte sich also krank und das schon seit einiger Zeit. Am nächsten Morgen beim Frühstück sprach Vroni Andreas an. »Wie du ausschaust in letzter Zeit, das gefällt mir schon länger nicht. Aber heute bist ja grad schneeweiß im Gesicht. Jetzt hör doch auf mich und geh zum Doktor!« Korbinian sah seinen Sohn an. Im Gegensatz zu Vroni war ihm nicht aufgefallen, dass sich das Aussehen seines Sohnes verändert hatte. Aber sie hatte recht, heute sah er richtig bleich und eingefallen aus. »Komm, Andreas, die Vroni hat recht.« Diesmal duldete er keine Widerrede: »Wir fahren jetzt zum Doktor.« Der stellte nach einer kurzen Untersuchung gleich eine Einweisung für das Krankenhaus aus. »Fahrt heute noch hin«, riet er. »Wenn es das ist, was ich vermute, zählt jeder Tag.«
Nachdem Vroni daheim schnell noch eine Tasche mit den nötigsten Sachen gepackt hatte, fuhren sie gleich ins Krankenhaus. Schon nach einem Tag stand die Diagnose fest: Leukämie in einem weit fortgeschrittenen Stadium. »Es gibt keine Heilung mehr«, sagte der Chefarzt zu Andreas. Korbinian stand dabei und sah, wie gefasst und tapfer Andreas diese Nachricht aufnahm. Korbinian musste sich zusammenreißen, damit der Sohn nicht merkte, wie schockiert er war.
»Wir werden aber dafür sorgen, dass Sie keine Schmerzen haben«, versprach der Arzt. Andreas fragte dann mit kraftloser Stimme: »Wie lang hab ich denn noch zu leben?« Der Arzt antwortete: »Das kann man natürlich nicht ganz genau sagen, aber länger als zwei Monate werden es nicht sein.« »Zwei Monate«, flüsterte Andreas. »Zwei Monate!« Dann schloss er die Augen und Korbinian saß stumm an seinem Bett. Gerne hätte er irgendetwas Tröstliches zu seinem Sohn gesagt. Aber er fand keine Worte. In ihm war alles leer. Nicht einmal die Hand von Andreas hielt er. Bis heute machte er sich deswegen furchtbare Vorwürfe. Er meinte, in dieser Situation vollkommen versagt zu haben. Er hätte die Gelegenheit ergreifen sollen, ihm zu sagen, wie sehr er ihn mochte und schätzte. Er hatte es versäumt, seinen Sohn nach seinen letzten Wünschen zu befragen. Oder ob er ihm noch etwas Gutes tun könne. Am besten wäre gewesen, er hätte ihn in ein anderes Krankenhaus verlegen lassen. Nach München-Großhadern vielleicht. Dort hätte es vielleicht Spezialisten gegeben, die sein Leben gerettet hätten.
Aber nein, er saß nur stumm und starr da. Gerade so, als ob ihm das jetzt gar nicht passieren würde.
Andreas war auch sehr schweigsam. Erst als es Abend wurde, sagte er: »Papa, fahr heim, du kannst doch hier auch nichts ausrichten.« Er wollte nicht, doch Andreas drängte ihn dazu. Also fuhr er schweren Herzens nach Hause, ohne zu wissen, dass dies die letzten Worte waren, die er von seinem Sohn hören sollte.
Am nächsten Morgen, als er sich gerade auf den Weg ins Krankenhaus machen wollte, kam ein Anruf. »Herr Leitner, Ihr Sohn ist ins Koma gefallen, es wäre gut, wenn Sie schnell hier sein könnten.«
Er konnte sich nicht erinnern, wie er den Weg ins Krankenhaus zurückgelegt hatte. Zwei Tage saß er Tag und Nacht bei seinem Sohn am Bett und verhandelte mit dem lieben Gott. »Lass mir den Bub, Gott«, betete er. »Nimm mich an seiner Stelle. Ich gehe auch Wallfahrten nach Altötting und bringe die größte Kerze mit, die ich finden kann. Ich würd auch etwas für die armen Leut’ spenden. Ich zahl die Renovierung unserer Dorfkapelle. Gott, wenn du etwas anderes von mir willst, gib mir ein Zeichen, nur nimm mir den Buben nicht.« Gott blieb stumm. Korbinian hatte keinen Hunger und spürte keinen Durst. Gar nichts spürte er und brauchte auch keinen Schlaf. Er saß nur da und schaute seinen Sohn an, der nun an einige medizinische Geräte angeschlossen war. Aus einem plötzlichen Impuls heraus legte er seine Hand auf die kalte Hand des Sohnes. »Ich wärm dich«, wisperte er. »Ich wärm dich, mein Bub, hast ja ganz eiskalte Händ’.«
Mit wachsbleichem Gesicht und geschlossenen Augen lag Andreas da. Atmete ein und aus, ein und aus, ein und ganz tief aus. Und plötzlich kein Einatmen mehr. Erschrocken lauschte Korbinian, wartete auf das nächste Einatmen, aber es kam keines mehr. Ungläubig starrte er auf seinen Sohn, beugte sich über ihn, versuchte noch Leben wahrzunehmen. Doch ein langgezogener, fast klagender Ton aus einem der Apparate machte klar, dass hier der Tod stärker war als das Leben. Eine Krankenschwester kam ins Zimmer gelaufen, nahm den Arm von Andreas und fühlte seinen Puls. »Sinnlos«, wollte Korbinian schreien. »Sinnlos!« Doch er blieb stumm. Die Krankenschwester wandte sich an ihn. »Ich hole jetzt einen Arzt. Kann ich etwas für Sie tun?« Er schüttelte nur den Kopf. In ihm stieg eine furchtbare Wut auf, ein Zorn, wie er ihn bis dahin nicht gekannt hatte. Er konnte nicht weinen. Auch nicht, als er am offenen Grab seines Sohnes stand, der neben der Mutter nun seine letzte Ruhestätte fand. Fast das ganze Dorf war zur Beerdigung gekommen. Korbinian wurde bewusst, wie beliebt sein Andreas gewesen war. Er war Mitglied bei der freiwilligen Feuerwehr, beim Schützenverein, beim Männergesangsverein und im Fußballverein. Alle erwiesen ihm die letzte Ehre, erschüttert und traurig über seinen frühen Tod. Es flossen viele Tränen, doch diese Tränen weinten die anderen Menschen. Er hörte sie flüstern: »Schaut euch den Korbinian an, wie gebückt er dasteht. Er sieht alt und gebrochen aus. Wie furchtbar für den armen Mann. Erst die Frau, nun der Sohn.«
Korbinian zog sich von den Menschen zurück und ließ niemanden an sich heran. Auch die, die es gut mit ihm meinten, ihm helfen und beistehen wollten. »Lasst mich in Ruhe«, sagte er nur. »Lasst mich einfach in Ruhe.« In dieser Zeit war der zweiundvierzigjährige Simon als Betriebshelfer zu ihm gekommen und hatte sich um die laufenden Arbeiten gekümmert. Er war ein tüchtiger Mann, der gut organisieren konnte und auch mit Leib und Seele der Landwirtschaft verbunden war. Was nur von vorübergehender Dauer sein sollte, wurde zu einer festen Anstellung. Simon mochte seinen Posten auf dem Leitnerhof und die beiden Männer kamen auch gut miteinander aus. Korbinian tat weiter seine Arbeit, doch ohne Freude und wirkliches Interesse. Sein Pflichtbewusstsein befahl ihm, weiterzumachen, doch es erschien ihm zunehmend sinnlos. Seine Tochter Bärbl lebte in der Stadt. Für wen sollte er also den Hof erhalten? Bärbl hatte das freundliche, zupackende und praktische Wesen ihrer Mutter geerbt. Auch äußerlich war sie das Ebenbild seiner Kathi. Das schmale Gesicht, die langen braunen Haare, die sie meist offen trug. Doch sie war zierlicher, wirkte fast zerbrechlich und sah viel jünger aus, als sie tatsächlich war.
Wie schon nach dem Tod der Mutter, hat Bärbl nach Andreas’ Tod sofort Urlaub genommen. Einen Monat ist sie bei ihm auf dem Hof geblieben. Sie haben zusammen getrauert. Er war ihr dankbar, dass sie ihm keine Vorwürfe gemacht hat, weil er sie nicht ans Krankenbett von Andreas geholt hatte. Sie hatte sich von ihrem Bruder nicht verabschieden können. In seiner Panik, den Sohn zu verlieren, hatte er vergessen, Bärbl zu benachrichtigen. Umso dankbarer war er für ihre Hilfe in der ersten, schweren Zeit der Trauer. Heute war er überzeugt davon, dass er sich umgebracht hätte, wäre sie in den ersten Wochen nicht bei ihm gewesen. Er ertappte sich dabei, dass er immer noch daran dachte, seinem Leben ein Ende zu setzen, so sinnlos erschien ihm an manchen Tagen das Weiterleben.
Eines Tages besuchte ihn Pfarrer Rösner. »Leitner-Bauer, der Andreas hat es gut, da wo er jetzt ist«, sagte er zu Korbinian. »Besteht dein Schmerz nicht darin, dass nicht dein Wille, sondern Gottes Wille geschehen ist? Du trauerst, weil deine Pläne nicht in Erfüllung gegangen sind, so wie du sie haben wolltest. Beende dein Selbstmitleid und wende dich wieder dem Leben zu.«
»Ja, Pfarrer, du redest dich natürlich leicht. Wer noch nie ein Kind gehabt hat, weiß doch gar nicht, wie es ist, eines zu verlieren. Und jetzt ist es besser, du gehst wieder und lässt mich in Ruhe.«
Der Pfarrer antwortete ruhig: »Deine Ruhe willst du? Die hast du gleich wieder, Korbinian. Ich geh sofort, aber eines will ich noch sagen. Ich kenne dich und deine Familie schon ein halbes Leben lang. Ich habe dich und die Kathi getraut. Deine Kinder hab ich getauft, sie bei der Erstkommunion und der Firmung gesegnet. Sie waren im Religionsunterricht bei mir. Jeden Sonntag warst du mit deiner Familie in der Kirche. Wie sich die Bärbl um dich gesorgt und gekümmert hat, das ist nicht selbstverständlich. Sie ist ein großartiges Mädel.« Ja, seine Tochter, seine Bärbl. Obwohl sie ihn so an Kathi erinnerte, obwohl sie das gute Wesen der Mutter hatte, kamen sie nicht recht zusammen. Er wusste nicht, woran es lag. Natürlich hatte er sich immer einen zweiten Buben gewünscht. So war das halt auf dem Land, da waren Söhne einfach wichtig. Wie glücklich waren er und Kathi gewesen, als sie nach einigen Fehlgeburten endlich wieder ein Baby in den Armen hielten. Korbinian versuchte, seine Enttäuschung zu verbergen, dass es nur ein Mädel war. Er wusste, noch ein Kind würde Kathi nicht bekommen können. Und er wollte auch nicht undankbar sein, denn er hatte ja zumindest einen Sohn, seinen Andreas.
Bärbl hatte die unausgesprochene Ablehnung wohl immer gespürt. Sie war ihm schon als Kind aus dem Weg gegangen. Sie hatte sehr an ihrer Mutter gehangen. Es kam ihm auch in den Sinn, dass sich der Herrgott vielleicht für seine Undankbarkeit gerächt hatte. Die Worte des Pfarrers wirkten bei ihm nach. Stimmte es, was er gesagt hatte? Selbstmitleid? Gerade war Bärbl wieder zurück in die Stadt gefahren. Sie hatten sich im Streit getrennt.
»Vater, ich versteh dich nicht«, meinte seine Tochter. »Du bist bald siebzig Jahre alt, und du kannst doch nicht ewig so weitermachen. Ich würd gern wieder heimkommen, mit dir und dem Simon arbeiten. Du gibst mir deine Erfahrung und dein Wissen weiter, dann könnte ich den Hof übernehmen. Ich würd wirklich gern wieder hier leben und arbeiten.« Er hatte mürrisch geantwortet »Einem Frauenzimmer geb ich meinen Hof nicht. Seit acht Generationen ist der Hof immer vom Vater auf den Sohn übergegangen.« Da antwortete sie ruhig, freundlich und sehr traurig: »Die Welt hat sich geändert. Es gibt in Deutschland eine Bundeskanzlerin, da werde ich doch einen Bauernhof bewirtschaften können. Für die schwere Arbeit gibt’s doch Maschinen. Außer ein paar Katzen haben wir auch keine Tiere mehr zu versorgen. Die Arbeit des Bauern hat sich doch total gewandelt. Vor hundert Jahren war das anders, da musste man körperlich schwer arbeiten. Was ist denn, wenn du plötzlich nicht mehr kannst? Bevor der Hof dann in fremde Hände kommt, gib ihn lieber mir. Lass es uns doch zusammen probieren.« Schroff sagte er: »Nein, Bärbl, du hast dich damals für ein Leben in der Stadt entschieden. Bist ein feines Bürofräulein geworden, mit solchen Händen kann man nimmer Bäuerin werden.« Sie wollte noch etwas sagen. Doch er wehrte sie mit einer Handbewegung ab.
»Das war jetzt mein letztes Wort, brauchst nimmer reden.«
2
Bärbl war jetzt achtundzwanzig Jahre alt. Manchmal glaubte sie, dass er noch gar nicht begriffen hatte, dass sie eine erwachsene Frau war. Bei ihrer Geburt war er schon enttäuscht, dass sie ein Mädel war. Er hatte sich auch gar nicht die Mühe gemacht, nach einem besonderen Namen für sie zu suchen. Als sie am vierten Dezember geboren wurde, am Barbaratag, wurde sie einfach nach der heiligen Barbara genannt. Bei Andreas hatte man sich schon mehr Mühe gegeben. Da hatte er mit der Tradition gebrochen, dass der Erstgeborene immer wie der Vater heißt. »So einen altmodischen Namen wie Korbinian weitergeben, das kann man nicht machen«, hatte er damals zu ihrer Mutter gesagt. Nach ihr konnte die Mutter keine weiteren Kinder mehr bekommen. Andreas war immer Vaters Liebling gewesen und sie wurde gerne von ihm übersehen. Das merkte sie schon als kleines Kind. Als Andreas und sie einmal die Mutter fragten, wen sie denn lieber hätte, gab sie die Antwort. »Ich habe euch beide gleich lieb. Von ganzem Herzen!« Das hatte Bärbl ihr geglaubt, doch beim Vater war das anders.
Es hatte ihr auch sehr weh getan, dass er sie nicht angerufen hatte, als Andreas im Sterben lag. Sie wäre auch gerne ins Krankenhaus zu ihm gefahren. So konnte sie nicht einmal Abschied nehmen von ihrem Bruder.
Sie und Andreas hatten sich immer gut verstanden. Sie hatte ihren großen Bruder vergöttert und er hatte seine kleine Schwester beschützt, wenn die anderen Kinder frech zu ihr waren. Einmal hatte sie den alten Buttertopf, den schon ihre Oma benutzt hatte, fallen lassen. Er war in tausend Stücke zerbrochen und sie hatte Angst gehabt, es den Eltern zu sagen. Sie war damals fünf Jahre alt und Andreas zwölf. Da hatte er behauptet, es wäre seine Schuld gewesen, dass der Topf kaputt gegangen war. Eine Woche Hausarrest hatte er dafür abgesessen. Oft dachte sie auch an die schönen Sommernachmittage, als sie zusammen ausgeritten waren. Als sie sechzehn Jahre alt war, durfte sie nur mit zum Tanzen gehen, weil der Vater wusste, dass Andreas auf sie aufpasste. Dankbar dachte sie daran, dass sie ihrem Bruder nie lästig gewesen war. Er hatte immer auf sie geschaut und sie auf ihn. Beim Vater war das anders gewesen. Immer schon hatte sie das Gefühl gehabt, dass sie ihm nie etwas recht machen konnte. Nie hatte er ihr etwas zugetraut. Deswegen war sie schon mit achtzehn Jahren von zu Hause weggegangen und nach München gezogen. Bärbl hatte eine Ausbildung zur Hotelkauffrau gemacht und dann eine Stelle als Empfangssekretärin an der Rezeption des »New Grand Hotel« in München angenommen. Von Anfang an hatte sie sich in diesem Hotel wohlgefühlt. In diesem Fünf-Sterne-Haus logierten oft prominente Stars oder Manager großer Firmen. Bärbl sprach fließend Englisch und Französisch und war wegen ihrer freundlichen und offenen Art bei den Gästen sehr beliebt. Sie war sehr froh, ein Zimmer im Personaltrakt des Hotels beziehen zu können. Als das Hotel einer Generalsanierung unterzogen wurde, hatte sich das Hotelmanagement dazu entschlossen, die Personalwohnräume ebenfalls zu renovieren. So konnte Bärbl in ein komplett neu möbliertes Zimmer ziehen. Der Raum war etwa dreißig Quadratmeter groß und mit modernen weißen Einbauschränken ausgestattet. Es gab ein komfortables Bett, eine kleine rote Couch, einen Flatscreen-Fernseher, und ein edles Bad. Da Bärbl alle Mahlzeiten in der Personalkantine des Hotels einnehmen konnte, gab es keine Küche, aber eine Kaffeemaschine und einen Wasserkocher. Als sie das Zimmer zum ersten Mal gesehen hatte, war ihr klar, dass sie sich hier wirklich wohlfühlen könnte. Natürlich hatten Kollegen sie gewarnt, dass es auch Nachteile hätte, direkt am Arbeitsplatz zu wohnen. Man sei immer verfügbar und könnte auch aus der Freizeit zur Arbeit geholt werden. Doch das schien Bärbl das geringere Übel. Denn im überteuerten München ein eigenes bezahlbares Zimmer zu finden, war schier unmöglich. Außerdem war Bärbl es nicht gewohnt, alleine zu wohnen und wollte das auch nicht. Ihre Entscheidung hatte sich als goldrichtig erwiesen. Kaum war sie eingezogen, überraschten sie ihre Mitbewohner mit einer Willkommensparty. Wie sich schnell herausstellte, wohnten in den siebenunddreißig Personalzimmern vor allem die jungen Hotelangestellten. Nach getaner Arbeit wurde oft gemeinsam etwas unternommen. Bevorzugt gingen sie zum »Kunstpark Ost« oder in eines der zahlreichen Lokale im Glockenbachviertel. Zusammen auszugehen, machte ihr viel Spaß. Doch sie genoss auch die Frauenabende mit ihrer Freundin Jessica, die wie sie als Empfangssekretärin im New Grand Hotel arbeitete. Jessica kam aus Berlin, war groß, blond und blauäugig und so alt wie Bärbl. Wenn die beiden Frauen unterwegs waren, erlebten sie immer sehr lustige Abende. Bärbl hatte noch nie jemanden gekannt, mit dem sie so viel lachen konnte. Es tat auch gut, eine Freundin zu haben, mit der sie sich aussprechen konnte. Die auch ihren Kummer verstand und teilte. Genauso war sie für Jessica immer da und sie schätzten einander sehr. Als einige Kollegen sich für einen Tangokurs anmeldeten, machten sie begeistert mit. Der siebenundzwanzigjährige Daniele, ein Hoteliersohn aus Mailand, entpuppte sich als der ideale Tanzpartner. Die Discobesuche wurden weniger. Immer öfter nahmen sie an Veranstaltungen teil, bei denen sie Tango tanzen konnten. Daniele war Barkeeper an der Hotelbar. Vor allem bei den Damen war er durch seinen italienischen Akzent und seinen Charme sehr beliebt. »Seniora äh bittä, darf ich Ihnen eine besondere Cocktail machen, der zu so schöner Frau, wie Sie es sind, passt?«, fragte er oft. Selbstverständlich fühlten sich die Damen geschmeichelt und stimmten zu. Den Männern bot er »Drink für de richtige, starke Mann« an – und hatte auch damit Erfolg. Er hatte in diesem Jahr den Sieg bei der »Deutschen Cocktail Meisterschaft« errungen. Der außergewöhnliche und vollkommen neue Geschmack des Getränks hatte die Jury begeistert. Der Cocktail trug den Namen »arabrab«. »Zu diesem Sieg hast du auch beigetragen«, sagte er zu Bärbl. »Ich kann mich beim Tanzen so gut entspannen, da habe ich immer die besten Ideen, welche Drinks ich mixen könnte.« Wochenlang hatte er vor der Meisterschaft neue Mixturen ausprobiert. Jessica und Bärbl hatten sie alle getestet. Auch wenn es meistens nur ein kleiner Schluck war, war es doch eine Herausforderung gewesen, die verschiedensten Alkoholika und Geschmacksrichtungen auszuprobieren. Das Hotelmanagement sah es gerne, wenn Mitarbeiter an Wettbewerben teilnahmen und stellte deshalb großzügig die gesamte Bar als Übungsplatz zur Verfügung. Dennoch musste Daniele seine Freizeit opfern, um den perfekten Cocktail zu entwickeln. Doch er war Barkeeper aus Leidenschaft und sein Beruf war sein Hobby. Er träumte davon, irgendwann seine eigene Bar zu eröffnen. Obwohl seine Eltern immer noch hofften, dass er das Familienhotel übernehmen würde. Die Gerüchteküche brodelte natürlich. Waren Bärbl und Daniele ein Liebespaar? Hatten sie ein Verhältnis? Ja oder Nein? Der Sieger-Cocktail gab wieder Anlass zu Spekulationen. Denn »arabrab« rückwärts gelesen heißt Barbara. So sehr sich Daniele um Bärbl bemühte, so bitter und traurig war es für ihn, als er einsehen musste, dass er nur Bärbls Freundschaft haben konnte. Er hatte lange um sie geworben, sie hatten sich geküsst und eine Nacht zusammen verbracht. Doch Liebe oder Leidenschaft wollte sich bei Bärbl nicht einstellen. »Es tut mir so leid, Daniele«, hatte sie zu ihm gesagt. »Ich hätte mir so gewünscht, dass zwischen uns beiden mehr entstanden wäre, aber ich liebe dich nicht. Ich bin gerne mit dir zusammen, aber ich kann dir nur meine Freundschaft anbieten.« Um sie nicht ganz zu verlieren, hatte sich Daniele darauf eingelassen, doch manchmal schmerzte es ihn schon, einfach nur der beste Freund zu sein. Bärbl war während ihrer Ausbildungszeit mit einem zwanzig Jahre älteren Mann zusammen gewesen, der sie aber immer wieder betrogen hatte. Wenn sie auf diese Beziehung zurückblickte, musste sie sich eingestehen, dass sie in ihm einen Vaterersatz gesehen hatte. Sie hatte sich damals auch nicht stark genug gefühlt, ihr Leben alleine zu verbringen. Das hatte er gespürt und ausgenutzt. Er wusste, sie würde sich ohne ihn schutzlos fühlen und daher bei ihm bleiben. So fand sie immer wieder Hinweise auf andere Frauen in seinem Leben. Als sie älter wurde und sich beruflich etabliert hatte, gewann sie auch an Selbstsicherheit. Es war ihr nicht leichtgefallen, sich aus dieser Verbindung zu lösen, doch letztendlich hatte sie es geschafft. Dazu hatte auch das Leben mit den anderen unbeschwerten jungen Leuten im New Grand Hotel beigetragen. Auch Jessica hatte sie sehr unterstützt. Verständnisvoll hatte sie zugehört, und so fand Bärbl bald wieder zu ihrer alten Fröhlichkeit zurück. Da sie ihre Arbeit gerne tat, störte sie auch der Schichtdienst nicht. Die Frühschicht ging von sechs bis vierzehn Uhr, die Spätschicht von vierzehn bis zweiundzwanzig Uhr und die Nachtschicht von zweiundzwanzig bis sechs Uhr. Alle Kollegen des achtköpfigen Rezeptionsteams bekamen am Monatsanfang ihren Dienstplan und konnten so auch ihre Freizeitaktivitäten gut planen. Danieles bester Freund Sandro war ein ausgezeichneter Koch. Im Sommer, wenn die Frühschicht um vierzehn Uhr zu Ende war, gingen sie manchmal zum »Chinesischen Turm«, dem Biergarten im Englischen Garten. Da im Hotel oft Bankette, Hochzeiten oder Kongresse stattfanden, war immer mal etwas von den köstlichen Buffets übrig. Sandro brachte diese Reste dann mit in den Biergarten und sie schlemmten den ganzen Nachmittag. Legendär waren auch die nächtlichen Küchenpartys in der Personalküche. Die jungen Köche, die teilweise noch in der Ausbildung waren, waren stolz darauf, ihr Können zu zeigen und legten sich richtig ins Zeug. Das Hotelmanagement ließ sie gewähren, solange die Leistung stimmte. Die Arbeitsatmosphäre war ausgezeichnet. Teamgeist wurde in allen Abteilungen großgeschrieben. Wenn Bärbl Kolleginnen aus der Ausbildungszeit traf und hörte, wie schlecht das Arbeitsklima in manch anderen Hotelbetrieben war, freute sie sich noch mehr über ihren Arbeitsplatz. Sie hatte eine sehr schöne Zeit in München gehabt, doch seit Andreas’ Tod zog sie sich von den Kollegen immer mehr zurück. Mit Jessica oder Daniele konnte sie zwar über ihre Trauer sprechen. Sie meinten es sicher gut, wenn sie sagten: »Das wird schon wieder, die Zeit heilt alle Wunden«, aber das half Bärbl nicht wirklich. Sie konnten den Verlust, den sie erlitten hatte, nicht nachempfinden. »Denn nur Gefühle, die man selbst durchlebt und durchlitten hat, kann man verstehen«, dachte sie oft.
Durch dieses Unverständnis fühlte sie sich zunehmend einsam und isoliert. Dann meldete sie sich wieder: die große Sehnsucht nach Igstdorf, der Heimat, die immer in ihrem Herzen geblieben war. Die grünen Wiesen, die schönen Wälder und die gute Luft. Besonders im Sommer fehlte ihr die Natur.
Als die Mutter noch lebte, war sie mindestens einmal die Woche nach Hause gefahren. Auch heute noch, wenn sie von »zu Hause« sprach, war ihr geräumiges Zimmer im Leitner-Hof gemeint. Obwohl die Spannungen mit dem Vater zugenommen hatten, seit Andreas im Frühjahr gestorben war.
Das erste Jahr nach dem Tod der Mutter war sie noch regelmäßig nach Igstdorf gefahren, doch da sich ihr Vater immer mehr von ihr zurückgezogen hatte, waren ihre Besuche seltener geworden. Seitdem Andreas gestorben war, erweckte der Vater den Eindruck eines Eigenbrötlers. Wieder einmal hatte sie das Birkental wütend und ratlos verlassen. Bärbls Gedanken kehrten zum Vater zurück. Sie zwang sich, konzentriert zu fahren. »Wenn du mit einem Mann verheiratet wärst, der Interesse für das Bauernleben hätte, wär das wieder etwas anderes. Dann könnt ich mir schon vorstellen, dir den Hof zu geben«, hatte der Vater zu ihr gesagt. Kopfschüttelnd wies sie dieses Ansinnen zurück. »Papa, du bist so altmodisch, ich kann deine Vorstellungen nicht nachvollziehen.«
»Ich dräng dich zu nix«, hatte er geantwortet.
Die Landstraße war kurvenreich und galt als sehr gefährlich und unfallträchtig. Dieses waldreiche Teilstück, das nach Burgersdorf, zum größten Ort im Birkental führte, war eine der letzten Alleestraßen im süddeutschen Raum. Schöne, alte Bäume säumten die schmale Straße. Bäume, die schon viele Autofahrer das Leben gekostet hatten. So wie ihrer Mutter, die sie schmerzlich vermisste. Bärbl lenkte ihren Wagen in einen kleinen Feldweg und ging dann auf dem Grünstreifen entlang zu einem der Bäume. Hier war die Mutter gestorben, an diesem unglückseligen, nebligen Abend. Es war an einem Freitagabend. Die Mutter war beim Friseur in Burgersdorf gewesen und hatte dann noch einige Einkäufe erledigt. Sie hatte schon seit Jahren ihren eigenen kleinen Wagen, mit dem sie immer sehr sicher gefahren war. Die genaue Unfallursache hatte man nicht feststellen können. Vielleicht war ein Tier auf die Fahrbahn gelaufen. Oder die Scheinwerfer eines entgegenkommenden Autos hatten sie geblendet. Es gab eine sichtbare Bremsspur, aber dennoch war sie mit hoher Geschwindigkeit frontal gegen den Baum geprallt. Sie war auf der Stelle tot gewesen. Bärbl war an diesem Abend zufällig zu Hause gewesen. »Ich muss schnell weg«, hatte Andreas gerufen. »Autounfall auf der Alleestraße!«
Als Mitglied der freiwilligen Feuerwehr war er mit seinen Kameraden zum Unglücksort gefahren. Die Polizei war schon da und hatte die Straße gesperrt. Als Andreas zur Unglücksstelle gehen wollte, hielt ihn ein Kamerad auf. Er sah den Kommandanten der Feuerwehr mit einem Polizisten flüstern. Dann kamen sie auf ihn zu. An ihren betroffenen Gesichtern konnte er schon ablesen, dass etwas nicht stimmte. »Bleib da, Andreas«, riet der Kommandant. »Geh da nicht hin. Es tut mir so leid! Es ist deine Mutter und der Anblick ist nicht schön.«
»Wann kommt denn der Rettungshubschrauber?«, fragte Andreas. Der Kommandant schüttelte den Kopf und erwiderte »Da ist keine Hilfe mehr möglich, Andreas. Komm, fahr heim zu deinen Leuten, tu dir das nicht an.« Doch Andreas hatte sich nicht davon abhalten lassen, mitzuhelfen, so sehr alle versuchten, ihn davon abzubringen. Das Autowrack musste aufgeschnitten werden, so war alles ineinander verkeilt. Wie besessen arbeitete Andreas. Leblos lag die Mutter da, mit blutüberströmtem Kopf.
Die ganze Zeit über hatte Andreas immer wieder gerufen: »Mama, Mama, wach auf, wach auf, es kommt gleich Hilfe.« Alle waren froh, als endlich die Männer vom Kriseninterventionsteam kamen und Andreas dazu bewegen konnten, nach Hause zu fahren. Zusammen überbrachten sie dann die schlimme Nachricht der Familie. Andreas hatte einen schweren Schock erlitten und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Korbinian machte sich furchtbare Vorwürfe. Wenn sie ein größeres Auto gehabt hätte. Wenn er mitgefahren wäre, wären sie zusammen mit dem großen Auto gefahren. Wenn sie an einem anderen Tag gefahren wäre. Wenn, wenn, wenn ...
Es konnte nicht ungeschehen gemacht werden, da half kein Denken und Grübeln.
Der Vater hatte neben dem Baum ein Marterl, ein kleines Gedenkkreuz aus Holz, aufgestellt. In der Mitte des Kreuzes war ein Bild von Kathi angebracht. Es war zwei Tage vor ihrem Unfall gemacht worden. Fröhlich lachte sie in die Kamera. Darunter hatte der Vater mit seiner ungelenken Handschrift geschrieben:
Oh Herr, nimm sie in Gnade auf,
hast vollendet ihren Lebenslauf.
Im sechzigsten Jahr,
in dunkler Nacht
hast du sie in den Himmel ‘bracht.
Obwohl er diesen Spruch mit einer Klarsichthülle geschützt hatte, konnte man ihn fast nicht mehr lesen.
Bärbl war immer noch erstaunt über diese Zeilen. Das hätte sie dem Vater gar nicht zugetraut. Ihr wurde bewusst, wie wenig sie ihn kannte, wie fremd er ihr war. Es herrschte eine quälende Sprachlosigkeit zwischen ihnen. Sicher lag viel Gutes in ihm verborgen, das sie gerne kennengelernt hätte. An diesem Gedenkkreuz fand Bärbl mehr Trost als am Grab der Mutter. Sie hatte einen schönen Geranienstock dabei und stellte ihn vor das Kreuz. Dann murmelte sie ein »Ave Maria«. Das hatte die Mutter oft mit ihr gebetet. »Wenn du ein Anliegen hast, wende dich an die Himmelsmutter«, hatte sie zu ihr gesagt. Bärbl hielt öfter Zwiesprache mit ihrer Mama und bat sie um Hilfe. »Mama, ich hoffe, es geht dir gut im Himmel! Es ist so schwer mit Papa, es tut so weh, dass er nicht mit mir zusammen den Hof weiterführen will. Vielleicht ist es dir ja möglich, dass du ihm einen guten Gedanken eingibst, dass er künftig mehr Vertrauen zu mir hat. Ich weiß, dass ich eine gute Bäuerin wäre. Bitte, Mama, bitte hilf mir«, seufzte sie. Dann zupfte sie die Geranienblüten zurecht. Sie prüfte, ob das Holzkreuz noch fest stand und putzte es mit einem mitgebrachten feuchten Tuch sauber. Dann strich sie sanft mit der Hand darüber und bekreuzigte sich.
Zuversichtlich, dass die Mutter sie unterstützen würde, ging sie langsam zu ihrem Auto zurück.
Dort erwartete sie ein wütender junger Mann, der auf einem Traktor saß. Schon von Weitem rief er ihr entgegen. »Hoffentlich kannst du besser Auto fahren als lesen! ›Für landwirtschaftliche Fahrzeuge frei‹ steht auf dem Schild!« Irritiert schaute sie zu ihm hoch. Er trug eine schicke rote Allwetterjacke. Seine schwarzen, kurz geschnittenen Haare lugten unter einem brauen Filzhut hervor, was ihm ein markantes, abenteuerliches Aussehen verlieh. Er war bestimmt einen Meter achtzig groß und hatte breite Schultern wie ein Bär. Und er duzte sie, was sie wirklich unverschämt fand, denn sie kannten sich nicht. Er sprach hochdeutsch. Also auch wieder einer von denen, die meinten, in Bayern auf dem Dorf sei die Zeit für immer stehen geblieben. Es war schon längst nicht mehr üblich, Menschen zu duzen, die man nicht kannte. Nach einer Schrecksekunde blaffte Bärbl zurück. »Wegen der fünf Minuten brauchst du nicht so einen Aufstand machen, du Zornigl.«
»Komm, fahr jetzt dein Auterl weg, ich kann im Gegensatz zu dir am helllichten Tag net spazieren gehen«, schimpfte er. Trotz ihres Ärgers registrierte sie, dass er nun in den hiesigen Dialekt verfallen war.
Bärbl stieg in ihren roten Golf, startete und gab wütend Gas. »So ein Idiot, was bildet der sich denn überhaupt ein?« Sie wunderte sich, dass sie ihn nicht kannte, denn der Grund, auf dem sie sich befanden, gehörte den Burgers. Vielleicht ein neuer Angestellter, der sich wichtig machen wollte? Ärgerlich bemerkte sie, dass ihre Vorderreifen durchdrehten und sich immer tiefer in das weiche Erdreich gruben. »So ein Mist«, schimpfte sie. »So ein verflixter Mist; na mach schon, blöde Karre!« Sie stieg wieder aus, ging zu den Vorderreifen und sah, dass sie tief in der Erde feststeckten.
Der Mann sagte erst nichts, sah zu ihr herunter und meinte dann süffisant, mit einem Blick auf ihr Autokennzeichen: »Wenn die Städter schon mal mit der Natur in Verbindung kommen, dann gründlich, oder?« Sie rollte die Augen und schwieg. Langsam stieg er von seinem Traktor. »Da müssen wir etwas drunterlegen«, meinte er und sah sich suchend um. Dann hob er ein flaches Holzstück vom Boden auf und legte es unter den rechten Vorderreifen. Als Bärbl ins Auto steigen wollte, fasste er sie am Oberarm und hielt sie zurück mit den Worten: »Ich mach das schon, geh bloß ein Stück weg, damit du nicht dreckig wirst.« Bärbl war empört, es brodelte in ihr. Der Typ war ja mehr als unverschämt. So einen überheblichen Macho hatte sie schon lange nicht mehr getroffen. Sie protestierte: »Ich bin nicht aus Zucker, das schaffe ich schon selbst.« Er grinste. Herablassend entgegnete er: »Das mag sein, aber so viel Zeit hab ich nicht. Also, soll ich jetzt helfen oder nicht?« Bevor Bärbl antworten konnte, saß er schon im Auto. Der Wagen schaukelte einige Male hin und her und dann hatte er ihn wieder auf sicheren Boden manövriert. Er stieg aus dem Auto und machte mit seinen Armen eine einladende Geste in Richtung Fahrersitz. »Bitte schön, gnädiges Fräulein«, sagte er gönnerhaft. »Danke schön«, sagte Bärbl notgedrungen, aber sehr schnippisch. Sie war immer noch wütend auf ihn. »Vorsichtig fahren, junge Frau, wenn noch mehr Unglück auf dieser Straße passiert, dann kriegen wir doch noch die Autobahn hierher.«
»Was sagen Sie da?«, fragte Bärbl und vergaß vor Schreck sogar ihren Ärger. »Ich dachte, es ist beschlossene Sache, dass diese Straße als Naturdenkmal erhalten bleibt.«
»Ich habe da so meine Zweifel«, meinte er, drehte sich um und ging zu seinem Traktor. »Wissen Sie denn mehr darüber?«, fragte sie ihn. »Nein, aber wenn so etwas mal im Gespräch war, dann ist alles möglich«, antwortete er. »Das wäre ja furchtbar, wenn sie die schöne Landschaft hier zerstören«, rief sie. Sie stieg in ihren Wagen und fuhr los. Im Rückspiegel sah sie, wie er in ihre Richtung blickte und ein kleines Lächeln über sein Gesicht huschte.
3
Leo Burger lächelte immer noch, als er seinen Traktor startete und langsam Richtung Wald fuhr. Die junge Frau hatte ihm auf Anhieb gefallen. Ein bisschen erinnerte sie ihn sogar an Karen. Erst jetzt fiel ihm auf, dass sie den Dialekt gesprochen hatte, der hier üblich war. War sie doch von hier? Seit er vor drei Monaten zurückgekommen war, hatte er sich nur um das Sägewerk gekümmert und versucht, alles am Laufen zu halten. Auch seine alten Freunde aus früheren Zeiten hatte er noch nicht kontaktiert. Er war sehr lange weg gewesen. Nachdem er in Rosenheim sein Holztechnik-Studium abgeschlossen hatte, war er nach Kanada gegangen und hatte dort lange Jahre gelebt und gearbeitet. In Quebec hatte er als Geschäftsführer das Sägewerk von Peter Webster geleitet. Doch dann war sein Vater gestorben. Die Entscheidung, die er bis dahin immer verdrängt hatte, musste er nun kurzfristig treffen. Zurück in die Heimat, das Sägewerk des Vaters übernehmen? In Kanada bleiben, den heimatlichen Betrieb verkaufen? Den Betrieb, der seit vielen Generationen in der Familie war. Wie wichtig das Sägewerk für die Region war und ist, zeigt auch die Tatsache, dass das kleine Dorf nach der Familie der Sägewerksbesitzer benannt wurde: Burgersdorf. Die Entscheidung war ihm unglaublich schwergefallen. Die Arbeit in Kanada machte ihm Spaß, er hatte viele Freunde gefunden, mit denen er zum Skilaufen, Kajakfahren und Wandern ging. Aber das Wichtigste, was ihn zögern ließ, war seine Freundin Karen Webster. Attraktiv, sehr gescheit, fünfundzwanzig Jahre alt, einzige Tochter von Peter Webster und somit Alleinerbin des Sägewerks. Mr. Webster wäre er als Schwiegersohn sehr willkommen gewesen. Er hätte das Sägewerk zusammen mit Karen, die auch in der Firma ihres Vaters arbeitete, weiterführen können.
Die Rückkehr nach Deutschland bedeutete auch das Ende der Liebesbeziehung mit Karen. Sie hatte ihm klargemacht, dass sie niemals mit nach Deutschland gehen würde. »Du hast mir zwar viel von deiner Heimat erzählt, aber ich kenne dein Land nicht. Obwohl ich ein bisschen deine Sprache gelernt habe, würde ich nicht glücklich werden außerhalb Kanadas. Außerdem kann und will ich meinen Daddy und die Firma nicht zurücklassen«, hatte sie traurig zu ihm gesagt. »Du wirst dich entscheiden müssen, ob du zu deiner alten Familie zurückkehrst oder mit mir eine neue Familie gründest.«
Das war hart gewesen für Leo. Er hatte lange mit sich gerungen und auch mit seiner Mutter Traudl und den Brüdern darüber gesprochen. »Bring Karen mit«, rieten sie ihm. Doch als er sie darum bat, sich seine Heimat anzusehen und dann eine Entscheidung zu treffen, lehnte sie ab. »Leo, als wir uns kennenlernten, habe ich dir gesagt, dass du berücksichtigen sollst, dass ich mein Land nie verlassen werde.«
Natürlich hatte sie das gesagt, als vor zwei Jahren ihre Beziehung begann. Doch damals war Leo noch fest davon überzeugt gewesen, dass er für immer in Kanada bleiben würde. Die Kompromisslosigkeit ihrer Entscheidung überraschte ihn. Damit hatte er nicht gerechnet. Voller Wehmut dachte er an die Verabschiedung am Flughafen. »So endet also eine große Liebe«, hatte er Karen ins Ohr geflüstert. Sie hatten vereinbart, jeden Kontakt zu unterlassen und sich auch daran gehalten.
Bis heute grübelte er darüber nach, aus welchem Grund er es nicht übers Herz gebracht hatte, den väterlichen Betrieb zu verkaufen und in Quebec bei Karen zu bleiben. Als er vor zwölf Jahren nach Kanada ging, war er zweiundzwanzig Jahre alt gewesen. Bis dahin war das Verhältnis zu seinem Vater von Gleichgültigkeit geprägt. Sein Vater hatte immer viel und lange gearbeitet. Für seine Frau und die drei Söhne blieb da nicht viel Zeit. Vor allem, weil er auch noch passionierter Jäger und Fischer war und diese Leidenschaften ausgiebig pflegte. Seine Mutter schien das nicht gestört zu haben, doch er und seine Brüder hätten gerne mehr Zeit mit dem Vater verbracht. Einmal war er mit seinen Geschwistern alleine zu Hause. Die Eltern waren auf eine Faschingsveranstaltung. Sein kleiner Bruder war mitten in der Nacht aufgewacht und hatte furchtbar geweint.
»Die Mama und der Papa sind nicht da«, hatte er geschluchzt. »Was würde denn wohl aus uns werden, wenn die beiden nicht wiederkommen würden?« Da hatte sein anderer Bruder den Kleinen in den Arm genommen und gemeint, dass es wichtig wäre, dass die Mama wiederkäme. »Die Mama ist unsere Familie«, sagte er altklug. »Der Papa hat doch sowieso keine Zeit für uns.« Leo dachte noch oft an diese Szene. Ja, die Mama, sie hatte immer alles zusammengehalten und ihnen einen guten Start ins Leben ermöglicht. Wenn er ehrlich war, hatte er in Kanada die Heimat auch nicht großartig vermisst. Leo verbrachte seinen fünfzehntägigen Jahresurlaub in Kanada. Manchmal reiste er in die USA oder nach Hawaii. Er war in all den Jahren nur einmal zu Hause gewesen, als seine Oma Sefferl gestorben war, und hatte eine Woche bei seinen Eltern verbracht. Da war klar geworden, dass es nicht gut gehen würde, wenn er den Betrieb zusammen mit dem Vater führen müsste. Der Vater hatte ihm zu verstehen gegeben, dass er noch lange nicht bereit sei, das Sägewerk an die nächste Generation weiterzugeben. Er erinnerte sich daran, dass die Mutter damals schon den Vater darauf ansprach, rechtzeitig an die Übergabe zu denken. »Schorsch«, mahnte sie. »Der Leo ist der einzige von deinen Buben, der als Nachfolger infrage kommt. Wart nicht zu lang, wenn der Leo sich in Kanada heimisch fühlt, kommt der nimmer zurück. Was soll dann werden?«
Doch der Vater hatte nur abgewunken und gesagt: »Ich gehör’ noch lang nicht zum alten Eisen!«
»Ja, das denkst du«, sagte die Mutter resigniert.
»Erbschaft ist oft kein Gewinn«, seufzte der Vater. »Das mag sein«, dachte sich Leo damals, »aber die Mama hat schon recht. Ob ich jemals wieder hierher zurückkomme, steht in den Sternen.« Denn sein Bruder Georg, als ältester Sohn der »rechtmäßige« Erbe, hatte schon früh deutlich gemacht, dass er am Sägewerk nicht interessiert war. Er hatte eine Lehre als Bankkaufmann absolviert.
Sein jüngerer Bruder Vinzenz arbeitete eine Zeit lang im Sägewerk mit, merkte aber, dass das nicht seine Welt war. Er sagte zum Vater: »Gutes Geld kann man mit dem Sägewerk sicher verdienen, aber so lange Arbeitstage wie du möchte ich nicht haben. Du lebst ja nur für die Firma.«
Vom Vater finanziert, pachtete Vinzenz dann eine Gastwirtschaft, die er aber nach einigen Jahren wieder schließen musste. Er war kein guter Geschäftsmann und hatte kaum Gewinne gemacht. Der Vater kommentierte nie die Handlungen seiner Söhne. Es gab keine Vorwürfe und Ratschläge. Als Leo seine Mutter, Traudl Burger, einmal auf diesen Umstand ansprach, meinte sie: »Solange er die Hoffnung hat, dass wenigstens aus dir ein Geschäftsmann und Nachfolger für den Betrieb wird, lässt er deine Brüder machen, was sie wollen.« Georg hatte die Arbeit in der Sparkasse irgendwann reichlich satt. Vinzenz wusste nach der Schließung der Wirtschaft auch nicht so recht, was er machen sollte. So saßen sie oft zu Hause und machten Musik miteinander. Georg spielte Akkordeon und Vinzenz Gitarre. Sie hatten das alte Liederbuch der Urgroßmutter Wally gefunden, arrangierten die Musik neu und passten die Texte an die Gegebenheiten der heutigen Zeit an. Manche Lieder gefielen ihnen so gut, dass sie sie im Original beließen. Im Ort sprach sich schnell herum, dass die Burger-Brüder Musik machten, und so bat man sie auf Hochzeiten, Geburtstagen und Beerdigungen zu spielen. Nach einiger Zeit waren sie in der ganzen Region bekannt und konnten schon gut vom Musikmachen leben. Sie spielten in Bierzelten und komponierten die Begleitmusik für das Krippenspiel des Heimatvereins.
Mit den beliebtesten Liedern ließen Georg und Vinzenz eine CD anfertigen. Leo war sehr erstaunt, als er in Kanada die CD zum ersten Mal hörte. Stolz war er auf seine Brüder, die sich jetzt »Die Birkentaler« nannten. Ihre Musik gefiel ihm sehr gut. Es war keine beliebige, bayerische Musik, nein, da gab es durchaus kritische Töne.
Natürlich war der Vater auch stolz auf die Buben, wie ihm die Mutter in einem Brief schrieb. »Aber somit ist auch Vaters Hoffnung dahin, dass es weitere Nachfolger für das Sägewerk geben könnte.«
»Die Birkentaler« blieben zu Hause wohnen, in dem großen Vierkanthof war ja genug Platz. Es war einer der schönsten Höfe im Umkreis. Vater Schorsch hatte den Hof vor einigen Jahren zusammen mit den Söhnen in Eigenarbeit aufwändig renoviert. Es wurden Wände eingerissen, um für die Söhne große, komfortable Wohnungen mit eigenen Eingängen zu schaffen. In den ehemaligen Ställen, in denen früher die Arbeitspferde standen, ließ man ein Tonstudio bauen. Das Dach wurde neu gedeckt und mit Solartechnik ausgestattet. Die neuen dunkelbraunen Sprossenfenster gaben dem Hof den ursprünglichen Charakter zurück. Die alten Holztüren wurden nach und nach repariert und neu gestrichen. Mutter Traudl pflanzte rote und rosa Geranienstöcke in viele Blumenkästen. Vor jedem der vielen Fenster platziert, machten sie das Haus zu einem richtigen Schmuckstück. Große, alte Bäume säumten das Grundstück ein. Jeder, der am Hof vorbeiging, blieb bewundernd stehen – es war wirklich ein sehr schöner Anblick.
Georg und Vinzenz, die Brüder von Leo, führten ein unstetes Leben. Durch die vielen Auftritte, die sie inzwischen quer durch Deutschland führten, hatten sie bisher keine Familie gegründet. Sehr zum Leidwesen der Mutter, die sich nichts mehr wünschte als Enkelkinder. Vinzenz hatte sie damit aufgezogen: »Mutter, Enkerl sind gleich g’macht, aber da g’hört auch a Schwiegertochter dazu – was is’, wenn’s dich mit der net verstehst?«
Die Mutter hatte das als Ausrede abgetan und geantwortet: »Geh, du bist doch a fescher Bua, du wirst doch auch a nett’s Madl finden. Du kennst mi doch, ich komm mit alle Leit’ gut aus!«
Aber die »Birkentaler« waren allein geblieben, hatten die Bewunderung der zahlreichen jungen weiblichen Fans genossen und auch schon das eine oder andere Frauenherz gebrochen.
Sie hatten auch dem Vater am offenen Grab den letzten musikalischen Gruß dargebracht. Alle waren vollkommen schockiert über seinen plötzlichen Tod gewesen. Ein tragischer Jagdunfall hatte seinem Leben ein Ende gesetzt.
Ärgerlich bemerkte Leo, dass am Ende des Feldwegs schon wieder ein Fahrzeug geparkt war. Der große Kastenwagen stand quer auf dem Weg und versperrte ihm die Durchfahrt. Er blieb stehen, schaltete den Motor aus und sah sich suchend um. Er konnte den Fahrer nicht entdecken, also stieg er ab, ging einige Schritte um die Wegbiegung und stand zwei Männern gegenüber. Eingepackt in dicke Anoraks, stapften sie mit Gummistiefeln auf der feuchten Wiese herum. Einer der Männer hantierte an einem Gerät, das auf einem Stativ stand, der andere hielt einen langen Stab in der Hand.
»Hallo«, rief Leo, »was machen Sie hier? Das ist Privatbesitz!« Der Mann winkte, legte den Stab auf den Boden und kam zu Leo. »Grüß Gott«, sagte er und reichte Leo die Hand. »Was machen Sie mit dem komischen Gerät?«, erkundigte sich Leo, als er die Hand des Mannes ergriff.
»Das ist ein Theodolit. Wir vermessen gerade die ganze Gegend.« Leo schaute den Mann skeptisch an.
»Geht es wieder um das unselige Autobahnprojekt?«
»Mein Name ist Herbert Münchmeier«, stellte sich der Mann vor. »Es geht hier nur um eine Erhebung der Autobahndirektion, eine Vorplanung.«
Bei Leo läuteten alle Alarmglocken. »Vorplanung? Das glaub ich jetzt nicht. Sie wissen, dass die Mehrheit der Bevölkerung gegen einen Autobahnbau ist. Darum haben Sie uns wohl auch nicht verständigt, dass sie eine sogenannte Vorplanung vornehmen.« Er sprach das Wort Vorplanung gedehnt und in einem spöttischen Ton aus.
Herrn Münchmeier war es sichtlich unangenehm, dass er bei seiner Arbeit überrascht wurde.
»Ich bin Leo Burger. Ich könnte Sie jetzt auffordern, meinen Grund und Boden zu verlassen«, meinte Leo, »aber was würde das bringen, irgendwann würden Sie Ihre Arbeit ja doch tun. Also entfernen Sie bitte Ihren Kastenwagen, damit ich weiterfahren kann.«
Dann ließ er den Mann wortlos stehen und stapfte zum Traktor zurück. Gleich darauf kam Herr Münchmeier und rangierte den Wagen in eine andere Position, damit Leo vorbeifahren konnte. Trotz des lauten Fahrgeräusches des Traktors hörte Leo, wie die Reifen des Kastenwagens durchdrehten. Ein bisschen schadenfroh war er schon. »Geschieht euch recht«, murmelte er und überhörte geflissentlich das laute Rufen von Herrn Münchmeier. »Herr Burger!«, rief er, »Herr Burger, warten Sie, ich stecke hier fest.«
Ungerührt fuhr Leo weiter und tat so, als ob er ihn nicht hören würde. Als er nach einer Stunde zurückkam, die Sonne war schon am Untergehen, traf er auf zwei frierende Vermesser. Er hielt an und wie schon am Nachmittag bei Bärbls Wagen, half er nun auch den Kastenwagen aus dem durchweichten Boden zu befreien. Herr Münchmeier bedankte sich bei Leo und als sein Kollege schon in den Wagen eingestiegen war, ging er noch mal auf Leo zu und flüsterte: »Ihre Vermutung von vorhin war schon richtig. Es geht hier wieder um die Autobahn. Es gibt anscheinend neue Planungen. Aber Sie haben das nicht von mir.« »Was habe ich nicht von Ihnen?«, fragte Leo und zwinkerte ihm verschwörerisch lächelnd zu. Herr Münchmeier grinste, stieg in den Wagen und fuhr los.
Nachdenklich blieb Leo auf dem Feldweg zurück. Igstdorf und Burgersdorf hätten bei einem Autobahnbau massive Einschnitte hinzunehmen. Vor sieben Jahren gab es schon einmal Überlegungen, eine große Straßentrasse zu bauen. Leo hatte in dieser Zeit in Kanada gelebt. Der Kontakt zur Familie war ausschließlich über die Briefe gelaufen, die seine Mutter geschrieben hatte. Die Anrainer waren so aufgebracht, dass sogar sein Vater das Bedürfnis verspürt hatte, ihn in Quebec anzurufen. Leo war erschrocken, er dachte jemandem aus der Familie sei etwas passiert. Doch die Nachricht des geplanten Straßenbaus hatte auch bei ihm Entsetzen hervorgerufen. »Der Vinzenz hat im Internet einen Entwurf gefunden, da kannst du dir anschauen, was diese Betonschädel planen«, hatte er voller Wut gesagt. Nachdem Leo dies getan hatte, rief er den Vater an. »Das dürft ihr euch nicht gefallen lassen, das zerstört doch das ganze Tal. Zwei Wälder sollen komplett gerodet werden, die wichtig für dein Sägewerk sind, auch der schöne Birkenwald. Wir würden fast direkt an der Autobahn wohnen. Der Leitnerhof müsste überhaupt weg, dort wär dann die Autobahnausfahrt. Das ist tatsächlich Wahnsinn.« Der Vater, der immer sehr laut sprach, wenn er telefonierte, weil er davon ausging, dass man ihn sonst nicht gut hören könnte, hatte geschrien: »Dem Leitner würd ich’s gönnen, der hat den Ruach im G’nack. Alles hat er zusammengerafft in den letzten Jahren. Dem würd ein Dämpfer nicht schaden, der hat genug Sach’. Den Hof lasst er sowieso verkommen, da schaut es aus wie Kraut und Rüben. Um den wär’s nicht schad’. Blöd ist halt, dass wir auch betroffen sind.«
Leo hatte den Kopf geschüttelt und ungläubig geantwortet: »Ich glaub’s nicht, was ich grad hör. Ihr müsst euch zusammentun. Wenn die Staatsregierung in München merkt, dass ihr euch uneinig seid, dann tun die sich viel leichter, den Bau durchzudrücken. Setzt euch zusammen und redet drüber.«
Bitter klang die Stimme des Vaters: »Mit dem Leitner? Mit dem größten Feind an einen Tisch setzen? Niemals!«
Leo hatte den Vater aufgefordert, ihm zu erklären, woher diese Feindschaft kam. Doch wie immer blockte der Vater da ab.