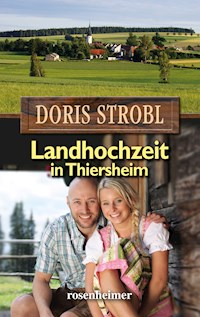16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rosenheimer Verlagshaus
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Frauenchiemsee 1003: Sophia, Schwester des Markgrafen Hezilo von Schweinfurt, lebt im Kloster Frauenwörth als Schützling von Äbtissin Tuta. Gerne würde sie Nonne werden. Als sie zur Ehe mit dem Grafen Adalbert gezwungen wird, fügt sie sich jedoch in ihr Schicksal, da dieser droht, ansonsten das Kloster zu zerstören. Nachdem er Feuer gelegt hat, kann Sophia in der allgemeinen Verwirrung fliehen. Sie wird von Azo de Casale gerettet, jedoch von ihm nach Italien entführt. Auf der Reise kommt sie dem rauen Mann immer näher. Währenddessen hat auch Tuta mit ihren Gefühlen zu kämpfen. Sie muss sich mit Gerhard von Seeon auseinandersetzen, der auf Geheiß König Heinrichs II. das Grab der seligen Irmengard öffnen will …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
LESEPROBE zu
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Rosenheimer Verlagshaus erschienenen Originalausgabe 2015
© 2015 Rosenheimer Verlagshaus GmbH & Co. KG, Rosenheim
www.rosenheimer.com
Titelbild: Franz von Defregger
Lektorat und Satz: Bernhard Edlmann Verlagsdienstleistungen, Raubling
eISBN 978-3-475-54452-1 (epub)
Worum geht es im Buch?
Doris Strobl
Das Wunder von Frauenchiemsee
Frauenchiemsee 1003: Sophia, Schwester des Markgrafen Hezilo von Schweinfurt, lebt im Kloster Frauenwörth als Schützling von Äbtissin Tuta. Gerne würde sie Nonne werden. Als sie zur Ehe mit dem Grafen Adalbert gezwungen wird, fügt sie sich jedoch in ihr Schicksal, da dieser droht, ansonsten das Kloster zu zerstören. Nachdem er Feuer gelegt hat, kann Sophia in der allgemeinen Verwirrung fliehen. Sie wird von Azo de Casale gerettet, jedoch von ihm nach Italien entführt. Auf der Reise kommt sie dem rauen Mann immer näher. Währenddessen hat auch Tuta mit ihren Gefühlen zu kämpfen. Sie muss sich mit Gerhard von Seeon auseinandersetzen, der auf Geheiß König Heinrichs II. das Grab der seligen Irmengard öffnen will …
Denen, die Gott lieben,
verwandelt er alles in Gutes.
Auch ihre Irrwege und Fehler
lässt Gott ihnen zum Guten werden.
Augustinus von Hippo (354 – 430)
Kapitel 1
Kloster Frauenwörth, Chiemsee, Bayern
im Jahr des Herrn 1003, Juni
»Herrgott, steh uns bei«, flüsterte Äbtissin Tuta, als sie die Rufe vernahm. Die Vigil, das mitternächtliche Gebet zu Ehren Gottes, musste bald beginnen. In den langen Jahren, die sie bereits im Kloster lebte, hatte Tuta sich daran gewöhnt, nicht viel zu schlafen. Heute fühlte sie eine ungewöhnliche Müdigkeit.
Irritiert blickte Tuta aus ihrer Äbtissinnenzelle. Das Stimmengewirr kam näher. Das verhieß nichts Gutes. Nachts lag für gewöhnlich eine friedliche Stille über der Insel. Die Fischer, die hier lebten, schliefen um diese Zeit.
Da sie wegen der Hitze in Leibwäsche und Unterkleid geschlafen hatte und nicht, wie es die Ordensregel vorsah, komplett angezogen, legte sie hastig ihre langärmelige, aus dunklem Leinenstoff gefertigte Tunika an.
Eilig gürtete sie ihre Taille, hängte die Kette mit dem goldenen Kreuz um ihren Hals und zog den Brustschleier aus hellem Leinen über ihren Kopf. Mit geübtem Griff schlang sie feine, weiße Stoffstreifen um ihr brünettes Haar, um die Stirn und das Kinn zu bedecken.
Als sie erneut einen kurzen Blick aus der fensterlosen Öffnung warf, sah sie, dass um die äußeren Klostermauern Männer standen. Sie hielten Fackeln in den Händen. Der Schein des Feuers und die düster aussehenden Gestalten wirkten bedrohlich. »Bitte, Himmelvater, hilf deinen treuen Dienerinnen!«, flehte die Äbtissin leise und bekreuzigte sich. Tuta griff nach der Kerze, die ein fahles, flackerndes Licht spendete. Sie verließ ihre Zelle und traf in dem halbdunklen Gang auf Schwester Elisabeth.
»Hast du den Lärm gehört, meine Tochter?«, fragte die Äbtissin.
Elisabeth blickte sie verwundert an und nickte stumm.
Von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang sprachen die Nonnen kein Wort, sondern regelten ihre Verständigung mit Handzeichen. Durch Anordnung der Äbtissin konnte das Schweigegebot aufgehoben werden. Das erschien Tuta in diesem Fall angebracht, und sie sagte zu Elisabeth: »Ich erlaube dir zu sprechen, meine Tochter. Ist bereits Zeit für das Gebet?«
»Noch nicht, ehrwürdige Mutter«, erwiderte Elisabeth.
Tuta ordnete an: »Betätige sofort die Glocke, damit die Mitschwestern erwachen.«
Elisabeth eilte davon.
Schwester Lioba, die Priorin von Frauenwörth und Novizinnenmeisterin, kam hinzu und musterte Tuta mit unsicherem Blick. Die Äbtissin berichtete ihrer Stellvertreterin, was vorging, und bat: »Geh mit den Mitschwestern ins Refektorium. Das Schweigegebot für diese Nacht ist aufgehoben.«
Lioba lief zum Dormitorium, dem Schlafsaal, in dem ihre Mitschwestern gemeinsam mit den Novizinnen Nachtruhe hielten. Anschließend würde sie die Mädchen wecken, deren Erziehung man dem Konvent anvertraut hatte.
Die Äbtissin erschauerte, als sie hörte, wie gegen das massive Holztor des Klosters gehämmert wurde. »Heda, aufmachen!«, forderte eine barsche Männerstimme. »Sofort öffnen!«
Erleichtert vernahm Tuta in diesem Augenblick das Geläut der Glocke.
Erneut schallte die Stimme herauf: »Aufmachen! Sofort!«
Tuta ging mit raschen Schritten zur Klostertüre, um die Pförtnerin zu unterstützen, die für den Einlass der Besucher verantwortlich war. Schwester Annuntiatas körperliche Kräfte hatten aufgrund ihres hohen Alters in letzter Zeit enorm nachgelassen.
Es kamen nicht viele Besucher auf die Insel. Die Römerstraße führte am gegenüberliegenden Ufer entlang. Selten ließ sich ein Reisender übersetzen und klopfte an das Portal. Ab und zu kamen Pilger, die am Grab Irmengards ihre Fürbitten darbringen wollten.
Schwester Annuntiata öffnete die schmale Klappe, die es ermöglichte, dass der Besucher die Augen seines Gegenübers sah. Tuta hörte Schwester Annuntiatas unwirschen Tadel: »Was lärmt Ihr mitten in der Nacht? Seid Ihr verrückt? Ihr befindet Euch auf heiligem Boden.«
Gebieterisch donnerte eine Männerstimme: »Schau zuerst, wer Einlass begehrt, Weib, und rede danach!«
Eine Fackel wurde an das Gesicht des Mannes gehalten.
Annuntiata versuchte sich ihr Erschrecken nicht anmerken zu lassen: »Graf Adalbert von Almau! Verzeiht, gnädiger Herr, ich erkannte Euch nicht!«
Tutas Herz schlug rascher. Schon als Kind hatte sie sich vor ihrem unberechenbaren und jähzornigen Bruder Adalbert gefürchtet. Die halblangen blonden Haare des großen, muskulösen Mannes standen wirr in alle Richtungen. Sein Gesicht war von einer langen Narbe verunstaltet, die von der Stirn quer über die Nase bis zum Kinn lief. Durch die Kampfeswunde, die von einem Messer herrührte, sah er grausam und brutal aus. Er galt als rücksichtslos, geizig und machtgierig.
Adalbert herrschte Annuntiata an: »Öffne das Tor, ich will meine Schwester sprechen!«
»Die ehrwürdige Mutter Tuta hat sich bereits zurückgezogen«, erwiderte diese, tapfer darum bemüht, sich von seinem rüden Ton nicht einschüchtern zu lassen.
»Wecke sie auf! Denkst du, ich komme zu meinem Vergnügen mitten in der Nacht hierher?«
Ich hoffe nicht, dachte Annuntiata. Als sie antworten wollte, trat Tuta zu ihr, zog sie vom Eingangstor weg und flüsterte: »Geh zu den anderen Frauen ins Refektorium!«
Annuntiata versuchte, etwas zu erwidern, doch die Äbtissin legte ihren Zeigefinger auf die Lippen und flüsterte: »Geh rasch!«
Tuta trat zur Besucherklappe und stellte sich auf die Zehenspitzen, um hindurchsehen zu können. Sie rief mit energischer Stimme: »Adalbert?«
»Ah, Ihr seid noch wach!«, schnaubte er herrisch und fuhr betont zynisch fort: »Verehrte Äbtissin, öffnet das Tor! Der Sohn Eures edlen Unterstützers sowie seine Mannen bitten um Unterkunft.«
Tuta runzelte unwillig die Stirn. Gleichzeitig dachte sie an die Regel, die Benedikt, der Ordensgründer, für die Aufnahme von Fremden aufgestellt hatte: »Alle ankommenden Gäste sollen wie Christus aufgenommen werden, denn er wird ja einmal sagen: ›Ich war ein Fremdling, und ihr habt mich aufgenommen.‹ Allen soll man die ihnen zukommende Ehre erweisen, besonders den Glaubensgenossen und den Pilgern. Sobald ein Gast gemeldet ist, gehen ihm der Obere oder einige Brüder in allem Eifer und Liebe entgegen.«
Vergib mir diese Sünde, Herr im Himmel, dachte Tuta. Es ist mir unmöglich, meinen Bruder zu lieben, nicht einmal gut leiden kann ich ihn. Ich bin nicht gewillt, ihn und seine Männer einzulassen.
So freundlich wie möglich antwortete sie: »Adalbert, wie Ihr wisst, darf außer König Heinrich, dem Bischof und unseren Ordensbrüdern kein Mann den Klosterbereich betreten. Ich lasse gerne für Eure Begleiter Speise und Trank hinausbringen.«
Adalbert trat näher an das Klostertor und sagte mit halblauter, heiserer Stimme: »Frau Äbtissin, ich habe bedeutsame Nachricht, die ich sicher nicht vor dem Portal kundtun werde. Lasst mich eintreten! Meine Männer werden vor den Mauern warten.«
Tuta atmete heftig. Mit Unbehagen dachte sie daran, ihn ins Besucherzimmer führen zu müssen.
Vorsichtig öffnete die Äbtissin die schmale, in das Haupttor eingearbeitete Türe. Adalbert zwängte sich durch die Öffnung. Selbstgefällig und überheblich baute er sich vor seiner Schwester auf und maß sie mit eiskaltem Blick. Unwillkürlich wich sie einen Schritt zurück.
In den vergangenen Jahren hatte sie Adalbert nicht oft gesehen. Immer schon fühlte sie sich in seiner Gegenwart in höchstem Maße unwohl. Etwas Gefährliches ging von ihm aus. Doch in dieser Nacht spürte sie, dass ihr Bruder noch mehr Selbstherrlichkeit und Macht ausstrahlte als bisher. Ohne es erklären zu können, fühlte sie sich von ihm bedroht.
»Nun, meine liebe Schwester, wollen wir hier am Eingang stehen bleiben, oder bittet Ihr mich weiter?«, fragte er mit erhobener Stimme.
Sie zuckte zusammen und führte ihn in den Bereich neben der Pforte. Zwei Stühle und ein Tisch standen in der Mitte des Raumes. An der Wand hing ein großes, dunkelbraunes Kreuz, und die kleine Luke, die der Belüftung diente, war mit einem leichten Leinentuch verhängt. Das Zimmer wirkte düster und ungemütlich und machte keinen einladenden Eindruck.
Tuta konnte sich nicht erklären, warum es ihrem Bruder gelang, sie derart aus der Fassung zu bringen.
Während sie sich bemühte, ihr seelisches Gleichgewicht wiederherzustellen, stand er breitbeinig da und ließ seinen Blick abschätzig durch die Kammer schweifen. Dann bemerkte er hämisch: »Welch vorbildliche klösterliche Einfachheit!«
Verzagt dachte Tuta daran, was die Regel Benedikts zur Aufnahme von Gästen weiter anordnete: »Zuerst sollen sie miteinander beten und sich dann den Frieden bieten. Der Friedenskuss werde erst gegeben nach dem Gebete, wegen der Täuschungen des Teufels.«
Um Himmels willen, überlegte sie, ihm den Friedenskuss geben?
»Setzt Euch, Frau Äbtissin«, befahl er mit machtgewohnter Stimme.
Tuta ärgerte sich über dieses ungebührliche Verhalten, doch eingedenk der Ordensregel erwiderte sie: »Wir wollen erst zusammen ein Gebet sprechen.«
Adalbert zog eine Augenbraue nach oben und ließ sich mit mürrischem Gesichtsausdruck auf einen der Stühle fallen: »Wie konnte ich das vergessen«, seufzte er scheinheilig. »Fangt ruhig an zu beten, liebe Schwester.«
Tuta stand mit undurchdringlicher Miene neben ihm.
›Fangt ruhig an zu beten!‹ – So wie er das betonte, hatte es wie eine Drohung geklungen. Schaudernd blickte sie auf das Kreuz, das auf der Längsseite des Raumes hing, und begann ein Paternoster zu sprechen. Adalbert stimmte murmelnd mit ein.
Als sie geendet hatten, bot er ihr mit einem hämischen Grinsen seinen Handrücken dar. Als er ihr Zögern bemerkte, sah er ihr tief in die Augen und befahl: »Der Friedenskuss für Euren Lehnsherrn!«
Tuta versuchte sich zu beherrschen und gelassen zu bleiben. Unter keinen Umständen würde sie ihm die Hand küssen. Was für ein unverschämtes Ansinnen, dachte sie und merkte, wie sie langsam wütend wurde. Was bildete sich Adalbert ein? Für sie als Äbtissin bestand die Verpflichtung zu einem Handkuss nur dem Bischof und dem König gegenüber.
Adalbert streckte seine Hand aus, griff rasch nach Tuta und zog seine überraschte Schwester zu sich hinunter. Er drückte ihr einen Kuss auf die Stirn und äußerte gönnerhaft: »Ich komme in Frieden!«
Das würde ich gerne glauben, dachte Tuta misstrauisch.
Zögernd überwand sie sich, beugte sich zu ihm und küsste seine rechte Wange. Er lächelte herablassend.
Wortlos ging sie auf die andere Seite des Tisches und setzte sich auf den Stuhl ihm gegenüber: »Ihr spracht davon, der neue Lehnsherr zu sein?« Noch während sie die Frage stellte, dachte sie: Was für ein Unsinn! Er ist keineswegs mein Lehnsherr! Er weiß sehr wohl, dass die Benediktinerinnenabtei Frauenwörth ein Reichskloster und damit nur einem verpflichtet ist: dem König.
Doch es war nicht zu übersehen, wie er seinen Auftritt genoss.
»Ja, Lehnsherr«, bestätigte er mit salbungsvoller Stimme. »Unser hochgeschätzter Vater, Graf Gundolf, ist heute Morgen zu seinem Schöpfer heimgekehrt.«
Trotz der stickigen Wärme, die in dem kleinen Raum herrschte, spürte Tuta, wie sich eine eisige Starre in ihr ausbreitete. Ihr Vater, den sie über alles liebte, der sie immer unterstützt und respektiert hatte, lebte nicht mehr? Er hatte das fünfzigste Lebensjahr schon überschritten, doch sein Tod kam überraschend.
Vor ihr saß nun der neue Hausherr von Almau. Eitel, selbstgerecht, seine Freude und Genugtuung nicht verhehlend. Während Tuta die Tränen über die Wangen liefen, stieß sie mit erstickter Stimme hervor: »An was ist denn unser Vater so unverhofft gestorben?«
Adalbert seufzte, rückte an den Tisch heran und beugte sich zu Tuta: »Er hat etwas gegessen, das ihm nicht so gut bekam.« Dann schwieg er. Sein Mund verzog sich zu einem boshaften Grinsen. Mit Befriedigung betrachtete er seine weinende Schwester, die niedergeschlagen auf ihrem Stuhl zusammensank.
Vaters Liebling, dachte er verächtlich. »Trauert Ihr um den Vater oder um die Pfründe, die Ihr verlieren werdet?«, erkundigte er sich nach einer Weile.
Fassungslos blickte sie ihn an und schluchzte: »Wodurch seid Ihr zu so einem gefühllosen, grausamen Mann geworden, Adalbert?«
Statt ihr eine Antwort zu geben, erhob er sich. »Ich will Eure klösterliche Ruhe nicht länger stören.«
Als er die Erleichterung in ihrem Gesicht sah, fuhr er fort: »Lasst meinen Mannen Trunk und Speise reichen! Mir holt das Fräulein Sophia von Schweinfurt. Sie wird meine Gemahlin werden und sofort mit mir kommen.«
Der Äbtissin gelang es kaum, ihr Entsetzen zu verbergen. »Muss nicht Sophias Bruder, Hezilo von Schweinfurt, gefragt werden?«
Schroff fuhr Adalbert sie an: »Was mischt Ihr Euch in Männerhändel ein? Gewiss ist Hezilo einverstanden, oder glaubt Ihr, ich habe es nötig, mir eine Frau zu rauben?«
»Nein, das wollte ich nicht unterstellen«, erwiderte Tuta hastig. Dabei traute sie ihm eine solche Aktion durchaus zu. »Dennoch entspricht Euer Vorgehen nicht den üblichen Gepflogenheiten«, fuhr sie fort.
Er streckte sich: »Na ja, was man so hört, scheint Fräulein Sophia ein bisschen sonderbar zu sein. Wenn nicht gar verrückt! Da ich um ihre Schönheit weiß, stört mich das aber nicht.«
Adalbert verschwieg seiner Schwester, dass es nicht nur Sophias Liebreiz war, der ihn magisch anzog. Sicherlich hatte er sich oft vorgestellt, wie es wäre, wenn die anmutige, zarte Sophia mit ihm das Lager teilte. Aber die stattliche Mitgift, die Hezilo bereitstellte, gefiel Adalbert ebenso. Und auch der gesellschaftliche Aufstieg, der mit dieser Ehe verbunden wäre. Den Bund, den er mit Hezilo geschlossen hatte, um mit ihm einen Aufstand gegen König Heinrich zu entfachen, erwähnte er Tuta gegenüber nicht.
»Aus welchem Grund erreichte mich keine Nachricht von Graf Hezilo? Wieso kommt er nicht persönlich, um seine Schwester dem Bräutigam zu übergeben?«
»Er hat dem König Heeresfolge zu leisten, meine liebe Schwester. Genug gesprochen jetzt, holt mir meine Braut!«
Unsicher darüber, ob ihr Bruder die Wahrheit sagte, wollte Tuta zunächst einmal Zeit gewinnen und schlug daher vor: »Wollt Ihr mit Euren Getreuen nicht ein Nachtlager aufschlagen? Mit Sicherheit ist es für Sophia viel angenehmer, bei Tag zu reisen.«
Energisch schüttelte er den Kopf und fauchte: »Bemüht Euch nicht, ich möchte sofort zur Burg Almau zurückkehren. Für einen bedeutenden Mann wie unseren Vater gilt es eine würdige Abschiedsfeier vorzubereiten. Da will ich meine Braut an meiner Seite wissen.«
Tuta stand auf und ging zur Tür. »Ich hole Sophia«, flüsterte sie, während ihr die Tränen über die Wangen liefen.
Als sie den Raum verließ, rief er ihr nach: »Ich will sofort aufbrechen! Beeilt Euch!«
Nachdem Tuta den Raum verlassen hatte, sprang Adalbert vom Stuhl auf. Die erwartungsvolle Erregung, die ihn erfasst hatte, zwang ihn, unruhig in der Kammer auf und ab zu gehen. »Weiber«, schnaubte er verächtlich.
Er dachte an jenen Tag zurück, an dem ihm der Vater stolz mitgeteilt hatte, dass seine geliebte Tochter als Äbtissin von Frauenwörth eingesetzt werden sollte. »Adalbert, was für eine Ehre für das Haus Almau! Deine Schwester wird Äbtissin von Frauenwörth! Ich muss sofort damit beginnen, die Aussteuer für ihre Erhebungsfeier anzuschaffen.«
»Ja, welche Auszeichnung«, heuchelte Adalbert und dachte misslaunig an die Kosten, die diese neue Position unweigerlich mit sich bringen würde.
»Was meinst du, es ist doch angemessen, ihr den Nießbrauch von Oberbuchberg zu überschreiben, oder?«
»Oberbuchberg?«, echote Adalbert. »Ein stattliches Gut! Ist das nicht zu viel? Es gibt jedes Jahr üppigen Ertrag.«
»Genau deswegen, Adalbert!«
Dem Sohn blieb nichts anderes übrig, als seinen Ärger hinunterzuschlucken.
»Wie kam König Otto dazu, meine Schwester zur Äbtissin zu berufen?«, fragte er stattdessen, um weiterhin Interesse vorzutäuschen.
»Ich denke, dass Herzog Heinrich von Bayern seine Hand im Spiel hatte und eine entsprechende Empfehlung aussprach. Immerhin kennt er Euch beide von Kindesbeinen an.«
»Das ist gut möglich«, sagte Adalbert.
»Wie auch immer«, fuhr der Vater fort. »Schick gleich den Verwalter zu mir, er muss die besten Handwerker auf die Burg holen.«
Für die Feierlichkeiten zur Erhebung Tutas hatte man bewusst den 16. Juli gewählt, den Todestag der so innig verehrten Irmengard. Spöttisch hatte Adalbert seinen Vater gefragt: »Aus welchem Grund huldigt man der ehemaligen Äbtissin Irmengard?«
»Mein Sohn, sie entstammt königlichem Geblüt«, antwortete der Vater. »Eine Tochter von Ludwig dem Deutschen und Urenkelin von Karl dem Großen. Sie ist 866 gestorben.«
»Da blieb viel Zeit, um Legenden zu erfinden!«, entgegnete Adalbert spöttisch.
Sein Vater gab zu bedenken, dass Irmengard bereits zu Lebzeiten als heilige Frau Verehrung entgegengebracht wurde. »Während sie Frauenwörth als Äbtissin vorstand, gab es durch ihre Wohltätigkeit im Chiemgau keine Armen. Sie verfügte wohl auch über besondere Heilkräfte. Wenn deine Schwester an diesem Tag ihre Weihe empfängt, steht sie in höchstem Maße unter dem Schutz Irmengards.«
»Das verstehe ich«, heuchelte Adalbert. Insgeheim tat er es aber als abergläubischen Unsinn ab.
Der neue Herr von Almau blieb ruckartig stehen, als könne er auf diese Weise gleichzeitig den Lauf seiner Gedanken anhalten. »Ab sofort ist Schluss mit der großzügigen Unterstützung Frauenwörths«, brummte er. »Im Gegensatz zu meinem Vater und dem König glaube ich nicht, dass die Gebete von Nonnen mein Leben und mein Sterben günstig beeinflussen.«
Wo blieb Tuta? Energisch riss er die Türe auf, spähte in den Klosterhof, den er menschenleer vorfand. »Geduld, Adalbert, hab Geduld!«, ermahnte er sich.
Eine unbändige Freude stieg in ihm auf. Ab sofort ging alles nach seinem Willen. Er herrschte jetzt über weite Teile des Chiemgaus. Endlich konnte er handeln, wie es ihm beliebte, und brauchte nicht mehr das Einverständnis des Vaters. Schon länger plante er zusammen mit Markgraf Hezilo von Schweinfurt, gegen den König aufzubegehren. In ihren Augen hatte er Versprechen nicht eingehalten, die er bei seiner Königswahl gegeben hatte. Jetzt würden sie bald zur Tat schreiten. Als Gegenleistung für seine Waffenhilfe hatte Adalbert die Heirat mit Sophia gefordert und zu seiner Überraschung die sofortige Zustimmung Hezilos erhalten.
»Eine der schönsten Frauen des Reiches wird bald in meinen Armen liegen«, murmelte er. »Dann habe ich alles erreicht, was ich mir ersehnte und erträumte.«
Auf dem Weg zum Refektorium versuchte Tuta, ihren zitternden Körper unter Kontrolle zu bekommen. Ein heftiger Schwindel erfasste sie und zwang sie, stehen zu bleiben. Ihr Vater gestorben, im schlimmsten Fall von ihrem Bruder vergiftet. Sophia gezwungen, das Kloster zu verlassen. Und das alles vollkommen unerwartet! Schluchzend wisperte sie: »Bitte, Irmengard, hilf!« Dann begann sie zu murmeln: »Pater noster, qui es in caelis …«
Nachdem sie das Vaterunser zu Ende gebetet hatte, fühlte sie sich ruhiger. Mit einem Blick nach oben sagte sie halblaut: »Dein Wille geschehe, Herr!« Es fiel ihr jedoch schwer, in dieser Situation Gottes Willen ohne Aufbegehren anzunehmen.
Einige hohe Herren des Reiches hatten ihre Töchter unter den Schutz des Klosters gestellt. Im abgelegenen Inselkloster wuchsen die Mädchen geschützt vor aufdringlichen Verehrern auf. Gut vorbereitet durch eine exzellente Erziehung übergab man sie ihrem Bräutigam, sobald sie das heiratsfähige Alter erreichten.
Derzeit hielten sich vier junge Damen zur Ausbildung im Kloster auf: Sophia von Schweinfurt, Gisela und Gundred von Hetzenstein und Mechthild von Meckenburg. Sie residierten in schön ausgestatteten, komfortablen Zimmern. Einbezogen in den Tagesablauf des Konvents sollten sie, wie die Nonnen, Mildtätigkeit, Demut und Schweigen üben. Ihr Leben bestand aus einem stetigen Wechsel zwischen Gebet und Arbeit, ganz im Sinne des heiligen Benedikt von Nursia.
»Dem Gottesdienst soll nichts vorgezogen werden«, hatte dieser in den Ordensregeln festgelegt. Eingedenk dessen sang man vor dem Morgengrauen die biblischen Psalmen. Kurz nach Sonnenaufgang wurde die heilige Messe gelesen. Die sogenannte Gebetsmeinung umfasste Fürbitten für den König, den Herzog und alle Unterstützer des Klosters. Für das Seelenheil anderer Menschen zu beten galt als unverzichtbare Aufgabe der Nonnen.
Im Anschluss an die Messe gab es für die Ordensfrauen im Refektorium eine kleine Schale warmer Mandelmilch, manchmal auch Hafergrütze. Während der Arbeitszeit, die gleich im Anschluss begann, wurde nur das Notwendigste gesprochen.
Auch am Mittag, wenn die Sonne hoch am Himmel stand, traf man sich zum Gebet. Schweigend nahm man das einfache Mittagessen ein, eine der Schwestern las aus einem geistlichen Werk. Nach einer kurzen Ruhepause ging es wieder an die Arbeit.
Sobald die Sonne unterging, stimmten die Schwestern Gesänge zur Ehre Gottes an. Nach dem Abendessen folgte die Zeit des Schweigens, der Stille, der inneren Einkehr. Nach Einbruch der Dunkelheit trugen die Frauen ein Dankgebet vor, baten Gott um eine gute Nacht und legten sich im Schlafsaal zur Ruhe. Gegen Mitternacht rief die Glocke erneut zur Versammlung, damit sie die Lobpreisungen anstimmen konnten.
Tuta umklammerte den Rosenkranz, den sie in der eingearbeiteten Tasche ihres Unterkleides trug. Weiße Perlen hatte ein Goldschmiedemeister mit feinen Goldkettchen verbunden. Die filigrane Arbeit endete mit einem goldenen Kreuz, in dessen Mitte ein Rubin eingelassen war. Sobald Tuta den Rosenkranz in Händen hielt, dachte sie an die Worte des Vaters, als er ihr das wertvolle Geschenk anlässlich ihrer Äbtissinnenweihe überreichte: »Das Gold soll für die Beständigkeit zwischen dir und Gott stehen, damit dich das Vertrauen niemals verlässt. Der rote Stein symbolisiert das Herzblut, das dich mit deinem Schöpfer verbindet.«
»Bitte, Gott, wieso schickst du mir so eine Prüfung?«, wisperte Tuta. »Gib mir die passenden Worte, Herr!«, flehte sie. Entschlossen schritt sie durch die Tür, die zum Refektorium führte. Sie rang um Fassung, als sie sagte: »Meine lieben Töchter, mein Bruder Adalbert brachte mir soeben die Nachricht, dass mein Vater in Gottes ewigen Frieden eingegangen ist.«
Sie konnte nicht verhindern, dass Tränen über ihre Wangen liefen. Die bedauernden Worte der Mitschwestern taten ihrer Seele wohl. Sie hörte die Gebete, die man sofort zu sprechen begann. Jetzt fiel ihr Blick auf Sophia, die mit versteinertem, kreidebleichem Gesicht und geschlossenen Augen auf einem Stuhl kauerte.
An ihre Mitschwestern gewandt bat Tuta: »Bitte geht in die Kirche und betet für die Seele des lieben Verstorbenen! Schließt die Türen und bleibt dort, bis ich zu euch komme!«
Nach und nach verließen die Frauen den Raum. Sophia blieb reglos sitzen. Als Tuta mit ihr alleine war, sagte Sophia in die entstandene Stille hinein: »Ich werde keinesfalls mit ihm gehen!« Sie öffnete ihre blauen Augen und blickte die Äbtissin direkt an.
Tuta nahm vorsichtig Sophias Hand und streichelte sie sanft. »Liebes Kind, hattest du wieder eine Vision?«
Sophia nickte und starrte zu Boden. »Ja«, wisperte sie. »Wie immer wurde es vollkommen still um mich herum, und ein grellweißes Licht erschien mitten am Tag. Da sah ich einen Mann und erhielt die Botschaft, dass ich ihm folgen müsse.«
»Es ist mein Bruder Adalbert«, offenbarte Tuta.
»Adalbert?«, entgegnete Sophia entsetzt. »Als ich ihn das letzte Mal sah, hatte er keine Narbe.«
»Wann bist du ihm begegnet?«, fragte Tuta erstaunt.
Sophia hob ihren Blick und schaute die Äbtissin verlegen an. »Kurz nach meinem elften Geburtstag. Als unser bairischer Herzog Heinrich in seinem Amt bestätigt wurde, gab es an seinem Hof in Regensburg ein glanzvolles Fest. Mein Bruder Hezilo ließ mich von Frauenwörth holen. Diesen entsetzlichen Abend werde ich nie vergessen.«
»Willst du mir erzählen, was geschah?«, fragte die Äbtissin.
»Ich fühlte mich unwohl, die Hofgesellschaft und die Gäste starrten mich neugierig an. In dem prachtvollen Kleid, das ich tragen musste, bekam ich kaum Luft. Ich trat vor die Türe, bemerkte aber nicht, dass mir Graf Adalbert folgte.«
»Und dann?«, fragte Tuta sanft.
»Ehrwürdige Frau Äbtissin, er ist Euer Bruder, ich weiß nicht, ob ich …«
Sie verstummte, und Tuta strich ihr aufmunternd über die Schulter. »Was tat er, liebes Kind?«
Schamvoll wisperte Sophia: »Er packte mich und gab mir einen Kuss auf die Lippen. Sein Atem roch nach Wein. Er sagte, dass es für ein reizendes Mädchen gefährlich sei, ohne männlichen Schutz zu sein. Zum Glück kamen Damen der Hofgesellschaft vorbei, und er zog sich zurück.«
Tuta schüttelte betroffen den Kopf und wagte beinahe nicht zu sagen, was sie der Gräfin zu verkünden hatte: »Mein Bruder möchte, dass du mit ihm gehst. Graf Hezilo gab ihm die Zusage, dass er dich als Ehefrau heimführen darf.«
»Hezilo?«, hauchte Sophia entsetzt.
»Ja«, erwiderte Tuta. »Du weißt, dass es das Recht der Männer ist, über unser Leben zu bestimmen.«
Tuta sah Sophias unglückliche Miene und die Tränen, die ihr über die Wangen liefen. Mitleid mit dem Schicksal dieses Mädchens überkam sie. Dennoch würde sie ihr nicht helfen können. Sie hatte keine Möglichkeit, sich Adalberts Begehren zu widersetzen.
Sophia sagte trotzig: »Ich will keinen Mann, ich will hier im Kloster bleiben!«
»Wir wissen beide, dass dein Bruder nicht bereit ist, dich als Nonne im Kloster zu lassen. Erinnerst du dich, was unser Ordensgründer Benedikt über den Gehorsam schrieb?«
Sophia nickte und antwortete: »Die höchste Stufe der Demut ist der Gehorsam ohne Verzug.«
Tuta nickte zustimmend, doch Sophia brauste auf: »Ich will Gott gehorchen, aber keinem Ehemann.«
Tuta seufzte: »Sophia, nimm es als Gottes Willen hin, dass Hezilo diesen Ehemann für dich erwählt hat. Zieh dir ein schönes Kleid an und komm dann zum Besucherzimmer.«
Sophia sank auf die Knie und flehte: »Bitte, könnt Ihr mir nicht helfen?«
Tief bewegt über ihre Worte sagte Tuta: »Sophia, glaub mir, es fällt mir schwer, dich gehen zu lassen. Doch wir wussten, dass es eines Tages geschehen würde. Du hast viele Menschen von ihren Krankheiten geheilt, es wird schwer, ohne dich zurechtzukommen.«
»Nicht ich, Gott wirkte durch mich, ehrwürdige Frau Äbtissin. Vielleicht ist es wirklich Gottes Wille, dass ich Adalberts Ehefrau werde. Bitte segnet mich, bevor ich diesen Ort verlassen muss, an dem ich so viel Glück fand.«
In diesem Moment wurde es Tuta erst voll bewusst, dass sie Sophia verlieren würde. Insgeheim hatte sie gehofft, dass Hezilo eines Tages dem Wunsch seiner Schwester entsprechen und sie für immer im Kloster lassen würde. Seit acht Jahren lebte Sophia hier. Die Entscheidung, das Mädchen an Adalbert zu geben, konnte Tuta nicht nachvollziehen.
Tuta seufzte tief und half der knienden Sophia mit einer liebevollen Geste aufzustehen.
Die Äbtissin nahm das wertvolle Geschenk des Vaters, ihren Rosenkranz, und legte ihn um Sophias Hals.
Wieso ausgerechnet Sophia, Allmächtiger?, dachte sie verzweifelt. Wie eine leibliche Schwester ist sie für mich, es gibt keine Frau, die ich lieber habe als sie. Willst du sie mir tatsächlich nehmen? Sei barmherzig mit mir!
Mit brüchiger Stimme betete sie: »Es segne dich der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Der gütige Gott gewähre dir Schutz und bleibe bei dir alle Tage, bis ans Ende der Welt.« Sie machte ein Kreuzzeichen über dem Kopf und dem Oberkörper Sophias.
»Adalbert wartet«, sagte sie dann. »Komm ins Besucherzimmer, wenn du bereit bist!«
Rasch wandte sie sich ab und ging zügig aus dem Raum, um ihre Tränen zu verbergen.
Burg Ammerthal, Nordgau
im Jahr des Herrn 1003, Juni
Graf Hezilo preschte in den Burghof von Ammerthal und rief seinem Knecht sofort einige Befehle entgegen. Dann stieg er schwungvoll vom Pferd, klopfte den Staub aus den Kleidern und ging ins Innere der Burg. Sein Bruder Bucco lief ihm entgegen und sagte: »Willkommen, Hezilo! Gott zum Gruße! Hat deine Reise den gewünschten Erfolg erzielt?«
Hezilo erwiderte die Willkommensworte und erklärte freudig: »Adalbert von Almau wird an unserer Seite sein! Er handelt gegen den Willen seines Vaters Gundolf, doch er versprach bis zum Ende des Monats, mit fünfzig Kriegern nach Ammerthal zu kommen.«
Dass er dem Almauer im Gegenzug für diese Unterstützung die Ehe mit Sophia versprochen hatte, verschwieg er dem Bruder. Viele Jahre hatte Hezilo als Oberhaupt der gräflichen Familie derer von Schweinfurt gezögert, Sophia zu verheiraten. Sein Wunsch war es immer gewesen, sie einem reichen und mächtigen Mann zur Ehefrau zu geben, der auch seine eigene, Hezilos, gesellschaftlicher Reputation fördern würde. Der Almauer hatte das alles nicht zu bieten, doch die beste und schlagkräftigste Reitertruppe, die man sich wünschen konnte. Sein Fußvolk stand im Ruf enormer Kampfeslust. Da Hezilo diese Männer zweifellos brauchte, musste er Adalberts Forderung nach einer Ehe mit Sophia erfüllen. Der Almauer ging ein enormes Risiko ein, indem er sich gegen den eigenen Vater und den König stellte. Weite Teile der Almauer Grafschaft waren königliches Lehen. Das hieß, der König konnte diese Gebiete ihrem derzeitigen Besitzer ohne Weiteres wieder wegnehmen, indem er das Lehen einzog.
Doch Hezilo kannte Adalbert. Der war ein unerschrockener, wild entschlossener Machtmensch und lehnte sich gegen alles auf, was seinen Interessen im Wege stand. Heimlich, ohne das Wissen Graf Gundolfs, würde er in den Kampf ziehen. Es war eine Freude, ihn an seiner Seite zu wissen.
Bucco legte dem Bruder die Hand auf die Schulter und sagte: »Graf Gundolf ist unerwartet verstorben. Heute Mittag brachte ein Bote die Nachricht. Adalbert wird mit allen verfügbaren Mannen mit uns in den Kampf ziehen.«
Hezilo sah ihn erstaunt an und murmelte: »Graf Gundolf tot? Hatte der Bote genauere Kunde darüber?«
»Nein«, erwiderte Bucco und fuhr fort: »Komm, Bruder, ruh dich aus, du hast einen langen Ritt hinter dir, das Willkommensmahl steht bereit.«
Hezilo nickte und folgte Bucco.
Kloster Frauenwörth, Chiemsee, Bayern
im Jahr des Herrn 1003, Juni
Als Tuta zu Adalbert zurückkam, sagte sie mit betont freundlicher und beherrschter Stimme: »Gräfin Sophia wird gleich bei Euch sein. Ohne Nachricht von Markgraf Hezilo zu haben, lasse ich Sophia nicht gerne ziehen. Doch Ihr seid mein Bruder, und ich vertraue Euch. Ich bitte Euch zu bedenken, dass Sophia segensreich für unsere Gemeinschaft wirkte. Ihre Heilkräfte retteten bereits viele Menschenleben.«
Adalberts höhnisches Lachen ließ Tuta zusammenfahren: »Heilkräfte? Genau, wie ich es vorher erwähnte, sie scheint ein bisschen verrückt zu sein! Die heilige Sophia! Verschont mich bitte mit diesem Unfug! Sie kommt sofort mit mir. Bald teilt sie die Schlafstatt mit mir. Wenn sie den ersten Sohn geboren hat, wird sie das Kloster schnell vergessen haben.«
Adalbert trat bedrohlich nahe an Tuta heran. Sie roch seinen säuerlichen, weingeschwängerten Atem. Angewidert wandte sie sich ab. Sie kämpfte gegen die aufsteigende Übelkeit an, die sie erfasste, wenn sie daran dachte, dass die zarte Sophia bald das Nachtlager mit diesem Rohling teilen würde. Was für eine grauenvolle Vorstellung! Sie hatte aufrichtiges Mitleid mit der Gräfin.
Kurz darauf hörten sie eine weibliche Stimme, die unsicher flüsterte: »Hier bin ich.«
Erstaunt blickten Tuta und Adalbert Sophia an, die den Raum geräuschlos betreten hatte. Sie hatte keines ihrer wertvollen Kleider angelegt, die sie in ausreichender Zahl besaß. Tuta spähte vorsichtig zu ihrem Bruder und bemerkte, wie sein Gesicht zornesrot anlief.
Sophia trug eine einfache, graue, bodenlange Tunika aus grobem Leinen, mit langen Ärmeln, wie es der Vorschrift einer Novizin entsprach. Ein Tuch verhüllte ihren Hals. Ihr langes blondes Haar verbarg sie unter einem Kopftuch, das Stirn und Kinn bedeckte. Um ihre Schultern lag ein dunkelgrauer Umhang, der mit Bändern an der Brust zusammengehalten wurde. Um ihren Hals hing der Rosenkranz, den ihr Tuta geschenkt hatte. Mit beiden Händen umklammerte die junge Frau das goldene Kreuz. Aufrecht und gefasst stand sie vor ihnen, das Haupt hoch erhoben.
Irritiert überlegte Tuta, woher Sophia diese Kleidung hatte.
Sie musterten einander schweigend. Adalbert runzelte die Stirn und ließ seinen Blick über Sophias Körper wandern.
Diese machte, wie es der höfischen Etikette entsprach, einen ehrerbietigen Knicks vor ihm. »Graf Adalbert«, wisperte sie.
»Was soll dieser Aufzug?«, donnerte er schroff. »Glaubt Ihr, dass es mich interessiert, ob Ihr eine Vorliebe für das Klosterleben hegt? Ihr kommt mit mir, wie es mit Eurem Bruder Hezilo vereinbart wurde!«
Erschrocken wich Sophia zurück. Noch nie hatte jemand auf derart grobe Weise das Wort an sie gerichtet. Ihr Mut sank. Sie fühlte sich unwohl. Angewidert blickte sie auf die Narbe, die Adalberts Gesicht verunstaltete.
»Gebt Eurem Bräutigam einen Kuss«, forderte er mit schmeichelnder Stimme.
Unsicher schaute Sophia zu Tuta, die neben ihrem Bruder stand.
Adalbert packte Sophia unvermittelt und hielt ihren Kopf zwischen seinen Händen. Er presste seine Lippen hart auf ihre. Sie taumelte leicht, als er sie abrupt wieder losließ.
Er leckte mit der Zunge über seinen Mund und raunte lüstern: »Der süße Geschmack von jungfräulichen Lippen! Ihr seid so dünn, Gräfin, ich mag die Frauen ein wenig draller, ich werde Euch gut füttern müssen!«
Sie schaute ihn entsetzt an. Der Anblick dieser unschuldigen Augen eines Mädchens, das nicht viel wusste von der Welt außerhalb der Klostermauern, reichte aus, Adalberts Verlangen ins Unermessliche zu steigern.
Lange wird er sich nicht mehr beherrschen können, dachte Tuta, der die gierigen Blicke des Bruders nicht entgangen waren. Es gab ihr einen Stich, wie er nun Sophia besitzergreifend an sich zog. »Bruder!«, rief sie empört. »Wo bleiben Eure Manieren?«
Seine Augen verengten sich zu schmalen Schlitzen, als er grinsend antwortete: »Wir sind doch im engsten Familienkreis.« Zu Sophia gewandt sagte er: »Ihr steht im sechzehnten Lebensjahr, oder?«
Sophia nickte zustimmend, und er fuhr fort: »Dann wird es höchste Zeit, dass ein Mann Euch in die Wonnen der körperlichen Liebe einweiht. Kommt, wir gehen.«
»Nein«, rief Tuta. »Das werde ich nicht zulassen.« Sie wunderte sich selbst, woher sie die Beherztheit zum Widerspruch nahm. Andererseits verhielt sich Adalbert im Moment wirklich nicht wie ein ritterlicher Ehrenmann.
»Ach nein?« Adalbert lachte süffisant und musterte sie mit eiskaltem Blick. »Was wollt Ihr tun? Ihr wähnt Euch unter dem Schutz des Königs? Wo ist Heinrich jetzt? Kann er Euch helfen?«
Tuta starrte ihn wortlos an.
»Aus einer Unachtsamkeit heraus kann es schnell zu einem Brand kommen! Wenn eine der Fackeln, die meine Mannen in den Händen halten, versehentlich die Klostergebäude treffen …«
»Das wagt Ihr nicht«, unterbrach ihn Tuta aufgebracht.
»Seid Ihr Euch da sicher?«, zischte er.
Sophia schüttelte den Kopf. »Das Kloster soll keinen Schaden nehmen! Ich gehe mit Euch, Graf Adalbert. Aber mein Leben und meine Seele gehören Christus, dessen heimliche Braut ich schon lange bin.«
Adalbert packte sie mit eisernem Griff und zog sie in seine Arme. »Bald werdet Ihr meine Frau sein«, raunte er. »Ich bin überzeugt davon, dass Ihr die Nächte mit mir bald nicht mehr missen möchtet.«
Sophia versuchte erfolglos, sich zu befreien, und sah Tuta Hilfe suchend an. Dieser Blick schnitt der Äbtissin ins Herz, und sie fragte Adalbert: »Wollt Ihr nicht wenigstens bis zum Morgen verbleiben?«
Adalbert runzelte unwillig die Stirn. Er hatte viel zu lange mit Tuta debattiert und musste den Weibern zeigen, dass er der Herr war und wo sie ihren Platz hatten. »Nein, auf keinen Fall!«, polterte er mit harter Stimme.
»Ich helfe Sophia, ihre Truhe zu packen, damit sie ihre persönlichen Sachen mitführen kann«, seufzte Tuta.
»Sie wird nichts mitnehmen, was sie an diesen unseligen Ort erinnert«, rief Adalbert. »Alles, was sie braucht, bekommt sie von mir. Nehmt Abschied!«
Tuta nahm das Mädchen in den Arm und spürte, wie dessen ganzer Körper zitterte.
»Schon gut«, wisperte Sophia, »ich werde meinem Bräutigam folgen und tun, was er will, meine Seele wird aber immer in Frauenwörth bleiben.«
Adalbert rieb sich zufrieden die Hände und bemerkte mit einem boshaften Grinsen: »Eure Seele will ich nicht, an Eurem wohlgeformten Leib bin ich mehr interessiert.«
Tuta fing den unglücklichen Blick Sophias auf. Den Ausdruck dieser Augen würde sie in alle Ewigkeit nicht vergessen.
»Wir gehen«, entschied Adalbert.
Sophia flüsterte Tuta zu: »Bringt Euch und die Frauen in Sicherheit! In meiner Vision sah ich Feuer!«
»Los!«, befahl der Graf, packte Sophia am Oberarm und zerrte sie zur Tür. »Meine Geduld ist zu Ende. Sperrt das Tor auf!«
Tuta blickte nachdenklich auf die junge Frau, die ihr in den letzten acht Jahren so ans Herz gewachsen war. Diese nickte unmerklich und ließ sich von Adalbert zum Tor führen.
Die Äbtissin holte aus der Pförtnerzelle den schweren Schlüssel und öffnete.
»So, liebste Gräfin«, säuselte Adalbert zu Sophia, während er sie grob durch das Portal schob, »sagt nicht auf Wiedersehen, denn ein Wiedersehen wird es sicher nicht geben.«
Mit zitternder Hand schloss Tuta das Tor hinter ihrem Bruder und durchschritt eilig den Klosterhof. Sophias Warnung war ein Zeichen, dass echte Gefahr bestand. Durch den Kreuzgang eilte Tuta zur Kirche. Das Gebäude aus massivem Stein würde mit Gottes Hilfe einem Feuer standhalten. Als sie das kühle Münster betrat, sah sie durch die kunstvoll gestalteten bunten Glasfenster das Schimmern der lodernden Fackeln. Sie tauchten den Raum in ein gespenstisches Licht.
Tuta berichtete den Nonnen von der Drohung ihres Bruders und Sophias Hinweis. Entsetzt sanken die Frauen auf die Knie und fingen laut an zu beten.
Schwester Aurelis, eine Greisin, blieb stehen. »Geliebte Mutter«, sagte sie. »Erst vor Kurzem erzählte mir Sophia von einem geheimen Versteck in der Kirche. Der Zugang muss in der Nähe des Grabes unserer verehrten Irmengard liegen.«
Während Tuta mit Lioba dorthin eilte, betete sie im Stillen: »Bitte, Irmengard und alle Heiligen des Himmels, helft uns in der Stunde der Not! Allmächtiger Gott, dein Wille geschehe, und doch flehe ich um Hilfe für mich und meine Töchter.«
Von draußen drang Lärm in das Kircheninnere, und Schwester Lioba flüsterte entsetzt: »Die Kirchentüre ist aus Holz.«
Tuta tastete mit ihren Füßen erfolglos den Boden ab. Mit beiden Händen fuhr sie über die raue Wand hinter und neben dem Grab. Sie entdeckte eine leichte Unebenheit, presste die Hände dagegen. Nichts geschah. Verzweifelt stemmte sie ihre Schulter gegen die Wand. Da wich der Stein rasch vor ihr zurück. Fast verlor Tuta das Gleichgewicht, erst im letzten Moment fand sie Halt.
Sie blickte in ein dunkles Gewölbe, aus dem ihr eiskalte, modrige Luft entgegenschlug, und rief einer Novizin zu: »Schnell, Judith, entzünde die dicke Kerze, die am Altar der Jungfrau Maria steht, und bring sie hierher!«
Es war die einzige Lichtquelle, die ihnen zur Verfügung stand. Tuta befahl den Frauen: »Folgt mir, beeilt Euch!«
Was würde sie erwarten? Es blieb keine Zeit, um zu überlegen, und die Äbtissin ging vorsichtig mit der Kerze voran. Nach und nach folgten die Frauen. Gemeinsam gelang es, die schwere Steintüre zu schließen. Mit klopfendem Herzen standen sie im Halbdunkeln. Bevor sie Klarheit über den Zustand ihres Zufluchtsortes gewannen, erlosch die Kerze. Sie kauerten im Finstern. Jetzt konnte ihnen nur noch Gott Schutz und Hilfe gewähren.
Kloster Frauenwörth, Chiemsee, Bayern
im Jahr des Herrn 1003, Juni
Jakob glitt vorsichtig in das hölzerne Ruderboot zurück. Ab und zu lugte er über den Bootsrand zum Kloster hin. Wie sein Vater und Großvater lebte er vom Fischfang.
Seit er mit einem Pilger gesprochen hatte, träumte er davon, über das Meer zu fahren. Der Mann, der von weit her kam, hatte ihm von dessen unendlicher Größe erzählt. So unermesslich, hatte er gesagt, sei die Ausdehnung, dass man kein Ufer mehr sah.
Obwohl es Jakob unfassbar schien, faszinierte ihn die Vorstellung. Er liebte das Wasser, er mochte die sanften Wellen des Chiemsees. Der Pilger erklärte ihm, dass man auf dem Meer bis zum Ende der Erde segeln könne und aufpassen müsse, nicht hinunterzufallen. Oh, wie gerne hätte der junge Bursche vom Chiemsee das erlebt! Was für ein verlockendes Abenteuer!
Wenn er es vor Sehnsucht nicht mehr aushielt, schlich er nachts aus der armseligen Hütte der Eltern und schlief im Kahn. Das sanfte Schaukeln gab ihm die Illusion, auf langer Reise zu sein. Sein Vater durfte ihn dort nicht erwischen, das hätte eine ordentliche Tracht Prügel zur Folge gehabt.
Auch in dieser Nacht hing der Jakob wieder seinen Träumen nach. Doch plötzlich vernahm er polternde Stimmen. Verwirrt und ängstlich schreckte er hoch und spähte neugierig über den Bootsrand. Sofort spürte er ein Gefühl der Bedrohung und erachtete es für besser, sich in den Kahn zu ducken. Er wusste nicht, was die Männer hier wollten, doch wie sie da standen, mit den brennenden Fackeln in den Händen, bekam er Angst.
Er musste mit ansehen, wie eine zarte Frau vor einem Mann auf die Knie fiel. Jakob hörte, dass sie ihn Graf nannte. Das hämische Lachen des Hünen und seiner Kumpane erschreckte ihn zutiefst. Zwei Kerle zerrten die Frau brutal hoch und hielten sie fest.
»Sie ist angeblich Hellseherin!«, rief der Rohling den Begleitern zu. »Verehrte Gräfin, sicher wisst Ihr auch, was ich heute Nacht mit Euch anstellen werde.«
»Nein«, stammelte Sophia verwirrt und senkte ihren Blick.
Die Kerle johlten und stimmten in Adalberts anzügliches Lachen ein.
Die Frau fragte: »Seid Ihr sicher, dass diese Tat dem Willen meines Bruders und unseres Königs Heinrich entspricht?«
Der Graf grinste: »Ho, ho! Wie rebellisch für eine Klosterschülerin. Als Seherin wisst Ihr es doch. Jetzt entzünden wir ein ansehnliches Feuerchen, dann habe ich dieses elende Kloster für immer vom Hals.«
»Nein!«, schrie die Frau entrüstet. »Bitte, nein!«
»Ach, Gräfin«, hörte Jakob den Hünen spöttisch rufen, »dachtet Ihr, es wäre damit getan, dass Ihr mit mir kommt? Wir werden noch viel Spaß zusammen haben, das hier ist der Anfang.«
Jakobs Herz klopfte zum Zerspringen. Die Eindringlinge mussten von der Nordseite der Insel gekommen sein. Am Ankerplatz lagen nur die ihm bekannten Boote. Als er vorsichtig den Kopf hob, wurde er Zeuge, wie der Graf eine brennende Fackel gegen das hölzerne Eingangstor des Klosters schmetterte.
Die Frau stieß einen Schrei aus, und der Mann brüllte: »Ihr dürft das Feuerchen gern mit ansehen.«
Jakob wagte nicht mehr zu atmen. Inständig hoffte er, dass ihn das verabscheuungswürdige Mannsvolk nicht entdeckte. Er legte sich nicht ins Boot zurück, er konnte seinen Blick nicht abwenden. Fassungslos starrte er auf die Szenerie.
Der Graf gab ein Handzeichen. Die Männer schleuderten grölend ihre Fackeln auf das strohgedeckte Dach des Klostergebäudes. Von allen Seiten kamen wild aussehende Gestalten angelaufen. Es herrschte ein wüstes Durcheinander.
Die ersten Fischer, aufgeschreckt durch den Lärm, liefen auf das Kloster zu. Als die Inselbewohner die ungestüme Meute entdeckten, kehrten sie um und brachten sich in Sicherheit. Was sollten sie auch gegen die vielen bewaffneten Mannsbilder ausrichten? Ihren Schwertern, Messern und Lanzen hatten sie nichts entgegenzusetzen.
Der Lärm wurde übertönt vom Rufen der Frau. »Haltet ein, Graf Adalbert!«, forderte sie lautstark. »Eure Seele ist sonst für immer verloren.«
Der Mann lachte schallend: »Fräulein Sophia, schaut, welch Höllenangst mich überfällt!« Dabei schlenkerte er mit seinen Händen, als ob er zitterte.
Die willfährigen Helfer des Grafen stimmten in sein Gelächter ein.
Das Dach des Klosters brannte kaum, doch aus dem Eingangsportal schlugen hohe Flammen.
»Jesus und Maria«, wisperte Jakob. »Das muss ein Albtraum sein.«
Unvermittelt, wie von Zauberhand, löste sich die Gräfin aus dem Griff der beiden Kerle und rannte auf das brennende Tor zu.
Weder der Graf noch die Männer regten sich. Starr standen sie da, unfähig einer Bewegung.
Sophia rief: »Ich sehe, dass dieser Frevel für ewig Unglück über Euer Geschlecht bringen wird, Adalbert von Almau!« Dann stürzte sie sich in die Flammen.
Jakob stockte der Atem. Die Gräfin lief durch das Feuer, scheinbar ohne verletzt zu werden! Unvermittelt krachte es furchtbar. Die Holzbalken, die das Portal stützten, brachen zusammen. Jakob hörte den markerschütternden Schrei der Frau, dann herrschte Totenstille. Er sank ins Boot, Tränen liefen ihm übers Gesicht.
In diesem Moment begann der Kahn kräftig zu schaukeln. Ein Sturm zog auf.
Ein gewaltiger Donnerschlag ließ Jakob zusammenzucken. Obwohl ihn das Grauen packte, konnte er nicht aufhören, zum Kloster hinüberzuspähen. Dunkelgraue, düstere Wolken wirbelten in einem unbändigen Tempo und mit ohrenbetäubendem Tosen über das Münster und die anderen Gebäude. Das laute Toben, Zischen und Heulen ging ihm durch Mark und Bein. Blitze zuckten am Himmel und tauchten die Nacht in geisterhaftes Licht.
»Des is der Weltuntergang«, entfuhr es Jakob. »Gott, steh mir bei!«
Unverhofft hörte das Wüten der Natur auf, und für einen Moment trat eine gespenstische Ruhe ein. Dann stürzte urplötzlich sintflutartiger Regen über den Klostergebäuden herab. Der Niederschlag löschte alle Flammen, jedoch nicht ein Tropfen traf Jakob.
Verwundert starrten die Frevler auf die Szenerie, dann rannten sie kopflos vor Angst davon. Als der letzte Übeltäter entschwand, kletterte Jakob aus dem Kahn und lief hinter ihnen her. Wie vermutet, lagen ihre Boote an der Nordseite der Insel. In fliegender Hast ruderten die Männer auf den See hinaus.
Mächtige Blitze erleuchteten die Landschaft taghell. Heftige Winde tobten, dichtes Gewölk schien die Berge zu verschlucken. Über den entfesselt tosenden See jagten enorme Wogen. Das Wasser schwappte in die Boote und ließ sie im Nu kentern. Die unglückseligen Insassen stürzten in den Chiemsee. Die panischen Schreie der ertrinkenden Männer gellten Jakob in den Ohren.
Er sank auf die Knie und fing an zu beten. »Himmelvater und alle Heiligen, stehts mir bei. Irmengard, verschon mich!«
Graf Adalbert stand aufrecht im Boot, als ob er den Tod erwartete. Aber Gott hatte offenbar andere Pläne mit ihm. Trotz der gigantischen Flut kippte sein Kahn nicht.
Unvermittelt beruhigten sich die tosenden Wasser, und die Wolken verschwanden. Graf Adalbert und eine Handvoll seiner Begleiter erreichten das rettende Ufer – dazu verdammt, mit der Schuld weiterzuleben, die sie auf sich geladen hatten.
Kloster Frauenwörth, Chiemsee, Bayern
im Jahr des Herrn 1003, Juni
»Wie lange werden wir hier noch sein müssen?«, weinte die neunjährige Gisela. Ihre zwölfjährige Schwester Gundred und die gleichaltrige Mechthild schluchzten leise vor sich hin. »Ich habe auch so furchtbare Angst«, jammerte Schwester Elisabeth, die dicht neben Tuta stand.
Die Äbtissin drückte tröstend ihre Hand und sagte: »Denkt alle daran: Jesus hat uns gesagt, dass wir uns niemals fürchten müssen.«
»Ja«, wisperte Gundred verzagt. »Ich versuche es, aber je länger wir hier stehen, umso mehr graut mir. Es ist schrecklich eng, dunkel und kalt. Wenn wir uns doch wenigstens hinsetzen könnten!«
»Wir beten jetzt einen Rosenkranz«, ordnete Tuta mit energischer Stimme an, obwohl sie selbst gegen die aufsteigende Panik ankämpfen musste. »Haltet euch an den Händen und vertraut Gott dem Herrn!« Es gelang der Äbtissin, die Unsicherheit zu verbergen, die sich ihrer bemächtigt hatte.
Nachdem sie den Rosenkranz verrichtet hatten, fühlten sie sich etwas getröstet. Schwester Hemma bat: »Bitte, liebe Mutter, erzählt uns doch von Eurer Erhebungsfeier zur Äbtissin. Die Schilderung dieses prachtvollen Festes wird uns Ablenkung schenken.« – »O ja, bitte«, bettelte auch Mechthild. Tuta fing an zu erzählen.
»Eine Woche vor dem Festakt begannen meine Mitschwestern und ich zu fasten. Am Vorabend der Feierlichkeit legten wir die Beichte ab. Die Kirche und den Kapitelsaal schmückten wir mit Wiesenblumen. An der Hand des Bischofs zog ich am 16. Juli 996 unter Gesängen in das Münster ein. Hier nahm der geistliche Herr meine öffentliche Proklamation zur Äbtissin vor. Eine feierliche heilige Messe wurde zelebriert. Ich leistete den Treueid auf den König, den Herzog und den Bischof. Er steckte mir einen goldenen Ring mit einem riesigen Saphirstein auf den Finger, und ich weiß noch genau, was er sagte: ›Mit diesem Ring sei angetraut der Mutter Kirche und der Heiligen Dreifaltigkeit. Durch mich, Justanus, lässt der Erzbischof kundtun, dass Tuta ab heute als Äbtissin die Geschicke von Frauenwörth bestimmen wird.‹ Die Konventualinnen traten einzeln vor, knieten vor mir und sprachen ihre Glückwünsche aus.«
Gundred seufzte. »Wie gern wäre ich dabei gewesen!«
»Dann hätte dir das nachfolgende Weihehochamt mit Gebeten, Gesängen und Psalmen auch gefallen. Ich zog in einem Nebenraum meine neue Kleidung an, gelobte noch einmal Gehorsam und legte mich auf einem vorbereiteten Teppich vor dem Altar auf den Boden. Mit dem Gesicht zur Erde liegend, wurden über mir die sieben Bußpsalmen gesprochen. Der Bischof sang die Oration. Er beräucherte mich mit Weihrauch und besprengte mich mit Weihwasser. Ich kniete mich hin, und er hielt seine Hände über mich und sang die Weihepräfation. Während der Gabenbereitung wurden meine Spenden an das Kloster zum Altar gebracht. Mein großzügiger Vater hatte drei dicke, armlange Kerzen aus Bienenwachs, zwei gewaltige Brotlaibe und zwei goldene Kerzenständer mitgebracht. Zwei versilberte Fässchen, die mein neues Wappen trugen, waren mit Wein gefüllt. Nach dem Kommunionempfang und dem Schlusssegen nahm ich auf einem Stuhl der Mitte der Kirche meinen Platz ein. Der Bischof trat vor mich hin und sprach einige Gebete und setzte mir die goldene Krone auf.«
»Die goldene Krone«, wisperte Gisela andächtig.
»Ja«, sagte Tuta. »Diese Krönungszeremonie stammt noch aus Zeiten Irmengards.«
»Dann legte mir der Bischof das Brustkreuz um den Hals und gab mir den Äbtissinnenstab in die Hand. Wieder kamen die Konventfrauen zu mir und küssten ihrer gekrönten Äbtissin zum Zeichen ihres Gehorsams die rechte Hand. Zusammen mit dem Bischof, den Prälaten und meinen Mitschwestern hielt ich dann in einer Prozession Auszug aus der Kirche. Im Zeltlager vor dem Kloster wurde ein Festmahl gereicht, und alle lobten und bewunderten Graf Gundolfs Großzügigkeit.«
Sie schwieg und überlegte derweil fieberhaft, wie sie in dieser Finsternis den Mechanismus für die Türöffnung des Verlieses finden sollte.
Ein Donnerschlag ließ die Frauen zusammenzucken. Sie spürten Wasser an ihren Füßen, das rasch zu steigen begann. Entsetzensrufe erfüllten das Versteck, als unvermittelt ein matter Lichtschein aufleuchtete.
Sophia stand unter ihnen und befahl: »Geht hinaus, es ist vorüber!«
Suchend blickte Tuta umher und entdeckte durch das fahle Licht einen kleinen Hebel neben der Steintüre.
Die Äbtissin rief: »Sophia, wie kommst du hierher?«
Die Türe ging auf, die Erscheinung war verschwunden. Eilig stolperten die Frauen ins Freie. Ein heftiger Schwall Wasser ergoss sich in das Innere der Kirche.
»Kniet nieder und lasst uns ein Dankgebet für unsere Rettung sprechen«, verfügte Tuta.
Von draußen vernahmen sie keine Geräusche mehr. Während die Äbtissin überlegte, was sie als Nächstes tun sollte, hörte sie ein polterndes Klopfen an der Kirchentüre.
»Hallo? Hallo?«, erscholl eine Stimme. »Ehrwürdige Frauen, seid Ihr in der Kirch? Die Gfahr ist vorbei. Falls Ihr da drin seid, öffnets die Tür! Hier ist Jakob, der Fischerbua, die Kerl’ sind weg.«
Die Äbtissin atmete auf und öffnete das Kirchenportal.
Als Jakob vor ihr stand, bekreuzigte er sich. »Gott sei’s gedankt, ehrwürdige Frau Äbtissin, Ihr lebt!«, stammelte er verlegen. »I hab alles genau g’sehn. Ein wahres Wunder ist g’schehn!«
Die Äbtissin und ihre Mitschwestern traten in den Innenhof der Abtei. Die fahle Morgensonne bahnte sich ihren Weg durch die Wolken und spiegelte sich in den Pfützen. Sie erinnerten an den gewaltigen Platzregen, der das Kloster vor der Vernichtung bewahrt hatte. Teile des Daches fehlten, aber die Unterkünfte der Nonnen, die Wirtschaftsgebäude und die Wohnungen der fürstlichen Fräulein schienen dem ersten Augenschein nach unbeschädigt. Vorsichtig gingen die Frauen in das Innere des Hauses. Entsetzensschreie ertönten. Das Regenwasser hatte mehr Schaden verursacht als das Feuer.
»Die Bücher«, flüsterte die Äbtissin erschrocken.
Mit flinken Schritten erklomm sie die Treppe, die ins Obergeschoss führte. Als sie vor der Bibliothek stand, zögerte sie erst, öffnete dann aber entschlossen mit einem Ruck die Türe. Ihr Blick glitt an die unversehrte Zimmerdecke und zum Bücherschrank. Ein Seufzer der Erleichterung entstieg ihrer Brust. Feuer und Wasser hatten den wertvollsten Schatz, die Bücher und das gesammelte Wissen, das in ihnen steckte, verschont.
»Danke, mein Gott«, stieß Tuta hervor. Tränen stiegen ihr in die Augen. Wie oft hatte sie mit Sophia in diesem Raum gesessen! Auf dem Tisch in der Mitte des Zimmers lagen einige lose Blätter aus wertvollem Pergament. Sie erkannte die kunstvolle Handschrift Sophias. Auf die Bitte Tutas hin hatte sie begonnen, ihre Erkenntnisse über die Heilkraft niederzuschreiben.
»Wo bist du, Sophia?«, murmelte Tuta.
Sie lief zu ihren Mitschwestern, die vom Schadensstand berichteten. Der Schlafsaal und die Zelle der Äbtissin waren unversehrt.
Der Fischer Jakob wartete schüchtern vor dem Eingang der Kirche. Er hatte ein schlechtes Gewissen, dass er auf dem Klostergelände herumstand, aber was hätte er sonst tun sollen? Die Äbtissin sollte doch erfahren, welches Wunder er hatte beobachten dürfen.
Endlich trat Tuta aus dem Gebäude und kam auf ihn zu. »Du bist der Sohn vom Alois, oder?«, fragte sie.
Jakob nickte, während er einen tiefen Bückling machte. »I hab die Männer beobachtet«, stammelte er. »De schöne Frau, sie is’ ins Feuer g’rannt.«
»Sophia!«, entfuhr es der erschrockenen Äbtissin. »Meine Güte, Sophia! Wo?«, rief sie.
Der Bub zeigte auf das zerstörte Eingangstor des Klosters. Die Äbtissin rief nach ihren Mitschwestern und lief rasch auf die Reste der Anlage zu, die ihnen vor Kurzem noch Schutz vor der Außenwelt gewährt hatte. Verkohlte Holzbalken lagen über einem Aschenhaufen. Der Fischer Jakob hielt der Äbtissin einen robusten Stock hin.
Tuta stocherte in der schwarzen Asche und sah etwas durch den Schmutz schimmern. Sie zog es hervor und erkannte den Rosenkranz, den sie Sophia zum Abschied geschenkt hatte. Unversehrt lag er in Tutas Hand. Es kam ihr wie ein letzter Gruß Sophias vor.
»Jetzt erzähl, Bub, was geschah mit der Frau?«
»Die Kerle haben sie nicht festhalten können, mit einem Sprung ist sie durchs Feuer glaufen!«
»Lasst uns die Stützträger beiseiteschieben«, befahl die Äbtissin, und gemeinsam hoben sie die schweren Balken weg. Tutas Herz klopfte heftig. Ihr graute vor dem Moment, wenn sie auf die sterblichen Überreste Sophias stießen. Stück für Stück räumten die Ordensfrauen die verkohlten Holzreste fort. Langsam arbeiteten sie sich vor. Doch als sie den Boden erreichten, hatten sie keine Spur von Sophia gefunden. Ratlos standen die Nonnen da und wussten nicht, was sie davon halten sollten.
Nach einiger Zeit flüsterte der Fischer Jakob: »Da ist ein Wunder g’schehn, ehrwürdige Frau! Das ist ein Wunder, wie Jesus Christus ist sie gleich in den Himmel aufg’fahrn.« Er kniete nieder und begann lautstark zu beten.
Erstaunt blickten sich die Nonnen an, berührt von der Gläubigkeit dieses einfachen Fischerjungen.
Bestürzt schaute die Äbtissin zu dem Jungen und den Frauen. Noch nie hatte sie die Last ihres Amtes so heftig empfunden wie in diesem Moment. Bestand tatsächlich die Möglichkeit, dass sich ein Wunder ereignet hatte? Alle standen schweigend um sie herum.
Benedikt von Nursia, der Gründer des Ordens, nach dessen Regeln sie lebten, sah den Abt oder die Äbtissin als »Stellvertreter Christi im Kloster« an. Wobei man der Äbtissin eine geringere Stellung einräumte als einem Abt, denn eine Frau konnte in den Augen der heiligen Mutter Kirche unmöglich Stellvertreterin Christi sein.
»Der Vorsteher einer Klostergemeinschaft sollte sich immer klar darüber sein, dass er wisse, wem mehr anvertraut ist, von dem wird mehr gefordert werden. Er wisse, welch schwere und mühsame Aufgabe er übernommen hat, Seelen zu leiten und der Eigenart vieler zu dienen.«
Tuta seufzte, als ihr die Worte in den Sinn kamen. »Benedikt kannte den Kleinmut der Menschen«, murmelte sie.
Resolut wies sie die Schwestern an: »Möglicherweise ist es Sophia gelungen, sich in Sicherheit zu bringen. Wir sollten nachsehen, ob sie sich im Klosterbereich versteckt hält.«
Tuta teilte die Frauen in Gruppen ein und gab Anweisung, in welchen Teilen der Gebäude sie nach Sophia schauen mussten. Mägde wurden ausgeschickt, um bei den Fischern nachzufragen, ob sie Sophia gesehen hätten.
Der Fischer Jakob schüttelte den Kopf. Die Freundlichkeit der Äbtissin hatte ihm Mut verliehen, und er wagte zu sagen: »Ich bin mir sicher, sie ist im Himmel. Ihr werdet sie nicht finden.«
Die Äbtissin lächelte und antwortete: »Jakob, Gottes Segen sei mit dir. Jetzt lauf mit den Mägden, hilf ihnen beim Suchen.«
Eine Novizin rannte aufgeregt auf Tuta zu: »Ehrwürdige Mutter, Ihr sollt bitte in die Kirche kommen.«
Tuta folgte dem Mädchen und sah ihre Priorin am Grab von Irmengard stehen. »Ich kann den Eingang zu dem Raum nicht finden, der uns Schutz gab«, rief sie.
Erstaunt stellte Tuta fest, dass die Wand hinter Irmengards Grab keine Vertiefung aufwies.
Gemeinsam tasteten sie jeden Zoll Mauerwerks ab, um den geheimen Mechanismus in Gang zu setzen. Tuta drückte ihre Schulter dagegen, aber nichts geschah! Die Priorin klopfte erfolglos mit einem Holzhämmerchen die Wand ab, um zu ergründen, ob ein Hohlraum vorhanden wäre. Ratlos standen sie in der Kirche.
»Es ist wahrhaft ein Wunder geschehen«, flüsterte Tuta. »Irmengard hat uns geholfen, eine andere Erklärung gibt es für mich nicht.«
Schwester Lioba nickte. »Ja, so ist es, ehrwürdige Mutter. Ihr gutes Wirken geht über ihren Tod hinaus.«
Sie entzündeten Kerzen an Irmengards Grab, knieten nieder und sprachen ein Dankgebet.
Kapitel 2
Burg Almau in der Nähe des Chiemsees, Bayern
im Jahr des Herrn 1003, Juni
Von den 42 Männern, die Graf Adalbert zur Fraueninsel begleitet hatten, kehrten nur vierzehn nach Almau zurück.
Mit Grausen dachten die Überlebenden an den jähen Wetterumschwung und die verzweifelten Hilfeschreie der Ertrinkenden. Im Gegensatz zu Adalbert glaubten sie fest daran, der Rache Gottes anheimgefallen zu sein. Ihr Herr hatte versucht, ein Kloster niederzubrennen. Was für ein Frevel!
Das Wehklagen der Frauen erfüllte das Dorf Almau und die Burg, als sie vom unrühmlichen Ende ihrer Ehemänner erfuhren. Die Schuld lag bei Graf Adalbert, doch als Unfreie hatten sie ohne Murren alles zu erdulden, was der Lehnsherr ihnen auferlegte und forderte.
Adalbert war mit seinen bewaffneten Handlangern in das Dorf geritten. Er hatte die Bauern aus ihren Hütten holen lassen und sie gezwungen, ihm zu folgen. Die friedlichen Zeiten, die unter Graf Gundolf geherrscht hatten, schienen beendet. Die Untertanen bekamen einen ersten Vorgeschmack darauf, welche Regierungsführung sie von Adalbert zu erwarten hatten.
Das Selbstbewusstsein des Grafen hatte jedoch auch einige Risse bekommen, denn bisher hatte er noch nie eine ernsthafte Niederlage einstecken müssen. Aber er würde sich nicht geschlagen geben. Er ärgerte sich über seine kopflose Flucht von der Insel und fragte sich, was ihn dazu bewegt hatte.
Schwerfällig glitt er vom Pferd. »Bringt mir Wein!«, brüllte er. Sofort eilte eine Magd herbei und reichte ihm einen Krug.
Mit gierigen, hastigen Schlucken leerte er das Gefäß. Aber der bittere Geschmack in seinem Mund wollte nicht weichen. Er schwankte in die Hauskapelle, was seinem Umfeld die Hoffnung gab, er würde Reue und Buße zeigen. Doch das Gegenteil trat ein.
Adalbert baute sich vor dem Altar auf und sagte leise: »Ein bisschen Regen und Sturm soll ich als Zeichen deiner Rache und deiner Stärke nehmen? Lass dir gesagt sein, Gott: Meine Macht und meinen Willen wird niemand brechen.« Er hob den Kopf, sah nach oben und brüllte: »Keiner! Hast du das gehört, Gott!«
Dann torkelte er zum Leichnam seines Vaters. Eingehüllt in ein weißes, mit Goldfäden besticktes Totenhemd lag er aufgebahrt auf einem Tuch aus dunkelblauem Stoff. Die vor der Brust gefalteten Hände umschlossen ein kostbares Silberkreuz.
Die Frauen, die mit Rosenkränzen in den Händen Totenwache hielten, sahen den Burgherrn nach dieser Gotteslästerung mit weit aufgerissenen, erschrockenen Augen an. Doch unterbrachen sie ihre murmelnden Gebete nicht.
»Wie es Brauch ist, habe ich mit den Klageweibern die Psalmen gesungen, als wir des Grafen sterbliche Hülle wuschen«, flüsterte die Totenfrau, die zu Adalbert trat. Sie hatte hervorragende Arbeit geleistet.
»Vortrefflich seht Ihr aus, Herr Vater«, murmelte Adalbert und wunderte sich gleichzeitig darüber, dass die sommerliche Hitze dem Leichnam nicht mehr zusetzte. Doch die Totenfrau schien Essenzen verwendet zu haben, die für eine ausreichende Konservierung sorgten. Die Fenster der Kapelle standen weit offen, damit die Seele des Vaters unverzüglich den Weg in den Himmel finden konnte.
Das Gesinde beschäftigte sich mit den Vorbereitungen für das Totenmahl, das im Anschluss an die Trauerfeier stattfinden sollte. Am Vortag hatte man bereits die ersten Tiere geschlachtet. Die Vorratskammern leerten sich merklich. Adalbert hatte einen enormen Aufwand zu leisten, doch er störte sich nicht daran. Berauscht von dem Gedanken, endlich sein eigener Herr zu sein, war es ihm gleichgültig, wie viel Fleisch und sonstige Naturalien verbraucht wurden. Dann müssten eben seine Bauern künftig den Gürtel enger schnallen.
Lange genug hatte ihn der Vater gegängelt.
Er nahm Schritte in der Kapelle wahr. Ein Priester trat zu ihm, verneigte sich leicht und sagte: »Gott zum Gruße, Graf Adalbert, der Bischof persönlich wird morgen die Grablegung vornehmen.«
»Davon bin ich ausgegangen«, knurrte Adalbert. »Mein Vater ließ der heiligen Mutter Kirche immer mehr zukommen, als sie verlangte.«
Unbeirrt fuhr der Priester fort: »Der Herr Bischof lässt ausrichten, dass es nicht mehr erlaubt ist, Tote innerhalb der Kapelle zu bestatten. Graf Gundolf muss auf dem Friedhof, in geweihter Erde, beerdigt werden.«
»Mein Vater wird neben meiner Mutter hier in dieser Kirche ruhen, da kann der Bischof sagen, was er will. Und wenn er den Segen nicht spenden will, dann soll er es lassen«, zischte Adalbert.
Der Priester schnappte hörbar nach Luft. »Graf Adalbert«, begann er.
Doch sofort wurde er rüde unterbrochen. »Das ist mein Wille, und so wird es getan. Ihr dürft Euch entfernen.« Adalbert blaffte die Worte in schroffem Tonfall, drehte dem Priester den Rücken zu und fuhr noch harscher fort: »So weit kommt es noch, dass mir ein Bischof Vorschriften macht!«
Der Priester schüttelte unwillig den Kopf und eilte aus der Kapelle.
Diese Pfaffen versuchen sich ständig in Angelegenheiten der Herrschaft einzumischen, dachte Adalbert verärgert. Was für eine unmögliche Vorstellung, den Vater nicht in der Kapelle zur letzten Ruhe zu betten. Diese Grablegung entsprach seinem Rang und seiner einst einflussreichen Position. Welchen Eindruck würde es auf die Trauergemeinde machen, wenn er seinen Vater in der Erde verscharren ließ?
»Na, alter Mann«, flüsterte er so leise, wie er konnte, denn er wollte nicht, dass die Klageweiber ihn hörten. »Schade, dass Ihr nicht mehr sprechen könnt! Wärt Ihr stolz auf mich? Und nicht nur auf Hellwegis? Eure Tochter, die den Namen Tuta annahm und die einst Eurer Ehefrau das Leben nahm?«