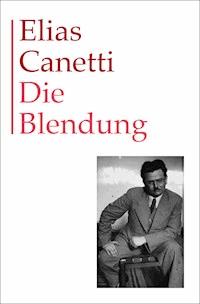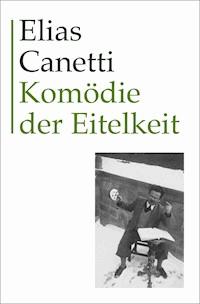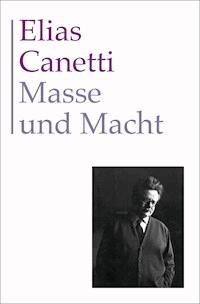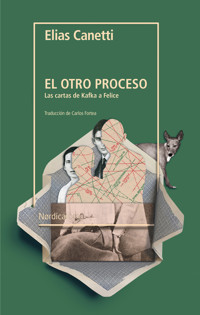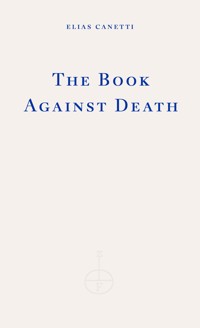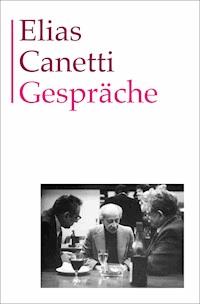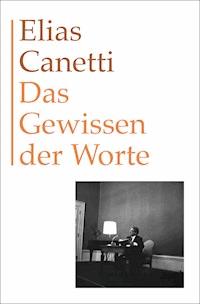
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die fünfzehn Essays, die Elias Canetti unter dem so bezeichnenden Titel "Das Gewissen der Worte" zusammengefasst hat, sind zugleich persönlich und universell: Das Öffentliche und das Private, so Canetti, lassen sich nicht mehr voneinander trennen und durchdringen einander auf früher unerhörte Weise. Canetti schreibt hier über Kafka und Konfuzius, über Büchner, Tolstoi und Karl Kraus und reflektiert die Entstehung seines Romans "Die Blendung" und seines philosophischen Hauptwerks "Masse und Macht".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 497
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Die fünfzehn Essays, die Elias Canetti unter dem so bezeichnenden Titel Das Gewissen der Worte zusammengefasst hat, sind zugleich persönlich und universell: Das Öffentliche und das Private, so Canetti, lassen sich nicht mehr voneinander trennen und durchdringen einander auf früher unerhörte Weise. Canetti schreibt hier über Kafka und Konfuzius, über Büchner, Tolstoi und Karl Kraus, und reflektiert die Entstehung seines Romans Die Blendung und seines philosophischen Hauptwerks
Elias Canetti
Das Gewissen der Worte
Essays
Impressum
ISBN 978–3–446–25348–3
Zuerst erschienen 1975
Wiedergegeben nach Band VI der Canetti-Werkausgabe
© 2015, 2016 Elias Canetti Erben Zürich, Carl Hanser Verlag München
Umschlaggestaltung: S. Fischer Verlag / www.buerosued.de
Cover: Elias Canetti in der Bayerischen Akademie der Schönen Künste, München 1975
Foto: Felicitas Timpe, Bayerische Staatsbibliothek München
Unser gesamtes lieferbares Programm und viele andere Informationen finden Sie unter www.hanser-literaturverlage.de. Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/HanserLiteraturverlage oder folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/hanserliteratur
Inhaltsverzeichnis
Das Gewissen der Worte
Vorbemerkung
Zur zweiten Auflage
Hermann Broch
Macht und Überleben
Karl Kraus, Schule des Widerstands
Dialog mit dem grausamen Partner
Realismus und neue Wirklichkeit
Der andere Prozeß. Kafkas Briefe an Felice
Wortanfälle
Hitler, nach Speer
Konfuzius in seinen Gesprächen
Tolstoi, der letzte Ahne
Dr. Hachiyas Tagebuch aus Hiroshima
Georg Büchner
Das erste Buch: Die Blendung
Der neue Karl Kraus
Der Beruf des Dichters
Vorbemerkung
In diesem Bande werden die Essays aus den Jahren 1962–1974 in der Reihenfolge ihrer Entstehung vorgelegt. Es mag auf den ersten Blick etwas absonderlich erscheinen, hier Figuren wie Kafka und Konfuzius, Büchner, Tolstoi, Karl Kraus und Hitler, Katastrophen furchtbarsten Ausmaßes wie die von Hiroshima und literarische Betrachtungen über das Schreiben von Tagebüchern oder die Entstehung eines Romans beisammen zu finden. Aber um ebendieses Nebeneinander war es mir zu tun, denn nur scheinbar handelt es sich um Unvereinbares. Das Öffentliche und das Private lassen sich nicht mehr voneinander trennen, sie durchdringen einander auf früher unerhörte Weise. Die Feinde der Menschheit haben rapid an Macht gewonnen, sie sind einem Endziel der Zerstörung der Erde sehr nah gekommen, es ist unmöglich, von ihnen abzusehen und sich auf die Betrachtung geistiger Vorbilder allein zurückzuziehen, die uns noch etwas zu bedeuten haben. Diese sind rarer geworden, viele von denen, die früheren Zeiten ausreichen mochten, enthalten in sich nicht genug, umfassen zuwenig, um uns noch dienen zu können. Um so wichtiger ist es, von solchen zu sprechen, die auch unserem monströsen Jahrhundert standgehalten haben.
Doch hätte man auch damit, mit der Erfassung von Vor- und Gegenbildern, selbst wenn sie einem gelingen könnte, nicht genug getan. Es ist, glaube ich, nicht überflüssig, auch für sich zu sprechen – unter unzähligen anderen einer der Zeugen dieser Zeit – und die Bemühung zu schildern, sich ihrer zu erwehren. Vielleicht ist es nicht etwas bloß Privates zu zeigen, wie ein Mensch heute zu einem Roman gelangt, sofern es seine Absicht dabei war, sich der Zeit wirklich zu stellen; oder wie er sich ein Tagebuch einrichtet, um in ihr geistig nicht zerrieben zu werden. Ich hoffe, man wird verstehen, warum ich auch das kurze Stück ›Wortanfälle‹ hier aufgenommen habe. Zwar bezieht es sich auf einen Aspekt der Emigration, doch keineswegs weil ich über sie klagen wollte, die das Schicksal von Millionen Vertriebenen war, während noch mehr andere als Gefangene oder als Soldaten zugrunde gingen. Ich wollte darin schildern, was mit einer Sprache geschieht, die entschlossen ist, sich nicht aufzugeben, wahrer Gegenstand dieses Stückes ist die Sprache und nicht der Sprecher.
Der Essay ›Macht und Überleben‹ faßt, etwas anders gewendet und schärfer pointiert, einen der Hauptgedanken aus ›Masse und Macht‹ zusammen. Es hat sich wiederholt gezeigt, daß er sich eben in dieser konzentrierten Form zur Einführung in das größere Buch eignet. ›Hitler, nach Speer‹ ist die Anwendung der Erkenntnisse von ›Masse und Macht‹ auf eine bestimmte Figur, die uns noch nahe genug steht, um jedem eine Prüfung der Brauchbarkeit dieser Erkenntnisse zu ermöglichen.
Die Rede über Hermann Broch, die ich an die Spitze dieses Bandes gestellt habe, fällt aus dem bezeichneten Rahmen auffallend heraus. Sie wurde 1936 zu Brochs 50. Geburtstag in Wien gehalten. Zwischen ihr und dem folgenden Essay ›Macht und Überleben‹ liegen 26 Jahre. Der Leser mag sich wohl fragen, was mich zur Aufnahme dieser einsamen frühen Rede bestimmt hat, und ich bin ihm eine Erklärung dafür schuldig. Hermann Brochs Werk lag damals erst zum Teil vor; das Wichtigste waren die Schlafwandler-Trilogie und einige kurze Prosastücke wie ›Die Heimkehr‹. Ich habe versucht, immer im Gedanken an Broch und auch aus der Kenntnis seiner Person heraus zu bestimmen, was man von einem Dichter fordern müsse, damit er für unsere Zeit etwas bedeute. Die drei Eigenschaften, zu deren Aufstellung ich damals kam, sind so, daß ich auch heute nichts daran ändern könnte. Jahre später fiel mir zu meinem Erstaunen auf, daß ich mich seither – wenn auch auf sehr unzulängliche Weise – darum bemüht hatte, diesen Forderungen selber nachzukommen. Über Hermann Broch nachdenkend, war ich zu dem gelangt, was zu den Ansprüchen an mein eigenes Leben werden sollte. Seither gab es etwas, woran ich drohendes Versagen messen konnte. In Zeiten des Erlahmens, die während der langjährigen Arbeit an ›Masse und Macht‹ nicht selten waren, hielt ich mir die ›drei Gebote‹, wie ich sie etwas überheblich nannte, vor und richtete mich in einer Hoffnung, die zwar ungestüm und maßlos, aber doch auch unentbehrlich war, an ihnen auf. So halte ich es nicht für sinnlos, daß der Band damit beginnt.
Die zeitliche Kluft, die diese frühe Rede von den späteren Essays trennt, ist übrigens nur eine scheinbare. Denn sie handeln vielfach von frühen Erlebnissen und Inhalten, und als ich sie in der Reihenfolge, die sie jetzt haben, zusammenhängend las, erschienen sie mir wie eine Rechenschaft über die geistigen Stationen meines ganzen erwachsenen Lebens.
Zur zweiten Auflage
Seit dieser Band, dessen Berechtigung für mich in seiner Vielgestaltigkeit allein besteht, der Öffentlichkeit vorliegt, hat mich das Gefühl nicht verlassen, daß ihm etwas fehlt: ein Schluß, der ihn von innen her zusammenfaßt. Was läßt sich heute, da man weiß, wie wenig man selber ausgerichtet hat, von einem Dichter erwarten? Wäre es möglich für einen, der heute beginnt, den Sinn dieses scheinbar zerstörten Wortes zurückzugewinnen? In der Münchner Rede ›Der Beruf des Dichters‹ vom Januar 1976 habe ich versucht, etwas darüber zu sagen. Als ich sie schrieb, schien sie mir etwas Autonomes für sich, als sie geschrieben war, erkannte ich, daß sie an den Schluß dieses Bandes gehört. Es lag mir daran, sie in diese zweite Auflage aufgenommen zu sehen, als Ausdruck der Hoffnung auf solche, denen es gelingen wird, ihrer Forderung besser zu genügen.
Hermann Broch
Rede zum 50. Geburtstag Wien, November 1936
Es hat seinen schönen Sinn, wenn man den fünfzigsten Geburtstag eines Mannes dazu benutzt, ihn vor aller Öffentlichkeit anzusprechen, ihn aus den dichten Zusammenhängen seines Lebens beinahe gewaltsam herauszureißen und so hinzustellen, erhöht, von vielen Seiten und allen sichtbar, als wäre er ganz allein, zu einer steinernen und unabänderlichen Einsamkeit verurteilt, obwohl ihm doch schon die eigentliche, die heimliche Einsamkeit seines Lebens, weich und demütig, wie sie ist, gewiß Pein genug verursacht. Es ist, als würde ihm mit dieser Ansprache gesagt: Ängstige dich nicht, du hast dich genug für uns geängstigt. Wir alle müssen sterben; aber noch ist es nicht sicher, ob auch du sterben mußt. Vielleicht haben gerade deine Worte uns vor den Späteren zu vertreten. Du hast uns treu und ehrlich gedient. Die Zeit entläßt dich nicht.
Um diesen Worten, wie einem Zauber, ihre volle Wirksamkeit zu verleihen, wird das Siegel der fünfzig Jahre auf sie gedrückt. Denn die Vergangenheit ist für unser Denken in Jahrhunderte abgeteilt; neben den Jahrhunderten hat nichts Platz. Soweit es der Menschheit um den großen Zusammenhang ihres Gedächtnisses geht, füllt sie alles, was ihr wichtig und eigentümlich erscheint, in den Sack der Jahrhunderte. Das Wort selbst, das diesen Abschnitt bezeichnet, hat etwas Ehrwürdiges bekommen. Man spricht, wie in einer geheimnisvollen Priestersprache, vom Säkularen. Die magische Kraft, die früher, bei primitiven Völkern, bescheideneren Zahlen eignete, der Drei, der Vier, der Fünf, der Sieben, ist auf das Säkulum übergegangen. Ja selbst die vielen, die sich in der Vergangenheit nur tummeln, um dort ihre Unzufriedenheit an der Gegenwart wiederzufinden, diese von der Bitternis aller bekannten Jahrhunderte Erfüllten, stecken gerne die Zukunft, von der sie träumen, in bessere Jahrhunderte ab.
Kein Zweifel, das Jahrhundert ist für die Sehnsucht des Menschen gerade weit genug gespannt. Denn wenn er sehr viel Glück hat, wird er so alt; es kommt ab und zu vor; doch ist es unwahrscheinlich. Mit Staunen und vielen Geschichten werden die wenigen umgeben, die es wirklich so weit gebracht haben. In alten Chroniken werden sie geflissentlich mit Namen und Stand aufgezählt. Man beschäftigt sich mit ihnen noch mehr als mit den Reichen. Der heftige Wunsch, gerade noch so viel Leben zu bewältigen, mag, nach Einführung des Dezimalsystems, das Jahrhundert zu seinem hohen Rang erhoben haben.
Die Zeit aber, die ihren Fünfzigjährigen feiert, kommt ihm darin auf halbem Weg entgegen. Sie streckt ihn den Späteren hin, als des Bewahrens würdig. Sie macht ihn, vielleicht gegen seinen Willen, deutlich sichtbar in der schütteren Schar der wenigen, die mehr für sie da waren als für sich. Sie freut sich der runden Höhe, auf die sie ihn gehoben hat, und verbindet damit eine leise Hoffnung: Vielleicht hat er, der nicht lügen kann, ein gelobtes Land gesehen, und vielleicht spricht er noch davon, ihm würde sie glauben.
Auf dieser Höhe steht heute Hermann Broch, und so sei denn, um es rundheraus zu sagen, die Behauptung gewagt, daß wir in ihm einen der ganz wenigen repräsentativen Dichter unserer Zeit zu verehren haben; eine Behauptung, die ihre volle Wucht nur hätte, wenn ich hier die vielen aufzählen könnte, die keine Dichter sind, obwohl sie dafür gelten. Aber wichtiger als diese Ausübung eines anmaßlichen Henkeramtes erscheint es mir, die Eigenschaften zu finden, die sich in einem Dichter hart beieinander stoßen müssen, damit er als repräsentativ für seine Zeit gelten könne. Es wird sich, wenn man gewissenhaft an eine solche Untersuchung herantritt, kein bequemes und noch weniger ein harmonisches Bild ergeben.
Die pralle und entsetzensvolle Spannung, in der wir leben und von der uns keines der herbeigesehnten Gewitter erlösen konnte, hat sich aller Sphären bemächtigt, selbst der freieren und reineren Sphäre des Staunens. Ja es ließe sich unsere Zeit, wenn man sie sehr kurz zu fassen hätte, als die Zeit bezeichnen, in der man über die entgegengesetztesten Dinge zugleich staunen könne: Über die jahrtausendelange Wirkung eines Buches zum Beispiel und zugleich darüber, daß nicht alle Bücher länger noch wirken. Über den Glauben an Götter und zugleich darüber, daß wir nicht stündlich vor neuen Göttern auf die Knie sinken. Über die Geschlechtlichkeit, mit der wir geschlagen sind, und zugleich darüber, daß diese Spaltung nicht tiefer reicht. Über den Tod, den wir nie wollen, und zugleich darüber, daß wir nicht schon im Mutterleib aus Gram über unsere kommenden Dinge sterben. Das Staunen war einmal wohl jener Spiegel, von dem gerne gesprochen wird, der die Erscheinungen auf eine glattere und ruhigere Fläche brachte. Heute ist dieser Spiegel zerschlagen und die Splitter des Staunens sind klein geworden. Aber selbst im kleinsten Splitter spiegelt sich keine Erscheinung allein; unbarmherzig zerrt sie ihr Entgegengesetztes mit; was du auch siehst und sowenig du siehst, es hebt sich von selbst, indem du es siehst, wieder auf.
So werden wir auch nicht erwarten, daß es um den Dichter, wenn wir ihn im Spiegel einzufangen suchen, anders bestellt sei als um die gequälten Kiesel des Alltags. Von allem Anfang an treten wir dem weitverbreiteten Irrtum entgegen, daß der große Dichter über seine Zeit erhaben sei. Niemand ist von sich aus über seine Zeit erhaben. Die Erhabenen sind gar nicht da. Sie mögen im alten Griechenland sein oder bei mancherlei Barbaren. Das sei ihnen vergönnt; viele Blindheiten gehören dazu, um so weit weg zu sein, und das Recht, sich an allen Sinnen zu versperren, ist niemand abzusprechen. Nur ist so einer nicht über uns erhaben, sondern über die Summe von Erinnerung – an das alte Griechenland zum Beispiel –, die wir in uns tragen, ein experimenteller Kulturhistoriker sozusagen, der sinnreich an sich ausprobiert, was seinem sicheren Vernehmen nach stimmen muß. Der Erhabene ist noch ohnmächtiger als der experimentelle Physiker, der zwar nur an einem Teilgebiet seiner Wissenschaft herumhantiert, dem aber immer die Möglichkeit einer Kontrolle bleibt. Mit mehr als wissenschaftlichem, mit geradezu kultischem Anspruch tritt der Erhabene auf; meist nicht einmal Sektenstifter, Priester für sich allein; für sich allein zelebriert er, der einzige Gläubige ist er sich selbst.
Der wahre Dichter aber, wie wir ihn meinen, ist seiner Zeit verfallen, ihr leibeigen und hörig, ihr niedrigster Knecht. Er ist mit einer Kette kurz und unzerreißbar an sie gefesselt, ihr auf das engste verhaftet; seine Unfreiheit muß so groß sein, daß er nirgends andershin zu verpflanzen wäre. Ja wenn es nicht den Beigeschmack des Lächerlichen hätte, würde ich einfach sagen: Er ist der Hund seiner Zeit. Er läuft über ihre Gründe hin, bleibt hier stehen und dort; willkürlich scheinbar, doch unermüdlich, für Pfiffe von oben empfänglich, nur nicht immer, leicht aufzuhetzen, schwerer zurückzurufen, von einer unerklärlichen Lasterhaftigkeit getrieben; ja in alles steckt er die feuchte Schnauze, nichts wird ausgelassen, er kehrt auch zurück, er beginnt von neuem, er ist unersättlich; im übrigen schläft und frißt er, aber nicht das unterscheidet ihn von den anderen Wesen, was ihn unterscheidet, ist die unheimliche Beharrlichkeit in seinem Laster, dieses von Laufen unterbrochene innige und ausführliche Genießen; so wie er nie genug bekommt, bekommt er es auch nicht rasch genug; ja es ist, als hätte er für das Laster seiner Schnauze eigens laufen gelernt.
Ich bitte Sie um Entschuldigung für ein Bild, das Ihnen des Gegenstandes, um den es uns geht, in hohem Maße unwürdig erscheinen muß. Aber es ist mir darum zu tun, an die Spitze der drei Attribute, die dem repräsentativen Dichter dieser Zeit gebühren, gerade das eine zu stellen, von dem nie die Rede ist, das eine, von dem die übrigen erst ihren Ausgang nehmen, das ganz konkrete und eigentümliche Laster, das ich für ihn fordere, ohne das er, wie eine traurige Frühgeburt, nur mühsam zu dem aufgepäppelt wird, was er dann doch nicht ist.
Dieses Laster verbindet den Dichter so unmittelbar mit seiner Umwelt wie die Schnauze den Hund mit seinem Revier. Es ist bei jedem ein anderes Laster, einmalig und neu in der neuen Situation der Zeit. Es ist ja nicht zu verwechseln mit der normalen Zusammenarbeit der Sinne, die jeder ohnehin hat; im Gegenteil, eine Störung des Gleichgewichts in dieser Zusammenarbeit, das Ausfallen eines Sinnes zum Beispiel, oder die übermäßige Entwicklung des anderen kann Anlaß zur Ausbildung des notwendigen Lasters werden. Es ist immer unverkennbar, heftig und primitiv. Es drückt sich im Gestaltlichen und Physiognomischen deutlich aus. Der Dichter, der sich von ihm besessen sein läßt, verdankt ihm das Wesentliche seiner Erfahrung.
Aber auch das Problem der Originalität, über das mehr gestritten als gesagt wurde, erfährt von hier aus eine andere Beleuchtung. Originalität darf man bekanntlich nicht fordern. Wer sie haben will, hat sie nie; und die eitlen und wohlausgesonnenen Clownerien, mit denen manche aufwarteten, um als originell zu gelten, sind gewiß noch in unser aller peinlicher Erinnerung. Doch ist von der Ablehnung der Originalitätshascherei bis zur tölpelhaften Behauptung, daß ein Dichter gar nicht originell sein müsse, ein ungeheuer weiter Schritt. Ein Dichter ist originell, oder er ist gar keiner. Er ist es auf eine tiefe und simple Weise, durch das, was wir sein Laster nannten. Er ist es so sehr, daß er es gar nicht weiß. Sein Laster treibt ihn, die Welt selbst auszuschöpfen, was niemand sonst für ihn vermöchte. Unmittelbarkeit und Unerschöpflichkeit, die beiden Eigenschaften, die man vom Genie schon immer zu fordern wußte und die es auch immer hat, sind die Kinder dieses Lasters; wir werden noch Gelegenheit haben, die Probe aufs Exempel zu machen und zu erkennen, welcher Art es denn bei Broch selbst sei.
Die zweite Eigenschaft, die man vom repräsentativen Dichter heute verlangen muß, ist der ernste Wille zur Zusammenfassung seiner Zeit, ein Drang zur Universalität, der sich durch keine Einzelaufgabe abschrecken läßt, von nichts absieht, nichts vergißt, nichts ausläßt, es sich in gar nichts leichtmacht.
Mit dieser Universalität hat sich Broch selbst eingehend und wiederholt beschäftigt. Mehr noch: Man kann sagen, daß sein dichterischer Wille sich an der Forderung nach Universalität recht eigentlich entzündet hat. Ursprünglich und für lange Jahre ein Mann der strengen Philosophie, gestattete er es sich nicht, das, was ein Dichter leistet, besonders ernst zu nehmen. Zuviel Konkretes und Abgesondertes schien ihm darin zu stecken, Stück- und Winkelwerk, nie war das Ganze da. Die Philosophie, zur Zeit, da er zu philosophieren begann, gefiel sich noch manchmal in ihrer alten Forderung nach Universalität, zaghaft zwar, denn ihre Forderung war seit langem verjährt; aber als großherziger und auf alles Unendliche gerichteter Geist ließ Broch sich von dieser Forderung gerne täuschen. Dazu kam der tiefe Eindruck, den ihm die universelle, geistige Geschlossenheit des Mittelalters machte, ein Eindruck, den er nie ganz überwunden hat. Er ist der Meinung, daß damals ein geschlossenes geistiges Wertsystem bestand; und geraume Zeit seines Lebens hat er sich mit einer Untersuchung über den ›Zerfall der Werte‹ beschäftigt, der für ihn mit der Renaissance beginnt und nur sein katastrophales Ende mit dem Weltkrieg erreicht.
Während dieser Arbeit hat das Dichterische in ihm allmählich die Oberhand gewonnen. Sein erstes umfassendes Werk, die Romantrilogie ›Die Schlafwandler‹, stellt genau besehen die dichterische Realisierung seiner Geschichtsphilosophie dar, allerdings auf seine eigene Zeitspanne, die Zeit von 1888–1918, eingeschränkt. Der ›Zerfall der Werte‹ ist in deutlichen und sehr dichterischen Gestalten realisiert worden. Man wird das Gefühl nicht los, daß das Vollgültige, ja zuweilen Mehrdeutige, das sie an sich haben, gegen den Willen oder doch unter schamhaftem Widerstreben ihres Urhebers zustande gekommen ist. Es wird immer merkwürdig bleiben, wie hier einer sein Eigenstes unter einem Berg von Angedachtem zu verstecken suchte.
Durch die ›Schlafwandler‹ hat Broch eine Möglichkeit zur Universalität gerade dort gefunden, wo er sie am wenigsten vermutet hätte, im Stück- und Winkelwerk des Romans, und äußert sich nun darüber an den verschiedensten Stellen: »Der Roman hat Spiegel aller übrigen Weltbilder zu sein«, sagt er einmal. »Das Dichtwerk hat in seiner Einheit die gesamte Welt zu umfassen«, oder »der moderne Roman ist polyhistorisch geworden«. »Immer ist Dichten eine Ungeduld der Erkenntnis.«
Am klarsten formuliert er wohl seine neue Einsicht in der Rede über »James Joyce und die Gegenwart«:
»Die Philosophie hat ihrem Zeitalter der Universalität, dem Zeitalter der großen Kompendien selbst ein Ende gesetzt, sie mußte ihre brennendsten Fragen aus ihrem logischen Raum entfernen oder, wie Wittgenstein sagt, ins Mystische verweisen.
Und dies ist der Punkt, an dem die Mission des Dichterischen einsetzt, Mission einer totalitätserfassenden Erkenntnis, die über jeder empirischen oder sozialen Bedingtheit steht, und für die es gleichgültig ist, ob der Mensch in einer feudalen, in einer bürgerlichen oder in einer proletarischen Zeit lebt, Pflicht der Dichtung zur Absolutheit der Erkenntnis schlechthin.«
Die dritte Forderung, die man an den Dichter zu stellen hätte, wäre die, daß er gegen seine Zeit steht. Gegen seine ganze Zeit, nicht bloß gegen dies oder jenes, gegen das umfassende und einheitliche Bild, das er allein von ihr hat, gegen ihren spezifischen Geruch, gegen ihr Gesicht, gegen ihr Gesetz. Sein Widerspruch soll laut werden und Gestalt annehmen; er darf nicht etwa erstarren oder schweigend resignieren. Er muß strampeln und schreien wie ein ganz kleines Kind; aber keine Milch der Welt, auch aus der gütigsten Brust nicht, darf seinen Widerspruch stillen und ihn in Schlaf lullen. Wünschen muß er sich den Schlaf, aber er darf ihn nie erlangen. Vergißt er seines Widerspruchs, so ist er abtrünnig geworden, wie in früheren gläubigen Zeiten ein ganzes Volk seinem Gotte.
Es ist eine grausame und radikale Forderung, grausam, weil sie in so starkem Gegensatz zum Früheren steht. Denn keineswegs ist der Dichter ein Held, der seine Zeit zu bewältigen und sich untertan zu machen hätte. Im Gegenteil, wir sahen, daß er ihr verfallen ist, ihr niedrigster Knecht, ihr Hund; und dieser selbe Hund, der sein Leben lang seiner Schnauze nachläuft, Genießer und willenloses Opfer, Lüstling und genossene Beute zugleich, dieses selbe Geschöpf soll in einem Atem gegen das alles sein, sich gegen sich selbst und sein Laster stellen, ohne sich je davon befreien zu dürfen, weitermachen und empört sein und obendrein um seinen eigenen Zwiespalt wissen! Es ist eine grausame Forderung, wirklich, und es ist eine radikale Forderung; sie ist so grausam und radikal wie der Tod selbst.
Denn aus der Tatsache des Todes leitet sich diese Forderung her. Der Tod ist die erste und älteste, ja man wäre versucht zu sagen: die einzige Tatsache. Er ist von monströsem Alter und stündlich neu. Er hat den Härtegrad 10, und wie ein Diamant schneidet er auch. Er hat die absolute Kälte des Weltraums, – 273 Grad. Er hat die Windstärke des Hurrikans, die höchste. Er ist der sehr reale Superlativ, von allem; nur unendlich ist er nicht, denn auf jedem Weg wird er erreicht. Solange es den Tod gibt, ist jeder Spruch ein Widerspruch gegen ihn. Solange es den Tod gibt, ist jedes Licht ein Irrlicht, denn es führt zu ihm hin. Solange es den Tod gibt, ist nichts Schönes schön, nichts Gutes gut.
Die Versuche, sich mit ihm abzufinden, und was sind die Religionen sonst, sind gescheitert. Die Erkenntnis, daß es nichts nach dem Tode gibt, eine fürchterliche und nie ganz auszuschöpfende Erkenntnis, hat eine neue und verzweifelte Heiligkeit auf das Leben geworfen. Der Dichter, dem es kraft dessen, was wir ein wenig summarisch sein Laster nannten, möglich ist, an vieler Leben teilzuhaben, hat auch an allen Toden teil, von denen diese Leben bedroht sind. Seine eigene Angst, und wer hätte sie nicht vor dem Tode, muß zur Todesangst aller werden. Sein eigener Haß, und wer haßt den Tod nicht, muß zum Todeshaß aller werden. Dies und nichts anderes ist sein Widerspruch zur Zeit, die von Myriaden und Abermyriaden Toden erfüllt ist.
Damit ist dem Dichter ein Erbteil des Religiösen zugefallen, und sicher das beste Stück aus dem Erbe. Er hat nicht wenig an Erbschaften zu tragen: Die Philosophie hat ihm, wie wir sahen, ihre Forderung nach Universalität der Erkenntnis vermacht; die Religion die bereinigte Problematik des Todes. Das Leben selbst, das Leben, wie es vor aller Religion und Philosophie war, das animalische, seiner selbst und seines Endes nicht bewußte Leben, gab ihm, in der konzentrierten und glücklich kanalisierten Form der Passion, seine unersättliche Gier.
Es wird nun unsere Aufgabe sein, zu untersuchen, wie der Zusammenhang dieser Erbteile in einem einzigen Menschen, eben in Hermann Broch, beschaffen ist. Nur in ihrer Zusammengehörigkeit sind sie ja von Bedeutung. Ihre Einheit macht das Repräsentative seiner Person. Die ganz konkrete Passion, von der er besessen ist, muß ihm den Stoff bieten, den er zum universalen, verbindlichen Bild seiner Zeit verdichtet. Seine ganz konkrete Passion muß aber auch auf natürliche und eindeutige Weise in jeder ihrer Schwingungen den Tod verraten. Denn so nährt sie ja den unaufhörlichen, unerbittlichen Widerspruch gegen die Zeit, die den Tod verhätschelt.
Erlauben Sie mir jetzt einen Sprung zu der Materie, die uns im weiteren fast ausschließlich beschäftigen wird, zur Luft. Es wird Sie vielleicht verwundern, daß von etwas so Gewöhnlichem überhaupt die Rede ist. Sie erwarten etwas über die Eigenart unseres Dichters zu hören, über das Laster, dem er verfallen ist, seine schreckliche Passion. Sie vermuten dahinter etwas Peinliches, oder sofern Sie vertrauensvoller veranlagt sind, doch zumindest etwas sehr Geheimnisvolles. Ich muß Sie enttäuschen. Brochs Laster ist ganz alltäglicher Art, alltäglicher als Tabakrauchen, Alkoholgenuß und Kartenspielen, denn es ist älter, Brochs Laster ist das Atmen. Er atmet leidenschaftlich gern, und er atmet nie genug. Er hat eine unverwechselbare Art dabeizusitzen, wo es auch sei; scheinbar abwesend, weil er nur selten und ungern mit den geläufigen Mitteln der Sprache reagiert, in Wahrheit anwesend wie kein anderer, denn immer ist es ihm um die Gesamtheit des Raumes zu tun, in dem er sich befindet, um eine Art von atmosphärischer Einheit.
Da genügt es nicht zu wissen, daß hier ein Ofen steht und dort ein Schrank; zu hören, was einer sagt und was der andere vernünftig antwortet, als hätten die beiden es vorher einträchtiglich besprochen; es genügt auch nicht, den Ablauf und die Masse der Zeit zu registrieren, wann der kommt, wann jener aufsteht, wann der dritte geht, das besorgt schon die Uhr für uns. Viel mehr ist zu spüren, überall, wo Menschen in einem Raume beisammen sind und atmen. Der Raum kann ja voll guter Luft sein und die Fenster geöffnet. Es kann geregnet haben. Der Ofen kann warme Luft verbreiten, und diese Wärme mag die Anwesenden ungleichmäßig erreichen. Der Schrank mag eine gute Weile verschlossen gewesen sein; die andere Luft, die ihm nun plötzlich, da er geöffnet wird, entströmt, ändert vielleicht das Verhalten der Anwesenden zueinander. Sie sprechen, gewiß, sie haben auch was zu sagen, aber sie formen ihre Worte aus Luft, und indem sie sie sagen, erfüllen sie das Zimmer urplötzlich mit neuen und sonderbaren Schwingungen, katastrophalen Veränderungen des früheren Bestandes. Und die Zeit, die wahre psychische Zeit, richtet sich am allerwenigsten nach der Uhr; sie ist viel eher und zu sehr gutem Teil eine Funktion der Atmosphäre, in der sie abläuft. Es ist also ungemein schwer, auch nur annähernd zu bestimmen, wann einer wirklich in eine Gesellschaft kam, wann jener aufstand, und wann der dritte wirklich ging.
Gewiß, das alles läßt sich simpel an, und ein erfahrener Meister wie Broch darf über solche Exempel lächeln. Aber es soll damit nur angedeutet werden, wie wesentlich für ihn selbst gerade all das geworden ist, was zum Atemhaushalt gehört, wie er die atmosphärischen Verhältnisse sich ganz zu eigen gemacht, so daß sie bei ihm oft unmittelbar für die Beziehungen der Menschen stehen; wie er hört, indem er atmet, und tastet, indem er atmet, wie er alle seine Sinne seinem Atemsinn unterordnet, und so mutet er zuweilen wie ein großer, schöner Vogel an, dem die Flügel gestutzt wurden, aber seine Freiheit sonst belassen. Statt ihn grausam in einen einzigen Käfig zu sperren, haben ihm die Peiniger alle Käfige der Welt geöffnet. Noch treibt ihn der unersättliche Lufthunger jener raschen, gehobenen Zeit; ihn zu sättigen, eilt er von Käfig zu Käfig. Jedem entnimmt er eine Probe der Luft, die ihn erfüllt und trägt sie mit sich fort. Früher war er ein gefährlicher Räuber, in seinem Hunger fiel er alles Lebende an; jetzt ist Luft der einzige Raub, nach dem es ihn gelüstet. Er bleibt nirgends lange; so rasch er kommt, so rasch geht er. Den eigentlichen Herren und Insassen der Käfige entzieht er sich. Er weiß, daß er nie, aus allen Käfigen der Welt nicht, zusammenatmen wird, was er früher hatte. Seine Sehnsucht nach jenem großen Zusammenhang, nach der Freiheit über allen Käfigen, behält er immer. So bleibt er der große, schöne Vogel, der er war, den anderen an den Luftbrocken kenntlich, die er sich bei ihnen holt, sich selbst an seiner Unrast.
Aber mit dem Lufthunger und mit dem häufigen Wechsel der Atemräume ist es für Broch keineswegs getan. Seine Fähigkeit reicht weiter; er merkt sich sehr wohl, was er einmal eratmet hat; er merkt es sich in der einmaligen, exakt erlebten Form. Und so vieles Neue und vielleicht Kräftigere dazukommen mag, die Gefahr einer Vermischung atmosphärischer Eindrücke, für uns andere ganz natürlich, besteht bei ihm nicht. Nichts verwischt sich ihm, nichts verliert seine Deutlichkeit; er besitzt eine reiche und wohlgeordnete Erfahrung in Atemräumen. An seinem Willen liegt es, von dieser Erfahrung Gebrauch zu machen.
Man muß also annehmen, daß Broch mit etwas begabt ist, was ich nur als Atemgedächtnis zu bezeichnen vermag. Die Frage, was denn dieses Atemgedächtnis eigentlich sei, wie es funktioniere und wo es seinen Sitz habe, liegt nahe. Man wird sie mir stellen, und ich werde nichts Präzises darauf zu antworten wissen. Und auf die Gefahr hin, von der dafür zuständigen Wissenschaft als Pfuscher verachtet zu werden, muß ich aus bestimmten Wirkungen, die anders nicht zu erklären wären, auf das Vorhandensein eines solchen Atemgedächtnisses schließen. Um der Wissenschaft ihre Verachtung nicht ganz leicht zu machen, müßte man in Erinnerung bringen, wie weit die abendländische Zivilisation von allen subtileren Problemen des Atems und der Atemerfahrung abgekommen ist. Die älteste, exakte, ja fast experimentelle Psychologie, von der man weiß, die mit mehr Recht allerdings als Psychologie der Selbstbeobachtung und der inneren Erfahrung zu bezeichnen ist, ein Werk der Inder, hatte ebendieses Gebiet zum Gegenstand. Man kann nicht genug darüber staunen, daß die Wissenschaft, dieser Parvenü der Menschheit, die sich im Laufe der letzten Jahrhunderte schamlos und auf aller Kosten bereichert hat, gerade hier, auf dem Gebiet der Atemerfahrung, verlernt hat, was schon einmal, in Indien, wohlbekannt und offenbar tägliche Übung unzähliger Adepten war.
Gewiß ist auch bei Broch eine unbewußte Technik mit im Spiel, die ihm das Auffassen atmosphärischer Eindrücke, ihr Festhalten und späterhin ihre Verarbeitung erleichtert. Der naive Beobachter wird manches bei ihm bemerken, was dazu gehören könnte. So haben Gespräche mit ihm eine ganz eigene und unvergeßliche Interpunktion. Er antwortet nicht gern mit Ja oder Nein, das wären vielleicht zu heftige Zäsuren. Die Rede des zu ihm Sprechenden teilt er willkürlich in scheinbar sinnlose Abschnitte ein. Sie sind bezeichnet durch einen charakteristischen Laut, den man phonographisch treu wiedergeben müßte, der vom anderen als Zustimmung aufgefaßt wird, und in Wirklichkeit bloß die Registrierung des Gesprochenen anzeigt. Eine Negation bekommt man kaum zu hören. Es wird der Partner weniger in seiner Art des Denkens und Sprechens aufgenommen; Broch ist vielmehr daran interessiert zu erfahren, auf welche spezifische Art der andere die Luft erschüttert. Er selbst gibt wenig Atem her und wirkt so, wenn er mit den Worten an sich hält, verstockt und abwesend.
Aber lassen wir dieses Persönliche, das eine ausführlichere Behandlung erfordern würde und nur dann von wirklichem Wert wäre, beiseite, und fragen wir uns, was Broch mit der reichen Atemerfahrung, über die er verfügt, in seiner Kunst unternimmt. Gibt sie ihm die Möglichkeit, etwas auszudrücken, was sonst nicht ausdrückbar wäre? Bietet eine Kunst, die aus ihr schöpft, ein neues und anderes Bild der Welt? Ja ist eine Dichtung, die aus der Atemerfahrung gestaltet, überhaupt denkbar? Und welches sind die Mittel, deren sie sich im Medium des Wortes bedient?
Darauf wäre vor allem zu antworten, daß die Vielfalt unserer Welt zum guten Teil auch aus der Vielfalt unserer Atemräume besteht. Der Raum, in dem Sie hier sitzen, in ganz bestimmter Anordnung, fast völlig von der Umwelt abgeschlossen, die Art, in der sich Ihr Atem vermischt, zu einer Ihnen allen gemeinsamen Luft, und dann mit meinen Worten zusammenstößt, die Geräusche, die Sie stören, und die Stille, in die diese Geräusche wieder zurückfallen, Ihre unterdrückten Bewegungen, Abwehr oder Zustimmung, das alles ist, vom Standpunkt des Atmenden aus, eine ganz einmalige, unwiederholbare, in sich ruhende und wohlabgegrenzte Situation. Aber gehen Sie dann ein paar Schritte weiter, und Sie finden die völlig andere Situation eines anderen Atemraumes, in einer Küche vielleicht oder in einem Schlafzimmer, in einem Gassenschank, in einer Tram, wobei immer an eine konkrete und unwiederholbare Konstellation atmender Wesen in Küche, Schlafzimmer, Gassenschank oder Tram zu denken ist. Die Großstadt steckt von solchen Atemräumen so voll wie von einzelnen Menschen; und so wie die Zersplitterung dieser Menschen, von denen keiner wie der andere ist – eine Art Sackgasse jeder –, den Hauptreiz und den Hauptjammer des Lebens ausmacht, so könnte man auch über die Zersplitterung der Atmosphäre klagen.
Die Vielfalt der Welt, ihre individuelle Zerspaltenheit, eigentlicher Stoff der künstlerischen Gestaltung, ist also auch für den Atmenden gegeben. Wie weit war sich die frühere Kunst dessen bewußt?
Man kann nicht sagen, daß das Atmosphärische in der früheren Betrachtung der Menschen vernachlässigt worden sei. Die Winde gehören zu den ältesten Gestalten des Mythos. Jedes Volk hat ihrer gedacht; wenige Geister oder Götter sind so populär wie sie. Das Orakelwesen der Chinesen hat sich sehr nach den Winden gerichtet. Stürme, Gewitter, Tornados bilden ein tragendes Element der Handlung in den ältesten Heldenepen. Sie sind auch später und noch heute ein immer wiederkehrendes Requisit; mit Vorliebe werden gerade sie aus den Rumpelkammern des Kitsches hervorgezogen. Eine Wissenschaft, die heute mit sehr seriösem Anspruch auftritt, denn sie gibt Prognosen aus, die Meteorologie, beschäftigt sich zum guten Teil mit den Strömungen der Luft. Aber das alles ist im Grunde doch sehr grob, denn immer geht es dabei um das Dynamische der Atmosphäre, um Veränderungen, die uns fast erschlagen, um Mord und Totschlag in der Luft, große Kälte, große Hitze, rasende Geschwindigkeiten, tobende Rekorde.
Stellen Sie sich vor, daß die moderne Malerei in einer groben und simplen Darstellung der Sonne oder des Regenbogens bestünde! Das Gefühl einer Barbarei ohnegleichen müßte uns vor solchen Bildern packen. Man wäre geneigt, Löcher in sie zu schlagen. Sie hätten keinerlei Wert. Man würde ihnen das Attribut ›Bild‹ glattweg absprechen. Denn eine lange Übung hat die Menschen gelehrt, aus der Vielfalt und der Veränderlichkeit der Farben, die sie erleben, statische, wohlabgeschlossene, doch in ihrer Ruhe unendlich differenzierte Flächenwerke abzuziehen, die sie Bilder nennen.
Die Dichtung des Atmosphärischen als einem Statischen steht erst im Beginn ihrer Entwicklung. Der statische Atemraum ist noch kaum gestaltet worden. Bezeichnen wir das, was hier zu erschaffen wäre, im Gegensatz zum farbigen Bild des Malers als Atembild, und halten wir, bei der großen Verwandtschaft, die zwischen Atem und Sprache zweifellos besteht, an der Voraussetzung fest, daß die Sprache ein geeignetes Medium für die Realisierung des Atembildes sei. Da müssen wir auch erkennen, daß wir in Hermann Broch den Begründer dieser neuen Kunst zu sehen haben, ihren ersten bewußten Vertreter, dem auch das klassische Vorbild seiner Gattung geglückt ist. Als klassisch und großartig muß man ›Die Heimkehr‹ bezeichnen, eine Erzählung von etwa dreißig Seiten, in der dargestellt wird, wie ein Mann, der eben in einer Stadt angekommen ist, auf ihren Bahnhofsplatz hinaustritt und bei einer alten Frau und ihrer Tochter ein Zimmer aufnimmt. Das ist der Inhalt im Sinne der alten Erzählungskunst, die Fabel. In Wahrheit dargestellt werden der Bahnhofsplatz und die Wohnung der alten Dame. Die Technik, die Broch hier anwendet, ist so neu wie vollkommen. Ihre Untersuchung würde eine eigene Abhandlung erfordern und wäre, da sie sehr ins Detail zu gehen hätte, hier gewiß nicht am Platze.
Seine Gestalten sind ihm keine Gefängnisse. Er entschwebt ihnen gerne. Er muß ihnen entschweben; aber er bleibt viel in ihrer Nähe. Sie sind in Luft gebettet, er hat für sie geatmet. Seine Behutsamkeit ist eine Scheu vor dem Hauch seines eigenen Atems, der an die Ruhe der anderen rührt.
Seine Empfindlichkeit aber trennt ihn auch von den Menschen seiner Zeit, die sich, alles in allem, noch in Sicherheit wähnen. Zwar sind auch sie nicht gerade stumpf. Die Gesamtsumme an Empfindlichkeit in der Kulturwelt ist sehr groß geworden. Doch hat auch diese Empfindlichkeit, so sonderbar es klingen mag, ihre geregelte und durch nichts zu erschütternde Tradition. Sie ist bestimmt durch das, was man bereits gut kennt. Martern, die bis auf uns überliefert sind, von denen oft berichtet und von denen oft in gleicher Weise berichtet wurde, wie die der Märtyrer zum Beispiel, erregen in uns den tiefsten Abscheu. Manche Zeiten haben, so stark ist der Eindruck, den Erzählungen und Abbildungen in uns hervorrufen, als Ganzes den Stempel der Grausamkeit aufgedrückt bekommen. So ist das Mittelalter für die riesige Mehrheit aller lesenden und schreibenden Menschen die Zeit der Folter und der Hexenverbrennungen. Auch die verbürgte Nachricht, daß die Hexenverbrennungen eigentlich Erfindung und Übung einer späteren Zeit sind, vermag daran wenig zu ändern. Der Durchschnittsmensch denkt mit Grauen ans Mittelalter zurück, nämlich an den sorgfältig konservierten Henkerturm einer mittelalterlichen Stadt, die er – vielleicht auf seiner Hochzeitsreise – besichtigt hat. Der Durchschnittsmensch hat, alles in allem, mehr Grauen fürs ferne Mittelalter übrig, als für den Weltkrieg, den er selbst erlebt hat. Man kann diese Erkenntnis in einem niederschmetternden Satz zusammenfassen: Es wäre schwerer heute, einen einzigen Menschen öffentlich zum Feuertod zu verurteilen als einen Weltkrieg zu entfesseln.
Die Menschheit ist also bloß dort wehrlos, wo sie keine Erfahrung und Erinnerung besitzt. Neue Gefahren können so groß sein, wie sie wollen, sie werden sie nur schlecht und höchstens äußerlich gerüstet finden. Die größte aller Gefahren aber, die in der Geschichte der Menschheit je aufgetaucht ist, hat sich unsere Generation zum Opfer erwählt.
Es ist die Wehrlosigkeit des Atems, von der ich zum Schluß noch sprechen will. Man macht sich von ihr schwer einen zu großen Begriff. Für nichts ist der Mensch so offen wie für die Luft. In ihr bewegt er sich noch wie Adam im Paradies, rein und schuldlos und keines bösen Tieres gewärtig. Die Luft ist die letzte Allmende. Sie kommt allen gemeinsam zu. Sie ist nicht vorgeteilt, auch der Ärmste darf von ihr nehmen. Und wenn einer schon Hungers sterben müßte, so hat er, was gewiß wenig ist, immerhin bis zum Schluß geatmet.
Und dieses letzte, das uns allen gemeinsam war, soll uns alle gemeinsam vergiften. Wir wissen es, aber wir spüren es noch nicht, denn unsere Kunst ist das Atmen nicht.
Hermann Brochs Werk steht zwischen Krieg und Krieg, Gaskrieg und Gaskrieg. Es könnte sein, daß er die giftigen Partikel des letzten Krieges noch jetzt irgendwo spürt. Doch das ist unwahrscheinlich. Sicher aber ist, daß er, der besser zu atmen versteht als wir, schon heute am Gas erstickt, das uns anderen, wer weiß, wann erst, den Atem benehmen wird.
Macht und Überleben
Zu den unheimlichsten Phänomenen menschlicher Geistesgeschichte gehört das Ausweichen vor dem Konkreten. Es besteht eine auffallende Tendenz, erst auf das Fernste loszugehen und alles zu übersehen, woran man sich in nächster Nähe unaufhörlich stößt. Der Schwung der ausfahrenden Gesten, das Abenteuerlich-Kühne der Expeditionen ins Ferne täuscht über die Motive zu ihnen hinweg. Nicht selten handelt es sich einfach darum, das Nächste zu vermeiden, weil wir ihm nicht gewachsen sind. Wir spüren seine Gefährlichkeit und ziehen andere Gefahren unbekannter Konsistenz vor. Selbst wenn diese gefunden sind, und sie finden sich immer, haben sie dann erst noch den Glanz des Plötzlichen und Einmaligen für sich. Es würde viel Beschränktheit dazu gehören, diese Abenteuerlichkeit des Geistes zu verdammen, obwohl sie zuweilen offenkundiger Schwäche entspringt. Sie hat zu einer Erweiterung unseres Horizonts geführt, auf die wir stolz sind. Aber die Situation der Menschheit heute, wie wir alle wissen, ist so ernst, daß wir uns dem Allernächsten und Konkretesten zuwenden müssen. Wir ahnen nicht einmal, wieviel Zeit uns geblieben ist, das Peinlichste ins Auge zu fassen, und doch könnte es sehr wohl sein, daß unser Schicksal von bestimmten harten Erkenntnissen, die wir noch nicht haben, abhängig ist.
Ich will heute von Überleben sprechen, womit ich natürlich das Überleben anderer meine, und zu zeigen versuchen, daß dieses Überleben im Kern alles dessen steht, was wir – etwas vage – als Macht bezeichnen; und ich möchte dazu mit einer ganz einfachen Betrachtung beginnen.
Der stehende Mensch wirkt autonom, als stünde er für sich allein, und als hätte er noch die Möglichkeit zu jeglicher Entscheidung. Der sitzende Mensch übt einen Druck aus, sein Gewicht stellt sich nach außen dar und erweckt ein Gefühl von Dauer. So wie er sitzt, kann er nicht fallen; er wird größer, wenn er sich erhebt. Der Mensch aber, der sich zur Ruhe niedergelassen hat, der liegende Mensch, hat sich entwaffnet. Es ist ein leichtes, ihm in der Wehrlosigkeit seines Schlafes beizukommen. Der Liegende ist vielleicht gefallen, vielleicht ist er verwundet worden. Bevor er wieder auf den Beinen steht, wird er nicht für voll genommen.
Der Tote aber, der nie wieder aufsteht, hat eine ungeheure Wirkung. Die erste Regung in dem, der einen Toten vor sich sieht, besonders wenn ihn dieser etwas anging, aber nicht nur dann, ist eine der Ungläubigkeit. Argwöhnisch, wenn er ein Feind war, mit bebender Erwartung, wenn ein Freund, belauert man ihn auf jede Regung seines Leibes hin. Er hat gezuckt, er atmet. Nein. Er atmet nicht. Er zuckt nicht. Er ist wirklich tot. Und nun setzt der Schrecken ein vor der Tatsache des Todes, die man die einzige Tatsache nennen möchte, die so ungeheuerlich ist, daß sie alles in sich einbezieht. Die Konfrontation mit dem Toten ist eine Konfrontation mit dem eigenen Tod, weniger als dieser, da man daran nicht wirklich stirbt, mehr als dieser, da immer auch ein anderer da ist. Selbst dem Berufstöter, der seine Unempfindlichkeit mit Mut und Männlichkeit verwechselt, bleibt diese Konfrontation nicht erspart, in einem wohlverborgenen Teile seiner Natur erschrickt auch er. Über diese Aufnahme des Toten in den Betrachter, diese tiefste und menschenwürdigste aller Aufnahmen, wäre viel zu sagen; mit ihrer präzisen Beschreibung ließen sich Stunden und Nächte füllen. Das großartigste Zeugnis für sie ist das älteste: der Gram des sumerischen Gilgamesch über den Tod seines Freundes Enkidu.
Aber hier geht es uns nicht um dieses offene Stadium eines Erlebnisses, für das wir uns als Opfer nicht zu schämen haben und das darum im hellen Lichte der Religionen steht, sondern um das nächste Stadium, das wir uns nicht gern eingestehen, das viel folgenreicher war als das frühere und keineswegs menschenwürdig, das sich im Herzen der Macht wie der Größe findet und das wir unerschrocken und schonungslos ins Auge fassen müssen, wenn wir begreifen wollen, was als Macht gilt und was diese anrichtet.
Der Schrecken über den Toten, wie er vor einem daliegt, wird abgelöst von Genugtuung: Man ist nicht selbst der Tote. Man hätte es sein können. Aber es ist der andere, der liegt. Man selbst steht aufrecht, ungetroffen und unberührt, und ob es ein Feind war, den man getötet, ein Freund, der einem starb, alles sieht plötzlich so aus, als wäre der Tod, von dem man bedroht war, von einem selber auf ihn abgelenkt worden.
Es ist dieses Gefühl, das sehr rasch die Oberhand gewinnt; was erst Schrecken war, durchdringt sich nun mit Befriedigung. Nie ist der Stehende, dem alles noch möglich ist, sich seines Stehens mehr bewußt. Nie fühlt er sich besser aufrecht. Der Augenblick hält ihn fest, das Gefühl der Erhabenheit über den Toten bindet ihn an diesen. Wenn der Aufrechte Flügel hätte, er würde jetzt nicht entschweben. Er bleibt, wo er ist, in der nächsten Nähe des Leblosen, diesem zugewandt, und wer immer dieser ist, er wirkt auf ihn, als ob er ihn eben noch zum Kampfe herausgefordert und bedroht hätte, und verwandelt sich in eine Art von Beute.
Dieser Sachverhalt ist so furchtbar und so nackt, daß er auf jede Weise verschleiert wird. Ob man sich seiner schämt oder nicht, ist für die Bewertung des Menschen entscheidend. Aber am Sachverhalt selbst ändert es nichts. Die Situation des Überlebens ist die zentrale Situation der Macht. Überleben ist nicht nur erbarmungslos, es ist konkret, eine genau begrenzte, unverwechselbare Situation. Der Mensch glaubt nie ganz an den Tod, solange er ihn nicht erlebt hat. Aber er erlebt ihn an anderen. Sie sterben vor seinen Augen, als einzelner jeder, und jeder einzelne, der stirbt, überzeugt ihn vom Tod. Er nährt den Schrecken davor, und er ist statt seiner gestorben. Der Lebende hat ihn statt seiner vorgeschoben. Der Lebende dünkt sich nie größer, als wenn er mit dem Toten konfrontiert ist, der für immer gefällt ist: In diesem Augenblick ist ihm, als wäre er gewachsen.
Doch ist es ein Wachstum, das man für gewöhnlich nicht zur Schau trägt. Es kann hinter echtem Kummer zurücktreten und von diesem ganz verdeckt sein. Aber auch wenn der Verstorbene einem nur wenig bedeutet hat und eine besondere Zurschaustellung von Trauer von einem gar nicht erwartet wird, geht es sehr gegen die gute Sitte, etwas von der Genugtuung merken zu lassen, die die Konfrontation mit dem Toten in einem hervorruft. Es ist ein Triumph, der verborgen bleibt, den man niemand und vielleicht nicht einmal sich selber eingesteht. Die Konvention hat hier ihren Wert: Sie sucht eine Regung geheim und klein zu halten, deren unbekümmerte Manifestation die gefährlichsten Folgen hätte.
Nicht unter allen Umständen bleibt es bei dieser Verborgenheit. Um zu begreifen, wie aus dem heimlichen Triumph angesichts des Todes ein offener, eingestandener wird, einer, der Ehre und Ruhm einbringt und dem man darum nachstrebt, ist es unerläßlich, die Situation des Kampfes ins Auge zu fassen, und zwar in ihrer ursprünglichsten Form.
Der Leib des Menschen ist weich und anfällig und in seiner Nacktheit sehr verletzlich. Alles vermag in ihn einzudringen; mit jeder Verletzung wird es schwerer für ihn, sich zur Wehr zu setzen; und im Nu ist es um ihn geschehen. Ein Mann, der sich zum Kampfe stellt, weiß, was er riskiert; wenn er sich keiner Überlegenheit bewußt ist, riskiert er am meisten. Der das Glück hat zu siegen, fühlt einen Zuwachs an Kraft und stellt sich um so eifriger seinem nächsten Gegner. Nach einer Reihe von Siegen wird er das gewinnen, was dem Kämpfenden das Kostbarste ist, ein Gefühl von Unverletzlichkeit, und sobald er dieses einmal hat, wird er sich an immer gefährlichere Kämpfe wagen. Nun ist ihm, als hätte er einen andern Leib, nicht mehr nackt, nicht mehr anfällig, durch die Augenblicke seiner Triumphe gepanzert. Schließlich kann ihm keiner mehr etwas anhaben, er ist ein Held. Aus der ganzen Welt und von den meisten Völkern kennt man Geschichten von Immer-Siegern; und selbst wenn sie, wie es nicht selten vorkommt, an einer geheimen Stelle ihres Leibes verletzlich bleiben, so bringt das ihre sonstige generelle Unverletzlichkeit nur um so mehr zur Geltung. Das Ansehen des Helden wie sein Selbstgefühl setzt sich zusammen aus all den Augenblicken, in denen er als Sieger vor seinem erlegten Feinde stand. Für die Überlegenheit, die ihm sein Gefühl von Unverletzlichkeit gibt, wird er bewundert; sie gilt nicht als unbilliger Vorteil über seinen Gegner. Jeden, der sich ihm nicht beugt, fordert er bedenkenlos heraus. Er kämpft, siegt, tötet; er sammelt seine Siege.
›Sammeln‹ ist hier buchstäblich zu verstehen. Es ist, als gingen die Siege in den Leib des Siegers ein und stünden nun zu seiner Verfügung. Die Auffassung dieses Vorgangs als einer konkreten Prozedur ist uns zwar abhanden gekommen, wir anerkennen sie nicht recht, doch ihre untergründige Wirksamkeit bis in unser Jahrhundert ist unbestreitbar. Es mag aufschlußreich sein, ihr auch in einer Kultur nachzugehen, in der sie sich noch offen darstellt, eine jener Kulturen, die wir etwas ungenau als primitiv bezeichnen.
Als Mana bezeichnet man in der Südsee eine Art von übernatürlicher und unpersönlicher Macht, die von einem Menschen auf den anderen übergehen kann. Sie ist sehr begehrt, sie läßt sich in einzelnen Individuen anreichern. Ein tapferer Krieger kann sie ganz bewußt erwerben. Er verdankt sie aber nicht seiner Erfahrenheit im Kampf oder seiner Körperkraft, sondern sie geht als das Mana seines erschlagenen Feindes auf ihn über. Ich zitiere hier aus dem Buch von Handy über polynesische Religion:
»Auf den Marquesas konnte ein Stammesangehöriger durch persönliche Tapferkeit zum Kriegshäuptling werden. Man nahm an, daß der Krieger in seinem Leib das Mana aller derer enthalte, die er getötet hatte. Im Verhältnis zu seiner Tapferkeit wuchs sein eigenes Mana. Doch war in der Vorstellung des Eingeborenen seine Tapferkeit das Ergebnis und nicht die Ursache seines Mana. Mit jeder Tötung, die ihm gelang, wuchs auch das Mana seines Speers. Der Sieger im Kampfe von Mann zu Mann nahm den Namen des erschlagenen Feindes an: Dies war das Zeichen dafür, daß seine Macht nun ihm gehöre. Um sich sein Mana unmittelbar einzuverleiben, aß er von seinem Fleisch; und um diesen Zuwachs an Macht in einer Schlacht an sich zu fesseln, um sich des intimen Rapports mit dem erbeuteten Mana zu versichern, trug er als Teil seiner Kriegsausrüstung irgendein körperliches Überbleibsel des besiegten Feindes an sich; einen Knochen, eine vertrocknete Hand, manchmal sogar einen ganzen Schädel.«
So weit Handy. Die Wirkung des Sieges auf den Überlebenden läßt sich nicht klarer fassen. Indem er den anderen getötet hat, ist er stärker geworden, und der Zuwachs an Mana macht ihn zu neuen Siegen fähig. Es ist eine Art von Segen, den er dem Feinde entreißt, aber er kann ihn nur erlangen, wenn dieser tot ist. Die physische Gegenwart des Feindes, lebend und dann tot, ist unerläßlich. Es muß gekämpft und es muß getötet worden sein; auf den eigenen Akt des Tötens kommt alles an. Die handlichen Teile der Leiche, deren der Sieger sich versichert, die er sich einverleibt, mit denen er sich behängt, erinnern ihn immer an den Zuwachs seiner Macht. Er fühlt sich stärker durch sie und erregt mit ihnen Schrecken: Jeder neue Feind, den er herausfordert, zittert vor ihm und sieht sein eigenes Schicksal furchtbar vor sich.
Es gibt, bei anderen Völkern, Vorstellungen anderer Art, die doch demselben Ziele dienen. Der Nachdruck liegt nicht immer auf der Offenheit des Kampfes. Bei den Murngin, im australischen Arnhem-Land, sucht jeder junge Mann sich einen Feind, um sich seiner Kraft zu bemächtigen. Aber er muß ihn heimlich töten, bei Nacht, und nur wenn ihm das gelingt, geht der Geist des Erschlagenen auf ihn über und verleiht ihm doppelte Stärke. Es wird ausdrücklich gesagt, daß der Sieger durch diesen Vorgang wächst, er wird tatsächlich größer. Statt der unpersönlichen Kraft des Mana, die wir im vorigen Falle kennengelernt haben, ist es hier ein persönlicher Geist, den man zu erbeuten sucht, und dieser darf den Mörder während seiner Tat nicht zu Gesicht bekommen, sonst wird er zornig und weigert sich, in ihn einzugehen. Aus diesem Grunde eben ist es unerläßlich, daß der Überfall im Dunkel der Nacht vor sich geht. Die Art, wie die Seele des Toten dann in den Leib des Mörders eingeht, wird genau geschildert. Einmal gemeistert und einverleibt, wird ihm diese Seele nun auf jede Weise nützlich. Nicht nur der Mörder selbst wird durch sie physisch größer, auch die Beute, zu der sie ihm verhilft, sei es ein Känguruh, sei es eine Schildkröte, wächst, nachdem sie getroffen ist, noch im Sterben und setzt in ihren letzten Augenblicken eigens Fett für den Glücklichen an.
Helden mehr in der Art unserer wohlbekannten Tradition finden sich auf den Fidschi-Inseln. Es wird erzählt, wie ein Knabe, der fern von seinem Vater lebte und noch nicht ganz erwachsen ist, seinen Weg zu ihm findet, und um ihm Eindruck zu machen, es ganz allein mit allen Feinden des Vaters aufnimmt.
»Am nächsten Morgen in aller Frühe kamen die Feinde mit Kriegsgeschrei zur Stadt herauf … Der Knabe erhob sich und sagte: ›Niemand möge mir folgen. Bleibt ihr alle in der Stadt!‹ Er nahm seine selbstverfertigte Keule in die Hand, stürzte hinaus mitten unter die Feinde und schlug wütend um sich, nach rechts und nach links. Mit jedem Schlage tötete er einen, bis sie schließlich vor ihm flohen. Er setzte sich auf einen Haufen von Leichen und rief seine Leute in der Stadt: ›Kommt heraus und schleppt die Erschlagenen fort!‹ Sie kamen heraus, sie sangen den Todesgesang, sie schleppten die 42 Leichen der Erschlagenen fort, während in der Stadt die Trommeln schlugen.« Der Knabe hat es nicht nur allein mit einer ganzen Meute von Feinden aufgenommen, mit jedem seiner Schläge hat er einen von ihnen hingestreckt, und keiner seiner Schläge war vergeblich. Am Ende sitzt er als Sieger auf einem Leichenhaufen, und jeden, auf dem er sitzt, hat er persönlich umgebracht. Das Ansehen solcher kriegerischer Tüchtigkeit auf Fidschi war so groß, daß es vier verschiedene Namen für Helden gab, je nach der Zahl der getöteten Feinde. Der Niedrigste in der Skala hieß Koroi, der Töter eines Menschen, Koli hieß, wer zehn, Visa, wer zwanzig und Wangka einer, der dreißig Leute erschlagen hatte. Wer mehr geleistet hatte, empfing einen zusammengesetzten Namen. Ein berühmter Häuptling hieß Koli-Visa-Wangka, er war der Töter von 10 + 20 + 30, also von 60 Menschen.
Es ist nie ganz ungefährlich, sich zu den sogenannten Primitiven zu begeben. Man sucht sie auf, um von ihnen her ein schonungsloses Licht auf sich selbst zu werfen; doch ist die Wirkung, die sie haben, oft die entgegengesetzte. Wir kommen uns ungeheuer erhaben über sie vor, weil sie es mit Keulen und nicht mit Atombomben machen. In Wirklichkeit ist alles, wofür wir den Häuptling Koli-Visa-Wangka bedauern dürfen, die Tatsache, daß seine Sprache ihm solche Schwierigkeiten mit dem Zählen macht. Da haben wir es allerdings leichter, nämlich viel zu leicht.
Ich habe das letzte Beispiel nur herangezogen, um zu zeigen, wohin die offene Gewöhnung ans Überleben führt. Es bleibt nicht beim sozusagen ›sauberen‹ Fall des Helden, der allmählich in ausgesuchten Zweikämpfen sein Gefühl von Unverletzlichkeit gewinnt, um es dann immer wieder ins Treffen zu führen, wenn seine Leute von Ungeheuern oder Feinden bedroht sind. Vielleicht hat es gezügelte Helden dieser Art wirklich gegeben. Ich neige dazu, sie für einen Idealfall zu halten. Denn das Glücksgefühl konkreten Überlebens ist eine intensive Lust. Einmal eingestanden und gebilligt, wird sie nach ihrer Wiederholung verlangen und sich rapid zu einer Passion steigern, die unersättlich ist. Wer von ihr besessen ist, wird sich die Formen gesellschaftlichen Lebens um ihn in der Weise zu eigen machen, daß sie der Frönung dieser Passion dienen.
Die Passion ist die der Macht. Sie ist so sehr an die Tatsache des Todes gebunden, daß sie uns natürlich erscheint; wir nehmen sie hin wie den Tod, ohne sie wirklich in Frage zu stellen, ja ohne sie auf ihre Verzweigungen und Auswirkungen hin ernsthaft ins Auge zu fassen.
Wer Geschmack am Überleben gewonnen hat, der will es häufen. Er wird Situationen herbeizuführen suchen, in denen er viele zugleich überlebt. Die zerstreuten Augenblicke von Überleben, die ihm das alltägliche Dasein bietet, werden ihm nicht genügen. Da dauert es alles zu lange, er kann nicht nachhelfen. Bei Menschen, die ihm wirklich nahestehen, will er gar nicht nachhelfen. Das friedliche Dasein in den meisten menschlichen Sozietäten hat seinen täuschenden Gang, es sucht Gefahren und Brüche zu verdecken. Das unaufhörliche Verschwinden von Menschen aus ihm, die da und dort plötzlich nicht mehr am Leben sind, wird so aufgefaßt und dargestellt, als ob sie nicht wirklich ganz weg wären. In Beschwichtigungsprozeduren besonderer Art wendet man sich an sie, so als könnten sie noch daran teilhaben. Meist wurde an ihre Existenz irgendwo wirklich noch geglaubt, und ihr Neid auf die Lebenden war gefürchtet, er konnte zu gefährlichen Einwirkungen auf diese führen.
Gegen dieses Netz von Beziehungen, das dicht gewoben ist, so dicht, daß wirklich niemand, auch ein Verstorbener nicht, ganz aus der Welt fallen kann, hat sich immer schon die Aktivität derer gerichtet, die auf physisches Überleben aus waren. Waren sie im übrigen relativ simple Naturen, so fühlten sie sich in Kriegen und Schlachten wohl. Es wird bei solchen Anlässen immer vom Reiz der Gefahr gesprochen, als ob die Gefahr der eigentliche Sinn der kriegerischen Situation wäre. Und doch liegt es auf der Hand, worum es in Kriegen wirklich geht: ums Töten, ums massenhafte Töten. Ein Haufen feindlicher Toter ist das Ziel, und wer siegen will, stellt sich ganz deutlich vor, daß er diesen Haufen feindlicher Toter überlebt. Es bleibt aber nicht bei diesen, viele der eigenen Leute fallen auch, und auch sie sind überlebt worden. Wer gern in den Krieg zieht, handelt im Gefühl, daß er zurückkehren wird, ihn wird es nicht treffen; es ist eine Art von umgekehrter Lotterie, bei der nur die Nummern gewinnen, die nicht herauskommen. Wer gern in den Krieg zieht, geht mit Vertrauen, und dieses Vertrauen besteht in der Erwartung, daß die Gefallenen auf beiden Seiten, der eigenen auch, lauter andere sind, und er der Überlebende. Der Krieg bietet so auch dem einfachen Mann, der sich in Friedenszeiten als nichts Besonderes vorkommen mag, die Gelegenheit zu einem Gefühl von Macht, nämlich ebendort, wo dieses Gefühl seine Wurzel hat, im gehäuften Überleben. Die Gegenwart von Toten ist hier gar nicht zu umgehen, auf sie ist alles abgestellt; und selbst wer in dieser Richtung persönlich nicht viel geleistet hat, wird durch den Anblick aller Gefallenen gehoben, unter denen er sich nicht befindet.
Worauf im Frieden die schwersten Sanktionen stehen, das wird hier nicht nur von einem gefordert, es wird massenhaft bewirkt. Der Überlebende kehrt mit einem gesteigerten Gefühl von sich zurück, selbst wenn der Krieg für seine Seite nicht gut ausgegangen ist. Anders wäre es nicht zu erklären, daß Menschen, die die grauenvollen Aspekte des Kieges sehr wohl aufgefaßt haben, diese so rasch vergessen oder verklären. Etwas vom Glanz der Unverletzlichkeit umstrahlt jeden, der heil zurückkehrt.
Aber nicht alle sind einfach, nicht alle begnügen sich damit. Es gibt eine aktivere Form dieses Erlebnisses, und sie ist es, die uns hier eigentlich interessiert. Ein einzelner allein kann gar nicht so viele Menschen töten, als seine Passion fürs Überleben sich wünschen mag. Aber er kann andere dazu veranlassen oder sie dirigieren. Als Feldherr bestimmt er über die Form der Schlacht. Er plant sie im voraus, und er gibt den Befehl zu ihrem Beginn. Er läßt sich über sie berichten. Früher pflegte er von einer erhöhten Stelle ihren Fortgang zu beobachten. Dem unmittelbaren Kampf ist er so zwar entrückt; er kommt vielleicht gar nicht dazu, einen einzigen Feind zu töten. Aber die anderen, die unter seinem Befehl stehen, besorgen es für ihn. Was ihnen gelingt, wird ihm zugeschrieben. Als der eigentliche Sieger gilt er. Sein Name wie seine Macht wächst mit der Zahl der Toten. Für eine Schlacht, in der nicht ernsthaft gekämpft, die zu leicht und fast ohne Opfer gewonnen wurde, wird man ihn nicht sonderlich achten. Aus leichten Siegen allein ist eine wirkliche Macht nicht zu erbauen. Der Schrecken, den sie erregen will, auf den sie eigentlich aus ist, hängt an der Massenhaftigkeit der Opfer.
Die berühmten Eroberer der Geschichte sind insgesamt diesen Weg gegangen. Tugenden aller Art sind ihnen später zugeschrieben worden. Noch nach Jahrhunderten wägen Historiker ihre Eigenschaften gewissenhaft gegeneinander ab, um zu einem – wie sie glauben – gerechten Urteil über sie zu gelangen. Ihre fundamentale Naivität bei diesem Geschäft ist mit Händen zu greifen. Faktisch erliegen sie noch der Faszination einer Macht, die längst vergangen ist. Daß sie sich in einer Zeit einleben, macht sie zu Zeitgenossen, und etwas von der Furcht, die diese vor der Erbarmungslosigkeit des Mächtigen empfanden, ist in sie eingegangen; sie wissen nicht, daß sie sich ihm ergeben, während sie Tatsachen redlich sichten. – Ein nobleres Motiv kommt dazu, von dem selbst große Denker nicht frei waren: Man erträgt es nicht, sich zu sagen, daß eine ungeheure Zahl von Menschen, deren jeder sämtliche Möglichkeiten der Menschheit in sich enthält, umsonst, für absolut nichts, hingeschlachtet worden sind; und so sucht man in der Folge nach einem Sinn. Da die Geschichte weiterging, ist ein scheinbarer Sinn in ihrer Kontinuität immer leicht zu finden; und es wird dafür gesorgt, daß dieser Sinn eine Art von Würde bekommt. Die Wahrheit nämlich hat hier gar keine Würde. Sie ist so beschämend, wie sie vernichtend war. Es geht um eine private Passion des Machthabers: Seine Lust am Überleben wächst mit seiner Macht; seine Macht erlaubt es ihm, ihr nachzugeben. Der eigentliche Inhalt dieser Macht ist die Begierde, massenhaft Menschen zu überleben.
Es ist nützlicher für ihn, wenn seine Opfer Feinde sind; aber Freunde tun es auch. Im Namen männlicher Tugenden wird er von seinen Untertanen das Schwierigste, das Unmöglichste verlangen. Es bedeutet ihm gar nichts, wenn sie dabei zugrunde gehen. Er vermag ihnen einzureden, daß es eine Ehre ist, da es für ihn geschieht. Durch Beute, die er ihnen anfangs verschafft, wird er sie an sich binden. Er wird sich des Befehls bedienen, der für seine Zwecke wie geschaffen ist (auf eine genaue Untersuchung des Befehls, die unendlich wichtig ist, können wir heute nicht eingehen). Er wird sie, wenn er sich darauf versteht, zu kriegerischen Massen erregen und ihnen so viel gefährliche Feinde erwecken, daß es für sie schließlich unmöglich wird, von ihrer eigenen Kriegsmasse abzufallen. Seine tiefere Absicht gibt er ihnen nicht preis; er kann sich gut verstellen und findet für alles, was er anordnet, hundert überzeugende Vorwände. Vielleicht daß er sich im Übermut verrät, im Keis seiner engsten Freunde, aber dann sehr gründlich, wie Mussolini zu Ciano, wenn er sein Volk verächtlich Schafe nennt, auf deren Leben es natürlich nicht ankommt.
Denn die eigentliche Absicht des wahren Machthabers ist so grotesk wie unglaublich: Er will der einzige sein. Er will alle überleben, damit keiner ihn