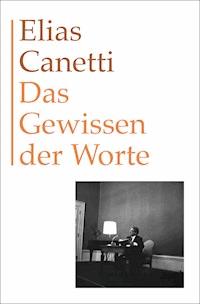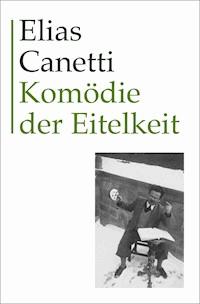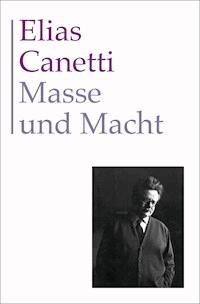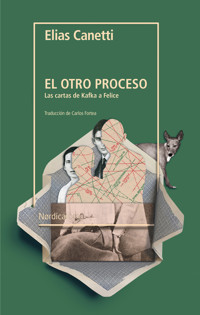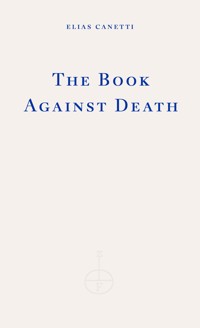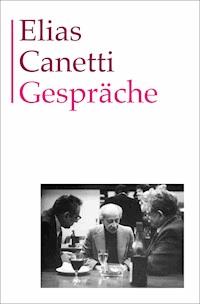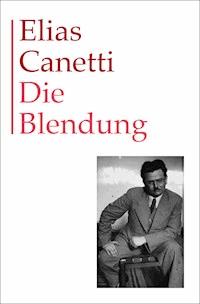
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der weltweite Ruhm dieses erstaunlichen Romans eines Sechsundzwanzigjährigen kam spät – obwohl er von Thomas Mann, Hermann Hesse und anderen in seiner Bedeutung sogleich erkannt und enthusiastisch begrüßt worden war. Heute steht fest, dass "Die Blendung", 1935 zum ersten Mal veröffentlicht, zu den großen Werken der europäischen Literatur des 20. Jahrhunderts gehört. Es ist die Geschichte des Sinologen Peter Kien, der in den Flammen seiner Bibliothek stirbt. Habgier, Brutalität und Weltfremdheit münden in den Zustand völliger Verblendung, die für die unheimlichen Personen des Romans den Untergang bedeutet. Ein Roman, halb Höllenbild, halb Weltgericht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 928
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Über das Buch
Der weltweite Ruhm dieses erstaunlichen Romans eines Sechsundzwanzigjährigen kam spät – obwohl er von Thomas Mann, Hermann Hesse und anderen in seiner Bedeutung sogleich erkannt und enthusiastisch begrüßt worden war. Heute steht fest, dass Die Blendung
Elias Canetti
Die Blendung
Roman
Impressum
ISBN 978–3–446–24385–9
Zuerst erschienen 1935
Text nach Band I der Canetti-Werkausgabe
© 2015, 2016 Elias Canetti Erben Zürich, Carl Hanser Verlag München
Umschlaggestaltung: S. Fischer Verlag / www.buerosued.de
Cover: Elias Canetti nach Erscheinen der Blendung, Wien 1936
Unser gesamtes lieferbares Programm und viele andere Informationen finden Sie unter www.hanser-literaturverlage.de. Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/HanserLiteraturverlage oder folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/hanserliteratur
Inhaltsverzeichnis
Erster TeilEin Kopf ohne Welt
Der Spaziergang
Das Geheimnis
Konfuzius, ein Ehestifter
Die Muschel
Blendende Möbel
Liebste Gnädigste
Mobilmachung
Der Tod
Das Krankenlager
Junge Liebe
Judas und der Heiland
Die Millionenerbschaft
Prügel
Die Erstarrung
Zweiter TeilKopflose Welt
Zum idealen Himmel
Der Buckel
Großes Erbarmen
Vier und ihre Zukunft
Enthüllungen
Verhungert
Die Erfüllung
Der Dieb
Privateigentum
Das Kleine
Dritter TeilWelt im Kopf
Der gute Vater
Hosen
Ein Irrenhaus
Umwege
Listenreicher Odysseus
Der rote Hahn
Erster Teil
Ein Kopf ohne Welt
Der Spaziergang
Das Geheimnis
Konfuzius, ein Ehestifter
Die Muschel
Blendende Möbel
Liebste Gnädigste
Mobilmachung
Der Tod
Das Krankenlager
Junge Liebe
Judas und der Heiland
Die Millionenerbschaft
Prügel
Die Erstarrung
Der Spaziergang
Was tust du hier, mein Junge?«
»Nichts.«
»Warum stehst du dann da?«
»So.«
»Kannst du schon lesen?«
»O ja.«
»Wie alt bist du?«
»Neun vorüber.«
»Was hast du lieber: eine Schokolade oder ein Buch?«
»Ein Buch.«
»Wirklich? Das ist schön von dir. Deshalb stehst du also da.«
»Ja.«
»Warum hast du das nicht gleich gesagt?«
»Der Vater schimpft.«
»So. Wie heißt dein Vater?«
»Franz Metzger.«
»Möchtest du in ein fremdes Land fahren?«
»Ja. Nach Indien. Da gibt es Tiger.«
»Wohin noch?«
»Nach China. Da ist eine riesige Mauer.«
»Du möchtest wohl gern hinüberklettern?«
»Die ist viel zu dick und zu groß. Da kann keiner hinüber. Drum hat man sie gebaut.«
»Was du alles weißt! Du hast schon viel gelesen.«
»Ja, ich lese immer. Der Vater nimmt mir die Bücher weg. Ich möchte in eine chinesische Schule. Da lernt man vierzigtausend Buchstaben. Die gehen gar nicht in ein Buch.«
»Das stellst du dir nur so vor.«
»Ich hab's ausgerechnet.«
»Es stimmt aber doch nicht. Laß die Bücher in der Auslage. Das sind lauter schlechte Sachen. In meiner Tasche hab ich was Schönes. Wart, ich zeig's dir. Weißt du, was das für eine Schrift ist?«
»Chinesisch! Chinesisch!«
»Du bist aber ein aufgeweckter Junge. Hast du schon früher ein chinesisches Buch gesehen?«
»Nein, ich hab's erraten.«
»Diese beiden Zeichen bedeuten Mong Tse, der Philosoph Mong. Das war ein großer Mann in China. Vor 2250 Jahren hat er gelebt, und man liest ihn noch immer. Wirst du dir das merken?«
»Ja. Jetzt muß ich in die Schule.«
»Aha, da siehst du dir auf dem Schulweg die Buchhandlungen an? Wie heißt du denn selbst?«
»Franz Metzger. Wie mein Vater.«
»Und wo wohnst du?«
»Ehrlichstraße 24.«
»Da wohn ich ja auch. Ich kann mich gar nicht an dich erinnern.«
»Sie sehn immer weg, wenn jemand über die Stiege geht. Ich kenne Sie schon lange. Sie sind der Herr Professor Kien, aber ohne Schule. Die Mutter sagt, Sie sind kein Professor. Ich glaube schon, weil Sie eine Bibliothek haben. So was kann man sich gar nicht vorstellen, sagt die Marie. Das ist unser Mädchen. Bis ich groß bin, will ich eine Bibliothek. Da müssen alle Bücher drin sein, in allen Sprachen, so ein chinesisches auch. Jetzt muß ich laufen.«
»Wer hat denn dieses Buch geschrieben? Weißt du das noch?«
»Mong Tse, der Philosoph Mong. Vor genau 2250 Jahren.«
»Schön. Du darfst einmal in meine Bibliothek kommen. Sag der Wirtschafterin, daß ich es erlaubt habe. Ich zeig' dir Bilder aus Indien und China.«
»Fein! Ich komm! Ich komm bestimmt! Heut nachmittag?«
»Nein, nein, mein Junge. Ich hab zu arbeiten. Frühestens in einer Woche.«
Professor Peter Kien, ein langer, hagerer Mensch, Gelehrter, Sinologe von Hauptfach, steckte das chinesische Buch in die volle Tasche, die er unterm Arm trug, verschloß sie sorgfältig und sah dem klugen Jungen nach, bis er verschwand. Wortkarg und mürrisch von Natur, machte er sich einen Vorwurf aus dem Gespräch, das er ohne zwingenden Grund begonnen hatte.
Auf seinen Morgenspaziergängen zwischen sieben und acht pflegte er in die Auslagen jeder Buchhandlung, an der er vorüberkam, einen Blick zu tun. Beinahe angeheitert stellte er fest, daß Schund und Schmutz immer weiter um sich griffen. Er selbst besaß die bedeutendste Privatbibliothek dieser großen Stadt. Einen winzigen Bruchteil führte er immer mit sich. Seine Leidenschaft für sie, die einzige, die er sich in einem strengen und arbeitsreichen Leben gestattete, zwang ihn zu Vorsichtsmaßregeln. Bücher, auch schlechte, verlockten ihn leicht zum Kauf. Die meisten Buchhandlungen öffneten zum Glück erst nach acht. Manchmal erschien ein Lehrjunge, der das Vertrauen seines Chefs erringen wollte, schon früher und wartete auf den ersten Angestellten, dem er die Schlüssel feierlich abnahm. »Ich bin seit sieben hier!« rief er oder: »Ich kann nicht hinein!« So viel Eifer steckte einen Kien leicht an; es kostete ihn Überwindung, nicht auf der Stelle zu folgen. Unter den Besitzern kleinerer Läden gab es oft Frühaufsteher, die sich ab halb acht hinter ihren offenen Türen zu schaffen machten. Diesen Versuchungen zum Trotz pochte Kien auf seine wohlgefüllte Tasche. Er hielt sie eng an sich gepreßt, auf eine besondere Art, die er sich ausgedacht hatte, um möglichst viel von seinem Körper mit ihr in Berührung zu bringen. Die Rippen spürten sie durch den dünnen, schlechten Anzug hindurch. Der Oberarm lag in der seitlichen Vertiefung; er paßte genau hinein. Der Unterarm stützte von unten. Die gespreizten Finger verbreiteten sich über alle Flächen, nach denen es sie gelüstete. Seine übertriebene Sorgfalt entschuldigte er vor sich mit dem Wert des Inhalts. Fiel die Tasche zufällig zu Boden, öffnete sich der Verschluß, den er jeden Morgen vor dem Weggehen nachprüfte, doch gerade in diesem gefährlichen Augenblick, so war es um kostbare Werke geschehen. Nichts haßte er mehr als schmutzige Bücher.
Als er heute auf dem Heimweg vor einer Auslage stehenblieb, trat plötzlich ein Junge zwischen das Fenster und ihn. Kien empfand diesen Schritt als Ungezogenheit. Platz war wohl genug da. Er stellte sich immer in einem Meter Entfernung von der Scheibe auf; trotzdem las er spielend, was sich an Buchstaben dahinter fand. Seine Augen funktionierten nach Belieben; bei einem vierzigjährigen Menschen, der den ganzen Tag über Büchern und Manuskripten sitzt, eine Tatsache von Bedeutung. Morgen für Morgen bewiesen ihm seine Augen, wie gut es ihnen ging. Im Abstand von den feilen und öffentlichen Büchern drückte sich auch seine Verachtung aus, die sie, gegen die spröden und schweren Werke seiner Bibliothek gehalten, in hohem Maße verdienten. Der Junge war klein, Kien von ungewöhnlicher Länge. Leicht sah er über ihn hinweg. Mehr Respekt hätte er aber doch erwartet. Bevor er ihm sein Benehmen verwies, rückte er zur Seite, um ihn zu beobachten. Der Junge starrte die Titel der Bücher an und bewegte langsam und leise die Lippen. Ausdauernd glitt er von Band zu Band. Alle paar Minuten warf er den Kopf herum. Auf der andern Straßenseite hing über dem Laden eines Uhrmachers eine ungeheure Uhr. Es war zwanzig Minuten vor acht. Offenbar fürchtete der Kleine, etwas Wichtiges zu versäumen. Den Herrn hinter ihm beachtete er nicht. Vielleicht übte er sich im Lesen. Vielleicht lernte er die Titel auswendig. Er behandelte sie gleichmäßig und gerecht. Man merkte genau, wo er einen Augenblick hielt.
Kien tat er leid. Da verdarb er an diesem niederträchtigen Zeug seinen frischen, vielleicht schon lesehungrigen Geist. Manches miserable Buch würde er in späteren Jahren bloß deshalb lesen, weil ihm der Titel von früh auf geläufig war. Wie soll man die Empfänglichkeit der ersten Jahre beschränken? Sobald ein Kind laufen und buchstabieren kann, ist es dem Pflaster irgendeiner schlecht angelegten Straße, der Ware irgendeines Händlers, der, weiß der Teufel warum, sich auf Bücher geworfen hat, auf Ungnade ausgeliefert. Kleine Knaben müßten in einer bedeutenden Privatbibliothek aufwachsen. Der tägliche Umgang mit nur ernsten Geistern, die kluge, dunkle, gedämpfte Atmosphäre, eine hartnäckige Gewöhnung an peinlichste Ordnung, im Raum wie in der Zeit – welche Umgebung eignete sich besser, um so zarten Geschöpfen über ihre Jugend hinwegzuhelfen? Der einzige Mensch in dieser Stadt, der eine ernstzunehmende Privatbibliothek besaß, war eben Kien selbst. Er konnte keine Kinder zu sich nehmen. Seine Arbeit erlaubte ihm keine Abschweifungen. Kinder machen Lärm. Man muß sich mit ihnen beschäftigen. Ihre Pflege erfordert eine Frau. Fürs Kochen genügt eine gewöhnliche Wirtschafterin. Für Kinder muß man sich eine Mutter halten. Wenn eine Mutter nur Mutter wäre; welche begnügt sich aber mit ihrer eigentlichen Rolle? Im Hauptfach ist eine jede Frau und stellt Ansprüche, die ein ehrlicher Gelehrter nicht im Traum zu erfüllen gedenkt. Kien verzichtet auf eine Frau. Frauen waren ihm bisher gleichgültig, gleichgültig werden sie ihm bleiben. So kommt der Junge mit den starren Augen und dem beweglichen Kopf zu kurz.
Aus Mitleid sprach er ihn gegen seine Gewohnheit an. Durch eine Schokolade hätte er sich gern von seinen erzieherischen Gefühlen losgekauft. Da zeigte es sich, daß es Neunjährige gibt, die ein Buch einer Schokolade vorziehen. Was dann folgte, überraschte ihn noch mehr. Der Junge interessierte sich für China. Er las gegen den Willen seines Vaters. Die Gerüchte von den Schwierigkeiten der chinesischen Schrift reizten ihn, statt ihn abzuschrecken. Auf den ersten Blick erkannte er sie, ohne sie je gesehen zu haben. Eine Intelligenzprüfung bestand er mit Auszeichnung. Das Buch, das man ihm zeigte, rührte er nicht an. Vielleicht schämte er sich seiner schmutzigen Finger. Kien prüfte sie; sie waren sauber. Ein anderer hätte auch mit schmutzigen hingegriffen. Er war in Eile, die Schule begann um acht, doch blieb er bis zur letzten Sekunde. Auf die Einladung stürzte er sich wie ein Verhungerter, der Vater quälte ihn wohl sehr. Am liebsten wäre er gleich am Nachmittag gekommen, mitten in der Arbeitszeit. Er wohnte ja im selben Hause.
Kien vergab sich das Gespräch. Die Ausnahme, die er sich gestattet hatte, schien ihm der Mühe wert. Den schon entschwundenen Jungen begrüßte er in Gedanken als einen kommenden Sinologen. Wer interessierte sich für diese abgelegene Wissenschaft? Knaben spielten Fußball, Erwachsene gingen ihrem Verdienst nach; ihre freie Zeit vertrieben sie sich mit Liebe. Um acht Stunden zu schlafen und acht Stunden nichts zu tun, ergaben sie sich die restliche Zeit einer verhaßten Arbeit. Nicht den Bauch, aber den ganzen Körper hatten sie zu ihrem Gott erhoben. Der Himmelsgott der Chinesen war strenger und würdiger. Selbst wenn der Junge nächste Woche nicht kam, unwahrscheinlich genug, so hatte er einen Namen im Kopf, der sich schwer vergaß: den des Philosophen Mong. Gelegentliche Stöße, unerwartet empfangen, geben Menschen ihre Richtung fürs Leben.
Lächelnd setzte Kien seinen Heimweg fort. Er lächelte selten. Selten war es jemandes höchster Wunsch, eine Bibliothek zu besitzen. Als Neunjähriger sehnte er sich nach einer Buchhandlung. Die Vorstellung, als ihr Besitzer darin auf und ab zu gehen, erschien ihm damals frevelhaft. Ein Buchhändler ist ein König, ein König kein Buchhändler. Für einen Angestellten kam er sich zu klein vor. Einen Laufjungen schickte man immer weg. Was hatte er von den Büchern, wenn er sie bloß als Pakete unterm Arm trug? Lange suchte er nach einem Ausweg. Eines Tages ging er nach der Schule nicht heim. Er trat in das größte Geschäft der Stadt, sechs Auslagen voller Bücher, und fing laut zu weinen an. »Ich muß hinaus, rasch, ich hab Angst!« plärrte er. Man wies ihm den Ort. Er merkte ihn sich gut. Als er zurückkam, dankte er und fragte, ob er nicht etwas helfen könne. Sein strahlendes Gesicht belustigte die Leute. Noch vor kurzem war es von jener komischen Angst verzerrt. Sie zogen ihn ins Gespräch; er wußte viel über Bücher. Für sein Alter fanden sie ihn klug. Gegen Abend schickten sie ihn weg, mit einem schweren Paket. Er fuhr auf der Elektrischen hin und zurück. So viel Geld hatte er sich erspart. Knapp vor der Geschäftssperre, es dämmerte schon, meldete er, der Auftrag sei ausgerichtet und legte die Bestätigung auf den Ladentisch. Jemand gab ihm zur Belohnung ein saures Bonbon. Während die Angestellten in ihre Mäntel schlüpften, schlich er leise nach hinten, an jenen sichern Ort, und sperrte sich dort ein. Niemand merkte was; die dachten wohl alle an ihren freien Abend. Da wartete er lange. Erst nach vielen Stunden, spät in der Nacht, wagte er sich hervor. Im Laden war es finster. Er suchte nach dem Schalter. Bei Tage hatte er nicht daran gedacht. Als er ihn fand und schon in der Hand hatte, fürchtete er sich, Licht zu machen. Vielleicht sah ihn jemand von der Straße und holte ihn nach Hause.
Sein Auge gewöhnte sich von selbst ans Dunkel. Nur lesen konnte er nicht, das war sehr traurig. Einen Band nach dem andern holte er herunter, blätterte drin und wirklich entzifferte er manchen Titel. Später kletterte er auf der Leiter herum. Er wollte wissen, ob die oben Geheimnisse versteckten. Er fiel herunter und sagte: Ich hab mir nicht weh getan! Der Boden war hart. Die Bücher waren weich. In einer Buchhandlung fällt man auf Bücher. Er hätte einen Turm vor sich aufbauen können, aber Unordnung fand er gemein und stellte, bevor er ein neues herunternahm, das alte an seinen Platz. Der Rücken tat ihm weh. Vielleicht war er nur müde. Zu Hause hätte er jetzt schon längst geschlafen. Hier ging es nicht, die Aufregung hielt ihn wach. Aber seine Augen erkannten die größten Titel nicht mehr, das ärgerte ihn. Er rechnete aus, wie viele Jahre es sich hier lesen ließe, ohne daß man einmal auf die Straße und in die dumme Schule ging. Warum blieb man nicht immer da! Ein kleines Bett hätte er zusammengespart. Die Mutter fürchtete sich. Er auch, aber nur ein wenig, weil es so still war. Die Gaslaternen auf der Straße gingen aus. Schatten krochen herum. Gespenster gab es doch. In der Nacht flogen sie alle her und hockten sich über die Bücher. Da lasen sie. Die brauchten kein Licht, die hatten so große Augen. Jetzt hätte er oben kein Buch mehr angerührt, nein, auch unten keines. Er kroch unter den Ladentisch und klapperte mit den Zähnen. Zehntausend Bücher, auf jedem hockte ein Gespenst. Drum war es so still. Manchmal hörte er sie blättern. Sie lasen genauso rasch wie er. Er hätte sich an sie gewöhnt, aber es waren zehntausend, da konnte einer beißen. Gespenster ärgern sich, wenn man sie streift, sie glauben, man will sie auslachen. Er machte sich ganz klein; sie flogen über ihn weg. Der Morgen kam erst nach vielen Nächten. Da schlief er ein. Als die Leute aufsperrten, merkte er nichts. Sie fanden ihn unterm Ladentisch und schüttelten ihn wach. Erst tat er, als ob er noch schliefe, dann begann er rasch zu heulen. Sie hätten ihn gestern eingesperrt, er fürchtete sich vor seiner Mutter, die habe ihn sicherlich überall gesucht. Der Inhaber fragte ihn aus und schickte ihn, sobald er seinen Namen erfahren hatte, mit einem Angestellten nach Hause. Er lasse sich bei der Dame entschuldigen. Der Junge sei irrtümlich eingesperrt worden, aber sonst wohlauf. Er selbst verbleibe mit besten Empfehlungen. Die Mutter glaubte es und war glücklich. Jetzt besaß der kleine Lügner von damals eine großartige Bibliothek und einen ebenso berühmten Namen.
Kien verabscheute die Lüge; von klein auf hielt er sich an die Wahrheit. Er entsann sich keiner einzigen Lüge, außer dieser. Auch sie war verfemt. Nur das Gespräch mit dem Schulbuben, der ihm als das Ebenbild seiner Jugend erschien, hatte sie wachgerufen. Weg damit, dachte er, es ist gleich acht. Punkt acht begann die Arbeit, sein Dienst an der Wahrheit. Wissenschaft und Wahrheit waren für ihn identische Begriffe. Man näherte sich der Wahrheit, indem man sich von den Menschen abschloß. Der Alltag war ein oberflächliches Gewirr von Lügen. So viel Passanten, so viel Lügner. Drum sah er sie gar nicht an. Wer unter den schlechten Schauspielern, aus denen die Masse bestand, hatte ein Gesicht, das ihn fesselte? Sie veränderten es nach dem Augenblick; nicht einen Tag lang verharrten sie bei derselben Rolle. Das wußte er zum vorhinein, Erfahrung war hier überflüssig. Er legte seinen Ehrgeiz in eine Hartnäckigkeit des Wesens. Nicht bloß einen Monat, nicht ein Jahr, sein ganzes Leben blieb er sich gleich. Der Charakter, wenn man einen hatte, bestimmte auch die Gestalt. Seit er denken konnte, war er lang und zu mager. Sein Gesicht kannte er nur flüchtig, aus den Scheiben der Buchhandlungen. Einen Spiegel besaß er zu Hause nicht, vor lauter Büchern mangelte es an Platz. Aber daß es schmal, streng und knochig war, wußte er: das genügte.
Da er nicht die geringste Lust verspürte, Menschen zu bemerken, hielt er die Augen gesenkt oder hoch über sie erhaben. Wo Buchhandlungen waren, spürte er ohnehin genau. Er durfte sich ruhig seinem Instinkt überlassen. Was Pferde zuwege bringen, wenn sie in ihre Ställe heimtrotten, gelang ihm auch. Er ging ja spazieren, um die Luft fremder Bücher zu atmen, sie reizten ihn zum Widerspruch, sie frischten ihn ein wenig auf. In der Bibliothek lief alles wie am Schnürchen. Zwischen sieben und acht Uhr früh gönnte er sich einige der Freiheiten, aus denen das Leben der übrigen ganz besteht.
Obwohl er diese Stunde auskostete, hielt er auf Ordnung. Vor Überschreiten einer belebten Straße zögerte er ein wenig. Er ging gern gleichmäßig; um nicht zu hasten, wartete er auf einen günstigen Augenblick. Da rief jemand laut jemand andern an: »Können Sie mir sagen, wo hier die Mutstraße ist?« Der Gefragte entgegnete nichts. Kien wunderte sich; da gab es auf offener Straße noch außer ihm schweigsame Menschen. Ohne aufzublicken, horchte er hin. Wie würde sich der Fragende zu dieser Stummheit verhalten? »Verzeihen Sie, bitte, können Sie mir vielleicht sagen, wo hier die Mutstraße ist?« Er steigerte seine Höflichkeit; sein Glück blieb gleich gering. Der andere sagte nichts. »Ich glaube, Sie haben mich überhört. Ich möchte Sie um eine Auskunft bitten. Vielleicht sind Sie so freundlich und erklären mir, wie ich jetzt in die Mutstraße finde.« Kiens Wißbegier war geweckt, Neugier kannte er nicht. Er nahm sich vor, den Schweiger anzusehen, vorausgesetzt, daß er auch jetzt in seiner Stummheit verharrte. Zweifellos war der Mann in Gedanken und wünschte jede Unterbrechung zu vermeiden. Wieder sagte er nichts. Kien belobte ihn. Unter Tausenden ein Charakter, der Zufällen widersteht. »Ja, sind Sie taub?« schrie der erste. Jetzt wird der zweite zurückschlagen, dachte Kien und begann die Freude an seinem Schützling zu verlieren. Wer beherrscht seinen Mund, wenn man ihn beleidigt? Er wandte sich der Straße zu; der Augenblick, sie zu überqueren, war da. Erstaunt über das fortgesetzte Schweigen, hielt er inne. Noch immer sagte der zweite nichts. Zu erwarten war ein um so stärkerer Ausbruch seines Zorns. Kien hoffte auf einen Streit. Erwies sich der zweite als gewöhnlich, so blieb er, Kien, unbestritten das, wofür er sich hielt: der einzige Charakter, der hier spazierenging. Er überlegte, ob er bereits hinblicken solle. Der Vorgang spielte zu seiner Rechten. Dort tobte der erste: »Sie haben kein Benehmen! Ich hab Sie in aller Höflichkeit gefragt! Was bilden Sie sich denn ein! Sie Grobian! Sind Sie stumm?« Der zweite schwieg. »Sie werden sich entschuldigen! Ich pfeife auf die Mutstraße! Die kann mir jeder zeigen! Aber Sie werden sich entschuldigen! Hören Sie!« Jener hörte nicht. Dafür stieg er in der Achtung des Lauschenden. »Ich übergebe Sie der Polizei! Wissen Sie, wer ich bin! Sie Skelett! Und das will ein gebildeter Mensch sein! Wo haben Sie Ihre Kleider her? Aus dem Pfandhaus! So sehen sie aus! Was halten Sie da unterm Arm? Ihnen zeig ich's noch! Hängen Sie sich auf! Wissen Sie, was Sie sind?«
Da bekam Kien einen bösen Stoß. Jemand griff nach seiner Tasche und riß daran. Mit einem Ruck, der weit über seine normalen Kräfte ging, befreite er die Bücher aus den fremden Klauen und wandte sich scharf nach rechts. Sein Blick galt der Tasche, fiel aber auf einen kleinen, dicken Mann, der heftig auf ihn einschrie. »Ein Flegel! Ein Flegel! Ein Flegel!« Der zweite, der Schweiger und Charakter, der seinen Mund auch im Zorn beherrschte, war Kien selbst. Ruhig drehte er dem gestikulierenden Analphabeten den Rücken. Mit diesem schmalen Messer schnitt er sein Geschwätz entzwei. Ein fetter Wicht, dessen Höflichkeit nach einigen Augenblicken in Frechheit umschlug, konnte ihn nicht beleidigen. Auf alle Fälle ging er rascher, als er vorhatte, über die Straße. Wenn man Bücher bei sich trug, waren Handgreiflichkeiten zu vermeiden. Er trug immer Bücher bei sich.
Denn schließlich ist man nicht verpflichtet, auf die Dummheiten jedes Passanten einzugehen. Sich in Reden zu verlieren ist die größte Gefahr, die einen Gelehrten bedroht. Kien drückte sich lieber schriftlich als mündlich aus. Er beherrschte über ein Dutzend östliche Sprachen. Einige westliche verstanden sich von selbst. Keine menschliche Literatur war ihm fremd. In Zitaten dachte er, in wohlüberlegten Absätzen schrieb er. Unzählige Texte verdankten ihre Herstellung ihm. An schadhaften oder verderbten Stellen uralter chinesischer, indischer, japanischer Manuskripte fielen ihm Kombinationen ein, soviel er wollte. Andere beneideten ihn drum, er hatte der Überfülle zu wehren. Von peinlicher Vorsicht, monatelang erwägend, langsam bis zum Überdruß, am strengsten gegen sich selbst, schloß er seine Meinung über einen Buchstaben, ein Wort oder einen ganzen Satz nur dann ab, wenn er ihrer Unangreifbarkeit sicher war. Seine bisherigen Abhandlungen, gering an Zahl, aber jede ein Fundament für hundert andere, hatten ihm den Ruf des ersten Sinologen seiner Zeit verschafft. Die Fachkollegen kannten sie genau, beinahe auswendig. Sätze, die er einmal niedergeschrieben hatte, galten als entscheidend und bindend. In strittigen Fragen wandte man sich an ihn, die oberste Autorität auch auf Nachbargebieten der Wissenschaft. Wenige beehrte er mit Briefen. Wen er aber erwählte, der empfing, in einem einzigen Schreiben, Anregung über Anregung und hatte auf Jahre hinaus Arbeit, deren Ergebnisse, in Anbetracht des Anregenden, zum vorhinein sicherstanden. Persönlich verkehrte er mit niemandem. Einladungen schlug er aus. Wo immer eine Lehrkanzel für östliche Philologie frei wurde, trug man sie zu allererst ihm an. Er lehnte mit verächtlicher Höflichkeit ab.
Zum Redner sei er nicht geboren. Bezahlung für seine Tätigkeit würde ihm diese verleiden. Seiner bescheidenen Meinung nach sollten dieselben unproduktiven Popularisatoren, denen man den Unterricht an den Mittelschulen anvertraue, die Lehrkanzeln an den Hochschulen besetzen, damit die eigentlichen, wirklichen, schöpferischen Forscher sich ausschließlich ihrer Arbeit widmen könnten. An mittelmäßigen Köpfen sei ohnehin kein Mangel. Vorlesungen, die er abhalte, könnten, da er an seine Hörer die höchsten Forderungen stellen müßte, nur auf wenig Zulauf rechnen. Bei Prüfungen käme voraussichtlich kein einziger Kandidat durch. Er würde seinen Ehrgeiz dareinsetzen, die jungen, unreifen Menschen so lange durchfallen zu lassen, bis sie ihr dreißigstes Jahr erreicht und sei es aus Langeweile, sei es aus beginnendem Ernst, einiges, wenn auch vorläufig nur weniges gelernt hätten. Schon die Aufnahme von Menschen, deren Gedächtnis man nicht sorgfältig geprüft habe, in die Hörsäle der Fakultät, käme ihm bedenklich und zumindest nutzlos vor. Zehn nach schwersten Vorprüfungen ausgewählte Studenten würden, blieben sie unter sich, unzweifelhaft mehr leisten, als wenn sie sich unter hundert träge Biernaturen, die üblichen an den Universitäten, mischten. Seine Bedenken seien also gewichtiger und prinzipieller Art. Er bitte das Kollegium, auf den Vorschlag, der, obwohl er ihn nicht ehre, doch ehrend gemeint sei, nicht mehr zurückzukommen.
Auf Kongressen, wo es sehr redselig herzugehen pflegt, war Kien eine meistbesprochene Figur. Die Herren, während der längsten Zeit ihres Lebens stille, scheue und kurzsichtige Mäuse, traten da alle paar Jahre einmal ganz aus sich heraus. Sie begrüßten einander, steckten die unpassendsten Köpfe zusammen, tuschelten, ohne etwas zu sagen und stießen bei den Banketten linkisch an. Aufs tiefste gerührt und aufs freudigste bewegt, hielten sie ihr Banner hoch, ihren Ehrenschild rein. Fort und fort gelobten sie in allen Sprachen dasselbe. Auch ohne sie einzugehen, hätten sie ihre Gelübde gehalten. In den Zwischenpausen schlossen sie Wetten ab. Wird Kien diesmal wirklich erscheinen? Man sprach von ihm mehr als von einem berühmten Kollegen, sein Verhalten reizte die Neugier. Daß er seinen Ruhm nie einkassierte, Begrüßungen und Banketten, wo man ihn seiner Jugend zum Trotz gefeiert hätte, seit über zehn Jahren hartnäkkig auswich, daß er bei jedem Kongreß einen wichtigen Vortrag ankündigte, den dann ein anderer vom Manuskript für ihn ablas, betrachteten seine Kollegen als bloßen Aufschub. Einmal, vielleicht diesmal, wird er plötzlich auftauchen, den durch lange Zurückhaltung um so heftigeren Applaus mit Würde einstreichen und sich durch Akklamation zum Präsidenten der Versammlung wählen lassen, eine Stelle, die ihm zukam, und die er selbst als Abwesender auf seine Art einnahm. Aber die Herren täuschten sich. Kien erschien nicht. Der gläubigere Teil verlor seine Wetten.
Kien sagte in letzter Stunde ab. Die Sendungen seiner Manuskripte an irgendeinen Bevorzugten waren von ironischen Wendungen begleitet. Falls man neben dem reichen Unterhaltungsprogramm zur Arbeit gelange, was er im Interesse des allgemeinen Wohlbefindens durchaus nicht wünsche, bitte er, diese Kleinigkeit, das Ergebnis von zweijähriger Arbeit, dem Kongreß vorzulegen. Neue und überraschende Resultate seiner Forschung pflegte er für solche Augenblicke aufzusparen. Ihre Wirkung, die Diskussionen, welche sich darüber entspannen, verfolgte er aus der Ferne argwöhnisch und gewissenhaft, als hätte er sie auf ihre textliche Stichhaltigkeit hin zu prüfen. Die Versammlung ließ sich seinen Hohn gefallen. Von hundert Anwesenden stützten sich achtzig auf ihn. Seine Leistungen waren unschätzbar. Man wünschte ihm langes Leben. Über seinen Tod wäre die Mehrzahl zu Tode erschrocken.
Die wenigen, die ihm in seinen jüngeren Jahren persönlich begegnet waren, hatten die Erinnerung an sein Gesicht verloren. Wiederholt bat man ihn schriftlich um seine Photographie. Er besitze keine, erwiderte er, und denke auch keine zu besitzen. Beides entsprach der Wahrheit. Zu einer anderen Konzession ließ er sich freiwillig herbei. Als Dreißigjähriger vermachte er, ohne im übrigen ein Testament aufgesetzt zu haben, seinen Schädel samt Inhalt einem Institut für Hirnforschung. Er begründete diesen Schritt mit dem Vorteil, den es brächte, sein wahrhaft phänomenales Gedächtnis durch eine besondere Struktur, vielleicht doch auch ein größeres Gewicht seines Hirns zu erklären. Zwar glaube er nicht, schrieb er an den Leiter jenes Instituts, daß Genie Gedächtnis sei, wie man seit einiger Zeit vielfach anzunehmen beliebe. Er selbst sei nichts weniger als ein Genie. Aber den Nutzen des fast erschreckenden Gedächtnisses, über das er verfüge, für seine wissenschaftliche Arbeit zu leugnen, wäre unwissenschaftlich. Er trage gleichsam eine zweite Bibliothek im Kopf, ebenso reichhaltig und verläßlich wie die wirkliche, von der man, wie er höre, allgemein so viel Aufhebens mache. Er sitze an seinem Schreibtisch und entwerfe Abhandlungen, in denen er bis auf die exaktesten Einzelheiten eingehe, ohne, außer eben in seiner Kopfbibliothek, je nachzuschlagen. Wohl prüfe er später Zitate und Quellenangaben anhand der realen Literatur genau nach; aber nur aus Gewissenhaftigkeit. Irgendeines Gedächtnisfehlers, der ihm je unterlaufen sei, könne er sich nicht entsinnen. Selbst seine Träume hätten eine schärfere Fassung als die bei den meisten Menschen übliche. Unplastische, farblose, verschwommene Visionen seien den Träumen, die er bis jetzt berücksichtigt habe, fremd. Nie stelle bei ihm die Nacht etwas auf den Kopf; Laute, die er höre, hätten ihren normalen Ursprung; Gespräche, die er führe, blieben durchaus vernünftig; alles behalte seinen Sinn. Es sei nicht seines Fachs, zu untersuchen, ob der vermutete Zusammenhang zwischen seinem präzisen Gedächtnis und den eindeutigen, klaren Träumen zu Recht bestehe. Er weise nur in aller Bescheidenheit darauf hin und bitte, die persönlichen Angaben, die er sich in diesem Brief erlaube, nicht als Zeichen von Anmaßung oder Geschwätzigkeit zu betrachten.
Kien reproduzierte sich noch einige Tatsachen aus seinem Leben, die sein zurückgezogenes, redescheues und jeder Eitelkeit bares Wesen ins rechte Licht rückten. Aber der Ärger über den frechen und kecken Menschen, der ihn erst nach einer Straße gefragt und dann beschimpft hatte, wurde von Schritt zu Schritt größer. Es wird mir also doch nichts anderes übrigbleiben, sagte er, trat unter ein Haustor, sah sich um – niemand beobachtete ihn – und zog ein langes, schmales Notizbuch aus der Tasche. Auf dem Titelblatt stand in hohen, eckigen Buchstaben: dummheiten. Sein Auge verweilte erst hier. Dann blätterte er um, mehr als die Hälfte des Notizbuches war beschrieben. Alles, was er vergessen wollte, trug er da ein. Mit Datum, Stunde und Ort begann er. Es folgte die Begebenheit, welche wieder die Dummheit der Menschen illustrieren sollte. Ein angewandtes Zitat, immer ein neues, bildete den Beschluß. Die gesammelten Dummheiten las er nie; ein Blick auf das Titelblatt genügte. In späteren Jahren dachte er sie herauszugeben, als »Spaziergänge eines Sinologen«.
Er zog einen scharf gespitzten Bleistift hervor und schrieb auf die erste leere Seite: »23. September, 3/48 Uhr. Auf der Mutstraße begegnete mir ein Mensch und fragte mich nach der Mutstraße. Um ihn nicht zu beschämen, schwieg ich. Er ließ sich nicht beirren und fragte noch einige Male; sein Benehmen war höflich. Plötzlich fiel sein Blick auf ein Straßenschild. Er bemerkte seine Dummheit. Statt sich in aller Eile zu entfernen, wie ich es an seiner Stelle getan hätte, überließ er sich einem maßlosen Zorn und beschimpfte mich auf das gröblichste. Hätte ich ihn nicht geschont, so wäre mir die peinliche Szene erspart geblieben. Wer war der Dümmere?«
Mit dem letzten Satz bewies er, daß er auch vor sich nicht haltmachte. Er war unbarmherzig gegen jedermann. Befriedigt steckte er das Notizbuch ein und vergaß den Mann. Die Bücher waren während des Schreibens in eine unbequeme Lage geraten. Er rückte sie zurecht. An der nächsten Straßenecke scheute er vor einem Wolfshund. Das Tier bahnte sich rasch und sicher einen Weg. An straffer Leine zog es einen Blinden hinter sich her. Dessen Gebrechen war, falls man den Hund übersah, an einem weißen Stock kenntlich, den er in der Rechten trug. Auch die eilfertigsten Menschen, die für den Blinden keine Zeit hatten, schenkten dem Hund einen bewundernden Blick. Er stieß sie mit geduldiger Schnauze zur Seite. Da er schön und kräftig war, litt man ihn gern. Plötzlich holte der Blinde seine Mütze vom Kopf herunter und hielt sie zugleich mit dem Stock, den Leuten entgegen. »Fürs Hundefutter!« bat er. Es regnete Münzen. Mitten auf der Straße drängte man sich um die beiden. Der Verkehr stockte; zum Glück stand an dieser Ecke kein Polizist, der ihn regelte. Kien sah sich den Bettler aus der Nähe an. Er war mit ausgesuchter Armut gekleidet und trug ein gebildetes Gesicht. Weil er die Muskeln rings um die Augen unaufhörlich bewegte – er zwinkerte, zog die Brauen in die Höhe und runzelte die Stirn –, mißtraute ihm Kien und beschloß, ihn für einen Schwindler zu halten. Da erschien ein vielleicht zwölfjähriger Junge, drückte eifrig den Hund beiseite und warf in die Mütze einen schweren Knopf. Der Blinde starrte hin und bedankte sich, um ein Haar noch freundlicher als bisher. Der Klang, den man vom Knopf gehört hatte, war wie von Gold. Kien gab es einen Stich ins Herz. Er packte den Jungen beim Schopf und schlug ihm, da er behindert war, mit der Tasche eine über den Kopf. »Schäm dich«, rief er, »einen Blinden zu betrügen!« Als es geschehen war, fiel ihm ein, was die Tasche enthielt: Bücher. Er schrak zusammen, ein so großes Opfer hatte er noch nie gebracht. Der Junge rannte heulend davon. Um auf die gewöhnliche, viel tiefere Ebene des Mitleids zurückzugelangen, leerte Kien sein ganzes Kleingeld in die Mütze des Blinden. Die Umstehenden nickten laut; er kam sich jetzt vorsichtiger und kleinlicher vor. Der Hund zog wieder an. Gleich darauf, als ein Polizist auftauchte, waren Führer und Geführter im alten Trott.
Kien schwor sich zu, sobald ihn Blindheit bedrohte, freiwillig zu sterben. Immer wenn er einem Blinden begegnete, ergriff ihn dieselbe peinliche Angst. Stumme liebte er; Taube, Lahme und sonstige Krüppel waren ihm gleichgültig; Blinde beunruhigten ihn. Er begriff nicht, daß sie ihrem Leben kein Ende machten. Selbst wenn sie die Blindenschrift beherrschten, waren ihre Lesemöglichkeiten beschränkt. Eratosthenes, der große Bibliothekar von Alexandria, ein Universalgelehrter des dritten vorchristlichen Jahrhunderts, der über eine halbe Million Schriftrollen gebot, machte als Achtzigjähriger eine furchtbare Entdeckung. Seine Augen begannen ihm den Dienst zu versagen. Er sah noch, aber er vermochte nicht mehr zu lesen. Ein anderer hätte die völlige Erblindung abgewartet. Er hielt seine Trennung von den Büchern für Blindheit genug. Freunde und Schüler flehten ihn an, bei ihnen zu bleiben. Er lächelte weise, dankte und hungerte sich in wenigen Tagen zu Tode.
Dieses große Beispiel wird der kleine Kien, dessen Bibliothek nur aus fünfundzwanzigtausend Bänden besteht, kommt die Zeit, mit Leichtigkeit nachahmen.
Den restlichen Weg bis zu seiner Wohnung erledigte er in beschleunigtem Tempo. Sicher war es schon acht. Um acht begann die Arbeit. Unpünktlichkeit verursachte ihm Brechreiz. Hie und da griff er verstohlen nach seinen Augen. Sie sahen in Ordnung und fühlten sich angenehm und ungefährdet an.
Im vierten und obersten Stock des Hauses Ehrlichstraße 24 befand sich seine Bibliothek. Die Wohnungstüre war durch drei komplizierte Schlösser gesichert. Er sperrte sie auf, durchschritt den Vorraum, in dem nur ein Kleiderständer war, und betrat sein Arbeitszimmer. Behutsam legte er die Tasche auf einen Lehnstuhl nieder. Dann schritt er ein paarmal durch die gerade Flucht der vier hohen, weiten Räume, die seine Bibliothek bildeten, auf und ab. Sämtliche Wände waren bis zur Decke mit Büchern ausgekleidet. Langsam hob er an ihnen den Blick. In die Decke waren Fenster eingelassen. Auf sein Oberlicht war er stolz. Die Seitenfenster waren vor Jahren nach hartem Kampf mit dem Hausbesitzer zugemauert worden. So gewann er in jedem Raum eine vierte Wand: Platz für mehr Bücher. Auch schien ihm ein Licht, das alle Regale von oben gleichmäßig erhellte, gerechter und seinem Verhältnis zu den Büchern angemessener. Die Versuchung, das Treiben auf der Straße zu beobachten – eine zeitraubende Unsitte, die man offenbar mit auf die Welt bekommt –, fiel mit den Seitenfenstern weg. Täglich, bevor er sich an den Schreibtisch setzte, segnete er Einfall und Konsequenz, denen er die Erfüllung seines höchsten Wunsches dankte: den Besitz einer reichhaltigen, geordneten und nach allen Seiten hin abgeschlossenen Bibliothek, in der ihn kein überflüssiges Möbelstück, kein überflüssiger Mensch von ernsten Gedanken ablenkte.
Der erste Raum diente als Arbeitszimmer. Ein mächtiger alter Schreibtisch, ein Lehnstuhl davor, ein zweiter in der Ecke gegenüber waren seine ganze Einrichtung. Außerdem machte sich da ein Diwan schmal, den Kien gern übersah, weil er auf ihm bloß schlief. An der Wand hing eine verschiebbare Leiter. Sie war wichtiger als der Diwan und wanderte im Laufe eines Tages von Raum zu Raum. Die Leere der drei übrigen nämlich störte nicht ein Stuhl. Nirgends ein Tisch, ein Schrank, ein Ofen, der das bunte Einerlei der Regale unterbrochen hätte. Schöne, schwere Teppiche, von denen der Boden überall bedeckt war, erwärmten das schroffe Halbdunkel, welches durch die weit geöffneten Türen alle vier Räume zu einer einzigen hohen Halle verband.
Kien hatte einen steifen, nachdrücklichen Gang. Auf den Teppichen trat er besonders fest auf; es freute ihn, daß solche Schritte nicht den leisesten Widerhall weckten. In seiner Bibliothek war selbst einem Elefanten die Möglichkeit, Lärm aus dem Boden zu stampfen, verwehrt. Drum schätzte er die Teppiche sehr hoch ein. Er überzeugte sich davon, daß sämtliche Bücher die Ordnung, in der er sie vor einer Stunde verlassen mußte, beibehalten hatten. Dann begann er die Tasche ihres Inhalts zu entleeren. Bei seinem Eintritt pflegte er sie auf den Stuhl vor dem Schreibtisch zu legen. Sonst vergaß er sie vielleicht und setzte sich, bevor sie weggeräumt war, an die Arbeit, zu der es ihn um acht Uhr auf das heftigste drängte. Mit Hilfe der Leiter verteilte er die Bände, wohin sie gehörten. Trotz seiner Vorsicht fiel der letzte – da er schon so weit war, beeilte er sich noch mehr – vom dritten Regal, für das er nicht einmal die Leiter brauchte, zu Boden. Es war jener Mong Tse, den er über alles liebte. »Dummkopf!« schrie er sich an, »Barbar! Analphabet!«, hob ihn zärtlich auf und ging rasch zur Tür. Bevor er sie erreicht hatte, fiel ihm etwas Wichtiges ein. Er kehrte zurück und schob die Leiter, die an der Wand gegenüber hing, möglichst leise an die Unfallstelle heran. Den Mong Tse legte er mit beiden Händen auf den Teppich zu Füßen der Leiter nieder. Jetzt durfte er zur Tür. Er öffnete sie und rief hinaus:
»Das beste Staubtuch, bitte!«
Kurz darauf klopfte die Wirtschafterin an die bloß angelehnte Tür. Er antwortete nicht. Sie steckte den Kopf diskret in die Spalte und fragte:
»Ist was passiert?«
»Nein, geben Sie nur her!«
Aus seiner Antwort hörte sie, gegen seinen Willen, eine Klage. Sie war zu neugierig, um das auf sich sitzen zu lassen. »Aber ich bitt Sie, Herr Professor!« sagte sie vorwurfsvoll, trat herein und erkannte auf den ersten Blick, was geschehen war. Sie glitt auf das Buch zu. Unter dem blauen, gestärkten Rock, der bis zum Teppich reichte, sah man die Füße nicht. Ihr Kopf saß schief. Beide Ohren waren breit, flach und abstehend. Da das rechte die Schulter streifte und von ihr zum Teil verdeckt wurde, erschien das linke um so größer. Beim Gehen und Sprechen wackelte sie mit dem Kopf. Ihre Schultern machten dazu abwechselnd die Musik. Sie bückte sich, hob das Buch auf und fuhr mit dem Staubtuch ein dutzendmal gründlich drüber. Kien suchte ihr nicht zuvorzukommen. Höflichkeit war ihm verhaßt. Er stand daneben und paßte auf, ob sie ihre Arbeit ernstlich verrichte.
»Ja, das passiert leicht, wenn man auf der Leiter oben steht, ich bitt Sie.«
Dann reichte sie ihm das Buch wie einen staubfreien Teller hin. Sie hätte gar zu gern ein Gespräch mit ihm angeknüpft. Aber es gelang ihr nicht. Er sagte kurz »danke« und kehrte ihr den Rücken. Sie verstand und ging. Als sie die Türschnalle in der Hand hielt, drehte er sich plötzlich um und fragte mit erheuchelter Freundlichkeit:
»Das ist Ihnen wohl schon oft passiert?«
Sie durchschaute ihn und war ehrlich entrüstet: »Aber, ich bitt Sie, Herr Professor!« Das »bitt Sie« stach spitz wie ein Dorn durch ihre ölige Sprache. Sie kündigt mir noch, dachte er und erklärte begütigend:
»Ich meinte ja nur. Sie wissen, was für Werte in dieser Bibliothek stecken!«
Auf einen so leutseligen Satz war sie nicht gefaßt. Sie wußte nichts zu erwidern und verließ befriedigt das Zimmer. Als sie draußen war, machte er sich Vorwürfe. Über seine Bücher sprach er wie der schmutzigste Händler. Wie sollte er eine solche Person denn anders dazu bringen, Bücher anständig zu behandeln? Ihren wirklichen Wert verstand sie nicht. Sie mußte glauben, daß er mit der Bibliothek spekuliere. Das waren Menschen! Das waren Menschen!
Nach einer unwillkürlichen Verbeugung, die den japanischen Manuskripten auf ihm galt, setzte er sich endlich an den Schreibtisch.
Das Geheimnis
Vor acht Jahren hatte Kien folgende Annonce in die Zeitung gesetzt:
»Gelehrter mit Bibliothek von ungewöhnlicher Größe sucht verantwortungsbewußte Haushälterin. Nur charaktervollste Persönlichkeiten wollen sich melden. Gesindel fliegt die Treppe hinunter. Gehalt Nebensache.«
Therese Krumbholz hatte damals einen guten Posten, auf dem sie sich soweit wohl fühlte. Sie las täglich, bevor sie ihrer Herrschaft das Frühstück anrichtete, den Annoncenteil des »Tagblatts« gründlich durch, um zu wissen, was in der Welt vorgeht. Sie dachte nicht daran, ihr Leben bei dieser gewöhnlichen Familie zu beschließen. Sie war noch eine junge Person, keine 48 Jahre alt, und wollte am liebsten zu einem alleinstehenden Herrn. Man kann sich da alles besser einteilen, und mit Frauen ist ja doch nicht auszukommen. Sie wird sich aber schön hüten, ihre sichere Stelle mir nichts dir nichts aufzugeben. Bevor sie nicht weiß, mit wem sie's zu tun hat, bleibt sie. Sie kennt das falsche Gerede in den Zeitungen und die goldenen Berge, die ehrbaren Frauen versprochen werden. Kaum ist man im Haus, so wird man gleich vergewaltigt. 33 Jahre bringt sie sich jetzt allein durch auf der Welt, aber das ist ihr noch nie passiert. Es wird ihr auch nicht passieren, da paßt sie schon gut auf.
Diesmal stach ihr die Annonce gewaltig in die Augen. Bei »Gehalt Nebensache« blieb sie hängen und las die Sätze, die durch gleichmäßig fetten Druck hervorgehoben waren, einige Male von rückwärts nach vorwärts durch. Der Ton imponierte ihr; das war ein Mann. Es schmeichelte ihr, sich als charaktervollste Persönlichkeit vorzustellen. Sie sah das Gesindel die Treppe herunterfliegen und freute sich aufrichtig darüber. Keinen Augenblick lang befürchtete sie, selbst als Gesindel behandelt zu werden.
Am nächsten Morgen stand sie in aller Frühe, um sieben, vor Kien, der sie in den Vorraum einließ und sofort erklärte:
»Ich muß es mir ausdrücklich verbieten, daß ein fremder Mensch meine Wohnung betritt. Sind Sie in der Lage, die Haftung für den Bücherbestand zu übernehmen?«
Er musterte sie scharf und argwöhnisch. Bevor sie auf diese Frage antwortete, wollte er seine Meinung über sie nicht abschließen. »Aber ich bitt Sie, was glauben Sie denn von mir?«
In ihrer Verblüffung über seine Grobheit gab sie eine Antwort, an der er nichts auszusetzen fand.
»Sie müssen wissen«, sagte er, »warum ich meine letzte Haushälterin entlassen habe. Ein Buch aus meiner Bibliothek hat gefehlt. Ich hab die ganze Wohnung durchsuchen lassen. Es ist nicht zum Vorschein gekommen. Ich sah mich gezwungen, sie auf der Stelle zu entlassen.« Empört schwieg er. »Sie werden das verstehen«, fügte er dann noch hinzu, als hätte er ihrer Intelligenz zuviel zugetraut.
»Ordnung muß sein«, erwiderte sie prompt. Er war entwaffnet. Mit großartiger Gebärde lud er sie in die Bibliothek ein. Sie betrat bescheiden den ersten Raum und wartete.
»Ihr Pflichtenkreis«, sagte er ernst und trocken. »Täglich wird ein Zimmer von oben bis unten gestaubt. Am vierten Tag sind Sie fertig. Am fünften beginnen Sie wieder mit dem ersten. Können Sie das übernehmen?«
»Ich bin so frei.«
Er ging wieder hinaus, öffnete die Wohnungstür und sagte: »Auf Wiedersehen. Sie treten heute an.«
Sie stand schon auf der Treppe und zögerte noch. Vom Gehalt hatte er nichts gesagt. Bevor sie ihre Stelle aufgab, mußte sie ihn fragen. Nein, lieber nicht. Da könnte man sich schön anschmieren. Wenn sie nichts sagte, gab er vielleicht von selber mehr. Über die zwei streitenden Kräfte: Vorsicht und Gier, siegte eine dritte: die Neugier.
»Ja, und wie steht es mit dem Gehalt?« Verlegen über die Dummheit, die sie vielleicht beging, vergaß sie, »ich bitt Sie« voranzusetzen.
»Soviel Sie wollen«, sagte er gleichgültig und schlug die Wohnungstür zu.
Ihren gewöhnlichen Herrschaften, die sich auf sie verließen – ein altes Möbelstück, das nun seit über zwölf Jahren im Hause stand –, erklärte sie, zu deren Entsetzen, sie halte das nicht mehr aus, diese Wirtschaft, da möcht sie noch lieber ihr Brot auf der Straße verdienen als so. Sie war durch keine Vorstellung von ihrem Entschluß abzubringen. Sie gehe gleich, wenn man zwölf Jahre im Hause sei, könne man mit der Kündigung schon eine Ausnahme machen. Die biedere Familie ergriff die Gelegenheit, das Monatsgehalt bis zum 20. zu ersparen. Sie weigerte sich, es auszubezahlen, weil die Person ihre Kündigungsfrist nicht einhalte. Therese dachte sich: das muß er eben zahlen, und ging.
Ihre Pflichten den Büchern gegenüber erfüllte sie zu Kiens Zufriedenheit. Im stillen sprach er ihr dafür seine Anerkennung aus. Sie öffentlich, in ihrer Gegenwart zu beloben, erschien ihm unnötig. Das Essen war immer pünktlich fertig. Ob sie gut oder schlecht kochte, wußte er nicht; es war ihm herzlich gleichgültig. Während der Mahlzeiten, die er auf seinem Schreibtisch einnahm, beschäftigten ihn wichtige Gedanken. Gewöhnlich hätte er nicht zu sagen gewußt, was er gerade im Mund hatte. Das Bewußtsein bewahre man für wirkliche Gedanken; sie nähren sich von ihm, sie brauchen es; ohne Bewußtsein sind sie nicht denkbar. Kauen und Verdauen versteht sich von selbst.
Therese hatte vor seiner Arbeit einen gewissen Respekt, weil er ihr das hohe Gehalt regelmäßig ausbezahlte und zu keinem Menschen freundlich war, auch mit ihr redete er nie. Für gesellige Naturen, wie ihre Mutter eine war, hatte sie von Kind auf eine große Verachtung. Ihre eigene Arbeit nahm sie sehr genau. Sie ließ sich nichts schenken. Auch gab ihr gleich von Anfang an ein Rätsel zu schaffen. Das hatte sie gern.
Punkt sechs Uhr früh stand der Professor von seinem Schlafdiwan auf. Das Anziehen und Waschen dauerte kurz. Abends, bevor sie zu Bett ging, richtete sie seinen Diwan her und rollte den Waschtisch, der auf Rädern lief, bis in die Mitte des Arbeitszimmers hinein. Über Nacht durfte er hier stehen. Eine vierteilige spanische Wand, außen mit fremden Buchstaben bemalt, wurde so aufgestellt, daß ihm der schlechte Anblick erspart blieb. Er konnte Möbel nicht schmecken. Den »Waschwagen«, wie er ihn nannte, hatte er selbst erfunden, damit das ekelhafte Zeug, sobald es benützt war, rascher verschwand. Um 61/4 sperrte er auf und schleuderte den Wagen mit Wucht hinaus. Den ganzen langen Gang hinunter hielt der Schwung vor. Neben der Küchentür stieß er krach gegen die Mauer. Therese wartete in der Küche; ihr kleines Zimmer lag gleich dabei. Sie öffnete die Tür und rief: »Schon auf?« Er sagte nichts und sperrte sich wieder ein. Dann blieb er noch bis sieben zu Haus. Kein Mensch wußte, was er in der langen Zeit bis sieben tat. Sonst saß er immer am Schreibtisch und schrieb.
Der dunkle, schwere Koloß war innen bis zum Bersten mit Manuskripten gefüllt, außen mit Büchern überladen. Bei der vorsichtigsten Bewegung dieser oder jener Schublade gab er einen schrillen Pfiff von sich. Obwohl ihm der Lärm zuwider war, beließ Kien das uralte Erbstück bei dieser Einrichtung, damit die Haushälterin, falls er einmal nicht zu Hause sei, sofort auf Einbrecher aufmerksam würde. Diese komischen Käuze pflegen nämlich nach Geld zu suchen, bevor sie sich hinter die Bücher machen. Er hatte Therese den Mechanismus des kostbaren Tisches in drei Sätzen knapp und erschöpfend erklärt. Er hatte bedeutungsvoll hinzugefügt, daß es keine Möglichkeit gebe, den Pfiff abzustellen, auch für ihn nicht. Bei Tag bekam sie ihn jedesmal zu hören, wenn Kien ein Manuskript hervorsuchte. Sie wunderte sich: Mit diesem Lärm hatte er Geduld. Nachts räumte er alle Papiere ein. Bis um acht Uhr früh blieb der Schreibtisch stumm. Wenn sie aufräumte, fand sie auf ihm nur Bücher und vergilbte Schriften. Neues Papier mit seinen eigenen Buchstaben suchte sie vergebens. Es war klar, daß er zwischen 61/4 und 7, drei viertel Stunden lang, überhaupt nichts arbeitete.
Betete er vielleicht? Nein, das glaubte sie nicht. Wer wird denn beten? Fürs Beten hat sie nichts übrig. In die Kirche geht sie nicht. Man braucht sich nur das Gesindel anzuschauen, das in die Kirche läuft. Da sitzt eine schöne Rasse beisammen. Das ewige Betteln ist ihr auch zuwider. Man muß was geben, weil alle auf einen hinschauen. Was mit dem Geld geschieht, das weiß kein Mensch. Zu Hause beten – wozu? Es ist schade um die schöne Zeit. Ein anständiger Mensch braucht das nicht. Sie ist von selber anständig. Die anderen beten nur. Das möcht sie aber doch gern wissen, was zwischen 61/4 und 7 in dem Zimmer vorgeht. Neugierig ist sie nicht, das kann ihr niemand nachsagen. Sie mischt sich nicht in fremde Angelegenheiten. Die Frauen sind heute so. Die stecken in alles ihre Nase herein. Sie tut bloß ihre Arbeit. Es wird ja alles von Tag zu Tag teurer. Die Kartoffeln kosten bereits das Doppelte. Es ist eine Kunst, bei den Preisen auszukommen. Er sperrt alle vier Türen zu. Sonst könnte man einmal im Nebenzimmer zuschauen. Ein Herr, der mit seiner Zeit sonst so gut wirtschaftet und keine Minute unnütz vertut!
Während seines Spaziergangs durchsuchte Therese die ihr anvertrauten Räume. Sie vermutete ein Laster; was für eins, blieb unentschieden. Erst schwebte ihr eine Frauenleiche im Koffer vor. Da unter den Teppichen zuwenig Platz für sie war, gab sie die gräßlich Verstümmelte auf. Kein Schrank half aus, wie hätt sie sich welche gewünscht: an jeder Wand einen. So steckte das Verbrechen sicher hinter einem Buch. Wo denn sonst? Vielleicht hätte sich ihr Pflichtgefühl damit begnügt, mit dem Staubtuch über die Rücken zu fahren; das unsittliche Geheimnis, dem sie auf der Spur war, zwang sie, auch hinter die Bücher zu sehen. Sie nahm jedes einzeln heraus, klopfte dran – vielleicht war es hohl –, streckte die plumpen, schwieligen Finger bis zur Holztäfelung hin, tastete und zog sie, unzufrieden den Kopf schüttelnd, zurück. Ihr Interesse verleitete sie nie so weit, die festgesetzte Arbeitszeit zu überschreiten. Fünf Minuten bevor Kien die Wohnung aufsperrte, stand sie schon in der Küche. Sie nahm ruhig eine Abteilung nach der andern vor, ohne Übereilung, ohne Nachlässigkeit und ohne je die Hoffnung völlig zu verlieren.
Während dieser Monate unermüdlicher Nachforschungen verbot sie sich, ihr Gehalt auf die Sparkasse zu tragen. Sie rührte nichts davon an, wer weiß, was das für Geld war. Die Scheine legte sie, so wie sie ihr überreicht wurden, in einen sauberen Umschlag, der das ganze Briefpapier, mit dem sie ihn vor zwanzig Jahren gekauft hatte, noch unberührt enthielt. Nach Überwindung gewichtiger Bedenken brachte sie ihn im Koffer unter, der ihre Aussteuer umfaßte, lauter ausgesucht schöne Stücke, für teures Geld im Laufe der Jahrzehnte erstanden.
Nach und nach sah sie ein, daß sie nicht so bald dahinterkommen würde. Macht nichts, sie hat Zeit. Sie kann warten. Es geht ihr nicht schlecht. Wenn dann schließlich was herauskommt – sie ist nicht schuld. Das kleinste Fleckchen der Bibliothek hat sie abgegrast. Ja, wenn man einen Vertrauten bei der Polizei hätte, einen soliden, anständigen Menschen, der Rücksicht auf die gute Stelle nähme, den könnte man höflich drauf aufmerksam machen. Bitte, sie läßt sich vieles gefallen, aber daß man gar keine Stütze hat. Wofür interessieren sich die Menschen heute? Fürs Tanzen, fürs Baden, fürs Unterhalten, nur nicht fürs Ernste und nur nicht fürs Arbeiten. Ihr Herr, der ernste Mensch, hat auch seine unsittlichen Seiten. Er geht erst um zwölf zu Bett. Der beste Schlaf ist vor Mitternacht. Ein anständiger Mensch geht um neun zu Bett. Was Besonderes wird es ja eh nicht sein.
So schrumpfte das Verbrechen zu einem Geheimnis zusammen. Dicke, zähe Verachtung legte sich um das verborgene Laster. Nur neugierig blieb sie, zwischen 61/4 und 7 war sie immer auf dem Sprung. Sie rechnete mit seltenen, aber menschlichen Möglichkeiten. Vielleicht trieben ihn plötzliche Bauchkrämpfe einmal heraus. Sie wird sich hineinbeeilen und ihn fragen, ob ihm was fehlt. Krämpfe vergehn nicht so rasch. In ein paar Minuten weiß sie, woran sie ist. Doch das mäßige und vernünftige Leben, das Kien führte, bekam ihm zu gut. Während acht langer Jahre, die er Therese schon im Hause hatte, wurde er nie von Magenbeschwerden geplagt.
Am Vormittag nach der Begegnung mit dem Blinden und seinem Hund geschah es Kien, daß er verschiedene alte Abhandlungen dringend benötigte. Er warf die Schubladen des Schreibtisches wüst durcheinander. Haufen von Papieren hatten sich angesammelt. Entwürfe, Verbesserungen, Kopien, alles, was sich auf die Arbeit bezog, hob er sorgfältig auf. Er fand Wische, deren Inhalt überholt und widerlegt war. Bis auf seine Studentenzeit reichte dieses Archiv zurück. Um eine Kleinigkeit hervorzusuchen, die er ohnehin auswendig wußte, um einer bloßen Bestätigung willen, verlor er Stunden. Dreißig Blätter las er, eine Zeile brauchte er. Unnützes, längst erledigtes Zeug geriet in seine Hände. Er verfluchte es, wozu war es da. Gedrucktes oder Geschriebenes, worauf sein Auge einmal fiel, konnte er nicht übergehen. Ein anderer hätte sich eine so ausschweifende Lektüre versagt. Er hielt vom ersten bis zum letzten Wort aus. Die Tinte war verblaßt. Er hatte Mühe, den schwachen Umrissen zu folgen. Der Blinde von der Straße fiel ihm ein. Da spielte er mit seinen Augen, als wären sie für die Ewigkeit offen. Statt ihre Leistung einzuschränken, erweiterte er sie leichtfertig von Monat zu Monat. Jedes Papier, das er zurücklegte, kostete ein Stück Sehkraft. Hunde leben kurz und Hunde lesen nicht; drum helfen sie Blinden mit ihren Augen aus. Ein Mensch, der sie vergeudet, ist seinen Führerhund wert.
Kien beschloß, seinen Schreibtisch von Unrat zu entleeren, am Morgen, gleich nach dem Aufstehen, denn jetzt war er bei der Arbeit.
Am nächsten Tag, punkt sechs, er steckte noch mitten in einem Traum, schnellte er vom Diwan hoch, stürzte vor den strotzenden Koloß und riß seine sämtlichen Laden auf. Der Pfeifenlärm brach los; es gellte durch die Bibliothek und schwoll herzzerreißend an. Es war, als besäße jede Lade eine eigene Kehle und suche lauter als die nächste um Hilfe zu schreien. Man bestahl sie, man quälte sie, man raubte ihr das Leben. Sie konnten nicht wissen, wer sich an sie wagte. Augen hatten sie keine; ihr einziges Organ war eine schrille Stimme. Kien sichtete die Papiere. Es dauerte lang genug. Er verbiß den Lärm; was er begann, führte er durch. Einen Turm von Makulatur auf den dürren Armen, stelzte er ins vierte Zimmer hinüber. Hier, in einiger Entfernung von den Pfeifen, zerriß er unter Fluchen Stück für Stück. Es klopfte; er knirschte mit den Zähnen. Es klopfte wieder; er stampfte auf. Das Klopfen ging in Hämmern über. »Ruhe!« befahl er und fluchte. Den eigenen Spektakel hätte er sich gern erlassen. Doch tat es ihm leid um seine Manuskripte. Nur die Wut gab ihm den Mut, sie zu vernichten. Schließlich stand er, ein langbeiniger, einsamer Marabu, mitten in einem Berg von Papierfetzen, die er scheu und verlegen, als hätten sie Leben, anfühlte und leise bedauerte. Um sie nicht noch unnötig zu verletzen, spreizte er behutsam ein Bein. Als er den Friedhof hinter sich hatte, atmete er auf. Vor der Tür fand er die Haushälterin. Mit müder Gebärde wies er auf den Haufen und sagte: »Wegräumen!« Die Pfeifen waren verstummt, er kehrte zum Schreibtisch zurück und schloß die Laden. Sie blieben ruhig. Er hatte sie zu stark aufgerissen. Der Mechanismus war zerstört.
Therese hatte sich gerade bemüht, in den gestärkten Rock, mit dem sie ihre Toilette beschloß, hineinzufinden, als der Lärm begann. Sie erschrak zu Tode, band sich den Rock provisorisch fest und glitt eilig an die Tür des Arbeitszimmers. »Um's Himmels willen«, klagte sie, eine Flöte, »was ist geschehen?« Sie klopfte erst schüchtern, dann immer lauter. Da sie keine Antwort bekam, suchte sie zu öffnen, vergeblich. Sie glitt von Tür zu Tür. Im letzten Zimmer hörte sie ihn selbst, wie er zornig rief. Hier hämmerte sie mit aller Kraft. »Ruhe!« schrie er böse, so böse war er noch nie. Halb aufgebracht, halb resigniert ließ sie die harten Hände auf den harten Rock sinken und erstarrte zu einer Holzpuppe. »So ein Unglück!« flüsterte sie, »so ein Unglück!« und stand, mehr aus Gewohnheit, noch da, als er öffnete.
Langsam von Natur, begriff sie doch im Nu, was für eine Gelegenheit sich jetzt ergab. Mit Mühe sagte sie: »Sofort« und entglitt in die Küche. Auf der Schwelle fiel ihr ein: »Um's Himmels willen, er sperrt wieder zu, was die Gewohnheit alles macht! Es kommt bestimmt was dazwischen, im letzten Augenblick, so geht es! Ich hab kein Glück, ich hab kein Glück!« Das sagte sie sich zum erstenmal, da sie sich sonst für eine verdienstvolle und drum auch glückliche Person hielt. Vor Angst geriet ihr Kopf in heftiges Wackeln. Sie schlich sich wieder auf den Gang hinaus. Ihr Oberkörper war tief vornübergebeugt. Die Beine schlenkerten, bevor sie aufzutreten wagten. Der steife Rock verfiel in Wallungen. Mit Gleiten hätte sie ihren Zweck viel leiser erreicht, aber das war ihr zu gewohnt. Die festliche Gelegenheit erforderte einen festlichen Schritt. Das Zimmer war offen. In der Mitte lag noch das Papier. Zwischen Tür und Rahmen schob sie eine dicke Falte des Teppichs, damit der Wind sie nicht zuschlug. Dann kehrte sie in die Küche zurück und wartete, Schaufel und Besen in der Rechten, auf das vertraute Rollen des Waschwagens. Am liebsten wäre sie ihn abholen gekommen, es dauerte heut so lang. Als er endlich gegen die Wand schlug, vergaß sie sich und rief wie immer: »Schon auf?« Sie schob ihn zur Küche hinein und kroch gebückter noch als früher in die Bibliothek hinüber. Schaufel und Besen legte sie auf den Boden. Langsam pirschte sie sich durch die trennenden Räume hindurch bis an die Schwelle seines Schlafzimmers. Nach jedem Schritt blieb sie stehen und warf den Kopf auf die andre Seite herum, um mit dem rechten, weniger abgenützten Ohr zu hören. Für den dreißig Meter langen Weg brauchte sie zehn Minuten; sie kam sich tollkühn vor. Ihre Angst nahm im selben Verhältnis wie ihre Neugier zu. Tausendmal hatte sie sich ihre Haltung am Ziel ausgemalt. Fest preßte sie sich an den Türrahmen. Der frisch gestärkte Rock fiel ihr ein, als es schon zu spät war. Mit einem Aug' suchte sie einen Überblick zu gewinnen. Solang das zweite im Hinterhalt blieb, fühlte sie sich sicher. Sie durfte nicht gesehen werden, sie durfte nichts übersehen. Den rechten Arm, den sie gern in die Seite stemmte, der immer wieder einknicken wollte, zwang sie stillzuhalten.
Kien ging vor seinen Büchern ruhig auf und ab und gab unverständliche Laute von sich. Unterm Arm hatte er die leere Aktentasche. Er blieb stehen, überlegte einen Augenblick, holte sich die Leiter her und kletterte hinauf. Aus dem obersten Regal zog er ein Buch heraus, blätterte drin und legte es in die Aktentasche. Unten angelangt, ging er wieder auf und ab, stutzte, zerrte an einem Buch, das nicht folgen wollte, runzelte die Stirn, und gab ihm, als er es hatte, einen starken Klaps. Dann verschwand es in der Tasche. Fünf Stück suchte er sich aus. Vier kleine, ein großes. Plötzlich hatte er es eilig. Mitsamt der schweren Tasche kletterte er auf die höchste Sprosse der Leiter und schob das erste zurück an seinen Platz. Seine langen Beine behinderten ihn; beinahe wäre er heruntergefallen.
Wenn er fiel und sich was tat, war das Laster zu Ende. Theresens Arm hob sich, er ließ sich nicht mehr meistern; er griff nach ihrem Ohr und zupfte es kräftig. Mit beiden Augen glotzte sie auf den gefährdeten Herrn. Als seine Füße den dicken Teppich erreichten, atmete sie auf. Die Bücher sind ein Schwindel. Das Richtige kommt erst. Sie kennt die Bibliothek genau, aber Laster macht erfinderisch. Es gibt Opium, es gibt Morphium, es gibt Kokain, wer kann sich das alles merken? Sie läßt sich nichts weismachen. Hinter den Büchern steckt es. Warum zum Beispiel geht er nie quer durch das Zimmer? Er steht bei der Leiter und will was vom Regal genau gegenüber. Er könnte es sich einfach holen, aber nein, er geht immer schön an der Wand entlang. Mit der schweren Tasche unterm Arm macht er den großen Umweg. Hinter den Büchern steckt es. Den Mörder zieht es an die Mordstelle. Jetzt ist die Tasche voll. Es geht nichts mehr hinein, sie kennt die Tasche, sie staubt sie täglich aus. Jetzt muß was geschehen. Es ist doch nicht schon sieben? Wenn es sieben ist, geht er weg. Aber wo ist es sieben? Es darf nicht sieben sein.
Frech und sicher beugt sie den Oberkörper vor, stemmt die Arme in die Seiten, spitzt die flachen Ohren und reißt die schmalen Augen gierig auf. Er packt die Tasche an zwei Enden und legt sie fest auf den Teppich. Sein Gesicht sieht stolz aus. Er bückt sich und bleibt gebückt. Sie ist in Schweiß gebadet und zittert am ganzen Körper. Die Tränen kommen ihr, also doch unterm Teppich. Sie hat sich's gleich gedacht. Wie man so dumm sein kann. Er richtet sich auf, knackst mit den Knochen und spuckt aus. Oder hat er nur »so« gesagt? Er greift nach der Tasche, nimmt einen Band heraus und führt ihn langsam an seinen Platz zurück. Dasselbe macht er mit allen andern.