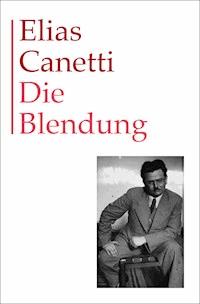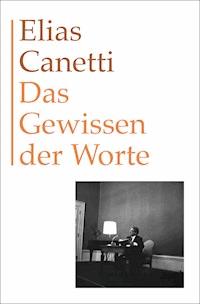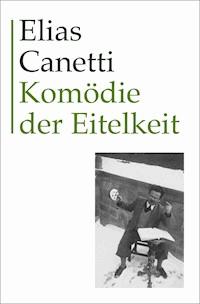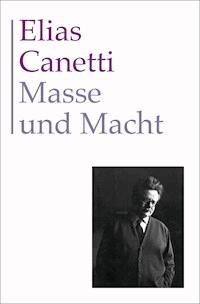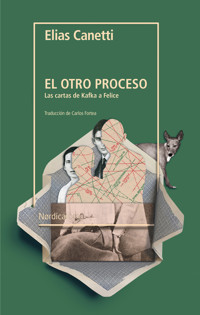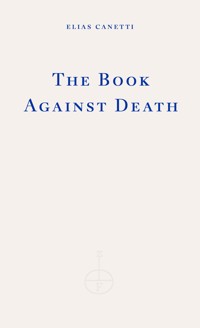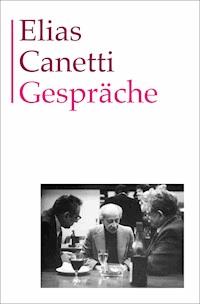Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
"Jede Zeile von Kafka ist mir lieber als mein ganzes Werk." - Elias Canettis Schriften über Franz Kafka „Er ist“, notiert Elias Canetti 1947, „der Einzige, der mir wirklich nahe geht“. Und schreibt später, nur kurz vor seinem Tod: „Ich habe ihn geliebt“. Die Rede ist von Franz Kafka. Die hier zusammengeführten Schriften – bereits publizierte sowie erstmals zugänglich gemachte Materialien aus dem Nachlass – erlauben es, Canettis Äußerungen zu Kafka in den Prozess seiner Selbstvergewisserung als Schriftsteller einzuordnen. Die an Kafka verhandelten Kernthemen erweisen sich immer wieder als seine ureigensten. Erstmals zeigt und deutet dieses Buch die Bindung Canettis an diese Zentralgestalt der Moderne.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 525
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
»1968: sein Kafka-Jahr. Es war das Jahr der Studenten in der Sorbonne, des Prager Frühlings und der August-Katastrophe. Ein wildes, demonstratives, tragisches Jahr. Ein Jahr der abgöttischen Liebe und Verehrung, für Kafka« – so lautet eine Aufzeichnung Elias Canettis von 1993.
Canettis Beschäftigung mit der Person und dem Werk Franz Kafkas reicht jedoch bis 1930 zurück. Sein Verhältnis zu dem knapp zwanzig Jahre Älteren war von Anfang an ambivalent: Von Verehrung für den Größeren ist die Rede, aber auch von Rivalität und »Einflussangst«.
Aus Canettis über sechzig Jahre währender Beschäftigung mit Kafka liegen der Öffentlichkeit bisher nur die englische Rede über Proust–Kafka–Joyce von 1948 vor, der große, 1968 entstandene Kafka-Essay Der andereProzess und verstreute Überlegungen und Aphorismen in den publizierten Aufzeichnungen und in der Autobiographie.
In Canettis Nachlass existieren jedoch umfangreiche weitere Materialien, die hier zum ersten Mal publiziert werden. Sie geben bisher nicht mögliche Einblicke in Canettis Auseinandersetzung mit einem Dichter, der ihm immer wieder als Identifikationsfigur diente und dessen Werk er auch als Maßstab und Richtschnur seiner eigenen Arbeit nahm.
Die nachgelassenen Materialien erlauben es, die publizierten Kafka-Texte in einen (auto)biographischen Prozess der Selbstvergewisserung einzuordnen, in dem die an Kafka explizierten Kernthemen sich immer wieder als Canettis ureigenste erweisen: Es ist tatsächlich »Canettis Kafka«, der uns hier entgegentritt, damit aber auch eine exemplarische literaturgeschichtliche Konstellation des 20. Jahrhunderts.
Elias Canetti
Prozesse
Über Franz Kafka
Im Auftrag der Canetti Stiftung herausgegeben von Susanne Lüdemann und Kristian Wachinger
Carl Hanser Verlag
Inhalt
Susanne Lüdemann: Canettis Kafka
Aufzeichnungen 1946–1966
Aus der Arbeitszeit am Essay 1967–1968
Aufzeichnungen 1969–1994
Proust – Kafka – Joyce (1948)
Der andere Prozess. Kafkas Briefe an Felice (1968)
Hebel und Kafka (1980)
Die Aufzeichnungen im ersten Teil dieses Buches stammen aus Elias Canettis Nachlass in der Zentralbibliothek Zürich sowie aus Privatbesitz. Sie wurden von Johanna Canetti transkribiert. Die Auswahl hat Susanne Lüdemann getroffen (vgl. zu den Kriterien der Auswahl auch die folgende Einführung). Auf die Überprüfung und den Nachweis von Kafka-Zitaten nach einer der kritischen Kafka-Ausgaben (die Canetti noch nicht zur Verfügung standen) wurde im Rahmen dieser Leseausgabe verzichtet. Die Schreibweise der Daten wurde um des einheitlichen Erscheinungsbilds willen angeglichen. Einzelne in den Manuskripten nicht entzifferbare Wörter sind durch »…..« gekennzeichnet.
Die von Canetti selbst publizierten Texte im zweiten Teil des Buches sind wiedergegeben nach den Bänden VI und X der im Hanser-Verlag erschienenen Gesamtausgabe. Auf die Gesamtausgabe wird in gelegentlichen Fußnoten abgekürzt verwiesen unter Angabe von Band- und Seitenzahl:
I
Die Blendung
II
Hochzeit / Komödie der Eitelkeit / Die Befristeten / Der Ohrenzeuge
III
Masse und Macht
IV
Aufzeichnungen 1942–1985 (Die Provinz des Menschen / Das Geheimherz der Uhr)
V
Aufzeichnungen 1954–1993 (Die Fliegenpein / Nachträge aus Hampstead)
VI
Die Stimmen von Marrakesch / Das Gewissen der Worte (Aufsätze)
VII
Die gerettete Zunge
VIII
Die Fackel im Ohr
IX
Das Augenspiel
X
Aufsätze, Reden, Gespräche / Bibliographie
Susanne Lüdemann
Canettis Kafka
Zu dieser Ausgabe
Als Franz Kafka am 3. Juni 1924 im Lungensanatorium Hoffmann in Kierling, zwölf Kilometer donauaufwärts von Wien, im Alter von vierzig Jahren starb, war er als Schriftsteller so gut wie unbekannt. Zu Lebzeiten waren nur wenige Texte von ihm erschienen; dass er postum zum wohl bekanntesten Dichter des 20. Jahrhunderts werden sollte (mittlerweile geradezu global), war völlig unabsehbar. Er hatte seinen Freund Max Brod zum Nachlassverwalter eingesetzt, mit der Bitte, alle seine Papiere zu vernichten. Auch wenn an der Aufrichtigkeit dieser Bitte mit Fug gezweifelt werden kann (und, mit glücklichen Folgen für die lesende Menschheit, nicht zuletzt von Max Brod selbst gezweifelt worden ist): Dass Kafkas Schreiben einst zur gültigen ästhetischen Signatur der inneren und äußeren Verfasstheit eines ganzen literarischen Zeitalters – der klassischen Moderne – werden sollte, konnte man 1924 nicht wissen.
Elias Canetti war 1924, als Kafka starb, neunzehn Jahre alt, lebte nach Stationen in Manchester, Zürich und Frankfurt/Main nun in Wien, seit seiner Kindheit in Rustschuk (Bulgarien) der europäische Bezugspunkt der Familie, und studierte dort Chemie. Von Kafka las er nach eigenem Bekunden zuerst »Die Verwandlung« und den »Hungerkünstler«, auf die er im Winter 1930/31, während der Arbeit an seinem einzigen Roman »Die Blendung«, in der Buchhandlung Lanyi in Wien gestoßen war. Die Lektüre dieser beiden Erzählungen, der er Einfluss auf den weiteren Verlauf der »Blendung« zugestand, markiert den Beginn seiner lebenslangen Auseinandersetzung mit Kafka, deren Spuren in diesem Buch versammelt sind.
Diese umfassen, außer den zu Canettis Lebzeiten publizierten in sich abgeschlossenen Texten – der englischen Rede zu »Proust – Kafka – Joyce« von 1948, dem Essay »Der andere Prozess. Kafkas Briefe an Felice« von 1968 und der Hebelpreisrede über »Hebel und Kafka« von 1980 –, vor allem eine große Menge von Aufzeichnungen (die früheste von 1946, die späteste von 1994, sechs Monate vor seinem Tod), von denen Canetti nur die wenigsten in die zu Lebzeiten publizierten Aufzeichnungen-Bände aufgenommen hat. Der größte Teil dieser nachgelassenen und hier zum ersten Mal publizierten Aufzeichnungen zu Kafka wiederum stammt aus dem Jahr 1968, als Canetti in London in zwei sehr intensiven Schreibphasen (von Februar bis April und dann wieder von Juli bis September) an den beiden Teilen seines Kafka-Essays arbeitete, die im Juni und Dezember desselben Jahres in der von Rudolf Hartung herausgegebenen »Neuen Rundschau« erschienen.1
Dass es 1968 zu diesem Essay und damit zu einer weit über diesen hinausgehenden ebenso intensiven wie extensiven Beschäftigung Canettis mit Kafka kam, war zunächst wohl mehr oder weniger Zufall: Die »Neue Rundschau« hatte in ihrer Septembernummer von 1967 eine Reihe von Briefen Kafkas an Felice aus dem Jahr 1912 vorabgedruckt und auf das Erscheinen der ersten Gesamtedition der Briefe im S. Fischer Verlag noch im selben Herbst hingewiesen. Die Septembernummer enthielt auch einen Text von Canetti, »Besuch in der Mellah« (ein Kapitel aus »Die Stimmen von Marrakesch«), weswegen Hartung ihm das Heft wohl zugeschickt hatte. Canetti war von Kafkas Briefen – es waren in dieser Frühphase der Beziehung zu Felice noch genuine Liebesbriefe – sofort sehr »ergriffen« (2.9.1967, S. 55).2 Neben Kafkas »Zärtlichkeit« in diesen Briefen und deren »Zaghaftigkeit« (im Kontrast zu seiner eigenen »Heftigkeit und Hitze«) verzeichnet er jedoch augenblicklich auch den Zusammenhang zwischen dem Briefwechsel und Kafkas literarischer Produktivität – der Vorabdruck enthielt drei Briefe aus der Zeit, in der Kafka an der »Verwandlung« schrieb. »Das Herz blieb mir stehen, als ich las, um welche Geschichte es sich handelt«, notiert Canetti. Der eigentliche Vorschlag, über die Briefe zu schreiben, muss dann wohl von Rudolf Hartung gekommen sein, und das einzige, was Canetti noch zögern lässt, ist, dass er die Kafka-Forschung nicht kennt (28.11.1967, S. 57).
Nachdem er sich bei Hartung die Lizenz für seine wohlverteidigte »Naivität« gegenüber der akademischen Kafka-Exegese geholt hat, macht er sich an die Arbeit und füllt in den nächsten neun Monaten insgesamt 14 Hefte, die mit»Aufzeichnungen und Tagebücher« überschrieben sind, manchmal zusätzlich mit »Kafka« oder »viel zu Kafka«, und aus denen der Essay hervorgegangen ist. Neben umfangreichen Exzerpten aus Kafkas Gesamtwerk und Entstehungsvarianten des Essays enthalten sie weiterführende Reflexionen zu Kafka, aber auch Notate persönlicher, teilweise sehr persönlicher, und zeitgeschichtlicher Natur, die insgesamt einen aufschlussreichen Einblick in Canettis multiple Schreibwerkstatt bieten. Gleichzeitig mit den Kafka-Heften (später versammelt in Schachtel 25a des Nachlasses) arbeitete er an weiteren Heften mit ›regulären‹ Aufzeichnungen (versammelt in Schachtel 15) und am Manuskript des Essays. Die Grenzen zwischen den Aufzeichnungstypen freilich verschwimmen. Obwohl Canetti in anderen Texten und Interviews wiederholt behauptet hat, zwischen Tagebüchern und Aufzeichnungen streng zu trennen,3 war das offenbar in der Praxis nicht der Fall. Auch außerhalb der Kafka-Hefte gibt es Aufzeichnungen zu Kafka – manchmal von Canetti eigens mit »K« gekennzeichnet –, und die Kafka-Hefte enthalten zu einem nicht unwesentlichen Teil auch persönliche Reflexionen sowie gelegentliche Kommentare zu politischen Ereignissen. »1968: sein Kafka-Jahr. Es war das Jahr der Studenten in der Sorbonne, des Prager Frühlings und der August-Katastrophe. Ein wildes, demonstratives, tragisches Jahr. Ein Jahr der abgöttischen Liebe und Verehrung, für Kafka«, notiert Canetti noch 25 Jahre später (14.9.1993, S. 241), und kurz darauf: »Ende der Kleinheits-Lehre. Periode Kafka – Hera beschlossen.« (7.11.1993)
Die noch in diesen späten Aufzeichnungen geltend gemachte und an den Textträgern aus dem Jahr 1968 unmittelbar ablesbare Verflechtung der Kafka-Phase mit ›anderen Prozessen‹ (persönlichen und politischen) wurde in der vorliegenden Ausgabe respektiert, das heißt, es wurde nicht versucht, die Ebenen zu trennen oder die Kafka-Hefte um scheinbar ›nicht zur Sache Gehöriges‹ zu erleichtern. Im Kapitel »Aus der Arbeitszeit am Essay« (S. 53ff.) wurden Aufzeichnungen aus den Kafka-Heften mit Aufzeichnungen aus Schachtel 15 in chronologischer Reihenfolge kombiniert. Weggelassen wurden lediglich Canettis umfangreiche Exzerpte aus Kafka-Texten sowie zahlreiche Entstehungsvarianten zu einzelnen Passagen seines Essays, die für diese Leseausgabe zu redundant gewesen wären und deren Edition einer historisch-kritischen Ausgabe vorbehalten bleiben muss. Was Canettis Sache 1968 war, ist allerdings aus der auf diese Weise sichtbar werdenden Entstehungsgeschichte des Essays neu zu bestimmen. Im Sinne Canettis dürfte das schon insofern sein, als er – im Gegensatz zu Kafka – seinen Nachlass erhalten wissen wollte: Er hat ihn selbst in Schachteln gepackt und vor seinem Tod der Zentralbibliothek Zürich übergeben.
Canettis Prozesse
»Von den Gebilden führt kein Weg zurück zu den Prozessen«, notiert Canetti Anfang Februar 1968: »Bedenke die Prozesse, nichts sonst.« (S. 65)
Bereits in dieser frühen Arbeitsphase ist die Rede von den »Prozessen« mehrdeutig. Bezieht sie sich im gegebenen Zusammenhang zunächst auf Kafkas Prozess-Roman, den darin geschilderten Gerichtsprozess und auf jenen seinem Essay den Titel gebenden »anderen Prozess«, als den Canetti die unglückliche Ver- und Entlobungsaffäre zwischen Kafka und Felice Bauer interpretiert, so gilt sie mit dem Verhältnis von »Gebilden« und »Prozessen« doch gleichzeitig in einem allgemeineren Sinn dem Verhältnis der Werke zu den Prozessen, aus denen sie entstehen. Führt von den »Gebilden kein Weg zurück zu den Prozessen«, so kann man doch, wenn man »nur die Prozesse bedenkt«, vielleicht den umgekehrten Weg beschreiten.
Dass Kafkas Verlobung mit Felice zur Verhaftung Josef K.s im ersten Kapitel des Prozess-Romans geworden sei, die Entlobung im Askanischen Hof in Berlin (von Kafka selbst als »Gericht« über ihn bezeichnet) zur Hinrichtung Josef K.s im letzten Kapitel, ist die entsprechende Kernthese des Essays, die Canetti unter anderem mit Tagebucheinträgen Kafkas stützt. Er sei sich »sehr wohl dessen bewusst, wie anfechtbar solche Eingriffe in gültige Dichtung« seien, konzediert er, und über den »Prozess« als Ganzes sei damit überhaupt nichts ausgesagt. Bei der »unfassbaren Originalität Kafkas« sei es jedoch »von Bedeutung, den Vorgängen in ihm nachzugehen und so vielleicht dem Wesen wahrhaftiger dichterischer Prozesse näherzukommen.« (31.7.1968, S.161) Diese »dichterischen Prozesse« sieht er wiederum in Zusammenhang mit dem »Prozess der Selbsterkenntnis«, den er in Kafkas Briefen an Felice dokumentiert findet (25.2.1968, S. 96).
Für Literaturwissenschaftler ist die biographische Annäherung an einen literarischen Text, wie Elias Canetti sie in seinem Essay und auch in seinen Aufzeichnungen betreibt, eine Art Todsünde – droht sie doch das, was Adorno noch den »objektiven Gehalt der Gebilde« genannt hätte, auf die subjektive Befindlichkeit und die Lebensprobleme ihres Autors zu reduzieren, deren Ausdruck sie seien. Die biographische Lesart, so das Credo der akademischen Philologie, verfehle durch die Rückführung der Texte auf ihren ›Sitz im Leben‹ des Autors gerade das, worin sie über die Beschränkungen dieses individuellen Lebens hinausreichen: das, worin sie der Sache der Literatur mehr verbrüdert oder verschwistert sind als dem Leben des Autors, und damit das, worin sie exemplarische Gültigkeit auch für andere beanspruchen können – und wollen.
Canetti hingegen besteht darauf, dass »das Öffentliche und das Private […] sich nicht mehr voneinander trennen« lassen, dass sie einander »auf früher unerhörte Weise« durchdringen.4 Exemplarisch ist Kafkas besondere Form der literarischen Produktion für ihn gerade in dieser Untrennbarkeit von Öffentlichem und Privatem, von literarischen und anderen Prozessen. Von seinen gelegentlichen Seitenhieben auf die professionellen »Literatur-Erklärer« (24.11.1991, S. 238), die Germanisten, nimmt er lediglich einen (namentlich nicht Genannten) aus, der in einem Vortrag über Kafkas Tagebücher auch seine eigenen erwähnt. (8.3.1990, S. 233)
Eben diese Untrennbarkeit von literarischen und biographischen Prozessen dokumentieren oder inszenieren nun aber auch Canettis Kafka-Hefte selbst als Versuch, Kafkas Prozess der Selbsterkenntnis auf sich selbst anzuwenden und dadurch seine eigenen dichterischen Prozesse freizusetzen: »Es ist undenkbar, dass seine Prozesse nicht eigene in mir auslösen.« (19.2.1968, S. 79) Canetti hat die Einträge in den Kafka-Heften – nach Art seiner sonstigen Aufzeichnungen – akribisch datiert und ihnen so zumindest die Form des Tagebuchs gegeben. Dieser Form war – im Gefolge von Proust, Joyce und Kafka, die er »die drei bedeutendsten und einflussreichsten Schriftsteller« des 20. Jahrhunderts nennt – auch Canetti »auf das Tiefste verpflichtet« (6.5.1965, S. 40).
Auch die autobiographische Ausrichtung ihrer Werke, die er in der Rede von 1948 Proust, Joyce und Kafka attestiert (S. 248), findet sich bei Canetti zumindest seit der »Geretteten Zunge«. Der Titel dieses ersten Bandes seiner Lebensgeschichte, der 1977 erschien, gewinnt im Zusammenhang der Kafka-Hefte eine zweite Bedeutung,5 denn die Rettung seiner ›Zunge‹ – seiner Sprache als Dichter – ist das, was Canetti während der Arbeit am Kafka-Essay und in der Auseinandersetzung mit Kafka eigentlich umtreibt:
»Rette mich, Kafka. Willst du mich nicht retten«, lautet einer der inständigsten Einträge zu Beginn der Arbeitszeit am Essay, »verachtest du mein Gewicht, meine Wollust, meinen Bauch? War Flaubert nicht so schwer wie ich, war seine Wollust geringer? – Wo sind deine Werke, hör ich dich sagen. Ach, nirgends, nirgends. Aber kann ich sie nicht noch finden? […] Auch mir ist Schreiben ein Gebet, das einzige, das ich kenne. Mein Prozess ist mit dem Tod, er ist noch nicht zu Ende. Diese Rechnung ist dir zu früh aufgegangen. Ich habe länger gelebt und trage mehr Tote als du. Sie sind es, die mir deine Askese verweigern. Damit, dass ich hungere, kann ich sie nicht abspeisen. Keinen wollte ich überleben und so sind sie alle in mir. Welche Sprache find ich für sie, noch hab ich keine. Aber absehen kann ich von ihnen nicht, das ist meine Unfruchtbarkeit.« (20.12.1967, S. 59)
Der Dialog mit Kafka wird Canetti immer wieder zum »Dialog mit dem grausamen Partner«, als den er sein Tagebuch bestimmte.6 Die »Sprache für die Toten« hingegen fand er schließlich in der dreibändigen Lebensgeschichte, an der er nach dem Abschluss des Kafka-Essays zu arbeiten begann. Canettis Kafka-Phase ist so zugleich eine Zeit des ›Kampfs ums Werk‹, den wir in seinen Aufzeichnungen mit verfolgen können.
1960 war »Masse und Macht« erschienen, Canettis Versuch, »dieses Jahrhundert an der Gurgel zu packen«,7 an dem er fast vierzig Jahre gearbeitet hatte. 1963 war Veza Canetti, seine erste Frau, gestorben. Elias Canetti und Venetiana Taubner-Calderon hatten sich 1924 in Wien bei einer Lesung von Karl Kraus kennengelernt; sie waren seit 1934 verheiratet und emigrierten 1938 gemeinsam nach England. Dass es sich, gelinde gesagt, um eine schwierige Ehe gehandelt hatte – geprägt durch außereheliche Liebschaften und paranoide Episoden seinerseits, durch zahllose depressive Krisen und Selbstmorddrohungen ihrerseits –, ist der breiteren Öffentlichkeit seit der Publikation der Briefe beider Ehepartner an Elias Canettis jüngeren, in Paris lebenden Bruder Georges bekannt.8 Canettis Trauer um Veza war dennoch grenzenlos, und sie durchzieht noch die Kafka-Hefte. »Ich möchte in ihre Asche kriechen. Nur in ihrer Asche will ich schreiben. Ich will mit ihrer Asche schreiben.« (24.7.1968, S. 149)
Mit Veza, die acht Jahre älter war als er, hatte er nicht nur seine Frau und engste Gefährtin der Emigrationsjahre verloren, sondern auch, wie er vielfach selbst konstatierte, seine Ersatz-Mutter und literarische Ratgeberin. Seine Schuldgefühle ihr gegenüber, die ihre eigene Existenz als Schriftstellerin für ihn geopfert und mit ihrem Unglück sein Werk genährt hatte, müssen ebenso grenzenlos gewesen sein wie seine Trauer (und vielleicht ja auch von dieser nicht zu unterscheiden). Seit der Publikation von »Masse und Macht« hatte er außer den kontinuierlich fortgesetzten Aufzeichnungen fast nichts Zusammenhängendes mehr geschrieben, und die Unzufriedenheit mit der eigenen literarischen Impotenz kehrt in den Kafka-Heften litaneiartig wieder. »Wann beginne ich mit dem wirklichen, neuen, anderen Werk? Aufzeichnungen unzählige, und gewiss manches Brauchbare darunter, aber wann entschließe ich mich endlich zu einem neuen Werk. Jeden Tag könnte ich beginnen. Was hindert mich? Warum beginne ich nicht? Warum will ich nicht beginnen?« (24.7.1968, S. 148)
Noch vor Vezas Tod hatte er allerdings die Zürcher Kunstrestauratorin Hera Buschor kennengelernt, mit der ihn seit Vezas Tod eine zunehmend enger werdende Liebe verband und die er 1971 heiratete. In der Beziehung zu der 28 Jahre jüngeren Frau muss der schon über sechzigjährige Canetti seine persönliche ›sexuelle Revolution‹ erlebt haben, eine ganz neue Dimension der körperlichen Liebe (auch davon sind die Kafka-Hefte voll).
Gleichzeitig treibt ihn die Angst um, es könne gerade diese glückliche Liebesbeziehung sein, die ihn literarisch unfruchtbar macht. Wenn Hera bei ihm in London ist, verausgabt er sich im Liebesglück und kann nicht arbeiten. Wenn sie aber nicht bei ihm in London ist, wird er »unruhig« und geht »zuviel ins Kaffeehaus« (16.8.1968, S. 182). Erleichtert verzeichnet er es, wenn er mit Hera im Haus doch gut arbeiten kann. Als Hera schwanger ist, legt er sich Listen von Dichtern ohne Kinder und solchen mit Kindern an und fragt sich, ob sich die letzteren »als Väter verringert« haben (14.11.1971, S. 215). Ähnliche Tabellen über die Vor- und Nachteile des Junggesellen-Daseins finden sich auch in Kafkas Tagebüchern – Canetti schreibt sie akribisch ab.
So überkreuzen und überlagern sich in den Kafka-Heften die verschiedensten Prozesse – die Fragen, die Canetti an Kafka bewegen, sind seine eigenen. Kann er gleichzeitig Dichter sein und Ehemann, Familienvater gar, oder muss er – wie Kafka – der Ehe ausweichen, um schreiben zu können? Wodurch ist seine Produktion gehemmt, wie bekommt er sie wieder frei? Welche Rolle spielen dabei die verschiedenen Schreibformen, die Aufzeichnungen, der Briefwechsel mit Hera, die Tagebücher? Wird er noch einmal in der Lage sein, einen Roman zu schreiben? Oder wird der Essay über Kafka alles sein, was von ihm übrig bleibt? (25.9.1968, S. 198) Wie, schließlich, schreibt er sich ein in die Genealogie der modernen Literatur seit Kafka? Wie behauptet er seine Autorschaft gegen den früh verstorbenen Vorgänger, den er verehrt, ja vergöttert, dessen Überlegenheit ihm aber auch den Atem nimmt?
Vielleicht lässt sich das Drama, das sich zwischen Canetti und Kafka abspielt – oder besser: der Prozess, den Canetti in seinen Aufzeichnungen über Kafka mit sich selbst austrägt –, mit einem Ausdruck des amerikanischen Literaturwissenschaftlers Harold Bloom am ehesten als »Einfluss-Angst«9 beschreiben. Harold Bloom bezeichnet damit den Ambivalenzkonflikt, der entsteht, wenn ein Autor sich in die Nachfolge eines verehrten Vorbilds stellt – ja stellen muss, um den eigenen Stand und Halt in der Geschichte der Literatur überhaupt erst zu gewinnen –, und sich innerhalb dieser Nachfolge doch gleichzeitig von seinem Vorbild abgrenzen muss, um die eigene Originalität zu behaupten. Er wird dann schwanken zwischen der bis zum symbolischen Vatermord gehenden Identifizierung mit dem Vorbild und der Abstoßung von ihm.
Canettis Aufzeichnungen zu Kafka sind von diesem Schwanken gekennzeichnet. Seine Identifizierung mit Kafka nimmt, besonders in der Schreibzeit am Essay, teilweise wahnhafte Züge an. Es ist ihm »merkwürdig«, dass die »wichtige erste Zeit« zwischen Hera und ihm sich »genau fünfzig Jahre« nach der zwischen Kafka und Felice abspielte: »Sommer 1912 – März 1913/ Sommer 1962 – März 1963« (23.2.1968, S. 89). Ende Februar 1968 sind ihm Kafkas Briefe an Felice »so ansteckend geworden, dass ich sie selbst an Hera schreiben möchte, obwohl sie zwischen uns ganz und gar sinnlos wären.« (S. 93) Gleichzeitig fragt er sich, ob er das Recht hat, »darüber nachzudenken, was ihre Briefe mir bedeuten, wenn ich darauf kommen will, was Briefe für Kafka waren?« (S. 88)
Er fühlt sich »versucht, den Kafka-Essay, wenn er als Buch erscheint, H. B. [Hera Buschor] zu widmen«, fürchtet aber »die Wirkung von Kafkas Widmung für F. B. [Felice Bauer]«. Der Anfangsbuchstabe B. macht ihm Angst, »so als müsste H. dann sterben, weil F. B. schon tot ist«. Auf der anderen Seite hat er Angst, dass er selbst »vor der Beendigung des Kafka sterben könnte«. In Anspielung auf Kafkas »Lungenwunde« – den Ausbruch seiner Tuberkulose in der Nacht vom 9. auf den 10. August 1917 – schreibt er Ende Februar 1968: »In der Nacht vom 23. auf den 24. ist meine Wunde aufgebrochen.« Alles was er nunmehr zu tun habe, sei, sie »offen zu halten« (S. 93). Liest er von Kafkas Aufenthalt in Berlin-Steglitz im Winter 1923/24, so notiert er sofort, dass er weniger als sechs Jahre später ebenfalls in Steglitz gewohnt hat. Er imaginiert Gespräche mit Kafka darüber, »was er sich wünscht«. (S. 222) Im Gebrauch des aphoristischen »Er« in den Kafka-Heften ist es oftmals schwer zu entscheiden, ob er von sich oder von Kafka spricht. Ebenso sucht er die Berührung mit Kafka über gemeinsame Bekannte. In der Episode mit Ludwig Hardt (S. 233), der ihm 1936 aus Johann Peter Hebels »Schatzkästlein des Rheinischen Hausfreunds« vortrug – und zwar dieselben Geschichten, die Hardt 1921 Kafka vorgetragen hatte –, nimmt er schließlich den Platz Kafkas ein: »Es war zwölf Jahre nach Kafkas Tod und dieselben Worte, die er damals gehört hatte, aus demselben Mund, trafen auf mein Ohr. Wir verstummten beide, denn wir waren uns dessen bewußt, daß wir eine neue Abwandlung derselben Geschichte erlebt hatten.« Diese Episode, die Canetti sowohl im zweiten Band seiner Lebensgeschichte als auch in der Hebelpreisrede (S. 381) erzählt, findet ihr Pendant in der Nobelpreisrede, in der er – in scheinbarer Bescheidenheit – seinen Platz umgekehrt symbolisch an Kafka abtritt: Sechzig Jahre nach Kafkas Tod hat er »ihn nach Stockholm begleitet: vor der ganzen Welt habe ich ihm den Preis zuerkannt, in einer Gesellschaft, die ihm vielleicht nicht recht war, zwei der neben ihm Genannten hat er gekannt (einen sogar in Person: Robert Musil). Ich glaube nicht, dass er Karl Kraus verachtet hat, aber geheuer war er ihm nicht (wem war er geheuer?). Von mir wusste er nichts und ebensowenig von Broch. Da ich sozusagen der Träger war, der sie alle dorthin brachte, konnte ich mich nicht ausschalten.« (S. 223). Scheinbar ist diese Bescheidenheit insofern, als der nicht auszuschaltende »Träger« – der ja zugleich der Preisträger und der ›Fackelträger‹ der literarischen Überlieferung ist – sich damit selbst als legitimer Nachfahre Kafkas installiert; als jener zumal, der »vor der ganzen Welt« die Preise zuerkennt und die Plätze verteilt.
Dass Bescheidenheit seine Sache nicht war, hat Canetti andererseits nur zu gut gewusst, er geißelt sich selbst als »Bescheidenheitsspieler«: »Er stellt sich, als wäre er Kafka, die Demut gelingt ihm nicht.« (24.12.1983, S. 227) Bescheiden war Kafka, er ist eitel und »aufgeblasen«. Er versäumt nicht zu erwähnen, dass Aufgeblasenheit eine »phallische Eigenschaft« ist, die in der Liebe am Platz sei, aber nicht in der Literatur. Die von der Mimikry an Kafka erhoffte Verwandlung bleibt aus: »Umsonst die Bescheidenheit. Umsonst die Wandlung durch sie und Kafka. Klein wolltest du sein. Doch sie entschwand.« (10.1.1989, S. 232) Die Fähigkeit zur »Verwandlung ins Kleine«, die er vielfach an Kafka, aber auch an Hera rühmt – Kafkas »Magerkeit«, das »Verschwinden des Namens«, das »Schwinden durch Hungern«, aber auch Heras Herumkratzen »an den Noten in ihrem Schulzeugnis […], um sie zu verschlechtern« (S. 236) –, ihm ist sie nicht gegeben. Er listet die Gründe auf, aus denen er »nicht wie Kafka« sein kann (15.2.1968, S. 73): 1. Er ist ein schwerer Mensch, sein Körper hat Gewicht. 2. Er ist ein gesunder Mensch; seine hypochondrischen Züge sind, anders als Kafkas, »nicht entscheidend«. 3. Er ist Paranoiker, ihm steht als Mittel der Abwehr jederzeit sein Misstrauen zur Verfügung. Anders als Kafka, der sich gegen die Übermacht seines Vaters zeitlebens wehren, sich ihr durch »Verwandlung ins Kleine« entziehen musste, hat er schon im Alter von sieben Jahren seinen Vater verloren. In diesem frühen Verlust wurzelt sein »Prozess mit dem Tod«, aber auch sein Größenwahn. Seine eigenen Themen: Verwandlung und Macht, sind Kafkas Themen, er hat sie von ihm, aber er und Kafka stehen auf entgegengesetzten Seiten des Spektrums: Er kann sich, wenn überhaupt, nur in Stimmen verwandeln, und wo Kafkas Reaktion auf Macht vom »einzigartigen Standpunkt (…) der absoluten Ohnmacht aus« geschah, ist seine Kenntnis der Macht seiner »privaten Machtausübung über einzelne Menschen« (S. 177) und seiner unbegrenzten Fähigkeit zum Überleben, untrügliches Kennzeichen des Machthabers,10 geschuldet. Bis in den Vergleich seiner frühesten Kindheitserinnerungen mit denen Kafkas hinein reicht Canettis Selbstanalyse, und der Prozess, der sich dabei entspinnt, kann fast ein psychoanalytischer genannt werden. »Ich bin, auf meinen Spuren, so roh wie Freud auf seinen. Meine Abneigung gegen Freud ist eine Abneigung gegen mich selbst«, notiert er im Juli 1968, zu Beginn der Arbeitszeit am zweiten Teil des Essays – ein maximales Zugeständnis des bekennenden Freud-Hassers Canetti an die Verwandtschaft seiner Forschungen mit denen des Begründers der Psychoanalyse. »Nun gehöre ich gar zu den Glücklichen. Habe ich noch ein Recht auf mein Leben? Wenn es geliehen ist – wer hat es mir geliehen? Wenn es geraubt ist – wer ist für mein Leben gestorben? Ich suche den, dem ich entstamme, es ist nicht mein Vater.« (S. 138).
Genealogien und Schreibweisen
»Ich suche den, dem ich entstamme, es ist nicht mein Vater« – diese Notiz verweist nicht nur auf die Schuld des Überlebens und die Verwerfung des Vaters, die Canettis Leben – als europäischer Jude im 20. Jahrhundert wie als Schriftsteller – kennzeichnete wie kaum ein anderes,11 sie verweist auch erneut auf die Verflechtung von privaten und literarischen Genealogien, von ›Leben und Werk des Autors‹. Sich von Kafka her oder aus Kafka herausschreiben zu können, den frühen Verlust des privaten Vaters durch die Investitur eines selbstgewählten literarischen Vaters, die persönliche Genealogie durch eine intellektuelle ersetzen, ja durch sie die Brüche der persönlichen Biographie ›heilen‹ zu können, muss ein zentrales Phantasma Canettis und ein zentraler Motor seines Schreibens gewesen sein. Nur dass der imaginäre literarische Vater seinerseits ein »ewiger Sohn«,12 der »letzte« (S. 65) gar, geblieben war, und dass Canetti ihn 1968, auf der Schwelle seiner eigenen späten, buchstäblichen Vaterschaft, schon um mehr als zwanzig Überlebensjahre geschlagen hatte. Der Ambivalenzkonflikt durchläuft alle Stadien: Der triumphierenden Identifizierung mit dem literarischen Vater (der keiner sein wollte) folgt die schuldbehaftete Selbsterniedrigung vor ihm, dieser wiederum die Abwehr und der Versuch, seinen zuvor selbst reklamierten »Einfluss« loszuwerden. »Wie Kafka kann ich nicht sein, sein Reich war die Ohnmacht«, notiert Canetti schon 1964 (S. 39). »Jede Zeile von Kafka ist mir lieber als mein ganzes Werk. Denn er, nur er, ist von Aufgeblasenheit frei geblieben. […] Wenn ich an Kafka denke, sind mir meine eigenen Reaktionen schal, wie die aller Tiere, die über der Erde leben. Man muss ein Wurm sein wie Kafka, um ein Mensch zu werden«, auch dies schon 1964 (S. 39). »Er musste viel subtilere Mittel ausbilden, um sich der väterlichen Macht zu entziehen, so ist sein Werk in allem feiner, rätselhafter und genauer«, heißt es dann im Februar 1968 (S. 74). Es ist hier wichtig zu bemerken, dass die physischen und psychischen Eigenschaften, die Canetti an Kafka diagnostiziert, gleichzeitig literarische und ethische Eigenschaften sind. Die »Magerkeit« von Kafkas Körper ist gleichzeitig die ›Magerkeit‹ seines Werks – nicht nur, was den Seitenumfang, sondern auch, was die aufs äußerste reduzierte und dennoch (oder gerade deswegen) übergenaue Sprache betrifft. Kafkas Gabe zur »Verwandlung ins Kleine« entzieht ihn nicht nur – jedenfalls für eine Zeit – der Übermacht des biographischen Vaters, sondern bringt auch jene Erzählungen von Käfern, Mäusen, Maulwürfen, Hungerkünstlern, auf Buchstabenkürzel reduzierten Antihelden und »kleinen Frauen« hervor, die Kafkas »kleine Literatur«13 in die große Literaturgeschichte eingeschrieben haben wie keine sonst. Seine biographisch bedingte Empfindlichkeit für die Macht in allen ihren Erscheinungsformen hat ihn die Katastrophen des 20. Jahrhunderts vorausahnen und als »Vor-Fluch des Jahrhunderts« (S. 227) in die Schrift seiner Romane bannen lassen – Katastrophen, die er selbst nicht mehr erlebte, die Canetti dagegen überlebte, während Kafkas Schwestern und seine Geliebten in den Konzentrationslagern starben (einzig Felice gelang die rechtzeitige Flucht nach Amerika). Kafkas Wortkargheit, seine Schreibschwierigkeiten, sein Vegetarismus, seine Askese, seine Unfähigkeit zur Ehe, sein früher Tod, ein heroischer Märtyrertod für die moderne Literatur – alles Embleme seiner Unbestechlichkeit als Schriftsteller, vor denen sich Canetti – dick, lüstern und glücklich verliebt, wie er ist – in Demut beugt. Oder in scheinbarer Demut, denn schon im Juli 1968 geht ihm seine eigene »unaufhörliche Selbsterniedrigung vor Kafka« gehörig auf die Nerven, und er fragt sich nach den Gründen. Weil er »wahllos isst«? Weil er Kafka »schon um 22 Jahre überlebt« hat, ohne bedeutende literarische Werke zu produzieren? Weil die einzige Genauigkeit, deren er fähig ist, die der »Übertreibung« ist? Weil er glücklich sein und sich »leicht und rückhaltlos mitteilen« kann? Weil er von Kafka »angesteckt« ist und für seine »eigene Art des Selbsthasses« nun Kafkas eingetauscht hat? (S. 151).
Canettis »eigene Art des Selbsthasses« dokumentieren diese Fragen freilich nur allzu gut, auch in dieser Hinsicht war es ihm nicht gegeben, sich in Kafka zu verwandeln oder ihn sich einzuverleiben. Zu seinem eigenen besten, wie man sagen muss, oder zum besten seiner Leserschaft, denn Canettis Werk, auch dies sei gesagt, ist dezidiert nicht epigonal. Die Kafka-Ansteckung hat ihn, aller Verehrung zum Trotz, nicht zum Kafka-Imitator werden lassen. »Ob ich mich jetzt, da ich ihn so gut kenne, von Kafkas Einfluss befreien kann? Ob ich jetzt so schreiben könnte, als hätte ich ihn nie gelesen?« fragt er sich nach der Beendigung des Essays (S. 198), und 1974 stellt er fest, dass Kafka in den vorangegangenen Jahren »einen schlechten Einfluss« auf ihn gehabt hat: Er hat ihm mit seiner »asketischen Verdorrung des Wortes« die »Lust auf Expansion genommen, die der Atem meines Lebens war.« (S. 217)
Auch nach Abschluss des Essays taucht Kafka in Canettis Aufzeichnungen aber mit größter Regelmäßigkeit immer dann auf, wenn es darum geht, Einflüsse zu sortieren und so eine Genealogie, einen Familienroman der modernen Literatur zu erstellen. Der Einfluss Goethes, Grillparzers und der »chassidischen Geschichten« auf Kafka, dessen »Blutsverwandtschaft« mit Flaubert, Dostojewski und Kleist – 1982 sind Canetti und Kafka »Brüder in Dostojewski«. Sie haben auch »je einen französischen Gott: er Flaubert, ich Stendhal«. Deutsch sind sie »Brüder in Hebel«; Canetti ist aber »auch Spanier und er dafür mehr Jude. Das ist unsere eigentliche Divergenz, denn Chinesen sind wir wieder beide.« (S. 223) Zu seinen Vorbildern rechnet Canetti außer Kafka aber auch Karl Kraus, Robert Musil und Hermann Broch – letzteren zwar nur mit Einschränkungen, denn »er besteht geradezu aus fremden Einflüssen«, sein »Zweifel am Schreiben war keine Einsicht, es war ein Mangel« (S. 239), wie er 1992 kategorisch urteilt – und sich, besorgt um seinen Nachruhm, noch nachträglich ärgert, dass er auch Broch 1981 ›mit nach Stockholm‹ genommen hat.
Canettis eigene Zweifel am Schreiben haben ihn – neben den drei Bänden der Lebensgeschichte – vor allem zur Kultivierung jener Schreibform der »Aufzeichnungen« geführt, die sein Biograph Sven Hanuschek sein »Hauptwerk« und sein »Zentralmassiv«14 genannt hat (von dem der größte Teil noch in den Tiefen der Zentralbibliothek Zürich verborgen liegt). Vielleicht waren die Aufzeichnungen Canettis Ausweg aus dem gerade für die großen Schriftsteller der klassischen Moderne notorischen ›Scheitern am Werk‹, der »heroischen Negativität«, die Werner Hamacher eine »Grundfigur der Moderne« genannt hat.15 In mehreren Vorbemerkungen zu Büchern mit »Aufzeichnungen« hat Canetti diese Publikationsform damit begründet, dass er sich 1937, kurz vor der Emigration und unter dem Druck der politischen Ereignisse, ein »Verbot rein literarischer Arbeit« auferlegt habe, weil er »begreifen« wollte, »was geschehen war, was geschah, und den Dingen endlich wirklich auf den Grund gehen.«16 »Die Dinge« – das waren die Probleme von Masse und Macht, »die Untersuchung der Wurzeln des Faschismus«,17 die ihn dann quer durch die Jahrhunderte und quer durch die Kulturen bis 1960 beschäftigt hat.
Mit dem Aufzeichnen als Denk-, Schreib- und Lebensform (der Verlaufsform oder dem Prozessieren des Denkens und Schreibens also eher als dem Verfassen in Stein gemeißelter Aphorismen – »Klitsch! eine Wahrheit; klatsch! ein Aphorismus«18) hat Canetti jedoch, der Selbststilisierung des »Verbots rein literarischer Arbeit« zum Trotz, lange vor der Arbeit an »Masse und Macht« begonnen.19 Sie waren keineswegs, wie er behauptet hat, nur ein »Ventil« für die Arbeit am Hauptwerk, sondern sind Canettis ›anderer Prozess‹ – sein anderer Versuch, »das Jahrhundert an der Gurgel zu packen«. Denn einer Welt gerecht zu werden, in der sich ›nichts mehr reimt‹, in der die fürchterlichsten Dinge geschehen, in der die Tradition noch gilt, aber ohne zu bedeuten,20 in der das privateste Leben ständig von kollektiven Katastrophen durchfurcht und geschüttelt, die biographische Eigenzeit ständig von historischer Zeit ergriffen wird – einer solchen Welt gerecht zu werden, ist die Form des Aufzeichnens, in der das alles – Persönliches, Politisches, Literarisches – nebeneinander bestehen, sich wechselseitig kommentieren und bedacht werden kann, vielleicht mehr berufen als jede andere. »Deutschland hat Russland den Krieg erklärt. – Nachmittags Schwimmschule«, lautet ein berühmter Tagebuch-Eintrag Franz Kafkas vom 2. August 1914, auch er eine Aufzeichnung. Die ungeheure Diskrepanz zwischen den geschichtlichen Ereignissen und den unbedeutenden Daten des persönlichen Lebens, eine Diskrepanz, in der sich doch beide untrennbar aufeinander verwiesen finden, ließe sich besser nicht darstellen als in diesem lapidaren Trennstrich, der zugleich ein Bindestrich ist. Gedanken zusammenzustellen, »damit sie sich nicht ineinanderfügen«,21 ist auch eine Bewegungsform von Canettis Aufzeichnungen. »Es schien mir nicht mehr möglich, die Welt mit den üblichen Mitteln des Realismus zu erfassen. Sie war sozusagen zu weit auseinandergegangen in alle Richtungen«, sagt er im Gespräch mit Horst Bienek über seinen Roman »Die Blendung«.22 Eine Konsequenz aus dieser Diagnose – nicht der persönlichen Unfähigkeit zur Synthese, sondern ihrer Unmöglichkeit im 20. Jahrhundert – ist auch die Schreibform der Aufzeichnungen als ein Versuch, dieser auseinanderdriftenden Welt dennoch gerecht zu werden.
Das Romanwerk, von dem er auch nach dem Abschluss von »Masse und Macht« noch träumte, ist nicht mehr entstanden. Die Phantasie von einem Buch »zum Nicht-Veröffentlichen«, von einem ›geheimen Werk‹ zum Hinterlassen, das er niemandem zeigt, damit er schreiben kann, was er will (24.7.1968, S. 149), lässt sich jedoch postum statt auf die nicht existierenden Romane auf das durchaus existierende »Zentralmassiv« der Aufzeichnungen beziehen. Während er öffentlich von allen möglichen großen Werken schwatzt – mindestens fünf Romanen, an denen er gleichzeitig arbeitet, dem notorisch angekündigten zweiten Band von »Masse und Macht« (der ebenfalls nicht existiert) –, schreibt er tatsächlich bis zu seinem Tod unermüdlich weiter an jenem Korpus der Aufzeichnungen, von denen mit den Kafka-Heften hier nun ein kleiner Teil vorliegt.
Aufzeichnungen
1946–1966
17.1.1946
Es ist nichts unheimlicher als der sich fortsetzende Zweifel eines Menschen, der zum Glauben geboren ist. Jeder Schritt als Flucht vor dem Zweifel. (Kafka)
Kafka hatte seinen Kierkegaard, in dem er sich fand und erkannte. Ich habe Blake.
30.12.1946
Durch Deutlichkeit undeutlich werden: Kafkas Genie.
Sogar über die Frauen weiß Kafka alles, worüber weiß er es denn nicht.
25.6.1947
Das Versagen in Kleidern als ein ganz eigenes Versagen. Kafkas Abwehr gegen einen Smoking.
Alles was ich über Kafka erfahre, beglückt und beunruhigt mich zugleich. Es beglückt mich seine Überlegenheit, die eine unanfechtbare ist; ihm geht wirklich jede Eitelkeit des Dichters ab, nie prahlt er, er kann nicht prahlen. Er sieht sich klein und geht in kleinen Schritten. Wo immer er den Fuß aufsetzt, spürt er die Unsicherheit des Bodens. Er trägt einen nicht, solange man mit ihm ist, trägt einen nichts. So verzichtet er auf die Täuschung und das Blendwerk der Dichter. Ihr Glanz, den er sehr wohl fühlte, ist seinen eigenen Worten abhanden gekommen. Man muss die kleinen Schritte mit ihm gehen und wird bescheiden. Es gibt nichts in der neueren Literatur, das einen so bescheiden macht. Er reduziert die Aufgeblasenheit jedes Lebens. Man wird gut, während man ihn liest, aber ohne stolz darauf zu sein. Predigten machen den Ergriffenen stolz, Kafka verzichtet auf Predigt. Er gibt die Gebote seines Vaters nicht weiter; eine merkwürdige Verstocktheit, seine größte Gabe, erlaubt es ihm, das Ketten-Getriebe der Gebote, die von Vätern zu Söhnen immer weiter heruntergereicht werden, zu unterbrechen. Er entzieht sich ihrer Gewalttätigkeit; ihr äußerlich Energisches, das Tierische daran, verpufft bei ihm. Dafür beschäftigt ihn ihr Gehalt umso mehr. Die Gebote werden ihm zu Bedenken. Er ist von allen Dichtern der Einzige, den Macht in keiner Weise angesteckt hat; es gibt keine wie immer geartete Macht, die er ausübt. Er hat Gott der letzten Reste von Väterlichkeit entkleidet. Was übrig bleibt, ist ein dichtes und unzerstörbares Netz von Bedenken, die dem Leben selber gelten, und nicht den Ansprüchen seines Erzeugers. Die andern Dichter imitieren Gott und gebärden sich als Schöpfer. Kafka, der nie ein Gott sein will, ist auch nie ein Kind. Was Manche an ihm erschreckend finden und was auch mich beunruhigt, ist seine konstante Erwachsenheit. Er denkt, ohne zu gebieten, aber auch ohne zu spielen.23
6.7.1947
Die Biographie Kafkas,24 die ich in dieser Nacht zu Ende gelesen habe, hat mich auf eine tiefe und merkwürdige Weise berührt. Von »lebenden« Dichtern ist er der Einzige, der mir wirklich nahe geht, den ich so bewundre wie einen der Alten. Ich empfinde ihn als einen der »Lebenden«, nicht weil er jetzt erst 64 alt wäre; sondern weil er ganz von dieser unsrer Welt ist und es immer mehr wird, oder soll man besser sagen, die Welt wird wie er. Es ist nichts Überflüssiges an ihm, in all seiner Umständlichkeit; er hat die Einfachheit jeder seiner Verzweigungen. Er hat manches von einem Puritaner, noch mehr von einem Juden, vielleicht wäre es am richtigsten, ihn einen Essäer zu nennen; es ist die alte jüdische Form des Puritaners, die er verkörpert. – Im Winter 1930/31, während ich an der »Blendung« schrieb – sie hatte damals natürlich noch keinen Namen –, stieß ich zuerst auf ihn. Ich kaufte mir, in der Buchhandlung Lanyi,25 die »Verwandlung« und den »Hungerkünstler«. Von der »Verwandlung« war ich verzaubert; sie schien mir vollkommen. Außer Stendhals »Rot und Schwarz«, das ich damals deutsch las, ging mir in jenem Winter kein andres literarisches Werk so nahe. Ich glaube, die Lektüre der »Verwandlung« erfolgte, als ich bei Kiens – damals »Kants« – Krankenlager angelangt war. Sie hat auf die weitere Entwicklung des ersten Teils des Romans zweifellos Einfluss gehabt. Ich war mir dieses Einflusses auf eine dunkle Weise immer bewusst; da ich aber sonst nur den »Hungerkünstler« kannte, weder den »Prozess« noch das »Schloss«, ärgerte ich mich immer, wenn man von einem solchen Einfluss sprach, und leugnete ihn kurzerhand ab. Heute fühle ich, dass Kien ohne die »Verwandlung« nie zu Stein erstarrt wäre; sein letztes Abenteuer mit Therese in der Wohnung hätte sich auf irgendeine andre Weise abgespielt. Aus der Sammlung »Der Hungerkünstler« entsinne ich mich nur an die eine Geschichte, die dem Bändchen den Titel gegeben hat. Ich las sie Veza26 vor, der sie wenig Eindruck machte. Die Leisheit des Hungerkünstlers gegen Ende der Erzählung kommt in der »Blendung« vor; es ist die Leisheit Kiens nach der gewalttätigen Leibesvisitation im Idealen Himmel, als man ihn enttäuscht und noch immer nach seinen Geldscheinen begierig am Boden liegen lässt.
Ich würde sagen, dass dieser Einfluss Kafkas nicht groß sein konnte. Er hat mich vielleicht in einer Genauigkeit und Dichte ermutigt, in die ich durch meine eigene Pedanterie von selber geraten war. Es war wohl ein Glück für mich, dass ich damals weder den »Prozess« noch das »Schloss« hernahm; denn davon wäre ich kaum mehr losgekommen.
28.1.1948
Die Welt der Worte, der Empfindungen und des Zweifels: Joyce, Proust und Kafka.27
30.3.1950
Kafka, ein Riese an Kleinheit.
13.1.1951
Bedenken-Innigkeit. (Kafka)
6.3.1951
Ich frage mich, wie es kommt, dass mir fast alle die altehrwürdigen Figuren der modernen Literatur so gar nichts bedeuten. Shaw ist mir ein schaler Witz, Gide sagt mir nichts, Eliot ekelt und Mann langweilt mich. Valéry ist eine Ausnahme, er ist unter ihnen allen der Einzige, der mich unterhält. Aber dann muss ich mir doch sagen, dass Kafka und auch Proust heute noch sehr wohl am Leben sein könnten, und diese Beiden verehre ich allerdings so sehr wie nur irgendwen unter den Alten der Vergangenheit.
25.12.1953
Zwei sehr merkwürdige Stellen bei Kafka, die zusammenhängen (an zwei Tagen hintereinander geschrieben: 19. Oktober 1917, 20. Oktober).
»Psychologie ist Ungeduld
Alle menschlichen Fehler sind Ungeduld, ein vorzeitiges Abbrechen des Methodischen, ein scheinbares Einpfählen der scheinbaren Sache.«
»Es gibt zwei menschliche Hauptsünden, aus welchen sich alle andern ableiten: Ungeduld und Lässigkeit.
Wegen der Ungeduld sind sie aus dem Paradies vertrieben worden, wegen der
Lässigkeit kehren sie nicht zurück. Vielleicht aber gibt es nur eine Hauptsünde:
Die Ungeduld. Wegen der Ungeduld sind sie vertrieben worden, wegen der
Ungeduld kehren sie nicht zurück.«
Meine Geduld ist so unermesslich wie meine Lässigkeit.
27.12.1953
Kafka ist nicht nahrhaft, aber er hat das unaufhörlich Verzagte der Kreatur. Es gibt wenig Kreaturen, zu denen er nicht werden kann, wenn sie nur ausgestoßen oder bedroht sind. In der Drohung, die er empfindet, ist kein Spiel. Nie schleicht sich bei ihm auch nur eine Spur der Überlegenheit ein, die der Mensch sonst merken lässt, wenn er sich einem seiner schwächlichsten Opfer spielend gleichstellt. Er ist das Opfer so sehr, dass er alles immer nur vom Opfer aus sieht. Er hat kein Erbarmen, denn dieses setzt voraus, dass ein weites oder starkes Wesen ein kleines, schwaches zu sich nimmt. Erbarmen ist Kraft und Aufnahme. Er aber wird zum Schwachen und fühlt die Drohung des Starken, das er meist nicht einmal sehen oder finden kann. Das Mächtige untersucht er nie, es ist ihm zu mächtig, aber er behält es fasziniert im Sinn, er wendet sich nie ab davon; er weiß wohl, dass es nicht zu überwältigen ist, aber es ist immer da. Durch sein ganzes Werk, durch alles, was er aufgeschrieben hat, geht das Bewusstsein dieser Übermacht. Das Konsequente seiner Haltung ist einzigartig, innerhalb der ganzen Weltliteratur, und man geht wohl kaum fehl in der Vermutung, dass er an ihr gestorben ist.
28.12.1953
Kafka gibt einem nur die Knochen. Aber sie sind säuberlich abgenagt.
Für mich ist Kafka der Autor, den ich wirklich, also einschließlich »Schloss« und »Prozess« erst im Sommer 1948 kannte, als F.28 wieder zu mir zurückgekommen war und ich einige weltlich-glückliche Monate mit ihr erlebte, die einzigen lustvollen, die ich gekannt habe. In seiner reifen Bedeutung ist er so erst fünf Jahre bei mir und ich kann ihn nicht in die Hand nehmen, ohne an F. zu denken. Aber auch Steiner29 fällt mir manchmal ein, mit dem ich oft über ihn sprach. Vielleicht wird K. für mich immer anziehender und lesbarer bleiben als für Andere, weil etwas von meinem unfasslichen Glück jener Monate in ihn eingegangen ist und weil er mir das Bild zweier meiner wichtigsten Toten heraufbeschwört. Es ist übrigens möglich, dass Steiner, der in Manchem, wenn auch Äußerem – seiner Herkunft, seinem schwächlichen Leib, seinem frühen Tod – Ähnlichkeiten mit Kafka hatte, von diesem als Bote zu Friedl gesandt war. Er verfolgte noch den Gang ihrer Krankheit, starb aber vier Monate vor ihr. – Wie sich diese Bindung an Kafka noch mit meinem Schicksal – meinem letzten Augenblick also – verflechten wird, kann ich nicht sagen. Ich wollte, es wäre mir gegeben, das noch selber zu beurteilen.
23.5.1960
Pavese ist eine Figur zwischen Kafka und mir. An seinem Vornamen Cesare musst du dich nicht stoßen. Unzählige Hunde haben schon so geheißen. Der wahre Dichter ist der Hund seiner Zeit.
24.1.1963
Von Homer bis Kafka, er hat alles in Dosen.
14.12.1964
Jede Zeile von Kafka ist mir lieber als mein ganzes Werk. Denn er, nur er, ist von Aufgeblasenheit frei geblieben.
In der Liebe allein ist Aufgeblasenheit am Platz. Sie ist eine phallische Eigenschaft, die den ganzen Menschen durchdringt. Ich glaube nicht, dass Kafka eine Frau wirklich glücklich machen konnte. Ich hab’s auch erst mit 58 gelernt, vorher hab ich mich mit Händen und Füßen dagegen gesträubt und erlaubte mir von Liebe nur Eifersucht, das ist sehr wenig.
Wenn ich an Kafka denke, sind mir meine eigenen Reaktionen schal, wie die aller Tiere, die über der Erde leben. Man muss ein Wurm sein wie Kafka, um ein Mensch zu werden. Man darf nur kriechen können und alles muss einem missglücken. Man muss Pläne machen, aus denen nie etwas wird. Man muss zu früh und nicht einmal gern sterben. Während der kurzen Zeit, die man lebt, muss man meistens krank sein. Man muss vor den Mächtigen in die Erde flüchten.
26.12.1964
Wie Kafka kann ich nicht sein, sein Reich war die Ohnmacht. Dafür wird man ihn immer lieben müssen.
Für mich, dessen Reich die Macht ist, kann man nur Abneigung empfinden, denn ohne ihr verfallen zu sein, ist es niemandem gegeben, sie so zu hassen, dass er sie zertrümmert.
Kafkas rare Natur (die edelste dieses Jahrhunderts) konnte sich ihr entziehen. So gibt es in seinem Leben nichts, das ihm Schande machte, und so ist er auch viel früher und im Zustand seiner besonderen Unschuld gestorben.
Ich habe mir alle Schuld, und die allerverhassteste erst recht, erwerben müssen, um ihr nichts zu schenken, um nichts an ihr zu übersehen.
6.5.1965
Proust, Joyce und Kafka
Es ist merkwürdig, dass die drei bedeutendsten und einflussreichsten Schriftsteller dieses Jahrhunderts dem Tagebuch als solchem auf das Tiefste verpflichtet sind. Das Werk von Proust bestünde nicht ohne die Einwirkung von Saint-Simon, das gehaltreichste Memoiren-Werk der Weltliteratur, das aus Tagebüchern entstand, die über Jahrzehnte geführt wurden. Joyce hat die Erfassung des Tages auf seine neue und extremste Spitze getrieben, bis in die Erfassung des Momentanen, das so zu einem Simultanen wird. Kafka hat seine Passion für Tagebücher sehr deutlich gemacht, sie waren seine liebste Lektüre, und es wäre der Mühe wert zu zeigen, was er dieser Lektüre verdankt. Er hat selber ein ernstzunehmendes Tagebuch hinterlassen. Die Dignität des Tagebuchs hat in diesen Ausläufern, in dem, was wir als moderne Literatur empfinden, ihren höchsten Stand erreicht. Es wäre mehr als undenkbar, es wäre hirnverbrannt, sie zu bestreiten.
6.7.1965
Ich las gestern einige der theoretischen Aufsätze von Robbe-Grillet30. Er lässt mich vollkommen kalt. Diese Welt der Dinge außerhalb des Menschen, von der er spricht, ist nur durch den Menschen zu erreichen. Wie will er sich ausschließen, wenn er sie beschreibt? Das Abbauen der Figur macht ihn noch mehr zum allwissenden Gott als es der Romancier zuvor je war. Der Unterschied ist nur, dass der Romancier früher seine Allwissenheit auf mehrere Figuren verteilte, während die einzige jetzt er allein ist. Dass er sie hinter den Dingen versteckt, bedingt darum nicht, dass sie nicht da ist.
Wenn er vom allmählichen Eingehen der Figur spricht, bis zu K. bei Kafka, vergisst er, dass Kafka damit etwas sehr Menschliches ausdrückt, nämlich Ohnmacht.
10.7.1965
Es ist auffallend, dass wichtige literarische Werke dieses Jahrhunderts so persönlich sind: Proust, Joyce und Kafka, unendlich verschieden voneinander, haben das Eine gemein, dass sie sich selber, ihrer konkretesten Erfahrung, so nah geblieben sind.
Der »objektive« Roman, wie etwa der von Flaubert oder Tolstoi, ist ihnen verloren gegangen. Seine Glätte genügt ihnen nicht, sie beziehen sich auf subtilere Erfahrungen. Jeder von ihnen ist seine Hauptfigur, und selbst wo, wie bei Proust, die Kraft zu Figuren in höchstem Maße besteht, werden sie doch alle einem Ich, das gar nicht so fiktiv ist, untergeordnet.
11.7.1965
Eine Sprache finden, die so klar ist, dass sie zum Geheimnis wird. (Nicht wie bei Kafka, ohne eigene Substanz des Sprechenden, abgesehen von seiner Substanz.)
17.7.1965
Seit langem weiß ich, dass Joyce mich überhaupt nicht berührt. Seit langem ist Kafka mein eigentlicher Dichter. Nur bin ich nicht wie er, und so kann er mich nicht erschöpfen. Seit langem hab ich geahnt, dass Proust der weitaus Größte der drei ist. Er betrifft mich jetzt ganz besonders, weil ich voll von unausgeschöpfter eigener Erinnerung bin. Aber ich weiß auch, dass mein Weg zur Erinnerung nicht der seinige sein kann. (Er hat die Sensibilität eines Kranken, ich die Brutalität eines Gesunden, der mit 60 seine größte Liebesleidenschaft erlebt.) In meinem Leben ist alles verschoben, das Wichtigste, das auch das Natürlichste ist, kenne ich erst jetzt, und was immer ich früher erdacht habe, war mir nur zugänglich, weil dieses Wichtigste fehlte. Die Verachtung für das Geschlecht war ein Glück für einen, der Freud zu widerstehen hatte, um der Masse ins Auge zu sehen. Sie war kein Glück für einen Dichter (der wohl darum seit seiner Jugend keiner mehr war).
So ist die Proportion von Erinnerung zu Gegenwart eine ganz andere wie bei Proust, und ich muss meine eigenen Wege zu ihr finden.
Seit dem Werk dieser Drei ist aber manches andere geschehen und ich kenne es nur aus zufälligen Bruchstücken. Vielleicht ist schon gefunden worden, was ich jetzt zu tun hätte. Vielleicht habe ich als Romancier überhaupt nichts mehr zu tun. Vielleicht bleibt mir nur übrig, mich ganz zum Drama zu wenden, wo ich stecken geblieben bin, da niemand mich hören wollte.
14.8.1965
Es gibt viele Methoden, der Schalheit des Überkommenen in der Kunst auszuweichen. Die Festlegung auf eine einzige wird bald genauso schal; nichts ist langweiliger und absurder als Geltungskämpfe in der Kunst. Die Art etwa, wie der Ruhm von Joyce zustande gekommen ist, hat etwas unsäglich Beschämendes und ist nah verwandt den simultanen Bewegungen des politischen Lebens. Mit Proust ist es anders: seinem Ruhm geht keine Partei- oder Sektenbildung voraus; aber der unschuldigste und darum unverfänglichste Ruhm ist der von Kafka.
Dass ich selbst jetzt etwas wie Ruhm, wenn auch in viel geringerem Maße, erlebe, erfüllt mich mit unsäglichem Ekel. Der Mensch, dem er gebührt, der jedes Recht darauf gehabt hätte, Veza, die das Opfer dieses Ruhmes war, ist nicht mehr am Leben.
Aus einem einzigen Grunde nehme ich diesen Ruhm zum Schein an: er könnte dazu dienen, den Trotz gegen den Tod, den ich allein bewusst vertrete, unter den Menschen zu verstärken, sie hören nur auf »Namen«.
17.8.1965
»Warum schreib ich nicht wie … wer?«
Diese Aufgabe, die einem gestellt wurde, reizt mich und ich beginne zu glauben, dass Aufgaben für mich gut sind.
Aber wie wer nicht? Karl Kraus? Stendhal? Gogol? Dostojewski? Swift? Kafka? Wieviel Vorbilder hat man gehabt, oder zumindest wieviel Einflüsse! Und auf welchem Gebiet! Wenn es ums Drama ginge, müsste ich sagen: nicht wie Aristophanes, oder nicht wie Büchner.
Wenn es ums Denken ginge, müsste ich sagen: nicht wie Hobbes, oder Freud, oder noch eher: nicht wie Burckhardt. Was aber die Aufzeichnungen anlangt, könnte ich gar niemand nennen, ich müsste nämlich alle nennen, von denen es Aufzeichnungen gibt: Pascal, Chamfort, Joubert, Lichtenberg, Hebbel.
Was mich daran reizt, ist, dass ich mich endlich ernsthaft der Frage nach dem Wesen des Vorbilds stellen müsste.
2.9.1965
Wenn es nur das Eine wäre, dass ich ihm Svevo verdanke, müsste ich für Joyce Wärme fühlen. Sonst fühl ich für ihn keine, er lässt mich eiskalt.
Sonderbar wenn ich an meine abgöttische Liebe für Proust und für Kafka denke.
Ich glaube immer mehr, dass Joyce nicht bleiben kann.
22.2.1966
Ich glaube, dass in meinen frühen Werken Elemente des Surrealismus, des Existenzialismus und des absurden Theaters ungeschieden beieinanderlagen, und meine Wurzeln, soweit es darum ging, waren Aristophanes, Cervantes, Gogol und sicher auch Karl Kraus. Später kamen Büchner und die kurzen Stücke von Kafka dazu: »Die Verwandlung«, »Der Landarzt«, »Der Hungerkünstler«. – Auch die deutschen Expressionisten wirkten nur via Karl Kraus auf mich. Sternheim z.B. habe ich bis zum heutigen Tage nicht gelesen, ich kenne nichts von ihm.
Soweit sich also für die frühen drei Werke etwas sagen lässt, verdanke ich sie der Tatsache, dass ich nie einer literarischen Richtung der Moderne angehört habe und meine Vorbilder alle für mich selber fand.
3.3.1966
Nur die Dichter, die sehr jung starben, Büchner, Trakl, haben die Reinheit ihrer Ahnung bewahrt. Allen anderen hat sie sich allmählich in Erfahrung verwandelt. In dieser einzigen Hinsicht kann man sagen, dass auch Kafka sich immer gleich blieb; er hatte von Anfang eine eigene Einheit, die seines Alters, und es ist ihm erspart geblieben, später jung zu werden.
21.4.1966
Das Unternehmen Dantes erscheint mir immer ungeheuerlicher. Wer vermöchte es ihm gleichzutun und die Namen unserer Zeit zu einem solchen Gericht zu versammeln, wie es sein Gedicht ist.
Das Schwerste, was einer heute zustande bringt, ist, dass er sichselber richtet, und wie stolz er dann noch ist, wenn ihm das wahrhaftig gelingt!
Es hat niemand mehr die Ungebrochenheit und das Vertrauen des Richters.
Der Richter an sich ist suspekt geworden. Man glaubt ihm nicht, dass er’s ist. Man glaubt ihm nicht, dass er sich nicht dafür schämt. Die Verfassung dieser Scham ist Kafka.31
18.6.1966
Er kann sich lange um Zweifel bemühen, es wird kein Kafka aus ihm.
5.7.1966
Bei einer Sache bleiben: »Aber eine Sache gibt’s nicht, sie verstört sich unter den Händen.« »Gewiss. Diese Verstörungen, die in der Sache selber liegen, sind legitim. Aber es gibt auch etwas anderes. Sprünge, die von außen bestimmt sind, von Ast zu Ast, von Baum zu Baum. Diese lassen sich verlangsamen, reduzieren und für eine Weile auch ganz unterbinden.« »Wie bei Kafka, wo die Verlangsamung entscheidend ist. Da kommt es dann auf die Gleichmäßigkeit der Zögerung an.« »Man kann es auch auf wechselnde Geschwindigkeiten anlegen.« »Dabei geht aber die Reinheit der Textur verloren, die für Kafka so charakteristisch ist. Seine Gleichmäßigkeit ist wie aus einem besonderen Material, aus der Eindeutigkeit und Ruhe der Worte entsteht die Vieldeutigkeit seiner Dichtung. Es ist alles wie unter einer einzigen Perspektive gesehen. Die Vieldeutigkeit liegt in der dargestellten Welt selbst, nicht im Darstellenden. Ein höchst merkwürdiger Effekt. Man könnte ihn das Undramatische par excellence nennen. Kafka bleibt wirklich bei der Sache, aber diese Sache ist alles. Sie könnte nicht alles sein, wenn er sich dramatische Sprünge erlauben würde. Er selbst ist ein Käfer. Aber sein Panzer ist nie hart geworden, er ist am ganzen Körper empfindlich geblieben.«
25.7.1966
Ein »privater« Geburtstag, nicht wie der letztes Jahr, der der 60. war. Heute kamen noch zwei Bücherpakete von Hera32, das eine enthielt ein wunderschönes Vogelbuch, das andere eine ganze Reihe von Büchern, die ich erwartet und mir gewünscht hatte. Es waren von Kafka das »Schloss«, das bei mir schon lange verschwunden war, und genauso »Amerika«, Heras eigenes Exemplar, das sie dreizehn Jahre bei sich gehabt hat, ich glaube, ihr liebstes Buch, und jedenfalls ihr liebstes von Kafka. Dann die »Aufzeichnungen aus einem Totenhaus«, der Dostojewski, das erste Buch, über das ich je zu ihr sprach, in Gegenwart Hells, vor sieben Jahren, in der Ausgabe, die sie dann auf meine Empfehlung hin las. Dieses Buch war für Hera eine Brücke von Hell zu mir; er hatte oft zu ihr von seiner Kriegsgefangenschaft in Sibirien gesprochen, wie früher schon, bevor sie ihn kannte, zu mir, und um dieser Erzählung willen hatte sie ihn eigentlich geliebt. Schließlich noch zwei sehr schöne Bücher mit farbigen Bildern von Mineralien und von Geschöpfen der Tiefsee. Wie hat sie mich reich beschenkt, wie umgibt sie mich mit Gaben, wie setzt sie auf ihre Weise etwas fort, was nur Veza vermochte.
Es kam aber noch etwas, was sich auf Zürich und somit auch auf Hera bezieht: eine Einladung zu einer Vorlesung am 8. Januar in Zürich.
In ihrem Brief schreibt Hera, dass sie am liebsten ganz plötzlich bei mir aufgetaucht wäre. Sie habe sich dagegen entschieden, weil dieser Tag Veza gehöre. Diese Feinheit rechne ich ihr hoch an, denn sie kann nicht wissen, dass jeder Tag Veza gehört, selbst die Tage, an denen ich sie, Hera, auf das leidenschaftlichste liebe, Veza und ich lieben Hera zusammen, sie ist unsere gemeinsame Geliebte.
30.7.1966
Noch habe ich nichts getan. Aber ich spüre, dass ich etwas tun kann, weil ich so viel aufnehme. Hundert Bücher interessieren mich, die verschiedenartigsten. Ich lese Gedichte in allen Sprachen, die ich kenne, in Übersetzungen, wenn sie aus Sprachen sind, die ich nicht kenne, versuche ich wenigstens einen Blick auch in die Sprache selber zu tun und lerne eifrig, als wäre ich zwanzig, gleich einige hundert Worte. Ich betrachte Bücher über alle möglichen Tiere. Ich höre wieder, was ich sehr viele Jahre nicht mehr getan habe, meine geliebten Tierstimmen. Gleich neben meinem Bett habe ich endlich den gelben Strindberg hinausgeworfen, in den ich nie hineinsah, er war bloß ein Erbteil von meiner Mutter, und statt dessen habe ich eine wunderbare kleine Handbibliothek eingerichtet, mit vielen von den Dingen, die mir am meisten bedeuten. Da stehen nun: die Odyssee, ein Band Sophokles (Ajax, Elektra), die Vorsokratiker, die Sokratiker (wegen der Kyniker), Pascal, von Stendhal »Le Rouge …«, die »Chartreuse«, »De l’Amour«, die autobiographischen Schriften, »Rome, Naples et Florence«, Kleist, Swift, Blake, darüber liegt mehr aus Respekt als aus Kenntnis Dante, dann Hamann, die Bibel, englisch und deutsch, Dschuang-tse, Bushmen-Folklore, das Lappenbuch des Johan Turi, die Ilias, Aristophanes, Baudelaire, Trakl, die Totenmasken, Shakespeare, Lichtenberg, alles von Kafka außer den Briefen, Rabelais (den ich noch immer nicht gelesen habe), die Spanischen Schelmenromane, Don Quijote, Gogols Tote Seelen, von Dostojewski das Totenhaus. Für einiges, das in dieses Allerheiligste meiner Literatur gehören würde, war einfach kein Patz. So fehlen Büchner, Hölderlin, Dostojewskis Dämonen, der Leviathan von Hobbes, Wuthering Heights, es fehlt Proust, den ich ganz da hinstellen müsste, Nestroy, gar Sophokles, Aischylos und Euripides – von den Historikern: Herodot, Thukydides, Tacitus gar nicht zu reden –, es fehlen die Analekten des Konfuzius, Lao-tse, Liä-tse, es fehlen die kürzeren Sachen von Gogol. Aus Dankbarkeit sollte auch Kraus’ »Die letzten Tage der Menschheit« da sein, aus akuter Neigung die französischen Moralisten von La Rochefoucauld bis Joubert und vielleicht auch Gérard de Nerval. Trotzdem schlafe ich nun neben dem größeren Teil meiner allerwichtigsten Bücher. Wenn ich erwache, ziehe ich eines von ihnen heraus und lese darin und so ist endlich das erste, was ich morgens lese, nicht mehr die Zeitung.
Dante, den ich zu wenig, und Rabelais, den ich kaum kenne, stehen, ich möchte sagen: schon da, weil ich oft an sie denke und weiß, dass sie mir noch sehr viel bedeuten werden. Aber diese Änderung steht für eine neue Arbeitsperiode in meinem Leben. Hera war dabei, als ich den Strindberg hinauswarf, dieser Akt war auch eine Huldigung an sie und sie hat ihn auch als meine Erklärung verstanden.
Darüber ist, wie früher, eine ganze Reihe von Mythen der verschiedensten Völker, unter ihnen neu eingereiht eine vollständige deutsche Übersetzung der Jātaka-Geschichten, vielleicht vierzig Bände. Darunter eine ebensolange Reihe von Büchern über Tiere.
Mit noch etwa hundert Büchern dazu könnte ein Mensch leben, aber es ist gut, dass es nicht zu viele sind, weil ich so auch mehr Lust habe, sie alle wiederzulesen.
Unter diese Reihe Bücher möchte ich einmal eingereiht sein, ein vermessener Ehrgeiz. Aber da ich solche Kraft fühle und zum ersten Mal seit vielen Jahren in geistiger Bewegung bin, scheint es mir doch nicht vermessen. Ich will Dinge schreiben, die mir ein Recht darauf geben, zu diesen Göttern zu gehören. Ich glaube, ich werde sie schreiben.
Ich gehöre zu den Leuten, die einen großen Lärm vor sich schlagen müssen, bevor sie etwas machen, die es nur machen können, wenn sie es übertrieben vor sich ankündigen.
Ich denke mit Beschämung an Kafka, der immer das Gegenteil getan hat. Es hat nicht viele seiner Art gegeben. Die meisten waren eher wie ich, Übertreiber, Prahler, Selbstüberschätzer.
Darin bin ich den Griechen nachgeraten, die Herolde ihrer selbst waren, aber wie kläglich, mit Ausnahme von Proust, ist absolut alles verglichen mit den Griechen.
4.8.1966
Das Totenhaus von Dostojewski: erstes Gefühl: Verwirrung. Man ist verwöhnt durch Kafka, seine Ordnung. Das Chaos bei Kafka ist hinter eine Oberfläche von Ordnung gebannt, bei Dostojewski ist die Oberfläche selbst das Chaos.
Man meint zuerst, dass es sich heute besser schreiben lässt. Ist das aber eine Täuschung?
Geht etwas ganz Wesentliches durch diese Ordnung verloren?
Mich stört weder Übertreibung noch Intensität, ich liebe beide. Mich stört nicht Leidenschaft noch langer heißer Atem. Mich stört das Chaos der Form. Aber vielleicht ist gerade dieses das Eigentlichste von Dostojewski, die Leidenschaft, die bis ins letzte Wort unberechenbar, ungeordnet, Fieber und Wunde bleibt.
Es ist etwas Wunderbares um die Nahrung der großen Dichter. Wie viele hat der unerträgliche Walter Scott genährt, seine falsche Ordnung, seine glatte Oberfläche, sein Ding-Wissen.
Aber solltest du ihn nicht wieder lesen, bevor du aus einer Erinnerung, die bald fünfzig Jahre alt ist, über ihn urteilst? Immerhin, ich habe auch Dickens kaum wieder gelesen, und er ist mir, ohne jede Prüfung, bestehen geblieben.
Sehr merkwürdig ist die Herkunft der Moral in Dichtern. Schiller hat schon Dostojewskis Moral gebildet, wie achtzig Jahre später meine.
Das Verrückte ist über Poe zu mir gekommen. Der hatte es von E. T. A. Hoffmann, Gogol hatte es von diesem. Ich bekam es von Poe und von Gogol, also doppelt. Aber ich bekam es auch von Dostojewski, der es von Gogol und von Hoffmann hatte.
Die sonderbaren Verschränkungen: Dass ich von Gogol herkomme, war mir immer bewusst. Ich hatte Dostojewski vorher gelesen, aber nie hatte ich das Gefühl, dass ich von ihm komme.
Meine Ordnung