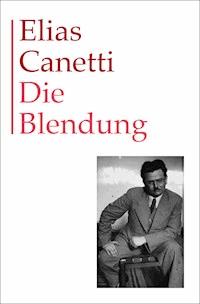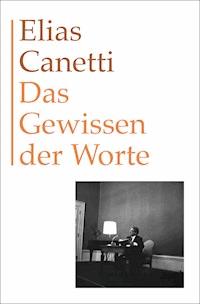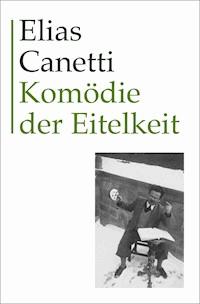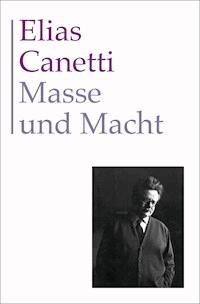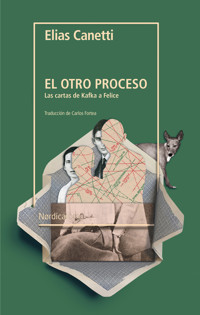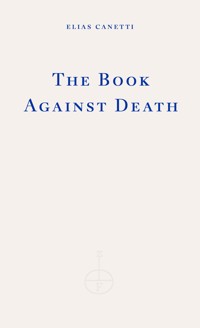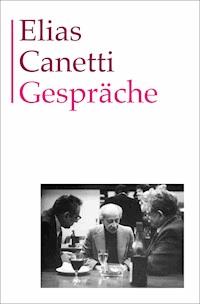Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mit dem "Augenspiel" schließt Elias Canetti seine Autobiographie ab. Hier erzählt er die Zeit, als er seinen Roman "Die Blendung" bereits vollendet hat. Von gelegentlichen Reisen abgesehen, verbringt Canetti die Jahre 1931–1937 in Wien, wo Sigmund Freud gerade dabei ist, sein neues Bild vom Menschen zu erarbeiten, wo Robert Musil und Hermann Broch ihre epochemachenden Werke schreiben, Alban Berg und Arnold Schönberg Neue Musik komponieren und Anna Mahler und Fritz Wotruba als Bildhauer neue Wege gehen. Wie kein anderer stellt Canetti seine Zeit in Menschen dar.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 545
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Mit dem Augenspiel schließt Elias Canetti seine Autobiographie ab. Hier erzählt er die Zeit, als er seinen Roman Die Blendung
Elias Canetti
Das Augenspiel
Lebensgeschichte
1931–1937
Impressum
ISBN 978–3–446–25339–1
Zuerst erschienen 1985
Text nach Band IX der Canetti-Werkausgabe
© 2015, 2016 Elias Canetti Erben Zürich, Carl Hanser Verlag München
Umschlaggestaltung: S. Fischer Verlag / www.buerosued.de
Cover: Anna Mahler, um 1935
Unser gesamtes lieferbares Programm und viele andere Informationen finden Sie unter www.hanser-literaturverlage.de. Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/HanserLiteraturverlage oder folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/hanserliteratur
Inhalt
Teil 1Hochzeit
Büchner in der Wüste
Auge und Atem
Beginn eines Gegensatzes
Der Dirigent
Trophäen
Straßburg 1933
Anna
Teil 2Dr. Sonne
Geschenk eines Zwillings
Der ›Schwarze Stehende‹
Schweigen im Café Museum
Komödie in Hietzing
Auffindung des Guten
Sonne
Die Operngasse
Teil 3Der Zufall
Musil
Joyce ohne Spiegel
Der Wohltäter
Die Hörer
Begräbnis eines Engels
Hohe Instanz
Teil 4Grinzing
Himmelstraße
Die letzte Version
Alban Berg
Begegnung in der Liliput-Bar
Der Exorzismus
Die Zartheit des Geistes
Einladung bei Benedikts
»Ich suche meinesgleichen!«
Ein Brief von Thomas Mann
Ras Kassa. – Das Grölen
Die 38er Tram
Teil 5Die Beschwörung
Unverhofftes Wiedersehen
Der spanische Bürgerkrieg
Besprechung in der Nußdorferstraße
Hudba. Bauern tanzend
Tod der Mutter
Teil 1
Hochzeit
Büchner in der Wüste
Auge und Atem
Beginn eines Gegensatzes
Der Dirigent
Trophäen
Straßburg 1933
Anna
Büchner in der Wüste
Kant fängt Feuer‹, so hieß damals der Roman, hatte mich verwüstet zurückgelassen. Die Verbrennung der Bücher war etwas, das ich mir nicht vergeben konnte. Ich glaube nicht, daß es mir um Kant (den späteren Kien) noch leid tat. Es war ihm während der ganzen Niederschrift des Buches so arg mitgespielt worden, ich hatte mich so sehr damit abgequält, mein Mitleid für ihn zu unterdrücken, es mir, auch im leisesten nicht, merken zu lassen, daß es vom Standpunkt des Schreibenden aus eher als eine Erlösung erschien, sein Leben zu beenden.
Aber für diese Befreiung waren die Bücher eingesetzt worden, und daß sie in Flammen aufgingen, empfand ich so, als wäre es mir selbst geschehen. Mir war zumute, nicht nur als hätte ich meine eigenen Bücher geopfert, sondern auch die der ganzen Welt, denn in der Bibliothek des Sinologen war alles enthalten, was für die Welt von Bedeutung war, die Bücher aller Religionen, die aller Denker, die der östlichen Literaturen insgesamt, die der westlichen, soweit sie auch nur das geringste ihres Lebens bewahrt hatten. Das alles war niedergebrannt, ich hatte es geschehen lassen, ohne auch nur einen Versuch zu machen, etwas davon zu retten, und zurück blieb eine Wüste, es gab nun nichts mehr als Wüste, und ich selbst war an ihr schuld. Denn es ist kein bloßes Spiel, was in einem solchen Buch geschieht, es ist eine Wirklichkeit, für die man einzustehen hat, viel mehr als jeder Kritik von außen sich selbst gegenüber, und wenn es auch eine Angst sehr großen Ausmaßes ist, die einen zwingt, solche Dinge niederzuschreiben, so bleibt immer noch zu bedenken, ob man nicht durch sie eben das mit herbeiführt, was man so sehr fürchtet.
Der Untergang war nun in mir angelegt, und ich kam nicht von ihm los. Durch die ›Letzten Tage der Menschheit‹ hatte er sich seit sieben Jahren schon vorgeprägt. Aber jetzt hatte er eine sehr persönliche Form angenommen, die den Konstanten meines eigenen Lebens entsprang: dem Feuer, das ich am 15. Juli im Zusammenhang mit der Masse erkannt hatte, und den Büchern, die mein täglicher Umgang waren. Was ich dem Protagonisten des Romans geliehen hatte, war, trotz seiner sonstigen Verschiedenheit von mir, so wesentlich, daß ich es nicht, nachdem er seinen Zweck erfüllt hatte, unversehrt und ungestraft wieder zurücknehmen konnte.
Die Wüste, die ich für mich selbst geschaffen hatte, begann alles zu überziehen. Die Bedrohung der Welt, in der man sich fand, empfand ich nie stärker als damals, nach dem Untergang Kiens. Die Unruhe, in die ich zurückverfiel, glich der früheren, in der ich den Plan zu jener ›Comédie Humaine an Irren‹ entworfen hatte, mit dem Unterschied, daß inzwischen etwas Entscheidendes geschehen war und ich mich schuldig fühlte. Es war eine Unruhe nicht ohne Kenntnis ihrer eigenen Verursachung. Nachts, aber auch tags, rannte ich durch dieselben Straßen. Es war keine Rede mehr davon, daß ich mich einem anderen Roman oder gar einem der ehemals geplanten Reihe zuwenden könnte, das enorme Vorhaben war im Rauch des Bücherbrandes erstickt, ohne Bedauern, und statt dessen sah ich nun nichts, wo immer ich mich fand, das nicht vor einer Katastrophe stand, die im nächsten Augenblick einbrechen konnte.
Jedes Gespräch, von dem ich im Vorbeigehen Teile hörte, schien ein letztes. Es geschah unter furchtbarem, unerbittlichem Zwang, was in letzten Momenten geschehen mußte. Aber es hing auf das engste mit den Bedrohten selbst zusammen, was ihnen geschah. Sie hatten sich in die Situation gebracht, aus der es kein Entrinnen gab. Sie hatten sich die besondere und absonderlichste Mühe gegeben, so zu sein, daß sie ihren Untergang verdienten. Jedes Gesprächspaar, das ich hörte, erschien mir so schuldig, wie ich selbst es war, seit ich jenes Feuer angefacht hatte. Aber wenn diese Schuld wie ein eigener Äther alles durchdrang, so daß nichts davon frei war, blieben die Menschen im übrigen genau die, die sie waren. Sie behielten ihre Tonfälle so gut wie ihr Aussehen, die Situationen, in denen sie sich fanden, waren unverwechselbar ihre eigenen, unabhängig von dem, der sie gewahrte und aufnahm. Alles, was er dazutat, war, daß er ihnen eine Richtung gab und sie wie mit einem Treibstoff mit seiner eigenen Angst erfüllte. Jede Szene, vor der ihm der Atem stockte, die er mit der Leidenschaft des Gewahrenden, dessen einziger Sinn das Gewahren geworden ist, aufnahm, endete mit dem Untergang.
Er schrieb sie in größter Hast und in riesigen Buchstaben auf, als Kritzeleien an die Wände eines neuen Pompeji. Es war wie die Vorbereitung auf Vulkanausbruch oder Erdbeben: Einer merkt, daß es kommt, sehr bald, durch nichts aufzuhalten, und schreibt auf, was vorher geschehen ist, was die Leute, durch ihre Verrichtungen und Umstände getrennt, vorher getan haben, von der Nähe ihres Schicksals nichts ahnend, die Atmosphäre der Erstickung mit ihrem alltäglichen Atem einziehend, und eben darum, bevor es noch eigentlich eingesetzt hat, ein wenig eigensinniger und hektischer atmend. Szene um Szene warf ich aufs Papier, jede war für sich, keine hing mit der anderen zusammen, aber jede endete im gewaltsamen Untergang, einzig durch ihn an andere gebunden, und wenn ich heute vornehme, was von ihnen erhalten geblieben ist, scheinen sie wie den Bombennächten des erst kommenden Weltkriegs entsprungen.
Szene um Szene, es waren viele, wie im Laufen geschrieben, in besessener Eile, jede führte in Untergang, und gleich danach begann eine neue, die unter anderen Menschen spielte, und sie hatte mit der früheren nichts gemein als den verdienten Untergang, in den sie mündete. Es war wie ein Strafgericht, ein wahlloses, das alles einbezog, und am schwersten gestraft war der, der es sich über die anderen anmaßte. Denn er, der es abwenden wollte, führte es herbei. Er war es, der die Lieblosigkeit dieser Menschen durchschaute. Er streifte vorüber an ihnen, sah sie und hatte sie schon wieder verlassen, hörte ihren Ton, der sich nie aus seinen Ohren verlor, trug ihn weiter zu den anderen, die ebenso lieblos waren, und wenn ihm der Kopf von den bewahrten Tönen der Selbstsucht zu bersten drohte, schrieb er die dringlichsten von ihnen unter Zwang auf.
Das Quälendste in jenen Wochen war das Zimmer in der Hagenberggasse. Über ein Jahr schon hatte ich hier mit den Lichtdrucken des Isenheimer Altars gelebt. Sie waren mir, mit den erbarmungslosen Details der Kreuzigung, in Fleisch und Blut übergegangen. Solange ich am Roman schrieb, schien ihre Stelle die richtige, sie trieb mich in ein und dieselbe Richtung weiter, ein unerbittlicher Stachel. Sie waren, was ich ertragen wollte, ich gewöhnte mich nicht an sie, ich verlor sie nie aus den Augen, sie setzten sich in etwas um, das scheinbar nichts mit ihnen zu tun hatte, wer wäre so vermessen und so hirnverbrannt, die Leiden des Sinologen mit denen Christi zu vergleichen. Und doch hatte sich etwas wie eine Verbindung zwischen den Aufnahmen, die an den Wänden hingen, und den Kapiteln des Buches hergestellt. Ich brauchte die Bilder so sehr, daß ich sie nie durch etwas anderes ersetzt hätte. Ich ließ mich auch durch das Entsetzen der seltenen Besucher, die ich empfing, nicht beirren.
Aber dann, als Bibliothek und Sinologe in Flammen aufgegangen waren, geschah etwas Seltsames, das ich nicht erwartet hatte. Grünewald gewann seine volle Kraft zurück. Sobald ich am Roman nicht mehr schrieb, war der Maler nur noch für sich selber da, und in der Wüste, die ich geschaffen hatte, blieb er allein wirksam. Wenn ich nach Hause kam, erschrak ich über die Wände meines Zimmers. Alles Bedrohliche, das ich fühlte, verstärkte sich an Grünewald.
Ich konnte mir in dieser Zeit auch durch Lesen nicht helfen. Nicht nur hatte ich mein Recht auf Bücher verloren, denn ich hatte sie um eines Romans willen geopfert. Selbst wenn ich mich zwang, dieses Schuldgefühl zu überwinden und nach einem meiner Bücher so griff, als wäre es noch vorhanden, nicht mitverbrannt, nicht untergegangen, wenn ich mich weiter zwang, darin zu lesen, ekelte es mich bald, und was ich am besten kannte, was ich am längsten schon liebte, ekelte mich am meisten. Ich entsinne mich des Abends, da ich Stendhal, der mich während eines Jahres täglich zur Arbeit angeleitet hatte, im Zorn fallen ließ, nicht auf den Tisch, auf den Boden, und so verzweifelt war ich über die Enttäuschung, die er mir bereitete, daß ich ihn nicht einmal aufhob, sondern liegen ließ. Ein anderes Mal hatte ich den unsinnigen Einfall, es mit Gogol zu versuchen, und diesmal erschien mir sogar ›Der Mantel‹ läppisch und willkürlich, und ich fragte mich, was mich je an dieser Geschichte so erregt hatte. Nichts von den vertrauten Dingen, aus denen ich entstanden war, verfing. Vielleicht hatte ich durch den Bücherbrand alles Alte wirklich zerstört. Scheinbar standen die Bände noch da, aber ihr Inhalt war versengt, in mir war nichts mehr davon da, und jeder Versuch, Abgebranntes wiederzubeleben, weckte Wut und Widerstand. Nach einigen jämmerlichen Versuchen, von denen jeder mißglückt war, nahm ich nichts mehr in die Hand. Das Regal mit den eigentlichen, den unzählige Male gelesenen Bänden blieb unberührt, es war, als seien sie gar nicht mehr da, ich sah sie nicht mehr, ich griff nicht nach ihnen, und die Wüste um mich war vollkommen geworden.
Damals, in einer Verfassung, die trostloser nicht hätte sein können, fand ich eines Nachts meine Rettung in etwas Unbekanntem, das ich schon lange bei mir stehen hatte, ohne es berührt zu haben. Es war ein hoher, großgedruckter Band Büchner, in gelbem Leinen, so aufgestellt, daß man ihn nicht übersehen konnte, neben einem vierbändigen Kleist derselben Ausgabe, in der mir jeder Buchstabe vertraut war. Es wird unglaubwürdig klingen, wenn ich sage, daß ich Büchner nie gelesen hatte, aber es war so. Ich wußte sicher, wie bedeutend er war, und ich glaube, ich wußte auch, daß er mir noch viel bedeuten würde. Es mochten zwei Jahre vergangen sein, seit ich den Band Büchner in der ›Vienna‹-Buchhandlung in der Bognergasse erblickt, gekauft, nach Hause gebracht und neben den Kleist gestellt hatte.
Zu den wichtigsten Dingen, die sich in einem vorbereiten, gehören hinausgeschobene Begegnungen. Es kann sich um Orte und um Menschen handeln, um Bilder wie um Bücher. Es gibt Städte, nach denen ich mich so sehne, als wäre es mir vorbestimmt, ein ganzes Leben von Anbeginn an in ihnen zu verbringen. Unter hundert Listen vermeide ich es hinzufahren, und jede neue Gelegenheit zu einem Besuch, um die ich herumgekommen bin, steigert ihre Bedeutung in mir so sehr, daß man meinen könnte, ich wäre nur um ihretwillen noch auf der Welt und, wenn es sie nicht gäbe, die mich weiter erwarten, längst schon vergangen. Es gibt Menschen, von denen ich gern sprechen höre, so viel und mit so viel Begierde, daß man meinen könnte, ich wisse schließlich mehr über sie als sie selbst – aber ich vermeide es, ein Bild von ihnen zu sehen, und weiche jeder visuellen Vorstellung von ihnen aus, so als läge ein besonderes und berechtigtes Interdikt darauf, ihr Gesicht zu kennen. Es gibt auch Menschen, die mir während Jahren auf ein und demselben Weg begegnen, über die ich nachdenke, die mir wie Rätsel erscheinen, die mir zu lösen aufgegeben sind, und ich richte kein Wort an sie, gehe stumm an ihnen vorbei wie sie an mir, und beide blicken wir uns fragend an, beide halten wir fest unsere Lippen geschlossen, ich denke mir das erste Gespräch aus und bin erregt bei der Vorstellung, wieviel Unerwartetes ich dann erfahren werde. Und schließlich gibt es Menschen, die ich seit Jahren liebe, ohne daß sie eine Ahnung davon haben können, ich werde alt und älter, und es muß schon wie eine unsinnige Illusion erscheinen, daß ich es ihnen je sagen werde, obwohl ich immer in der Vorstellung dieses herrlichen Augenblicks lebe. Ohne diese umständlichen Vorbereitungen auf Künftiges vermöchte ich nicht zu sein, und sie sind mir, wenn ich mich sehr genau prüfe, nicht weniger wichtig als die plötzlichen Überraschungen, die wie von nirgends kommen und einen auf der Stelle überwältigen.
Ich möchte nicht die Bücher nennen, auf die ich mich noch immer vorbereite, einige der herühmtesten Bücher der Weltliteratur sind darunter, an deren Bedeutung ich nach dem Konsensus all derer in der Vergangenheit, deren Meinungen für mich bestimmend waren, nicht zweifeln dürfte. Es ist einleuchtend, daß nach zwanzigjähriger Erwartung ein Zusammenstoß mit einem solchen Werk zu etwas ganz Ungeheuerlichem wird, vielleicht ist es nur so möglich, zu geistigen Wiedergeburten zu gelangen, die einen vor den Folgen der Routine und des Verfalls bewahren. Damals jedenfalls war es so, daß ich als 26jähriger schon lange den Namen Büchner kannte und seit zwei Jahren einen höchst auffälligen Band mit seinen Werken bei mir stehen hatte.
Eines Nachts, in einem Augenblick schlimmster Verzweiflung – ich war sicher, daß ich nie mehr etwas schreiben, ich war sicher, daß ich nie mehr etwas lesen würde –, griff ich nach dem gelben Band und schlug ihn irgendwo auf: Es war eine Szene des ›Wozzeck‹ (so druckte man damals noch den Namen), die nämlich, in der der Doktor zu Wozzeck spricht. Es war, als hätte der Blitz in mich eingeschlagen, ich las diese Szene, alle übrigen des Fragments, ich las das ganze Fragment immer wieder, wie oft, vermag ich nicht zu sagen, mir scheint, es waren unzählige Male, denn ich las diese ganze Nacht, ich las nichts anderes im gelben Band, den Wozzeck immer wieder von vorn und war in solcher Erregung, daß ich vor sechs Uhr morgens das Haus verließ und zur Stadtbahn hinunterlief. Da nahm ich den ersten Zug, der in die Stadt fuhr, stürzte in die Ferdinandstraße und weckte Veza aus dem Schlaf.
Die Kette war nicht vorgelegt, ich hatte den Schlüssel zu ihrer Wohnung. So war es, für den Fall, daß irgendeine Unruhe mich frühmorgens hintreiben sollte, zwischen uns besprochen, aber in den sechs Jahren, während deren unsere Liebe schon bestand, war das nie geschehen, und als es jetzt zum erstenmal unter der Einwirkung von Büchner geschah, mußte es Veza alarmieren.
Sie hatte aufgeatmet, als das asketische Jahr des Romans zu Ende war, und schwerlich war später je ein Leser so erleichtert wie sie, als der hagere Sinologe in Flammen aufging. Sie hatte neue Wendungen befürchtet, eine Wiederaufnahme und Fortsetzung der Abenteuer. Vor der Niederschrift des letzten Kapitels ›Der rote Hahn‹ hatte ich einige Wochen Pause eingelegt, und diese Zögerung mißdeutete sie als Zweifel am Abschluß. Sie malte sich aus, daß Georges bei der Rückfahrt plötzlich Bedenken kämen, spät, aber noch rechtzeitig erkannte er die wahre Verfassung des Bruders, wie hatte er ihn alleine lassen können! Bei der nächsten Station stieg er aus und nahm den Zug zurück. Schon stand er wieder vor der Wohnung und erzwang sich Einlaß. Ohne viel Federlesens packte er Peter zusammen und entführte ihn nach Paris. Da wurde er nun zu einem der Patienten des Bruders, einem ungewöhnlichen, gewiß, der sich mit aller Macht dagegen sperrte. Aber es half nichts, allmählich fand auch er in Georges seinen Meister.
Sie witterte, wie sehr es mich gereizt hätte, den Kampf zwischen den Brüdern in dieser neuen Situation fortzusetzen, ihr verdecktes Gespräch, das in jenem langen Kapitel angeschnitten, doch keineswegs erschöpft war. Auf die Nachricht, daß ›Der rote Hahn‹ endlich geschrieben, daß dem Sinologen sein Vorhaben geglückt war, reagierte sie erst mit Unglauben. Sie dachte, ich wolle sie beruhigen, denn ihre Zweifel an meiner Lebensführung während dieser ganzen Zeit waren mir wohl bewußt. Im dritten Teil des Romans war auch ihr vieles in die Knochen gegangen, und es war ihre Überzeugung, daß dieses nie enden wollende Eindringen in den Verfolgungswahn des Sinologen für meinen eigenen Geisteszustand gefährliche Folgen haben müsse. So war es nicht verwunderlich, daß sie aufatmete, als ich ihr das letzte Kapitel vorlas, und während die schlimmste Zeit, die ich die ›Wüstenzeit‹ genannt habe, für mich erst begann, hätte sie gern gedacht, das Ärgste sei vorüber.
Sie erlebte aber, daß ich jetzt erst recht ihr wie allen anderen Menschen aus dem Weg ging, und obwohl ich eigentlich im Augenblick nichts Bestimmtes tat, weder für sie noch für die wenigen Freunde Zeit aufbrachte. Wenn ich sie doch sah, war ich einsilbig und verdrossen, diese Art von Schweigen hatte es nie zwischen uns gegeben. Einmal verlor sie so sehr die Beherrschung, daß sie sagte: »Seit er tot ist, ist dein Büchermensch in dich gefahren, und du bist wie er. Das ist wohl deine Art, um ihn zu trauern.« Sie hatte unendlich viel Geduld mit mir, ich verargte ihr die Erleichterung über jenen Feuertod, und als sie einmal sagte: »Schade, daß die Therese keine indische Witwe ist, sie hätte sich sonst auch ins Feuer werfen müssen«, parierte ich mit Ingrimm: »Er hatte bessere Angehörige als eine Frau, er hatte seine Bücher, die wußten was sich gehört und sind mit ihm verbrannt.«
Seither erwartete sie, daß ich eines Nachts oder Morgens plötzlich auftauchen könnte, mit der Nachricht, die sie mehr als alles fürchtete: daß ich mich nämlich anders besonnen hätte, das letzte Kapitel gelte nicht, es sei ohnehin in einem anderen Stil gehalten als das übrige Buch, ich hätte es gestrichen. Kant sei wieder zum Leben zurückgekehrt. Das Ganze beginne wieder von vorn, sozusagen als zweiter Band desselben Romans, und damit hätte ich nun mindestens noch ein ganzes Jahr zu tun.
Sie erschrak sehr, als ich sie an diesem Büchner-Morgen aus dem Schlaf weckte. »Wunderst du dich, daß ich so früh komme? Das ist noch nie passiert!« »Nein«, sagte sie, »ich hab dich erwartet« und dachte schon verzweifelt darüber nach, wie sie mich von einer Fortsetzung des Romans abbringen könne.
Ich begann aber gleich mit Büchner. Ob sie den ›Wozzeck‹ kenne? Natürlich kenne sie ihn. Wer kenne das nicht? Sie sagte es ungeduldig, das Schlimmere und Eigentliche erwartend, das sie für mein Anliegen hielt. Ihre Antwort hatte etwas Wegwerfendes im Ton – ich fühlte mich für Büchner beleidigt.
»Und davon hältst du nichts?« Ich sagte es drohend und böse, sie merkte plötzlich, worum es ging.
»Wer? Ich? Ich halte davon nichts? Ich halte es für das größte Drama der deutschen Literatur.«
Ich traute meinen Ohren nicht und sagte irgend etwas: »Es ist doch ein Fragment!«
»Fragment! Fragment! Nennst du das ein Fragment? Was darin fehlt, ist noch besser, als was in den besten anderen Dramen da ist. Man möchte sich mehr solche Fragmente wünschen.«
»Du hast mir nie ein Wort darüber gesagt. Kennst du Büchner schon lange?«
»Länger als dich. Ich habe ihn schon früh gelesen. Zur gleichen Zeit, als ich auf Hebbels Tagebücher und auf Lichtenberg stieß.«
»Aber du hast über ihn geschwiegen! So oft hast du mir Stellen aus Hebbel und aus Lichtenberg gezeigt. Über den ›Wozzeck‹ hast du geschwiegen. Warum nur? Warum?«
»Ich habe ihn sogar versteckt. Den Band Büchner hättest du bei mir nicht finden können.«
»Ich habe ihn die ganze Nacht gelesen. Den ›Wozzeck‹ immer wieder von vorn. Ich habe nicht glauben wollen, daß es so etwas gibt. Ich glaube es jetzt noch nicht. Ich bin hergefahren, um dich zu beschimpfen. Erst dachte ich, du kennst es vielleicht nicht. Aber das kam mir dann gleich unmöglich vor. Was wäre deine ganze Liebe zur Literatur wert, wenn du das nicht kennst. Natürlich kennst du's. Aber du hast es vor mir versteckt. Sechs Jahre reden wir über alle wunderbaren Dinge. Den Namen Büchner hast du nicht einmal vor mir genannt. Und jetzt sagst du, du hast den Band vor mir versteckt. Das ist nicht möglich. Ich kenne jeden Winkel deines Zimmers. Beweis es mir! Zeig mir den Band! Wo hast du ihn versteckt? Es ist ein großer gelber Band. Wie könnte man den verstecken?«
»Er ist weder groß noch gelb. Es ist eine Dünndruck-Ausgabe. Jetzt sollst du ihn selbst sehen.«
Sie öffnete den Schrank, der ihre liebsten Bücher enthielt. Ich dachte an den Augenblick, als sie mir ihn zuerst gezeigt hatte. Ich kannte mich darin besser als in meiner Tasche aus. Da sollte der Büchner versteckt sein? Sie holte einige Bände Victor Hugo heraus. Dahinter, flach gegen die Rückwand des Schrankes gepreßt, lag die Insel-Ausgabe des Büchner. Sie hielt mir den Band hin, es war mir nicht recht, ihn in diesem reduzierten Format zu sehen, ich hatte noch die großen Buchstaben der Nacht vor mir, und in dieser Größe wollte ich sie nun immer vor mir haben.
»Hast du noch andere Bücher vor mir versteckt?«
»Nein, das ist das einzige. Ich wußte, daß du keinen Victor Hugo herausziehen wirst, den liest du ja doch nicht, dahinter war der Büchner sicher. Er hat übrigens zwei Dramen von Victor Hugo übersetzt.«
Das zeigte sie mir, es ärgerte mich, und ich reichte ihr den Band zurück.
»Aber warum nur? Warum hast du ihn vor mir versteckt?«
»Sei froh, daß du ihn nicht gekannt hast. Glaubst du, du hättest sonst selber etwas schreiben können? Er ist auch der modernste aller Dichter. Er könnte von heute sein, nur daß niemand so ist wie er. Man kann ihn sich nicht zum Vorbild nehmen. Man kann sich nur schämen und sagen: ›Wozu schreibe ich überhaupt?‹ Man kann dann nur noch den Mund halten. Ich wollte nicht, daß du den Mund hältst. Ich glaube an dich.«
»Trotz Büchner?«
»Darüber will ich jetzt nicht reden. Es muß Dinge geben, die unerreichbar sind. Aber das Unerreichbare darf einen nicht zermalmen. Jetzt bist du fertig mit dem Roman. Jetzt sollst du noch etwas anderes lesen. Es gibt noch ein Fragment von ihm, eine Erzählung: ›Lenz‹. Lies es gleich!«
Ich setzte mich hin und las ohne ein weiteres Wort das wunderbarste Stück Prosa. Nach der Nacht des ›Wozzeck‹ der frühe Morgen des ›Lenz‹, ohne einen Augenblick Schlaf dazwischen. Da zerfiel mir mein Roman, auf den ich so stolz gewesen war, er zerfiel mir zu Staub und Asche.
Es war ein harter Schlag, aber es war gut, daß das geschah. Nach den Kapiteln von ›Kant fängt Feuer‹, die sie alle gehört hatte, hielt Veza mich für einen Dramatiker. Sie hatte in der Furcht gelebt, daß ich aus dem Roman nicht mehr herausfinden würde. Sie hatte erlebt, wie tief ich mich in ihn verstrickt und wie sehr er mich hergenommen hatte. Ob er es war, ob ein anderer, der neu begann, sie erkannte die fatale Neigung zu Aufgaben, die sich über Jahre hinzogen. Sie hatte die Entwürfe zu jener Romanreihe einer ›Comédie Humaine an Irren‹ in Erinnerung, über die ich oft zu ihr gesprochen hatte. Der Blick auf Steinhof von meinem Fenster, der ihr anfangs Eindruck gemacht hatte, gefiel ihr längst nicht mehr. Sie hatte das Gefühl, daß die Faszination, die besessene oder abseitige Menschen auf mich ausübten, mit der Niederschrift des Romans noch gewachsen war. Auch die Freundschaft mit Thomas Marek beunruhigte sie. Meine Parteinahme für ihn war heftig und aggressiv, und als ich einmal mich zu der Behauptung verstieg, daß dieser Gelähmte wichtiger sei als sämtliche Leute, die undankbar und ahnungslos auf Beinen gingen, widersprach sie mir und zog über meine Verstiegenheit her.
Sie fürchtete wirklich um mich, und die Liebeserklärung an alle, die für wahnsinnig gelten, im Kapitel ›Ein Irrenhaus‹ des Romans gab ihr die Überzeugung, daß ich eine gefährliche Grenze überschritten hatte. Der Hang zu Isolation, die Bewunderung für alle, die ganz und gar anders waren, der Wunsch, sämtliche Brücken zu einer niederträchtigen Menschheit abzubrechen – alles das machte ihr sehr zu schaffen. Ich hatte mich über Wahngebilde mancher Menschen, die ich kannte, zu ihr so geäußert, als ob es vollkommene Kunstwerke wären, und mich bemüht, die Entstehung eines solchen Wahngebildes, das ich erfand, Schritt für Schritt zu verfolgen. Sie hatte oft, auch aus ästhetischen Gründen, Unmut über die Ausführlichkeit in meiner Darstellung eines Verfolgungswahns geäußert, und ich pflegte dann zu erklären, daß man es anders gar nicht machen könne, daß es eben auf jede Einzelheit, auf jeden kleinsten Schritt ankomme. Ich zog zu Felde gegen frühere Darstellungen von Wahnsinn in der Literatur und suchte ihr zu beweisen, wie wenig sie stimmten. Sie meinte, es müsse auch möglich sein, solche Zustände komprimiert und dadurch in einer Art von Steigerung vorzuführen. Dagegen aber opponierte ich am entschiedensten: in solchen Fällen ginge es immer um die Selbstgefälligkeit, um die Pfauenhaftigkeit von Autoren und nicht um die Sache selbst. Man müsse endlich begreifen, daß Wahnsinn nichts Verächtliches sei, ein Phänomen voll eigener Bedeutungen und Beziehungen, die in jedem Fall wieder andere wären. Sie bestritt das und verteidigte dann, was ganz gegen ihre Art war und nur aus Sorge um mich geschah, die herrschenden Klassifikationen der Psychiatrie, wobei sie eine besondere Schwäche für den Begriff des ›manisch-depressiven Irreseins‹ zeigte, während sie mit ›Schizophrenie‹, die damals daran war, zu einem Modebegriff zu werden, etwas zurückhaltender umging.
Ihre Absicht bei alledem: mich von dieser Art von Roman abzubringen, war mir wohlbekannt. Ich war von einer wilden Entschlossenheit, mich von niemandem, nicht einmal von ihr, beeinflussen zu lassen, und setzte als Waffe dagegen den, wie ich dachte, gelungenen Roman ein. Wenn ich mich auch als Brandstifter schuldig fühlte und unter dieser Schuld schwer litt, so bedeutete das keinen Einwand gegen die Gültigkeit des Romans, von der ich felsenfest überzeugt war. Obwohl mich seit seinem Abschluß alles zum Drama drängte, scheint es mir durchaus nicht ausgeschlossen, daß ich mich nach einer Periode der Erschöpfung einem neuen, nicht weniger langen Roman zugewandt hätte, dessen Gegenstand wieder ein Wahn geworden wäre.
Jetzt aber wurde die Nacht, in der ich den ›Wozzeck‹ aufnahm, und der Morgen darauf, als mich in einem Erregungszustand der Erschöpfung der ›Lenz‹ überfiel, entscheidend. Auf wenigen Seiten fand ich da alles, was sich über die Besonderheit der Verfassung von Lenz sagen ließ, es wäre furchtbar gewesen, sich das als ausführlichen Roman vorzustellen. Hochmut und Trotz waren mir aus der Hand geschlagen. Ich schrieb keinen neuen Roman, und es vergingen Monate, bevor ich das Vertrauen zu ›Kant fängt Feuer‹ wiedergewann. Als es soweit war, war ich schon besessen von der ›Hochzeit‹.
Wenn ich nun sage, daß ich die ›Hochzeit‹ jenem nächtlichen Eindruck vom ›Wozzeck‹ verdanke, so wird das zuallererst als Anmaßung erscheinen. Ich kann aber, bloß um diesen Eindruck der Anmaßung zu vermeiden, um die Wahrheit nicht herumkommen. Ich darf sie nicht vermeiden. Die Untergangsvisionen, die ich bis dahin aneinandergereiht hatte, standen noch unter dem Einfluß von Karl Kraus. Alles was geschah, und es geschah immer das Ärgste, geschah ohne Begründung, und es geschah nebeneinander. Es war von einem Schreibenden aus gehört, und es wurde angeprangert. Es wurde von außen angeprangert, eben von dem, der schrieb, und über alle Szenen des Untergangs hielt er seine Peitsche. Sie gab ihm keine Ruhe, sie trieb ihn an allem vorbei, er hielt nur inne, wenn es etwas zu peitschen gab, und kaum war die Strafe exekutiert, trieb sie ihn weiter. Im Grunde geschah immer wieder dasselbe: Menschen in ihren alltäglichsten Verrichtungen, während sie die banalsten Sätze von sich gaben, standen ahnungslos am Rande des Abgrunds. Da kam die Peitsche und trieb sie hinein, es war derselbe Abgrund, in den sie alle stürzten. Es gab nichts, das sie davor hätte bewahren können. Denn ihre Sätze änderten sich nie, sie waren ihnen angemessen, und der, der Maß für sie genommen hatte, war immer ein und derselbe, der Schreiber mit der Peitsche.
Am ›Wozzeck‹ erlebte ich etwas, wofür ich erst später einen Namen fand, als ich es Selbstanprangerung nannte. Die Figuren, die einem (außer der Hauptfigur) den größten Eindruck machen, stellen sich selber vor. Der Doktor oder der Tambourmajor schlagen nach außen. Sie greifen an, aber auf so verschiedene Weise, daß man ein wenig zögert, für beide dasselbe Wort Angriff zu verwenden. Es ist aber doch ein Angriff, denn auf Wozzeck wirkt er sich als solcher aus. Ihre Worte, die unverwechselbar sind, wenden sich gegen ihn und haben die schwersten Folgen. Aber diese haben sie nur, indem sie sich selbst, den Sprecher nämlich darstellen, der einem mit sich einen bösen Schlag versetzt, einen Schlag, den man nie vergißt, an dem man ihn immer und überall erkennen würde.
Die Figuren, wie gesagt, stellen sich selber vor. Sie sind von niemand hergepeitscht worden. Als wäre es das Natürlichste von der Welt, prangern sie sich selber an, und es ist mehr von Gepränge darin als von Strafe. Sie sind, wie immer sie sind, da, bevor ein moralischer Spruch über sie gefällt wurde. Sicher, man denkt mit Abscheu an sie, aber er ist mit Wohlgefallen verquickt, weil sie sich vorführen, ohne zu ahnen, welchen Abscheu sie erregen. Es ist eine Art von Unschuld in der Selbstanprangerung, es ist noch kein juristisches Netz für sie ausgelegt, das mag, wenn es überhaupt kommt, später über sie geworfen werden, aber keine Anklage, auch die des gewaltigsten Satirikers nicht, könnte so viel bedeuten wie die Selbstanprangerung, denn diese enthält auch den Raum, in dem ein Mensch besteht, seinen Rhythmus, seine Angst, seine Atemzüge.
Es gehört wohl dazu, daß man ihnen das volle Wort ›Ich‹ ernsthaft gönnt, das der pure Satiriker niemandem wirklich zubilligt, außer sich selbst. Die Vitalität dieses unmittelbaren und uneingeklammerten ›Ich‹ ist ungeheuer. Es sagt mehr über sich als jeder Richter. Für den Urteilenden liegt das meiste in der dritten Person, selbst die direkte Anrede, in der das Schlimmste gesagt wird, ist usurpiert. Erst wenn der Richter in sein Ich verfällt, ist er in der vollen Schrecklichkeit dessen, was er verübt, da, aber dann ist er selbst zur Figur geworden und führt sich, er, der Urteilende, ahnungslos in seiner Selbstanprangerung vor.
Der Hauptmann, der Doktor, der dröhnende Tambourmajor treten wie von selbst in Erscheinung. Niemand hat ihnen ihre Stimme geliehen, sie sagen sich und schlagen mit sich auf ein und denselben los, eben auf Wozzeck, und entstehen, indem sie auf ihn schlagen. Er dient ihnen allen, er ist ihr Zentrum. Sie bestünden nicht ohne ihn, aber er weiß das so wenig wie sie, man möchte so weit gehen zu sagen, daß er seine Quäler mit seiner Unschuld ansteckt. Sie können nicht anders sein, als sie sind, es ist das Wesen der Selbstanprangerung, daß sie diesen Eindruck vermittelt. Die Kraft dieser Figuren, aller Figuren ist ihre Unschuld. Soll man den Hauptmann, soll man den Doktor hassen, weil sie anders sein könnten, wenn sie nur wollten? Soll man auf Bekehrung für sie hoffen? Soll das Drama eine Missionsschule sein, in die solche Figuren so lange gehen, bis sie sich anders schreiben lassen? Der Satiriker erwartet von den Menschen, daß sie anders seien. Er peitscht sie, als ob sie Schulbuben wären. Er richtet sie für moralische Instanzen her, vor denen sie irgendeinmal zu stehen kommen sollten. Er weiß sogar, wie sie besser wären. Woher bezieht er diese unumstößliche Sicherheit? Hätte er sie nicht, er könnte gar nicht zu schreiben beginnen. Es fängt damit an, daß er ungescheut wie Gott ist. Ohne das geradezu zu sagen, vertritt er ihn und fühlt sich wohl dabei. Er verliert keinen Augenblick an den Gedanken, daß er vielleicht gar nicht Gott ist. Denn da diese Instanz besteht, die höchste, leitet sich Vertretungsmacht aus ihr her, man muß sie nur ergreifen.
Es gibt aber eine ganz andere Haltung, die den Kreaturen und nicht Gott verfallen ist, die sich ihrer gegen ihn annimmt, die vielleicht so weit geht, ganz von ihm abzusehen, und nur von Kreaturen handelt. Sie sieht ihre Unabänderlichkeit, obwohl sie sie anders haben möchte. Mit Haß wie mit Strafen ist den Menschen nicht beizukommen. Sie klagen sich an, indem sie sich darstellen, wie sie sind, aber es ist ihre Selbstanklage, nicht die eines anderen. Die Gerechtigkeit des Dichters kann nicht darin bestehen, sie zu verdammen. Er kann den erfinden, der ihr Opfer ist, und alle ihre Spuren wie Fingerabdrücke auf ihm zeigen. Von solchen Opfern wimmelt die Welt, aber es scheint das Schwierigste zu sein, einen als Figur zu fassen und so sprechen zu lassen, daß die Spuren erkennbar bleihen und sich nicht zu Anklagen verwischen. Wozzeck ist diese Figur, und man erlebt, was an ihm verübt wird, während es geschieht, und es ist kein Wort der Anklage hinzuzufügen. Die Spuren der Selbstanprangerungen sind an ihm erkennbar. Die auf ihn losgeschlagen haben, sind da, und wenn es mit ihm zu Ende geht, bleiben sie am Leben. Das Fragment führt nicht vor, wie es mit ihm zu Ende geht, es führt vor, was er tut, seine Selbstanprangerung nach denen der anderen.
Auge und Atem
Meine Beziehung zu Hermann Broch war, mehr als es sonst üblich ist, von der Gelegenheit unserer ersten Begegnung bestimmt. Ich sollte bei Maria Lazar, einer Wiener Schriftstellerin, die wir beide unabhängig voneinander kannten, mein Drama ›Hochzeit‹ vorlesen. Einige Gäste waren geladen. Ernst Fischer und seine Frau Ruth waren darunter, ich weiß nicht mehr, wer die anderen Gäste waren. Broch hatte sein Erscheinen zugesagt, man wartete auf ihn, er hatte sich verspätet. Ich wollte schon beginnen, da kam er im letzten Augenblick, mit Brody zusammen, seinem Verleger. Zu mehr als einer kurzen Vorstellung reichte die Zeit nicht: Bevor wir noch zueinander gesprochen hatten, begann ich mit der Vorlesung der ›Hochzeit‹.
Maria Lazar hatte Broch erzählt, wie sehr ich die ›Schlafwandler‹ bewunderte, die ich während des Sommers dieses Jahres 1932 gelesen hatte. Er kannte von mir nichts; da nichts gedruckt war, hatte er nichts von mir kennen können. Er war für mich, nach dem Eindruck der ›Schlafwandler‹ und besonders des ›Huguenau‹, ein großer Dichter, ich für ihn ein junger, der ihn bewunderte. Es mochte Mitte Oktober sein, sieben oder acht Monate zuvor hatte ich die ›Hochzeit‹ beendet. Einzelnen Freunden hatte ich das Stück vorgelesen, es waren Freunde, die etwas von mir erwarteten, und nie noch waren es mehrere von ihnen zusammen gewesen.
Broch aber, und darauf kommt es hier besonders an, bekam mit voller Wucht und bevor er sonst irgend etwas von mir erfuhr, die ganze ›Hochzeit‹ zu hören. Ich las dieses Stück mit Leidenschaft, die Figuren standen durch ihre akustischen Masken fest voneinander abgegrenzt da, daran hat sich auch in Jahrzehnten nie mehr etwas geändert. Es dauerte über zwei Stunden, und ich las in einem Zug. Es war eine dichte Atmosphäre, außer Veza und mir waren vielleicht ein Dutzend Menschen da, aber ihre Präsenz war so stark, daß es sich wie ein Vielfaches davon anfühlte.
Ich sah Broch gut vor mir, die Art, wie er dasaß, machte mir Eindruck. Sein Vogelkopf schien zwischen den Schultern ein wenig eingesunken. Während der Hausbesorgerszene, der letzten des Vorspiels, die mir die teuerste des ganzen Stückes geworden ist, bemerkte ich seine Augen. Der Satz der sterbenden Kokosch: »Du Mann, ich muß dir was sagen«, den sie immer wieder beginnen muß, den sie nicht vollenden kann, ist für mich der Augenblick der Begegnung mit den Augen Brochs. Wenn Augen atmen könnten, sie hätten den Atem angehalten. Sie warteten darauf, daß der Satz zu Ende gesprochen würde, und dieses Einhalten und Verharren war angefüllt mit Kokoschs Worten aus Simson. Es war eine doppelte Lesung, und zum lauten Dialog, der gar keiner war, denn Kokosch hörte nicht auf die Worte der Sterbenden, war ein unterirdischer hinzugetreten, zwischen Brochs Augen, die sich der Sterbenden angenommen hatten, und mir, der immer wieder zu ihren Worten ansetzte und sich darin von den biblischen Sätzen des Hausbesorgers unterbrechen ließ.
Das war die Situation in der ersten halben Stunde des Lesens. Dann kam die eigentliche ›Hochzeit‹, und sie setzte mit großer Schamlosigkeit ein, für die ich mich aber damals, da ich sie so sehr haßte, gar nicht schämte. Von der Naturwahrheit dieser ekelhaften Szenen hatte ich vielleicht keine komplette Vorstellung. Eine Quelle davon war Karl Kraus, aber es war auch anderes eingeflossen: George Grosz, dessen ›Ecce Homo‹-Mappe ich bewundert und verabscheut hatte. Das meiste hatte mit Selbstgehörtem zu tun.
Beim Vorlesen des wüsten, mittleren Teils der ›Hochzeit‹ achtete ich nie auf meine Umgebung. Es gehörte zu dieser Art von Besessenheit, daß man zu schweben vermeint, auf schrecklichen und gemeinen Sätzen, die nichts, gar nichts mit einem zu tun haben, die einen mehr und mehr aufblasen, so daß man auf ihnen fliegt, wie ein Schamane vielleicht, doch das hätte ich damals nicht gewußt.
An diesem Abend war es aber anders. Ich spürte während des ganzen mittleren Teils die Anwesenheit von Broch. Sein Schweigen war eindringlicher als das der anderen. Er hielt an sich, wie man Atem anhält, wie es genau damit beschaffen war, wußte ich nicht, aber daß es etwas mit Atem zu tun hatte, fühlte ich, und ich glaube, es war mir bewußt, daß er anders atmete als alle anderen. Gegen den schrecklichen Lärm, den meine Figuren vollführten, stand seine Stille. Sie hatte etwas Körperliches, sie wurde von ihm bewirkt, es war eine Stille, die sich erzeugte, heute weiß ich, daß sie mit seiner Art zu atmen zusammenhing.
Im dritten Teil des Stücks, dem eigentlichen Untergang und Totentanz, spürte ich nichts mehr um mich. Die große Anstrengung nahm mich her, ich war im Rhythmus, der hier das Entscheidende ist, so sehr gefangen, daß ich nicht hätte sagen können, was mit diesem oder jenem Hörer geschah, und als ich zu Ende war, wußte ich nicht einmal, daß Broch da war. Mit der Zeit war inzwischen etwas passiert, und ich mag wieder dort gewesen sein, wo man auf sein Kommen gewartet hatte. Doch er äußerte sich und sagte: Wenn er das gekannt hätte, hätte er sein Stück nicht geschrieben. (Es scheint, daß er damals gerade mit einem Stück beschäftigt war, es wird dasselbe gewesen sein, das dann in Zürich gespielt wurde.)
Dann sagte er etwas, das ich hier nicht wiedergeben mag, obwohl es viel Einsicht in die Genese des Stückes verriet. Ohne ihn zu kennen, wußte ich, daß er erschüttert, daß er wirklich mitgenommen war. Brody, sein Verleger, hatte für alles ein verbindliches Grinsen, das mißfiel mir sehr. Nichts war mit ihm passiert, vielleicht hatte er sich über die wütende Attacke auf Bürgerlichkeit geärgert, mochte sich das nicht anmerken lassen und verbarg es hinter Verbindlichkeit. Vielleicht war er aber immer so, vielleicht war er gar nicht zu erschüttern – was ihn wirklich mit Broch verband, denn er war zweifellos mit ihm befreundet, das vermag ich nicht zu sagen.
Die beiden blieben nicht lang, sie wurden schon wieder irgendwo erwartet. Broch, obschon er mitsamt seinem Verleger angerückt war, was als eine Art von Selbstbewußtsein wirkte, erschien mir am Ende der ›Hochzeit‹ als gebrechlich. Es war eine sehr schöne Gebrechlichkeit, nämlich eine, die von Ereignissen, Beziehungen, Schwankungen unter Menschen abhing, Empfindlichkeit war ihre Voraussetzung. Den meisten wird es als Schwäche erschienen sein, ich darf es so nennen, weil ich eine Schwäche dieses Bewußtseinsgrades als Vorzug, ja als Tugend empfinde. Wenn aber Menschen der kommerziellen Umwelt, in der er gelebt hatte, oder einer entsprechenden Daseinsform heute über ihn ›Schwäche‹ sagen, möchte ich ihnen auf den Mund schlagen.
Nicht leichten Herzens befasse ich mich mit Broch, denn ich weiß nicht, wie ich ihm gerecht werden soll. Da war die Erwartung, mit der ich an ihn herantrat, die stürmische Werbung von Anfang an, der er sich zu entziehen versuchte, die Blindheit, mit der ich alles an ihm gut finden wollte, die Schönheit seines Auges, in dem alles andere eher als Berechnung für mich zu lesen war: Was habe ich nicht erhaben gesehen bei ihm und wie naiv und unbedacht ließ ich mich auf eine besessene Art gehen, ohne meine immense Ignoranz zu verbergen! Denn wenn ich auch wirklich offen und wißbegierig war, Früchte hatte diese Wißbegier noch keine getragen. Ich hatte, wenn ich es heute zu bemessen versuche, noch wenig gelernt und jedenfalls nichts von dem, was sein besonderes Wissen ausmachte: die zeitgenössische Philosophie. Seine Bibliothek war hauptsächlich eine philosophische, er scheute im Gegensatz zu mir vor der Welt der Begriffe nicht zurück, er gab sich ihnen hin wie andere dem Besuch von Nachtlokalen.
Es war der erste ›Schwache‹, dem ich begegnet bin, es war ihm nicht um Siegen und nicht um Überwinden und schon gar nicht um Prahlen zu tun. Das Verkünden großer Absichten war ihm in tiefster Seele zuwider, während bei mir jeder zweite Satz lautete: »Darüber schreibe ich ein Buch« – ich konnte keinen Gedanken, vielleicht keine Beobachtung aussprechen, ohne gleich zu sagen: »Darüber schreibe ich ein Buch.« Nun war das aber nicht ganz leere Prahlerei, denn ein langes Buch ›Kant fängt Feuer‹ hatte ich geschrieben, es bestand im Manuskript, wenige wußten davon, und ein anderes, das mir viel wichtiger war, über Masse, hatte ich mir zum Lebenswerk bestimmt, davon gab es nicht viel mehr als Erlebnisse, die aber sehr tief reichten, und eine ausgebreitete, gierige Lektüre, von der ich dachte, daß sie mit ›Masse‹ zusammenhing – aber eigentlich bezog sie sich auf ›alles‹ nicht weniger als auf Masse. Mein Leben war auf ein großes Werk abgestellt, ich nahm es so ernst, daß ich ohne zu zögern zu sagen imstande war: »Das wird aber Jahrzehnte dauern.« Daß ich alles in meine Absichten und Pläne einbeziehen wollte, dieses Umfassend-Unerschöpfliche mußte er als Leidenschaft und als echt empfinden. Was ihn abstieß, war eine grausam-zelotische Art, die Besserung der Menschen von einer Züchtigung abhängig zu machen, zu deren ausführendem Organ ich mich ohne weiteres eingesetzt hatte. Das hatte ich von Karl Kraus gelernt, den ich bewußt nie nachzuahmen gewagt hätte, von dem aber unendlich viel in mich eingegangen war und besonders, in der Zeit, da ich die ›Hochzeit‹ schrieb, im Winter 1931/32, sein Furor.
Mit diesem Furor, der durch die ›Hochzeit‹ zu meinem eigenen geworden war, hatte ich mich bei der Vorlesung des Stückes Broch präsentiert. Er war ihm erlegen, aber es war das einzige bei mir, dem er je erlag, was er sonst, wie sich zeigte, übernahm, geschah auf jene Art, die ich viel später, eigentlich erst nach seinem Tod begriff: Es war die Aneignung fremder Willensimpulse, deren er sich anders nicht erwehren konnte.
Broch gab immer nach, er nahm nur auf, indem er nachgab. Das war kein komplizierter Prozeß, das war seine Natur, und ich glaube, es war eine richtige Erkenntnis von mir, das auch mit der Art seines Atems in Verbindung zu bringen. Doch gab es unter unzähligen Dingen, die er aufnahm, manchmal welche, die zu gewalttätig waren, um sich ruhig aufbewahren zu lassen. Solche störenden Dinge, die er als peinliche Stöße empfand und moralisch mißbilligte, wurden dann, sei es bald, sei es später, zu seinen eigenen Initiativen. Als er später ein Emigrant in Amerika war und sich zur Befassung mit Massenpsychologie entschloß, hatte er sicher unsere Gespräche darüber nicht vergessen. Doch hatte ihn der Inhalt dessen, was ich sagte, die eigentliche Substanz, in keiner Weise berührt. Die Unwissenheit des Sprechenden, dessen Worte von keiner der herrschenden philosophischen Terminologien gefärbt waren, ließ ihn den Gehalt des Gesagten völlig übersehen, auch wenn es seine Eigenart hatte. Es war die Kraft der Absicht, was ihn traf, der Anspruch auf eine neue Lehre, die einmal dastehen würde, und obschon sie – außer in kümmerlichen Ansätzen – noch gar nicht bestand, empfand er diese Absicht als Befehl und ließ diesen Befehl, als wäre er an ihn gerichtet, in sich nachwirken. Wenn ich in seiner Gegenwart von dem zu sprechen begann, was ich vorhatte, hörte er daraus: »Tu du's!«, wußte aber nicht gleich, wie sehr er es unter Zwang gehört hatte, und verließ mich mit dem Keim zu einem Auftrag, der in einem neuen Milieu später aufblühte, aber keine Früchte trug.
Ich nehme gleich viel vorweg und verwirre so die klare Linie unserer Beziehung, die ja auch entstand, aber es ist jetzt, nach allen Jahrzehnten notwendig, daß ich ebenso sehe, was damals schon am Anfang wirklich zwischen uns geschah, ohne daß es einer von uns wußte, auch er nicht.
Auf seinen eiligen Gängen kam Broch nicht selten zu uns in die Ferdinandstraße. Ich sah ihn als einen großen, schönen Vogel, aber mit gestutzten Flügeln. Er schien sich einer Zeit zu entsinnen, da er noch fliegen konnte. Er hatte nie verwunden, was mit ihm geschehen war. Ich hätte ihn gern darüber befragt, aber ich wagte es damals noch nicht. Seine stockende Art täuschte, vielleicht sprach er gar nicht ungern über sich. Aber er überlegte, bevor er sprach, flüssige Geständnisse wie bei den meisten Menschen, die ich in Wien kannte, waren von ihm nicht zu erwarten. Geschont hätte er sich nicht, er neigte dazu, sich zu verklagen, von Selbstzufriedenheit hatte er keine Spur, er gab sich unsicher, aber es war, so schien mir, eine erworbene Unsicherheit. Meine bestimmte Art zu sprechen irritierte ihn, doch war er zu menschenfreundlich, es zu zeigen. Ich merkte es aber, und wenn er gegangen war, blieb ich beschämt zurück. Ich machte mir Vorwürfe, weil er mich nicht mochte, so kam es mir vor. Er hätte mich gern zum Selbstzweifler gemacht, vielleicht wollte er mich vorsichtig dazu erziehen, aber das gelang ihm gar nicht. Ich stellte ihn sehr hoch, von den ›Schlafwandlern‹ war ich eingenommen, weil er darin das vermochte, wozu ich unfähig war. Das Atmosphärische in der Literatur hatte mich nie interessiert, ich hatte es als Sache der Malerei empfunden. Aber nun war es bei Broch auf eine Weise da, die einen dafür empfindlich machte. Ich bewunderte es, weil ich alles bewunderte, was mir versagt war. Es machte mich nicht irre an dem, was ich selber vorhatte, aber es war wunderbar zu sehen, daß es ganz anderes gab, das sein eigenes Recht hatte und einen im Lesen von einem selber befreite. Solche Verwandlungen im Lesen sind für einen Dichter unentbehrlich. Er findet wirklich nur zu sich zurück, wenn er sehr stark von anderen weggezogen wurde.
Broch brachte jedes neue Stück Prosa, das von ihm herauskam, gleich in die Ferdinandstraße. Besonders wichtig war ihm, was in der ›Frankfurter‹ und in der ›Neuen Rundschau‹ erschien. Es wäre mir nicht eingefallen zu denken, daß mein Urteil für ihn von Bedeutung war. Wie sehr er Zustimmung brauchte, habe ich erst später begriffen, als einige Jahre nach seinem Tod seine Briefe veröffentlicht wurden. Sosehr ihn meine behauptende Art des Sprechens irritierte, die Entschiedenheit eines Urteils, wenn es ihn betraf, holte er sich gern und zitierte es sogar in Briefen an andere.
Für Brochs eilige Gänge hatte ich damals eine beinah mythische Deutung: Er, der große Vogel kam, nie darüber hinweg, daß ihm die Flügel gestutzt worden waren. Bis in die Freiheit der einen Atmosphäre über allen Menschen konnte er nicht mehr entschweben. Aber er holte sich statt dessen jeden vereinzelten Atemraum unter Leuten. Andere Dichter sammelten Menschen, er sammelte die Atemräume um sie, die die Luft enthielten, die in ihren Lungen gewesen war und die sie dann ausgestoßen hatten. Aus dieser bewahrten Luft schloß er auf ihre Eigenart, er charakterisierte Menschen durch die ihnen zugehörigen Atemräume. Das schien mir etwas vollkommen Neues, das mir noch nie begegnet war. Ich wußte von Dichtern, die vom Visuellen, und solchen, die vom Akustischen bestimmt waren. Daß es einen geben könnte, der sich durch die Art seines Atems bestimmen ließe, wäre mir früher nicht eingefallen.
Er war sehr zurückhaltend und wirkte, wie ich schon sagte, unsicher. Worauf immer sein Blick fiel – er zog alles in sich, aber der Rhythmus dieses Einziehens war nicht der des Schlingens, sondern der des Einatmens. Er stieß an nichts, alles blieb, wie es war, unveränderlich, und behielt seine besondere Aura von Luft. Er schien das Verschiedenartigste aufzunehmen, um es zu behüten. Heftigen Reden mißtraute er, und wie immer gutmeinend die Absicht, mit der sie sich ankündigten, er witterte Böses dahinter. Jenseits von Gut und Böse war für ihn nichts, und daß er sich sofort, vom ersten Satz an, zu einer verantwortlichen Haltung bekannte und sich nicht für sie schämte, nahm mich für ihn ein. Sie verriet sich auch in der Zurückhaltung seines Urteils, in dem, was ich schon früh sein ›Stocken‹ nannte.
Ich erklärte mir sein ›Stocken‹ – nämlich daß er lange nichts sagte, obschon ihm anzumerken war, wieviel er sich dachte – damit, daß er niemand bedrängen wollte. Es war ihm peinlich, auf seinen Vorteil bedacht zu sein. Ich wußte, daß er einer Industriellen-Familie entstammte, sein Vater hatte die Spinnerei in Teesdorf besessen. Broch, der eigentlich Mathematiker werden wollte, hatte in dieser Spinnerei gearbeitet, gegen seinen Willen. Als sein Vater starb, mußte er sie ganz übernehmen, nicht um seinetwillen, sondern weil es eine Mutter und andere Familienmitglieder zu versorgen gab. Aus einer Art von Trotz studierte er, er studierte spät noch Philosophie, und als ich ihn kennenlernte, ging er ins Philosophische Seminar der Wiener Universität und sprach davon wie von etwas sehr Ernstem. Ich witterte bei ihm ein ähnliches Verhältnis zur kommerziellen Herkunft wie das meine: eine tiefe Abneigung nämlich, die nach jedem Mittel griff, sich dagegen zur Wehr zu setzen. Da er sich so lange noch, als Erwachsener, als reifer Mann mit der väterlichen Fabrik abgeben mußte, brauchte er besonders starke Gegenmittel. In seinen Neigungen hielt er sich an strenge Wissenschaften und verschmähte es nicht, sie in ihrer akademischen Form auf sich wirken zu lassen. Ich stellte ihn mir als Studenten vor, diesen Mann von reich belebtem Geist. Wenn er so weise war, daß er unsicher blieb, wie fand er Sicherheit in Seminaren? Es war ihm um Zwiesprache zu tun, aber er verhielt sich so, als ob er immer der Lernende wäre, und da ich annahm, daß er es in den häufigsten Umständen gar nicht sein konnte, denn es sprang in die Augen, daß er mehr wissen müsse als die Gesprächspartner, dachte ich, es sei seine Herzensgüte, die ihn davon abhalte, irgendwen zu beschämen.
Im Café Museum lernte ich Ea von Allesch kennen, die die Freundin Brochs war. Ich hatte ihn allein woanders getroffen. Er sei mit Ea verabredet und habe versprochen, mich mitzubringen. Er schien mir nicht ganz frei, er sprach anders als sonst, und er hatte sich stark verspätet. »Sie wartet schon lange auf uns«, sagte er und ging rascher, zum Schluß war es beinahe, als flöge er durch die Drehtüre und zöge mich dabei mit sich ins Lokal hinein. »Wir haben uns verspätet«, sagte er gleich, beinahe devot, bevor er mich noch vorstellte, nannte meinen Namen und fügte in einem sachlichen Ton, der keine Besorgnis mehr verriet, »und das ist Ea Allesch« hinzu.
Ich hatte ihren Namen früher ein paarmal von ihm gehört und hatte beide Teile, das ›Allesch‹ und schon gar das ›Ea‹ merkwürdig, ja rätselhaft gefunden. Ich hatte ihn nicht gefragt, woher dieses ›Ea‹ komme, habe es auch später nie wissen wollen. Sie mochte in ihren Fünfzigern sein, sie war nicht jung, sie hatte den Kopf eines Luchses, aber aus Samt, mit rötlichen Haaren. Sie war schön, und ich dachte etwas bestürzt, wie schön sie erst gewesen sein müsse. Sie sprach leise und sanft, aber doch so eindringlich, daß man sich gleich ein wenig vor ihr fürchtete. Es war, als hätte sie, ohne es zu merken, ihre Krallen in einen geschlagen. Diesen Eindruck hatte man aber nur, weil sie Broch widersprach. Nicht einen einzigen seiner Sätze ließ sie gelten. Sie fragte, wo wir uns verspätet hätten, sie hätte gedacht, wir kämen nicht mehr, seit einer Stunde sitze sie da. Broch erklärte ihr, wo wir gewesen waren. Aber obwohl er mich dabei einbezog, als sei ich dazu da, es zu bezeugen, hörte sie sich's so an, als glaube sie ihm kein Wort. Sie machte keinen Einwand, aber es stimmte ihr nicht, und sie kam, wir saßen schon längst, darauf zurück, durch einen Satz, in dem ihr Zweifel verarbeitet war, als sei er bereits Geschichte geworden und als wolle sie nur merken lassen, daß sie ihn zu allen übrigen Zweifeln dazulege.
Es entspann sich ein literarisches Gespräch. Broch wollte von unserem Fehltritt ablenken und erinnerte daran, daß er gleich nach der Vorlesung der ›Hochzeit‹ zu ihr in die Peregringasse gekommen sei und wie er damals zu ihr darüber gesprochen habe. Es war, als bitte er sie damit, mich ernst zu nehmen; und sie bestritt auch nicht, was bei dieser Gelegenheit geschehen war, wendete es aber gleich gegen ihn. Er sei ganz zerdrückt gewesen und habe darüber geklagt, daß er gar kein Dramatiker sei, wozu habe er nur ein Stück geschrieben, er hätte es am liebsten vom Züricher Theater, wo es lag, zurückgezogen. Seit einiger Zeit bilde sich der Broch nämlich ein, daß er schreiben müsse. Wer ihm das nur eingeredet habe, eine Frau wahrscheinlich. Es tönte sehr sanft, beinah einschmeichelnd, aber es war niemand da, in den sie sich einschmeicheln wollte, und es war vernichtend. Denn sie fügte hinzu, sie habe ihm schon aus der Schrift gesagt, daß er kein Schriftsteller sei, sie sei nämlich Graphologin und es genüge, seine Schrift mit der von Musil zu vergleichen, um zu wissen, daß der Broch kein Schriftsteller sei.
Mir war das so peinlich, daß ich schleunig die Ablenkung auf Musil nutzte und sie fragte, ob sie ihn kenne. Den kenne sie seit Jahrzehnten, aus der Allesch-Zeit, noch früher sogar, länger als Broch. Der sei ein Schriftsteller, ihr Ton war ganz verändert, als sie das sagte, und als sie gar hinzufügte, daß Musil nicht so viel von Freud halte und sich nicht leicht verführen lasse, begriff ich, daß ihre Animosität gegen alles ging, was für Broch zählte, während Musil für sie intakt bestand. Sie hatte ihn in der Zeit ihrer Ehe mit Allesch, der Musils ältester Freund war, oft gesehen und sah ihn auch jetzt noch manchmal, lange nach der Trennung jener Ehe. Es bedeutete ihr etwas, daß sie Graphologin war, und sie hatte auch ihre Position in der Psychologie. »Ich bin Adler«, sagte sie und zeigte auf sich, »er ist Freud« und zeigte auf Broch. Dieser war Freud wirklich verfallen, auf religiöse Weise, möchte ich sagen – ich meine damit nicht, daß er ein Zelot geworden war, wie so viele andere, die ich damals kannte, sondern er war von Freud durchdrungen wie von einer mystischen Lehre.
Es gehörte zu Broch, daß er seine Schwierigkeiten nicht verbarg. Er präsentierte sich nicht als Fassade. Ich weiß nicht, warum er mich so früh schon mit Ea zusammenbrachte. Daß sie ihn vor anderen nicht auszeichnete, war ihm immer bewußt. Vielleicht wollte er ihrer schroffen Ablehnung seines Schreibens meine Verehrung dafür entgegensetzen, was ich aber damals nicht begriff. Erst allmählich erfuhr ich, daß Broch als Mäzen gegolten hatte: ein Industrieller, dem geistige Dinge mehr bedeuteten als seine Fabrik und der für Künstler immer etwas übrig hatte. Seine Noblesse hatte er behalten, aber es war bald zu spüren, daß er kein reicher Mann mehr war. Er klagte nicht über seine Not, wohl aber über Zeitmangel. Jeder, der ihn kannte, hätte ihn gern oft gesehen.
Er brachte es dazu, daß man über sich sprach, in Rage geriet und nicht mehr aufhören mochte. Man hielt das für ein besonderes Interesse an der Person, die man war, die Absichten und Pläne, die man hatte, die großen Entwürfe. Man sagte sich nicht, daß dieses Interesse jeder Person galt, obwohl man das aus den ›Schlafwandlern‹ wohl erfaßt haben könnte. In Wirklichkeit war es seine Art des Zuhörens, der man verfiel. Man breitete sich in seiner Stille aus, nirgends stieß man auf Hindernisse. Man hätte alles sagen können, er wies nichts zurück, Scheu empfand man nur, solange man etwas nicht ganz und gar gesagt hatte. Während man sonst in solchen Gesprächen an eine Stelle gelangt, wo man sich mit einem plötzlichen Ruck ›Halt!‹ sagt, ›Bis hierher und nicht weiter!‹, da die Preisgabe, die man sich gewünscht hat, gefährlich wird – denn wie findet man wieder zurück zu sich, und wie soll man danach wieder allein sein? –, gab es diesen Ort und diesen Augenblick bei Broch nie, nichts rief Halt, nirgends stieß man auf Warntafeln oder Markierungen, man stolperte weiter, rascher, und war wie betrunken. Es ist überwältigend zu erleben, wieviel man über sich zu sagen hat, je weiter man sich wagt und verliert, um so mehr fließt nach, von unter der Erde springen die heißen Quellen auf, man ist eine Landschaft von Geysiren.
Nun war mir diese Art von Ausbrüchen nicht unbekannt, ich hatte sie von anderen erlebt, die zu mir sprachen. Der Unterschied lag darin, daß ich auf andere zu reagieren pflegte: Ich mußte etwas darauf sagen, ich konnte nicht schweigen, und in dem, was ich sagte, bezog ich Stellung, urteilte, riet, ließ Anziehung oder Ablehnung spüren. Broch, in dieser Situation, ganz im Gegensatz dazu, schwieg. Es war kein kaltes oder machtgieriges Schweigen, wie es von der Analyse her bekannt ist, wo es darum geht, daß ein Mensch sich rettungslos einem anderen ausliefert, der sich kein Gefühl für oder gegen ihn erlauben darf. Brochs Zuhören war von kleinen, vernehmlichen Atemstößen unterbrochen, die einem bezeugten, daß man nicht nur gehört, daß man aufgenommen worden war, so als wäre man mit jedem Satz, den man sagte, in ein Haus getreten und lasse sich da umständlich nieder. Die kleinen Atemlaute waren die Honneurs, die einem der Gastgeber erwies: ›Wer immer du bist, was immer du sagst, tritt ein, du bist mein Gast, bleib, solange du willst, komm wieder, bleib immer!‹ Die kleinen Atemlaute waren ein Minimum an Reaktion, voll ausgebildete Worte und Sätze hätten ein Urteil bedeutet und wären einer Stellungnahme gleichgekommen, bevor man sich noch ganz mit allem, was man mit sich herumschleppt, ins gastliche Haus eingebracht hatte. Der Blick des Gastgebers war immer auf einen selbst und zugleich auf das Innere der Räume gerichtet, in die er einen einlud. Obwohl sein Kopf dem eines großen Vogels glich, war sein Auge nie auf Greifen, auf Erbeuten aus. Der Blick ging in eine Ferne, die das Nahe des Gegenübers meistens mitenthielt, und was im Blickenden zuinnerst war, lag in ein und derselben Nähe und Ferne.
Es war eine geheimnisvolle Aufnahme, die er einem gewährte, um derentwillen man Broch verfiel, und ich kannte damals keinen Menschen, der nicht süchtig danach wurde. Diese Aufnahme hatte keine ›Vorzeichen‹, keine Bewertung, bei Frauen wurde sie zu Liebe.
Beginn eines Gegensatzes
Im Laufe der fünfeinhalb Jahre, die Broch in meinem Leben präsent war, ist mir allmählich nur eingegangen, was heute, da es um eine einschneidende Bedrohung allen Lebens geht, als selbstverständlich gilt: die Nacktheit des Atems. Der eigentliche Sinn, der Hauptsinn, durch den Broch die Welt um sich aufnahm, war der Atem. Wenn andere immerzu sehen oder hören müssen, nie zu Ende kommen damit und nur nachts, auf den Schlaf zurückgezogen, sich davon ausruhen, war Broch seinem Atem unaufhörlich ausgeliefert, den er nicht abstellen konnte und durch gerade noch vernehmliche knurrende Laute, die ich seine Atem-Interpunktion genannt habe, zu gliedern versuchte. Ich begriff bald, daß er niemanden abzuschütteln vermochte. Ich habe nie ein Nein von ihm gehört. Es war ihm leichter, ein Nein zu schreiben, wenn der, dem es galt, nicht vor ihm saß und ihm nicht seinen Atem sandte.
Auf der Straße hätte ein Fremder ihn ansprechen und beim Ellbogen fassen können, er wäre ihm ohne Widerstand gefolgt. Ich hatte das nicht erlebt, aber ich stellte mir's vor und fragte mich, wohin