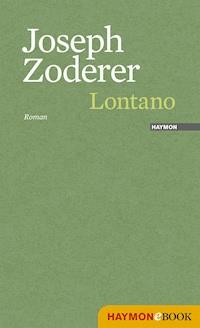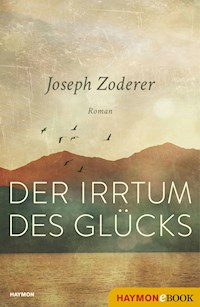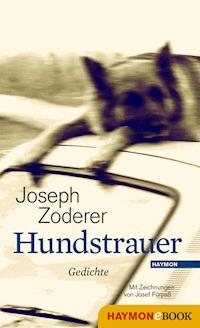Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein 12-jähriger Junge tritt eine schicksalhafte Reise in die streng religiöse Welt eines Schweizer Internats an. Abgeschirmt von der Außenwelt, werden ihm Gehorsam und Schweigsamkeit allmählich zur Ersatzheimat – bis ihn die Begegnung mit einem Mädchen dazu bringt, die heilige Regel des Schweigens zu brechen ... Joseph Zoderer erzählt eine berührende Geschichte von Heimat und Heimatlosigkeit, von Lust und Leiden an der Unterwerfung, aber auch von Rebellion und Widerstand.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 199
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Joseph Zoderer
DasGlückbeimHändewaschen
Roman
HAYMONverlag
Innsbruck-Wien
www.haymonverlag.at
Originalausgabe: 1982 Carl Hanser Verlag, München-Wien
© Haymon Verlag, Innsbruck-Wien
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder in einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
ISBN 978-3-7099-3718-1
Umschlag- und Buchgestaltung:
Kurt Höretzeder, Büro für Grafische Gestaltung, Scheffau/Tirol
Satz: Haymon Verlag/Roland Kubanda
Coverfoto: www.gettyimages.com
Autorenfoto: Max Lautenschläger
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses Buch erhalten Sie auch in gedruckter Form mit hochwertiger Ausstattung in Ihrer Buchhandlung oder direkt unter www.haymonverlag.at.
Joseph Zoderer
Das Glück beim Händewaschen
Auf der letzten Station vor der Schweizer Grenze sah ich das Gesicht meines Bruders zwischen zwei Waggons verschwinden. Ich fuhr allein in das Land, wo Milch und Honig fließen. Neben mir saß ein Fremder in weißer Kutte.
Später hockte ich in der Leere eines langgezogenen Raumes an einem langen Tisch am Ende einer langen Bank. Der Fremde zeigte mir das Viereck in der Wand. Man konnte in diesem Viereck eine Falltüre hochschieben und in die Küche sehen, in Abständen kam darin eine Hand zum Vorschein und reichte verschiedene Schüsseln. Zuhause waren die Lebensmittel noch rationiert.
Durch dunkle Gangschluchten über enge Treppen wurde ich in einen Saal mit Holzwänden geführt. Inmitten von unzähligen Stahlrohrbetten stand das für mich bestimmte Stahlrohrbett. Ich hörte das Klicken des Schalters, als das Licht ausging. Es war ein großer Saal, in dem ich einschlief, auf die Seite gedreht, bis ich das Trampeln von Füßen hörte und ein grelles, fremdes Licht mich in die Mitte warf, auf einen Seziertisch für neugierige Blicke. Ich versuchte mich vor diesem Licht zu verbergen, indem ich mich schlafend stellte. Nie zuvor, erzählten mir Albisser und auch Leisibach später, hätten sie derart lange schwarze Haarzotteln gesehen. Der Haarwust hätte das weiße Kissen ganz und gar überschwemmt.
Der jähe Schrecken, der mich am nächsten Morgen die Decken zurückschlagen ließ wie bei einem Bombenalarm, dieser Schrecken würde sich täglich um fünf Uhr früh wiederholen, im Sommer wie im Winter, wenn die Klingel schrillte und fast gleichzeitig eine Stimme die Worte zerhackte: »Ehre sei Gott in der Höhe.«
Aus den Betten rings um mich herum klatschten Füße auf den Boden. Ein Maschinengewehr antwortete: »Und Deinem Geiste.« Alles in Latein.
Auch ich stand neben dem Bett, in Hemd und Unterhose. Die anderen schlüpften aus einem Pyjama in Unterhose, Socken, Unterhemd und Hose. Mit Unterhemd und Hose liefen sie weg und verschwanden. Niemand sprach mit mir, überhaupt sagte keiner etwas. Ich zog die Hose an, eine Kniehose, die wie meine Jakke braun, senfbraun war, zusammengeschneidert aus einer Tommy-Decke.
Ich lief dem Strom nach, tat so als ob ich es eilig hätte. Am Ende des Schlafsaals stieß ich rechter Hand auf den Waschraum. Ich wurde geschubst, absichtlich unabsichtlich gerempelt. Alles geschah so wortlos, und ich war froh, daß ich nichts sagen mußte. Ich sah das Gesicht meines Bruders zwischen zwei Eisenbahnwaggons, meine erst gestern verlassenen Nester: das zerbombte Haus neben der Kohlenhandlung, den Hinterhof mit Durchgang, den Hasenstall neben dem Mechaniker, die Bretterwand, hinter der man den Kanal hörte, Mutter, wie sie in der Küche Wäsche kocht, und den Hilmteich mit den Booten.
Ich wurde zu einem Waschbecken hingeschoben, das ich und kein anderer würde benützen dürfen. Ich versuchte, das nasse Gesicht mit den Händen zu trocknen, in Wirklichkeit verbarg ich es, während ich zu meinem Bett zurückging, um dort mein Handtuch auszupacken. Und dann hatte ich keine Zahnbürste.
Schlangestehen hinter der Schlafsaaltür. Genaues Einreihen in die Kolonne. Ich wurde nach hinten gezogen. Gesichter, filmartig, fremde Nasen, fremde Ausdrucksmünder, fremde Ausdruckswangen. Die Augen gehen in den Wangen und Nasenflügeln unter.
Abmarsch über die Stiegen von einem Stock in den unteren, drei Stockwerke bis ins Parterre. Mit dem ganzen Rudel in einen Raum, vollgestellt mit Bänken zum Knien und zum Sitzen. Und vorn in Briefanrededistanz der Altar, mit nur einer Stufe. Tischtuch, Tabernakel, der kleine Schlafsaal Gottes, sein Boudoir. Die Messe am ersten Morgen.
Zur Kommunion leerten sich die Bänke wie Gedärme. Allmählich und doch zu jäh war ich der einzige Körper zwischen den Sitz- und Kniegestellen. Ich hatte kaum Zeit zum Überlegen. Alles um mich herum war tiefer Ernst. Mit gefalteten Händen, mit vor sich hingetragenen gefalteten Händen oder mit an die Brust gedrückten gefalteten Händen, mit gesenktem Kopf oder mit steil aufgerichteter Stirn, mit geschlossenen oder offenen, aber verschleierten Augen, oder mit offenen, aber abweisenden Augen, mit auf den Boden oder ins Leere stierendem Blick sah ich sie nach vorn gehen und zurückkehren, nach vorn gehen, stehen, niederknien, Mund aufsperren, Oblate, lieber Gott, Oblatenteig, Papier, zerrinnendes Teigpapier, Gottes Schluckabtod. Sie schoben sich aneinander, durcheinander nach vorn, vorbei, zurück, es war ein leises Drängeln um das Brot Gottes, um das unblutige Blutvergießen Gottes. Nur ich blieb zurück.
Ich hatte noch alle Sünden, ich mußte erst noch beichten. Ich hätte statt Sünde auch Notsünde sagen können, Notwehr, ich mußte Gott in Notwehr verzehren.
Aber ich war eingeschüchtert von der Wortlosigkeit, von der Ruhe, von der Sauberkeit, die mich so selbstverständlich verschluckt hatten. Ich wollte mich anständig benehmen. Ich konnte Gott nicht vom fremden Tisch wegessen, ohne zu wissen, ob das gestattet war.
Die zurückkehrenden Blicke, ich spürte, wie mich die Blicke der komischen, weil so ungewohnt gutgekleideten Figuren bei der Rückkehr, beim Wiederauffüllen der Bänke streiften. Am nächsten Morgen schob auch ich mich mit allen meinen Knie- und Sitznachbarn aus der Bank und stellte mich in die Reihe und streckte die Zunge heraus und spürte Finger und Papierleib Gottes zugleich, kehrte, auf den Boden glotzend und seitwärts und manchmal nach vorn blinzelnd, in meine Bank zurück. Nichts denkend, als daß die Oblate sich auf dem Weg bis zur Bank auf der Zunge auflöste, und, wenn Gott die Oblate war, Gott jetzt mit Händen und Füßen und Haar und Haut durch meine Gurgel in den Dünndarm und weiter abrutschen und zu riechen anfangen würde. Aber das dachte ich mir in der allgemeinen Gottesfurcht zuallerletzt.
Im selben Sommer, bevor ich durchs Land zur Grenze gefahren war, hatte ich mich im einzigen Schlafzimmer der elterlichen Wohnung verirrt. Dort, wo in einer Ecke mein Bruder und gegenüber meine ältere Schwester und ich mit meiner jüngsten Schwester nachts im großen Ehebett schliefen, dort verirrte ich mich, weil Nachmittag war, ins Bett unserer zwangszugeteilten »Ausgebombten« und Untermieterin. Vielleicht weil es Nachmittag war, schlief Mary nicht, sondern tat, als lese sie. Und ich kroch zu ihr unter die Decke und klappte ein Buch auf. Ich lehnte das Buch mit dem oberen Rand leicht an ihren Rücken, und sie stützte sich auf ihrem rechten Ellenbogen auf und lag seitwärts mit dem Rücken zu mir und dem Gesicht zur Wand. Sie trug ein aalglattes Negligé, das knisterte, wenn ich den Atem anhielt.
Im selben Sommer, in einer der letzten Wochen, bevor ich abreisen sollte, lief ich am Flußufer entlang neben Mary her. Möglicherweise machten wir eine lange Abkürzung durch die Stadt, und vielleicht am anderen Ende mußte sie Dokumente besorgen. Ich schaute auf die Brennesseln, die in dichten Büschen auf der Uferböschung wuchsen, sah die weißgrauen Ufersteine, die vom Wasser angespült wurden. Mary erzählte, nur in Andeutungen, von ihren Erfahrungen mit den Tommys, erzählte auf eine Art, daß ich nicht an Besatzungssoldaten, sondern an Krimihelden denken mußte. Sie ließ sich breit aus, wenn sie von ihrer Kleinen sprach oder einfach von sich. Wie das vor sich gegangen sei: sie noch ein Pflasterstein, dann der Schrei, der in ihr einen Sprung, einen riesigen Sprung quer durch sie hindurch verursacht hätte. Auf einmal hätte sie diesen Stoß rasend gespürt und ihn gewollt und noch einmal gewollt: und wie ein Pflasterstein sei sie zersprungen. Und dann hätte sich alles noch einmal in einem qualvollen Blutbad wiederholt. Mir schien, daß ihr die Leute die Gedärme zwischen den Schenkeln aus dem Bauch gerissen hatten, und daß sie geschrien haben mußte, bis sie nicht mehr konnte. Das zweitemal sei alles ohne großes Tamtam gegangen. Wie ein Geschwür hätten sie das Tote aus ihr herausgezogen, mit einer einzigen Hand.
Die Einzelheiten des ersten Tages im Hause der Regel glichen den meisten Einzelheiten der darauffolgenden Tage, den Einzelheiten von eintausendfünfhundert Tagen, in ein Gemeinsames zusammengeronnen, eine graue Wasserfläche, aus der einige Eisspitzen ragten, schön und kalt. Alles woran ich mich erinnere, ist kalt, auch wenn einiges schön war, woran ich mich erinnere.
Ich hob meine Füße über die Treppen, eingezwängt in der Schar der anderen, die wie ich die Füße über die Treppen hoben und schwiegen, so wie ich schwieg. Die Gangschluchten verschluckten mich, wie die anderen. Es waren nicht meine Wände, auch wenn sie aus Holz waren. Die anderen taten, als ob ich ihr Besitz wäre, sie schleppten mich mit. Im Speisesaal waren die Wände nicht aus Holz. Weißverkalkte Mauern.
Man war freundlich zu mir, neugierig freundlich. Konnte ich boxen, war ich Einhundert-Meter-Läufer, war ich eine Nummer am Barren? Ich war kleiner als der Kleinste und ich hatte lange Haare. Auch war ich der einzige Ausländer. Ich mußte anders riechen. Zumindest redete ich ein anderes Deutsch. Ein lächerliches Schriftdeutsch. Ihr raffiniertes Schwyzerdütsch gefiel mir. Es war, als würden mich Baumstämme streicheln.
Aber im Refektorium schwiegen sie. Mir war es recht. Ich hatte nichts, was ich erzählen wollte. Im Gang schwiegen sie weiter. Und als wir im Keller rund um einen Tisch standen, auf den einer Erdäpfel schüttete, schwiegen sie auch, nur einer las aus einem Buch vor. Auch das war mir recht. Ich bekam einen Erdäpfelschäler. Mein Koffer war noch nicht ausgepackt, aber ich schälte Erdäpfel für das Mittagessen. Wie immer die ersten Fragen und Antworten gewesen sein mögen, in der Klasse, in der Pause, nach dem Mittagessen oder auf einem Klosett, ich erinnere mich an nichts so deutlich wie an die Frage: Bischn Öschtriecher?
Mein zweiblättriger Paß war ein Staatenlosen-Paß für Minderjährige. Ich kam aus Hitlers Reich, ich kam aus dem Land der Nazis, ich kam aus dem Land mit dem neuen Namen, das wußte ich, natürlich war ich ein Öschtriecher. Und wer das nicht kapieren wollte, dem wamste ich eins aufs Maul. Ich verstand weder zu decken noch eine Kinnspitze zu treffen, aber ich galt von den ersten Stunden an als der Boxer. Das war das einzige, was mich über sie und ihren Tell erhob.
Und so erfuhr ich, daß Tell es den Österreichern gezeigt hatte. Ich hörte zum erstenmal diesen Namen: Tell. Was mich störte, war, daß ich sechshundert oder siebenhundert Jahre später für einen österreichischen Landvogt namens Geßler als Watschenmann herhalten mußte. Das war mein einziger Ansatzpunkt zur Kritik, sonst hatte ich weder am Maulhalten noch am Kuschen noch an der Neutralität der Schweiz etwas auszusetzen. Auf die Nerven ging mir einzig und allein, daß ich die einsame Minderheit auf weiter Flur war.
Während ich mit geweiteten Augen oder mit dumpfem Hirn und verkniffenem Mund durch die Gänge und Stiegenhäuser mittrottete, polterte und mitschlappte, erhielt ich schnelle Geschichtsnachhilfe. Jahre bevor ich begriff, wer der gestiefelte Schnäuzchenträger war, der im offenen Wagen, die rechte Hand am rechten Ohr hochgestreckt, vor unserer Mietskaserne in der Hitlerstraße, der späteren und vorherigen Annenstraße, vorbeifuhr und dem ich mit einem Papierfähnchen zugewinkt hatte; noch vor dem Bewußtwerden, welches Land das war, aus dem ich kam, und was die Bombensplitter, die ich wie Abzeichen mit meiner Schwester gesammelt hatte, und was die über unseren Luftschutzkellern brummenden Tommys machten und wer die Russen waren, vor denen Mutter mit uns im offenen Viehwaggon in ein Tiroler Bergdorf geflüchtet war; und lange auch, bevor ich hörte, daß Andreas Hofer der Stolz eines aufrechten Tirolers sein sollte, wurden mir die Gefechtsorte der Schweizer Heldengeschichte wie eine eiserne Lunge angesetzt: Morgarten, Sempach und sogar Murten und Nancy wurden Sammelplätze meiner geschichtlichen Niederlage. Tell, Winkelried, die Selbstaufopferer, und Karl der Kühne, der edle Geschlagene, der den Schweizern erst die internationale Krone der Unbesiegbarkeit aufsetzte, später dann der Schlachtopfertod der Schweizer Garden am französischen und am päpstlichen Hof: diese Namen und Fakten erlitt ich als eigenes Versagen durch die Tatsache: ich war Öschtriecher und kein Schweizer. Und darin lag die unaufhebbare Tragik, denn ich konnte mich nicht noch einmal gebären lassen: diesmal in der Schweiz, um menschenwürdig zu werden.
Meine Regel-Kameraden wollten, daß ich für ihren Briefmarkenpatriotismus Hitler spielen sollte. Wir spielten alle kurz nach dem Krieg ehrbare Soldaten. Ich sollte auf jeden Fall verlieren, denn ich kam ja aus der Gegend. Aber ich hatte es über, die Nase voller Rotz zu lassen, mich nicht schneuzen zu dürfen, im Dreck zu rüsseln, damit die anderen die Sonntagshemden tragen durften. Sie wollten, daß ich schön Danke sage. Weil es Schokolade für neunzig Rappen und Präzisionsuhren um fünfzig Franken aufwärts gab.
Die Trostlosigkeit von zuhause begann mir erst jetzt zu dämmern. Allmählich kehrte ich die Werte um. Ich fing an, meine Herkunft zu verleugnen. Ich fing an, nicht davon zu sprechen oder alles lügnerisch zu verschönern. Ich schämte mich. Ich konnte mit nichts aufwarten. Ich hatte keine Werte, von denen mir bewußt gewesen wäre, daß ich ein Recht hatte, sie herzuzeigen. Aus der Finsternis geriet ich in noch größere Finsternis. Es begann die Zeit, in der ich mich im Zentrum der Wahrheit glaubte, nur weil ich aus keinem Fenster hinaussehen konnte.
Man schnitt mir die Haare. Ein älterer Schüler, der das konnte, besorgte es in seiner Handarbeitsstunde. Es war nichts Ungewöhnliches, es war nichts Böswilliges dabei. Es war eher eine Art Erlösung für mich, befreit zu werden von einem der Merkmale, die mich von dem Block der Schonhiergewesenen absonderten. Vielleicht wunderte ich mich im ersten Augenblick darüber, daß es entschieden, daß es überhaupt notwendig geworden war. Ich hatte mir ja niemals vorgenommen, die Haare wachsen zu lassen, die Haare wuchsen von selbst. Das war alles. Und damit war ich in der Annenstraße nie aufgefallen.
Hier schnitten sie meine Haare. Die Ohren standen im Wind. Mir fiel das nicht auf. Es kam nur auf das Innere an. Das sickerte allmählich auch in mein Gehirn. Bis es an die Schädeldecke stieß.
Ich bekam Kleidungsstücke. Schöne Hosen, wie ich sie nie vorher besessen hatte, Hosen bis über die Knie. Warum sie von anderen nicht mehr getragen wurden, fragte ich nicht. Man war großherzig. Die Hemden, die sie mir gaben, hingen mir immer lose um den Hals. Ich sagte Danke dafür, obwohl ich die Spender nicht kannte. Ich sagte auch Danke, obwohl man mir nicht sagte, ich müßte Danke sagen. Vielleicht sagte ich nicht einmal ausdrücklich Danke. Aber schon, daß ich die Hosen der anderen und die Hemden der anderen trug, war ein einziges Danke.
Innerhalb des Hauses durfte zu jeder Zeit nur mit ausdrücklicher Erlaubnis gesprochen werden. Die Regel war das Silentium: das Schweigen nach dem Erwachen, beim Frühturnen vor der Messe, im Studiersaal, beim Essen, beim Schuhputzen, beim Erdäpfelschälen, im Schlafsaal, bei zufälligen Einzelbegegnungen im Stiegenhaus oder im Korridor. Im Haus durfte ich nur sprechen, wenn ich von einem Vorgesetzten in der Klasse oder in dessen Zimmer gefragt wurde. Jedes andere Reden im Haus war verboten und schlug aufs Gewissen. Das Reden mit Gott und den Heiligen war immer erlaubt.
Gut, im Haus der Guten zu sein. Mit weißen geschenkten Unterhosen, einem rosaroten und einem blauen geschenkten Pyjama, einem Hemd, das zweimal in der Woche gewechselt wurde, Socken ohne Löcher. Kaum daß ich begonnen hatte, hörte ich auf, von zuhause zu erzählen.
Ich begann die Betäubung zu genießen, die das Auswendiglernen von Wörtern schafft. Mors gleich Tod. Mors mortis femininum. Die Hand auf mors gelegt. Was heißt mors? Mors ist der Tod. Dann die Hand auf Tod. Was heißt Tod? Tod ist mors. Mors mortis femininum. Die ganze Seite so herunter. Wenn die Glokke schrillte und wir von den Klappsitzen aufsprangen, war die Brust leichter. In der Klasse konnte es immer zwischen einem Lächeln und dem anderen Lächeln passieren, daß die Soutane sagte: Extempora. Das war eine Zwischendurchprüfung, die Stichprobe. Die Stichfragen schossen dem Lehrer aus dem Mund. Drei Fragen pro Minute. Zehn Worte gefragt, Schluß, Zettel einsammeln. Es gab kein Dahindösen.
Nur wenn ich den Pultdeckel hob, erlebte ich manchmal Eigenheimfreuden. Für Sekunden war es wichtig zu sehen, wie die Bücher gereiht standen, ob das Schreibzeug geordnet und wo der Zettel mit Notizen hineingesteckt war.
Der Ernst ringsum war ansteckend. Hie und da machte einer zur anderen Bank hinüber ein Zeichen oder hüstelte. Mit fortschreitender Zeit und bei passender Gelegenheit machte auch ich Zeichen oder hüstelte. Ich war eine Anpassungskanone.
Er sei ein gieriges Schwein und fresse für drei, hatte ich meinem Bruder in der Annenstraße gesagt. Wenn der Vater mich nie erwischte, bekam mich Hans wenigstens einmal zu fassen, und er trat in der Küche auf mir herum, bis Vater laut genug »genug« sagte. Trotzdem bestand ich darauf, daß ich meine Lebensmittelmarken selbst verwalten konnte. Schließlich hatte nicht ich Hans nach Rußland geschickt und auch den Lungenschuß hatte er nicht von mir bekommen.
Tatsächlich verwahrte ich vorübergehend meine Zucker-, Brot- und Mehlrationen im Nachtkästchen. Die Margarine lieferte ich ab, Mehl steuerte ich zweimal pro Woche bei.
Als ich mit Sigi den Bäckerladen betrat, sagte Sigi gleich: zwei Semmeln, und streckte die Marken vor. Die Verkäuferin drehte sich zur Wand und holte die zwei Semmeln. Inzwischen zog ich einen Wecken von der Budel und steckte ihn unter meinen Mantel. Mit meinem Kopf reichte ich nicht sehr weit über den Ladentisch, und als Sigi die Semmeln bezahlte, hatte ich mich schon zur Tür umgewandt.
In die Schweiz kam ich durch Zufall. Die Caritas verteilte Arbeiterkinder aufs Land. Beim Kirchweihfest machte ich die Bekanntschaft des Dorfkaplans. Einige Tage später lud er mich ein, seine Bücher auf der Stellage in Ordnung zu bringen. Den Likör lehnte ich ab. Warum, weiß ich nicht. Likör hätte mich interessieren müssen. Der Mann hatte während der letzten Kriegsjahre in der Ostschweiz studiert. Er versprach, einen Empfehlungsbrief für einen Freiplatz dorthin zu schicken. Inzwischen fuhren wir in die Obersteiermark, wo er mir seine Primizmutter zeigen wollte. Die Primizmutter war eine sehr unauffällige Frau. Sie brachte mich in einem Zimmer unter, wo ein Doppelbett mit Federpolster stand. Mitten in der Nacht, eigentlich mitten im Schlaf, wachte ich auf, weil Finger an meiner Unterhose herumnestelten. Zuerst erschrak ich. Dann wartete ich ab und zog schließlich die Unterhose bis zu den Kniekehlen herab. Aber es geschah nichts weiter. Später bekam ich einen Brief, in dem ein Satz stand, der mir ein Rätsel blieb: Auf der Reise in die Obersteiermark hast Du mich tief enttäuscht.
Der Brief jedenfalls, den er Monate zuvor ins Haus der Regel geschickt hatte, ebnete mir plötzlich den Übergang von rationiertem Hunger zu möglicher Sattheit.
Wir waren ein anständiges Haus.
Es war verboten, zu zweit Spaziergänge zu machen. Zwei, die zusammen auf die gleichen Gedanken kamen, waren eine Gefahr für die Gemeinschaft.
Zusammenrottung wurde gefördert. Spaltpilze wurden gefördert. Nur die Verschwörung zu zweit war verpönt. Ein Dritter wurde von der Regel vorgeschrieben: allein oder zumindest zu dritt. Die Wirkung war erprobt. Zu dritt zerstritt man sich leichter.
Da war Leisibach.
Leisibach war mittelgroß, behäbig und hatte Hängebacken. Er war ruhiger als die anderen, seine Behäbigkeit machte ihn noch ruhiger. Er war der Philosoph der Klasse. Sein feister Hintern bildete mit dem Rückgrat, das er kerzengerade wie eine Fahnenstange balancierte, fast einen rechten Winkel. Aber die Ruhe verlieh seiner Gangart soviel Gravität, daß seine Hosen aus solidem Stoff steil und mit scharfen Bügelfalten vom äußersten Punkt der Kugelwölbung auf die Schuhferse abfielen.
Leisibach war so alt wie ich, aber er wirkte auf mich ohne Alter oder eigentlich erwachsener als Erwachsene. Obwohl er sparsam zu lachen verstand. Gerade so, daß sich je ein Grübchen in der linken und in der rechten Hängewange bildete. Leisibach verkörperte Autorität. Schon weil er erwartungsgemäß lange zuhören konnte, bis man nicht mehr wußte, ob man jetzt blöd dran war. Im Haus der Regel hob ein Typ wie Leisibach entschieden das Niveau. Mit ihm ging ich gerne zu dritt. Dann war er kein Langweiler. Nur allein mit ihm hätte ich mich gelangweilt. Er ließ sich zwar nie etwas anmerken, aber ich glaube, ich habe Leisibachs Flanellpyjamas aufgetragen.
Leisibach bürgte für Anständigkeit. Er konnte auch Soutanen in Verlegenheit bringen. Bei einer banalen Frage sah er kuhäugig vor sich hin, ohne Antwort zu geben.
Es war schwer auszumachen, ob die Regel tatsächlich Freundschaften verhinderte oder ob nur für mich zufällig kein Freund da war. Eines war jedenfalls möglich: man konnte Feindschaften haben. Dies war nicht verboten, sondern nur Sünde und daher beichtbar. Man konnte sich mit dieser Versuchung auseinandersetzen. Besonders unsympathisch war mir in meiner Klasse Albisser.
Albisser kam aus dem Luzerner Gebiet, von einem Bergbauernhof, hatte einen Semmelkopf und Haare aus gelbem Draht. Mittelgroß, vielleicht einige Zentimeter größer, schien er eine Kreissäge im Bauch laufen zu haben. Er hatte jede Art von Schwierigkeiten, in der Schulbank zu sitzen. Aber in der Turnstunde, beim Fußballspielen, im Wald war er der Draufgänger, über seine Kräfte hinaus setzte er alles ein. Dabei konnte er hinterhältig und verschlagen sein. Regeln beachtete er nur, wenn jemand aufpaßte. Er trat einem gerne verstohlen gegen das Schienbein, klopfte dem Vordermann in der Klasse immer unerwartet mit der Linealkante auf die Schulter.
In den Fächern war Albisser nirgendwo untendurch, nirgendwo ganz obenan. Er hatte Ehrgeiz, ohne ihn beim Lernen zu übertreiben. Wenn ihm das Richtige nicht einfiel, bekam er einen roten Kopf. Er kämpfte bis zuletzt um die Möglichkeit eines Sieges.
Albisser war eigentlich ein Hauptgegner. In meiner Altersgruppe nahm ich ihn am wichtigsten. Zuviel an ihm war mir ähnlich. Er war stur, radikal und biegsam. Auch daß er es immer mehr oder minder so meinte, wie er es meinte.
Außerhalb unserer Naivität waren wir Fische auf dem Trockenen.
Mehr als andere wurde Albisser für mich der Schweizer. Alles übrige lernte ich im Geschichtsunterricht. Und so sah ich sein triumphierendes Gesicht, wenn er sich mir bei markanten Daten höhnisch zuwandte – besonders deutlich, wenn ich im Namen der österreichischen Sache dem morgensternbewehrten Heer entgegentreten mußte. Dabei wollte ich unbedingt auf die andere Seite übertreten. Aber das war Nichtschweizern nicht erlaubt. Noch schlimmer war, daß niemand meinem Heldentod zuschauen wollte.
Wahrscheinlich wäre ich auch in Abwesenheit Albissers nie ein Paradeturner geworden, doch allein daß Albisser wie ein Affe an Barren und Reck turnte, machte mir klar, daß ich nie so gut wie ein Affe sein würde. Es war aussichtslos, hier das Äußerste zu versuchen. Also wich ich auf andere Gebiete aus. Ich wäre gerne Schmetterlingsfänger geworden. Im Winter entwikkelte ich besondere Fähigkeiten zur Beobachtung der Eisblumen am Klassenfenster. Beim Spiel wurde ich fast immer als letzter in eine Mannschaft gewählt. Ein wenig pflegte ich auch mein Handikap.
Nachdem sie mir die Haare geschnitten hatten, und ich nun Hosen mit der Andeutung einer Bügelfalte trug, aufgeklärt war über Helden und Schlachtfelder des Landes, vor allem aber das Schweigen in den Gängen, im Stiegenhaus, im Keller, in der Sakristei und bei den Mahlzeiten einzuhalten selbstverständlich fand, auch mein Stahlrohrbett unter allen anderen gleichen Stahlrohrbetten zu unterscheiden gelernt hatte und es für mein Nest hielt, mein nächtliches Eigenheim, auch glücklich war über den eigenen Schlafzimmerspind und das Kästchen für die Schuhe im Keller – wählte ich meinen Seelenführer. Jeder mußte jemanden haben; die Institution war verordnet, aber die Person durften wir auswählen.
Etwas Zeit konnte ich mir lassen, obwohl es ein Risiko war, wenn ich so mir nichts dir nichts Gott am Morgen verschluckte.
Viele deponierten ihre Beichte bei Pater Rufus. Er war der Älteste, roch aus dem Mund und aus dem schütteren weißen Bärtchen nach Tabak und fragte nicht lange herum.
Pater Clemens pflegte sein gewelltes Haar mit Brillantine und glich mit seinem geteilten schwarzen Knebelbart am ehesten einem Hochzeitsgast in Kana. Nur wirkte er so flach wie von einem Bild herab.
Zu Pater Superior wagten sich höchstens zukünftige Gruppenführer.
Außerdem gab es den nasenhöckerigen Pater Fuchs und den Ökonomiepater. Die zackigsten aber waren Pater Zeller und Pater Suter. Beide machten sich als Turnlehrer stark. Zeller durch Vorturnen an Reck, Pferd und Barren, Suter durch den Schleifton seiner nasalen Befehlsstimme und durch lederne Unerbittlichkeit.