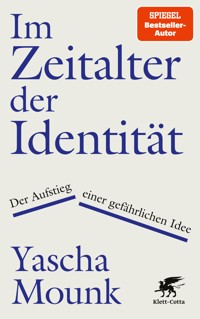19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Kann Demokratie in einer diversen Gesellschaft funktionieren? Politikwissenschaftler Yascha Mounk zeigt, wie dieses Experiment gelingt. Er liefert die Gebrauchsanweisung für unsere plurale Gesellschaft. "Zu den Stärken des Buches gehört es, dass er das Spannungsverhältnis zwischen Diversität und Demokratie klar benennt. (…) Die angelsächsische Methode, komplizierte politikwissenschaftliche Sachverhalte interessant und verständlich darzulegen, machen das Buch zu einer empfehlenswerten Lektüre." – Das Parlament "Ein wertvoller Beitrag in der heutigen Zeit." – Handelsblatt "Yascha Mounk gehört zu den originellsten Denkern der Gegenwart."– Jüdische Allgemeine "Demokratie indes ist immer auch die Suche nach Mehrheiten. Yascha Mounk zeigt in seinem Buch eindrücklich auf, wie beherzt Menschen sich zu Gruppen zusammenschließen." – Bayerischer Rundfunk Globalisierung, Migration und Identitätspolitik prägen Deutschland und stellen das politische Systems vor ungeahnte Herausforderungen. Wie kann eine demokratische Verfassung die sozialen und politischen Zentrifugalkräfte einer multiethnischen Gesellschaft einhegen, ohne dabei die liberale Idee zu verraten? Der renommierte Politologe Yascha Mounk zeigt in seinem neuen Sachbuch nicht nur die Hindernisse, auf die das Experiment einer diversen Gesellschaft trifft. Er liefert auch die Anleitung für eine intakte multiethnischen Demokratie. Klarsichtig und mit analytischer Schärfe widmet er sich den Argumenten, die von rechts und links kommen: eine wegweisende Verteidigung pluralistischer Prinzipien. Denn nie war es wichtiger als heute, über die Balance von Gleichheit und individueller Freiheit nachzudenken. - Yascha Mounk untersucht zunächst, woran multiethnische Gesellschaften scheitern und warum ein "Weiter so!" nicht reicht. - In einem zweiten Schritt legt er dar, was die Grundpfeiler einer diversen Demokratie sind und lotet das Verhältnis von Individualismus und Gemeinschaft aus. - Schließlich schildert Mounk, warum es sich lohnt, das große Experiment zu wagen und warum die Antwort auf die Herausforderung Diversität nur die liberale Demokratie sein kann. Denn bei allen Unterschieden kommt es am Ende auch in einer vielfältigen Demokratie auf die Gemeinsamkeiten an. Yascha Mounk, 1982 in München geboren, ist Politikwissenschaftler und Associate Professor an der Johns-Hopkins-Universität. Darüber hinaus hat er die einflussreiche Zeitschrift Persuasion gegründet und schreibt u.a. für die New York Times, den Atlantic und die ZEIT. Bei Droemer erschien 2018 Der Zerfall der Demokratie.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 467
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Yascha Mounk
Das große Experiment
Wie Diversität die Demokratie bedroht und bereichert
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Wie kann Demokratie in Zeiten von Globalisierung, Migration und Identitätspolitik besser funktionieren? Der renommierte Politikwissenschaftler Yascha Mounk zeigt nicht nur die Hindernisse, auf die das Experiment einer diversen Gesellschaft trifft. Er liefert auch die Anleitung für eine intakte multiethnischen Demokratie. Klarsichtig und mit analytischer Schärfe widmet er sich den Argumenten, die von rechts und links kommen: eine wegweisende Verteidigung pluralistischer Prinzipien. Denn nie war es wichtiger als heute, über die Balance von Gleichheit und individueller Freiheit nachzudenken.
Inhaltsübersicht
Einleitung
Das Unbehagen an der diversen Demokratie
Der Aufstieg der Pessimisten
Von der Notwendigkeit einer optimistischen Vision
Teil eins
Wenn diverse Gesellschaften scheitern
Kapitel 1
Weder natürlich noch willkürlich
Freund und Feind
Kapitel 2
Anarchie
Der hohe Preis der strukturierten Anarchie
Dominanz
Harte Dominanz
Weiche Dominanz
Dominanz von Minderheiten
Fragmentierung
Kann geteilte Macht das Problem der Fragmentierung lösen?
Lehren aus dem Scheitern
Kapitel 3
Wann der Kontakt zwischen verfeindeten Gruppen zu Toleranz führt (und wann nicht)
Blick nach vorn
Teil zwei
Welche Zukunft diverse Demokratien anstreben sollten
Kapitel 4
Die wichtigsten Freiheiten – und was sie bedroht
Freiheit vor Verfolgung
Freiheit von Zwang
Verfolgung eindämmen
Flucht aus dem Käfig der Normen
Kapitel 5
Die Macht und die Gefahr des ethnischen Nationalismus
Ein (verhaltenes) Hoch auf den Verfassungspatriotismus
Plädoyer für den Kulturpatriotismus
Kapitel 6
Der Schmelztiegel: eine allzu edle Vision
Die Salatschüssel: eine zu fragmentierte Zukunft
Eine neue Vision: der öffentliche Park
1. Ein öffentlicher Park ist für alle zugänglich
2. Ein öffentlicher Park bietet seinen Besuchern verschiedene Optionen
3. Ein öffentlicher Park schafft lebendige Orte der Begegnung
Kapitel 7
Die Uhr zurückdrehen
Verweigerung des Wandels
Das Diktat der Identitäten
1. Strategischer Essenzialismus
2. Die Unmöglichkeit gegenseitigen Verständnisses
3. Die Gefahr kultureller Aneignung
Ein besseres Modell
1. Mehr Empathie, tiefere Solidarität
2. Ein Lob auf die gegenseitige Beeinflussung
3. Betonung der Gemeinsamkeiten
Teil drei
Wie diverse Demokratien gelingen können
Kapitel 8
Ausgrenzung und Integration
Die Kluft bei Jobs und Bildung
Kriminalität und Terrorismus
Warum Optimismus so wichtig ist
Kapitel 9
Wenn es der »Wissenschaft« an Wissenschaftlichkeit fehlt
Aufstieg des multiethnischen Amerika
Die komplexe Identität der Latinos
Die unsichere Verortung der asiatischen Amerikaner
Die gefährlichste Idee in der amerikanischen Politik
Warum wir froh sein sollten, dass die Demografie nicht das Schicksal vorwegnimmt
Kapitel 10
Sicherer Wohlstand
Universelle Solidarität
Effektive und inklusive Institutionen
Gegenseitiger Respekt
Zum Schluss
Einleitung
Kurz bevor wir auf Sendung gingen, merkte ich auf einmal, wie nervös ich war.
Deutsch ist meine Muttersprache. Aber nachdem ich in Großbritannien das College besucht und in den USA meinen Doktor gemacht habe, fällt es mir inzwischen leichter, auf Englisch über Politik zu reden. Als ich nun zu dem Live-Interview mit den Tagesthemen im Studio Platz nahm, saß mir die Angst im Nacken, ich könnte mich missverständlich ausdrücken oder mich gar zum Narren machen.
Als mich Caren Miosga bat, über die Hauptargumente meines aktuellen Buchs zu sprechen – konkret fragte sie mich nach den Gründen für das Erstarken des autoritären Populismus –, fühlte ich mich schon wohler. Allmählich beruhigten sich meine Nerven.
Es gibt eine weitverbreitete Wut über die wirtschaftliche Stagnation, sagte ich. Hinzu kommt der steigende Einfluss der sozialen Medien, die es Demagogen leichter machen, ein großes Publikum zu erreichen, wenn sie ihre Lügen verbreiten und zum Hass aufstacheln. Und dann gibt es noch einen weiteren Grund, der in einem Land, das noch immer mit der Ankunft von einer Million Flüchtlingen aus Afrika und dem Mittleren Osten zu kämpfen hat, besonders wichtig ist.
»Wir wagen hier ein Experiment, das in der Geschichte einzigartig ist«, sagte ich der Moderatorin. »Und zwar, eine monoethnische und monokulturelle Demokratie in eine multiethnische zu verwandeln. Das kann klappen, das wird, glaube ich, auch klappen, aber dabei kommt es natürlich auch zu vielen Verwerfungen.«
Nach dem Interview war ich sehr erleichtert. Mein Deutsch hatte ganz natürlich geklungen, und es war mir gelungen, die Kernargumente meines Buchs zu vermitteln. Vor allem war mir nichts Albernes oder Peinliches passiert. Das schlimmste Ergebnis eines Live-Interviews – dass man wider Willen viral geht – war nicht eingetreten. Dachte ich.
Mit einem breiten Lächeln fuhr ich zum Bahnhof, erwischte noch so eben den Zug nach Frankfurt, checkte im Flughafenhotel ein und schlief fast sofort ein.
Erst als ich am nächsten Abend, nach einem zehnstündigen Flug in die USA, mein Telefon wieder einschaltete, wurde mir klar, dass das Interview eben doch viral gegangen war. Mein Maileingang quoll förmlich über von wütenden Botschaften: »Du hast uns nicht zu sagen, wie wir leben sollen!!« – »Wie können Sie es wagen, Experimente mit uns zu machen?« – »Vielen Dank, dass Sie Ihre miese Verschwörung eingestanden haben!«
Ich war überrascht, wie hasserfüllt die Nachrichten klangen. Aber noch mehr verblüffte mich der Inhalt. Von was für einer Verschwörung war hier die Rede? Und mit wem führte ich angeblich irgendwelche Experimente durch?
Eine Recherche im Internet brachte mir rasch die Antwort. Ein paar Minuten nach meinem Interview hatte Tichys Einblick, eine rechte Website, einen Artikel gepostet, in dem behauptet wurde, Angela Merkel und ich führten ein Experiment mit dem deutschen Volk durch. »Wer hat diesem ›Experiment‹ zugestimmt?«, fragte der Autor.1
Nach diesem Kommentar hatte sich die Wut über mein angebliches Geständnis mit erstaunlichem Tempo verbreitet. Ultrarechte Radiomoderatoren, YouTuber, sogar gewisse Politiker von der AfD zitierten das Interview als Beweis dafür, dass sinistre Kräfte einen »großen Bevölkerungsaustausch« planten – mit dem Ziel, die angestammte Bevölkerung Europas auszulöschen.
Schließlich meldete sich auch The Daily Stormer, eine Neonazi-Website in den USA, zu Wort.2 In der Überschrift wurde mein Name in Klammern gesetzt, um anzuzeigen, dass ich Jude bin, und vor »(((Yascha Mounk)))’s einzigartigem historischen Experiment«3 gewarnt. Mit einer Anspielung auf »Arbeit macht frei«, die widerwärtige Inschrift am Eingang des Vernichtungslagers Auschwitz, bekam der Beitrag den Tag »Diversity macht frei – The Hebrew People Are At It Again«.4
In gewisser Weise beruhten meine fünfzehn Minuten Ruhm bei den extremen Rechten und die fünf Minuten Hass, die sich daraus ergaben, auf einem schlichten Missverständnis. Um das Selbstverständliche noch einmal klar zu formulieren: Angela Merkel und ich haben uns nicht zu einem großen Experiment am deutschen Volk verabredet. Niemand hat das getan. Der rasche Wandel der ethnischen und religiösen Zusammensetzung der Bevölkerung vieler Länder – von Deutschland bis Schweden, von Australien bis zu den USA – beruht nicht auf einer geheimen Verschwörung. Er ist eine im Wesentlichen unbeabsichtigte Folge von Entscheidungen, die Politiker aus verschiedenen ökonomischen, politischen und humanitären Gründen getroffen haben.
Dennoch bereue ich es nicht, den Begriff »Experiment« benutzt zu haben. Denn ich glaube nach wie vor, dass dieses Wort, richtig verstanden, die Situation, in der sich die meisten Demokratien der Welt heute befinden, gut beschreibt.
In einer Bedeutung wird ein Experiment von Naturwissenschaftlern durchgeführt, die seine Parameter bewusst festlegen, bevor es beginnt. Nach Auskunft des Oxford English Dictionary handelt es sich bei einem Experiment um ein wissenschaftliches Verfahren mit dem Ziel, etwas zu entdecken, eine Hypothese zu überprüfen oder eine bereits bekannte Tatsache zu beweisen.5 Meine Kritiker verstanden die Aussage, dass in vielen Ländern der Erde heute ein bisher so nicht da gewesenes Experiment laufe, in diesem Sinne. Wo es ein Experiment gibt, muss auch einer sein, der es durchführt, dachten sie. Und wer eignet sich dafür besser als ein Jude mit Anbindung an eine Elite-Institution wie die Harvard University?6
Es gibt aber auch noch eine andere Bedeutung des Begriffs: Ein Experiment kann schlicht und einfach der Versuch sein, unter ungewohnten oder unvorhergesehenen Bedingungen zum Erfolg zu kommen. Oder mit anderen Worten, ebenfalls nach dem Oxford English Dictionary: eine vorläufige Vorgehensweise ohne Gewissheit über ihren Ausgang.7
Das war es natürlich, was ich gemeint hatte.
Im 18. Jahrhundert ließen sich die Gründungsväter der Vereinigten Staaten auf ein großes Experiment in Sachen moderne Demokratie ein, als sie eine sich selbst regierende Republik errichteten – zu einer Zeit, da ähnliche Vorhaben in allen Ländern, die den Versuch dazu gemacht hatten, gescheitert waren. Obwohl sie nicht sicher sein konnten, wie das Experiment ausgehen würde, erkannten sie, dass ihnen eine »lange Reihe von Missständen« keine andere Wahl ließ, wenn sie ihren Idealen treu bleiben wollten.8
Heute sind wir in einer ähnlichen Lage. Ohne dass es größere Präzedenzfälle gäbe, sind wir in das große Experiment hineingestolpert, sehr diverse – und hoffentlich stabile – Demokratien zu errichten, die ihre Mitglieder gerecht behandeln sollen.
Dieses große Experiment ist die wichtigste Aufgabe unserer Zeit. Es wurde in Gang gesetzt, ohne dass jemand es bewusst geplant oder gesteuert hätte. Wir sind uns über die Regeln und Institutionen, die diesem Experiment zum Erfolg verhelfen können, noch nicht einig. Und wir verlieren das Ziel – die Vision einer Zukunft, die sowohl Mehrheits- als auch Minderheitengruppen enthusiastisch mittragen können – immer mehr aus den Augen.
Ziel dieses Buchs ist es, dem Charakter dieses Experiments nachzuspüren, den hohen Preis zu beziffern, den wir alle im Falle seines Scheiterns zu zahlen hätten, und eine optimistische Vision für sein Gelingen zu entwerfen.
Das Unbehagen an der diversen Demokratie
Es wäre verführend zu denken, dass das große Experiment ganz einfach funktionieren sollte.
»Die Diversität ist unsere Stärke«, behaupten Politiker von Schweden bis zu den USA gern. Und wer demokratische Institutionen schätzt, glaubt selbstverständlich, dass sie besser dazu in der Lage sein sollten, den Frieden zwischen verschiedenen ethnischen oder religiösen Gruppen zu wahren, als Diktaturen. Sollte es also nicht ein Leichtes sein, diverse Demokratien aufzubauen?
Leider gibt es zwei oft zu wenig berücksichtigte Gründe, warum das Wechselspiel zwischen Diversität und Demokratie den Erfolg von Gesellschaften eher behindern kann. Erstens gehören Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen Identitätsgruppen seit jeher zu den Haupttreibern von Konflikten zwischen Menschen. In vielen Gesellschaften erwies die Diversität sich eher als Stolperstein denn als Stärke. Zweitens können demokratische Institutionen die Herausforderungen von Diversität ebenso leicht verschärfen wie verringern. In vielen Fällen hat die Herrschaft der Mehrheit eher zu Gewalt zwischen rivalisierenden ethnischen oder religiösen Gruppen geführt und den Ausschluss von Minderheiten vorangetrieben.
Wenn das große Experiment Erfolg haben soll, müssen wir diese Hindernisse ohne Scheuklappen in den Blick nehmen.
In einigen der blutigsten Konflikte der Menschheitsgeschichte hatten Opfer und Täter – zumindest aus moderner Sicht – dieselbe Identität. Menschen sind durchaus in der Lage, gegen Angehörige derselben Religion in den Krieg zu ziehen oder Menschen mit derselben Hautfarbe unaussprechliches Leid zuzufügen.
Die Geschichte von Ländern wie Indien und Indonesien zeigt aber auch, dass Diversität die Gefahr gewaltsamer Konflikte deutlich erhöht. Bei vielen der grausamsten Verbrechen der Menschheit spielten »zugeschriebene Identitäten« wie »Rasse« oder Religion eine entscheidende Rolle1. Von den Massendeportationen der Assyrer im 9. Jahrhundert v.Chr. über die Vertreibung der Muslime aus dem mittelalterlichen Spanien bis hin zur Schoah und dem Völkermord in Ruanda: Immer wieder lieferte das »Anderssein« oder die angebliche »Minderwertigkeit« einer Gruppe den Vorwand für Gewalt und Massenmord.
Die Auseinandersetzung zwischen Gruppen, die von unterschiedlichen Vorfahren abstammen oder verschiedene Götter anbeten, gehört historisch gesehen zu den Hauptgründen für gewaltsame Konflikte, Staatsversagen und sogar Bürgerkriege. Das ist die erste Schwierigkeit, der sich diverse Gesellschaften stellen müssen.
Können die charakteristischen Merkmale der Demokratie, wie etwa regelmäßige Wahlen, dabei helfen, den Problemen diverser Gesellschaften zu entgehen?
Die historische Bilanz ist alles andere als rosig. Die Angehörigen der besonders hoch geschätzten Demokratien waren stolz auf ihre ethnische »Reinheit«. Vom antiken Athen bis zum Römischen Reich, von Venedig bis Genua – vormoderne Versuche der Selbstregierung waren stets auf eine ethnische In-Group beschränkt.
Andersherum waren die berühmtesten Beispiele diverser Gesellschaften – von Bagdad im 9. Jahrhundert bis hin zu Wien im 19. Jahrhundert – zumeist Monarchien. Historische Phasen, in denen viele verschiedene Gruppen friedlich zusammenlebten und einander beeinflussten, fielen mit Zeiten zusammen, in denen die Menschen wenig Einfluss auf ihr kollektives Schicksal genossen.
Das ist kein Zufall. Wenn du Untertan eines Königs oder Kaisers bist, hat die relative Größe deiner Gruppe keinen direkten Einfluss auf die Gesetze, denen du gehorchen musst. Solange du dem Monarchen vertraust, dass er deine ethnische oder religiöse Gemeinschaft toleriert, kannst du dem Zustrom von Menschen anderer Gruppen recht gelassen entgegenblicken.
Als Bürger einer Demokratie dagegen hat die relative Größe der eigenen Gruppe direkte Auswirkungen auf die Möglichkeiten politischer Einflussnahme. Solange man in der Mehrheit ist, bestimmt man, wo es langgeht.
Gerät man aber aufgrund von Einwanderung oder anderer Formen demografischen Wandels in die Minderheit, können sich die Gesetze, denen man unterworfen ist, drastisch ändern. Die Logik der Selbstregierung mit ihrer ständigen Notwendigkeit, eine Mehrheit gleichgesinnter Wählerinnen und Wähler zusammenzuschustern, führt Menschen in Versuchung, diejenigen, die sie als »anders« betrachten, von der vollen Teilhabe an Politik auszuschließen.
Und das ist die zweite Schwierigkeit, mit der diverse Demokratien konfrontiert sind. Demokratische Institutionen machen es eher schwerer als leichter, den Frieden zwischen rivalisierenden Identitätsgruppen zu wahren.
Diversität führt oft zum Konflikt. Demokratische Institutionen verschärfen häufig ethnische und religiöse Spannungen. Sollen diverse Demokratien also dauerhaft funktionieren oder gar gedeihen, dann wäre es hilfreich, wenn sie auf eine lange Geschichte zurückblicken könnten, in der man versucht hat, faire und inklusive Gesellschaften zu schaffen.
Doch leider ist das nicht der Fall. Im Gegenteil blicken die meisten Demokratien auf eine lange Tradition ethnischer und religiöser Ausgrenzung zurück. Damit, die Diversität von Identitätsgruppen – die heute längst zu ihrer Wirklichkeit gehören –, zu handhaben, haben sie beunruhigend wenig Erfahrung.
Erst in den letzten fünfzig oder sechzig Jahren haben die meisten Demokratien im größeren Stil damit begonnen, frühere Außenseiter als Landsleute zu begreifen. Am Ende des Zweiten Weltkriegs waren nicht einmal vier Prozent der Einwohner von Großbritannien im Ausland geboren.9 Heute sind es mehr als vierzehn Prozent.10 Vor wenigen Jahrzehnten war Schweden eines der homogensten Länder der Erde. Heute haben zwanzig Prozent der Menschen, die in Schweden leben, ausländische Wurzeln.11 Ähnlich schnell vollzieht sich diese Transformation in vielen anderen Ländern.
Die Gründe für diesen demografischen Wandel unterscheiden sich von Land zu Land. In Deutschland12 und der Schweiz13 war er hauptsächlich vom Bedarf an ungelernten Arbeitskräften getrieben, die das »Wirtschaftswunder« der Fünfziger und Sechziger möglich machten. In Frankreich und Großbritannien sind es weitgehend die Folgen der Errichtung und späteren Auflösung einer brutalen Kolonialherrschaft.14 In Dänemark und Schweden spielt die großzügige Asylpolitik eine wesentliche Rolle.
Doch trotz aller bedeutenden Unterschiede haben diese Länder eine wichtige Gemeinsamkeit: Ihre Transformation beruht auf unvorhergesehenen und unbeabsichtigten Folgen politischer Entscheidungen, deren Ziele mit dem heute sichtbaren Ergebnis nichts zu tun hatten. Keines dieser Länder hat sich bewusst dafür entschieden, sich in eine diverse Demokratie zu verwandeln. Und so entwickelte auch keines von ihnen einen vernünftigen Plan für den Umgang mit den großen Herausforderungen, die sich aus dem großen Experiment ergeben.
Auch in Nordamerika gibt es eine Version dieser Geschichte.
Da die große Mehrheit ihrer Bürger aus fernen Ländern stammt, konnten weder die USA noch Kanada jemals so tun, als würde eine gemeinsame Abstammung oder eine lange Geschichte gemeinsamer Erfahrungen ihre Bewohner aneinanderbinden. Anders als die meisten europäischen Länder betrachteten sie sich von Anfang an als Nationen, die sich aus Einwanderern zusammensetzten. Trotzdem herrschte in den großen Demokratien der Neuen Welt über weite Strecken ihrer Existenz eine anders geartete Form der ethnischen Ausgrenzung und stolperten auch sie ohne Absicht oder Voraussicht in das große Experiment.
Die Verbindung zwischen Hautfarbe und dem Status als voller Bürger ist in den USA besonders eng. Während der ersten neunzig Jahre der Republik besaßen Schwarze nicht einmal die grundlegendsten Bürgerrechte. Sie durften weder die Früchte ihrer Arbeit genießen noch selbst entscheiden, wo sie lebten und wen sie heirateten.
Nachdem die grausame Institution der Sklaverei im Jahr 1865 endlich abgeschafft wurde15 und eine hoffnungsvolle Phase der »Reconstruction« begann, konnten Amerikaner mit afrikanischer Abstammung kurzzeitig auf volle Bürgerrechte hoffen. Doch die Gegenreaktion ließ nicht lange auf sich warten. Nach ein paar Jahren wurden sie wieder von der vollen Teilhabe am öffentlichen Leben der Nation ausgeschlossen.16 Unter den repressiven Gesetzen, die die nächsten hundert Jahre vor allem im Süden galten, wurden sie von ihren nominellen Landsleuten abgesondert, hatten keinen Zugang zu grundlegenden Sozialleistungen und waren auch vom Wählen ausgeschlossen.
Während eines Großteils seiner Geschichte war Amerika auch weniger offen für Einwanderung aus nicht europäischen Ländern, als die gängigen Erzählungen über die Ursprünge der Nation glauben machen wollen. Als in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts chinesische Arbeiter in größerer Zahl an der Westküste ankamen, machten sich Politiker Sorgen über die Auswirkungen dieses Zustroms einer »fremden Rasse« auf die amerikanische Bevölkerung.17 Ab 1875 wurden daraufhin mithilfe einer ganzen Reihe von Gesetzen »unerwünschte« Einwanderer aus Ostasien daran gehindert, ins Land zu kommen.18
Als in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts die Zahl der im Ausland geborenen Einwohner neue Rekordhöhen erreichte, einigten sich Demokraten und Republikaner darauf, die Schrauben noch stärker anzuziehen. Die Gesetze, die sie in den Zwanzigerjahren verabschiedeten, deckelten die Gesamtzahl der Neuankömmlinge auf 165000 pro Jahr und legten nicht europäischen Einwanderern zusätzliche Beschränkungen auf.19
Erst im Jahr 1965 wurden mit dem Immigration and Nationality Act die strengen Beschränkungen der Einwanderung von außerhalb der westlichen Hemisphäre abgebaut.20 Und selbst zu diesem Zeitpunkt versuchten führende Politiker noch zu verhindern, dass das neue Gesetz die demografische Zusammensetzung des Landes veränderte. In seinem Statement anlässlich der Unterzeichnung erklärte Lyndon B. Johnson, es handele sich nicht »um eine Revolution. Dieses Gesetz hat keinerlei Einfluss auf das Leben von Millionen Menschen in unserem Land. Es wird unseren Alltag nicht verändern.«21
Zunächst stieg die Zahl der Einwanderer aus Asien, Afrika und Lateinamerika nur langsam. Doch der Anteil von nicht europäischen Einwanderern wuchs stetig. Und da die Neuankömmlinge auch regen Gebrauch von ihrem Recht machten, Familienangehörige ins gelobte Land nachzuholen, machten sie bald den Löwenanteil der Neubürger aus. In den 2010er-Jahren kamen vier von fünf legalen Einwanderern in die USA aus Asien oder Lateinamerika.22
Selbst in den USA ist das große Experiment also eher das Ergebnis falscher Annahmen über die langfristigen Auswirkungen politischer Reformen als Zeugnis einer grundsätzlich positiven Einstellung zu den Segnungen der Diversität. Weder Woodrow Wilson noch Franklin D. Roosevelt, weder Lyndon B. Johnson noch Ronald Reagan haben bewusst eine Entscheidung zugunsten des großen Experiments getroffen. Sie alle sind in das Experiment hineingestolpert.
Das hilft, viele der Probleme zu erklären, unter denen diverse Demokratien rund um den Globus heute leiden.
Viele Demokratien haben sich bei ihrer Gründung dazu verpflichtet, alle ihre Bürger gleich zu behandeln, unabhängig von Religion und ethnischer Herkunft. Sie tun ihr Bestes, um das große Experiment zum Erfolg zu führen. Und doch beruhen die Geschichten, die sie über sich selbst erzählen, noch immer auf der Fiktion ihrer Homogenität.
Wenn Sie Bewohner von Stockholm, Wien oder Tokio vor fünfzig Jahren gefragt hätten, wer wirklich in ihr Land gehörte, dann hätten Sie überall mehr oder weniger dieselbe Antwort bekommen: jemand, dessen Vorfahren dieselbe Sprache sprachen, auf demselben Territorium lebten, zur selben ethnischen Gruppe gehörten und vielleicht sogar denselben Gott anbeteten. Noch heute wird es in vielen dieser Länder Minderheiten schwer gemacht, ihre Religion zu praktizieren oder kulturell akzeptiert zu werden. Häufig werden die dunkelsten Kapitel der eigenen Geschichte unterschlagen. Und in einigen Fällen herrscht nach wie vor die Überzeugung, ein »wahres« Mitglied der Gesellschaft müsse dieselbe Kultur und ethnische Herkunft besitzen.
Vor allem in Ländern, die lange stolz auf ihre kulturelle Homogenität waren und keinen größeren Zustrom von Einwanderern erlebten, fördern solche Haltungen das Risiko einer dauerhaften Spaltung zwischen Einheimischen und Fremden. In Teilen von Europa und Ostasien befürchten Einwanderer und Mitglieder anderer Minderheiten, dass sie niemals ganz dazugehören werden, obwohl sie gar kein anderes Land kennen.
Das daraus resultierende Risiko einer kulturellen Fragmentierung ist heute sehr real. Einige Einwanderergruppen bilden eine sozioökonomische Unterschicht. In den ärmsten Banlieues oder »Problemvierteln« führt dies bei manchen Bewohnern zu einer Ablehnung der grundlegenden gesellschaftlichen Spielregeln, zu Sympathiebekundungen für gewalttätige Extremisten oder sogar zu Fällen von hausgemachtem Terrorismus.
Andere Demokratien, die seit ihrer Gründung in hohem Maße divers sind, haben über Jahrhunderte hinweg eine Struktur der Dominanz aufrechterhalten. Ein Großteil ihrer Geschichte besteht aus dem mühsamen Kampf für die Überwindung einer offen rassistischen Hierarchie, die wie im Falle der USA weiße angelsächsische Protestanten an die Spitze setzte, eine breite Vielfalt von Religionen und Ethnien in die Mitte und Schwarze sowie die Urbevölkerung ganz nach unten. Die Erfolge dieses Kampfes sollte niemand kleinreden. Es gibt einen gewaltigen Unterschied zwischen den Zuständen, die vor fünfzig oder hundert Jahren herrschten, und den Rechten und Möglichkeiten, die Amerikaner mit afrikanischer Abstammung heute haben. Selbst die defektesten Demokratien verfügen über die Fähigkeit, sich zu wandeln.
Und doch wirft die brutale Geschichte der Dominanz nach wie vor ihren langen Schatten auf die betroffenen Gesellschaften. Menschen, deren Vorfahren in der Vergangenheit unterdrückt wurden, leiden immer noch unter ernsthaften sozioökonomischen Nachteilen. Das Misstrauen zwischen verschiedenen demografischen Gruppen sitzt tief. Und obwohl diese Länder dem Gesetz nach längst alle ihre Bürger gleich behandeln, findet die Unterdrückung vergangener Tage ihren Nachhall in schockierenden Ungerechtigkeiten wie den abscheulichen Polizeiverbrechen gegen unbewaffnete schwarze Männer.
Diverse Gesellschaften blicken auf eine düstere Geschichte zurück. Obwohl sich in den letzten Jahrzehnten vieles gebessert hat, sucht die Vergangenheit die Gegenwart noch immer heim. Kein Wunder also, dass viele Menschen zunehmend pessimistisch auf die Zukunft diverser Demokratien blicken.
Der Aufstieg der Pessimisten
Um die Zeit vor dem Spiel totzuschlagen, stimmten die Fans ein paar ihrer Schlachtgesänge an. »Hier kommt der Moskito«, intonierte ein Mann mit kurz geschnittenem braunem Haar, der Menge zugewandt. »Der sticht euch vorn und hinten«, fuhr er fort, während die anderen mit den Füßen trampelten. »Hol schnell das Mückenspray«, ging der Gesang weiter, untermalt von wildem Applaus. »Dann ist der Moskito kaputt.«
Dann trank er einen großen Schluck Bier und hob die Hand zum Hitlergruß. Die Menge, etwa hundert Männer und ein Dutzend Frauen, tat es ihm gleich.
Einer der wenigen, die nicht den Arm hoben, stand gleich neben mir. »Heutzutage muss man vorsichtig sein, wie man jubelt«, sagte Paolo Polidori, ein Italiener mittleren Alters, der ein T-Shirt, gelbbraune Hosen und blaue Turnschuhe trug. »Sonst wird da womöglich noch was missverstanden.«
Polidori ist in Triest geboren. Die Curva Furlan, wo sich die treuesten Fans des lokalen Fußballklubs treffen, besucht er seit seiner Kindheit. Über die Jahre ist er in dieser mittelgroßen Stadt im Nordosten Italiens zu einem mächtigen Mann aufgestiegen. Inzwischen ist der langjährige Vorsitzende der größten Stadtratsfraktion stellvertretender Bürgermeister von Triest. Sollte seine Partei, die rechte Lega, die nächsten Parlamentswahlen gewinnen, steht er auch für größere Aufgaben bereit. »Polidori ist ein aufsteigender Stern«, erzählte mir ein Lokaljournalist.
Bei unserem Gespräch im pittoresken Caffè Degli Specchi am Stadtplatz betete Polidori die ganze Litanei an Sprüchen herunter, die ich schon von rechten Aktivisten auf der ganzen Welt – von Polen bis nach Brasilien – gehört hatte. Die Mainstream-Politiker, erklärte er mir nachdrücklich, seien in Wirklichkeit alle Marionetten von George Soros. Ihre Regierungen verschwiegen die schädliche Wirkung von Impfungen, nur um die Profite der großen Pharmakonzerne zu sichern. Die Einwanderung, vor allem aus muslimischen Ländern, sei eine entsetzliche Gefahr für Italien. Deshalb sei seine Partei, die der multiethnischen Gesellschaft stolzen Widerstand entgegensetzt, die einzige politische Kraft, die das Land retten könne.
Im Stadion hatte inzwischen das Match begonnen. Jedes Mal, wenn der gegnerische Torwart einen Ball hielt, kamen laute Affenrufe von den Fans. »Schon okay, ist ja ein Weißer«, erklärte mir Polidori mit verschmitztem Lächeln. »Ein Paradox …«
In vielen entwickelten Demokratien ist der Pessimismus gegenüber dem großen Experiment zum Markenzeichen von Teilen der Rechten geworden. Die Rassisten und Demagogen dieser Welt teilen Polidoris Credo: Der historische Erfolg der Demokratien von Italien bis hin zu den USA wurzele in ihrem kulturellen Erbe und ihrer ethnischen Zusammensetzung. Einwanderung und demografischer Wandel stellten eine existenzielle Bedrohung für diesen Erfolg dar. Sie ließen Länder und Kulturen verarmen und schürten Chaos bis hin zum Bürgerkrieg.
In den letzten Jahrzehnten sind diese Stimmen von den Rändern des öffentlichen und politischen Lebens in die Mitte gewandert. Es gibt viele große Unterschiede zwischen rechten Politikern wie Donald Trump und Marine Le Pen, Viktor Orbán und Jair Bolsonaro, Narendra Modi und Recep Tayyip Erdoğan. Sie stammen aus unterschiedlichen religiösen Traditionen, gehören zu verschiedenen ideologischen Kreisen und richten ihre Wut gegen unterschiedliche Feinde. Doch was sie alle vereint, ist eine starke Neigung zum ethnischen Mehrheitsdenken: Sie alle betrachten die sichtbarste Minderheit in ihrem Land als zentrale Bedrohung des Gemeinwohls – und versprechen, für die Rechte der Mehrheit einzustehen.
Diese Politiker regieren heute einige der größten Demokratien der Welt. In Dutzenden von Ländern, die früher als stabil galten, unterdrücken sie abweichende Meinungen, behindern unabhängige Institutionen und greifen den Rechtsstaat an. In einigen Ländern ist es ihnen sogar gelungen, den Charakter demokratischer Bürgerrechte grundlegend zu verändern.23
Auf der ganzen Welt, von Italien bis Indien, werden große Teile der Rechten heute von Leuten dominiert, die eine diverse Demokratie ganz und gar ablehnen. An diesem historischen Moment erstaunt aber nicht nur, dass Teile der Rechten die Diversität ablehnen – sondern auch, dass Teile der Linken ihren ganz eigenen Pessimismus gegenüber den Erfolgsaussichten des großen Experiments entwickelt haben.
Heidi Schreck verehrte als Kind die amerikanische Verfassung. In Wenatchee im US-Bundesstaat Washington aufgewachsen, wurde sie durch ihre patriotischen Vorträge über die Verfassung der USA, die sie in Legion Halls im ganzen Land hielt, bekannt.24
Doch dann wurde Schreck erwachsen und erfuhr immer mehr über vergangene und aktuelle Ungerechtigkeiten in Amerika. Und so wurde sie skeptischer, sowohl in Bezug auf ihr Land als auch auf seine Verfassung. Wie konnten die Dinge so schrecklich aus dem Ruder laufen?, fragte sie sich. Scheitert die Verfassung daran, ihren ursprünglichen Sinn in die Realität umzusetzen?25
In einem Ein-Frau-Stück, das den Broadway im Sturm eroberte und sowohl für den Tony als auch den Pulitzerpreis nominiert wurde, verneint Schreck diese Frage. »Ich glaube nicht, dass unsere Verfassung scheitert. Ich glaube, sie tut genau das, was sie von Anfang an tun sollte: Sie schützt die Interessen einer kleinen Zahl reicher weißer Männer.«26
Am Ende ihres Erfolgsstücks fragt Schreck jemanden aus dem Publikum, ob die Amerikaner ihre Verfassung abschaffen sollten.27 Was ihre eigene Haltung angeht, lässt sie ihre Zuschauer nicht im Zweifel. Trotzdem warf eine Rezension in der Zeitschrift The Atlantic dem Stück vor, nicht stärker gegen den »altersschwachen nationalen Albatros« Stellung zu beziehen.28
Über lange Phasen der amerikanischen Geschichte hinweg argumentierten selbst die glühendsten Kritiker der Ungerechtigkeiten im Land, die Gründungsideale könnten helfen, den Weg in eine bessere Zukunft zu weisen. In einer Rede über die Bedeutung der Unabhängigkeitserklärung wies Frederick Douglass auf die bittere Ironie hin, dass man die Freiheit feierte, während die Sklaverei noch das Recht des Landes blieb: »Dieser vierte Juli ist Ihr Feiertag, nicht meiner«, erklärte er. »Sie können sich freuen, aber ich muss trauern.« Trotzdem wies auch Douglass die Prinzipien der Gründerväter nicht zurück: »Trotz des düsteren Bildes, das ich heute zur Lage der Nation zeichne«, schloss er, »verzweifle ich nicht über dieses Land. … Deshalb ende ich, wie ich begonnen habe: mit Hoffnung. Ich lasse mich von der Unabhängigkeitserklärung ermutigen, von den großen Prinzipien, die sie enthält, und dem Geist der amerikanischen Institutionen.«29
Als Martin Luther King Jr. hundert Jahre später die Grausamkeiten der Jim-Crow-Gesetze thematisierte, beklagte er, Amerika habe sein Versprechen gebrochen, allen Menschen »die unveräußerlichen Rechte auf Leben, Freiheit und das Streben nach Glück« zu garantieren. Trotzdem zeigte auch er sich entschlossen, »diesen Schuldschein einzulösen«, und weigerte sich zu glauben, »dass die Bank der Gerechtigkeit bankrott« sein könne.30
Die heutige Generation verwirft diese Gefühle als naiv. Für Autorinnen wie Schreck stellen Ungleichheiten zwischen verschiedenen ethnischen Gruppen keinen Verrat an Amerika dar, sondern seine Definition. Rassismus ist keine von bestimmten Personen begangene Sünde – sondern eine allgegenwärtige gesellschaftliche Kraft, an der alle Weißen unweigerlich mitschuldig seien. Und die letzten fünfzig Jahre schreiben nicht die Geschichte eines großen, wenn auch zickzackartigen Fortschritts hin zu mehr Gerechtigkeit und Gleichheit – sondern haben bestenfalls ein paar kurze Atempausen von der weißen Vorherrschaft gebracht, die die DNA des Landes ausmacht.
Da sie für das letzte halbe Jahrhundert keinen deutlichen Fortschritt erkennen wollen, haben sie natürlich auch wenig Hoffnung für die nächsten fünfzig Jahre. So wie sie die Dinge sehen, werden sich »Weiße« und sogenannte »People of Color« immer als unversöhnliche Feinde gegenüberstehen. Und sollten Länder wie die Vereinigten Staaten tatsächlich einen erkennbaren Fortschritt in Richtung Gerechtigkeit machen, dann nur aufgrund eines unerbittlichen Machtkampfes, als Ergebnis eines Sieges der Unterdrückten über die Unterdrücker.
Viele der Ungerechtigkeiten, die diese Autoren beschreiben, sind real. Trotzdem führt ihr Fatalismus ebenso wenig zu einem realistischen Blick darauf, wie es möglich sein könnte, funktionierende diverse Demokratien zu schaffen, wie die Xenophobie der Rechtsextremisten. Wenn das große Experiment gelingen soll, brauchen wir eine optimistischere Vision für die Zukunft.
Von der Notwendigkeit einer optimistischen Vision
Diejenigen, die das große Experiment mit großem Pessimismus beäugen, zeichnen weder ein realistisches Bild seines aktuellen Zustands noch seiner möglichen Zukunft.
Manche Pessimisten behaupten, Immigranten und andere Mitglieder von Minderheiten würden sich nicht in den gesellschaftlichen Mainstream integrieren, weil sie dumm, faul oder bösartig seien. Andere weisen diese Analyse zurück und machen vergangene Unterdrückung oder fortbestehende Hürden für den niedrigeren sozioökonomischen Status von Minderheiten verantwortlich. Beide Sichtweisen übersehen, dass diese Gruppen in Wirklichkeit erhebliche Fortschritte in Richtung Gleichstellung machen.
In den meisten diversen Demokratien steigen die Nachkommen von Einwanderern und die Angehörigen von Minderheiten in der gesellschaftlichen Rangordnung schnell auf. Sie erlangen immer mehr Universitätsabschlüsse. Ihr Einkommen steigt rasch. In Wirtschaft, Kultur und Politik erreichen sie einflussreichere und angesehenere Positionen, als ihre Eltern und Großeltern es sich hätten vorstellen können.
Auch die Ansichten der Mehrheit zu Herkunft und Religion verändert sich rasend schnell. Ob in Deutschland oder Australien: Die Wahrscheinlichkeit, dass Bürger eine feindselige Einstellung gegenüber ethnischen oder religiösen Minderheiten hegen, ist deutlich gesunken. Gleichzeitig steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen eine Person, die nicht dieselbe Hautfarbe oder Religion hat, als echten Deutschen oder echte Australierin anerkennen.
Solange wir zurückdenken können, war Amerika von offizieller Segregation und offenem Hass geprägt. Gültige Gesetze machten es schwarzen und weißen Amerikanern schwer, Freundschaft zu schließen, und verboten es ihnen, zu heiraten. Heute gibt es schwere Strafen für Unternehmen, die gesetzeswidrige Diskriminierung betreiben. Personen, die Hassverbrechen begehen, landen im Gefängnis. Die Zahl von Freundschaften, Partnerschaften und Familien mit gemischter Herkunft und Hautfarbe wächst stündlich. Und obwohl die Lücke beim Einkommen und im Bildungsstatus, bei der Lebenserwartung und dem Risiko einer Inhaftierung noch deutlich sichtbar ist, schließt sie sich immer weiter.31
Allen Schatten der Vergangenheit zum Trotz bewegen sich die meisten Demokratien ganz klar darauf zu, Diversität in ihr Selbstbild zu integrieren.
Eine übermäßig pessimistische Einschätzung des derzeitigen Status diverser Demokratien ist nicht nur falsch. Sie zeichnet auch eine abstoßende Vision der Zukunft und schadet damit den Erfolgsaussichten des großen Experiments.
Menschen, die sich stark für Politik interessieren, neigen gerade bei heiß diskutierten Themen zu polarisierten Ansichten. Entweder befürworten sie diverse Demokratien und glauben, dass eine intolerante oder gar rassistische Mehrheitsbevölkerung die Verantwortung für alle Schwierigkeiten bei ihrem Aufbau trage. Oder sie lehnen diverse Demokratien ab und schieben Immigranten oder Minderheiten die Schuld für alle derzeitigen Probleme zu.
Die meisten Bürger jedoch interessieren sich wenig für Parteipolitik und haben gegenüber den zentralen Fragen der Politik eher ambivalente Gefühle. Sie wünschen sich, dass das große Experiment gelingt. Aber sie machen sich auch Sorgen über Veränderungen in ihrem Land, die ihren Gewohnheiten zuwiderlaufen, oder über Probleme, die eine wachsende Diversität mit sich bringen kann. Sie verabscheuen die Ungerechtigkeit, die viele ihrer Landsleute erleiden, von Herzen. Aber sie fragen sich auch, ob mehr Einwanderung nicht womöglich zu mehr Kriminalität oder Terrorismus führen könnte.32
Wer sich diverse Demokratien wünscht, die erfolgreich sind, muss darum bemüht sein, anständige Leute, die dem großen Experiment solche ambivalenten Gefühle entgegenbringen, an Bord zu holen. Doch diese Leute werden sich kaum überzeugen lassen, wenn man ihnen sagt, dass sie sich als ersten Schritt eine unerbittlich negative Einschätzung ihres eigenen Landes zu eigen machen müssen. Und sie werden auch kaum an der Verwirklichung gerechterer Demokratien mitarbeiten, wenn man sie glauben macht, diese würden selbst im besten Fall zu einem Existenzkampf verschiedener Identitätsgruppen führen.
Es gibt gute Gründe für die Sorge, das große Experiment könnte misslingen.
So ist es durchaus denkbar, dass diverse Demokratien selbst in fünfundzwanzig oder fünfzig Jahren noch unter denselben Ungerechtigkeiten leiden werden, die sie heute prägen. Doch es ist viel zu früh, sich mit einer düsteren Vision der Zukunft abzufinden, laut derer die meisten Menschen die Angehörigen anderer Religionen oder Hautfarben weiterhin misstrauisch beäugen werden; Mitglieder verschiedener Identitätsgruppen im Alltag kaum Kontakt zueinander haben werden; wir alle mehr auf die Unterschiede, die uns trennen, als auf die Gemeinsamkeiten, die uns verbinden, schauen werden; und die politischen und kulturellen Gräben immer noch zwischen Christen und Muslimen, zwischen Einheimischen und Migranten oder zwischen Schwarz und Weiß verlaufen werden.
Vielleicht wirkt es smart und cool, ehrgeizigere Zukunftsvisionen als naiv oder utopisch zu belächeln. In Wahrheit hat das große Experiment aber viel größere Erfolgsaussichten, wenn seine eifrigsten Verfechter versuchen, Gesellschaften aufzubauen, in denen die meisten Menschen auch gern leben würden.
Um solche Gesellschaften aufzubauen, sollten wir darauf hinweisen, dass die Mankos von heute nicht die Möglichkeiten von morgen festschreiben müssen. Mitglieder diverser Demokratien können durchaus engere Freundschaften und Beziehungen knüpfen. Nationen können Neuankömmlinge als gleichwertige Mitglieder integrieren. Menschen aus unterschiedlichen ethnischen und kulturellen Gruppen können gemeinsam ein sinnerfülltes Leben führen, ohne ihre jeweilige Identität aufgeben zu müssen. Und askriptive Identitäten wie die Hautfarbe können eine geringere Rolle spielen, als das jetzt der Fall ist – nicht weil Menschen vor ihrer heutigen Bedeutung die Augen verschließen, sondern weil sie viele der Ungerechtigkeiten, die sie heute verursachen, überwunden haben werden.
Wer es ernst meint mit der Schaffung diverser Demokratien, die Bestand haben oder gar gedeihen, muss eine positive und realistische Vision für das Gelingen des großen Experiments entwerfen. Genau das möchte ich in diesem Buch tun.
Im ersten Teil erkläre ich, warum das große Experiment eine solch ernste Herausforderung ist. Menschen neigen stark dazu, In-Groups zu bilden und Außenseiter zu diskriminieren. Das erklärt ein Stück weit, warum diverse Demokratien oft unter Anarchie, Dominanz und Fragmentierung leiden. Um diese Fallstricke zu vermeiden, brauchen wir Regeln und Institutionen, die unsere instinktive Neigung zum Gruppendenken in Schach halten können.
Im zweiten Teil entwerfe ich eine ehrgeizige Vision für die Zukunft diverser Demokratien. Die Bürger solcher Gesellschaften können ihren tiefsten Überzeugungen treu bleiben und sich gleichzeitig gewiss sein, dass sie sowohl von staatlicher Unterdrückung als auch von den restriktiven Normen ihrer eigenen Gruppe beschützt werden. Sie empfinden eine gemeinsame Verantwortung für ihr Land, das sowohl in seinen politischen Traditionen als auch in seiner alltäglichen Kultur wurzelt. In ihnen ähnelt der öffentliche Raum einem belebten Park, in dem jede Gruppe ihr eigenes Ding machen kann, sich Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund aber auch oft zu gemeinsamem Handeln entschließen. Und schließlich gäbe es in ihnen informelle Regeln für den Umgang miteinander, die alle zu größerem gegenseitigen Verständnis und Solidarität ermutigen – in dem festen Glauben, dass die Bürger diverser Demokratien gemeinsam ein sinnerfülltes Leben gestalten können.
Im dritten Teil des Buchs schließlich werde ich erklären, warum eine solch ehrgeizige Zukunftsvision für diverse Demokratien realistisch ist, und gleichzeitig aufzeigen, wie Bürger und Politiker dazu beitragen können, sie zu verwirklichen. In den letzten Jahrzehnten ist es diversen Demokratien in aller Welt gelungen, den Lebensstandard von Minderheiten deutlich zu erhöhen und sie wesentlich stärker in den gesellschaftlichen Mainstream zu integrieren. Sie können eine viel besser integrierte Kultur und Politik aufbauen und so eine dystopische Zukunft, die von Gräben zwischen Einheimischen und Migranten oder zwischen Weißen und »People of Color« gezeichnet wäre, vermeiden. Für die ernsten Herausforderungen und Ungerechtigkeiten, die heute noch herrschen, gibt es keine Allheilmittel. Aber realistische Veränderungen in Politik, Kultur und Alltag können das Gelingen solch diverser Demokratien deutlich beschleunigen.
Bevor es losgeht, möchte ich kurz ansprechen, wovon dieses Buch nicht handelt. Diversität ist ein vielschichtiges Phänomen. Menschliche Gesellschaften kennen die Spaltung entlang von Klassenunterschieden und Geschlechtszugehörigkeit seit jeher. Länder wie Frankreich, in denen die »Ureinwohner« für den heutigen Beobachter relativ homogen wirken, sind aus Regionen zusammengesetzt, die früher stolz auf ihre eigenen Bräuche, Gesetze, Traditionen und Dialekte pochten. Und eine ganze Reihe von Demokratien, darunter Belgien und Kanada, muss eine gemeinsame Regierung zusammenhalten, obwohl das Land aus kulturell und sprachlich verschiedenen Territorien zusammengesetzt ist.
Gelegentlich werde ich auf historische Beispiele zurückgreifen, die diese Konfliktebenen verdeutlichen. Aber mein Hauptaugenmerk liegt auf einer neueren Herausforderung für den Erfolg und das Überleben der diversen Demokratie: die Weise, in der grundlegende Identitätsmerkmale wie die Ethnie und die Religion die Bewohner der führenden Demokratien der Welt spalten.
In der derzeitigen Situation fällt Optimismus nicht unbedingt leicht. Und als jemand, der bereits vor der ernsten Bedrohung durch autoritäre Populisten gewarnt hat, bevor Trump 2016 Präsident der USA wurde, bin ich, wenn es um Optimismus geht, vielleicht nicht die erste Wahl. Trotzdem muss ich zugeben, dass ich wesentlich zuversichtlicher in die Zukunft blicke, als es derzeit Mode ist.
Es wäre freilich blindem Optimismus geschuldet, nicht zu sehen, dass unsere Demokratien dringend Verbesserungen nötig haben. Aber genauso wäre es blindem Zynismus geschuldet, zu glauben, dass wir nicht in der Lage seien, auf den Fortschritten der letzten fünfzig Jahre aufzubauen – oder dass unsere Gesellschaften auf ewig dazu verdammt seien, von Rassismus oder Exklusion geprägt zu sein.
Der Weg zum Erfolg für das große Experiment ist steinig. Aber ein Misserfolg wäre viel zu teuer, als dass wir uns mit weniger zufriedengeben oder auf halbem Wege haltmachen dürften.
Teil eins
Wenn diverse Gesellschaften scheitern
Wenn diverse Gesellschaften scheitern
Meine Mutter hasst Menschenmengen. Als ich ein Kind war, gingen wir ihnen, so gut es irgendwie möglich war, aus dem Weg. Fußballspiele mit Zehntausenden Fans, die ihre Mannschaft anfeuerten – und den Gegner schmähten – waren ihr besonders unangenehm.
Da wir mitten in München lebten, trafen wir manchmal vor einem Bayern-Spiel auf kleinere Gruppen von gegnerischen Fans, die auf der Suche nach einer Kneipe oder einem Biergarten durch die Straßen zogen. Auf mich wirkten sie meistens harmlos. Aber sobald meine Mutter sie sah, zog sie mich auf die andere Straßenseite.
Trotzdem befanden wir uns immer wieder mal zur falschen Zeit am falschen Ort. Einmal fuhren wir an einem Samstagnachmittag um drei mit der U-Bahn zu Freunden im Norden der Stadt. Kaum waren wir am Marienplatz angekommen, stiegen Hunderte von Fußballfans zu, die fröhlich sangen und hüpften. Meine Mutter drückte meine Hand ganz fest und versicherte mir, ich müsse keine Angst haben. Schon damals wusste ich, dass eher sie diejenige war, die beruhigt werden musste.
Ihre Angst vor Menschenmengen hat mit ihrer Veranlagung zu tun: Sie ist eine zurückhaltende Frau, die schon immer das Zusammensein mit einigen wenigen Freunden großen Partys oder Versammlungen vorzog. Aber sie entstammt auch ihrer politischen Überzeugung.
Einige Jahre vor der Geburt meiner Mutter wurde ein Großteil ihrer Familie im Holocaust ermordet. Als sie Anfang zwanzig war, gab es in Polen eine gewalttätige Welle an Antisemitismus, die sie und ihre Eltern aus dem Land trieb. Menschenmengen sind für sie aufs Engste mit der tragischen Geschichte des 20. Jahrhunderts verbunden. Wenn sie Hunderte Fußballfans sieht, die ihre Stadiongesänge grölen, ist das für sie keine Gruppe von Leuten, die ihrer gemeinsamen Liebe zum Fußball und ihrem Stolz auf ihre Heimatstadt Ausdruck verleihen. Für sie repräsentieren diese Gesänge vielmehr die dunkelste Seite des menschlichen Charakters. Sie erinnern sie an die Neigung des Menschen, sich in Gruppen zusammenzuschließen, individuelles Urteilsvermögen kollektiven Leidenschaften zu opfern und – allzu oft – Außenstehenden schreckliches Leid zuzufügen.
Ich bin nicht wie meine Mutter.
Als Kind liebte ich Fußball und war ein leidenschaftlicher Bayern-Fan. Sobald ich alt genug war, ging ich zu Heimspielen ins Olympiastadion und genoss die dortige Atmosphäre. Und doch haben die Ansichten meiner Mutter über das Wesen von Gruppen und die Gefahren eines Stammesdenkens mein eigenes Weltbild zutiefst geprägt.
Auch ich war der Ansicht, die beste Verteidigung gegen gefährliche Formen von Gruppendenken sei eine entschieden individualistische Haltung. Und auch ich dachte, die Bedeutung von Gruppenidentitäten würde, je toleranter und fortschrittlicher die Gesellschaft wird, umso mehr zurückgehen. Irgendwann würden wir uns nicht mehr als Deutsche oder Franzosen, als Juden oder Nichtjuden, als Weiße oder Schwarze begreifen, sondern den anderen einfach nur als Menschen sehen. Das Zeitalter des Nationalismus würde einer Ära des Kosmopolitismus weichen, in der die meisten von uns sich um Menschen, die wir noch nie getroffen haben, genauso sorgen wie um unsere nächsten Nachbarn.
In vielerlei Hinsicht halte ich eine solche Vision weiterhin für sehr nobel. Die Welt wäre besser dran, wenn wir alle die eigene Gruppe oder Nation weniger stark bevorzugten und mehr Mitgefühl für Menschen zeigten, die weit entfernt leben. Wer es wagt, die Stimme zu erheben, wenn Mitglieder der eigenen Gruppe ungerecht handeln, oder gar echte Opfer erbringt, um Menschen, mit denen er nur wenige Gemeinsamkeiten hat, zu helfen, verdient unsere tiefste Bewunderung.
Inzwischen aber bin ich viel in der Welt herumgekommen und habe mich mit ihrer Geschichte beschäftigt. Dabei bin ich zu der Überzeugung gelangt, dass eine generelle Ablehnung sämtlicher Formen kollektiver Identität nicht der richtige Weg ist, um tolerante Gesellschaften aufzubauen. Wenn wir die dunkelsten Aspekte unserer menschlichen Natur in Schach halten wollen, ist die richtige Frage nicht, ob wir unseren Gruppeninstinkt überwinden können – sondern wie wir das enorme positive Potenzial dieses Instinkts nutzen und seine negativen Seiten eindämmen können.
Unsere Neigung, uns in Gruppen zusammenzuschließen, ist nicht nur für die dunkelsten Kapitel der Menschheitsgeschichte verantwortlich – sondern auch für die größten Leistungen unserer Spezies.
Schimpansen sind hochintelligente Lebewesen. Doch sosehr sie sich auch wünschen, an Nahrung heranzukommen, die nur über einen Holzbalken erreichbar wäre – sie schaffen es nicht, sich zusammenzutun, um den Balken in die richtige Position zu schieben. Nach Ansicht der meisten Naturwissenschaftler sind sie schlicht nicht gemeinschaftsorientiert genug, um eine so einfache Aufgabe zu lösen.33 Laut Michael Tomasello, einem Psychologen, der sich auf soziale Kognition spezialisiert hat, »ist es unvorstellbar, dass zwei Schimpansen zusammen einen Holzbalken tragen«.34
Menschen jedoch definieren sich nicht nur über ihre Intelligenz, sondern auch über ihren Gemeinschaftssinn. Ab einem Alter von drei bis vier Jahren sind Kinder zu Formen der Kooperation in der Lage, die Schimpansen niemals erreichen.35 Indem sie zusammenarbeiten, haben Menschen riesige Städte erbaut, wunderbare Kunstwerke geschaffen und Menschen zum Mond gebracht.
Viele dieser Leistungen wurden im Namen bestimmter Identitätsgruppen erbracht: Die Römer bauten ihre Stadt mit aller Pracht aus, um die Macht Karthagos einzudämmen. Fromme Künstler schufen wunderbare Darstellungen von Christus oder riesige Buddha-Statuen, um die eigene Zivilisation zu verherrlichen. Und die Amerikaner investierten Unsummen in die Mondlandung, um es den Sowjets zu zeigen.
Selbst meine Mutter, diese eingefleischte Individualistin, verbrachte ihr Berufsleben mit einer Tätigkeit, die Sozialwissenschaftler oft als bestes Beispiel für die erstaunliche Fähigkeit des Menschen anführen, Gruppen zu bilden, die ein gemeinsames Ziel eint: Als Dirigentin hatte sie die Aufgabe, aus den Stimmen und Instrumenten von mehr als hundert Musikern ein Kunstwerk zusammenzufügen.
Wenn wir über die Herausforderungen sprechen, die der Aufbau einer diversen Demokratie in unseren Tagen mit sich bringt, liegt es nahe, sich auf den gegenwärtigen Zustand unserer eigenen Gesellschaften oder die jüngsten Kontroversen in den sozialen Medien zu konzentrieren. Doch bevor wir entscheiden können, welche Art von Gesellschaft wir eigentlich aufbauen wollen und wie uns das gelingen könnte, müssen wir diese Frage in den Kontext der Geschichte und Psychologie des Menschen stellen. Denn es ist unmöglich, die wahren Ursachen all der Probleme zu erkennen, mit denen diverse Demokratien konfrontiert sind – oder gar zu analysieren, wie es besser laufen könnte –, wenn wir nicht verstehen, wie Menschen ticken und wie frühere Gesellschaften mit Diversität umgegangen sind.
Deshalb stellt der erste Teil dieses Buchs die großen Fragen, die wir beantworten müssen, bevor wir uns mit den Problemen, die diverse Demokratien in der Gegenwart meistern müssen, befassen können. Haben Menschen eine natürliche Neigung, Gruppen zu bilden? Ziehen sie zwangsläufig die In-Group vor und diskriminieren Außenstehende? Werden uns Kategorien wie Religion und Hautfarbe immer trennen? Auf welche Arten sind die diversen Gesellschaften der Vergangenheit zerfallen? Und was können wir aus alldem lernen, damit diverse Demokratien in Zukunft besser funktionieren als in der Vergangenheit?
Kapitel 1
Warum der Konflikt vorprogrammiert ist
Als Henri Tajfel in Włocławek, einer Kleinstadt in Polen, geboren wurde, hatten seine Eltern guten Grund zu glauben, vor ihrem Sohn läge eine bessere Zukunft. Der Erste Weltkrieg war gerade zu Ende gegangen. In ganz Europa warfen Länder Monarchie und Fremdherrschaft ab und gaben sich demokratische Verfassungen. Polen wurde zum ersten Mal seit hundert Jahren wieder unabhängig.
Als Tajfel ins Teenageralter kam, waren diese Hoffnungen bereits wieder zerstört. Die polnische Demokratie musste einer Militärdiktatur weichen. In ganz Europa wuchs der Antisemitismus. Weil es eine Quote für Juden gab, konnte sich Tajfel in seinem Heimatland nicht für ein Studium an der Universität einschreiben.
Er zog nach Paris und studierte Chemie an der Sorbonne. Als der Zweite Weltkrieg begann, meldete er sich freiwillig für den Dienst in der französischen Armee, geriet aber schnell in deutsche Kriegsgefangenschaft und überlebte die tödlichsten Jahre in der Geschichte Europas in verschiedenen Gefangenenlagern. Bei seiner Befreiung musste er erfahren, dass die Nazis den größten Teil seiner Familie ermordet hatten.36
Um das Schicksal seiner Eltern und Geschwister zu verstehen, entschloss sich Tajfel, darüber zu forschen, wie der Hass scheinbar zivilisierte Nationen so ergreifen konnte, dass sie Millionen von Menschen schlachteten. Mit einem Essay über die Natur des Vorurteils gewann er ein Stipendium für das Studium der Psychologie am Birkbeck College in London.
Im Verlauf seines Studiums stieß Tajfel auf eine Reihe neuer Experimente, die zeigten, wie leicht man Menschen dazu bringen kann, einander schreckliche Dinge anzutun. Was passiert, wenn ein Wissenschaftler im weißen Kittel einem Probanden die Anweisung gibt, einem anderen Probanden Elektroschocks zuzufügen, selbst wenn dieser fleht, man möge damit aufhören? Wenn Sie ähnlich ticken wie die Mehrzahl der Amerikaner (oder, wie spätere Studien zeigten, die Mehrzahl der Deutschen, Jordanier und Australier), werden Sie weitermachen, auch wenn ihr Opfer sich vor Schmerzen windet.37
Und was passiert, wenn nette Mittelschicht-Jungs aus einer friedlichen amerikanischen Stadt in zwei Gruppen aufgeteilt werden, die miteinander um Nahrung und Feuerholz konkurrieren? Innerhalb weniger Tage entsteht eine tiefe Bindung innerhalb der eigenen Gruppe – und brodelnder Hass gegen die Mitglieder der anderen.38
Psychologen haben in den Fünfziger- und Sechzigerjahren immer und immer wieder gezeigt, wie schockierend leicht sich Menschen dazu verleiten lassen, einander zu hassen, sobald man sie in Gruppen aufteilt. Doch während sich die Beweise für die Verderbtheit des Menschen häuften – nicht nur auf den Schlachtfeldern des Zweiten Weltkriegs, sondern auch in den friedlichen Laboren angesehener Universitäten –, wuchs Tajfels Frustration darüber, dass die Sozialwissenschaftler noch immer nicht wussten, warum Gruppen bereit sind, einander so schreckliche Dinge anzutun. Was braucht es, um eine Gruppe zu formen? Und welche Eigenschaften dieser Gruppen befähigen Menschen zu solch entsetzlicher Grausamkeit?
Das war das Rätsel, von dem Tajfel – der inzwischen einen angesehenen Lehrstuhl für Sozialpsychologie an der Universität Bristol innehatte – besessen war.39 Um es zu lösen, führte er eine genial kontraintuitive Studie durch. Er bildete Gruppen, die so bedeutungslos sein sollten, dass ihre Mitglieder nicht auf die Idee kommen würden, sie gegenüber anderen zu bevorzugen. Daraufhin wollte Tajfel diesen Gruppen allmählich weitere Merkmale hinzufügen, um dann zu beobachten, wann ihre Mitglieder die Bereitschaft entwickeln würden, Außenstehende zu diskriminieren.
Im Jahr 1970 bildete Tajfel eine solche Gruppe aus vierundsechzig Jungen im Teenager-Alter, die eine Schule in einem nahe gelegenen Vorort besuchten. Nachdem sie sich in einem großen Hörsaal versammelt hatten, stellte er ihnen die beliebigste Aufgabe, die ihm einfiel: Seine Assistenten zeigten ihnen vierzig Anordnungen von Punkten und forderten sie auf zu raten, wie viele Punkte auf diesen Bildern jeweils zu sehen waren.
Manche Menschen, erklärte Tajfel den Jungen, neigen dazu, die Zahl der Punkte zu unterschätzen. Andere neigen dazu, sie zu überschätzen. Keine Gruppe hat einen Vorteil bei der Annäherung an das richtige Ergebnis.
Im zweiten Teil des Experiments teilte Tajfel die Jungen in eine Gruppe von »Unterschätzern« und eine Gruppe von »Überschätzern« ein40 und forderte sie auf, ihren Mitschülern Punkte zu geben, die später in Geld eingetauscht werden konnten. Sie erfuhren nicht, wem die Punkte zugeteilt wurden, sondern sollten lediglich verschiedene Belohnungen an »Mitglied Nummer eins deiner Gruppe« und »Mitglied Nummer eins der anderen Gruppe« verteilen.
Da die Jungen »nach nichtigen, bedeutungslosen Kriterien aufgeteilt worden waren«, schrieb Tajfel später in einem Aufsatz, der weite Teile der Sozialwissenschaft verändern sollte, erwartete er nicht, dass sie die Mitglieder ihrer eigenen Gruppe bevorzugen würden. Denn unter den Umständen würde eine solche Form der Diskriminierung schlicht keinen Sinn machen.
Trotzdem bevorzugten fast alle von ihnen die Mitglieder ihrer eigenen Gruppe.
Der Unterschied zwischen der Behandlung von Mitgliedern der »eigenen« und der »fremden« Gruppe war verblüffend. Solange Geld zwischen den verschiedenen Mitgliedern der eigenen Gruppe verteilt werden sollte, waren die Jungen bemüht, allen denselben Betrag zuzusprechen. Doch sobald sie vor die Wahl gestellt wurden, einem Mitglied der eigenen oder der fremden Gruppe Geld zuzuteilen, bevorzugten sie die eigene Gruppe. »Das Einzige, was nötig war, um dieses Ergebnis zu erreichen«, berichtete Tajfel, »war die Verbindung ihrer Ergebnisse beim Raten von Zahlen mit dem Begriff ›deine Gruppe‹.«
Erstaunt über dieses Ergebnis, wiederholte Tajfel den Versuch mit anderen, ähnlich nichtigen Kriterien. In einem Fall zeigte er Schuljungen Gemälde von Paul Klee und Wassily Kandinsky und fragte, welches ihnen besser gefiele. Zu seiner Verblüffung verbündete sich die »Klee-Gruppe« sofort gegen die »Kandinsky-Gruppe« (und umgekehrt).
In den folgenden Jahren haben zahlreiche andere Forscher Tajfels Ergebnisse bestätigt. Sie konnten Menschen aufgrund so alberner Kriterien wie der Farbe ihres T-Shirts oder ihrer Meinung, ob ein Hotdog ein Sandwich sei, zur Bevorzugung der »eigenen Gruppe« veranlassen.41
»Die Diskriminierung von Außenstehenden«, so Tajfel, »ist unglaublich leicht in Gang zu setzen.«42
Für diejenigen unter uns, die das Glück hatten, in einer vergleichsweise friedlichen und toleranten Gesellschaft aufzuwachsen, ist es verführerisch zu denken, Stammesrivalitäten oder Hass aufgrund ethnischer Unterschiede seien eine außergewöhnliche Verirrung. Ich selbst dachte früher, die Neigung zur Gruppenbildung sei alles andere als natürlich – und müsse dem Menschen erst eingebläut werden. Wenn wir nur die zynischen Demagogen und Politiker überwinden könnten, die unsere niedrigsten Instinkte anstacheln, würden wir alle in Harmonie leben.
Tajfels Forschung widerlegt diese beruhigende Annahme. Er hat gezeigt, dass die Neigung, Gruppen zu bilden und Außenseiter zu diskriminieren, in uns allen schlummert.
Selbst gebildete Menschen, die in guten Verhältnissen aufgewachsen sind, sind natürlich dazu veranlagt, Gruppen zu bilden. Wir mögen uns für Individualisten halten, die mit allen anderen fair umgehen wollen. Aber in Wirklichkeit sind wir jederzeit bereit, den Unterschätzern gegen die Überschätzer beizustehen oder in einer Auseinandersetzung mit dem Team Klee gegen das Team Kandinsky ins Feld zu ziehen.
Tajfels »Minimalgruppen-Paradigma« bietet uns eine wichtige Erkenntnis. Doch die letzten hundert Jahre sind voll von Fällen, in denen Menschen einander aufgrund von angeblichen Unterschieden ermordeten, die weitaus bedeutungsvoller als diejenigen sind, die Tajfel in seinem Labor erschaffen konnte.
Im Ersten und Zweiten Weltkrieg lag die Hauptunterscheidung in den tödlichsten Konflikten der Menschheitsgeschichte zwischen Nationen. In den gewaltsamen Konflikten zwischen gemäßigten Muslimen und islamistischen Terroristen wie auch bei der Massenvernichtung von »Klassenfeinden« durch kommunistische Regierungen waren die Kriterien religiöser oder ideologischer Art. Und die Völkermorde von Ruanda bis Sarajevo waren hauptsächlich ethnisch motiviert.
Werden die tödlichsten Konflikte von Gruppen ausgelöst, deren Zusammensetzung ebenso willkürlich ist wie in Tajfels Experimenten? Oder sind die meisten von echten Unterschieden getrieben, die seit Langem bestehen?
Weder natürlich noch willkürlich
Viele Menschen glauben, die wichtigsten Gruppen in unserem Leben seien zutiefst bedeutungsvolle Einheiten, die natürlichen, biologischen oder weit zurückreichenden historischen Unterschieden folgen.
Französische Schülerinnen und Schüler lernen über »unsere Vorfahren, die Gallier«.43 Die Chinesen nennen ihr Land das Reich der Mitte.44 Die Maori bezeichnen sich als Kinder der Erde.45 Praktisch alle solchen Mythen enthalten zwei Aussagen über die jeweilige Gruppe: Sie beschreiben sie als natürliche Einheit, und sie behaupten, ihre Wurzeln ließen sich bis in Urzeiten zurückverfolgen. In der Sprache der Sozialwissenschaft werden die Geschichten, die die meisten Gruppen über sich selbst erzählen, »primordial« genannt.
Die primordiale Sicht auf soziale Gruppen hat durchaus wahre Wurzeln. Wir alle wissen, dass es auffällige visuelle Unterschiede zwischen vielen ethnischen Gruppen gibt. In den meisten Fällen brauchen wir nur den Bruchteil einer Sekunde, um zumindest eine Vermutung darüber anzustellen, ob die Vorfahren eines Menschen, dem wir auf der Straße begegnen, aus Europa, Asien oder Afrika stammen. Wer eine Kultur oder einen Kontinent gut kennt, kann vielleicht sogar die Unterschiede zwischen einem Italiener und einem Spanier, einer Kenianerin und einer Nigerianerin, einem Bengali und einem Bihari oder zwischen einer Japanerin und einer Koreanerin ausmachen.
In vielen Fällen haben Mitglieder heutiger ethnischer Gruppen auch eine gemeinsame Abstammung. Nach allem, was wir wissen, stammen Juden und Zoroastrier von kleinen Gruppen ab, die vor Tausenden von Jahren diese Identitäten angenommen haben.46 Und wenn Sie ein Gläschen mit Speichel und 99 Dollar an die freundlichen Leute bei 23andMe schicken, bekommen Sie eine hübsche Tabelle, die Ihnen sagt, dass sie beispielsweise zu 75 Prozent aus Westafrika, zu 10 Prozent aus Südasien, zu 10 Prozent aus Ozeanien und zu 5 Prozent aus Südeuropa stammen. Außerdem erfahren Sie dann, ob Sie zu 100 Prozent Homo sapiens sind oder ein bisschen Neandertalerblut in den Adern haben.
Genetische Unterschiede zwischen ethnischen Gruppen können sogar medizinische Relevanz haben. Ärzte wissen heute, dass vielen Ostasiaten ein Enzym fehlt, das die Verarbeitung von Alkohol erleichtert.47 Afroamerikaner haben ein erhöhtes Risiko, an Sichelzellenanämie zu erkranken,48 aschkenasische Jüdinnen, an Brustkrebs zu sterben.49
So gern wir es anders hätten, können wir die Unterschiede zwischen ethnischen Gruppen nicht einfach vom Tisch wischen. Aber obwohl viele ethnische Gruppen echte historische Gemeinsamkeiten haben, sind die Unterschiede zwischen ihnen gleichzeitig viel fließender, als die meisten Menschen denken.
Viele Behauptungen über die durchschnittlichen Unterschiede zwischen Mitgliedern verschiedener Gruppen sind deutlich übertrieben oder komplett falsch. Wie wir die Grenzen zwischen verschiedenen Gruppen ziehen, hängt stark von vergangenen politischen Debatten und anderen historischen Umständen ab. Und da nicht immer klar ist, wer zu welcher Gruppe gehört, kann die Art und Weise, wie wir die Zugehörigkeit zu verschiedenen Identitätsgruppen definieren, höchst willkürlich sein – wie die erschreckende Geschichte einer Frau zeigt, die in die Fänge der brasilianischen Bürokratie geriet, weil diese ihre »Rassenzugehörigkeit« nicht klar klären konnte.
Wie Millionen anderer Brasilianer ist auch Maíra Mutti Araújo gemischter Abstammung.50
Unter ihren Vorfahren sind wahrscheinlich Angehörige indigener Völker, die seit Jahrhunderten im Land leben, versklavte Afrikaner, die in Ketten dorthin verschleppt wurden, um Zuckerrohr oder Kaffee zu ernten, und portugiesische Kolonisten, die auf der Suche nach Reichtum und Macht nach Südamerika kamen.
Die junge Juristin galt als pardo, die brasilianische Bezeichnung für Menschen, deren Hautfarbe weder weiß noch schwarz ist. Da sie dunkler aussah als einige andere Mitglieder ihrer Familie, nannten ihre Eltern sie zärtlich pretinha, ein Kosename für dunkelhäutige Mädchen.
Als nun der brasilianische Bundesstaat Bahia ein Quotensystem ins Leben rief, um dafür zu sorgen, dass ein größerer Anteil der Stellen im öffentlichen Dienst von pretos oder pardos besetzt würde, und die Stadt Salvador neue Posten als Staatsanwalt ausschrieb, folgte Araújo dem Rat ihrer Freunde und bewarb sich.
Sie brachte drei heftige Prüfungen hinter sich und landete unter tausend Bewerbern auf Platz drei. Ihr Traum war zum Greifen nah. Doch dann begann, wie sie selbst es in einem Interview mit der brasilianischen Journalistin Cleuci de Oliveira nannte, eine »Rassen-Soap«, in der ihr die Rolle des Bösewichts zugewiesen wurde.
In der zweiten Runde des Bewerbungsprozesses versuchte die Einstellungskommission herauszufinden, ob die vielversprechenden Bewerberinnen und Bewerber für einen Posten infrage kamen, der für dunkelhäutige und schwarze Brasilianer reserviert war. Araújo wurde aufgefordert, Fotos einzusenden und einen Fragebogen zu ihrer ethnischen Identität auszufüllen. Sie wurde nach etwaigen schwarzen oder dunkelhäutigen Vorbildern befragt und sollte beantworten, ob sie »mit einer schwarzen oder braunen Person zusammen ist«.
»Ich fand die Fragen übergriffig«, sagte Araújo in dem Interview zu Oliveira. »Was hat es denn mit meiner Identität zu tun, mit wem ich zusammen bin?« Da sie die Stelle aber unbedingt haben wollte, füllte sie den Fragebogen brav aus.
Nach Betrachtung der Fotos und des Fragebogens beschloss die Kommission, Araújo zu disqualifizieren. Sie hatte sich zwar ein Leben lang als pardo gesehen, angeblich fehlte ihr jedoch der nötige »Phänotyp einer afrikanischen Herkunft«.