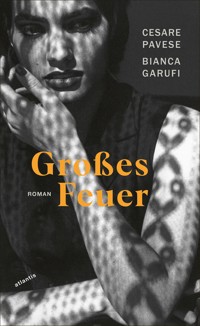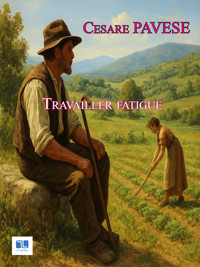Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Rotpunktverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Edition Blau
- Sprache: Deutsch
Fünfzehn Jahre lang hat Cesare Pavese – einer der wichtigsten Vertreter des Neorealismo – in einem Tage¬buch sein Leben und seine Literatur reflektiert. Es sind die Jahre, in denen Paveses Werke erscheinen, von den ersten Gedichten bis zum letzten und berühmtesten Roman Der Mond und die Feuer, in dem Pavese schreibend an den Ort seiner Kindheit zurückkehrt. Neben Gedanken zu seiner Arbeit als Autor und Lektor finden sich in den Tagebüchern Bekenntnisse eines zerrissenen Mannes. Das Handwerk des Lebens ist ein bewegendes Selbstzeugnis, das von den Verletzungen und Enttäuschungen eines großen Schriftstellers erzählt und bereits Jahre vor Paveses Suizid seine Sehnsucht nach dem Tod erahnen lässt. Maja Pflug wurde für ihre Übersetzung von dem Handwerk des Lebens 1999 mit dem Christoph--Martin¬Wieland-Übersetzerpreis ausgezeichnet. Für die Neu¬ausgabe hat sie ihre Übersetzung vollständig durchgesehen und überarbeitet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 532
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cesare Pavese
Das Handwerk des Lebens
Tagebuch 1935–1950
Aus dem Italienischen
von Maja Pflug
Edition Blau im
Rotpunktverlag
1935 beginnt Cesare Pavese, sein Leben, sein Schreiben und seine intensive Auseinandersetzung mit literarischen Werken der Vergangenheit und Gegenwart in einem Tagebuch zu reflektieren. Das Handwerk des Lebens gibt einen einmaligen Einblick in die Gedankenwelt eines Schriftstellers, der vielen als Begründer der modernen italienischen Literatur gilt. Was sein Tagebuch ihm selber bedeutet, formuliert Pavese im Eintrag vom 15. März 1947: »Hier werden die Dinge aufgeschrieben, die man nicht mehr sagen wird, es sind die Hobelspäne. Das Hobeln ist das Tagwerk. Das hier ist, wie soll man sagen, eine unauffällig-rasche Art, die Stützbretter, die Latten, die Gerüste, die schrulligen Grübeleien zu beseitigen. Man macht reinen Tisch, um klar das große Stück zu sehen, das kommen wird.«
Cesare Pavese hat seine Aufzeichnungen vor seinem Tod selbst zur Veröffentlichung bestimmt, indem er ein Titelblatt in die Mappe mit dem Handwerk eingelegt hat. Sie sind nicht nur ein Arbeitsjournal, er hat darin auch rückhaltlos seine Enttäuschungen, seine Niederlagen in der Liebe, seine Frauenfeindlichkeit in bittere Worte gefasst. Höchste Konzentration auf literarische und philosophische Fragen und tiefste innere Zerrissenheit beherrschen Pavese und machen aus dem Handwerk des Lebens »ein erschütterndes Dokument« (Italo Calvino).
Maja Pflug hat ihre preisgekrönte Übersetzung von 1988 überarbeitet und die intimen Passagen ergänzt, die erst 2010 veröffentlicht wurden. In der vorliegenden Neuausgabe ist Cesare Paveses Handwerk des Lebens erstmals vollständig auf Deutsch zugänglich.
Die Übersetzung dieses Buches wurde mit
Unterstützung des SEPS – SEGRETARIATO EUROPEO
PER LE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE erstellt.
Via Val d’Aposa 7 – 40123 Bologna
[email protected] – www.seps.it
Der Verlag bedankt sich dafür.
Der Rotpunktverlag wird vom Bundesamt für
Kultur mit einem Strukturbeitrag für die Jahre 2021
bis 2025 unterstützt.
Die Originalausgabe ist 1952 unter dem Titel Il
mestiere di vivere bei Giulio Einaudi Editore in
Turin erschienen.
© 2024 Rotpunktverlag, Zürich
(für die deutschsprachige Ausgabe)
www.rotpunktverlag.ch
Lektorat: Anina Barandun
Korrektorat: Sarah Schroepf
eISBN 978-3-03973-032-2
1. Auflage 2024
INHALT
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
ANMERKUNG ZUM TEXT
VERZEICHNIS DER IM TEXT GENANNTEN WERKE
Gedichte
Erzählungen
Romane
CESARE PAVESE
Secretum professionale
Okt.–Dez. 1935 und Febr. 1936, in Brancaleone
(Il mestiere di poeta, 1934,
abgedruckt in Lavorare stanca, geht ideell voran)
1935
6. Oktober
Dass manche der letzten Gedichte überzeugen, ändert nichts an der Bedeutung der Tatsache, dass sie mit immer mehr Gleichgültigkeit und Widerstreben geschrieben sind. Auch bedeutet es nicht viel, dass die Erfindungsfreude mich zuweilen sehr heftig überfällt. Beides erklärt sich aus der erworbenen metrischen Gewandtheit, die mir die Lust nimmt, aus einem ungeformten Material etwas herauszuholen, und zugleich aus meinen Interessen im praktischen Leben, die der Meditation über bestimmte Gedichte eine leidenschaftliche Erregung hinzufügen.
Es zählt viel mehr, dass mir die Anstrengung immer nutzloser und unwürdiger erscheint; fruchtbarer als das beharrliche Anschlagen dieser Saiten kommt mir die seit langem geplante Suche nach neuen Dingen vor, die zu sagen sind, und somit neuen Formen, die zu gestalten sind. Denn meine Neigung zur Dichtung hat ihren Anfang in der bangen Sehnsucht nach unbekannten geistigen Wirklichkeiten, die als möglich erahnt werden. Einen letzten Schutz gegen die Manie gewaltsamer Erneuerungsversuche finde ich in der erhabenen Überzeugung, dass die scheinbare Gleichförmigkeit und Strenge der Mittel, die ich nunmehr besitze, wohl noch immer der beste Filter für jedes meiner geistigen Abenteuer ist. Doch die historischen Vorbilder – wenn es in Sachen geistiger Kreativität überhaupt zulässig ist, sich bei Vorbildern irgendwelcher Art aufzuhalten – sind alle gegen mich.
Jedenfalls gab es eine Zeit, da ich einen leidenschaftlichen und sehr einfachen Haufen Stoff ganz lebendig im Sinn hatte, die Substanz meiner Erfahrung, die durch Dichten auf organische Klarheit und Eindeutigkeit zurückzuführen war. Und jeder meiner Versuche knüpfte subtil, aber unvermeidlich an diesen Fundus an, und nie hatte ich das Gefühl, mich zu verirren, wie überspannt der Kern jedes neuen Gedichts auch sein mochte. Ich spürte, dass ich etwas schuf, was das Teilstück (des Augenblicks) (des gegenwärtigen) stets übertraf.
Es kam der Tag, an dem der Haufen Leben ganz in das Werk aufgenommen war, und mir schien, als arbeitete ich nur noch mit Schnipseln oder betriebe Sophisterei. Das ging so weit – und noch klarer wurde es mir, als ich mir eine Studie über die vollbrachte Arbeit vornahm –, dass ich die weiteren Versuche meines Dichtens als Anwendung einer bewussten Technik des Seelenzustands abtat und dass ich aus meiner poetischen Berufung eine Spielerei mit der Poesie machte. Ich verfiel also wieder in den Irrtum, der, erkannt und gemieden, mir anfangs zu so viel frischer schöpferischer Kühnheit verholfen hatte, dass ich, und sei es auch nur indirekt, über mich als Dichter dichtete (Exegi monumentum …).
Auf dieses Gefühl von Rückschritt kann ich antworten, dass ich nun vergeblich einen neuen Ausgangspunkt in mir suchen werde. Seit dem Tag der Mari del Sud1, in denen ich zum ersten Mal in entschiedener und absoluter Form mich selbst ausdrückte, begann ich eine geistige Person aufzubauen, die ich nie mehr wissentlich werde ersetzen können, es sei denn, ich verleugnete sie und stellte jeden Aufschwung, den ich in Zukunft noch nehmen könnte, infrage. Ich antworte also auf das gegenwärtige Gefühl der Vergeblichkeit, indem ich mich demütig der Notwendigkeit beuge, meinen Geist nur in der Art und Weise zu befragen, die ihm bisher natürlich und gewinnbringend war, und jede Entdeckung nach ihrer Fruchtbarkeit im einzelnen, besonderen Fall beurteile. Denn die Dichtung kommt ans Licht, indem man sie versucht, und nicht, indem man sie perspektivisch betrachtet.
Doch warum versuche ich – in der Weise, wie ich mich bisher wie aus einer Laune heraus nur auf Dichtung in Versen beschränkt habe – niemals ein anderes Genre? Es gibt nur eine Antwort, und vielleicht ist sie unzureichend: Nicht aus Laune, sondern aus Gründen der Kultur, des Gefühls, der Gewohnheit weiß ich nun den Pfad nicht zu verlassen, und der plötzliche Einfall, die Form zu ändern, um die Substanz zu erneuern, erschiene mir dilettantisch.
9. Oktober
Jeder Dichter hat sich geängstigt, gewundert, und hat genossen. Die Bewunderung für ein großartiges Stück Dichtung gilt nie seiner verblüffenden Geschicklichkeit, sondern der Neuheit der Entdeckung, die sie enthält. Auch wenn unser Herz vor Freude höherschlägt, wenn wir ein Adjektiv glücklich mit einem Substantiv gepaart finden, die man noch nie zusammen sah, ist es kein Staunen über die Eleganz der Sache, über die Geistesgegenwart, über die technische Geschicklichkeit des Dichters, das uns berührt, sondern Verwunderung über die neue, ans Licht gebrachte Wirklichkeit.
Man muss nachdenken über die große Kraft von Bildern wie dem der Kraniche, der Schlange oder der Zikaden; oder des Gartens, der Dirne und des Windes; des Ochsen, des Hundes, der Kreuzung dreier Wege, usw. Vor allem sind sie für die breit angelegten Werke gemacht, denn sie stellen den Blick dar, der im Verlauf der aufmerksamen Erzählung menschlich wichtiger Begebenheiten auf die äußeren Dinge geworfen wird. Sie sind wie ein Seufzer der Erleichterung, ein Blick aus dem Fenster. Dadurch, dass sie wie dekorative Einzelheiten wirken, die bunt aus einem harten Stamm hervorgebrochen sind, beweisen sie die unbewusste Strenge des Schöpfers. Sie erfordern die natürliche Unfähigkeit zu landschaftsinspirierten Empfindungen. Klar und ehrlich benutzen sie die Natur als ein Mittel, als etwas der Substanz der Erzählung Untergeordnetes. Als eine Zerstreuung. Und das ist historisch zu verstehen, denn meine Vorstellung von Bildern als Substanz der Erzählung negiert es. Warum? Weil wir knappe Dichtung machen. Weil wir einen einzelnen Seelenzustand packen und in eine Bedeutung hämmern, der Grundprinzip und Selbstzweck ist. Und es ist uns daher nicht gegeben, den Rhythmus unserer verdichteten Erzählung blumig auszuschmücken mit naturistischen Ergüssen2, die albernes Getue wären, sondern wir müssen, um anderes besorgt, die Natur als Hort von Bildern ignorieren, oder eben einen naturistischen Seelenzustand ausdrücken, bei dem der Blick aus dem Fenster die Substanz des gesamten Aufbaus ausmacht. Im Übrigen genügt es, an manches moderne Werk mit breit angelegtem Aufbau zu denken – Romane, meine ich –, und schon finden wir darin, durch ein Gewirr landschaftlicher Filtrierungen hindurch, die wir unserer ununterdrückbaren romantischen Kultur verdanken, wieder klare Beispiele von Bildersprache als Zerstreuung.
Erhaben über Alte und Moderne – über das Bild als Zerstreuung und über das Bild als Erzählung – ist Shakespeare, der breit angelegt aufbaut, und zugleich ist alles ein Blick aus dem Fenster; er bringt ein Bild, das aus einem kargen, in Menschlichkeit wurzelnden Stamm sprosst, und baut zugleich die Szene, das gesamte play, als bildliche Interpretation des Seelenzustands auf. Dies muss aus der überaus glücklichen dramatischen Technik erwachsen, für die alles Menschheit ist – die Natur, untergeordnet –, alles aber auch, in der bilderreichen Sprache seiner Personen, Natur ist.
Er hat Stücke von Lyrik zur Hand, aus denen er ein festes Gefüge macht. Kurz, er erzählt und singt in unauflöslicher Weise, einzig auf der Welt.
10. Oktober
Auch angenommen, dass ich die neue Technik erreicht habe, über die ich mir klar zu werden suche, versteht es sich doch von selbst, dass sich hier und da verstreut in Larven anderer Techniken gegossene Züge finden. Das hindert mich, das Wesen meiner Art zu schreiben, klar zu sehen (mit Vorsicht sei es gegen Baudelaire gesagt, in der Dichtung ist nicht alles vorhersehbar, und beim Schreiben wählt man manchmal Formen nicht wohlüberlegt, sondern instinktiv; und man erschafft, ohne mit letzter Klarheit zu wissen, wie). Dass ich dazu neige, die objektive Entwicklung der Handlung durch das berechnete Fantasiegesetz des Bildes zu ersetzen, ist wahr, denn genau dies ist meine Absicht. Doch wie weit diese Berechnung reicht, wie wichtig ein Fantasiegesetz ist und wo das Bild endet und die Logik beginnt, das sind ganz schöne Problemchen.
Heute Abend, unter den mondhellen, roten Felsen, dachte ich, wie poetisch es wäre, den an diesem Ort verkörperten Gott zu zeigen, mit all den Anspielungen auf Bilder, die eine solche Arbeit erlauben würde. Sofort überfiel mich das Bewusstsein, dass es diesen Gott nicht gibt, dass ich das weiß, davon überzeugt bin und also ein anderer dieses Gedicht hätte schreiben können, ich nicht. Anschließend habe ich gedacht, wie anspielungsreich und all-pervading alle meine künftigen Themen werden sein müssen, genauso anspielungsreich und all-pervading wie der Glaube an den in den roten Felsen verkörperten Gott, wenn ein Dichter sich seiner bedient.
Warum kann nicht ich die mondhellen roten Felsen behandeln? Weil sie doch nichts von mir widerspiegeln, außer einem fleischlosen Berührtsein durch die Landschaft, was niemals ein Gedicht rechtfertigen sollte. Wären diese Felsen im Piemont, wüsste ich sie allerdings sehr wohl in ein Bild zu fassen und ihnen eine Bedeutung zu geben. Was heißt, dass die erste Grundfeste der Dichtung das dunkle Bewusstsein vom Wert der Verhältnisse, der biologischen womöglich, ist, die im vordichterischen Bewusstsein schon ein larvenhaftes Leben als Bilder führen.
Sicherlich muss es auch für mich möglich sein, über Stoffe mit nichtpiemontesischem Hintergrund zu dichten. Es muss so sein, aber bisher ist es fast noch nie so gewesen. Das bedeutet, dass ich noch nicht aus der einfachen Verarbeitung des Bildes, das meine Ursprungsbindungen an die Umwelt stofflich darstellt, herausgekommen bin: dass es, mit anderen Worten, in meiner ausdauernden dichterischen Arbeit einen toten Punkt gibt, ungreifbar, eine stoffliche Grundvoraussetzung, ohne die ich nicht auskommen kann. Doch ist es dann wahrhaftig ein objektiver Überrest oder unverzichtbares Blut?
11. Oktober
Sollten alle meine Bilder nichts anderes sein als eine erfindungsreiche Facettierung des Grundbildes: wie mein Herkunftsort, so auch ich? Der Dichter wäre ein personifiziertes Bild, untrennbar vom landschaftlichen und sozialen Vergleichshintergrund des Piemont.
Im Wesentlichen würde sein Wort bedeuten, dass er und sein Land, in wechselseitiger Funktion gesehen, schön sind. Ist das alles? Ist das der springende Punkt?
Oder laufen nicht vielmehr zwischen mir und dem Piemont einfach Beziehungen hin und her, manche bewusst und andere unbewusst, die ich, so gut ich kann, in Bildern objektiviere und dramatisiere: in einer Bilder-Erzählung? Und beginnen diese Beziehungen bei der stofflichen Eintracht des Blutes mit dem Klima und dem Wind, und enden sie in der anstrengenderen geistigen Strömung, die mich und die anderen Piemonteser aufwühlt? Und drücke ich die geistigen Dinge mit Erzählungen von stofflichen Dingen aus und umgekehrt? Und hat diese andauernde Arbeit – Austausch, Anspielung, Bild – insofern einen Wert, als sie Zeichen unseres anspielungsreichen und all-pervading Wesens ist?
Gegen den Verdacht, es handle sich bei mir um ein Piedmontese Revival, steht der gute Wille, an eine mögliche Weiterverbreitung der piemontesischen Werte zu glauben. Die Rechtfertigung? Diese: Meine Literatur ist nicht mundartlich – so sehr habe ich instinktiv und mit der Vernunft gegen die Mundart als Literaturform gekämpft –; sie will nicht skizzenhaft sein – und dafür habe ich mit Erfahrung bezahlt –; sie versucht, sich von dem besten nationalen und traditionellen Saft zu nähren; sie bemüht sich, die Augen offen zu halten, auf die ganze Welt gerichtet, und ist besonders für die nordamerikanischen Versuche und Ergebnisse empfänglich gewesen, bei denen ich früher gleichartige gestalterische Geburtswehen zu entdecken meinte. Oder bedeutet die Tatsache, dass die amerikanische Kultur mich nun überhaupt nicht mehr interessiert, etwa, dass ich diesen piemontesischen Gesichtspunkt voll ausgeschöpft habe? Ich glaube schon; zumindest den Gesichtspunkt, den ich bisher vertreten habe.
15. Oktober
Und doch braucht es einen neuen Ausgangspunkt. Da sich der Verstand an einen bestimmten Schöpfungsmechanismus gewöhnt hat, ist eine ebenso mechanische Anstrengung nötig, um ihn zu durchbrechen und die gleichförmigen Geistesfrüchte, die immer wieder nachwachsen, durch eine neue Frucht zu ersetzen, die nach Unbekanntem, nach nie da gewesener Veredelung schmeckt.
Nicht dass man die andauernde geistige Arbeit durch einen Impuls von außen ersetzen sollte, aber man muss den Stoff und die Mittel körperlich umwandeln, um sich neuen Problemen gegenüberzusehen; hat man erst einmal den Ausgangspunkt, wird der Geist selbstverständlich sein ganzes Spiel wiederaufnehmen. Ohne diesen stofflichen Sprung kann ich nicht aus der Trägheit herauskommen, also ist auch sie eine gewohnheitsmäßige, stoffliche Reduzierung jeder Situation auf das Schema und die Sensibilität der Bild-Erzählung. Es bedarf eines Eingriffs von außen, um den Instinkt, der etwas Äußerliches geworden ist, in eine andere Richtung zu lenken und ihn auf neue Entdeckungen vorzubereiten. Wenn ich diese vier Jahre Dichtung wirklich gelebt habe, umso besser: Das kann mir nur zu größerer Unanfechtbarkeit und einem besseren Sinn für Ausdrucksformen verhelfen.
Die ersten Male wird es mir vorkommen, als wäre ich in meine archaischen Zeiten zurückgekehrt, und es wird mir auch so vorkommen, als hätte ich nichts zu sagen. Doch darf ich nicht vergessen, wie orientierungslos ich vor den Mari del Sud war und wie ich meine Welt erst nach und nach kennenlernte, während ich sie schuf. Nicht vorher. Allerdings fehlt es heute nicht an einer Verschlimmerung der Schwierigkeiten. Lavorare stanca umfasste meine ganze Erfahrung seit dem Tag, an dem ich die Augen öffnete, und die Freude, mein erstes Gold zutage zu fördern, war so groß, dass ich keine Monotonie spürte. Alles in mir war damals zu entdecken. Jetzt, da ich die Ader ausgebeutet habe, bin ich zu erschöpft und zu genau festgelegt, um noch die Kraft zu haben, mich mit großen Hoffnungen auf eine Grabung zu stürzen. Das Land ist ganz und gar sondiert und vermessen, und ich weiß, worin meine Originalität besteht. Darüber hinaus ließ ich, bei den unzähligen vorpoetischen Versuchen, gerade die Möglichkeiten der Prosaerzählung und des Romans fallen und verwarf sie. Zu gut kenne ich die Hindernisse auf diesem Weg, dem ich auch die belebende Freude der ersten Begegnung genommen habe. Dennoch muss er gegangen werden.
16. Oktober
Nachdem ich nun, wie beabsichtigt, die zufriedenstellende Parallele zwischen mir und dem Piemont zum Ausdruck gebracht habe, wie wird da die neue Atmosphäre meiner Dichtung sein? Der neue, abstrakte und zugleich empirische Wert, der die verschiedenen Einzelstücke wird vereinen können? Ein Buch machen aus einer Sammlung?
Diese Atmosphäre und dieser Wert müssen so sein, dass sie mich in der Geschichte rechtfertigen. An welche geschichtlichen Dinge glaube ich denn zurzeit? Vielleicht an Revolutionen? Doch abgesehen davon, dass man noch nie gute Dichtung aus der Idee einer gerade stattfindenden Revolution geschöpft hat, begeistere ich mich sowieso nur oberflächlich für sie. Natürlich ginge es nicht darum, die Tumulte, die Reden, das Blut und die Triumphe zu beschreiben, sondern darum, in der moralischen Atmosphäre der Revolution zu leben und von hier aus das Leben zu betrachten und zu beurteilen. Spüre ich diese moralische Erneuerung? Nein, und ich habe sogar bisher die Neigung erkennen lassen, im Leben eher die statischen, genießerischen Fähigkeiten zu rühmen und nicht die aktiven, erneuernden.
Die Unfähigkeit also, den großen erneuernden Schritt zu tun, nach dem ich selbstverständlich das Leben in der neuen Atmosphäre beurteilen und genießen könnte, so beschaulich, wie es mir gefiele.
Ich kann nur hoffen, auf andere geschichtliche Werte zu treffen, die nicht die gewaltsamen Revolutionen sind, und aus diesen, meinen Fähigkeiten entsprechend, Bilder zu machen.
Was sehr vernünftig ist. Wie man hört, gibt es zurzeit nur Impulse zu gewaltsamen Revolutionen. Doch alles in der Geschichte ist Revolution; auch eine unmerkliche und friedliche Erneuerung oder Entdeckung. Weg also auch mit dem rhetorischen Vorurteil, dass die moralische Erneuerung (womöglich vonseiten der anderen, der aktiven) die Gewalttat braucht. Weg mit diesem infantilen Bedürfnis nach Kumpanei und Radau. Ich muss mich mit der kleinsten Entdeckung begnügen, die in jedem einzelnen Gedicht enthalten ist, und meine moralische Erneuerung in der Demut zeigen, mit der ich mich diesem Schicksal füge, das meine Natur ist. Was sehr vernünftig ist. Falls es nicht doch Faulheit oder Feigheit ist.
17. Oktober
Nachdem ich heute Morgen das Gedicht vom Hasen wiederaufgenommen und beendet habe, an dem ich eben wegen des Hasen verzweifelte, spüre ich einen gewissen Übermut, mit der unrühmlichen Anstrengung fortzufahren. Mir scheint wahrhaftig, als hätte ich einen solchen technischen Instinkt erworben, dass meine Fantasien, ohne dass ich absichtlich daran denke, nun nach jenem Fantasie-Gesetz imaginiert aus mir heraustreten, das ich am 10. Oktober erwähnte. Und dies, fürchte ich, will heißen, dass es an der Zeit ist, die Musik oder wenigstens das Instrument zu wechseln. Sonst komme ich noch so weit, dass ich, noch bevor ich das Gedicht schreibe, einen kritischen Essay darüber aufsetze. Und es wird eine lächerliche Angelegenheit wie das Prokrustesbett.
Und schon ist die Formel für die Zukunft gefunden: Wenn ich mich seinerzeit verzweifelt abmühte, unter Seelenqualen eine Mischung aus meinen Lyrismen (geschätzt wegen des leidenschaftlichen Ungestüms) und meinem Briefstil (schätzenswert wegen der logischen Kontrolle und reich an Bildern) zu schaffen und das Resultat die Mari del Sud mit allem Nachfolgenden waren – so muss ich jetzt hinter das Geheimnis kommen, die fantastische und sentenziöse Art von Lavorare stanca mit dem leicht verrückten und realistisch auf ein Publikum abgestimmten Stil der pornoteca3 zu verschmelzen. Und zweifellos wird dafür Prosa nötig sein.
Denn nur eines (unter vielem) scheint mir für den Künstler unerträglich: sich nicht mehr am Anfang zu fühlen.
19. Oktober
Den 16. Oktober noch einmal lesend, denke ich, eben weil ich die Parallele zwischen mir und dem Piemont schon ausgedrückt habe, darf dieses Element in meiner künftigen Dichtung nicht mehr fehlen. Denn ich stelle mir vor, dass kein Versuch von mir umsonst sein kann und dass der Fortschritt darin besteht, immer einsichtiger Erfahrungen zu mahlen, wobei die neuen auf die alten geworfen werden.
21. Oktober
»… sicut nunc foemina quaeque4
cum peperit, dulci repletur lacte …«
27. Oktober
»in gremium matris terrae praecipitavit«5
28. Oktober
Die Dichtung beginnt, wenn ein Dummkopf vom Meer sagt: »Es wirkt wie Öl.« Das ist keineswegs eine exaktere Beschreibung der Meeresstille, sondern das Vergnügen, die Ähnlichkeit entdeckt zu haben, der Kitzel einer geheimnisvollen Beziehung, das Bedürfnis, in alle vier Winde zu schreien, was man bemerkt hat.
Es ist allerdings ebenso dumm, hier stehen zu bleiben. Hat man die Dichtung so begonnen, muss man sie zu Ende bringen und eine reiche Erzählung von Beziehungen zusammenfügen, die auf geschickte Art einem Werturteil gleichkommt.
Dies wäre das typische Gedicht, die Idee. Doch gewöhnlich sind die Werke aus Gefühl gemacht – die genaue Beschreibung der Meeresstille –, das zuweilen überschäumt in der Entdeckung von Beziehungen. Es mag sein, dass das typische Gedicht irreal ist und – so wie wir auch von Mikroben leben – das, was man bisher gemacht hat, aus rein mimetischen Stücken (Gefühl), aus Gedanken (Logik) und aus so gut wie möglich hergestellten Beziehungen (Gedicht) besteht. Eine absolutere Kombination wäre vielleicht unerträglich und dumm6.
1. November
Interessant ist die Idee, dass das Gefühl in der Kunst der rein mimetische Teil sei, die genaue Beschreibung der Meeresstille. Eine Beschreibung mit eigenen Ausdrücken nämlich, ohne Entdeckungen von bildhaften Beziehungen und ohne logische Einmischungen.
Doch wenn eine Beschreibung denkbar ist, die keine Bilder erzählt (was vielleicht die Natur der Sprache selbst verneint), kann es dann eine Beschreibung diesseits des logischen Denkens geben? Ist es nicht schon Ausdruck eines Urteils, zu bemerken, dass der Baum grün ist? Und wenn es lächerlich erscheint, einen Gedanken zu finden in einer solchen Banalität – wo endet die Banalität, und wo beginnt das wahre logische Urteil?
Den zweiten Absatz überlasse ich einem besseren Philosophen. Mir erscheint es jedenfalls richtig, dass Fühlen das eigentliche Beschreiben sei. Die Gefühlsregungen nutzen, um darin Beziehungen zu entdecken, bedeutet ja schon, diese Erfahrungen rational zu bearbeiten.
Und woher kommt es, dass die Sprache ihrer Natur gemäß die Möglichkeit ausschließt, keine Bilder zu gebrauchen? Dass verde [grün] von vis [lat. Stärke] kommt und auf die Kraft der Vegetation anspielt, ist eine schöne Beziehung und unbestreitbar; doch unbestreitbar ist auch die gegenwärtige Einfachheit dieses Wortes und sein unmittelbarer Bezug auf eine einzige Idee. Dass arrivare [ankommen] einst approdare [an die Küste kommen] bedeutete und dass am Anfang ein Bild aus der Seefahrt benutzt wurde, um zu sagen, dass der Winter kam, nimmt derselben, heute gemachten Bemerkung nichts von ihrer absoluten Objektivität.
Also war mein Einschub dumm. Und wir knacken hohle Nüsse.
9. November
Die Suche nach einer Erneuerung ist mit der Manie verbunden, konstruktiv zu sein. Poetischen Wert insgesamt habe ich der Gedichtsammlung, die als Poem daherkommt, schon abgesprochen, dennoch überlege ich ständig, wie ich meine lyrischen Gedichtchen anordnen soll, um ihren Sinn zu vervielfachen und zu ergänzen. Wiederum scheint mir, ich tue nichts, als Seelenzustände darzulegen. Wiederum fehlt mir das Werturteil, die Revision der Welt.
Gewiss ist, dass die kalkulierte Anordnung der Gedichte in der als Poem zusammengestellten Sammlung nur einer rein dekorativen und wohlüberlegten Gefälligkeit entspricht. Das heißt, auf die Gedichte der Fleurs du Mal angewandt: dass sie so oder so angeordnet sind, kann anmutig und aufschlussreich, vielleicht auch kritisch sein, aber mehr nicht, immer angenommen, die Gedichte waren schon geschrieben. Doch könnte sich die Tatsache, dass Baudelaire sie genau so, eines nach dem andern, überzeugend und fesselnd in ihrem Zusammenhang wie eine Erzählung, geschrieben hat, nicht aus der moralischen, urteilenden, erschöpfenden Konzeption ihres Ganzen herleiten?7 Verliert etwa eine Seite der Divina Commedia den ihr eigenen Wert als Kennzeichen eines Ganzen, wenn sie aus dem Poem herausgerissen oder umgestellt wird?
Ist es aber – um die Analyse der Einheit der Commedia auf bessere Zeiten zu verschieben – möglich, einem in der Turbulenz einer Eingebung für sich konzipierten Gedicht einen Wert der Zugehörigkeit zu einem Ganzen beizumessen? Denn dass Baudelaire ein Gedicht nicht für sich konzipierte, sondern es sich mit den anderen verzahnt dachte, kommt mir unwahrscheinlich vor.
Da ist noch etwas anderes. Da ein Gedicht dem Verfasser in seiner tiefsten Bedeutung nicht klar ist, bevor es nicht ganz vollendet ist, wie ist es dem Verfasser dann möglich, das Buch aufzubauen, außer im Nachdenken über die schon gemachten Gedichte? Die Sammlung von Gedichten als Poem ist also immer ein afterthought.
Bleibt allerdings immer noch der Einwand, dass es dennoch möglich gewesen ist – lassen wir die Commedia beiseite –, die Shakespearschen Dramen als ein Ganzes zu konzipieren. Man muss es sagen: Die Einheit dieser Werke rührt gerade von der realistischen, durchgängigen Gestaltung der Personen her, von der naturalistischen Entwicklung der Begebenheit, die, da sie in einem nicht frivolen Bewusstsein stattfindet, ihre Materialität verliert und so geistige Bedeutung erlangt, Seelenzustand wird.
10. November
Warum verlange ich von meinen Gedichten immer den erschöpfenden, moralischen, urteilenden Inhalt? Ich, der ich nicht fassen kann, dass der Mensch über den Menschen urteile? Mein Anspruch ist nichts anderes als ein vulgärer Wille, das Meine zu sagen. Was weit entfernt ist vom Verteilen der Gerechtigkeit. Lasse ich in meinem Leben Gerechtigkeit walten? Liegt mir etwas an der Gerechtigkeit in den menschlichen Dingen? Und warum verlange ich sie dann ausdrücklich in den poetischen?
Wenn es in meinen Gedichten eine Gestalt gibt, dann die des Ausreißers, der, nachdem er alle möglichen bunten, immer pittoresken Abenteuer bestanden hat, freudig in sein Dörfchen zurückkehrt, ohne große Lust zu arbeiten, die einfachsten Dinge vollauf genießend, immer großzügig, gutmütig und resolut in seinen Urteilen, unfähig, tief zu leiden, froh, der Natur zu folgen und eine Frau zu genießen, aber auch froh, allein zu sein und sich nicht verpflichtet zu fühlen, jeden Morgen bereit, neu zu beginnen: kurz, die Mari del Sud.
12. November
Was vorausgeht, kann eine Verallgemeinerung sein. Man müsste eine Bestandsaufnahme der Gedichte des Buches machen, die nicht in den gesteckten Rahmen passen. Es ist offensichtlich, dass nicht Verschiedenheit in den Ereignissen die Gruppen unterscheiden wird, zumal ja mein Protagonist »alle möglichen bunten Abenteuer besteht«, sondern Verschiedenheit im Fühlen, zum Beispiel: Fähigkeit zu leiden, Unduldsamkeit gegenüber der Einsamkeit, Unzufriedenheit mit der Natur, Vorsicht und Tücke.
Die einzige dieser vorgeschlagenen Haltungen, die ich ausnahmsweise schon verwirklicht finde, ist die Ungeduld der Einsamkeit in sexueller Hinsicht (Maternità und Paternità).
Aber ich ahne, dass der neue Weg weder in der Richtung liegt, die ich schon lang und breit gegangen bin, noch in den verschiedenen »Nein«, die ich mir aus Widerspruch ausgedacht habe, sondern in der Ausnutzung irgendeiner lateralen Möglichkeit, bei der die bereits verwirklichte Person bleibt, während ihre Interessen und ihre Erfahrung unmerklich verschoben werden. Das ist zur Zeit von Una stagione geschehen, als ich, während ich mich für das bis dahin verachtete fleischliche Leben interessierte, eine neue Formwelt erobert habe (Sprung von den Mari del Sud zum Dio-caprone).
Unfruchtbar ist also die Suche nach einer neuen Person, fruchtbar das menschliche Interesse an der alten Person für neue Tätigkeiten.
16. November
Das mir und meiner Zeit dringlichste ästhetische Problem ist zweifellos das der Einheit eines Dichtwerks. Ob man sich mit der in der Vergangenheit akzeptierten empirischen Bindung begnügen soll oder diese Bindung als eine Verwandlung von Materie in poetischen Geist erklären oder ein neues Ordnungsprinzip für die poetische Substanz suchen. Dieses Problem gespürt und die drei oben genannten Punkte abgelehnt haben die heutigen Zerstäuber der Dichtung, die poeti di precisione [Präzisionsdichter]. Man muss zur situativen Dichtung zurückkehren. Indem man die Situationen der Vergangenheit unverändert akzeptiert oder indem man eine neue geistige Art und Weise findet, die Tatsachen zu situieren?
Die neue Art und Weise, die ich verwirklicht zu haben glaubte – die Bild-Erzählung –, ist, so scheint mir nun, nicht mehr wert als irgendein hellenistisches rhetorisches Mittel. Nur ein Trick also, wie die Wiederholung oder das in medias res, der gelegentlich große Wirksamkeit hat, aber nicht genügt, um einen ausreichenden Blickwinkel zu bilden.
17. November
Wenn ich fern bin, fange ich an, eine Funktion zu erfinden [inventare] (Frequentativ von invenire [finden]), die die Kunst im Piemont und zentral in Turin konditioniert. Stadt der Fantasterei wegen ihrer aristokratischen, aus neuen und alten Elementen zusammengesetzten Geschlossenheit; Stadt der Regel wegen der vollkommenen Abwesenheit von Misstönen im Materiellen und im Geistigen; Stadt der Leidenschaft wegen ihrer wohlwollenden Förderung des Müßigganges; Stadt der Ironie wegen ihres guten Geschmacks im Leben; vorbildliche Stadt wegen ihrer an Aufruhr reichen Gelassenheit. Jungfräuliche Stadt in Sachen Kunst, wie eine, die andere schon hat lieben sehen und selbst bisher nur Zärtlichkeiten geduldet hat, aber nun, wenn sie den Mann findet, bereit ist, den Schritt zu tun. Stadt schließlich, in der ich geistig geboren bin, von auswärts kommend: meine Geliebte und weder Mutter noch Schwester. Viele andere stehen mit ihr in diesem Verhältnis. Es kann ihr nicht an Zivilisation fehlen, und ich bin Teil einer Heerschar. Die Bedingungen sind alle gegeben.
24. November
Mir scheint, ich entdecke die neue Ader. Es würde sich um die unruhige Betrachtung von Dingen handeln, und seien sie piemontesisch. Ich merke, dass ich früher mit traumverlorenen Betrachtungen arbeitete (Mari del Sud, Paesaggio a Tina, Ritratto d’autore) und dass nicht erst nach dem 15. Mai, sondern schon in vorangegangene Sachen dieses Jahres (Lavorare stanca, Ulisse, Avventure, Esterno) ein Zittern, eine Traurigkeit, ein Leiden hineingekommen sind, die vorher unbekannt oder streng begrenzt waren. Es versteht sich von selbst, dass dies nach Mai-August die Regel geworden ist. Dieser neue Versuch verschmilzt bangere, geistigere Töne mit einer erneuten leidenschaftlichen Materialität, die ein sicheres Versprechen birgt. Ob das meine whispers of heavenly death sind?
Auf jeden Fall, um eine klare Vorstellung vom Übergang zu gewinnen, den Paesaggio mit Gewehr und die Luna d’agosto vergleichen: Was beim ersten ganz beschreibende Vergeistigung einer Szene war, ist beim zweiten wirklich die Erschaffung eines Naturgeheimnisses um eine menschliche Angst.
5. Dezember
Es muss eine bestimmte Bedeutung haben, dass ich, während ich meine Art und Weise entdeckte, nicht die Leichtigkeit des sexuellen Stoffs zu Hilfe genommen habe. Mari del Sud, Antenati, Fumatori di carta kennen diese Ader nicht. Und wenn ich auf das Thema einging, tat ich es verächtlich und besserwisserisch (zurückdenken an Donne perdute, den Blues dei blues, Maestrine). Die neue Überlegung begann mit Canzone di Strada und Tradimento, in Gestalt von lebendiger Beschreibung sinnlicher Erfahrungen. Bis sie in Una stagione als neuer, in die Welt geworfener Stoff hervorbrach. Hier war das Thema das eigentlich Wichtige und die all-pervadingness des Sexuellen, die Reduktion aller sinnlichen Erfahrungen auf sexuelle Äquivalente (»il vento di marzo sui vestiti« [der Märzwind auf den Kleidern]). Eine Rückkehr zur hämischen Herabsetzung der sexuellen Empfindungen kann ein Ausweg sein aus dem Sumpf der gewohnheitsmäßigen Leichtigkeit der Beschreibung. Wie wird sich jedoch diese sexuelle Bösartigkeit mit der am 24. November angekündigten kontemplativen Unruhe vertragen? Auf den ersten Blick könnte es scheinen, als stünden Bösartigkeit und Unruhe einander entgegen.
6. Dezember
Fluchen ist etwas Schönes für jene altmodischen Typen, die nicht völlig überzeugt sind, dass Gott nicht existiert, sondern ihn, obwohl sie auf ihn pfeifen, ab und zu zwischen Fleisch und Haut spüren. Ein Asthmaanfall kommt, und der Mensch beginnt mit Wut und Ausdauer zu fluchen: in der gezielten Absicht, diesen möglicherweise existierenden Gott zu beleidigen. Er denkt, dass am Ende, falls es ihn gibt, jeder Fluch ein Hammerschlag auf die Kreuzesnägel und eine ihm angetane Schmach ist. Dann wird Gott sich rächen – das ist seine Art –, er wird ein Höllenspektakel machen, weiteres Unglück schicken, einen zum Teufel jagen, doch mag er auch die Welt auf den Kopf stellen, keiner wird ihm die empfundene Schmach, den erlittenen Hammerschlag nehmen. Keiner! Das ist ein schöner Trost. Und mit Sicherheit zeigt es, dass dieser Gott schließlich und endlich doch nicht an alles gedacht hat. Denkt nur: Er ist der absolute Herrscher, der Tyrann, Alles; der Mensch ist Kot, ein Nichts, und doch hat der Mensch diese Möglichkeit, ihn aufzuregen und misszustimmen und ihm einen Augenblick lang seine glückselige Existenz zu vergällen. Dies ist wahrhaftig »le meilleur temoignage que nous puissons donner de notre dignite«. Wieso hat Baudelaire darüber kein Gedicht gemacht?
7. Dezember
Man muss der Behauptung auf den Grund gehen, dass das Geheimnis großer Kunst oft in den Hindernissen liege, die ihr der zeitgenössische Geschmack in Form von Regeln auferlegt. Die Regeln der Kunst geben dem Künstler, indem sie ein bestimmtes Ideal vorschlagen, das es zu erreichen gilt, ein Ziel vor, das den Leerlauf des Verstandes verhindert. Es muss jedoch hinzugefügt werden, dass der Wert der Werke für uns niemals in der Beachtung der Regeln liegt, sondern – angesichts der Verschiedenartigkeit der Ziele – in Strukturen, die dem Künstler unter der Hand gewachsen sind, während er nach dem suchte, was die Regel, also der Geschmack, verlangt. Der Verstand, überhitzt von einem rationalen Spiel – nämlich dem Versuch, bestimmte, für wertvoll erachtete Ergebnisse zu erzielen –, überschreitet den abstrakten, auf Konventionen beruhenden Wert dieser »Geschmacksrichtungen« und schafft hingerissen neue Gebäude. Ohne es zu wissen; und das ist logisch, wenn man bedenkt, dass das Geheimnis eines künstlerischen Gebildes dem, der es schafft, entgeht, bis er ihm, sich darüber klar werdend, sein Interesse entzieht. So löse ich das Bedürfnis nach »Intelligenz« in der Kunst: Es gibt eine bewusste Anwendung von ihr, aber nur zu jenen zeitgenössischen Zwecken, die für den Künstler und für die Zeit gelten und danach eingeschmolzen werden im Ausbruch der aus der Überhitzung des Geistes geborenen Dichtung. Der Künstler arbeitet mit dem Gehirn auf Ziele hin, die vor der Nachwelt ihren Wert verlieren werden; doch mit diesem Tun schafft sein »Gehirn« vorkritisch neue intellektuelle Wirklichkeiten. Beispiel: die Manie des »conceit« bei den Elisabethanern und das Shakespearsche Resultat der Bild-Erzählung. Oder die Vorliebe für das konkrete Beispiel in der klassischen Wissenschaftswelt und die daraus entstandene kosmische Vision bei Lukrez.
15. Dezember
Was mich betrifft, so geschieht die Komposition eines Gedichts auf eine Weise, wie ich es – würde es mir nicht durch die Erfahrung bewiesen – nie geglaubt hätte. Während ich mich um eine ungeformte suggestive Situation herumbewege, murmele ich mir selbst einen Gedanken zu, verkörpert in einem freien Rhythmus, immer demselben. Die verschiedenen Wörter und die verschiedenen Verbindungen färben die neue musikalische Verdichtung und verhelfen ihr zum Ausdruck. Und das meiste ist getan. Nun brauche ich nur noch zu den zwei, drei, vier Versen zurückzukehren, die schon in diesem Stadium fast immer endgültig sind und am Anfang stehen, um sie zu quälen, sie zu befragen, ihnen verschiedene Entwicklungen anzupassen, bis ich auf die richtige stoße. Das Gedicht ist ganz aus dem Kern herauszuholen, von dem ich gesprochen habe. Und jeder Vers, der hinzukommt, bestimmt ihn immer genauer und schließt eine immer größere Zahl fantastischer Irrtümer aus. Bis die dem Ausgangspunkt innewohnenden Möglichkeiten alle herausgefunden und meinen Kräften entsprechend ausgeformt sind; nach und nach haben sich unter der Feder neue rhythmische Kerne herausgebildet, die in den verschiedenen besonderen »Bildern« der Erzählung erkennbar werden; und ich gelange, lustlos, denn schon versiegt das Interesse, zum letzten abschließenden Vers, der fast immer entspannt und abgeklärt und wieder mit dem Anfang verknüpft ist und anspielungsweise die verschiedenen Kerne rekapituliert. Ob das Stendhals Kristallisierung ist? Ich habe einen rhythmischen Komplex vor mir – voller Farben, Übergänge, ruckartiger Sprünge und Entspannungen –, in dem die verschiedenen Momente der Entdeckung, des Vorwärtsgehens – kurz, die Kerne – wechseln, aufleuchten, unaufhörlich angetrieben vom rhythmischen Blut, das überall fließt. Ich rauche eine darauf und versuche, an anderes zu denken, aber ich lächle, vom Geheimnis angeregt.
16. Dezember
Sei es Zufall oder auch nicht, während ich meine Methode erläuterte, habe ich die Bild-Erzählung beiseitegelassen. Ich spreche von einer suggestiven Situation: von Kernen, von Blut, von rhythmischen Gebilden. Und ich sage, dass jeder Kern ein Bild in der Erzählung ist.
So ist deutlich zu sehen, dass die Bild-Erzählung nichts anderes gewesen ist als der Versuch einer technischen Interpretation meiner Dichtung; er selbst wahrscheinlich ein übertragener Ausdruck; jedenfalls gewiss kein aktuelles Programm. Dass die verschiedenen Bilder, die »wechseln und aufleuchten«, der progressus jedes einzelnen Gedichts sind, ist eine feststehende Tatsache und lässt die Frage unberührt, ob das Gedicht eine Erzählung von Bildern ist oder nicht vielmehr ein Spiel von Bildern, die einem primitiven Kern von ethischer und rhythmischer Bedeutung untergeordnet sind. Wäre nicht eher eine Untersuchung fällig über den sentenziösen Charakter (Ethik und Rhythmus) dieser Gedichte? Es ist eine Tatsache, dass eine von mir geschriebene Seite häufiger von Bild zu Bild springt, sich an rhythmischem Gewinsel berauscht, spielt, um dann (einerlei ob mit oder ohne stoffliche Grundlage) mit einer Sentenz zu schließen, mit einem Sprichwort, das Licht auf das Ganze wirft. Sollten die sayings und nicht die Mythen die Ganglien der Komposition sein; sollte zum Beispiel im letzten Paesaggio die Betonung nicht auf den Pferden oder auf dem von zu Hause Ausgerissenen liegen, sondern auf dem Schlussvers?
Ich füge hinzu, dass eines meiner am reinsten imaginierten Gedichte – Grappa a settembre – eben mit der Maxime endet, die alle Bilder eint: »così le donne non saranno le sole a godere il mattino« [so werden die Frauen nicht die Einzigen sein, die den Morgen genießen].
Sollte ich mich bisher feinsinnig geirrt haben?
18. Dezember
Wenn aber in meinen Gedichten der entscheidende Punkt die unterschiedlich ausgedrückte oder verborgene Sentenz ist, dann hatte ich viele Dinge, die ich theoretisch suchte, ja schon erreicht. Was im Übrigen zweifelsfrei zutreffen muss, wenn es wahr ist, dass ich schon manche Gedichte geschrieben habe, die das Endgültige berühren. Zum Beispiel ist hier das moralische Urteil über die Dinge dieser Welt erreicht, die Ernsthaftigkeit von Gedankengängen, der neuerliche Sieg über die reine Sinnlichkeit. Hier die Universalität der Innenwelt ausgedrückt, von der ich fürchtete, sie sei bloß ein literarisches Spiel. Kurz, hier ist alles. Heute ist wirklich ein heller Tag.
20. Dezember
Das Leben ohne Rauch ist wie der Rauch ohne den Braten.
Entweder Polizisten oder Verbrecher.
29. Dezember
Bei den zwei Dingen, dichten und studieren, finde ich größeren und beständigeren Trost im Zweiten. Ich vergesse jedoch nicht, dass mir das Studieren immer im Hinblick auf das Dichten gefällt. Aber im Grunde ist das Dichten eine immer offene Wunde, in der sich die gute Gesundheit des Körpers abreagiert.
1Mit diesem Gedicht beginnt der Band Lavorare stanca.
2Im Manuskript lesen wir: Zerstreuungen
Ergüsse
3Zur »pornoteca« vgl. Il mestiere di poeta, in: Lavorare stanca. Deutsch: Das Handwerk des Dichters, in: Sämtliche Gedichte, siehe S. 471.
4Lucrez, De rerum natura, V, 813–814:
»… wie jetzt ja jede der Frauen sich anfüllt,
hat sie geboren, mit süßer Milch.«
Deutsch von Karl Büchner, Reclam, Stuttgart 1981
5Lucrez, De rerum natura, I, 251:
»in den Schoß der Mutter Erde gestürzt hat«
Der ganze Vers lautet:
»Und zuletzt: Es vergeht der Regen, sobald ihn der Vater
Äther gestürzt in den Schoß hat der Mutter Erde vom Himmel.«
6Die Worte »und dumm« sind mit Bleistift hinzugefügt.
7Mit Blaustift unterstrichen.
1936
16. Februar
Der Zufall hat mich Lavorare stanca mit Gedichten über Turin anfangen und beenden lassen – genauer gesagt, über Turin als Ort, aus dem man zurückkommt, und über Turin als Ort, in den man zurückkommen wird. Man könnte das Buch als Ausdehnung S. Stefano Belbos auf Turin und als seine Eroberung Turins bezeichnen. Unter den vielen Erklärungen der »Dichtung« ist dies eine. Aus dem Dorf wird die Stadt, aus der Natur wird das menschliche Leben, aus dem Jungen wird ein Mann. Wie ich sehe, ist »von S. Stefano nach Turin« für dieses Buch ein Mythos von allen nur erdenklichen Bedeutungen.
Ebenso merkwürdig ist, dass die nach dem letzten Paesaggio verfassten Gedichte, alle, von anderem handeln als von Turin. Der Zufall scheint mich lehren zu wollen, dass ich mein Unglück in eine entschiedene Umwälzung der Dichtung verwandeln muss.
Turin und damit zusammenhängende Spiele zu überwinden wird bedeuten, eine andere Welt aufzubauen, deren Grundlagen, wie immer, ein genau bestimmter Zeitraum von Schmerz und Schweigen sein werden. Denn was immer ich in diesen Monaten fiebrigen Müßiggangs schreibe, es wird stets nur eine »Kuriosität« sein in der Zukunft, das heißt Schweigen. Viele Werte der Vergangenheit fallen in diesen Monaten, und es werden innere Gewohnheiten zerstört, die – ein außerordentliches Glück – bisher noch nichts ersetzt. Ich muss lernen, diesen unbedeutenden Zusammenbruch, diese mühsame Nutzlosigkeit als gesegnete Gabe zu nehmen – wie sie nur Dichtern zuteilwird –, als Vorhang vor der Aufführung, die dann wieder neu beginnen soll. Ich will mich klar ausdrücken: Ich kehre zurück in einen larvenhaften Zustand der Kindheit, besser: der Unreife, mit allen Plumpheiten und Verzweiflungen dieser Phase. Ich werde wieder der Mann, der Lavorare stanca noch nicht geschrieben hat. Stunden damit hinzubringen, an meinen Nägeln zu kauen, an den Menschen zu verzweifeln, Licht und Natur zu verachten, mich aus kindlichen und dennoch entsetzlichen Ängsten heraus zu fürchten, das ist für mich eine Rückkehr in die Jahre, in denen ich um die zwanzig war. Welche Welt jenseits dieses Meeres liegt, weiß ich nicht, aber jedes Meer hat ein anderes Ufer, und ich werde es erreichen. Ich ekle mich jetzt vor dem Leben, um es dann wieder auskosten zu können.
Gewiss ist, dass die jetzt geschriebenen Gedichte – Parole, Altri tempi, Poetica, Mito, Semplicità, Un ricordo, Paternità, L’istinto, Tolleranza, U steddazzu – geistig mit Il Dio-caprone, Balletto, Pensieri di Dina, Gelosia, Creazione, Dopo, Agonia und den vergessenen zusammengehen: Dies wird ein Büchlein mit Epaves werden, nicht das Werk der Zukunft.
Die Zukunft wird aus einem langen Schmerz und einem langen Schweigen kommen. Sie setzt einen Zustand von solcher Unwissenheit und Verwirrung voraus, dass er schon Demut ist, kurz, die Entdeckung neuer Werte, eine neue Welt. Der einzige Vorteil, den ich meinen ersten zwanzig Jahren gegenüber haben werde, wird die geübte Hand sein, der unbewusste Instinkt. Der Nachteil die vorausgegangene Ernte und das Ausgelaugtsein des Bodens.
Doch das neue Werk – dass ich es nur weiß – wird erst am Ende des Schmerzes beginnen. Im Augenblick kann ich nur immer wieder über Ästhetik, das Problem der Einheit nachdenken und Fragen studieren, um dem Schmerz ein Ende zu machen.
17. Februar
Es ist gut, auf Homer zurückzugreifen. Was macht die Einheit seiner Dichtungen aus? Jedes Buch hat seine eigene gefühlsmäßige, durch seine Stellung bedingte Einheit, derentwegen man es harmonisch, und auch physisch, als ein Ganzes liest. VIII. Buch der Odyssee: Der Trost der Dichtung, des Tanzes, des Wettstreits; der Gesang, der goldene, spielerische Mythos; der neuerliche Sieg des edlen Lebens, in einer Oase von Genuss und ideellen Tränen. X. Buch der Odyssee: das Abenteuer, die Aufeinanderfolge von Hindernissen, das menschliche Weinen und das Sichverhärten. III. Buch der Ilias: die schöne Frau und der Krieg um die Frau, und die zermürbende Liebe. Und so weiter. Dachte Homer, oder wer für ihn, an diese Definitionen? Ich glaube nicht, aber es ist aufschlussreich, dass das Buch, in dem ganz Griechenland lebt, auf diese Art gemacht ist, oder vielmehr, was dasselbe ist, dass man es so interpretieren kann.
Doch geben wir acht. Die große Faszination der beiden Dichtungen ist die konkrete Einheit ihrer Personen, die von Mal zu Mal in diesen dichterischen Feuersbrünsten aufflammt. Wir haben also, vom ersten Beispiel großer absichtsvoller Dichtung an, dieses doppelte Spiel: natürliche Entfaltung von Begebenheiten (die, ohne Schaden, auch doppelt so viele oder die Hälfte sein könnten) und daran anschließend organische, dichterische Erleuchtungen. Die Erzählung also, und die Dichtung. Die Vereinigung der beiden Elemente ist nicht mehr als Geschicklichkeit.
Nun stellt sich das Problem, ob es bei einzelnen Gedichten nicht möglich ist, das Wunder zu wiederholen; aus keinem anderen Grund, als dass man das Denken immer auf die Einheit in allen ihren Äußerungen richtet. Schreiben je nach Eingebung, aber mit unterirdischer Geschicklichkeit die verschiedenen Stücke zu einer Dichtung zusammenlaufen lassen.
Die einfachste Art schiene die, ein und dasselbe Hauptelement in den aufeinanderfolgenden Gedichten beizubehalten. Und das geht nicht, denn dann wäre es besser, gleich eine erzählte Dichtung zu machen, was sich als absurd erwiesen hat.
Bleibt die Möglichkeit, in einer Gruppe von Gedichten die subtilen – und fast immer geheimen – Übereinstimmungen von Thema (stoffliche Einheit) und von Erleuchtung (geistige Einheit) aufzuspüren.
Aufspüren soll heißen, sie beim Verfassen hineinlegen; und die Möglichkeiten sind: sich daran gewöhnen, die Natur (eine Themenwelt) als ein sehr genau bestimmtes Ganzes zu betrachten, kritisch dem Widerhall und den Anklängen vorausgegangener Gedichte nachgeben, kurz, mit kühlem Kopf die Themen suchen und dabei ihren Platz kalkulieren, und sich intuitiv mit heißem Kopf der rhythmischen Welle der Vergangenheit überlassen. Sich, ein Gedicht verfassend, sagen: Ich entdecke einen anderen Zipfel der Welt, die ich zum Teil schon kenne, nehme bei dieser Entdeckung Verweise auf das schon Bekannte zu Hilfe, kurz, überwache, wie weit die eigene Vergangenheit gut und richtig ist. Nie vorgeben, den Sprung ins Unbekannte zu tun, schlagartig eines Morgens neu geboren zu werden. Die Kippen des Vorabends verwenden und sich davon überzeugen, dass die Zeit – das Vorher und das Nachher – nur eine fixe Idee ist. Aber es vor allem nie der Schlange nachmachen, nie die Haut abwerfen, denn was hat der Mensch an Eigenem, Gelebtem, wenn nicht das, was er eben schon gelebt hat? Sondern sich im Gleichgewicht halten, denn was hat der Mensch zu leben, wenn nicht eben das, was er noch nicht lebt?
Ein weiterer interessanter Punkt bei Homer sind die Beinamen und die wiederkehrenden Verse: kurz gesagt alles, was in jedem einzelnen Fall einen lyrischen Nervenstrang von unbestreitbarem Wert bildet und jedes Mal, gleich oder nahezu gleich, abgeschrieben wird, ohne dass man sich die Mühe macht, die ursprüngliche Eingebung zu überprüfen. (Auch hier zählt nicht die Wahrheit, dass es sich um dichterische Sprache handelt, um geheiligten Jargon, um Sätze, die im Gebrauch zu einem einzigen Wort geworden sind, um hieratische Kristallisationen eines Gefühls. Das mag sein, ist sogar so; doch auf mich haben sie eine andere Wirkung, und ich habe jedes Recht, darüber nachzudenken, als wären sie von Homer bewusst gewählt. Nicht seine Absicht zählt, es zählt, was ich, der Leser, darin sehe.)
Ich glaube daher, dass es sich um ein sehr wichtiges technisches Mittel handelt, durch das ein Teil der Einheit von einzelnen Büchern erzielt wird. Ich weiß nicht, ob jeder Leser bemerkt hat, dass jedes Buch als Merkmal eine bestimmte Gruppe von Beinamen und wiederkehrenden Versen hat, die ihm vorbehalten sind. Es könnte scheinen, als würde die Konkretheit bestimmter Gesten, bestimmter Gestalten, bestimmter Wiederholungen auf diese Art mit Dichtung eingefärbt – und sei sie auch mnemotechnisch und kristallisch erstarrt –, um die zwangsläufige Erfindungsarmut zu verbergen. Kurz, als habe der erste Grieche ohne weiteres den Gegensatz von Erzählung und Dichtung gespürt und bemühe sich so – für unseren Geschmack ziemlich naiv –, ihn auszugleichen. Es versteht sich von selbst, dass, wenn das Buch wechselt, auch – aber natürlich nicht immer – der Ton der Wiederholungen wechselt, je nach der besonderen Färbung oder, wenn wir so wollen, Fixierung eines jeden Buches.
Um es zusammenzufassen: eine Möglichkeit, die Einheit zu erzielen, ist die Wiederkehr bestimmter lyrischer Formeln, die den Wortschatz auflockern, indem sie einen Beinamen oder einen Satz in ein einfaches Wort verwandeln. Von allen Arten, die Sprache zu erfinden (das Werk des Dichters), ist dies die überzeugendste und, denkt man darüber nach, die einzig reale. Und sie erklärt, wieso in jenem ganzen Teil des Werkes, in dem die gleichen Formeln wiederkehren, eine einheitliche Atmosphäre herrscht: Es ist derselbe Mann – Erfinder –, der spricht.
23. Februar
Je mehr ich darüber nachdenke, umso bemerkenswerter scheint mir das homerische Verfahren der Buch-Einheit. In einem bestimmten Stadium, von dem man annehmen musste, dass es zur Einförmigkeit neigt, offenbart sich stattdessen der Geschmack am umgrenzten, bunt gewirkten Wandteppich, das Studium der differenzierten Einheit. Er ist in Wirklichkeit ein Schreiber verschiedenartig konditionierter Novellen (die Liebe, die heroische Leidenschaft, das Abenteuer, der Krieg, die Idylle, die Rückkehr, die Welt der Genießer, die Freude am gemeinschaftlichen Leben, die Rache, der Zorn etc.). Darin ist er wie seine Schicksalsgefährten Dante und Shakespeare: mächtige, sagenhafte Konstrukteure, die sich bis in die Schnörkel hinein an einem Detail ergötzen, die mit regelmäßigen und vollkommen alltäglichen Atemzügen das ganze Leben einatmen. Vor allem sind sie nicht Männer des plötzlichen monotonen Schreis, der aus der Erfahrung hervorbricht und diese mit einschließt und in einer Empfindung zusammenfasst, sondern wohlgesetzt sprechende Seher, die Sachlichkeit selbst, ruhige und unerschütterliche Erwecker der Vielfalt, Verheimlicher der Erfahrung, die sie wie zum Spiel in geschliffene Figuren zerlegen und schließlich, überaus listig, ersetzen. Es mangelt ihnen vor allem an Arglosigkeit.
So verstanden, scheinen die Schöpfer gut vorbereitet auf jene Arbeit von grandioser und raffinierter Geschicklichkeit, jene List, die erforderlich ist, um den Spielraum zwischen Erzählung und Dichtung befriedigend zu überbrücken. Sie sind bewunderungswürdig im Kompromiss, in der ganz von der Gesellschaft und der Vorsicht bestimmten Kunst der Erfahrung. Statt Größe von der Gewalt des Fühlens abzuleiten, leiten sie sie von der Kunst zu leben ab. Diese biografische Basis ist das Einzige, was Lyriker und Schöpfer gemeinsam haben. Doch während für die Lyriker alles in dieser Gewalt erlischt, ist für sie, die Meister, das Zu-leben-Wissen eine Kunst, die einfach nur dazu dient, den menschlichen Stoff zu drechseln, in sich befreit, verfeinert, vollendet: allen zur Verfügung gestellt. So verschwinden sie im Werk, während die Lyriker sich darin entstellen.
28. Februar
Es gibt eine Parallele zwischen diesem Jahr von mir und der Betrachtung der Dichtung. Wie ich das grausame Leiden nicht in den großen Augenblicken (15. Mai, 15. Juli, 4. August, 3. Februar) gespürt habe, sondern in gewissen verstohlenen Spannen der dazwischenliegenden Zeiträume, so besteht die Einheit einer Dichtung nicht in den grundlegenden Szenen, sondern in der subtilen Übereinstimmung aller schöpferischen Momente. Mit anderen Worten, die Einheit verdankt nicht so viel dem großartigen Aufbau, dem erkennbaren Gerüst der Handlung, als vielmehr der spielerischen Geschicklichkeit der kleinen Berührungen, der winzigen und fast trügerischen Wiederaufnahmen, der Handlung mit den Wiederholungen, die in jeder verschiedenen Situation beharrlich wiederkehren.
Was bewirkt, dass ich an ihr leide? Der Tag, an dem sie den Arm hob auf dem asphaltierten Corso, der Tag, an dem niemand mir öffnete und sie dann mit wirren Haaren erschien, der Tag, an dem sie leise mit ihm auf dem Wall sprach, die tausend Male, die sie mich zur Eile angetrieben hat.
Doch das ist nicht mehr Ästhetik, das sind Klagen. Ich wollte die schönen, winzigen Erinnerungen aufzählen und erinnere mich nur an Qualen.
Nur zu, sie nützen trotzdem. Meine Geschichte von ihr besteht also nicht aus großen Szenen, sondern aus äußerst subtilen inneren Momenten. So muss eine Dichtung sein. Dieses Leiden ist entsetzlich.
15. März
Ende der Verbannung.
10. April1
Wenn ein Mensch in meinem Zustand ist, bleibt ihm nichts, als eine Gewissensprüfung vorzunehmen.
Ich habe keinen Grund, meiner fixen Idee zu entsagen, dass alles, was einem Menschen geschieht, durch seine gesamte Vergangenheit bedingt ist; kurz, verdient ist. Offenkundig habe ich schlimme Sachen gemacht, dass ich mich an diesem Punkt befinde.
Vor allem, moralische Leichtfertigkeit. Habe ich mir jemals wirklich die Frage gestellt, was ich meinem Gewissen nach tun muss? Ich bin immer gefühlsmäßigen, hedonistischen Impulsen gefolgt. Darüber gibt es keinen Zweifel. Sogar mein Frauenhass (1930–1934) war ein wollüstiges Prinzip: Ich wollte keine Scherereien und gefiel mir in der Pose. Wie rückgratlos diese Pose war, hat man dann gesehen. Und auch in der Frage der Arbeit, bin ich da je etwas anderes gewesen als ein Hedonist? Ich gefiel mir in Anfällen fieberhafter Arbeit, wenn mich der Ehrgeiz packte, aber ich hatte Angst, Angst, mich zu binden. Ich habe nie wirklich gearbeitet, und tatsächlich beherrsche ich kein Handwerk. Und auch einen anderen Makel sieht man deutlich. Ich bin nie der simple, gewissenlose Mensch gewesen, der seine Freuden genießt und im Übrigen auf alles pfeift. Dazu bin ich zu feige. Ich habe mir immer mit der Illusion geschmeichelt, ich hätte eine moralische Einstellung zum Leben, indessen ich köstliche Augenblicke – das ist das richtige Wort – damit zubrachte, mir Gewissensfragen zu stellen, ohne jede Entschlossenheit, sie in die Tat umzusetzen. Ich will nicht auch noch die Genugtuung ausgraben, die ich früher bei der moralischen Erniedrigung zu ästhetischem Zweck empfand, als ich mir davon eine Karriere als Genie erhoffte. Und diese Zeit habe ich noch keineswegs überwunden.
Zum Beweis: Nun, da ich die völlige moralische Verkommenheit erreicht habe, woran denke ich? Ich denke, wie schön es wäre, wenn diese Verkommenheit auch materiell wäre, wenn ich zum Beispiel kaputte Schuhe hätte.
Nur so ist mein gegenwärtiges Selbstmörderleben zu erklären. Und ich weiß, dass ich für immer dazu verdammt bin, bei jedem Hindernis oder Schmerz an Selbstmord zu denken. Das ist es, was mich entsetzt: Mein Prinzip ist der Selbstmord, nie vollzogen, den ich nie vollziehen werde, der aber meiner Empfindsamkeit schmeichelt.
Das Schreckliche ist, dass alles, was mir jetzt bleibt, nicht genügt, um mich aufzurichten, denn in demselben Zustand – abgesehen von den Verrätereien – bin ich schon in der Vergangenheit gewesen, und schon damals habe ich keine moralische Rettung gefunden. Auch diesmal werde ich nicht härter werden, das ist klar.
Und doch – oder täuscht mich die Schwärmerei, aber ich glaube nicht – hatte ich den Weg der Rettung gefunden. Und bei aller Schwäche, die in mir war, verstand es jene Person, mich an eine Disziplin, an ein Opfer zu binden, mit dem einfachen Geschenk ihrer selbst. Und ich glaube nicht, dass es die Tugend des unverständigen kleinen Jungen war, denn das Geschenk ihrer selbst hob mich auf und ließ mich neue Pflichten erahnen, ließ sie vor mir Gestalt annehmen. Denn mir selbst überlassen, die Erfahrung habe ich gemacht, bin ich sicher, dass ich es nicht schaffe. Ein Fleisch und ein Schicksal mit ihr geworden, hätte ich es geschafft, dessen bin ich ebenso sicher. Gerade auch mit meiner Feigheit: Sie wäre ein Imperativ an meiner Seite gewesen.
Was hat sie stattdessen getan! Vielleicht weiß sie es nicht, oder wenn sie es weiß, ist es ihr gleich. Und das ist richtig, denn sie ist sie und hat ihre Vergangenheit, die ihr die Zukunft vorzeichnet.
Aber das hat sie getan. Dass ich ein Abenteuer gehabt habe, in dessen Verlauf über mich geurteilt und ich für unwürdig erklärt wurde, es fortzusetzen. Angesichts dieses Sturzes ist es absolut nichts mehr, das Trauern um die Geliebte, das doch so entsetzlich ist, oder der Ruin der Stellung, der doch auch schlimm ist.
Das Gefühl dieses Sturzes vermischt sich mit dem Gehämmer, das 1934 aufgehört hatte, auf mich einzuschlagen: weg mit der Ästhetik, weg mit den Posen, weg mit dem Genie, weg mit dem ganzen Quatsch, habe ich je im Leben etwas getan, was nicht idiotisch gewesen wäre?
Idiotisch im banalsten und irreparabelsten Sinn, wie ein Mann eben, der nicht zu leben weiß, der moralisch nicht gewachsen ist, der hohl ist, der sich mit der Krücke des Selbstmords aufrecht hält, ihn aber nicht begeht.
20. April
Sehen wir, ob man auch hieraus eine Lehre für die Technik ziehen kann.
Die übliche – banale, aber noch nicht ganz ergründete. Es ist höchst wollüstig, sich der Aufrichtigkeit hinzugeben, sich in etwas Absolutem zu annullieren, alles andere außer Acht zu lassen; aber eben – es ist wollüstig – das heißt, man muss damit aufhören. Wenn mir etwas inzwischen klar sein müsste, dann dies: Jedes Mal, wenn ich hereingelegt werde, ist daran ursächlich meine wollüstige Hingabe ans Absolute, ans Unbekannte, ans Unhaltbare schuld. Ich habe noch nicht begriffen, worin die Tragik der Existenz besteht, ich bin noch nicht davon überzeugt. Und doch ist es so klar: Man muss die wollüstige Hingabe überwinden, aufhören, die Seelenzustände als Selbstzweck zu betrachten.
Für einen Dichter ist das schwierig. Oder auch sehr leicht. Ein Dichter gefällt sich darin, sich einem Seelenzustand zu überlassen und ihn zu genießen – da ist die Flucht vor dem Tragischen. Doch ein Dichter dürfte nie vergessen, dass ein Seelenzustand für ihn noch gar nichts ist, dass für ihn allein die künftige Dichtung zählt. Dieses Bemühen um zweckdienliche Kälte ist seine Tragik.
Dass man tragisch und nicht wollüstig leben muss, geht aus allem hervor, was ich bisher gelitten habe; und zwar nutzlos gelitten. Die Augen geöffnet hat mir das Wiederlesen der Gedichte von 1927. In jener bekleckerten und neapolitanischen Naivität dieselben Gedanken und dieselben Worte wiederzufinden wie im vergangenen Monat, war niederschmetternd. Neun Jahre sind vergangen, und ich antworte immer noch so kindisch auf das Leben? Und jene Männlichkeit, die ich mir in den Jahren der Arbeit hart erkämpft zu haben schien, war sie so haltlos?
Am wenigsten trifft die Schuld an solcher Unzulänglichkeit die Dichtung. Die Dichtung hat mich allenfalls gelehrt, mich zu beherrschen, mich zu sammeln, klar zu sehen; die Dichtung hat mir etwas eingebracht, in einem durchaus praktischen Sinn. Schuld ist die Träumerei, die etwas ganz anderes und aller guten Kunst feind ist. Schuld ist mein Bedürfnis, Verantwortlichkeit auszuweichen, zu fühlen, ohne zu bezahlen.
Sie ist nicht nur eine Ähnlichkeit, die Parallele zwischen einem Leben wollüstiger Hingabe und dem gelegentlichen Schreiben vereinzelter kleiner Gedichte, ohne Verantwortung für das Ganze. Dabei gewöhnt man sich an, sprunghaft zu leben, ohne Entwicklung und ohne Prinzipien.
Die Lehre ist diese: aufbauen in der Kunst und aufbauen im Leben, das Wollüstige aus der Kunst wie aus dem Leben verbannen, tragisch sein.
(Das schließt selbstverständlich nicht aus, dass man sich ab und zu schweinisch benimmt oder ein Sonettchen und eine Novelle schreibt; im Gegenteil, das muss man tun. Nur im Gedächtnis behalten, dass man, um eine Novelle oder einen Abend zu komponieren, nicht Himmel und Erde bemühen muss.)
Dies alles vorausgeschickt und unterschrieben, ist es menschlich, dass ich mir gestatte, mich abzureagieren und zu überlegen, dass niemand mir je ein größeres Unrecht angetan hatte. Nicht soweit es um Liebe geht – wir haben die Schnauze voll von der Liebe –, sondern aus jenem anderen Grund, weil ich diesmal gerade versuchte zu bezahlen, zu erwidern, mich zu binden und mich zu beschränken, kurz, das Wollüstige tragisch zu machen. Es ist gut, dass mir das Gegenteil passiert ist: So wird sich erweisen, ob meine Männlichkeit sich erholen kann. Es ist gut, es ist gut, aber trotzdem ist es eine große Gemeinheit gewesen. Und wenn ich darüber nachdenke, wenn ich willig jede wollüstige Träumerei und Leidenschaft ausschließe, wer kann sagen, ob meine Qual nicht gerade daraus erwächst – dass mir eine Ungerechtigkeit angetan worden ist, eine böse Tat? Und findet sich nicht auch hier eine Lehre für die Technik, eine Poetik?
22. April
Die Wahrheit ist, dass noch nichts von der Welt meinen Geist durchdrungen und sich mir wie auf einem Röntgenbild in elementarer und metakörperlicher Struktur gezeigt hat. Ich bin noch nicht zu dem grauen und urewigen Skelett vorgedrungen, das darunterliegt.
Ich habe Farben gesehen, Gerüche geschnuppert und Gesten liebkost, wobei ich mich mit einer elektrisierenden und neue Ordnung schaffenden Freude zufriedengab. Ich habe gescherzt wie mit Freunden und allein genossen.
Ich habe das überlegte Wort nicht gekannt. Meine Worte waren nur Empfindungen. Meine Porträts waren Gemälde, keine Dramen. Ich habe mich auf Gestalten fixiert und habe sie so lange hin und her gewendet und betrachtet, bis ich eine zufriedenstellende Verklärung davon wiedergeben konnte. Ich habe die Welt vereinfacht, reduziert auf eine banale Galerie von Kraftakten oder Lustakten. Das Schauspiel des Lebens ist auf jenen Seiten, nicht das Leben. Alles ist von vorn zu beginnen.
24. April
Man muss die Sucht, sich selbst zu zerstören, empfunden haben. Ich spreche nicht vom Selbstmord: Leute wie wir, verliebt ins Leben, ins Unvorhergesehene, in die Lust, »es zu erzählen«, können nicht bis zum Selbstmord kommen, es sei denn durch Unvorsichtigkeit. Und außerdem erscheint der Selbstmord inzwischen wie eine jener mythischen Heldentaten, jener legendären Bekräftigungen einer Würde des Menschen vor dem Schicksal, die wie Monumente interessieren, uns aber uns selbst überlassen.
Der Selbstzerstörer ist ein Typ, der zugleich verzweifelter und zweckorientierter ist. Der Selbstzerstörer bemüht sich, jeden Makel, jede Feigheit in sich zu entdecken und diese Veranlagungen zur Vernichtung zu fördern, indem er sie immer wieder sucht, sich an ihnen berauscht, sie genießt. Der Selbstzerstörer ist am Ende selbstsicherer als je ein Sieger der Vergangenheit, er weiß, dass der Faden, mit dem er am Morgen, am Möglichen, an der wunderbaren Zukunft hängt, ein kräftigeres Seil ist – wenn es sich um den letzten Ruck handelt – als jede Art von Glauben oder Integrität.
Der Selbstzerstörer ist vor allem ein Komödiant und ein Herr seiner selbst. Er lässt keine Gelegenheit aus, sich zu fühlen und sich zu erproben. Er ist ein Optimist. Er erhofft sich alles vom Leben und stimmt sich darauf ein, unter den Händen des künftigen Geschicks die höchsten oder bedeutsamsten Töne von sich zu geben.
Der Selbstzerstörer kann die Einsamkeit nicht ertragen.
Aber er lebt in einer ständigen Gefahr – dass ihn eine Bauwut überfällt, eine Ordnungswut, ein moralischer Imperativ. Dann leidet er heillos und könnte sich auch umbringen.
Dies muss man genau betrachten: In unserer Zeit ist der Selbstmord eine Art zu verschwinden, man begeht ihn schüchtern, still, gedrückt. Es ist kein Handeln mehr, es ist ein Erleiden.
Wer weiß, ob der optimistische Selbstmord noch einmal wiederkehren wird?
Eine innere Tragödie in Gestalt von Kunst, zu kathartischem Zweck, auszudrücken, das vermag nur der Künstler, der im Verlauf der gelebten Tragödie schon fein seine konstruktiven Fäden spann, kurz, der schon am schöpferischen Brüten war. Es gibt keinen im Wahnsinn durchlittenen Sturm und dann die Befreiung durch das Werk, es sei denn der Selbstmord. Daher sind die Künstler, die sich wirklich ihrer tragischen Geschicke wegen getötet haben, gewöhnlich leichte Sänger, Dilettanten der Empfindung, die in ihren Gesängen nie etwas von dem tiefsitzenden Krebs andeuteten, der sie zerfraß. Woraus man lernt, dass die einzige Möglichkeit, dem Abgrund zu entgehen, die ist, ihn anzuschauen und ihn zu ermessen, ihn auszuloten und hinabzusteigen.