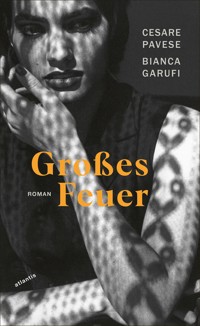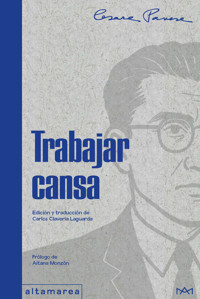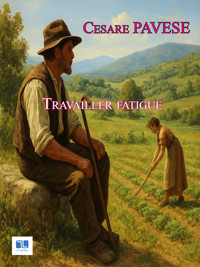Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Rotpunktverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Edition Blau
- Sprache: Deutsch
Der Roman führt ins Piemont, Ende der Vierzigerjahre. Der Erzähler, gut zwanzig Jahre zuvor aufgebrochen, sein Glück in Amerika zu machen, kehrt in sein Dorf zurück. Die Landschaft der Kindheit liegt vor ihm, die Rebhügel, der Fluss mit dem abschüssigen Ufer, die Eisenbahnlinie. Hier ist er, als angenommenes Kind, in einer Kleinbauernfamilie aufgewachsen, hier geschah die Entdeckung der Welt. Aber viel ist seither passiert. Von Nuto, seinem einzigen verbliebenen Freund, erfährt er, wie der Faschismus das Dorf gespalten hat, dass der Kampf auf der Seite der Partisanen den Weggefährten das Leben gekostet hat und nicht Freudenfeuer, sondern Feuer der Wut und Verzweiflung auf den Höhen entfacht wurden. In Der Mond und die Feuer, Paveses letztem Roman, leuchtet mit der mythischen Hügellandschaft der Langhe auch die Schönheit des Erzählens auf. Urbilder menschlicher Erfahrung – der Baum, das Haus, die Reben, der Abend, das Brot, die Frucht – erzeugen eine magische Melancholie. Virtuos verdichtet verhandelt Pavese große, auch in unserem Jahrhundert relevante Themen der Weltliteratur: Auswanderung und Rückkehr, Verwurzelung und Entwurzelung, Widerstand.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 250
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cesare Pavese
Der Mond und die Feuer
Cesare Pavese
Der Mondund die Feuer
Roman
Aus dem Italienischenvon Maja Pflug
Nachwortvon Paola Traverso
Die Originalausgabe ist unter dem Titel
La luna e i falò bei Giulio Einaudi Editore erschienen.
© 1950, 1971, 2000, 2005, 2014 Giulio Einaudi Editore, Turin
© 2016 Edition Blau im Rotpunktverlag, Zürich
www.rotpunktverlag.ch
www.editionblau.ch
Lektorat: Daniela Koch
ISBN 978-3-85869-723-3
1. Auflage
for C.
Ripeness is all
Inhalt
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII
Kapitel VIII
Kapitel IX
Kapitel X
Kapitel XI
Kapitel XII
Kapitel XIII
Kapitel XIV
Kapitel XV
Kapitel XVI
Kapitel XVII
Kapitel XVIII
Kapitel XIX
Kapitel XX
Kapitel XXI
Kapitel XXII
Kapitel XXIII
Kapitel XXIV
Kapitel XXV
Kapitel XXVI
Kapitel XXVII
Kapitel XXVIII
Kapitel XXIX
Kapitel XXX
Kapitel XXXI
Kapitel XXXII
RÜCKKEHR AN DEN ORT DER ERINNERUNG
CESARE PAVESE AUSGEWÄHLTE DATEN ZU LEBEN UND WERK
I.
Es hat einen Grund, dass ich in dieses Dorf zurückgekehrt bin, hierher und nicht nach Canelli, nach Barbaresco oder Alba. Hier bin ich nicht geboren, das ist fast sicher; wo ich geboren bin, weiß ich nicht; es gibt in dieser Gegend weder ein Haus noch ein Stück Land oder Gebeine, von denen ich sagen könnte: »Das war ich, bevor ich geboren wurde.« Ich weiß nicht, ob ich von den Hügeln oder aus dem Tal, aus den Wäldern oder aus einem Haus mit Balkonen stamme. Das Mädchen, das mich auf die Stufen des Doms von Alba gelegt hat, kam vielleicht gar nicht vom Land, war womöglich eine Tochter aus herrschaftlichem Haus; oder zwei arme Frauen aus Monticello, aus Neive oder, warum nicht, aus Cravanzana haben mich in einem Weinlesekorb dorthin getragen. Wer kann sagen, aus welchem Fleisch ich gemacht bin? Ich bin genug in der Welt herumgekommen, um zu wissen, dass alles Fleisch gleich gut und gleich viel wert ist, doch genau deshalb ermüdet man und versucht, Wurzeln zu schlagen, sich Land und ein Dorf zuzulegen, damit das eigene Fleisch etwas an Wert gewinnt und einen gewöhnlichen Jahreszeitenzyklus überdauert.
Dass ich in diesem Dorf aufgewachsen bin, verdanke ich Virgilia und dem Padrino, Leuten, die nicht mehr da sind, auch wenn sie mich nur aufgenommen und großgezogen haben, weil das Findelhaus von Alessandria ihnen ein monatliches Kostgeld zahlte. Vor vierzig Jahren gab es auf diesen Hügeln so hoffnungslos arme Familien, dass sie sich zusätzlich zu den Kindern, die sie schon hatten, noch ein Findelkind aufluden, nur um einen Silber-Scudo zu sehen. Manche nahmen ein Mädchen, damit sie dann eine junge Magd hatten, die sie besser herumkommandieren konnten; Virgilia wollte mich, denn Töchter hatte sie schon zwei, und wenn ich etwas älter wäre, hofften sie, auf einen großen Hof umzuziehen, um gemeinsam zu arbeiten und ein gutes Leben zu führen. Padrino hatte damals das Gehöft von Gaminella – zwei Zimmer und ein Stall –, die Ziege und den Uferhang mit den Haselnusssträuchern. Ich wuchs mit den Mädchen auf, wir klauten uns gegenseitig die Polenta, schliefen auf demselben Strohsack, Angiolina, die Ältere, war ein Jahr älter als ich; und erst mit zehn, in dem Winter, in dem Virgilia starb, erfuhr ich durch Zufall, dass ich nicht ihr Bruder war. Von jenem Winter an durfte die vernünftige Angiolina nicht mehr mit uns am Ufer und in den Wäldern herumstreunen; sie versorgte den Haushalt, buk Brot, machte die kleinen Frischkäse und ging nun auch aufs Gemeindeamt, um meinen Scudo abzuholen; ich brüstete mich vor Giulia, fünf Lire wert zu sein, sagte zu ihr, dass sie gar nichts einbringe, und fragte den Padrino, warum wir nicht noch mehr Bankerte aufnähmen.
Jetzt wusste ich, dass wir elend arm waren, denn nur die Ärmsten ziehen Kinder aus dem Findelhaus auf. Vorher, wenn ich zur Schule lief und die anderen mir Bankert nachriefen, glaubte ich, das sei ein Wort wie Feigling oder Strolch, und zahlte es ihnen mit gleicher Münze heim. Doch selbst als ich schon ein junger Bursche war und das Gemeindeamt uns den Scudo nicht mehr zahlte, hatte ich noch nicht recht begriffen, dass der Umstand, nicht der Sohn von Padrino und Virgilia zu sein, bedeutete, nicht in Gaminella geboren zu sein, nicht wie die Mädchen unter den Haselnusssträuchern oder aus dem Ohr unserer Ziege herausgekommen zu sein.
Voriges Jahr, als ich zum ersten Mal ins Dorf zurückkehrte, schlich ich mich beinahe heimlich her, um die Haselnusssträucher wiederzusehen. Der Hügel von Gaminella, eine lang gestreckte, gleichmäßige Flanke voller Weinberge und Uferwiesen, die so unmerklich ansteigt, dass man den Gipfel nicht sieht, wenn man den Kopf hebt – und oben, wer weiß wo, sind wieder Weinberge, Wälder und Pfade –, war wie vom Winter gehäutet, zeigte die nackte Erde und die kahlen Stämme. In dem trockenen Licht sah ich genau, wie gewaltig er nach Canelli hin abfällt, wo unser Tal zu Ende ist. Vom Sträßchen, das am Belbo entlangführt, gelangte ich zum Geländer der kleinen Brücke und zum Röhricht. Auf dem Kamm sah ich das Gehöft, die Wand aus großen, schwärzlichen Steinen, den verkrüppelten Feigenbaum, das kleine leere Fenster, und dachte an jene schrecklichen Winter. Doch die Bäume und das Land rundherum hatten sich verändert; das Haselnussgestrüpp war den Stoppeln eines Maisfelds gewichen. Im Stall brüllte ein Ochse, und in der Kälte des Abends roch ich den Mist. Wer jetzt in dem Gehöft wohnte, war also nicht mehr so bettelarm wie wir. Ich hatte immer etwas Ähnliches erwartet, oder auch, dass das Haus eingestürzt wäre; wie oft hatte ich mir vorgestellt, ich säße auf dem Brückengeländer und fragte mich, wie es möglich war, so viele Jahre in diesem Loch zu verbringen, auf diesen wenigen Pfaden, während ich die Ziege hütete und die Äpfel suchte, die unten ans Ufer gerollt waren, überzeugt, dass die Welt an der Biegung endete, wo die Straße steil zum Belbo hinabführte. Aber dass es die Haselnusssträucher nicht mehr geben könnte, hatte ich nicht erwartet. Das hieß, dass alles zu Ende war. Die Neuigkeit entmutigte mich so sehr, dass ich niemanden rief und nicht auf die Tenne trat. In dem Moment begriff ich, was es bedeutet, nicht an einem Ort geboren zu sein, ihn nicht im Blut zu haben, nicht schon halb mit den Alten dort begraben zu sein, sodass eine Änderung der Bepflanzung nichts ausmachte. Sicher, es gab auf den Hügeln noch Haselgesträuch, darin konnte ich mich noch wiederfinden; hätte ich dieses Ufer besessen, hätte ich es womöglich selbst gerodet und Weizen angepflanzt, doch vorerst wirkte es auf mich wie jene Zimmer in der Stadt, wo man sich einmietet, einen Tag oder auch jahrelang lebt, und wenn man dann auszieht, bleiben leere, verfügbare, tote Hüllen zurück.
Zum Glück aber hatte ich an jenem Abend, als ich Gaminella den Rücken kehrte, auf der anderen Seite des Belbo den Hügel des Salto mit seinen Kämmen und weiten Wiesen vor mir, die zum Gipfel hin verschwanden. Und weiter unten waren auch hier nur kahle Weinberge, vom Flussufer durchschnitten, und die Gehölze, die Pfade, die verstreut liegenden Bauernhöfe waren noch so, wie ich sie Tag für Tag, Jahr für Jahr auf dem Balken hinter dem Haus oder auf dem Brückengeländer sitzend gesehen hatte. Dann, all die Jahre bis zum Militärdienst, in denen ich Knecht auf der Mora, dem Hof in der fetten Ebene auf der anderen Seite des Belbo, gewesen war, nachdem der Padrino das Gehöft von Gaminella verkauft hatte und mit seinen Töchtern nach Cossano umgezogen war, all die Jahre brauchte ich nur den Blick von den Feldern zu heben, um die Weinberge am Salto unterm Himmel zu sehen, und auch sie fielen nach Canelli hin ab, Richtung Eisenbahn, wo der Zug pfiff, der abends und morgens am Belbo entlangfuhr und mich an Wunderdinge denken ließ, an Bahnhöfe und Städte.
So hatte ich dieses Dorf, wo ich nicht geboren bin, lange Zeit für die ganze Welt gehalten. Jetzt, da ich die Welt wirklich gesehen habe und weiß, dass sie aus vielen kleinen Dörfern besteht, weiß ich nicht mehr, ob ich damals so falsch lag. Man fährt übers Meer und über Land, so wie die jungen Burschen seinerzeit zu den Dorffesten ringsum fuhren und tanzten, tranken, sich prügelten, die Fahne und zerschundene Fäuste mit heimbrachten. Man erntet die Trauben und verkauft sie nach Canelli; man sucht Trüffel und bringt sie nach Alba. Nuto, mein Freund vom Salto, versorgt das ganze Tal bis nach Camo mit Bottichen und Weinpressen. Was das heißt? Ein Dorf braucht man, und wäre es nur wegen der Genugtuung wegzugehen. Ein Dorf bedeutet, nicht allein zu sein, zu wissen, dass in den Menschen, in den Pflanzen, in der Erde etwas von dir ist, das bleibt, auch wenn du nicht da bist, und auf dich wartet. Aber es ist nicht leicht, in Ruhe dort zu leben. Seit einem Jahr behalte ich es nun schon im Auge und komme, so oft ich kann, aus Genua herüber, doch es gleitet mir aus der Hand. Diese Dinge begreift man mit der Zeit und der Erfahrung. Ist es möglich, dass ich jetzt mit vierzig und bei allem, was ich von der Welt gesehen habe, immer noch nicht weiß, was mein Dorf ist?
Da gibt es etwas, das ich nicht begreife. Hier meinen alle, ich sei zurückgekehrt, um mir ein Haus zu kaufen, und sie nennen mich den Amerikaner, führen mir ihre Töchter vor. Einem, der, als er wegging, nicht einmal einen Namen hatte, müsste das gefallen, und in der Tat gefällt es mir. Aber es genügt nicht. Mir gefällt auch Genua, mir gefällt es, zu wissen, dass die Welt rund ist, und immer einen Fuß auf den Laufplanken zu haben. Seit ich mich als Junge am Gatter der Mora auf die Schaufel stützte und den Reden der Tagediebe zuhörte, die auf der großen Straße vorbeikamen, sind für mich die Hügel von Canelli das Tor zur Welt. Nuto, der sich im Gegensatz zu mir nie vom Salto fortbewegt hat, sagt, um es auszuhalten, in diesem Tal zu leben, darf man es nie verlassen. Ausgerechnet er, der als junger Bursche mit der Dorfkapelle, wo er die Klarinette spielte, über Canelli hinausgekommen ist bis nach Spigno, bis nach Ovada, auf die Seite, wo die Sonne aufgeht. Ab und zu reden wir darüber, und er lacht.
II.
Diesen Sommer bin ich im Albergo dell’Angelo am Dorfplatz abgestiegen, wo mich keiner mehr kannte, so groß und dick wie ich bin. Auch ich kannte im Dorf niemanden; zu meiner Zeit kam man selten her, man lebte auf der Straße, an den Ufern, auf den Tennen. Das Dorf liegt weit oben im Tal, das Wasser des Belbo fließt an der Kirche vorbei und braucht eine halbe Stunde, bis sich der Fluss unter meinen Hügeln verbreitert.
Ich war hergekommen, um mich vierzehn Tage auszuruhen, und nun ist gerade Mariä Himmelfahrt. Umso besser, in dem Kommen und Gehen der Leute von auswärts, dem Durcheinander und dem Radau auf der Piazza wäre selbst ein Neger nicht aufgefallen. Ich habe Rufen, Singen, Fußballspielen gehört; mit einbrechender Dunkelheit Feuer und Böller; die Leute tranken, lachten hemmungslos, gingen in der Prozession mit; drei Nächte lang wurde die ganze Nacht auf der Piazza getanzt, und man hörte die Drehorgeln, die Hörner, das Knallen der Luftgewehre. Die gleichen Geräusche, der gleiche Wein, die gleichen Gesichter wie damals. Die Buben, die den Leuten zwischen den Beinen herumliefen, waren die gleichen; die großen Halstücher, die Ochsengespanne, der Geruch, der Schweiß, die Strümpfe der Frauen an den gebräunten Beinen, alles war wie eh und je. Auch die Fröhlichkeit, die Tragödien, die Versprechen am Ufer des Belbo. Neu war, dass ich mich damals, das bisschen Geld meines ersten Lohns in der Hand, Hals über Kopf in den Trubel gestürzt hatte, am Schießstand, auf der Schaukel, wir hatten die kleinen Mädchen mit Zöpfen zum Weinen gebracht, und noch wusste niemand von uns, warum Männer und Frauen, Burschen mit Pomade im Haar und prächtige Mädchen, sich trafen, sich ineinander vernarrten, sich anlachten und miteinander tanzten. Neu war, dass ich es jetzt wusste, und dass jene Zeit vorbei war. Ich war aus dem Tal weggegangen, als ich gerade anfing, es zu wissen. Nuto, der geblieben war, Nuto, der Schreiner vom Salto, mein Komplize bei den ersten Fluchten nach Canelli, hatte dann zehn Jahre lang auf allen Festen, bei allen Tanzveranstaltungen im Tal Klarinette gespielt. Für ihn war die Welt zehn Jahre lang ein ununterbrochenes Fest gewesen, er kannte alle Trinker, alle Gaukler, alle Fröhlichkeit der Dörfer.
Seit einem Jahr besuche ich ihn jedes Mal, wenn ich auf einen Sprung herkomme. Sein Haus liegt auf halber Höhe am Salto, geht auf die freie Landstraße hinaus; es riecht nach frischem Holz, nach Blumen und Hobelspänen, in den ersten Zeiten auf der Mora schien es mir, der ich von einem Gehöft und einer Tenne kam, eine andere Welt zu sein: Es war der Geruch der Straße, der Musikanten, der Villen von Canelli, wo ich noch nie gewesen war.
Jetzt ist Nuto verheiratet, ein gestandener Mann, er arbeitet und gibt anderen Arbeit, sein Haus ist immer noch dasselbe und duftet in der Sonne nach Geranien und Oleander, die in Töpfen am Fenster und an der Vorderseite stehen. Die Klarinette hängt am Schrank; man geht auf Hobelspänen; sie kippen sie körbeweise ans Ufer unterhalb des Salto – ein Ufer voller Akazien, Farne und Holunder, das im Sommer stets trocken ist.
Nuto hat mir gesagt, dass er sich entscheiden musste – entweder Schreiner oder Musiker –, und so hat er nach zehn Jahren voller Feste beim Tod seines Vaters die Klarinette an den Nagel gehängt. Als ich ihm erzählte, wo ich gewesen war, sagte er, von Leuten aus Genua habe er schon etwas davon erfahren, und im Dorf heiße es mittlerweile, vor meiner Abreise hätte ich unter dem Brückenpfeiler einen Topf voll Gold gefunden. Wir scherzten. »Vielleicht«, sagte ich, »kommt jetzt auch noch heraus, wer mein Vater war.«
»Dein Vater«, sagte er, »bist du selbst.«
»Das Schöne an Amerika«, sagte ich, »ist, dass dort eigentlich keiner weiß, wo er hingehört.
»Auch das«, erwiderte Nuto, »muss anders werden. Warum soll es Leute geben, die weder einen Namen noch ein Haus haben? Sind wir nicht alle Menschen?«
»Lass die Dinge, wie sie sind. Ich habe es geschafft, auch ohne Namen.«
»Du hast es geschafft«, sagte Nuto, »und niemand wagt es mehr, dich darauf anzusprechen. Aber was ist mit denen, die es nicht geschafft haben? Du weißt nicht, wie viele kümmerliche Existenzen es noch auf diesen Hügeln gibt. Als ich mit der Musik umherzog, sah man überall vor den Küchen den Trottel, den Schwachsinnigen, den Landstreicher sitzen. Kinder von Trunkenbolden und unwissenden Mägden, dazu verurteilt, von Kohlstrünken und Brotkanten zu leben. Es gab auch Leute, die ihre Scherze mit ihnen trieben. Du hast es geschafft«, sagte Nuto, »weil du ein, wenn auch bescheidenes Zuhause gefunden hast; beim Padrino bekamst du wenig zu essen, aber gegessen hast du. Man darf nicht sagen, die anderen sollen es selber schaffen, man muss ihnen helfen.«
Ich unterhalte mich gern mit Nuto; jetzt sind wir Männer und kennen uns gut; aber damals, zu den Zeiten der Mora, der Arbeit auf dem Bauernhof, konnte er, der drei Jahre älter ist als ich, schon pfeifen und Gitarre spielen, er war beliebt und man hörte auf ihn, er redete vernünftig mit den Großen und mit uns Buben, zwinkerte den Frauen zu. Schon damals lief ich ihm hinterher, und manchmal rannte ich vom Feld davon, um am Ufer oder im Belbo Jagd auf Vogelnester mit ihm zu machen. Er sagte mir, was ich tun musste, um auf der Mora respektiert zu werden; am Abend kam er dann auf den Hof, um mit uns zusammenzusitzen.
Und jetzt erzählte er mir von seinem Leben als Musikant. Die Dörfer, wo er gewesen war, umgaben uns, tagsüber hell und waldig unter der Sonne, nachts Sternennester am schwarzen Himmel. Am Samstagabend probte Nuto mit den Mitgliedern der Kapelle unter einem Schutzdach am Bahnhof, und anschließend begaben sie sich leichtfüßig und rasch aufs Fest; dann schlossen sie zwei, drei Tage lang weder Mund noch Augen – nach der Klarinette kam das Glas, nach dem Glas die Gabel, dann wieder die Klarinette, das Horn, die Trompete, dann wurde wieder gegessen, dann wieder getrunken, dann das Solo, danach der Nachmittagsimbiss, das große Abendessen, der Tanz bis zum Morgen. Es gab Feste, Prozessionen, Hochzeiten; oft spielten konkurrierende Kapellen um die Wette. Am Morgen des zweiten, des dritten Tages stiegen sie benommen vom Podium herunter, es war ein Genuss, das Gesicht in einen Eimer Wasser zu tauchen und sich, wenn möglich, auf den Wiesen zwischen Fuhrwerken, Karren und dem Mist von Pferden und Ochsen ins Gras zu werfen. »Wer bezahlte?«, fragte ich. Die Gemeinden, die Familien, die Aufsteiger, einfach alle. Und beim Essen, sagte er, waren immer dieselben da.
Was sie aßen, wollte ich hören. Dabei fielen mir die großen Essen ein, von denen man auf der Mora erzählte, Festessen in anderen Dörfern und in anderen Zeiten. Aber die Gerichte waren immer die gleichen, und während ich zuhörte, schien mir, als käme ich wieder in die Küche auf der Mora, als sähe ich die Frauen wieder reiben, kneten, Füllungen zubereiten, Deckel abnehmen und das Feuer schüren, und ich schmeckte die Speisen im Mund und hörte das zerbrochene Reisig knacken.
»Es war deine Leidenschaft«, sagte ich zu ihm. »Warum hast du aufgehört? Weil dein Vater gestorben ist?«
Und Nuto sagte, erstens bringe Spielen wenig ein, und außerdem all die Verschwendung und nie zu wissen, wer bezahlt, das widert einen am Ende an. »Und dann kam der Krieg«, sagte er. »Die Mädchen juckte es vielleicht noch in den Beinen, aber wer hätte mit ihnen tanzen sollen? In den Kriegsjahren amüsierten die Leute sich anders.«
»Doch die Musik gefällt mir«, fuhr Nuto nachdenklich fort, »das Problem ist nur, dass sie ein schlechter Herr ist … Sie wird zum Laster, deshalb muss man aufhören. Mein Vater sagte immer, dann lieber das Laster mit den Frauen …«
»Tja«, sagte ich, »wie ist es dir mit den Frauen ergangen? Früher gefielen sie dir. Beim Tanz kommen sie ja alle vorbei.«
Nuto hat diese Art, wenn er lacht, leise zu pfeifen, auch wenn er es ernst meint.
»Hast du dem Findelhaus in Alessandria nichts geliefert?«
»Ich hoffe nicht«, sagte er. »Auf einen wie dich kommen so viele arme Teufel.«
Dann sagte er mir, ihm sei von beiden die Musik lieber. Als Gruppe losziehen in den Nächten, in denen sie spät heimkehrten – manchmal kam das vor –, und spielen, spielen, er das Horn und die Mandoline, während sie im Dunkeln die Straße entlangwanderten, fern von den Häusern, fern von den Frauen und den Hunden, die zur Antwort wie verrückt bellten, einfach nur spielen. »Einer ein Ständchen zu bringen, war nie meine Sache«, sagte er. »Wenn ein Mädchen hübsch ist, will sie keine Musik. Sie will von den Freundinnen beneidet werden, sie sucht den Mann. Ich habe noch nie ein Mädchen getroffen, die begriffen hätte, was Spielen bedeutet …«
Nuto bemerkte, dass ich lachte, und sagte sofort: »Ich erzähle dir was. Ich hatte einen Musikanten, Arboreto, der das kleine Bombardon spielte. Er brachte seiner Liebsten so viele Ständchen, dass wir sagten: ›Die zwei reden nicht miteinander, sie spielen sich auf …‹«
Diese Unterhaltungen führten wir auf der großen Straße, oder an Nutos Fenster, während wir ein Glas tranken, und unter uns lag die Ebene des Belbo mit den Silberpappeln, die jenen schmalen Wasserlauf säumten, und vor uns der mächtige Hügel von Gaminella voller Weinberge und an den Ufern dichtes Gestrüpp. Wie lange hatte ich nicht mehr von diesem Wein getrunken?
»Habe ich dir schon gesagt«, fragte ich Nuto, »dass der Cola verkaufen will?«
»Nur das Land?«, fragte er zurück. »Pass auf, der verkauft dir auch das Bett.«
»Strohsack oder Federn?«, knurrte ich zwischen den Zähnen. »Ich werde alt.«
»Alle Federn werden hart wie ein Strohsack«, sagte Nuto. Dann fügt er hinzu: »Hast du schon einen Blick auf die Mora geworfen?«
In der Tat. Dort war ich noch nicht gewesen. Vom Haus am Salto waren es nur ein paar Schritte, und ich war nicht hingegangen. Ich wusste, dass der Alte, die Töchter, die Jungen, die Knechte, dass sie alle versprengt waren, verschwunden, manche gestorben, manche weit weg. Nur Nicoletto war noch übrig, der schwachköpfige Neffe, der mir so oft, mit den Füßen aufstampfend, Bankert nachgeschrien hatte, und die Hälfte des Besitzes war verkauft.
»Eines Tages werde ich hingehen«, sagte ich. »Ich bin ja wieder da.«
III.
Neuigkeiten über Nuto, den Musikanten, hatte ich sogar in Amerika erfahren – vor wie vielen Jahren? –, als ich noch nicht daran dachte, zurückzukommen, als ich den Eisenbahnertrupp verlassen und mir, von Bahnhof zu Bahnhof in Kalifornien angelangt, beim Anblick jener lang gestreckten Hügel unter der Sonne gesagt hatte: »Ich bin zu Hause.« Auch Amerika endete am Meer, und diesmal war es sinnlos, mich erneut einzuschiffen, daher hatte ich mich zwischen den Pinien und den Weinbergen niedergelassen. »Wenn sie mich mit der Hacke in der Hand sähen«, dachte ich, »würden mich die daheim auslachen.« Aber in Kalifornien hackt man nicht. Es ist eher so, als arbeitete man als Gärtner. Ich begegnete anderen Piemontesen und ärgerte mich: Es lohnte sich nicht, durch die halbe Welt gereist zu sein, um dann genau solche Leute wie mich zu treffen, die mich noch dazu schief ansahen. Ich gab die Landwirtschaft auf und arbeitete als Milchmann in Oakland. Abends sah man am Meer auf der anderen Seite der Bucht die Lichter von San Francisco. Ich fuhr hin, hungerte mich einen Monat durch, und als ich aus dem Gefängnis kam, war ich so weit, dass ich die Chinesen beneidete. Da fragte ich mich, ob es die Mühe wert war, durch die Welt zu reisen, um irgendwen zu sehen. Ich kehrte auf die Hügel zurück.
Ich lebte schon eine Weile dort und hatte mir eine Freundin zugelegt, die mir nicht mehr gefiel, seit sie im selben Lokal an der Straße nach Cerritos arbeitete wie ich. Da sie mich immer am Ausgang abholte, hatte sie es geschafft, sich als Kassiererin anheuern zu lassen, und jetzt schaute sie mich den ganzen Tag über die Theke hinweg an, während ich Speck briet und Gläser füllte. Wenn ich Feierabend hatte, lief sie mit auf dem Asphalt klappernden Absätzen hinter mir her, hakte sich bei mir ein und wollte, dass wir ein Auto anhalten, um ans Meer hinunterzufahren oder ins Kino zu gehen. Kaum war man aus dem hell erleuchteten Lokal draußen, war man allein unter den Sternen, und die Grillen und Frösche machten einen Heidenlärm. Ich wäre gern mit ihr ein Stück landeinwärts gegangen, zwischen die Apfelbäume, die Wäldchen oder auch nur auf das kurze Gras der Böschungen, hätte sie rücklings auf den Boden gelegt, dem ganzen Lärm unter den Sternen einen Sinn gegeben. Sie wollte nichts davon wissen. Sie kreischte, wie die Frauen es so machen, verlangte, wir sollten in ein anderes Lokal gehen. Um sich anfassen zu lassen – wir hatten ein Zimmer in einer Gasse in Oakland –, musste sie betrunken sein.
An einem dieser Abende erzählte mir jemand von Nuto. Ein Mann, der aus Bubbio kam. Das erkannte ich an seiner Statur und am Schritt, noch bevor er den Mund aufmachte. Er fuhr einen Holzlaster, und während sie ihm draußen den Tank füllten, bestellte er bei mir ein Bier.
»Eine Flasche Wein wäre besser«, sagte ich mit verkniffenen Lippen in unserem Dialekt.
Mit lachenden Augen sah er mich an. Wir redeten den ganzen Abend, bis die draußen ununterbrochen hupten. An der Kasse spitzte Nora die Ohren, wurde unruhig, doch sie war nie in der Gegend von Alessandria gewesen und verstand nichts. Ich goss meinem Freund sogar eine Tasse verbotenen Whisky ein. Er erzählte mir, dass er daheim als Kraftfahrer gearbeitet hatte, wo er überall gewesen war, warum er nach Amerika gekommen war. »Aber wenn ich gewusst hätte, dass man hier solches Zeug trinkt … Es wärmt, da kann man nichts sagen, aber einen guten Wein zum Essen gibt es nicht …«
»Nichts gibt es hier«, sagte ich zu ihm, »es ist wie auf dem Mond.«
Gereizt richtete Nora sich die Haare. Sie drehte sich auf dem Stuhl um und stellte das Radio auf Tanzmusik. Mein Freund zuckte die Achseln, beugte sich über die Theke und sagte mit einer Handbewegung nach hinten zu mir: »Gefallen dir diese Frauen?«
Ich wischte mit dem Lappen über die Theke. »Es ist unsere Schuld«, sagte ich. »Dieses Land ist ihr Zuhause.«
Er schwieg und lauschte dem Radio. Ich hörte unter der Musik immer weiter das Quaken der Frösche. Mit vorgereckter Brust betrachtete Nora verächtlich seinen Rücken.
»Es ist wie dieses Gedudel«, sagte er. »Kein Vergleich! Sie können einfach nicht spielen …«
Und er erzählte mir von dem Wettspielen in Nizza Monferrato im Jahr davor, als die Kapellen aus allen Dörfern, aus Cortemilia, aus San Marzano, aus Canelli, aus Neive zusammengekommen waren und gespielt und gespielt hatten, die Leute hatten sich nicht mehr gerührt, das Pferderennen musste verschoben werden, auch der Pfarrer hörte der Tanzmusik zu, sie tranken nur, um durchzuhalten, um Mitternacht spielten sie immer noch, und zuletzt hatte Tiberio gewonnen, die Kapelle aus Neive. Doch es hatte eine Auseinandersetzung gegeben, Gerenne, Flasche auf den Kopf, und seiner Ansicht nach hätte dieser Nuto vom Salto den Preis verdient …
»Nuto? Den kenne ich doch.«
Daraufhin sagte mir der Freund, wer Nuto war und was er machte. Er erzählte, dass Nuto in derselben Nacht, um es diesen Banausen zu zeigen, mit seiner Kapelle auf der Landstraße losgegangen war und sie ununterbrochen gespielt hatten, bis Calamandrana. Im Mondschein war er ihnen auf dem Fahrrad gefolgt, und sie spielten so gut, dass die Frauen in den Häusern aus dem Bett sprangen und Beifall klatschten, und dann blieb die Kapelle stehen und begann ein neues Stück. Nuto in ihrer Mitte führte alle mit seiner Klarinette an.
Nora schrie, ich solle dafür sorgen, dass das Gehupe aufhört. Ich schenkte meinem Freund noch eine Tasse Whisky ein und fragte, wann er nach Bubbio zurückkehre.
»Am liebsten morgen«, sagte er, »wenn ich könnte.«
In jener Nacht setzte ich mich vor dem Heimweg nach Oakland ins Gras, um eine Zigarette zu rauchen, auf der leeren Böschung, weit weg von der Straße, wo die Autos vorbeifuhren. Der Mond war nicht da, aber ein Meer von Sternen, so viele wie Stimmen der Grillen und Frösche. Selbst wenn Nora sich in jener Nacht ins Gras hätte legen lassen, hätte es mir nicht genügt. Die Frösche hätten nicht aufgehört zu quaken, die Autos nicht aufgehört, mit Vollgas den Berg hinunterzurasen, und Amerika wäre weiter mit dieser Straße und diesen erleuchteten Städten unten an der Küste zu Ende gewesen. In dieser Dunkelheit, in diesem Geruch nach Garten und nach Pinien begriff ich, dass diese Sterne nicht meine waren, dass sie mir wie Nora und die Gäste des Lokals Angst machten. Die Eier mit Speck, der gute Lohn, die Orangen, so groß wie Wassermelonen, bedeuteten mir nichts, sie waren wie jene Grillen und Frösche. Hatte es sich gelohnt, herzukommen? Wo konnte ich noch hingehen? Mich von der Mole stürzen? Jetzt wusste ich, warum auf den Straßen ab und zu ein erdrosseltes Mädchen gefunden wurde, in einem Auto oder in einem Zimmer oder am Ende einer Gasse. Sollten auch diese Leute Lust haben, sich ins Gras zu werfen, im Einvernehmen mit den Fröschen zu leben, ein Stück Land zu besitzen, so groß wie eine Frau, und wirklich da zu schlafen, ohne Angst? Und doch war das Land groß, es reichte für alle. Es gab Frauen, es gab Grundstücke, es gab Geld. Aber niemand bekam genug, niemand, so viel er auch haben mochte, gab sich zufrieden, und die Felder, auch die Weinberge, sahen aus wie öffentliche Anlagen, künstliche Blumenbeete wie die vor den Bahnhöfen, oder waren unbebaut, verbrannte Erde, Schrottberge. Es war kein Land, in dem man sich fügen, den Kopf niederlegen und zu den anderen sagen konnte: »So schlecht es auch gehen mag, ihr kennt mich. So schlecht es auch gehen mag, lasst mich leben.« Das war es, was einen ängstigte. Nicht einmal untereinander kannten sie sich; wenn man diese Berge überquerte, begriff man an jeder Biegung, dass sich niemand je dort aufgehalten hatte, dass niemand sie je mit den Händen berührt hatte. Deshalb verprügelten sie einen Betrunkenen, lochten ihn ein, ließen ihn halb tot da liegen. Und sie hatten nicht nur den Rausch, sie hatten auch böse Frauen. Es kam der Tag, an dem einer, um etwas zu erreichen, um bekannt zu werden, eine Frau erwürgte, sie im Schlaf erschoss, ihr mit der Rohrzange den Kopf einschlug.
Nora rief mich von der Straße her, um in die Stadt zu gehen. Von fern klang ihre Stimme wie die der Grillen. Ich musste lachen bei der Vorstellung, sie könnte erfahren, was ich dachte. Doch diese Dinge sagt man niemandem, es bringt nichts. Eines schönen Morgens würde sie mich nicht mehr sehen, das war alles. Aber wo sollte ich hin? Ich war am Ende der Welt angelangt, an der letzten Küste, und hatte genug. Damals begann ich darüber nachzudenken, dass ich die Berge erneut überqueren könnte.
IV.
Nicht einmal an Mariä Himmelfahrt hat Nuto zur Klarinette greifen wollen – er sagt, es sei wie mit dem Rauchen, wenn man aufhört, muss man ganz aufhören. Am Abend kam er ins Angelo, und wir genossen die Kühle auf dem Balkon meines Zimmers. Der Balkon geht auf die Piazza hinaus, und auf der Piazza war der Teufel los, doch wir blickten über die Dächer hinweg auf die mondweißen Weinberge.
Nuto, der alles ergründen will, redete davon, was diese Welt ist, er wollte von mir wissen, was die Leute tun und sagen, stützte das Kinn aufs Geländer und hörte mir zu.
»Hätte ich so spielen können wie du, wäre ich nicht nach Amerika gegangen«, sagte ich. »Du weißt, wie es in dem Alter geht. Es genügt, ein Mädchen zu sehen, sich mit jemandem zu prügeln, im Morgengrauen heimzukommen. Man will etwas tun, etwas sein, sich entscheiden. Das bisherige Leben genügt einem nicht mehr. Wenn man weggeht, wirkt es leichter. Man hört so viel. In dem Alter scheint einem eine Piazza wie diese die ganze Welt zu sein. Man glaubt, so sei die Welt …«
Nuto schwieg und betrachtete die Dächer.
»Wer weiß, wie viele der Jungen hier unten gern den Weg nach Canelli einschlagen möchten …«, sagte ich.