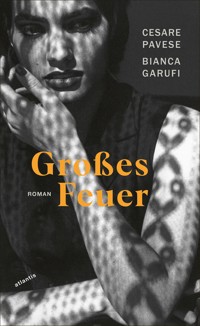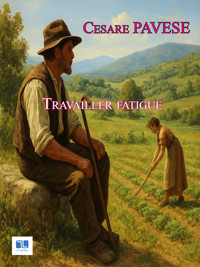Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Rotpunktverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Edition Blau
- Sprache: Deutsch
Die Romane führen ins Turin der vierziger Jahre, wo jugendliche Erwartung und Lebensgier, das übermütige Bedürfnis, die Norm zu übertreten, in Desillusionierung und gescheiterte Leidenschaft münden. "Damals war immer Festtag", so setzt Der schöne Sommer ein. Ginia, eine junge Schneiderin, entdeckt die Cafés unter den Arkaden und verliebt sich in den Maler Guido. Bald schon steht sie ihm Modell. Einer Versuchung erliegen auch die drei Studenten in Der Teufel auf den Hügeln, die wenig schlafen und viel reden, wenn sie nachts durch die Stadt laufen. Als sie auf dem Landsitz eines Mailänder Dandys ein paar wilde Sommertage verbringen, ist ihrer Jugend abrupt ein Ende gesetzt. Clelia aus Die einsamen Frauen könnte einmal die junge Ginia gewesen sein. Die erfolgreiche Modedesignerin kehrt in ihre Heimatstadt zurück, da wird vor ihren Augen die lebensmüde Rosetta, "aufgedunsenes Gesicht und wirre Haare, in einem Abendkleid aus hellblauem Tüll, ohne Schuhe", auf einer Trage abtransportiert. Die Schattenseite der fröhlichen Serenaden? Paveses "Turiner Romane", 1950 mit dem Premio Strega ausgezeichnet, haben mit ihrer Aufgekratztheit, der atemlosen Suche nach dem Geheimnis des Lebens und dem seinerzeit neuen jazzhaften Rhythmus auch siebzig Jahre nach Erscheinen nichts von ihrer Modernität verloren. Sie liegen nun vollständig in Neuübersetzung von Maja Pflug vor
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 565
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Die vorliegenden drei Romane erschienen unter dem Titel Der schöne Sommer in einem Band 1949 in der Reihe »Supercoralli« bei Einaudi. Im Klappentext schrieb Pavese: »Ein Band, drei Romane. Jeder davon könnte ein eigenes Buch sein. Warum kommen Der schöne Sommer, Der Teufel auf den Hügeln und Die einsamen Frauen zusammen heraus? Es ist nicht das, was man Trilogie nennt, es geht um ein moralisches Klima, ein Zusammentreffen von Themen, um ein wiederkehrendes geistiges Klima im freien Spiel der Fantasie. Obwohl reich an landschaftlichen Bezügen – und Der Teufel auf den Hügeln fragt sich sogar im Ansatz, was denn Natur und Land sind –, sind es drei urbane Romane, drei Romane über die Entdeckung der Stadt und der Gesellschaft, drei Romane über jugendliche Begeisterung und gescheiterte Leidenschaft. In jeder der unterschiedlichen Handlungen und Milieus kehrt das Thema der Versuchung wieder, der Einfluss, dem alle Jugendlichen zwangsläufig ausgesetzt sind. Ein weiteres Thema ist die atemlose Suche nach dem Laster, das übermütige Bedürfnis, die Norm zu übertreten, an die Grenzen zu stoßen. Und noch ein gemeinsames Thema ist, dass die natürliche Strafe den Unschuldigsten und Wehrlosesten trifft, den ›Jüngsten‹.«
Im Manuskript ist Der schöne Sommer datiert 2. März – 6. Mai 1940 und trägt den Titel La tenda (Der Vorhang); Der Teufel auf den Hügeln ist datiert 20. Juni – 4. Oktober 1948; Die einsamen Frauen 17. März – 26. Mai 1949.
Cesare Pavese
Der schöne Sommer
Drei Romane
Aus dem Italienischen von Maja Pflug
Der Rotpunktverlag wird vom Bundesamt für Kultur mit einem Strukturbeitrag für die Jahre 2021–2024 unterstützt.
Die Originalausgabe ist 1949 unter dem Titel La bella estate bei Giulio Einaudi Editore erschienen.
Maja Pflugs Übersetzung von Der schöne Sommer sowie von Einsame Frauen, 2012 bzw. 2008 erstmals erschienen, wurde für diese Ausgabe neu durchgesehen.
»Portrait eines Freundes« von Natalia Ginzburg ist dem Band Die kleinen Tugenden entnommen. Aus dem Italienischen von Maja Pflug. Mit freundlicher Genehmigung des Verlags Klaus Wagenbach.
© 1989, 1996, 2001, 2016, 2020 Verlag Klaus Wagenbach, Berlin
© 2021 Edition Blau im Rotpunktverlag, Zürich
www.rotpunktverlag.ch
www.editionblau.ch
Lektorat: Daniela Koch
eISBN: 978-3-85869-904-6
1. Auflage
INHALT
Der schöne Sommer
Der Teufel auf den Hügeln
Die einsamen Frauen
Statt eines NachwortsNatalia Ginzburg, Porträt eines Freundes
Cesara PaveseAusgewählte Daten zu Leben und Werk
Der schöne Sommer
I.
Damals war immer Festtag. Es genügte, das Haus zu verlassen und die Straße zu überqueren, schon wurden die Mädchen wie verrückt, und alles war so schön, besonders nachts, dass sie, wenn sie todmüde zurückkehrten, immer noch hofften, dass etwas geschähe, dass ein Brand ausbräche, dass zu Hause ein Kind geboren würde oder dass es womöglich plötzlich Tag würde und alle Leute auf die Straße liefen und man immer weiter und weiter gehen könnte bis zu den Wiesen und hinter die Hügel. »Ihr seid gesund, ihr seid jung«, sagten sie, »ihr seid Mädchen und habt keine Sorgen, das ist selbstverständlich.« Doch sogar Tina, eine von ihnen, die hinkend aus dem Krankenhaus gekommen war und zu Hause nichts zu essen hatte, auch sie lachte unentwegt über nichts, und eines Abends, als sie hinter den anderen hertrottete, war sie stehengeblieben und hatte zu weinen begonnen, weil Schlafen eine Dummheit war und der Fröhlichkeit die Zeit stahl.
Wenn Ginia solche Krisen überfielen, ließ sie sich nichts anmerken, sondern begleitete eine der anderen heim und redete und redete, bis sie nichts mehr zu sagen wussten. Kam dann der Augenblick, sich zu verabschieden, so waren sie schon eine ganze Weile wie allein, und Ginia ging ruhig nach Hause, ohne der Gesellschaft nachzutrauern. Die schönsten Nächte waren natürlich samstags, wenn sie zum Tanzen gingen und am nächsten Tag ausschlafen konnten. Aber es genügte auch weniger, und manchmal, wenn sich Ginia morgens auf den Weg zur Arbeit machte, war sie schon glücklich über das Stück Straße, das sie erwartete. Die anderen sagten: »Wenn ich spät heimkomme, bin ich dann müde; wenn ich spät heimkomme, kriege ich eins hinter die Ohren.« Doch Ginia war nie müde, und ihr Bruder, der nachts arbeitete, sah sie nur zum Abendessen, und tagsüber schlief er. Mittags (Severino drehte sich im Bett um, wenn sie hereinkam) deckte Ginia den Tisch und aß hungrig, kaute dabei gemächlich und lauschte den Geräuschen im Haus. Die Zeit verstrich langsam, wie es in leeren Wohnungen so ist, und Ginia hatte Zeit, das Geschirr abzuwaschen, das im Spülbecken wartete, ein wenig sauber zu machen, sich dann auf dem Sofa unter dem Fenster auszustrecken und beim Ticken des Weckers aus dem Nebenzimmer einzuschlummern. Manchmal schloss sie auch die Fensterläden, damit es dunkel wurde und sie sich noch einsamer fühlte. Rosa würde sowieso um drei die Treppe herunterkommen und leise, um Severino nicht zu wecken, an der Türe kratzen, bis sie ihr antwortete, sie sei wach. Dann verließen sie gemeinsam das Haus und verabschiedeten sich an der Straßenbahn.
Ginia und Rosa hatten nichts gemein außer diesem Stück Weg und einem Stern aus kleinen Perlen im Haar. Doch als sie einmal an einem Schaufenster vorübergingen und Rosa sagte: »Wir sehen aus wie Schwestern«, merkte Ginia, wie ordinär dieser Stern war, und begriff, dass sie einen kleinen Hut tragen musste, wenn sie nicht auch wie eine Arbeiterin wirken wollte. Umso mehr, da Rosa, die noch von Vater und Mutter abhängig war, sich erst wer weiß wann einen würde leisten können.
Wenn sie vorbeisah, um Ginia zu wecken, kam Rosa herein, falls es nicht schon zu spät war; und Ginia ließ sich beim Aufräumen helfen und lachte halblaut über Severino, der, wie alle Männer, nicht wusste, was es hieß, einen Haushalt zu führen. Zum Spaß nannte Rosa ihn dann »deinen Mann«, aber nicht selten machte Ginia ein finsteres Gesicht und erwiderte, die ganze Arbeit mit dem Haushalt zu haben, aber keinen Mann, sei gar nicht lustig. Ginia meinte es nicht ernst – denn ihr Vergnügen bestand genau darin, diese Stunde allein zu Hause zu verbringen, ganz ihre eigene Herrin –, doch ab und zu musste man Rosa zu verstehen geben, dass sie keine Kinder mehr waren. Auch auf der Straße wusste Rosa sich nicht zu benehmen und schnitt Grimassen, lachte, drehte sich um – Ginia hätte sie verprügeln mögen. Aber wenn sie zusammen tanzen gingen, war Rosa unentbehrlich, denn sie duzte alle, und ihre Verrücktheiten zeigten den anderen, dass Ginia feiner war. In diesem schönen Jahr, als sie begannen, allein zu leben, hatte Ginia bald gemerkt, was sie von den anderen Mädchen unterschied, nämlich dass sie auch zu Hause allein war – Severino zählte nicht – und mit sechzehn Jahren wie eine Frau leben konnte. Deshalb ließ sie sich, solange sie den Stern im Haar trug, von Rosa begleiten, weil sie sie lustig fand. Im ganzen Viertel gab es keine Zweite, die, wenn sie wollte, so albern war wie Rosa. Sie konnte jeden aus der Fassung bringen, indem sie lachte und in die Luft schaute, und ganze Abende war alles, was sie tat und sagte, die reine Komödie. Und sie war angriffslustig wie ein Hahn. »Was hast du, Rosa?«, fragte einer, während sie noch warteten, dass das Orchester zu spielen anfing. »Angst« – und die Augen traten ihr dabei aus dem Kopf –, »ich habe da hinten einen alten Mann gesehen, der mich anstarrt, er wartet draußen auf mich, ich fürchte mich.« Der Junge glaubte es nicht. »Das wird dein Großvater sein.« – »Dummkopf.« – »Also tanzen wir.« – »Nein, ich habe Angst.« Nach der halben Runde hörte Ginia den Jungen rufen: »Du ungezogene Göre, eine Hexe bist du, hau ab und verschwinde. Geh doch zurück in die Fabrik!« Da lachte Rosa und brachte auch alle anderen zum Lachen, aber Ginia dachte im Weitertanzen, dass es wirklich die Fabrik war, die ein Mädchen so herunterkommen ließ. Übrigens brauchte man ja nur die Mechaniker anzusehen, die eine Bekanntschaft auch immer mit solchen Scherzen begannen.
War einer von ihnen mit von der Partie, konnte man sicher sein, dass noch vor dem Dunkelwerden ein Mädchen wütend wurde oder, wenn sie dümmer war, weinte. Sie trieben genau solche Späße wie Rosa. Immer wollten sie die Mädchen mit in die Wiesen nehmen. Man konnte sich nicht mit ihnen unterhalten, sondern musste gleich auf der Hut sein. Aber schön war, dass dann an manchen Abenden gesungen wurde, und sie sangen gut, vor allem wenn Ferruccio mit der Gitarre kam, ein großer Blonder, der ständig arbeitslos war, aber noch ganz schwarze, rissige Finger hatte von der Kohle. Es schien unmöglich, dass diese groben Hände so geschickt waren, und Ginia, die sie einmal unter der Achsel gespürt hatte, als sie alle gemeinsam von den Hügeln zurückkehrten, achtete darauf, sie nicht anzusehen, während sie spielten. Rosa hatte ihr gesagt, dass sich dieser Ferruccio zwei- oder dreimal nach ihr erkundigt habe, und Ginia hatte geantwortet: »Sag ihm, er soll sich zuerst die Fingernägel sauber machen.« Beim nächsten Mal erwartete sie, dass Ferruccio lachen würde, aber er hatte sie keines Blickes gewürdigt.
Doch dann kam der Tag, an dem Ginia aus dem Schneideratelier trat und sich noch mit beiden Händen den Hut zurechtrückte, als Rosa unvermutet am Haustor auf sie zusprang. »Was ist los?« – »Ich bin aus der Fabrik fortgelaufen.« Gemeinsam gingen sie den Bürgersteig entlang bis zur Straßenbahn, aber Rosa blieb stumm. Ginia war verärgert und wusste nicht, was sie sagen sollte. Erst als sie in der Nähe ihres Hauses aus der Straßenbahn stiegen, murmelte Rosa leise, dass sie Angst habe, schwanger zu sein. Ginia nannte sie ein dummes Ding, und sie stritten sich an der Ecke. Dann ging die Sache vorüber, denn Rosa hatte sich nur vor Schreck in diesem Zustand geglaubt, aber unterdessen war Ginia aufgeregter als sie, weil sie sich vorkam, als habe man sie betrogen und wie ein Kind behandelt, während die anderen sich amüsierten, und noch dazu Rosa, die kein bisschen Ehrgeiz hatte. »Ich bin mehr wert«, sagte Ginia, »mit sechzehn ist es noch zu früh. Selber schuld, wenn sie sich so wegwerfen will.« Das sagte sie, aber sie konnte nicht ohne Demütigung daran zurückdenken, denn die Vorstellung, dass die anderen Mädchen alle schon in den Wiesen gewesen waren, ohne es je zu erwähnen, während ihr, die allein lebte, die Hand eines Mannes noch Herzklopfen verursachte, diese Vorstellung nahm ihr den Atem. »Warum bist du an dem Tag zu mir gekommen, um es mir zu sagen?«, fragte sie Rosa eines Nachmittags, während sie zusammen aus dem Haus gingen. »Wem hätte ich es denn sonst sagen sollen?« – »Warum hast du mir vorher nie was gesagt?« Rosa, die jetzt beruhigt war, lachte. »Wenn man nichts sagt, ist es schöner. Es bringt Unglück, darüber zu reden.« Ginia dachte: »Sie ist ein dummes Ding. Jetzt lacht sie, aber vorher wollte sie sich umbringen. Sie ist noch gar keine Frau, das ist es.« Auch wenn sie allein durch die Straßen ging, dachte sie nun oft, sie seien alle zu jung und man müsste sofort zwanzig sein, um zu wissen, wie man sich verhalten solle.
Einen ganzen Abend lang beobachtete sie Rosas Liebsten – Pino mit der krummen Nase, einen kleinen Kerl, der nur Billard spielen konnte und nichts tat und beim Reden die Mundwinkel verzog. Ginia verstand nicht, warum Rosa immer noch mit ihm ins Kino ging, nachdem sie erfahren hatte, wie feige er war. Ihr wollte dieser Sonntag nicht aus dem Kopf gehen, an dem sie alle zusammen Boot gefahren waren und man gesehen hatte, dass Pinos Rücken voller Sommersprossen war, wie Rost sah es aus. Jetzt, da sie alles wusste, erinnerte sie sich, dass Rosa an jenem Tag mit ihm unter den Bäumen verschwunden war. Wie dumm sie gewesen war, es nicht zu begreifen. Aber noch dümmer war Rosa, und das sagte sie ihr auch noch einmal am Eingang zum Kino.
Wenn sie daran dachte, wie oft sie Boot gefahren waren! Man scherzte, lachte, neckte die Paare. Ginia, die mehr auf die anderen Mädchen achtete, hatte Rosa und Pino nicht bemerkt. In der Mittagshitze waren sie und die hinkende Tina allein im Boot zurückgeblieben. Die anderen, einschließlich Rosa, waren an Land gegangen, wo man sie schreien hörte. Tina, die Rock und Bluse anbehalten hatte, sagte zu Ginia: »Wenn niemand kommt, ziehe ich mich aus, um mich zu sonnen.« Ginia erwiderte, sie würde aufpassen, lauschte aber stattdessen den Stimmen und dem Schweigen am Ufer. Nach einiger Zeit war es ganz still auf dem ruhigen Wasser. Tina lag in der Sonne, ein Handtuch um die Hüften. Da war Ginia ins Gras gesprungen und barfuß ein paar Schritte gegangen. Auch die Stimme von Amelia, die alle anderen hinter sich hergezogen hatte, war nicht mehr zu hören. Dumm, wie sie war, hatte Ginia sich eingebildet, sie spielten Verstecken, und nicht nach ihnen gesucht, sondern war aufs Boot zurückgekehrt.
II.
Von Amelia wusste man wenigstens, dass sie ein anderes Leben führte. Ihr Bruder war Mechaniker, doch sie tauchte an jenen Sommerabenden nur ab und zu auf und gestattete niemandem Vertraulichkeiten, lachte aber mit allen, weil sie schon neunzehn oder zwanzig war. Ginia hätte gern ihre Figur gehabt, denn an Amelias Beinen machten sich die feinen Strümpfe wirklich gut. War Amelia allerdings im Badeanzug, sah man ihre ausladenden Hüften, und ihre Gesichtszüge erinnerten ein bisschen an ein Pferd. »Ich bin arbeitslos«, sagte sie eines Abends zu Ginia, während diese ihr Kleid musterte, »ich habe den ganzen Tag Zeit, über ein Modell nachzudenken. Ich habe Zuschneiden gelernt, als ich noch wie du in der Schneiderei arbeitete, weißt du?« Ginia dachte, dass es am schönsten wäre, sich die Kleider machen zu lassen, sagte aber nichts. Vielmehr drehten sie an jenem Abend zusammen eine Runde, und Ginia begleitete Amelia bis nach Hause, denn sie fühlte sich hellwach und dachte nicht ans Schlafen. Es hatte geregnet, und der Asphalt und die Bäume waren wie frisch gewaschen: Man spürte die Kühle im Gesicht.
»Du gehst gern spazieren«, sagte Amelia lachend. »Was meint dein Bruder Severino dazu?« – »Um diese Zeit ist Severino bei der Arbeit. Alle Straßenlaternen zündet er an und überwacht sie.« – »Dann ist er es, der den Paaren Licht macht? Wie ist er angezogen? Wie ein Gasmann?« – »Aber nein«, sagte Ginia lachend, »er überwacht die Schalter in der Zentrale. Er verbringt die Nacht an einer Maschine.« – »Und lebt ihr allein? Hält er dir keine Moralpredigten?« Amelia redete fröhlich und unbefangen, wie jemand, der alle kennt, und Ginia fiel es nicht schwer, sie zu duzen. »Bist du schon lange arbeitslos?«, fragte sie sie.
»Eine Arbeit habe ich. Ich lasse mich malen.«
Nach der Stimme zu urteilen, klang es wie ein Scherz, und Ginia sah sie an. »Malen? Wie?«
»Von vorn, im Profil; angezogen, nackt. Modell stehen nennt man das.«
Ginia hörte zu und heuchelte Erstaunen, damit sie weiterredete, aber sie wusste längst, was Amelia da erzählte. Nur hätte sie nie geglaubt, dass Amelia mit ihr darüber sprechen würde, weil sie es nie einer von ihnen gesagt hatte, sondern Rosa das Geheimnis nur durch Portiersfrauen entdeckt hatte.
»Gehst du tatsächlich zu einem Maler?«
»Ich ging«, sagte Amelia. »Aber im Sommer kommt es ihn billiger, im Freien zu malen. Im Winter ist es zu kalt, um nackt zu posieren, und so arbeitet man so gut wie nie.«
»Hast du dich wirklich ausgezogen?« – »Aber ja«, sagte Amelia.
Dann hakte sie sich bei Ginia unter und fügte hinzu: »Es ist eine schöne Arbeit, weil du nichts tust und den Gesprächen zuhörst. Ich ging mal zu einem, der hatte ein wunderbares Atelier, und wenn Leute kamen, wurde Tee getrunken. Da lernt man, sich in der Welt zu bewegen, besser als im Kino.«
»Kamen sie einfach herein, während du Modell standest?«
»Sie klopften vorher an. Das Schönste sind die Frauen. Wusstest du, dass Frauen auch Bilder malen? Sie bezahlen ein Mädchen, um es nackt abzumalen. Warum stellen sie sich nicht vor den Spiegel? Wenn sie einen Mann malten, würde ich es noch verstehen.«
»Vielleicht tun sie das auch«, sagte Ginia.
»Kann gut sein«, sagte Amelia, indem sie am Haustor stehenblieb, und zwinkerte Ginia zu. »Aber manchen Modellen zahlen sie das Doppelte. Na wenn schon, die Welt ist schön, weil sie bunt ist.«
Ginia fragte, warum sie sie nicht einmal besuchen käme, und ging dann allein zurück über den schimmernden Asphalt, den die laue Wärme der Nacht schon fast getrocknet hatte. »So alt, wie sie ist, erzählt sie zu viel von sich«, dachte Ginia zufrieden. »Wenn ich ihr Leben führte, würde ich es schlauer anstellen.«
Ginia war ein wenig enttäuscht, als sie merkte, dass die Tage vergingen und Amelia sie nicht besuchte. Offenbar hatte sie an jenem Abend doch nicht versucht, Freundschaft zu schließen, aber dann – dachte Ginia – heißt das ja, dass sie diese Sachen jedem erzählt und dass sie wirklich dumm ist. Vielleicht hält sie mich für ein Kind, für eine von denen, die alles glauben. Und eines Abends erzählte Ginia den anderen Mädchen, sie habe in einem Geschäft ein Gemälde gesehen, für das Amelia Modell gestanden habe, das begreife man sofort. Alle glaubten es, aber Ginia wollte noch erklären, sie habe sie am Körper erkannt, denn wenn das Modell nackt sei, veränderten die Maler extra das Gesicht. »Glaub bloß nicht, dass die so viel Rücksicht nehmen«, sagte Rosa, und alle lachten Ginia aus wegen ihrer Naivität. »Ich wäre froh, wenn mich ein Maler porträtieren und auch noch dafür bezahlen würde«, sagte Clara. Dann diskutierten sie darüber, ob Amelia schön sei, und Claras Bruder, der mit ihnen Boot gefahren war, sagte, nackt sei er schöner. Alle Mädchen lachten, und Ginia sagte: »Wenn sie nicht gut gebaut wäre, würde kein Maler sie malen«, aber niemand hörte auf sie. An jenem Abend fühlte sie sich gedemütigt und hätte am liebsten vor Wut geweint; aber die Tage vergingen, und als sie – aus der Straßenbahn steigend – Amelia wieder einmal traf, schlenderten sie plaudernd zusammen weiter. Ginia war sogar eleganter als Amelia, die ihren Hut in der Hand trug und beim Lachen die Zähne zeigte.
Am darauffolgenden Nachmittag kam Amelia sie besuchen. In der Hitze erschien sie in der weit geöffneten Tür, und Ginia sah sie aus dem Dunkeln, ohne selbst gesehen zu werden. Sie begrüßten sich freudig, nachdem Ginia die Fensterläden aufgestoßen hatte, und Amelia blickte sich um, während sie sich mit dem Hut Luft zufächelte. »Die Idee mit der offenen Tür gefällt mir«, sagte Amelia. »Du hast Glück. Bei mir zu Haus ginge das nicht, wir wohnen im Erdgeschoss.« Dann warf sie einen Blick in das andere Zimmer, wo Severino schlief, und sagte: »Bei uns ist ständig Rummel. Wir sind zu fünft in zwei Zimmern, die Katzen nicht mitgezählt.« Als es Zeit war, machten sie sich gemeinsam auf den Weg, und Ginia sagte zu ihr: »Komm zu mir, wenn du dein Erdgeschoss satthast; hier hat man seine Ruhe.« Sie wollte Amelia zu verstehen geben, dass sie es nicht sagte, um ihre Familie schlechtzumachen, sondern weil sie sich darüber freute, wie gut sie miteinander auskamen. Und Amelia sagte weder Ja noch Nein, lud sie aber zu einem Kaffee ein, bevor sie die Straßenbahn nahm. Am nächsten Tag ließ sie sich dann nicht blicken und am übernächsten auch nicht. Sie kam vielmehr eines Abends, ohne Hut, setzte sich und bat lachend um eine Zigarette. Ginia spülte gerade die letzten Teller, und Severino rasierte sich. Er hielt Amelia eine Zigarette hin und gab ihr mit nassen Fingern Feuer, und sie scherzten alle drei über die Laternen. Severino musste sich beeilen, fand aber noch Zeit, Ginia zu sagen, sie solle nicht die ganze Nacht aufbleiben. Amelia sah ihm belustigt nach, als er hinausging.
»Willst du nicht mal in ein anderes Tanzlokal?«, fragte sie Ginia. »Diese Jungen sind ja sehr nett, aber zu anhänglich. Genau wie deine Freundinnen.«
Sie gingen ins Zentrum, alle beide ohne Hut, die kühlen Alleen entlang, und als Erstes kauften sie sich ein Eis, betrachteten, während sie es leckten, die Leute und lachten. Mit Amelia war alles einfacher, man amüsierte sich prächtig mit ihr, als wäre nichts wichtig und als könnten an diesem Abend die verschiedensten Dinge geschehen. Ginia wusste, auf Amelia, die zwanzig war, sich frech bewegte und schaute, konnte sie sich verlassen. Amelia hatte nicht einmal Strümpfe angezogen wegen der Hitze; und als sie an einem Tanzlokal vorbeikamen, einem mit gedämpft spielendem Orchester und Lämpchen auf den Tischen, fürchtete Ginia, sie müsse mit ihr hineingehen. Sie war noch nie dort gewesen und hielt den Atem an. Amelia fragte: »Du willst doch nicht etwa hier reingehen?«
»Es ist heiß, und wir sind nicht passend angezogen«, sagte Ginia. »Lass uns spazieren gehen, das ist schöner.«
»Dazu habe ich auch keine Lust«, sagte Amelia, »aber was machen wir sonst? Du willst doch nicht bloß an einer Ecke stehen und über die Leute lachen, die vorbeikommen?«
»Was möchtest du denn?«
»Wenn wir keine Frauen wären, hätten wir ein Auto und wären jetzt längst an einem See beim Baden.«
»Komm, wir bummeln und unterhalten uns ein bisschen«, sagte Ginia.
»Wir könnten auf den Hügel gehen, einen Wein trinken und was singen. Magst du Wein?«
Ginia verneinte, und Amelia betrachtete den Eingang des Lokals. »Aber ein Gläschen trinken wir. Los, komm. Wer sich langweilt, ist selber schuld.« Das Gläschen tranken sie im ersten Café, das sie fanden, und als sie wieder herauskamen, spürte Ginia eine Frische in der Luft, die vorher nicht da gewesen war, und dachte, wie schön es war, dass Likör im Sommer das Blut abkühlte. Unterdessen erklärte Amelia ihr, wer den ganzen Tag nichts tue, habe wenigstens das Recht, sich abends zu zerstreuen, doch manchmal komme der Augenblick, da fürchte man sich als Frau davor, wie die Zeit vergeht, und wisse nicht mehr, ob es sich lohne, so zu rennen. »Geht dir das nicht so?« – »Ich renne nur auf dem Weg zur Arbeit«, sagte Ginia, »ich amüsiere mich so wenig, dass ich keine Zeit habe, darüber nachzudenken.« – »Du bist jung«, sagte Amelia, »mir passiert es, dass ich nicht mal bei der Arbeit stillhalte.«
»Als du Modell gestanden hast, musstest du stillhalten«, sagte Ginia im Gehen.
Amelia begann zu lachen. »Keinesfalls. Die geschicktesten Modelle sind solche, die den Maler zur Verzweiflung treiben. Wenn du dich nicht ab und zu bewegst, vergisst er, dass du für ihn posierst, und behandelt dich wie ein Dienstmädchen. Wer sich zum Schaf macht, wird vom Wolf gefressen.«
Ginia antwortete nur mit einem Lächeln. Doch ein Wort brannte ihr auf der Zunge, noch unwiderstehlicher als der Likör. Da fragte sie Amelia, warum sie sich nicht irgendwo ins Kühle setzten und noch ein Gläschen tranken. »Aber ja«, sagte Amelia. Sie tranken es an der Bar, weil das billiger war.
Nun begann Ginia, sich erhitzt zu fühlen, und sagte im Hinausgehen mühelos zu Amelia: »Ich wollte dich etwas fragen. Ich würde dich gern mal Modell stehen sehen.«
Sie sprachen noch eine Weile darüber, und Amelia lachte, denn das Modell, ob nackt oder bekleidet, interessiere die Männer, nicht ein anderes Mädchen. Das Modell hält einfach still, was gibt es da zu sehen? Ginia sagte, sie wolle zusehen, wie der Maler sie male: Sie habe noch nie jemanden mit Farben hantieren sehen, das müsse schön sein. »Nicht heute oder morgen«, sagte sie, »jetzt bist du arbeitslos. Aber du musst mir versprechen, mich mitzunehmen, wenn du wieder hingehst.« Amelia lachte noch einmal und erklärte ihr, was die Maler angehe, das sei das wenigste: Sie wisse, wo sie wohnten, und könne sie hinbringen. »Aber pass auf, das sind Schufte.« Auch Ginia lachte.
Dann setzten sie sich auf eine Bank, und niemand kam vorbei, denn es war weder früh noch spät. Sie beendeten den Abend in einem Tanzlokal auf dem Hügel.
III.
Von da an kam Amelia sie häufig abholen, um auszugehen oder mit ihr zu plaudern. Sie trat ins Zimmer und redete laut und ließ Severino nicht schlafen. Wenn Rosa am Nachmittag erschien und nach Ginia rief, waren die beiden schon zum Ausgehen bereit. Amelia rauchte ihre Zigarette zu Ende, wenn sie eine hatte, und erteilte Rosa, die ihr die Geschichte mit ihrem Pino erzählt hatte, Ratschläge. Man merkte, dass sie sich ungern in ihrer Portiersloge aufhielt, und da sie den ganzen Tag nichts zu tun hatte, begnügte sie sich mit der Gesellschaft der Mädchen. Amelia scherzte auch mit Rosa, über die sie lästerten, wenn sie allein waren, tat, als glaube sie ihre Geschichten nicht, und lachte ihr ins Gesicht.
Ginia fasste Zutrauen zu Amelia, als ihr klar wurde, dass diese trotz aller Lebhaftigkeit ein armes Ding war. Ginia erkannte das nun, wenn sie nur ihre Augen betrachtete oder ihren schlecht geschminkten Mund. Amelia ging ohne Strümpfe, weil sie gar keine hatte; sie trug immer dieses schöne Kleid, weil sie kein anderes besaß. Ginia kam zu diesem Schluss, als sie einmal merkte, dass auch sie selbst sich verrückter fühlte, wenn sie ohne Hut ausging. Wer sie nervte, war Rosa, die das sofort durchschaut hatte. »Lohnt es sich etwa, so ein Leben zu führen«, sagte Rosa, »wenn man sich dann ins Bett legen muss, weil das Kleid einen Riss hat?« Mehrmals fragte Ginia sie, warum sie nicht wieder Modell stand, und Amelia sagte, um Arbeit zu finden, dürfe man nicht arbeitslos sein.
Es wäre schön gewesen, den ganzen Tag nichts zu tun und dann zusammen durch die Stadt zu schlendern, wenn es kühler wurde, aber so elegant zu sein, dass, während sie die Schaufenster betrachteten, die Leute sie betrachteten. »So frei zu sein, wie ich es bin, macht mich wütend«, sagte Amelia. Ginia hätte viel darum gegeben, Amelia mit Begeisterung über viele Dinge sprechen zu hören, die ihr gefielen, denn wahre Vertrautheit ist, zu wissen, was der andere sich wünscht, und wenn einem die gleichen Dinge gefallen, fühlt man sich weniger befangen. Doch Ginia war nicht sicher, ob Amelia, wenn sie gegen Abend unter den Arkaden bummelten, das ansah, was sie selbst ansah. Man konnte nie darauf schwören, dass ihr dieser Hut oder jener Stoff gefiel, und musste immer darauf gefasst sein, dass sie lachte, wie sie es mit Rosa machte. Da sie den ganzen Tag allein war, sagte sie nie, was sie gern Schönes tun würde, und wenn sie etwas sagte, meinte sie es nicht ernst. »Ist dir, wenn du auf jemanden wartest, noch nie aufgefallen, wie viele Schweinsgesichter und Hühnerbeine vorbeikommen? Ein herrlicher Zeitvertreib.« Vielleicht scherzte Amelia, aber vielleicht stimmte es, dass sie die Viertelstunden so verbrachte, und Ginia dachte jedenfalls, dass sie recht dumm gewesen war, an jenem Abend durchblicken zu lassen, wie gern sie einmal beim Malen zusähe.
Wenn sie jetzt ausgingen, war es Amelia, die den einen oder anderen Ort auswählte, und Ginia ließ sich willig führen. Als sie in das Tanzlokal jenes Abends zurückkehrten, erkannte Ginia, die sich damals so gut amüsiert hatte, weder die Lampen noch das Orchester wieder, nur die Kühle, die von den offenen Balkonen hereinwehte, gefiel ihr. Das bedeutete aber, dass sie sich nicht gut genug angezogen fühlte, um zu den Tischchen hinunterzugehen, doch Amelia hatte begonnen, sich mit einem jungen Mann zu unterhalten, der sie duzte, und als die Musik verstummte, tauchte noch einer auf, der ihnen zuwinkte, und Amelia wandte sich um und fragte: »Meint der dich?« Da freute sich Ginia, dass jemand sie wiedererkannt hatte, aber der junge Mann war verschwunden, und ein anderer, unsympathischer, der mit ihr getanzt hatte, ging rasch vorbei, ohne sie zu sehen. Ginia kam es vor, als hätten sie am ersten Abend nie an einem Tisch gesessen, außer um Atem zu schöpfen, jetzt dagegen warteten sie eine ganze Weile unter dem Fenster, und Amelia, die sich als Erste setzte, sagte laut: »Das ist auch ein Vergnügen.« Gewiss, die anderen Mädchen im Saal waren nicht besser gekleidet als Amelia, und viele trugen keine Strümpfe, aber Ginia sah vor allem die weißen Jacken der Kellner und dachte an die vielen Autos, die draußen standen. Dann begriff sie, dass es dumm von ihr war zu hoffen, da drinnen sei irgendwo Amelias Maler.
In jenem Jahr war es so heiß, dass man jeden Abend ausgehen musste, und es schien Ginia, als habe sie nie zuvor verstanden, was Sommer eigentlich bedeutete, so schön war es, jede Nacht auszugehen und durch die Alleen zu schlendern. Manchmal dachte sie, jener Sommer würde niemals enden, und zugleich, dass man sich beeilen musste, ihn zu genießen, denn wenn er zu Ende wäre, würde bestimmt etwas geschehen. Deshalb ging sie nicht mehr mit Rosa in das alte Lokal oder in ihr Kino, sondern machte sich manchmal allein auf den Weg und lief schnell in ein Kino im Zentrum. Was Amelia konnte, konnte sie auch. Amelia kam eines Abends und sagte, während sie das Haus verließen: »Gestern hab ich Arbeit gefunden.«
Ginia war nicht erstaunt. Sie hatte es erwartet. Ruhig fragte sie, ob sie sofort anfange. »Schon angefangen, heute Morgen«, sagte Amelia. »Zwei Stunden.« – »Jetzt bist du sicher froh«, sagte Ginia.
Dann fragte sie, um was für ein Bild es sich handle. »Kein Bild. Er macht Skizzen von mir. Er zeichnet mein Gesicht. Ich rede, und ab und zu wirft er ein Profil hin. Es ist keine Arbeit für länger.« – »Also stehst du gar nicht Modell?«, fragte Ginia. »Was glaubst du denn«, sagte Amelia, »dass Modellstehen nur heißt, sich auszuziehen und nackt dazustehen?«
»Gehst du morgen wieder hin?«, fragte Ginia.
Amelia ging am nächsten Tag wieder hin und dann noch mehrere Male. Am Abend danach erzählte sie lachend von dem Maler, der nie stillstand und der sie fragte, ob sie je jemand so gemalt habe, hin und her laufend, wie er es tat. »Heute Morgen hat er eine Aktzeichnung von mir gemacht. Er weiß genau, wie es geht. Zuerst tastet er sich langsam heran. Aber dann bringt er dich mit vier Strichen aufs Papier und braucht dich nicht mehr.« Ginia fragte sie, wie er sei, und Amelia sagte: »Ein kleines Männchen.« – »Wie hast du ihn gefunden?« – »Durch Zufall. – Komm mich morgen abholen«, sagte Amelia. Sie verabredeten, am Samstagnachmittag gemeinsam hinzugehen.
Den ganzen Weg über, in der Sonne, brachte Amelia sie an jenem Nachmittag zum Lachen. Über eine Wendeltreppe gelangten sie in einen großen halbdunklen Raum, in den nur ganz hinten durch einen Spalt zwischen den Vorhängen ein wenig kühles Licht fiel. Ginia war mit klopfendem Herzen auf den letzten Stufen stehengeblieben. Amelia rief laut »Guten Tag« und ging im Halbdunkel bis in die Zimmermitte, und aus den Vorhängen trat ein Mann – fett, mit grauem Bärtchen –, der mit den Händen wedelnd sagte: »Nichts zu machen, Mädchen. Heute muss ich weg.« Er trug ein langes, helles Hemd, das sich als schmutzig gelb herausstellte, als er sich umdrehte und den Vorhang ein wenig beiseite schob, um Licht hereinzulassen. »Heute wird nicht gearbeitet, Mädchen, heute muss man an die Luft.«
Ginia hatte sich nicht von der Treppenstufe gerührt. Im Gegenlicht sah sie von weitem Amelias Beine. Leise sagte sie, mehr zu sich selbst: »Amelia, lass uns gehen.«
»Wäre das die kleine Freundin, die mich kennenlernen möchte? Sie ist ja noch ein Kind. Lass dich mal im Licht anschauen.«
Unwillig stieg Ginia die letzte Treppenstufe hinauf, während sie die neugierigen grauen Augen auf sich ruhen fühlte und nicht wusste, ob Alter oder Verschlagenheit aus ihnen sprach. Gleichzeitig hörte sie Amelias Stimme – schneidend, verärgert –, die sagte: »Aber wir hatten doch einen Termin.«
»Was willst du machen?«, sagte der Maler. »Was willst du machen? Ihr seid doch auch müde. Zum Arbeiten braucht man Ruhe. Bist du nicht froh, wenn ich dir freigebe?«
Daraufhin ging Amelia zu einem Stuhl und setzte sich in den Schatten der Vorhänge, und Ginia schien es, als stünde sie schon wer weiß wie lange da, ohne zu wissen, wie sie auf die Blicke der beiden reagieren sollte, die einander und dann wieder sie musterten. Ihr war, als scherzte der Kerl, aber nicht mit ihnen; er redete noch weiter mit Amelia, sprach abgehackt, sagte ständig »Was willst du machen«. Dann sprang er unvermutet zurück, so klein und dick, wie er war, und schob die Vorhänge weiter auseinander. In dem großen leeren Raum roch es nach frischem Kalk und nach Firnis.
»Wir sind verschwitzt«, sagte Amelia. »Lassen Sie uns wenigstens im Kühlen verschnaufen. Nicht wahr, Ginia?« Als sie das sagte, drehte sich der Maler mit dem Bärtchen wieder um und öffnete die großen Scheiben, die auf den Himmel hinausgingen. Mit übergeschlagenen Beinen sah Amelia ihm zu und lachte. Am Fenster stand eine Staffelei, darauf eine Leinwand, die mit hingeworfenen und wieder abgekratzten Farbflecken bedeckt war. »Wenn man nicht jetzt arbeitet, solange Licht ist, wann wollen Sie dann arbeiten?«, fragte Amelia. »Ich wette, Sie gehen mich mit einem anderen Modell betrügen.« – »Mit der ganzen Welt betrüge ich dich«, rief der Maler gebückt. »Glaubst du, du bist mehr wert als eine Pflanze oder ein Pferd? Ich arbeite auch, wenn ich spazieren gehe, was glaubst denn du?« Und dabei stöberte er in einem Kasten unter der Staffelei und warf Zeichenblätter, Schachteln und Pinsel durcheinander. Amelia sprang vom Stuhl auf, nahm den Hut ab und zwinkerte Ginia zu. »Warum machen Sie nicht eine Skizze von meiner Freundin?«, schlug sie lachend vor. »Sie hat noch nie für jemanden Modell gestanden.«
Der Maler hatte sich umgewandt. »Genau das tue ich«, sagte er. »Ihr Ausdruck interessiert mich.«
Einen Bleistift in der Hand, begann er, mit geneigtem Kopf, sich den Bart streichend, in einem gewissen Abstand um Ginia herumzugehen, und starrte sie an wie ein Kater. Ginia, in der Zimmermitte, wagte nicht, sich zu rühren. Dann forderte er sie auf, ins Licht zu treten, und ohne sie aus den Augen zu lassen, lehnte er ein Blatt an die Leinwand auf der Staffelei und begann zu zeichnen. Am Himmel sah man eine gelbe Wolke und Dächer; mit klopfendem Herzen fixierte Ginia die Wolke und hörte Amelia irgendwo im Raum etwas sagen und hin und her gehen und schnaufen, aber sie blickte sie nicht an.
Als Amelia sie rief, damit sie sich die Zeichnung ansähe, musste Ginia die Augen schließen, um sich an das Halbdunkel zu gewöhnen. Dann beugte sie sich langsam über das Blatt und erkannte ihren Hut, doch das Gesicht schien ihr das einer anderen, ein schlafendes Gesicht, ausdruckslos, mit geöffnetem Mund, als spräche es im Schlaf. »Es ist beunruhigend«, sagte Barbetta, »hat dich wirklich noch nie jemand gezeichnet?« Er bat sie, den Hut abnehmen und sagte, sie solle sich setzen und mit Amelia reden. Im Sitzen sahen sie sich an und hatten Lust zu lachen, während der Maler weitere Blätter füllte. Amelia gestikulierte und sagte zu ihr, sie solle nicht an die Pose denken.
»Beunruhigend«, sagte Barbetta noch einmal und betrachtete sie von der Seite, »man möchte meinen, das jungfräuliche Profil hat keine Form.« Ginia fragte Amelia, ob sie nicht Modell säße, und Amelia sagte laut: »Heut hat er dich entdeckt. Da lässt er bestimmt nicht locker.« Während sie so redeten, fragte Ginia, ob sie Amelias Porträts der vergangenen Tage sehen dürfe. Da erhob sich Amelia und holte eine Mappe aus dem hinteren Teil des Raums. Sie legte sie ihr geöffnet auf die Knie und sagte: »Hier.«
Ginia wendete mehrere Blätter um, und beim vierten oder fünften war sie schweißgebadet. Sie wagte nichts zu sagen, weil sie die grauen Augen dieses Mannes auf sich fühlte. Auch Amelia sah sie wartend an und fragte schließlich: »Gefallen sie dir?«
Ginia hob das Gesicht und versuchte zu lächeln. »Ich erkenne dich nicht«, sagte sie. Dann blätterte sie alle nacheinander noch einmal durch. Danach war sie ruhiger. Schließlich saß Amelia angezogen vor ihr und lachte.
Töricht fragte sie: »Hat er die gemacht?« Amelia, die nicht begriff, erwiderte laut: »Ich ganz bestimmt nicht.«
Als Barbetta fertig war, wäre Ginia gern wieder so geblendet gewesen wie vorher, um die Augen zu schließen und zu warten. Doch Amelia rief, sie solle kommen, und vor dem großen Blatt war auch Ginia erstaunt. Es zeigte viele Male ihren Kopf, willkürlich aufs Blatt geworfen, manchmal schief, manchmal mit einer Grimasse, die sie nie gemacht hatte, aber die Haare, die Wangen, die Nasenflügel waren echt, waren ihre. Sie sah Barbetta an, der lachte, und es schien ihr unmöglich, dass dies die gleichen grauen Augen sein sollten wie zuvor.
Dann hätte sie Amelia am liebsten verprügelt, denn diese begann zu sticheln und darauf zu beharren, dass eine Stunde eine Stunde sei und dass Ginia für ihren Lebensunterhalt arbeite. Sie erwiderte, sie sei ganz zufällig mitgekommen und wolle ihr nicht ins Handwerk pfuschen. Barbetta lachte in seinen Bart und sagte, er müsse gehen. »Kommt, ich spendiere euch ein Eis. Aber dann verschwinde ich.«
IV.
Am nächsten Morgen gingen sie wieder zusammen hin, denn diesmal sollte Amelia Modell stehen. »Wehe«, sagte Amelia, »wenn du mir noch einmal den Platz wegnimmst. Dieser Halunke weiß, dass du dich mit einem Eis abspeisen lässt, und nutzt es aus, dass du noch Jungfrau bist.« Ginia war nicht mehr so zufrieden wie vorher, und gleich nach dem Aufwachen hatte sie an ihre Porträts gedacht, die noch zwischen den Aktzeichnungen von Amelia lagen, und an das schreckliche Herzklopfen, das sie bekommen hatte. Sie hegte noch die winzige Hoffnung, sie könne sich ihre Gesichter schenken lassen, nicht, weil sie sie unbedingt wollte, sondern damit sie nicht der Neugier jedes x-beliebigen ausgesetzt blieben. Sie konnte es einfach nicht fassen, dass ausgerechnet Barbetta, dieser fette alte Papi, Amelias Beine, Rücken, Bauch und Brustwarzen gezeichnet, daran radiert und herumgepfuscht hatte. Sie wagte ihr nicht ins Gesicht zu sehen. Diese grauen Augen und dieser Bleistift hatten sie fixiert, vermessen und erforscht, schamloser als ein Spiegel, und sie hatte stillgehalten oder womöglich herumgealbert und geplappert.
»Störe ich euch heute Morgen nicht?«, fragte Ginia sie, während sie in das Haustor einbogen.
»Hör zu«, antwortete Amelia, »wolltest du mich Modell stehen sehen, ja oder nein? Das nächste Mal werde ich aufpassen, mich nicht mehr mit höheren Töchtern einzulassen.«
Im Atelier waren alle Fenster aufgerissen und die Vorhänge geöffnet, und während sie auf Barbetta warteten, kam die alte Dienstmagd die Treppe herauf, um ein Auge auf sie zu haben. Ginia fragte sich, wo sich Amelia wohl zum Posieren hinstellen würde, doch Amelia stritt schon mit der Alten und ließ sie alle Fenster schließen, weil die Morgenluft den Raum auskühlte. Die Frau sprach nicht, sondern brummte und hatte ein so muffiges und behaartes Gesicht, dass Amelia sie ungeniert auslachte.
Schließlich kam Barbetta, zog sich den Kittel über und legte los, die Staffelei wurde nach hinten getragen, und die Palette kam zum Vorschein. Dort hinten im Atelier stand ein Bettsofa, und sie zogen alle Vorhänge zu bis auf den letzten, damit alles Licht auf diese Ecke fiel. Ginia fühlte sich in diesem Durcheinander überflüssig, und ihr schien, als sehe auch die Alte sie scheel an.
Als die Alte ging, zog sich Amelia neben dem Sofa aus, und Ginia beobachtete, wie Barbettas große Hand, einen Kohlestift zwischen den Fingern haltend, an der Staffelei ein weißliches Papier grundierte. Ohne sie anzusehen, sagte Barbetta zu ihr, sie solle sich setzen, und man hörte auch Amelias Stimme. Ginia blickte aus dem Fenster über die Dächer, als säße sie erneut Modell, und dachte, dass sie recht dumm war. Sie überwand sich und drehte sich um.
Ihr erster Gedanke war, Amelia müsse frieren und Barbetta sehe sie kaum an, und der wahre Störenfried sei allein sie selbst, weil sie nur aus Neugier da war. Amelia – braun, wie sie war – wirkte schmutzig, und es war peinlich, sie so zu sehen. Sie saß auf dem Sofa, die Arme auf einer Stuhllehne und das Gesicht verborgen, und zeigte deutlich das Bein von der Hüfte bis zur Ferse und die ganze Seite und die Achsel.
Nach kurzer Zeit langweilte Ginia sich. Sie beobachtete Barbetta, wie er wischte und wieder strichelte, betrachtete seine konzentrierte Miene, tauschte ein Lächeln mit Amelia, aber sie langweilte sich. Sie bekam wieder Herzklopfen, als Amelia zum ersten Mal aufstand, sich dehnte und das Höschen aufhob, das vom Sofa gefallen war, aber es war ein dummes Herzklopfen, das sie auch gespürt hätte, wenn sie allein gewesen wären, Herzklopfen, weil sie erkannte, wir Frauen sind alle gleich beschaffen, und wenn irgendwer Amelia nackt sah, war es, als sähe er auch sie, Ginia. Sie konnte nicht mehr stillsitzen.
Mit auf die Arme gelegtem Kopf sagte Amelia zu ihr: »Ciao, Ginia.« Das genügte, um sie zu erfreuen und zu beruhigen. Einen Augenblick davor hatte sie bemerkt, dass Amelias Fesseln gerötet waren, und sie überlegte, ob auch sie, hätte sie sich ausziehen müssen, solche Striemen gehabt hätte. »Meine Haut ist noch jünger«, sagte sie sich. Dann fragte sie laut: »Hat er dich je in Farbe gemalt?«
Barbetta antwortete ihr: »Mit Farben macht man keine Skizzen. Sie kommen mit der Sonne zum Fenster herein. Hier drin gibt es keine Farben.« – »Na klar«, sagte Amelia, »er ist zu geizig. Farben sind teuer.« – »Du hast ja keine Ahnung«, schrie der Alte, »die Farbe muss man achten, das ist es, und du weißt gar nicht, was das bedeutet, denn abgesehen von deinem Make-up bist du völlig farblos. Da ist an dieser kleinen Blonden schon mehr dran.« Amelia zuckte die Schultern und hob nicht einmal den Kopf.
Dann hörte man von irgendwo jenseits der Dächer eine Sirene, und Ginia begann, hin und her zu gehen, und fand auf dem Fensterbrett die Skizzen ihres Gesichts, wagte aber nicht, darum zu bitten. Als sie sie durchblätterte, sah sie auch die Zeichnungen von Amelia wieder und verglich sie im Stillen und fragte sich, ob Amelia tatsächlich diese Posen eingenommen hatte, die teilweise gymnastischen Übungen glichen. War es denn möglich, dass es einem alten Mann wie Barbetta noch Spaß machte, Mädchen abzuzeichnen und zu studieren, wie sie gebaut waren? Er war doch recht sonderbar, dachte sie.
Sie verließen das Atelier nach zwölf, und sie genossen es, wieder unter Leuten zu sein und völlig angezogen umherzugehen und die schönen Farben auf der Straße zu sehen, die, man begriff zwar nicht, wie, aber es stimmte, von der Sonne kamen, da es sie nachts nicht gab. Auch Amelias Unmut war verflogen, und sie bezahlte ihr einen Aperitif und redete nicht mehr von Malern.
Allein auf ihrem Sofa, dachte Ginia an diesem und mehreren anderen Nachmittagen noch lange darüber nach. Im Dunkeln sah sie Amelias schwarzen Bauch wieder vor sich und ihr gleichgültiges Gesicht und die hängenden Brüste. Gab es an einer bekleideten Frau nicht doch mehr zu malen? Wenn die Maler sie nackt malen wollten, mussten sie andere Ziele verfolgen. Warum malten sie keine Männer? Sogar Amelia wurde eine andere, wenn sie sich so bloßstellte. Ginia weinte beinahe.
Doch zu Amelia sagte sie nichts, es freute sie nur, dass diese jetzt etwas verdiente und lieber mit ins Kino ging, wenn sie sich trafen. Dann kaufte Amelia sich Strümpfe und frisierte sich besser, und Ginia ging wieder richtig gern mit ihr aus, weil Amelia gut ankam und sich viele nach ihnen umdrehten. So ging der Sommer zu Ende, und eines Abends sagte Amelia: »Dein Barbetta geht aufs Land, um seine Farben zu suchen und zur Weinlese. Er fing an, mich zu nerven.«
Gerade an diesem Abend hatte Amelia eine neue Handtasche, und Ginia fragte: »Hat er dir ein Abschiedsgeschenk gemacht?«
»Der?«, sagte Amelia. »Dass ich nicht lache! Der wollte, dass du wiederkommst, dir hätte er nichts bezahlen müssen.«
Dann stritten sie sich, weil Amelia es ihr nie gesagt hatte, und gingen beleidigt auseinander. »Sie hat einen Liebhaber gefunden«, dachte Ginia, allein auf dem Heimweg, »sie hat einen Liebhaber gefunden, der ihr Geschenke macht.« Sie beschloss, sich erst dann mit ihr zu versöhnen, wenn Amelia kommen und sie darum bitten würde.
Lustlos, um sich nicht zu langweilen, versuchte Ginia, die alten Freundschaften wieder aufzuwärmen. Schließlich würde sie im nächsten Sommer siebzehn Jahre alt sein, und ihr schien, sie sei nun längst so schlau wie Amelia. Umso mehr, als sie sie nicht mehr sah. An diesen schon kühlen Abenden versuchte sie, Rosa gegenüber die Amelia zu spielen. Sie lachte ihr oft ins Gesicht und ging plaudernd mit ihr spazieren. Sie redete noch einmal mit ihr über Pino. Aber sie zum Tanzen auf den Hügel zu führen, wagte sie nicht.
Amelia hatte bestimmt jemanden, denn niemand bekam sie mehr zu Gesicht. »Solange eine Frau was zum Anziehen hat«, dachte Ginia, »macht sie eine gute Figur. Man muss aufpassen, sich nicht nackt sehen zu lassen.« Doch über solche Dinge konnte man weder mit Rosa oder Clara noch mit deren Brüdern sprechen, die sofort schlecht von ihr gedacht oder versucht hätten, sie anzufassen, und das wollte Ginia nicht, weil sie begriffen hatte, dass es etwas Besseres auf der Welt gab als einen Ferruccio oder einen Pino. An den Abenden, die sie mit ihnen verbrachte, tanzten und scherzten sie – unterhielten sich auch –, aber Ginia wusste, dass es die gleiche Fröhlichkeit war wie an den Sonntagen, an denen sie Boot gefahren waren: Kindereien, ohne Folgen, eine Auswirkung der Sonne und des Singens, kaum sah man einen mit dem Handtuch um die Hüften, der eine Frau nachmachte, schon lachte man los. Jetzt dagegen bestanden die Sonntage und Abende aus Langeweile, da sich Ginia allein zu nichts mehr entschließen konnte und sich von den anderen Mädchen mitziehen ließ. Nur in der Schneiderei hatte sie manchmal Spaß, wenn die Signora sie rief, um einer Kundin mit Stecknadeln das Kleid abzustecken. Es war zum Lachen, wenn man bestimmte Geschichten hörte, die manche dummen Kundinnen erzählten, aber noch lustiger war es, wenn die Signora so tat, als glaube sie daran, und ganz ernst blieb, während die Spiegel ihr schelmisches Gesicht zeigten. Einmal kam eine Blonde, die behauptete, sie hätte ihr Auto unten vor der Tür, doch wenn das wahr gewesen wäre, dachte Ginia, hätte sie eine luxuriösere Schneiderei aufgesucht. Sie war jung und groß und trug keinen Ehering. Aber schön, fand Ginia, schön und schlank, auch als sie in Höschen und Büstenhalter und sonst nichts dastand. Wenn die Modell gestanden hätte, das wäre wirklich ein schönes Bild geworden, und vielleicht war sie tatsächlich ein Modell, denn sie spazierte in der gleichen Haltung wie Amelia vor den Spiegeln auf und ab. Tage später sah Ginia ihre Rechnung, aber es stand nur der Nachname darauf, und mehr erfuhr sie nicht. Für sie blieb die Blonde ein Modell.
Eines Abends ließ Ginia sich von einem Freund von Severino einladen, der zu ihnen nach Hause kam, um ihr eine Lampe zu bringen, und ging am nächsten Tag in seinem Geschäft vorbei. Er war ein junger Mann wie Severino und flößte ihr keine Scheu ein, denn er trug immer einen Arbeitsanzug, und ein paar Jahre zuvor hatte er sie noch an den Handgelenken gepackt und gefragt, ob sie einen elektrischen Schlag bekommen wolle. Jetzt betrachtete er sie mit der Zungenspitze zwischen den Zähnen. Ginia ging hin, weil man von dem Geschäft aus Amelias Haustor sehen konnte, aber dieser Massimo hatte bestimmt keine Ahnung, warum sie eine ganze Weile mit ihm plauderte und lachte und gleich am nächsten Tag wiederkam.
Sie betrachteten die rosafarbenen und himmelblauen Lampen, und Ginia alberte herum. Durch das Schaufenster sah man Leute vorbeigehen, und sie fragte, ob es stimme, dass Amelia weiß gekleidet herumlief. »Wer weiß«, sagte Massimo, »ihr seid so viele, ihr Mädchen. Severino wird es wissen.« – »Oh, warum Severino?« – »Severino«, antwortete Massimo, »mag kräftige Frauen. Es ist doch die, die ohne Strümpfe geht?« – »Hat er dir das gesagt?«, fragte Ginia. »Du bist seine Schwester und weißt es nicht?«, erwiderte Massimo lachend. »Lass es dir von Amelia erzählen. Kam sie nicht immer zu dir nach Hause?«
Daran hatte Ginia nie gedacht. Der Gedanke, dass Amelia Severino gefallen hatte und dass sie es sich gesagt hatten und sich womöglich trafen, verdarb ihr den Tag. Wenn das stimmte, war Amelias ganze Freundschaft nur eine Finte gewesen. »Ich bin wirklich ein Kindskopf«, dachte Ginia, und um ihre Wut zu dämpfen, erinnerte sie sich daran, dass es sie abgestoßen hatte, Amelia nackt zu sehen. »Aber stimmt es überhaupt?«, dachte sie. Severino in ein Mädchen verliebt, das konnte sie sich nicht vorstellen, sie war sich vielmehr sicher, hätte er die arme Amelia damals Modell stehen sehen, hätte sie ihm nicht mehr gefallen. »Oder vielleicht doch?« – »Aber warum sind wir nackt?«, dachte sie verzweifelt.
Gegen Abend war sie schon wieder ruhiger und überzeugt, dass Massimo nur so dahergeredet hatte. Während sie mit Severino aß, betrachtete sie seine Hände mit den kaputten Fingernägeln und begriff, dass Amelia ganz anderes gewohnt war. Dann blieb sie im gedämpften Licht allein und dachte an die schönen Abende im August, als Amelia sie abholen kam, da hörte sie hinter der Tür ihre Stimme.
V.
»Ich wollte dich besuchen«, sagte Amelia.
Ginia antwortete nicht sofort.
»Du bist immer noch böse«, sagte Amelia. »Lass es gut sein. Ist dein Bruder nicht da?«
»Er ist gerade weggegangen.«
Amelia trug das alte Kleid, hatte aber eine schöne Frisur mit Korallen. Sie setzte sich aufs Sofa und fragte sofort, ob Ginia ausgehen wolle. Ihre Stimme klang wie früher, aber tiefer, als sei sie erkältet.
»Willst du zu mir oder zu Severino?«, fragte Ginia.
»O diese Leute. Lass sie doch reden. Ich will mich nur vergnügen, wenn du auch mitkommst.«
Daraufhin wechselte Ginia die Strümpfe, und sie eilten die Treppe hinunter, und Amelia ließ sich erzählen, was im Lauf des Monats geschehen war. »Und was hast du gemacht?«, fragte Ginia. »Was soll ich schon gemacht haben«, sagte Amelia und begann wieder zu lachen, »nichts habe ich gemacht. Heute Abend habe ich mir gesagt: Gehen wir mal nachsehen, ob Ginia immer noch an Barbetta denkt.« Sonst war nichts aus ihr herauszubringen, aber Ginia gab sich damit zufrieden. »Trinken wir ein Gläschen?«, schlug sie vor.
Während sie tranken, fragte Amelia, warum Ginia sie nie besucht hatte. »Ich wusste ja nicht, wo du bist.« – »Na, wo schon. Im Café, den ganzen Tag.« – »Das hast du nie gesagt.«
Am nächsten Tag ging Ginia sie im Café suchen. Es war ein neues Café unter den Arkaden, und Ginia blickte sich um und hielt nach Amelia Ausschau. Es war Amelia, die sie rief, laut, als wäre sie hier zu Hause. Ginia sah, dass sie einen schönen grauen Mantel und einen Hut mit Schleier trug, in dem sie kaum wiederzuerkennen war. Mit übergeschlagenen Beinen saß sie da, die Faust unter dem Kinn, als säße sie Modell. »Du bist ja wirklich gekommen«, sagte sie lachend.
»Wartest du auf jemanden?«, fragte Ginia.
»Ich warte immer«, sagte Amelia und machte ihr neben sich Platz. »Das ist meine Arbeit. Um sich vor einem Maler ausziehen zu dürfen, muss man Schlange stehen.«
Amelia hatte eine Zeitung und ein Päckchen Zigaretten vor sich auf dem Tisch liegen. Also verdiente sie etwas. »Schön, dieser Hut, aber er macht dich alt«, sagte Ginia und blickte ihr in die Augen. »Ich bin alt«, sagte Amelia. »Gefällt er dir nicht?«
Amelia lehnte sich an den Spiegel, als säße sie auf einem Sofa. Sie schaute nach vorn, in den Spiegel gegenüber, in dem Ginia auch sich selbst sah, aber kleiner. Sie wirkten wie Mutter und Tochter. »Und du bist immer hier?«, fragte sie. »Kommen die Maler hierher?«
»Sie kommen, wann sie Lust haben. Heute hat sich noch keiner blicken lassen.«
Der Kronleuchter brannte, und viele Leute gingen draußen am Fenster vorbei. Der Raum war voller Rauch, aber so hell und ruhig, dass es schien, als kämen die Geräusche und Stimmen von weit her. Ginia beobachtete zwei Mädchen in einer Ecke, die sich angeregt unterhielten und mit dem Kellner sprachen. »Sind das Modelle?«, fragte sie.
»Ich kenne sie nicht«, sagte Amelia. »Nimmst du einen Kaffee oder einen Aperitif?«
Ginia hatte immer geglaubt, ins Café ginge man, um sich mit einem Mann zu treffen, als Paar, und sie konnte es kaum fassen, dass Amelia die Nachmittage allein dort verbrachte, fand es aber so schön, auf dem Heimweg von der Schneiderei durch die Bogengänge zu schlendern und dabei ein Ziel zu haben, dass sie am nächsten Tag gleich wieder hinging. Wäre sie nur ganz sicher gewesen, dass Amelia sie gerne sah, hätte sie sich prächtig amüsiert. Diesmal bemerkte Amelia sie durch die Scheibe, machte ihr ein Zeichen und kam heraus. Gemeinsam stiegen sie in die Straßenbahn.
An diesem Abend redete Amelia nicht viel. »Es gibt doch richtige Flegel«, sagte sie nur. »Hast du auf jemanden gewartet?«, fragte Ginia.
Bevor sie sich trennten, plauderten sie noch ein wenig und verabredeten sich für den nächsten Tag, sodass Ginia zu der Überzeugung kam, Amelia sehe sie gerne, und wenn sie etwas in die falsche Kehle bekommen hatte, gab es andere Gründe dafür, vielleicht irgendeine hässliche Begegnung.
»Wie geht das eigentlich? Kommt ein Maler zu dir und fragt, ob du ihm Modell stehen willst?«, fragte sie lachend.
»Es gibt auch solche, die gar nichts sagen«, erklärte Amelia ihr. »Die wollen keine Modelle.«
»Und was malen sie dann?«, sagte Ginia.
»Weißt du es? Da ist einer, der erzählt, dass er so malt, wie wir Lippenstift benutzen. ›Was malst du denn, wenn du Lippenstift benutzt? Genau so male ich.‹«
»Aber mit Lippenstift malt man sich die Lippen an.«
»Und er malt die Leinwand an. Ciao, Ginia.«
Machte Amelia solche Scherze, ohne zu lachen, fürchtete Ginia, es werde etwas geschehen, war enttäuscht und fühlte sich allein, während sie heimging. Zum Glück musste sie zu Hause schnellstens die Pasta für Severino kochen, und nach dem Essen sah alles schon anders aus, weil es Nacht wurde und Zeit, allein oder mit Rosa auszugehen. Manchmal dachte sie: »Was für ein Leben führe ich eigentlich. Keine Sekunde kann ich verschnaufen.« Aber dieses Leben gefiel ihr, denn nur so war es schön, nachmittags oder auch abends, wenn sie im Café bei Amelia vorbeiging, einen Augenblick Frieden zu finden und sich auszuruhen. Hätte sie Amelia nicht gehabt, wäre sie freier gewesen, aber wozu, jetzt, da das Wetter sich verschlechterte und es keinen Spaß mehr machte, die Straße zu überqueren? Falls in diesem Winter etwas geschehen sollte – Ginia spürte es –, so würde Amelia den Anstoß geben und nicht Dummköpfe wie Rosa oder Clara.
Im Café begann sie Bekanntschaften zu machen. Es gab einen Herrn, der Barbetta ähnelte und Amelia zuwinkte, wenn sie gingen. Er siezte sie, und Amelia sagte zu Ginia, er sei kein Maler. Ein hochgewachsener junger Mann, der vor den Arkaden mit dem Auto anhielt und eine sehr elegante Signora dabeihatte, kam manchmal an den Tresen, und Amelia kannte ihn nicht, sagte aber, er sei kein Maler. »So viele sind es nicht, was glaubst du denn«, sagte sie zu Ginia. »Wer wirklich arbeitet, geht nicht ins Café.« Alles in allem kannte Amelia die Kellner besser als die Gäste, aber Ginia, die sich durchaus amüsierte, wenn sie sie scherzen hörte, achtete darauf, niemandem zu viele Vertraulichkeiten zu gestatten. Einer, der oft bei Amelia saß und Ginia das erste Mal gegrüßt hatte, ohne sie überhaupt anzuschauen, war ein behaarter junger Mann mit weißer Krawatte und tiefschwarzen Augen, der Rodrigues hieß. In der Tat wirkte er nicht wie ein Italiener und sprach kehlig, und Amelia behandelte ihn wie einen Jungen und sagte zu ihm, wenn er diese Lira gespart hätte, anstatt sie im Café auszugeben, hätte er in zehn Tagen ein Modell bezahlen können. Ginia hörte belustigt zu, aber der junge Mann mit der unsicheren Stimme fing wieder an, Amelia bald wie eine schöne Frau, bald wie ein launisches Kind zu behandeln. Sie lachte, aber manchmal wurde sie ärgerlich und sagte, er solle verschwinden. Dann wechselte Rodrigues den Tisch, zog einen Bleistift heraus und begann zu schreiben, während er sie beide schief ansah. »Achte nicht auf ihn«, sagte Amelia, »er würde es genießen.« Nach und nach gewöhnte sich auch Ginia an, ihn links liegen zu lassen.
Eines Abends gingen sie ohne ein bestimmtes Ziel zusammen aus. Sie bummelten ein wenig, dann begann es zu regnen, und sie suchten Schutz in einem Hauseingang. Es war kalt, vor allem wenn man mit nassen Strümpfen herumstand. Amelia hatte gesagt: »Wenn Guido zu Hause ist, könnten wir zu ihm gehen, willst du?« – »Wer ist Guido?« Amelia hatte die Nase vorgestreckt und den Hals verrenkt, um zu den Fenstern am Haus gegenüber hinaufzuspähen. »Es brennt Licht; gehen wir, dann sind wir im Trockenen.« Sie waren mindestens sechs Stockwerke hinaufgestiegen und beim Dachgeschoss angelangt, als Amelia keuchend stehenblieb und sagte: »Hast du Angst?«
»Wieso Angst?«, fragte Ginia. »Kennst du ihn nicht?«
Als sie an die Tür klopften, hörten sie Gelächter im Zimmer, ein halblautes, unangenehmes Lachen, das Ginia an Rodrigues erinnerte. Sie hörten Schritte, die Tür öffnete sich, aber man sah niemanden. »Dürfen wir reinkommen?«, fragte Amelia, indem sie eintrat.
Auf einem Sofa an der Wand, unter einem grellen Licht, lümmelte tatsächlich Rodrigues. Aber daneben stand noch einer, ein Soldat in Hemdsärmeln, blond und verdreckt, der sie lachend ansah. Ginia kniff die Augen zusammen in dem Licht, es schien eine Karbidlampe zu sein. Kleine Bilder und Vorhänge bedeckten drei Wände; die vierte bestand nur aus Fenster.
Halb ernst, halb lachend sagte Amelia zu Rodrigues: »Sie sind wohl überall?« Er winkte ihr zu und brummte: »Die zweite heißt Ginia, Guido.« Da reichte der Soldat auch ihr die Hand, während er sie unverschämt lächelnd musterte.
Ginia begriff, dass sie sich ganz unbefangen geben musste, und begann, über Amelias und Guidos Köpfe hinweg die Bilder an den Wänden zu betrachten. Es schienen Landschaften mit Bäumen und Bergen zu sein, und dazwischen erkannte sie undeutlich einige Porträts. Aber die Lampe, wie in noch nicht ganz fertigen Wohnungen ohne Schirm aufgehängt, blendete, ohne Licht zu geben. Ginia sah aber doch, dass es hier nicht so viele Vorhänge gab wie bei Barbetta, sondern nur einen – einen langen roten –, der das Zimmer hinten abschloss, und sie begriff, dass es dahinter noch einen Raum geben musste.
Guido fragte, ob sie etwas trinken wollten. Auf dem großen Tisch in der Mitte des Zimmers standen Gläser und eine Flasche. »Wir sind gekommen, um uns aufzuwärmen«, sagte Amelia. »Wir sind nass bis zu den Knien.« Guido schenkte ein – einen dunklen Rotwein –, und Amelia brachte Rodrigues, der sich aufsetzte, ein Glas. Während sie tranken, sagte Amelia zu ihm: »Es tut mir leid für Guido, aber Sie stehen jetzt auf und überlassen mir das Bett, damit ich mir die Beine wärmen kann. Die Betten sind für die Frauen. Komm auch her, Ginia.« Doch Ginia wollte nicht, sie sagte, der Wein habe sie schon gewärmt, und setzte sich auf einen Stuhl. Da streifte Amelia die Schuhe ab, zog sich die Jacke aus und schlüpfte unter die Decke. Rodrigues blieb auf dem Sofarand sitzen.
»Redet ruhig weiter«, sagte Amelia. »Mich stört nur das Licht.« Damit streckte sie den Arm zur Wand und knipste es aus. »So, das hätten wir. Gebt mir eine Zigarette.«
Ginia saß entsetzt im Dunkeln. Aber sie merkte, dass Guido zum Sofa gegangen war, und hörte, wie er das Zündholz anstrich, und sah die beiden Gesichter in der Flamme zwischen tanzenden Schatten. Dann wurde es wieder dunkel, und einen Moment lang rührte sich niemand. Man hörte den Regen an die Fensterscheiben prasseln.
Jemand sagte etwas, aber Ginia, die immer noch verstört war, erfasste die Worte nicht. Sie merkte, dass auch Guido rauchte, während er ruhig im Dunkeln auf und ab wanderte. Sie sah die Zigarettenglut und hörte die Schritte. Dann begriff sie, dass Amelia und Rodrigues wieder angefangen hatten zu streiten. Doch erst, als sie sich allmählich an die Dunkelheit gewöhnt hatte und den Tisch, die Schatten der anderen und sogar einige Bilder an der Wand zu unterscheiden begann, wurde sie ruhiger. Amelia sprach mit Guido über früher, als sie einmal krank hier auf dem Sofa geschlafen hatte. »Aber damals hattest du noch nicht diesen Partner«, sagte sie, »was machst du mit ihm? Ziehst du ihn nackt aus?«
Alles war so seltsam, dass Ginia sagte: »Man kommt sich vor wie im Kino.«
»Aber hier kostet es keinen Eintritt«, erwiderte Rodrigues aus seiner Ecke.
Guido ging immer noch auf und ab, quer durch das ganze Zimmer, und brachte mit seinen Stiefeln den dünnen Boden zum Schwingen. Sie redeten alle durcheinander, doch plötzlich merkte Ginia, dass Amelia schwieg – man sah die Zigarette – und dass auch Rodrigues nichts mehr sagte. Nur Guidos Stimme erfüllte das Zimmer und erklärte etwas, das sie nicht verstand, weil sie mit einem Ohr zum Sofa hin horchte. Ein nächtliches Licht fiel durch die Scheiben, wie ein elektrischer Widerschein des Regens, und man hörte es von den Dächern und Regenrinnen tropfen, plätschern und gluckern. Jedes Mal, wenn der Regen und die Stimme zufällig gleichzeitig schwiegen, schien es kälter zu werden. Dann bemühte sich Ginia, im Dunkeln Amelias Zigarette zu erkennen.