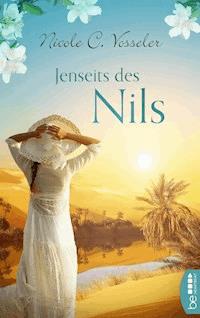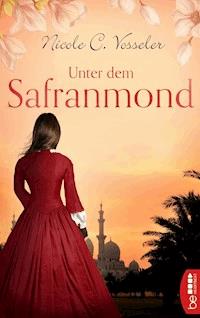3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
England, 1582. Zwei Königinnen streiten um die Macht im Land, nur eine kann siegen. Zwei Spione arbeiten gegen die Zeit, einer von ihnen ist noch ein Kind. Der Waisenjunge Nicholas Christchurch hätte sich nie träumen lassen, dass er eines Tages als Gehilfe im Haus des berühmten Magiers von Mortlake Aufnahme finden würde. Doch hätte er geahnt, was ihn dort erwartet, wäre er vielleicht lieber bei seinem Job als Trickdieb geblieben. Denn ehe er sich versieht, ist er zum Spion geworden. Zum Spion im Dienste der Königin. Und seine Aufgabe ist keine leichte: Kann ein Kind die Krone retten?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 502
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Nicole C. Vosseler
Das Haus der Spione
Roman
Edel:eBooks
Copyright dieser Ausgabe © 2013 by Edel:eBooks, einem Verlag der Edel Germany GmbH, Hamburg.
Copyright © 2012 by Nicole C. Vosseler
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Montasser Medienagentur, München.
Covergestaltung: Agentur bürosüd°, München
Konvertierung: Datagrafix
Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des jeweiligen Rechteinhabers wiedergegeben werden.
ISBN: 978-3-95530-210-8
edel.com
Inhalt
Prolog
Liber Primus Der Magus von Mortlake
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Liber Secundus Im Netz der Spinne
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Liber Tertius Spione in Salisbury Court
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Liber Quartus In der Höhle des Löwen
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Epilog
Nachwort der Autorin
Verzeichnis der wichtigsten historischen Persönlichkeiten
Glossar
Währung – im Roman erwähnte Münzen und ihr verhältnismäßiger Gegenwert
Back
Mein ganzes Leben habe ich nach dem Motto »video et taceo« gelebt, ich sehe und ich schweige. Aber nun ist der rechte Moment gekommen, mein Schweigen zu brechen. So richte ich heute das Wort an Euch über Raum und Zeit hinweg.
Schon zu Lebzeiten war ich eine Legende. Um wie viel mehr bin ich es heute nach all der Zeit, die vergangen ist! Vieles ist über mich geschrieben, noch mehr erzählt worden.
Was davon ist Wahrheit?
Alles und nichts.
Ich war eine Meisterin der Täuschung, das ist wahr, und mit mir das halbe Land, weil es die Zeit so erforderte. Richtet mich daher nicht nach Eurem Maß, denn dieses wäre tödlich gewesen in meinen Tagen. Lest aber diese Geschichte, um Euren Blick zu schärfen und der Wahrheit ein wenig näher zu kommen.
Prolog
London, den 6. Dezember Anno Domini 1569
Samuel Shipwash hatte es eilig. So eilig, dass er sich nicht einmal die Mühe machte, sein gepolstertes Wams zu schließen. Dabei war die Luft draußen schneidend kalt, stach unangenehm durch den dünnen Stoff seines Hemdes und ließ ihn frösteln. Aber den sich vorwölbenden Bauch einzuziehen und an den Verschlussbändern herumzunesteln – nein, das lohnte sich nicht. Nicht für die paar Schritte von seinem Haus am Bull Head Court bis zur Kirche. Außerdem hätte er sich dann eingestehen müssen, dass er das Wams kaum noch zubekam. Dabei stand die Weihnachtszeit mit all den Leckereien erst noch bevor! Sein Magen zog sich knurrend zusammen, als er an den Eintopf dachte, der über dem Feuer in der Küche vor sich hin blubberte, aus Erbsen, Möhren, Zwiebeln, mit großen Stücken fetten Hammelfleisches darin. Ein Grund mehr, sich zu beeilen. Ganz abgesehen davon, dass Mistress Shipwash schnell ungehalten wurde, wenn sie mit dem Essen auf ihn warten musste.
In großen Schritten hastete er über den Platz. Es hatte geschneit, nur einen Hauch, und die Kristalle auf dem gefrorenen Boden knisterten unter den Sohlen seiner Stiefel. Durch Ritzen in den hölzernen Fensterläden der Nachbarhäuser blinzelte Licht hervor. Um diese Jahreszeit dämmerte es bereits am Nachmittag und nun, am frühen Abend, herrschte schon schwarze Nacht. Doch Samuel Shipwash kannte seinen Weg im Schlaf. Seit gut zehn Jahren oblag ihm als Küster des Londoner Stadtteils Newgate die Sorge um das Erscheinungsbild der trutzigen Christ Church. Eine Sorge, der er mehr oder minder gewissenhaft nachkam.
Es waren Franziskanermönche gewesen, die vor langer Zeit das Kloster mit dem dazugehörigen Gotteshaus errichtet hatten. Damals hatten sowohl England als auch das übrige Europa nur einen Glauben gekannt. Jene Mönche hätten sich gewiss nicht träumen lassen, dass eines Tages ein deutscher Ordensmann namens Martin Luther mit seinen Weggefährten eine Spaltung der Christenheit in Katholiken und Protestanten auslösen würde. Und noch viel weniger hätten sie es für möglich gehalten, dass ein englischer König bald darauf diese Entwicklung nutzen würde, um seine eigene protestantische Kirche zu gründen. So wie es Heinrich VIII. getan hatte. Allein zu dem Zweck, sich von seiner ersten Frau Katharina von Aragón scheiden zu lassen, die ihm nur die Tochter Maria Tudor geboren hatte, nicht aber den ersehnten Thronerben. Die Franziskaner waren vertrieben worden, wie ihre Brüder und Schwestern aus allen Klöstern des Landes. Ihre großartige Kirche jedoch hatte die Zeit überdauert und blickte seither streng auf den winzigen Stadtteil herab, der zu ihren Füßen gewachsen war.
Über solche Dinge dachte Samuel Shipwash allerdings nie nach, während er die schweren Kirchenportale auf- und zuschloss, Kerzen anzündete oder auslöschte und auch sonst nach dem Rechten sah. Er war kein gläubiger Mensch, und ob England nun katholisch oder protestantisch war, spielte für ihn keine große Rolle. Hauptsache, es herrschte Frieden, er hatte einen vollen Magen und ein Dach über dem Kopf und Mistress Shipwash zankte nicht allzu oft mit ihm. Für alles andere sorgte Elisabeth I., Königin nun schon im zwölften Jahr. Gelobt sei unsere gute Queen Bess!
Seine Frömmigkeit beschränkte sich darauf, während der Predigten seines Pastors vor sich hin zu dösen und vor dem Essen schludrig das Dankgebet zu murmeln. Tief in seiner Seele verwurzelt war jedoch der alte Volksglaube. Wie alle seine Nachbarn fürchtete er sich nicht wenig vor Hexen mit ihrem bösen Blick, der Vieh krank und Milch sauer werden ließ. Vor Elfen, die Kinder in ihr magisches Reich entführten, und vor Zauberern, die mit dem Teufel im Bunde standen. Und als Samuel Shipwash an diesem Abend in der menschenleeren Kirche die Hand hob, um die letzte Kerze zu löschen, und hinter sich ein Rascheln hörte, erstarrte er.
Er kannte das Geräusch von über Steinplatten huschenden Mäusen und das Knarren der hölzernen Bänke. Jedes quietschende Scharnier an den Türen und das Knacken, das das eine oder andere Bauteil der Orgel auf der Empore von sich gab, waren ihm wohlvertraut. Doch dieses Geräusch war ihm gänzlich fremd und ließ ihm einen kalten Schauder den Rücken hinablaufen.
Mit angehaltenem Atem lauschte er angestrengt in den weiten, stillen Raum hinein, dessen Luft ihm plötzlich kälter schien als zuvor. Die Kerzenflamme flackerte, ließ Schatten über die glatten Säulen und die nackten, geweißelten Wände zucken. Einzelne Flächen der bunten Glasfenster glommen auf, schienen ihm wie leuchtende Katzenaugen, die sich öffneten und wieder schlossen. Da – da war es wieder: ein flaches Rascheln, ein Knistern und Scharren. Dann ein kleiner kehliger Laut, der sich in den steinernen Nischen und Vorsprüngen verlor. Zweifellos, er kam von der gegenüberliegenden Seite des Altars, die im Dunkeln lag.
Langsam und mit klopfendem Herzen drehte sich Samuel Shipwash um. Ein dünnes Wimmern setzte ein, wurde lauter und schriller, steigerte sich zu einem grellen Geheul, das erbarmungslos durch Mark und Bein drang. Der Küster zögerte keine Sekunde länger, nahm seine kurzen Beine in die Hand und rannte, so schnell es seine Leibesfülle zuließ.
Pastor Edmund Hardcastle saß beim trüben Licht einer rußenden Talgkerze in seiner Stube und kaute an einer Scheibe Brot, die so trocken und hart war wie Stein. Dass er sie ab und an in die Schale mit der wässrigen Rübensuppe oder in den irdenen Krug mit stark verdünntem Ale stippte, machte es auch nicht besser. Es war beileibe nicht so, dass er sich nichts Besseres hätte leisten können. Zwar waren die zur Christ Church gehörenden Einnahmen nicht gerade üppig, aber für Butter und Fleisch und eine dicke Suppe hätte es allemal gereicht. Zumal Hardcastle als Schulmeister für den Kirchsprengel ein nicht zu verachtendes Nebeneinkommen erzielte. Was er mit all diesem Geld machte? Das fragte sich auch seine Schwester Prudence jeden Montag, wenn er ihr die wenigen Münzen wöchentlichen Haushaltsgeldes hinzählte, obwohl sie grundsätzlich seine Überzeugung teilte, dass Völlerei einer der kürzesten Wege in Satans Hände sei.
Prudence Hardcastle saß an diesem Abend am anderen Ende des Tisches, an dem der Pastor sein karges Mahl verzehrte, und flickte zum wiederholten Male eines seiner Nachthemden. Mit jedem Jahr, das sie ihrem früh verwitweten, kinderlosen Bruder den Haushalt führte, war sie ihm ähnlicher geworden. Beide groß und hager, schienen ihre schmalen Gesichter immer länger zu werden. Und die links und rechts ihrer Mundwinkel senkrecht hinablaufenden Falten verliehen ihnen beiden auch dann einen mürrischen Ausdruck, wenn sie es ausnahmsweise einmal gar nicht waren.
Doch das fieberhafte Klopfen an der Tür ihres kleinen Pfarrhäuschens am Anfang der Cock Lane, gleich schräg gegenüber der Kirche, gab ihnen nun wirklich einen Grund, sich gegenseitig verdrießlich anzublicken. Unerwartete Störungen ihrer Abendruhe schätzten sie beide nicht sonderlich. Denn diese konnten meist nur bedeuten, dass ein gerade geborenes, schwächliches Kind die Nottaufe erhalten sollte oder eines der Gemeindemitglieder die letzte Stunde gekommen sah.
»Warum müssen sich die Leute immer solch ungünstige Uhrzeiten zum Sterben aussuchen?«, muffelte Hardcastle dann auch zwischen den letzten zwei Bissen seines Abendbrotes. Während er sich noch die Hände an seinem Talar abwischte und ohne Hast erhob, war seine Schwester schon zur Tür geeilt.
Die hohe Stirn unter der schmucklosen Haube gerunzelt, sah Prudence Hardcastle stumm den rotgesichtigen und sichtlich aufgelösten Küster an. Ihr Blick blieb ebenso fasziniert wie angewidert an seinem dicken Bauch hängen, der im Takt von Shipwashs Schnaufen auf- und abhüpfte. So entging ihr sein reflexartiges Naserümpfen. Denn Prudence Hardcastle sah nicht nur säuerlich aus – sie roch auch ebenso, wie Samuel fand. Erst als er den Pastor hinter ihr auftauchen sah, fing sich der Küster so weit, dass er mit dem Daumen über seine Schulter zeigen und stammelnd hervorbringen konnte:
»W-w-wir – wir haben einen Dämon in der Kirche!«
Ein Dämon, so ein Unfug, schnaubte Pastor Hardcastle, als er mit hallenden Schritten durch das lang gezogene Kirchenschiff eilte. Er warf einen verächtlichen Seitenblick auf seinen Küster, der beinahe rennen musste, um mit ihm mithalten zu können. Vermutlich hat er mal wieder den Rest seines Lohns in der Schenke vertrunken! Für alle Fälle hatte sich der Pastor jedoch mit einem eisernen Schürhaken bewaffnet, in der anderen Hand eine Laterne. Der Küster hielt mutig einen schweren schmucklosen Kerzenständer umklammert.
»Hier – hier war es.« Samuel Shipwash blieb an der Stelle stehen, an der er kurz zuvor das unheimliche Geräusch vernommen hatte. Seine Stimme zitterte wie seine Hand, als er auf die andere Seite des Altars wies. »Und – und von dort drüben kam es.«
Pastor Hardcastle lauschte aufmerksam. Nichts.
Entschlossen packte er den Schürhaken fester und marschierte quer durch den Altarraum. Sein Küster folgte ihm mit schlotternden Knien und suchte Deckung hinter dem schmalen Rücken des Pastors. Am Ende des steinernen Altars angelangt, hob Hardcastle die Laterne und lugte vorsichtig um die Ecke. Stück um Stück erhellte sich der Winkel in der Mauernische. Etwas Weißes leuchtete ihm entgegen, länglich und ausgebeult, wie ein Bündel Wäsche. Er trat näher und beugte sich vorsichtig darüber. Der Lichtkegel seiner Laterne enthüllte ein winziges Gesicht – das Gesicht eines Säuglings.
»Ha!«, entfuhr es Hardcastle, ebenso erschrocken wie erleichtert. Wie auf Kommando fing das Bündel zu schreien an. Das gellende Gebrüll, das die Ohren des Pastors schmerzen ließ, führte ihn einen Augenblick lang in Versuchung, tatsächlich an einen Dämon zu glauben.
»Meine haben nie so geschrien«, ließ sich Samuel Shipwash vernehmen, der sich hinter Hardcastle hervorgewagt hatte und ebenso ungläubig ihren Fund beäugte wie der Pastor. »Glaube ich jedenfalls«, fügte er verunsichert hinzu, als Hardcastle ihn streng anblickte.
Das Aussetzen von Kindern kam so gut wie nie vor. Die Sterblichkeit war hoch: Zwölf von hundert Kindern erreichten nicht einmal das erste Lebensjahr. In der Regel waren Eltern froh um jedes Kind, das sie durchbringen konnten. Gab es doch zu wenig zu essen für alle, wurde ein Kind mit einem Schlag zur Vollwaise oder brachte es durch seine außereheliche Geburt Schande über die Familie, fand sich immer ein Nachbar oder ein Verwandter, der es bei sich aufnahm. Oder man gab es zu einem Handwerksmeister, der das Kind aufzog und später für sich arbeiten ließ. So stellte die bloße Anwesenheit dieses Findelkindes Pastor und Küster vor ein Rätsel. Aber zunächst galt es, praktischere Probleme zu lösen.
»Was machen wir jetzt damit?« Hardcastles Gesicht zeigte deutlich seinen Missmut. Er verspürte wenig Neigung, sich mit solchen Problemen herumplagen zu müssen, die ihn im Grunde gar nichts angingen. Aber der Herr in Seiner unerforschlichen Weisheit hatte ihm diese Bürde dadurch auferlegt, dass das Kind ausgerechnet in der Kirche seiner Gemeinde ausgesetzt worden war. Hardcastle zuckte unter dem Geschrei wieder und wieder zusammen. Dann hellte sich seine Miene kaum merklich auf, als er erneut seinen Küster ansah. Samuel Shipwash brauchte ein paar Herzschläge, ehe er begriff. In hektischer Abwehr begann er sogleich, mit den Händen zu wedeln.
»Nein, auf gar keinen Fall! Ich kann es nicht nehmen, ich habe schon fünf Mäuler zu stopfen und das sechste ist unterwegs!«
»Was seid ihr nur für Helden«, ließ sich hinter ihnen Prudences knarzende Stimme vernehmen. In der Hoffnung, heute noch eine Sensation in ihrem sonst so farblosen Dasein miterleben zu können, war sie ihrem Bruder und dem Küster nachgeeilt. »So nehmt es doch erst einmal von den kalten Steinen weg!« Ächzend bückte sie sich und schaufelte das brüllende Bündel in ihre knochigen Arme. Augenblicklich herrschte Stille, zur großen Verblüffung der beiden Männer. Ungelenk schob Prudence das Kind in die eine Armbeuge, nestelte an den Tüchern herum und spähte darunter.
»Ein Rest Nabelschnur hängt noch dran. Es ist weniger als ein paar Tage alt.« Ihr Blick wanderte weiter. »Und es ist im Übrigen ein Er.«
Hardcastle schoss peinlich berührt das Blut in die hohlen Wangen. Seiner Meinung nach sollten gewisse Körperteile auch bei solch kleinen Kindern besser unerwähnt bleiben.
»Du taufst ihn besser rasch! Wer weiß, ob er die Nacht noch überlebt«, empfahl Prudence energisch.
»Aber vielleicht ist es – er – doch schon . . .«, wollte der Pastor einwenden, doch seine Schwester fiel ihm harsch ins Wort.
»Beim Blute unseres Erlösers, Edmund – seit wann bist du so geizig mit den Sakramenten? Doppelt genäht hält außerdem besser!« Mit einem Blick auf den Jungen fügte sie leise, fast sanft hinzu: »Wir wissen schließlich nicht, welche Sünde schon auf ihm lastet, deretwegen man ihn ausgesetzt hat.«
Und so wurde das Findelkind, das Pastor Hardcastle an diesem Abend um seine Ruhe gebracht hatte (und dies zu seinem Leidwesen auch noch in vielen weiteren Nächten tun sollte), in aller Eile nach dem Heiligen des Tages, Nikolaus von Myra, und nach dem Ort seines Auffindens auf den Namen Nicholas Christchurch getauft.
Liber Primus Der Magus von Mortlake
Und für solch wunderbare Taten und Werke, ob mittels der Natur, der Mathematik oder der Mechanik zustande gebracht – sollte dafür ein ehrlicher Student und bescheidener christlicher Philosoph wahrhaftig zu den Zauberern gezählt und ein Magier genannt werden?
Doctor John Dee,
1
London, Mai Anno Domini 1582
Dich werde ich lehren, mit dem Teufel um die Wette zu spielen«, brüllte Pastor Hardcastle, als er Nicholas in Richtung des Pfarrhauses zerrte.
Nicholas hoffte inständig, sein Ohr würde unter dem unbarmherzigen Griff des Pastors nicht abreißen. Doch was ihn mehr schmerzte als die körperliche Züchtigung war, dass der Pastor sein Geheimversteck aufgespürt hatte. Außer Nicholas kam seit Ewigkeiten niemand mehr in den alten Kreuzgang hinter der Kirche. In der Stille der selbstvergessen vor sich hin krümelnden Säulen und Mauern hatte Nicholas sich immer sicher und beschützt gefühlt. Hier grübelte er über die Welt im Allgemeinen und sich selbst im Besonderen nach. Hier verlor er sich in Träumereien, die ihm eine glanzvolle, abenteuerliche Zukunft verhießen, wenn er nur erst groß und der Enge des Pfarrhauses entwachsen sein würde. Träumereien, die ihm die grauen Tage bei den Hardcastles leichter machten. Und nun war ihm diese Zuflucht genommen.
Aus dem Bündel im Altarraum war gut zwölfeinhalb Jahre später ein schmaler, aber zäher Junge geworden. Von mittlerer Größe, mit hellen, glatten Haaren in einer undefinierbaren Farbe hatte Nicholas so gar nichts, was einem aufgefallen wäre. Und auch seine Augen, weder blau noch grau noch grün, sondern irgendetwas dazwischen, waren nichts Besonderes. Was Nicholas meist sehr gelegen kam. Denn sich in brenzligen Momenten aus dem Staub machen und dann inmitten des Trubels auf dem Marktplatz untertauchen zu können – das erwies sich sehr oft als hilfreich. Zum Beispiel, wenn er wieder einmal die bescheidene Speisekammer des Pfarrhauses geplündert hatte. Oder wenn Prudence Hardcastles sorgsam gepäppelte Salatpflänzchen mit den fetten Schnecken verziert waren, die Nicholas in der Nachbarschaft gesammelt hatte, um sich für die Prügel vom Vortag zu rächen.
Doch an diesem Spätnachmittag hatte ihm das nichts genutzt. Irgendwie hatte Hardcastle ihn gefunden und zog ihn am Ohr hinter sich her durch die stinkenden Gassen Newgates.
Vorbei an den Metzgern, die schon morgens um fünf ihrem grausamen Handwerk nachgingen, sobald die ersten Karren vom Land durch das Stadttor gerumpelt waren, um quiekende Ferkel gegen klingende Münze ihren Henkern zuzuführen. Die Luft war schwer vom metallisch-süßlichen Geruch geschlachteter Lämmer, Hammel, Hühner und Gänse. Newgate war einer der größten Fleischmärkte Londons und die Metzger hatten jeden Tag alle Hände voll zu tun. Nicht zuletzt damit, die Heerscharen von Fliegen von den Schweinehälften fernzuhalten, was sich natürlich als aussichtsloses Unterfangen erwies.
Nicholas schämte sich. Allerdings nicht, weil er ein schlechtes Gewissen hatte. Hardcastles Schimpftiraden waren ihm vertraut, so weit seine Erinnerung zurückreichte, und ließen ihn gänzlich unberührt. Sondern wegen der Blicke der Passanten und ihres Gelächters, das seinen schmachvollen Weg säumte.
»Nicht genug, dass du die Schule schwänzt und dich herumtreibst! Ist das der Dank für unsere Mühen? Für unsere christliche Nächstenliebe?«, schalt ihn der Pastor gerade. »Haben wir dich dafür aufgenommen und großgezogen, dich beherbergt und verköstigt? Dass du dich Müßiggang und Teufelswerk hingibst?«
Wie so oft in letzter Zeit hatte Nicholas auch an diesem Nachmittag statt Psalmen und Bibelverse sowie Griechisch und Latein zu lernen im Kreuzgang mit den zerfledderten Spielkarten jongliert, die er einem Kartenkünstler abgeluchst hatte.
Denn Nicholas hatte auf der anderen Seite der Newgate Street, die die südliche Grenze des Stadtteils markierte, das »richtige« London entdeckt. Schmutzig war es dort auch und an vielen Straßenecken roch es keineswegs besser als in Newgate, aber es gab so viel mehr zu sehen und zu erleben! Händler mit ihren mannigfachen Waren, feine Herrschaften in Samt und Seide. Vor allem die Taschenspieler mit ihren Kartenkünsten hatten es ihm angetan.
Über einem besonders kniffligen Trick hatte er die Zeit und auch sonst alles um sich herum vergessen. Bis ihn von einem Augenblick zum nächsten der Pastor am Schlafittchen gehabt hatte.
In der Küche des Pfarrhauses ließ Hardcastle Nicholas endlich los und schubste ihn in Richtung des gemauerten Herdes, über dem ein Süppchen vor sich hin köchelte. Nicholas’ Ohr pochte und fühlte sich an, als sei es zur Größe eines Flaschenkürbisses angeschwollen.
»Hinein damit!« Der Pastor wies erst auf den kümmerlichen Rest des Kartenspiels, den Nicholas im letzten Augenblick hatte noch zusammenraffen können und umklammert hielt; dann auf die Flammen unter dem Kessel. Nicholas sah ihn ungläubig an.
»Aber – aber es sind doch nur Karten!«, wandte er hilflos ein, das dünne Päckchen an sich pressend.
Doch Nicholas bedeutete es weitaus mehr; es war sein einziger Schatz und das Kostbarste, was er besaß.
Aber Edmund Hardcastle schien äußerst viel daran gelegen zu sein, das steife Papier in Flammen aufgehen zu sehen. »Ins Feuer mit dem Teufelszeug«, befahl er erneut und eine ungesunde Röte machte sich auf seinem Gesicht breit.
Nicholas schüttelte trotzig den Kopf. »Nein, ich geb’s nicht her!«
»Warte nur, Freundchen, ich kann auch anders!« Der Pastor packte Nicholas’ Hand und versuchte mit Gewalt, die Finger des Jungen aufzubiegen, die sich nur fester um die Karten krampften. »Wer mit Karten spielt, spielt sich Satan in die Hände. Du kannst auch gerne eine Nacht im Gefängnis darüber brüten!«
Nicolas würgte es, als er an die elenden Gestalten dachte, die im berühmten Gefängnis von Newgate angekettet vor sich hin moderten, schmutzig, verwildert und dem Wahnsinn nahe. Doch er ließ die Karten nicht los.
Hardcastle war hager, aber er war größer und stärker. Tränen des Zorns und des Schmerzes schossen Nicholas in die Augen. Er glaubte, jeden Moment müssten seine Fingergelenke brechen, die Sehnen reißen. Mit einem Ruck suchte er sich zu befreien, und sein Ellenbogen rammte etwas Hartes. Hardcastle japste auf, schmerzhaft zwischen die Rippen getroffen, und Nicholas nutzte seine Chance. Er riss sich los und preschte vorwärts, als ginge es um sein Leben. Er rannte, vorbei an einer zur Salzsäule erstarrten Prudence Hardcastle, vorbei an der grimmig dreinblickenden Kirche, quer über die breite Newgate Street und in die Freiheit.
2
Der Reiter sprengte durch den Forst. Zweige peitschten ihm ins Gesicht, doch er nahm darauf ebenso wenig Rücksicht wie auf sein Pferd, das Schaum vorm Maul hatte und unter dem scharfen Galopp keuchte. Das Blattwerk über ihm war so dicht, dass das Unterholz in tiefster Finsternis lag und keine genauere Schätzung der Stunde zuließ. Sein Weg in den Norden hatte ihn über traumverlorene braunviolette Moore geführt, durch dichte Wälder und über Wiesen, die so süß dufteten, wie sie es nur im Mai taten. Doch seine Sinne waren dafür nicht empfänglich gewesen. Eile war geboten, um das Ziel noch vor Einbruch der Nacht zu erreichen und das Päckchen zu überbringen, das er an seinem Körper trug. Erlen und Ulmen schossen vorüber und unvermittelt endete der Wald. Die Hufe seines Pferdes bohrten sich in eine feuchte Rasenfläche. Der Reiter zügelte sein Tier, bis es schließlich atemlos auf der Stelle tänzelte.
Es war nach Sonnenuntergang. Dämmerung kroch über die weite Parklandschaft und entzog ihr die Farben des Tages. Vor dem lavendelgrauen Himmel erhob sich der Schattenriss eines Schlosses, drohend und düster im schwindenden Licht. Zahlreiche Fenster waren erleuchtet, doch ihr gelblicher Schein wirkte eher abweisend denn einladend.
Er stieg ab und führte sein Pferd am Zügel zu einer vereinzelt stehenden ausladenden Esche.
»Ihr kommt spät.«
Mit gezücktem Dolch fuhr er herum. Aus der Silhouette des Baumstamms löste sich ein Schatten und trat auf ihn zu. »Ruhm sei der Silberdistel . . .«, begann die Gestalt in dem langen Umhang, die Kapuze tief ins Gesicht gezogen.
Der Reiter steckte den Dolch zurück und ergänzte das Losungswort: ». . . am Morgen des Phönix.« Aus dem Ausschnitt seines Hemdes zog er seine kostbare Fracht hervor und einen Lederbeutel, in dem es leise klimperte. »Ich bin so schnell geritten, wie ich konnte. Doch Yorkshire ist nun einmal kein Vorort Londons.« Er reichte beides seinem Gegenüber. Der Beutel verschwand sogleich zwischen den Falten des Umhangs. Das Paket jedoch wurde nachdenklich in beiden Händen gewogen. »Und die schwarze Spinne ahnt gewiss nichts hiervon?«
»Mein Wort als Ehrenmann und dasselbige meines Herrn«, bestätigte der Reiter. »Besagte Spinne kann ihre neugierige Nase weiterhin in die offizielle Post stecken, bis sie ganz tintenfleckig ist. Auf mehr als belanglose Neuigkeiten wird sie aber von nun an vergeblich warten. Garantiert Ihr uns im Gegenzug, dass dieses Päckchen Eure Gebieterin wohlbehalten erreichen wird?«
Der Mann mit der Kapuze lachte verächtlich auf und warf einen Seitenblick zum Schloss hinüber.
»Seid unbesorgt! Selbst wenn mich jemand gesehen haben sollte: Der Earl of Shrewsbury hält es für unter seiner Würde, die Post seiner Gefangenen zu kontrollieren.« Er nickte dem Reiter zum Abschied zu. »Versichert Eurem Herrn die unverbrüchliche Dankbarkeit meiner Gebieterin für seine Dienste.«
Schon nach wenigen Schritten verschmolz seine dunkle Gestalt mit der Dämmerung.
Der Reiter stieg auf und wendete sein Pferd, um ohne Hast die Rückreise anzutreten.
3
London, Anfang November Anno Domini 1582
Nicholas’ Revier reichte weit. Die meiste Zeit verbrachte er am südlichen Ufer der Themse, in Southwark. Southwark war das Vergnügungsviertel Londons, eingeklemmt zwischen hochherrschaftlichen Häusern. Ein Kontrast, wie er größer nicht hätte sein können. Auf der einen Seite die hohen Mauern, die die Villen mit ihren gepflegten Gärten abschirmten; auf der anderen die halbwegs respektablen Gasthäuser und üble Spelunken. Dazwischen brauten Holländer ihr Bier, hatten Franzosen ihre Weberstuben – Hugenotten, die vor gut einem Jahrzehnt aus ihrem bürgerkriegsgeschüttelten Land geflohen und hier hängen geblieben waren. Je näher man dem Wasser kam, desto enger und düsterer wurden die Gassen, aber auch bunter und lebendiger.
Zu jeder Jahreszeit tummelten sich hier Vergnügungssüchtige aus London selbst, aber auch Ausflügler vom Land, die etwas erleben wollten. Sie bestaunten die Tänzer in ihren bunten Kostümen, die Artisten, die waghalsig aufeinander herumturnten, die Straßenmusikanten und Jongleure, die Balladensänger und Puppenspieler. Für einen Penny konnte man in der hölzernen Arena zusehen, wie zähnefletschende Hunde einen Bären oder einen Bullen hetzten. In derselben Arena und in manchen Hinterhöfen wurden auch Theaterstücke aufgeführt, begleitet von Beifall und Jubel – oder von Buhrufen, fliegenden Tomaten und faulen Eiern, je nachdem. Betrunkene torkelten tags und nachts durch den Straßendreck und ihr Johlen und Krakeelen hallte von den Wänden wider. Manch eine Münze wurde mildtätig einem der Bettler gespendet, die durch den Unrat schlurften oder an der Ecke kauerten. Blauäugige Landburschen und eitle Gecken verloren ihren Geldbeutel an Taschendiebe oder verwetteten ihr Geld beim Würfelspiel. Southwark war zu Nicholas’ neuer Heimat geworden, seit er an jenem Maitag für immer dem Pfarrhaus entflohen war. Doch heute sprang Nicholas in eines der zahlreichen Fährboote, die von einem Ufer der Themse an das andere übersetzten. Er wollte sein Glück in der City versuchen. Auf der Cheapside beispielsweise, der prächtigen Einkaufsmeile, die für ihre Juweliere, Goldschmiede und Uhrmacher berühmt war. Auch die Royal Exchange war ein lohnendes Ziel. Hinter den Kolonnaden um den großen, quadratischen Innenhof und im ersten Stockwerk gab es in über hundert Läden alles, was das Käuferherz begehrte: bunte Trinkgläser, exotische Gewürze, Parfum und Räucherwerk, Federn in allen Farben des Regenbogens. Kunstvoll gelockte Perücken, bestickte Stoffe und Heilkräuter bis hin zu kompletten Ritterrüstungen warteten auf den mit genügend Silberlingen ausgestatteten Kunden.
Leise vor sich hin pfeifend schlenderte Nicholas die Threadneedle Street mit ihren Schneidern und Kurzwarengeschäften entlang.
»Mist«, entfuhr es ihm unwillkürlich, »der hat mir heute gerade noch gefehlt!« An einem Hauseingang lehnte mit verschränkten Armen der Lange Tom, unverwechselbar in seinem kanariengelben Wams und der langen roten Feder an der Kappe. Seit Nicholas sein täglich Brot auf der Straße verdiente, machte Tom ihm das Leben schwer. Auch heute blickte er ihm wieder angriffslustig entgegen. Nicholas erwiderte Toms Blick eisig. Und musste im nächsten Moment an sich halten, um nicht loszuprusten. Denn Toms rechtes Auge zierte eine gelblich verfärbte, noch deutlich sichtbare Schwellung. Sieh an, frohlockte Nicholas im Stillen, habe ich letzte Woche doch einen guten Treffer gelandet! Kurz überlegte er, ob er an ihrer letzten Begegnung anknüpfen sollte, um ihre Revierstreitigkeiten ein für alle Mal auszutragen. Aber als vor ihm wie aus dem Boden gestampft ein halbes Dutzend bulliger Jungen auftauchte, die sichtbar auf Randale aus waren, verwarf Nicholas diesen Gedanken sofort wieder. Einen Kampf mit Toms Schlägertruppe vom Zaun zu brechen, das erschien ihm heute eine Nummer zu groß. Er nickte Tom hoheitsvoll zu, wechselte in aller Gemütsruhe die Straßenseite und bog in Richtung St. Paul’s ab.
In der alten Kathedrale wurden schon lange keine Gottesdienste mehr abgehalten. Moos überzog die dicken Grundmauern. Die Bögen, Säulen und Türmchen bröckelten langsam auseinander. Vom ehemals stolzen Kirchturm in der Mitte des gewaltigen Kirchenschiffs war nach einem Blitzschlag nur noch ein plumper Stumpf übrig geblieben.
In und um St. Paul’s war immer was los. St. Paul’s war der zentrale Treffpunkt der Stadt; hier verabredete man sich, tauschte Neuigkeiten und Gerüchte aus und besiegelte Geschäfte mit einem Handschlag. Auf dem ehemaligen Kirchhof prangerten Prediger lautstark den Sittenverfall an, beklagten selbst ernannte Weltverbesserer Missstände im Land. Unweit des Hauptportals blieb Nicholas stehen und tat so, als wartete er auf jemanden. Geübt ließ er dabei seine Blicke über die Passanten schweifen, auf der Suche nach einem Bauerntölpel oder einem angetrunkenen Edelmann, den er anrempeln und dabei um seinen Geldbeutel erleichtern konnte. Nicht dass Nicholas knapp bei Kasse gewesen wäre. Im Gegenteil: Sein eigener Lederbeutel, geschickt unter dem gefütterten Wams versteckt, war gut gefüllt. Nicholas hatte jedoch läuten hören, dass die Zeit von Dreikönig bis nach Ostern in seinem Metier immer eine dürre war. Bis dahin wollte er so viel auf der hohen Kante haben, dass er in diesen Monaten keinen Hunger würde leiden müssen.
»Ich kann dir deine Zukunft voraussagen.«
Nicholas fuhr herum. Der Atem der Flüsterstimme an seinem Hals hatte ihm einen Schauder den Rücken hinabgejagt. Sie gehörte zu einem Zigeunermädchen, etwa in seinem Alter und einen halben Kopf kleiner. Ihr Kleid war geflickt und verdreckt, das bronzene Gesicht schmutzig und ihre dunklen Locken zerzaust. Zigeuner waren nichts Ungewöhnliches in den Straßen von London. Aber Nicholas hatte bislang immer einen großen Bogen um sie gemacht; irgendwie waren sie ihm unheimlich. Und auch jetzt riet ihm eine innere Stimme, das Weite zu suchen. Doch Nicholas blieb wie angewurzelt stehen. Das Mädchen lächelte ihn kess von unten herauf an und schnappte sich dann einfach seine rechte Hand.
»Mal sehen . . .« Konzentriert starrte sie in seine Handfläche und runzelte die Stirn. »Seltsam, deine Lebenslinie ist am Anfang ganz verschwommen. So etwas habe ich noch nie gesehen.«
Nicholas hätte ihr am liebsten die Hand entzogen. Allein die Vorstellung, was sie daraus herauslesen mochte, war ihm unangenehm. Aber ihre dunklen Augen mit dem Funkeln darin, die immer wieder zwischen den Linien in seiner Handfläche und seinen eigenen Augen hin- und herwanderten, hielten ihn gefangen wie unter einem Bann.
»Von dort aus ist sie dann klar erkennbar und tief eingegraben.« Sie tippte mit ihrem Zeigefinger nachdenklich in seine Handfläche. »Sie verläuft jedoch nicht gerade, sondern im Zickzack. Du wirst ein langes Leben haben, aber gewiss kein eintöniges. Ich sehe – ich sehe große Aufgaben und große Gefahren.«
Es durchlief Nicholas heiß und kalt, als sich das Mädchen auf die Zehenspitzen stellte, ihm ihre Hand auf die Schulter legte und ihm ins Ohr raunte: »Sei auf der Hut und halt die Augen offen – da ist ein Mann, der dich beobachtet!«
Ehe Nicholas den verwünschten Knoten in seiner Zunge lösen und nachfragen konnte, was sie meinte, lenkte ihn mehrstimmiges Gebrüll ab.
»Zieh Leine, du dreckiges Papistenschwein! Hau bloß ab und lass dich hier nie wieder blicken!«
Ein besser gekleideter Junge in seinem Alter stolperte über das Pflaster, schluchzend und das sommersprossige Gesicht tränenverschmiert. Ihm auf den Fersen war eine Horde Burschen, die ihm Schimpfnamen und Drohungen hinterherriefen. Immer wieder bückte sich einer von ihnen in vollem Lauf, klaubte einen losen Stein vom Pflaster und warf ihn nach dem Opfer der Treibjagd. Einzelne Spaziergänger auf dem Platz vor der Kathedrale blieben stehen, glotzten, machten aber keine Anstalten einzuschreiten. Ein oder zwei von ihnen grinsten gar. Der Junge heulte auf, als ihn ein Stein zwischen den Schulterblättern traf, stürzte aber weiter vorwärts. »Götzendiener! Papistischer Drecksack!«
Nicholas zuckte es in den Beinen, dem armen Kerl zu Hilfe zu kommen. Dennoch rührte er sich nicht von der Stelle. Offiziell war es nicht verboten, dem katholischen Glauben anzuhängen. Solange man nur regelmäßig den Gottesdienst der protestantischen Kirche besuchte, konnte jeder in seinem stillen Kämmerlein glauben, was er wollte. Immer wieder flammte jedoch der Hass gegen die Papisten auf und Nicholas war nicht das erste Mal Zeuge eines solchen Vorfalls. Und wenn er auch einen Widerwillen gegen die strengen Grundsätze des reformierten Glaubens hegte, die Pastor Hardcastle in ihn hineinzuprügeln versucht hatte, so empfand er doch eine gewisse Scheu vor den Katholiken. Zu schlecht war ihr Ruf als Verräter an Kirche und Königin und die Erinnerung an die Jahre vor Elisabeths Herrschaft, als die Inquisition Protestanten als Ketzer auf den Scheiterhaufen geschickt hatte, war kaum verblasst.
Dennoch drückte ein dicker Klumpen schlechten Gewissens von hinten gegen Nicholas’ Brustbein. Zu seiner Erleichterung rettete sich der Junge in einen Hauseingang und verschwand darin. Seine Häscher, erhitzt vom Jagdfieber, blieben außen vor. Enttäuschung auf den Gesichtern, beratschlagten sie sich kurz und trollten sich missmutig. Einer von ihnen schleuderte den Stein, den er noch in der Hand hatte, halbherzig an die Hauswand und schickte einen Fluch hinterher.
Als Nicholas aufatmete und sich umblickte, war er wieder alleine. Ebenso plötzlich, wie das Zigeunermädchen an seiner Seite aufgetaucht war, war sie nun auch verschwunden. Suchend blickte er sich zwischen den Vorübergehenden und Umstehenden um, doch das Mädchen war nirgendwo zu sehen. Er schüttelte den Kopf über diese seltsame Begegnung und setzte seinen Weg um St. Paul’s fort.
Als er an der nächsten Ecke seiner Gewohnheit nach über sein Wams strich, hielt er erschrocken inne. Die Ausbuchtung unterhalb des Rippenbogens war nicht mehr zu fühlen. Sein Geldbeutel war fort!
»Diese Rotzgöre! So eine blöde Gans! Dreimal verflixt und Halleluja! Ich Esel!« Die Passanten sahen ihn an, als wäre er aus dem Tollhaus entflohen. Er wütete und tobte und trat mehrmals gegen die Mauern eines Hauses, bis sein Fuß schmerzte.
4
Die Turmuhr von All Hallows Barking schlug die zwölfte Stunde. Mitternacht.
Sir Francis Walsingham legte die Feder beiseite und streckte seine steif gewordenen Finger. Es würde wieder eine lange Nacht werden. Seit Stunden schon wartete er auf die Ankunft eines seiner Kuriere aus den Niederlanden. Geistesabwesend tastete er nach dem Becher, der neben den ausgebreiteten Papieren auf dem Schreibtisch stand. Beim ersten Schluck verzog er das Gesicht. Wieder solch ein widerliches Gebräu, das seine Frau Ursula aus ihrem Kräutergärtchen zusammengemischt hatte! Er wusste ja, dass sie es gut meinte mit ihren Bemühungen, all die Zipperlein zu lindern, die ihn plagten: Gicht, Gallensteine, ein nervöser Magen. Doch dem, was ihm wirklich zu schaffen machte und erdrückend auf seinen Schultern lastete, war mit keinem Kräutertrank beizukommen. Es war die Sorge um England und seine Königin.
Seufzend erhob er sich und ging die paar Schritte zum Fenster. Er öffnete es und kippte den Inhalt des Bechers durch die schmiedeeisernen Gitterstäbe hinunter auf das Pflaster. Nebel von der nahen Themse verhüllte die gegenüberliegende Häuserzeile mit milchigen Schwaden und verschluckte jedes Geräusch. Es wurmte ihn immer aufs Neue, dass er aus seinem Kontor keinen vollständigen Blick auf den Tower von London hatte. Nur vom Dachgeschoss des Hauses konnte man die vier Türme mit ihren zwiebelförmigen Dächern sehen, um die die Raben ihre Kreise zogen. Sollten diese Raben eines Tages den Tower verlassen, so würde England untergehen, besagte die Legende. Walsingham empfand eine gewisse Sympathie für diese düsteren Vögel. Denn auch seine Mission war es, England vor dem Untergang zu bewahren. Deswegen versuchte er ohne Unterlass, mögliche Feinde Elisabeths aufzustöbern und drohendes Unheil von ihr und ihrer Krone abzuwenden.
Es war Walsingham zumindest ein Trost, dass er den Tower und den Tower Hill, den öffentlichen Hinrichtungsplatz, in allernächster Nähe wusste. Außerdem galt die Seething Lane als sehr gute Adresse. Dafür nahm er bereitwillig die durch die Nähe zum Fluss bedingte Feuchtigkeit in Kauf. Vor allem aber war das Haus mit seinen über dreißig Zimmern sehr groß. Und Walsingham brauchte Platz: Stallungen für die mehr als sechzig schnellen und ausdauernden Pferde, auf denen er seine Kuriere losschickte; Schreibstuben für seine Sekretäre und standesgemäße Wohnräume für sich selbst und seine Frau. Alle Fenster zur Straße hin waren mit Gittern gesichert. Der Innenhof mit angrenzendem Garten lag hinter einer hohen Mauer und das Eingangstor aus massiver, eisenbeschlagener Eiche war Tag und Nacht schwer bewacht. Kein beschriebenes Stück Papier, das dieses Haus erreichte, durfte je in falsche Hände gelangen. Denn in diesem Haus liefen die Fäden von Walsinghams Geheimdienst zusammen.
Es klopfte und Thomas Phelippes betrat das Kontor. Er war ein kleiner, drahtiger Mann, blond und bis auf sein pockennarbiges Gesicht von unscheinbarem Äußeren. Sein Spezialgebiet waren Geheimschriften und derzeit gab es auf der Welt keinen Code, den er nicht beherrschte.
»Bitte, Sir, die Nachricht aus Paris, die vor einer halben Stunde eingetroffen ist.«
»Sehr gut.« Walsingham schloss das Fenster und nahm die Papiere entgegen.
Phelippes sah zu, wie sein Dienstherr die Bögen in den Schein des Kerzenleuchters hielt. Das lange schwarze Gelehrtengewand mit der steifen Halskrause gab Walsingham ein strenges Aussehen. Jahre harter Arbeit und kurzer Nächte hatten das schwarze Haar und den Bart versilbert, die dunklen Augen umschattet und Linien in das längliche Gesicht gegraben. Die Königin liebte Spitznamen und Walsinghams südländisch anmutendes Äußeres hatte sie dazu bewogen, ihn »meinen Mohren« zu nennen. Eine Bezeichnung, die Walsingham hasste. Phelippes musste sich jedes Mal das Grinsen verbeißen, wenn er in seiner Gegenwart daran dachte.
»Hm«, machte Walsingham, als er zu Ende gelesen hatte, und strich sich über den geschwungenen Schnurrbart. Eine Geste, die Phelippes nur zu gut kannte und die nichts Gutes verhieß.
Walsingham warf die beschriebenen Seiten auf einen Stoß anderer Dokumente und wanderte mit nachdenklicher Miene um den Schreibtisch herum.
Die Rückwand des holzgetäfelten Kontors war in mehrere Dutzend Fächer unterteilt. Jedes davon wurde von einer kleinen Tür verschlossen, die den Namen einer Stadt trug: Antwerpen, Straßburg, Lübeck, Zürich, Genf, Madrid, Rom, Mailand, Florenz, Moskau . . . Über fünfhundert Korrespondenten sorgten dafür, dass der Strom an Nachrichten aus diesen Städten nie abriss. Ihre Berichte wurden gewissenhaft in diesen Fächern verwahrt. Wer einmal Walsinghams Kontor betreten durfte, begriff, wie weit sein Spionagenetz reichte – und wie viel Macht er damit in den Händen hielt.
»Diese vermaledeite Schottin«, knurrte Walsingham schließlich. Selbst wer nicht den Inhalt des entschlüsselten Schreibens kannte, das Walsingham so offensichtlich verstimmte, hätte sofort gewusst, wen er damit meinte: Maria Stuart, die Katholikin, Königin von Schottland durch Geburt, Königin von Frankreich durch Heirat. Das Schicksal war Maria Stuart nicht günstig gesonnen gewesen und hatte ihr beide Kronen wieder genommen. Von ihren eigenen Lords in Schottland gestürzt, war sie nach England geflohen, um bei ihrer Cousine Elisabeth Schutz zu suchen. »Diese papistische Natter im Gras unseres englischen Garten Eden! Verflucht sei der Tag, an dem sie dieses Land betreten hat!«
Maria Stuarts Anwesenheit in England, die nun schon über vierzehn Jahre andauerte, stellte ein Problem dar. Ein Problem, das nicht nur Walsingham Kopfzerbrechen bereitete. Maria Stuart war ein Flüchtling und von königlichem Geblüt. Aber sie stand auch unter Verdacht, an der Ermordung ihres zweiten Ehemannes beteiligt oder zumindest der Mitwisserschaft schuldig gewesen zu sein. Eine Ausweisung war dennoch undenkbar, weil man selbst mit Königinnen ohne Land nicht nach Belieben verfahren konnte. Doch je länger Maria Stuart in ihrem Hausarrest auf englischem Boden weilte, desto angespannter wurde die Lage. Durch ihre Verwandtschaft mit Elisabeth besaß Maria Stuart einen legitimen Thronanspruch. Ihr Glaube machte sie zur Galionsfigur der katholischen Minderheit in England, die die protestantische Elisabeth gestürzt sehen wollte. Und wer, von Kindesbeinen an zur Königin erzogen, würde Nein sagen, böte man ihm eine Krone auf dem Silbertablett an, zum Trost für zwei verlorene Königreiche?
»Es wäre einfacher, wenn Ihre Majestät Königin Elisabeth sich jemals vermählt und einen Erben zur Welt gebracht hätte«, ließ sich Phelippes vernehmen und zupfte nachdenklich an seinem Spitzbärtchen.
Walsingham schnaubte verächtlich. »Damit lag Lordschatzmeister Burghley der Königin seit ihrer Krönung in den Ohren. Sie tat zwar immer so, als habe sie ernsthafte Absichten. Aber als ich damals selbst die Verhandlungen mit einem französischen Kandidaten führte, wurde ich eines Besseren belehrt. Alles Taktik, Phelippes! Sie hat niemals im Traum daran gedacht, ihre Macht zu teilen. Gar nicht mal zu Unrecht. Wen hätte sie auch heiraten sollen?« Er machte eine ausholende Geste. »Einen Spanier? Einen Franzosen? Einen Engländer? Einen Protestanten oder zum Ausgleich lieber einen Katholiken? Gleich für wen sie sich auch entschieden hätte, es hätte immer eine Partei im Land gegeben, die gemurrt und gleich darauf zum Aufstand geblasen hätte! Und auch wenn sie immer noch mit dem einen oder anderen anbändeln sollte – mit neunundvierzig Jahren ist ihr Schoß längst verdorrt. Elisabeth ist und bleibt einzig mit England vermählt.« Er seufzte. »Letztlich obliegt es nicht uns, uns in die Regierungsgeschäfte Ihrer Majestät einzumischen. Unsere Aufgabe besteht allein darin, die Lage im Auge zu behalten und Schaden von der Königin abzuwenden, wo wir nur können.«
Unaufgefordert zog Phelippes sich einen Stuhl an den Schreibtisch heran und setzte sich. Gemütlich streckte er seine knochigen Beine in der taubenblauen Pumphose und den dazu passenden Strümpfen aus, die in wadenlangen Stiefeln steckten. Mit spitzen Fingern entfernte er ein Stäubchen auf Kniehöhe, ehe er sich mit selbstzufriedenem Gesicht zurücklehnte und die Hände im Genick verschränkte. Phelippes konnte sich solche Freiheiten gegenüber seinem Dienstherrn herausnehmen. Er war zu sehr ein Meister seiner Kunst, als dass Walsingham auf ihn hätte verzichten können.
»Ich hatte geglaubt, auf Schloss Sheffield sei Maria Stuart in sicherer Verwahrung, bis ich das da«, mit einem Rucken seines kaum ausgeprägten Kinns wies er auf die Papiere, die er Walsingham gebracht hatte, »entschlüsselt hatte.«
»Es gibt nichts Gefährlicheres, als sich in Sicherheit zu wiegen«, murmelte Walsingham wie zu sich selbst. »In Sicherheit«, er sah Phelippes unverwandt an, »in Sicherheit wird Elisabeth erst sein, wenn Maria Stuart tot ist.«
»Ein Meuchelmord, Sir?« Phelippes wasserblaue Augen glitzerten begierig.
Walsingham schüttelte den Kopf. »Zu plump und äußerst unklug. Das würde einen Bürgerkrieg heraufbeschwören und uns Ärger mit Frankreich und Spanien bescheren. Nein, Maria Stuart muss sterben – aber nach dem Gesetz, als Hochverräterin. Folglich«, er stützte sich mit der geballten Linken auf die Tischplatte und hob mahnend den rechten Zeigefinger, »folglich können wir momentan nur eines tun: einen unserer Agenten in die französische Botschaft einschleusen und herausfinden, ob wahr ist, was hier steht.« Sein Finger senkte sich langsam auf die entschlüsselte Nachricht. »Nämlich, dass es zwischen der französischen Gesandtschaft und Schloss Sheffield einen geheimen Postweg gibt.«
Walsingham witterte schon lange voller Unbehagen, dass im Ausland Pläne ausgeheckt wurden, die Verrat und Umsturz zum Ziel hatten. Pläne, nach denen Maria Stuart auf den englischen Thron gebracht werden sollte. Aber obwohl viele Gerüchte umherschwirrten, fehlten ihm noch die Beweise. Auch diese Nachricht aus Paris enthielt nur eine Vermutung, doch sie passte zu Walsinghams Beobachtungen der letzten Monate.
Es war ihm merkwürdig erschienen, dass in den Abschriften der Briefe an Maria Stuart, die er zu Gesicht bekam, nur noch harmlose Plaudereien zu finden waren. In der Überwachung der Gefangenen musste es eine undichte Stelle geben und er war entschlossen, diese aufzuspüren und zu schließen. Wenn er den Verantwortlichen überfuhrt hatte, dann würde er hoffentlich durch ihn an Belastungsmaterial herankommen, das ihm Maria Stuart ans Messer liefern würde.
Dienstbeflissen kramte Phelippes aus seinem dunkelblauen Wams eine zusammengefaltete Liste. Er klappte sie zur gesamten Länge aus und hielt sie dicht vor seine schon etwas kurzsichtigen Augen. Betrübt sah er auf. »Wir haben momentan keinen Agenten frei.«
»Ich weiß«, seufzte Walsingham. Er war ständig auf der Suche nach neuen Agenten und Boten. Nicht nur, dass es schwierig war, geeignete Leute zu finden. Spione waren zudem kostspielig und neben der Sorge um den Frieden des Königreiches trieben ihn des Nachts oft Geldnöte um. Denn Königin Elisabeth war nicht nur von zaudernder und wankelmütiger Natur, sondern auch knauserig – sofern es nicht um teure Kleider, Schmuck und verschwenderische Feste ging. Alle Bedenken, was die Kosten anbelangte, halfen aber nichts. Je mehr Agenten er beschäftigte, desto größer war die Chance, dass er Verschwörungen gegen Elisabeth und England frühzeitig entdecken und im Keim ersticken konnte. Wissen darf niemals zu teuer sein, pflegte er sich selbst immer wieder zu ermahnen.
»Wie dem auch sei«, Walsingham atmete tief durch und suchte das Schreiben hervor, das er verfasst hatte, ehe Phelippes das Kontor betreten hatte, »einstweilen muss das hier noch verschlüsselt und unverzüglich nach Prag geschickt werden.«
Ohne äußere Anzeichen von Missmut, dass sich sein wohlverdienter Feierabend noch eine Weile hinauszögern würde, nahm Phelippes das Papier entgegen und verließ das Kontor.
Als Walsingham wieder alleine war, sann er noch eine Weile über die Nachricht aus Paris nach. Der Kurier, den er erwartete, war noch immer nicht eingetroffen. Jetzt ins Bett zu gehen, machte keinen Sinn. Man würde ihn doch nur wieder wecken, sobald der Reiter ankam. Also machte er sich daran, einen Plan auszuarbeiten, wie sich am geschicktesten ein Maulwurf in der französischen Botschaft platzieren ließe.
5
He, Kleiner«, Nicholas fühlte sich unsanft an der Schulter gerüttelt, »‘s ist Zeit zum Aufstehen! Ich muss die Schenke noch ausfegen, heute werden die ersten Gäste sicher früh kommen!«
Nicholas fuhr schlaftrunken hoch. Im Traum war er wieder im Pfarrhaus in Newgate gewesen und er brauchte ein paar Herzschläge, um sich zu erinnern, wo er war. Will Cheddar, der Wirt des Blauen Karnickel, stand vor ihm, zur ganzen Größe seiner hünenhaften Gestalt aufgebaut. Die schaufelähnlichen Hände auf die Hüften unter der Lederschürze gestützt, grinste er den Jungen gutmütig an. »Dacht schon, ich krieg dich gar nicht mehr wach! War spät gestern, hm? Hat sich’s für dich wenigstens gelohnt?«
Hastig tastete Nicholas nach seinem Wams, das ihm auf der harten Holzbank als Kopfkissen gedient hatte. Der Lederbeutel war noch da und enthielt fühlbar die gleiche Hand voll Münzen wie zu der Stunde, als er sich zu seiner viel zu kurzen Nachtruhe begeben hatte. Nicholas entfuhr ein erleichterter Seufzer. Will lachte dröhnend auf, dass sein Bauch erbebte.
»Keine Angst! Der Laden hier läuft so gut, dass ich’s nicht nötig hab, dir dein hart ergaunertes Vermögen abzunehmen!« Er gab Nicholas einen so heftigen Klaps auf den Rücken, dass dieser beinahe von der Bank herabrutschte. »Geh dich mal pudern und frisieren. Ich schau derweil, ob ich meiner Herrin und Meisterin was zum Essen für dich abluchsen kann.«
Nicholas rieb sich die noch schlafverklebten Augen, gähnte herzhaft und stieg in seine Stiefel. Nachdem er seine Besitztümer eingesammelt hatte, schlurfte er zur rückwärtigen Tür der Gaststube. Im Hof war es empfindlich kalt, selbst für Mitte November, und nach seinem Besuch des Aborts überlegte Nicholas sich gut, ob er wirklich nähere Bekanntschaft mit dem Wasser im Brunnen machen wollte.
»Hilft alles nix«, murmelte er schließlich vor sich hin, »wie der letzte Landstreicher musst du ja nun auch nicht aussehen.« Heldenhaft zog er sich das Hemd über den Kopf. Als er sich über den gemauerten Rand des Brunnens beugte, hielt er inne. Die schiefen Häuser aus uralten Holzbalken und abblätterndem Putz verdunkelten den Innenhof, machten so die Wasseroberfläche zu einem Spiegel, aus dem Nicholas sich selbst entgegenblickte. Es gab Momente, da wünschte er sich, weniger unauffällig auszusehen, sondern etwas Außergewöhnliches darzustellen. So wie an diesem Morgen. Irgendwie war dieser Morgen seltsam. Nicholas hatte ein flaues Gefühl im Bauch, das nicht von seinem knurrenden Magen herrührte und das ihn nicht mehr verlassen hatte, seit er von Will geweckt worden war.
Nicholas schüttelte den Kopf über sich und seine krausen Gedanken, hielt die Luft an und tauchte kurzerhand bis weit über beide Ohren in das eiskalte Brunnenwasser.
Den Bauch voll mit Mistress Cheddars süßem Haferbrei, einer dicken Scheibe Brot mit Butter und einem Becher verdünnten Starkbieres trat er wenig später auf die belebte Gasse. Das Metallschild über der Tür, ein schielendes Kaninchen von ausgeblichener blauer Farbe, quietschte vernehmlich, als es im scharfen Wind hin- und herschaukelte. Die Schenke war einer der vielen Schlafplätze, die Nicholas über die Stadt verteilt hatte. Will Cheddar hatte nichts dagegen, wenn Nicholas ab und zu mit seinen Tricks die Gäste unterhielt. Die meisten glaubten, mit dem Jungen leichtes Spiel zu haben. Sie waren eher erstaunt denn verärgert, wenn sie Runde um Runde die gesetzten Pennys an ihn verloren. Mit flinken Fingern mischte Nicholas die Karten, ließ sie in einem lang gezogenen Bogen von links nach rechts und wieder zurückfliegen und fächerte sie dann in einem exakt ausgezirkelten Halbkreis auf dem Tisch auf. Wie von Zauberhand war dabei die Karte, die der Gast im Spiel zuvor blind aus dem Stapel gezogen und nur den Umstehenden gezeigt hatte, als einzige aufgedeckt. Vertieft in dieses vertrackte Spiel bestellte sich manch ein Zuschauer, ohne aufzublicken, einen Becher nach dem anderen. Und so kam Nicholas’ Anwesenheit in der Schenke auch dem Geldbeutel von Will Cheddar zugute. Deshalb und weil er den Jungen mochte, winkte er auch nur ab, wenn Nicholas seine Übernachtung und die Mahlzeiten bezahlen wollte.
Nicholas hatte es längst aufgegeben, mit Will darüber zu streiten. Dieser Tage war er froh, jeden Penny zu sparen. Noch immer schoss Nicholas voller Wut und Scham das Blut ins Gesicht, wenn er daran dachte, wie er sich hatte hereinlegen lassen. Und dass ausgerechnet ein Mädchen ihn so geschickt bestohlen hatte, vergrößerte seine Schmach noch ins Unendliche.
Zornig schritt er fester aus, vorüber an den Frauen mit ihren Hauben und frisch gestärkten Schürzen, die in der Gasse beisammenstanden, tratschten und lachten, während ihre Kinder um sie herum Fangen spielten. Vorbei an jungen Kavalieren, die sich ihre Kappen vom Kopf rissen und den herausgeputzten Mägden hinterherpfiffen. Die ganze Stadt war gut gelaunt auf den Beinen. Denn heute war der 17. November, der Jahrestag von Königin Elisabeths Thronbesteigung. Überall im Land würde ausgelassen gefeiert werden, mit Musik und Tanz, mit Theaterstücken, Prozessionen, Turnieren und nach Einbruch der Dunkelheit mit Freudenfeuern. Die beste Gelegenheit also für Nicholas, seinen neu gekauften Beutel zu füllen und den Verlust seines Ersparten wieder wettzumachen.
Königin Elisabeth I. von England – für Nicholas war diese Bezeichnung etwas so Entrücktes, Ungreifbares wie Sonne und Mond. Und so nahm er die Existenz der Herrscherin über England ebenso als gegeben hin wie diejenige der Himmelskörper.
»Ich wünschte nur, sie war im Sommer Königin geworden«, maulte Nicholas vor sich hin. Er schlang die Arme fester um sein Wams, um sich vor dem Wind etwas zu schützen. »Verdammt, passt doch auf da oben«, brüllte er zu dem geöffneten Fenster hoch, aus dem gerade der Inhalt eines Nachttopfs auf das Pflaster klatschte und Nicholas nur knapp verfehlte. Im nächsten Moment blieb er wie vom Blitz getroffen stehen.
Keine zwanzig Schritte vor ihm überquerte ein Mädchen die Gasse. Ihren dunkelroten Rock hielt sie gerafft, um die Säume nicht durch die übel riechenden Rinnsale zu beschmutzen, die über die Pflastersteine liefen. Auch wenn sie jetzt sauber und hübsch zurechtgemacht war in der engen tannengrünen Jacke, die Locken ordentlich gekämmt unter der weißen Haube, erkannte er sie doch auf Anhieb wieder.
»He!«, brüllte Nicholas aus Leibeskräften und rannte los.
Das Zigeunermädchen sah erschrocken auf und begann ebenfalls zu laufen. Aber ihre weiten Röcke behinderten sie und auf ihren dünnen Sohlen kam sie auf dem glatten Pflaster immer wieder ins Rutschen. Noch ehe sie sich um die nächste Hausecke retten konnte, hatte Nicholas sie eingeholt und beim Arm gepackt. Grob schüttelte er sie.
»Rück mein Geld raus, du diebische Elster!«
»Lass mich los«, fauchte sie und schlug mit ihrem bestickten Stoffbeutel auf ihn ein. »Ich hab dein blödes Geld nicht!«
»Lüg doch nicht auch noch! Ich will mein Geld zurück!« Er bekam ihren anderen Arm auch noch zu fassen und glaubte sich schon Sieger in diesem Kampf. Doch schneller, als er schauen konnte, hatte sie ausgeholt und ihm mit einem ihrer spitzen Schuhe voller Wucht vor das Schienbein getreten.
Nicholas jaulte auf und sah Sterne vor seinen Augen tanzen. Als sich das Mädchen aus seinem plötzlich gar nicht mehr so festen Griff befreite, verlor er das Gleichgewicht und landete ebenso unsanft wie unehrenhaft auf seinem Hosenboden. Sie lief, so schnell es ihr leichtes Schuhwerk zuließ, und sprang dann gekonnt auf ein Pferdefuhrwerk auf, das gerade die angrenzende Gasse hinabrumpelte.
Das Letzte, was Nicholas von ihr sah, war, wie sie mit baumelnden Beinen auf der Ladefläche saß, geziert ihren Rock zurechtzupfte und ihm mit einem spöttischen Lächeln zuwinkte.
»Ich krieg dich, du hinterhältige Schlange! Verlass dich drauf!«, brüllte Nicholas hinter ihr her, mehr um seine Ehre zu retten denn um dem Mädchen wirklich zu drohen. Mit hochrotem Kopf rappelte er sich unter dem Gelächter der Passanten auf. Er klaubte seine Ballonmütze vom Pflaster, klopfte sie aus und begradigte die abgeknickte Feder. Wütend zog er die Kopfbedeckung bis über beide Ohren.
»Na, das kann ja heute noch heiter werden«, knurrte er übellaunig vor sich hin, als er davonhumpelte.
Damit sollte er recht behalten.
6
Wie an jedem Festtag bewiesen sich Burschen gegenseitig ihren Wagemut, indem sie in der Fassade von St. Paul’s herumkletterten. Einer davon hatte es gar auf den Dachfirst des Südportals geschafft, auf dem er herumbalancierte. Den Kopf in den Nacken gelegt, staunten etliche Schaulustige über diese Tollkühnheit und vergaßen alles um sich herum. Eine Stunde später war Nicholas um zwei leidlich gefüllte Geldbeutel reicher und wieder ganz in seinem Element. Federnden Schrittes betrat er die Kathedrale.
Das Innere von St. Paul’s war Ehrfurcht gebietend. Auf einer Allee aus turmhohen Pfeilern ruhte das Deckengewölbe des westlichen Kirchenschiffs. Farbig getöntes Licht fiel seitlich durch die Bleiglasfenster. Doch wer die Kathedrale betrat, hatte meist keinen Blick für ihre Architektur. Er wurde abgelenkt von den vielfältigen Buden in den Seitenkapellen und entlang den Säulen. Verleger und Drucker boten ihre Erzeugnisse an: lose zusammengeheftete Broschüren oder in feinstes Leder gebundene Bücher, lateinische Bibeln, philosophische, mathematische, religiöse Abhandlungen, Lehrbücher für Architektur und Medizin, Gedichtbände und Liedersammlungen. Es gab Tinte, Schreibfedern und Papiermesser zu kaufen. Ein Händler pries das so praktische Bier in Flaschen an; ein anderer Dörrobst und kandierte Früchte. Wie in einem Bienenstock summte und brummte es. Londoner Akzent mischte sich mit dem der Grafschaften Sussex oder Kent. Mit Französisch, Italienisch, Niederländisch und Flämisch, Deutsch und Böhmisch. Füße scharrten über den Stein und Gelächter quoll empor zu den Rippenbögen der Decke. Im Gebälk gurrten Tauben; Spatzen schossen mit surrendem Flügelschlag hin und her.
Eine kleine Gruppe hatte sich in einer Seitennische um den steinernen Sarkophag eines längst vergessenen Heiligen versammelt. Voller Spannung verfolgten sie, wie Nicholas die Karten durch die Luft flattern ließ und wieder fing. Wie er mit großen Gesten mischte, abhob, auffächerte, Karten aufdeckte. Nicht nur die kleinen Kinder, die sich an die Rockzipfel ihrer Mütter klammerten, sperrten Augen und Mund auf. Immer wieder ging ein Raunen von Mund zu Mund, brandete Applaus auf. Und nach jeder gewonnenen Runde strich Nicholas die Münzen ein, die auf die Steinplatte klimperten.
Eigentlich hätte er es gut sein lassen können, er hatte heute mehr als genug verdient. Aber es juckte ihn in den Fingern, einen neuen Trick auszuprobieren, den er lange geübt hatte. Schadet nichts, wenn ich es wage, dachte er bei sich. Mehr als schiefgehen kann es ja nicht . . .
Nicholas mischte das Kartendeck neu und schlug damit einen Fächer, Bildseite nach unten. Er hielt ihn dem Nächststehenden hin, einem vierschrötigen Kerl mit Haar und Bart wie aus Kupfer.
»Hier, Master, zieht eine Karte und merkt sie Euch wohl!« Gehorsam tat der Mann, wie Nicholas ihn geheißen hatte. Er betrachtete die Karte genau, zeigte sie den Umstehenden, sorgsam darauf bedacht, dass Nicholas sie nicht zu Gesicht bekam. Dann schob er sie wieder in den Fächer, Rückseite unverändert nach oben. Nicholas mischte und hob dreimal ab. Er mischte erneut, bog die Karten leicht durch und ließ sie wie aufgefädelt von einer Handfläche in die andere schnurren. Seine Hand mit dem Kartenstapel glitt flach über den Sarkophag und hinterließ eine pfeilgerade Bahn gemusterter Kartenrückseiten. Verschmitzt lächelnd sah er der Reihe nach in die Gesichter vor ihm, um die Spannung noch zu steigern. Dann hob er die zuunterst liegende Karte an einer Ecke an und mit einem Rauschen klappten die Karten nacheinander um wie Dominosteine.
»Und, Master – findet Ihr Eure Karte wieder?«
Fast ein Dutzend Köpfe beugte sich über das ausgebreitete Kartenspiel, allen voran der rothaarige Mann. Ein paar Herzschläge lang war es totenstill.
»Das ist unmöglich«, brummelte der Mann in seinen Bart. Hektisch begann er, beidhändig die Karten zu durchwühlen, wild durcheinanderzuschieben. »Mein Herz-Ass! Mein Herz-Ass fehlt!«
Einige Zuschauer sogen scharf die Luft ein, andere tuschelten aufgeregt miteinander.
Nicholas breitete in einer stolzen Geste die Arme aus und sonnte sich in seinem Erfolg. Jawohl, Mesdames et Messieurs, jubelte er im Stillen, vor Euch steht Nicholas Christchurch, der größte Kartenkünstler aller Zeiten! Doch der tosende Beifall, auf den er wartete, stellte sich nicht ein. Stattdessen wichen die Menschen spürbar vor ihm zurück. Eine der Frauen zerrte gar ihr Kind hinter ihren voluminösen Rock. Ein Flüstern hob an, wurde lauter.
»Der Teufel! Er steht mit dem Teufel im Bund! Satansbrut!«
Nicholas wurde blass um die Nase. Ehe er auch nur einmal geblinzelt hatte, hatte ihn der Rothaarige auch schon am Kragen gepackt, dass nur noch Nicholas’ Zehenspitzen den Boden berührten. Drohend schüttelte er den Jungen. »Wir werden den Teufel schon aus dir austreiben, Bürschchen!«
»Ähm, Mo-Moment«, krächzte Nicholas. Verzweifelt zermarterte er sich das Gehirn, wie er sich aus dieser misslichen Lage wieder befreien könnte.
»Verzeiht, dürfte ich?« Ein älterer Herr schob sich durch die Zuschauer. »Ich glaube, ich kann etwas Licht in diese Angelegenheit bringen.« Er tippte höflich auf die Schulter des selbst ernannten Inquisitors. Verdutzt ließ dieser Nicholas los.
Nicholas blickte ähnlich verwirrt drein wie die Übrigen, als sich der ältere Mann dicht neben ihn stellte. Das lange schwarze Gewand mit der Halskrause wies ihn als Gelehrten aus, ebenso das dicke, in rotes Leder gebundene Buch, das er unter den Arm geklemmt hatte. Doch auch wenn sein langer Bart weiß war, wirkte sein Gesicht unter der runden Kappe jugendlich. Nicholas glaubte für einen Moment gar, einen Funken Schalks in den braunen Augen aufglimmen zu sehen.
»Zähl bis sieben und dann lauf hinüber in den Chorraum«, raunte ihm der Mann in Schwarz zu, als er sich amüsiert über den Bart strich. Laut und gut verständlich jedoch fragte er: »Du gestattest?«
Gezielt fischte er das Herz-Ass aus Nicholas’ Ärmel. Triumphierend präsentierte er den verblüfften Zuschauern die Karte. »Seht Ihr: eine ganz einfache Erklärung!«
Sieben. Nicholas spurtete los, noch ehe er die empörten Aufschreie hörte. »Betrüger! Haltet den Halunken! Haltet ihn!«
Die Besucher von St. Paul’s drehten sich neugierig nach Nicholas um, der Haken schlug wie ein Hase. Ein Spaßvogel wollte ihm ein Bein stellen, doch Nicholas sprang darüber hinweg. Einen Augenblick lang war er versucht, durch das Nordportal zu flüchten. Doch er rannte weiter, wie ihn der Mann mit dem weißen Bart geheißen hatte. In zwei Sätzen war er die Stufen zum Chorraum hinauf und jagte den gemusterten Steinboden entlang. Die geschnitzten Chorstühle flitzten links und rechts an ihm vorbei. Als außer dem Hallen seiner Schritte und seinem Keuchen nichts mehr zu hören war, blieb er schließlich stehen.
Der hohe, weite Raum war verlassen. Und nun? Die Arme in die schmerzenden Seiten gestützt, sah Nicholas sich ratlos und schwer atmend um. Deckung suchen, aber fix, gab er sich selbst zur Antwort. Am Ende des Chorgestühls erspähte er hinter einem Spitzbogen eine Wandnische, die im Dunkeln lag. Na bitte, kommt ja wie gerufen, nichts wie hinein! Erleichtert ließ Nicholas sich gegen die Wand fallen und rutschte in die Hocke hinab, nach Luft ringend.
Im nächsten Moment gab die Wand hinter ihm nach und er purzelte rückwärts über eine hölzerne Schwelle, hinaus ins Freie.
»Ah, da bist du ja schon!« Die Klinke der winzigen Seitentür noch in der Hand, sah der Mann in Schwarz vergnügt auf ihn hinunter. »Kann ich mir die Suche sparen. Der Chorraum mit den ganzen Nischen und Ecken ist doch ein wenig unübersichtlich gebaut.«
7
W-wie«, stammelte Nicholas, der einem Käfer gleich auf dem Rücken lag. »Ich meine, woher . . .«
Er kam sich unsagbar dämlich vor. Wütend ignorierte er die helfend hingestreckte Hand und stand hastig auf.
»Das mit der Tür?« Der Mann mit dem weißen Bart ließ selbige wieder ins Schloss fallen. Schmunzelnd sah er zu, wie Nicholas übertrieben heftig den Staub aus Wams und Hose klopfte. »Ich habe schon viel Zeit meines Lebens in St. Paul’s verbracht und irgendwann gelernt, dass es nirgendwo schadet, die Hintertüren zu kennen«, erklärte er vage.
»Euer Buch!«, rief Nicholas unvermittelt und deutete auf die leeren Hände des Mannes.
Dieser zuckte bedauernd mit den Schultern. »Musste ich leider einem besonders eifrigen Verfolger zwischen die Beine werfen.«
»Das – das tut mir leid.« Schuldbewusst senkte Nicholas den Blick.
»Nicht der Rede wert«, winkte der Mann ab. »Es war ohnehin keine sonderlich wertvolle Ausgabe. So hatte es zumindest einen gewissen praktischen Nutzen.«
»Danke jedenfalls«, murmelte Nicholas gepresst. Er war grundsätzlich niemandem gerne zu Dank verpflichtet, schon gar keinem Fremden. »Professor«, bemühte er sich dennoch um eine höfliche Anrede.
»Doktor genügt. Doktor John Dee.«
Nicholas’ Kinnlade klappte nach unten.
»Deinem Gesichtsausdruck nach zu urteilen, hast du schon von mir gehört.«
Jeder im Königreich hatte das. Dr. Dee, der Magus von Mortlake. Alchemist, Astronom und Astrologe, Mathematiker und Philosoph. Er hatte seinerzeit in die Sterne geschaut und den günstigsten Tag für die Krönung Elisabeths berechnet. Ein Tag, der ihr eine lange und glorreiche Herrschaft garantieren sollte. Die Königin zählte ihn zu ihren engsten Ratgebern und doch verstummten die Gerüchte nicht, dass er mit finsteren Mächten im Bunde stand.
Nicholas machte den Mund wieder zu und nickte. Dr. Dee lächelte nachsichtig.