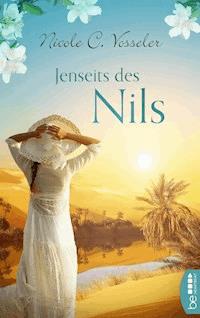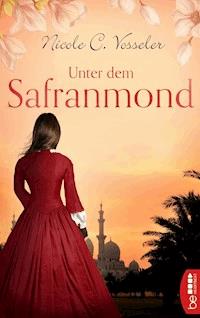5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Märchen wie aus Tausendundeiner Nacht - nach einer wahren Geschichte
Sansibar, Mitte des 19. Jahrhunderts. Die Luft erfüllt vom Duft der Blüten und Gewürze, endlose Tage in herrlichen Gärten und prunkvollen Gemächern, umsorgt und geliebt von der Familie - Salimas Leben im Palast könnte schöner nicht sein. Doch die unbeschwerten Jahre der Tochter des Sultans von Sansibar finden ein jähes Ende, als ihre Eltern sterben und Salima umziehen muss - in die direkte Nachbarschaft des deutschen Kaufmanns Heinrich.
Die beiden verlieben sich, und schon bald wird die junge Frau schwanger. Für eine muslimische Prinzessin ist ein uneheliches Kind undenkbar, einen Ungläubigen zu heiraten kommt allerdings auch nicht infrage. So bleibt als Ausweg nur die Flucht nach Hamburg, in Heinrichs Heimat. Doch was erwartet Salima in dem kalten, fremden Land?
Dieser farbenprächtige Roman erzählt das außergewöhnliche Leben von Salima bint Said (der späteren Emily Ruete) und spannt den Bogen von einer sorglosen Kindheit auf der Gewürzinsel Sansibar bis in die Hansestadt Hamburg - und darüber hinaus. Ein wechselvolles Leben, mal abenteuerlich, oft tragisch und im Spannungsfeld von zwei Kulturen, zwei Religionen, zwei Welten.
Eine Geschichte über die Bedeutung von Heimat und Herkunft, über Entwurzelung und den Machtkampf kolonialer Interessen - und mit einer unvergesslichen Heldin.
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 612
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titel
Über dieses Buch
Über die Autorin
Impressum
Widmung
Aufbruch
Erstes Buch: Salima
Ein Zweiglein am Baume
1
2
3
4
Wildwuchs
5
6
7
8
9
Der Ast gabelt sich
10
11
12
13
14
15
Zweites Buch: Bibi Salmé
Verpflanzt
16
17
18
19
20
Ein Garten aus Gewürznelken und Rosen
21
22
23
24
25
Entwurzelt
26
27
28
29
30
Niemandsland
31
32
33
34
35
36
Drittes Buch: Emily
Neuland
37
38
39
In der Fremde
40
41
42
43
44
45
Im Abgrund
46
47
48
49
50
51
Viertes Buch: Frau Ruete oder Die Prinzessin von Sansibar
Nomadenjahre
52
53
54
55
56
Die versunkene Welt
57
58
59
60
61
62
63
Heimatlos
64
65
66
67
68
69
Ankunft
Nachwort
Personenverzeichnis
Über dieses Buch
Ein Märchen wie aus Tausendundeiner Nacht – nach einer wahren Geschichte
Sansibar, Mitte des 19. Jahrhunderts. Die Luft erfüllt vom Duft der Blüten und Gewürze, endlose Tage in herrlichen Gärten und prunkvollen Gemächern, umsorgt und geliebt von der Familie – Salimas Leben im Palast könnte schöner nicht sein. Doch die unbeschwerten Jahre der Tochter des Sultans von Sansibar finden ein jähes Ende, als ihre Eltern sterben und Salima umziehen muss – in die direkte Nachbarschaft des deutschen Kaufmanns Heinrich. Die beiden verlieben sich, und schon bald wird die junge Frau schwanger. Für eine muslimische Prinzessin ist ein uneheliches Kind undenkbar, einen Ungläubigen zu heiraten kommt allerdings auch nicht infrage. So bleibt als Ausweg nur die Flucht nach Hamburg, in Heinrichs Heimat. Doch was erwartet Salima in dem kalten, fremden Land?
Dieser farbenprächtige Roman erzählt das außergewöhnliche Leben von Salima bint Said (der späteren Emily Ruete) und spannt den Bogen von einer sorglosen Kindheit auf der Gewürzinsel Sansibar bis in die Hansestadt Hamburg – und darüber hinaus. Ein wechselvolles Leben, mal abenteuerlich, oft tragisch und im Spannungsfeld von zwei Kulturen, zwei Religionen, zwei Welten.
Eine Geschichte über die Bedeutung von Heimat und Herkunft, über Entwurzelung und den Machtkampf kolonialer Interessen – und mit einer unvergesslichen Heldin.
Über die Autorin
Nicole C. Vosseler wurde 1972 in Villingen-Schwenningen geboren und studierte nach dem Abitur Literaturwissenschaft und Psychologie in Tübingen und Konstanz, wo sie heute lebt. 2007 wurde die SPIEGEL-Bestsellerautorin für ihren Roman »Der Himmel über Darjeeling« mit dem Konstanzer Förderpreis in der Sparte »Literatur« ausgezeichnet. Ihre Bücher wurden bisher in acht Sprachen übersetzt. Wie die Heldinnen ihrer farbenprächtigen Romane sucht auch sie gerne mal das Abenteuer.
Mehr über die Autorin und Hintergrundinformationen zu ihren Romanen finden Sie unter: https://www.nicole-vosseler.de/
Nicole C. Vosseler
SterneüberSansibar
beHEARTBEAT
Digitale Neuausgabe
»be« – Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Copyright © 2010/2018 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Monika Hofko, Scripta Literatur-Studio München
Umschlaggestaltung: Guter Punkt, München | www.guter-punkt.de unter Verwendung von Motiven © thinkstock: tonyoquias; © shutterstock: Olesia Grachova | Andrushko; © The-hungry-JPEG
E-Book-Produktion: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN 978-3-7325-5913-8
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Jede Zeit hat ihre eigenen Schicksale.
SPRICHWORT AUS SANSIBAR
Der Sehnsucht meiner Mutter gewidmet
Aufbruch
Jena, Februar 1924
Wenn nun die Ebbe kommt – ist’s dann nicht Zeit Für jene in der Fremde, wieder heimwärts zu zieh’n? Dacht’ ich und konnt’ nicht aufhalten den Tränenstrom, entfesselt von Dingen, die verschlossen in meiner Brust; So manch ein Haus, das auseinanderbrach, und Harmonie ward gestört, die wiederkehrte unversehrt; So die Zeit stets den Wandel bewirkt und Menschen treibt hindurch zwischen Dürre und Regen.
DI’BIL VON AZD
Es würde ihre letzte Reise sein.
Die letzte von so vielen.
Einmal mehr ein Aufbruch ins Unbekannte. Einmal mehr alles hinter sich lassen, zerrissen zwischen dem, was zurückblieb, und dem, was auf sie wartete.
Dieses Mal würde sie mit leichtem Gepäck reisen. Nichts nahm sie mit: keinen Koffer und keine Hutschachtel, keinen Geldbeutel; keine Reue, keine Sorge und keine Furcht. Nur die Hoffnung auf ein Wiedersehen. Irgendwann.
Um ihre Kinder war ihr nicht bang. Sie konnte sie hören, unten im Haus, wo sie zusammengekommen waren, um Abschied zu nehmen. Wände und Türen dämmten ihre ohnehin behutsamen Schritte, dämpften ihre Stimmen zu einem Murmeln, dunkel vor Besorgnis und Kummer.
Schon lange bedurften sie ihrer nicht mehr. Wie die Zugvögel waren sie einst ausgeschwärmt in die Welt, ehe sie in der Liebe zu ihren eigenen Kindern starke Wurzeln geschlagen hatten. In Hamburg. In London. Hier in Jena.
Zu Hause, endlich. Zu Ende die Rastlosigkeit, die sie mit ihrer Milch aufgesogen hatten.
Nach Hause, endlich. Ihre rissigen Lippen, vom Alter unberührt, aber vom Leben mit einem wissenden, fast spöttischen Zug versehen, verbreiterten sich zu einem blinden Lächeln.
Endlich Frieden finden. Endlich heimkehren.
Sie war müde. Schon lange hatte sie sich zerschlissen gefühlt, wie ein Kleidungsstück, das zu lange am Leib getragen worden war, dem beständigen Nagen der Elemente schutzlos ausgesetzt. Ausgewaschen von der Zeit waren ihre einstmals kräftigen dunklen Farben: das Haar schon lange weiß und brüchig. Durchscheinend fast, wie von der Sonne gebleichtes Gras. Die Haut aschen und welk, die früher glänzende Iris der Augen matt.
Sie war der Kämpfe überdrüssig, an deren Ende sie sich hatte geschlagen geben müssen. Erschöpft von einem Leben, das ein so anderes gewesen, als ihr in die Wiege gelegt worden war. Nicht das gehalten hatte, was es einst versprach.
Reich war es dennoch gewesen. An Jahren. An Wendepunkten, Abschieden und Neuanfängen. Reich an Freud und Leid und reich an Liebe. Das vor allem.
Ihre Sehnsucht galt nicht mehr denen, die sie zurückließ. Sondern jenen, die vorausgegangen waren.
Ich bin bereit.
Allein, ihr Leib wollte sie nicht gehen lassen, gefangen im Spalt zwischen Leben und Tod. Derselbe Leib, der immer voller Kraft gewesen war und biegsam wie ein gesunder Baum, von keinem noch so heftigen Sturm in die Knie gezwungen. Der erst spät unter dem unerbittlich fauchenden Wind der Jahre spröde und zerbrechlich geworden war. Dem jeder Atemzug Mühe bereitete und der sich dennoch weiterhin einen nach dem anderen abrang, pfeifend und rasselnd. Für den quälenden Husten, der ihre Tage zuletzt begleitet hatte, war sie zu schwach geworden. Bitter hatte er geschmeckt; bitter wie die Enttäuschung, die dieses Land ihr bereitet hatte.
Unruhig tänzelten ihre knotigen, braun gefleckten Greisinnenhände über das Leintuch. Vertraut war ihr dieser Raum, und doch war er nicht mehr der ihre geworden. Ein geborgter Raum. Geborgt die letzten Jahre. Ein Kredit, dessen Zinsen nun fällig wurden, in einer neuen Zeit, die sie nicht mehr verstand.
Was bleibt am Ende eines Lebens?
Schritte näherten sich, sanft und vorsichtig; Flüsterstimmen. Kamen sie zu ihr? Sie wollte sich ihnen zuwenden, wollte etwas sagen – sorgt euch nicht, ich leide keine allzu großen Schmerzen, lebt wohl –, doch es gelang ihr nicht mehr. Das Fieber hatte sie bereits zu weit fortgetragen, in ein Reich jenseits von Zeit und Raum.
Stimmt das, hörte sie unter dem Trappeln von Kinderschuhen ein Stimmchen rufen, kieksig vor Aufregung. Stimmt es, was die anderen Kinder sagen? Und ein zweites, ein drittes bat atemlos: Erzähl, Mutter, erzähl!
Sie hatte es ihnen erzählt, wieder und wieder, das Märchen, das ihr Leben einmal gewesen war. Wenn sie selbst es auch nie als ein Märchen empfand, bis heute nicht.
Manches davon hatte sie niedergeschrieben. Erlebtes, Empfundenes und Gedachtes. Gehörtes und Gelesenes, sich zu eigen gemacht. Niedergeschrieben für ihre Kinder, für die Welt, für sich selbst. Und doch war es längst nicht alles gewesen; so vieles, was ungesagt blieb.
Worte, nichts als Worte. Wie konnten Worte auch nur annähernd vermitteln, was hinter ihr lag? Noch dazu in einer Sprache, in der sie zwar denken und träumen gelernt hatte, die ihr aber immer fremd geblieben war. Umso mehr, als es Dinge gab in einem Menschenleben, die sich nur unvollkommen in Worte fassen ließen. In jeder Sprache.
Liebe. Einsamkeit. Der Tod geliebter Menschen. Sehnsucht. Heimweh.
Zayn z’al barr, raunte es in ihr, schön ist dieses Land. Land der Schwarzen – Zanjbar. Sansibar. Laute wie das Hauchen des Meeres. Wie das Rauschen des Windes, wenn er durch die Palmwälder strich und ihre gefiederten Kronen aneinanderrieb. Ssschhh … ssschhh … ssschh … Aufwallend und abebbend und allgegenwärtig, mit jedem Atemzug. Tröstlich wie das Flüstern ihrer Mutter. Ssschhh.
Unter den Klagelauten der Muezzins pulsierten die Trommeln Afrikas. Tha-dhung-gung. Tha-dhung. Der Herzschlag der Insel. Ihr eigener Herzschlag. Heimat. El-Watan. Nyumbani.
Tränen rannen unter ihren geschlossenen Lidern hervor, brannten in den Furchen der alterstrockenen Haut. Nach Hause … Das Meer brandete in ihr auf und rief sie zu sich, lockend und beschwörend.
Komm nach Hause, Salima. Komm, Salima, komm … Salima …
Ssschh, Salima.
Komm.
Erstes BuchSalima
1851 – 1859
Ein Zweiglein am Baume
Von meinen Zweigen strömt das Nass,dessen Name Millionen Herzen höher schlagen lässt.
AUS DEM OMAN
1
»Salima! Wirst du wohl hierbleiben! Salima!!«
Salimas bloße Füßchen prasselten in schnellem Lauf über den Steinboden. In ihren Armen und Beinen kribbelte es wohlig; ihr ganzer siebenjähriger Leib jauchzte vor Freude, dem Stillsitzen entronnen zu sein.
»Salima!«
Sie flitzte zwischen den verwitterten Säulen hindurch, hinein in das Gras, das noch feucht war vom morgendlichen Regenguss. Ihr Herz schlug im gleichen übersprudelnden Takt wie die Goldmünzen an den Enden der zahllosen Flechtzöpfchen, die aneinanderklimperten und munter über ihren Rücken tanzten. Leicht und hell schlug es wie die Glöckchen an den Säumen der schmalen Hosen und des knöchellangen Gewandes darüber. Du-kriegst-mich-nicht, sang es in ihr im Rhythmus ihres Atems, du-kriegst-mich-nicht.
»Salima!« Die Stimme der Lehrerin hinter ihr kippte von zorniger Strenge in eine hilflose Klage. »Metle? Ralub …«
Ein rascher Blick über die Schulter verriet ihr, dass ihre Halbschwester Metle sie auf ihren längeren Beinen schon fast eingeholt hatte, während deren Bruder Ralub auf seinen kurzen, stämmigen Beinchen Mühe hatte, mit den beiden Mädchen mitzuhalten. Unverdrossen jedoch trommelte er damit über die Erde, die kahler wurde, je weiter sie rannten, hart gebacken von der Sonne und heiß unter ihren Sohlen. Auf Salimas Gesichtchen breitete sich ein Strahlen aus, das mit der Sonne über ihr wetteiferte; aufs Köstliche mischte sich in ihr der Triumph über die Lehrerin mit überbordender Zuneigung für ihre treuen Geschwister und gipfelte in einem Gefühl der Unbesiegbarkeit.
Wir. Zusammen. Sie kann uns nichts. Keiner kann uns was!
Ein kurzer Augenblick – kaum mehr als ein Wimpernschlag –, in dem die drei Kinder sich ansahen und dann wie auf Geheiß in Gelächter ausbrachen, übermütig und voller Schabernack. Ihr Lachen sprudelte über die Ebene hinweg, flog zum blauen Himmel hinauf und verlieh ihnen Flügel.
Eine Pfauenhenne plusterte ihr braunes Gefieder auf und scheuchte mit aufgeregten Trippelschritten ihre Küken vor sich her, um ihre flaumige Brut vor den heranstürmenden, lärmenden Kindern zu schützen. Salima, Metle und Ralub jedoch rannten unbeirrt auf die Badehäuser zu, die das äußerste Ende der Palastanlage von Beit il Mtoni bildeten. Die Orangenbäume, die die aschrosa Fassaden unter ihren staubbraunen Walmdächern in dichten Reihen säumten, waren ihr Ziel.
Eingehüllt in den honigsüßen Duft der weißen Blüten und außer Atem, schlängelten sie sich zwischen den glattborkigen Stämmen hindurch, bis sie ihren Lieblingsbaum erreicht hatten: ein besonders altes, ausladendes Exemplar, dessen unterste Zweige unter ihrer goldkugeligen Last beinahe den Boden berührten. Wie üblich war es Salima, die als Erste den Fuß in die Gabelung des Stammes setzte und sich behände wie ein Äffchen im schattigen Geäst emporhangelte, dicht gefolgt von Metle, die immer wieder innehielt, um Ralub eine helfende Hand entgegenzustrecken.
»Dafür bekommen wir bestimmt doppelt Haue«, schnaufte Metle, als sie rittlings auf einem Ast zu sitzen kam.
»Nicht wir«, widersprach Ralub in der ihm so eigenen Gemütsruhe. Sein rundliches Hinterteil hatte er bequem in einer Astgabel platziert; er baumelte mit den nackten Beinen unter dem bis an die Knie hochgezogenen Gewand und war schon dabei, die erste Orange zu schälen. »Nur Salima. Die Hiebe, die sie fürs Schwatzen hätte kriegen sollen, und noch welche fürs Weglaufen. Wir höchstens ein, zwei dafür, dass wir ihr nach sind.« Die Schalenstücke ließ er achtlos fallen, bohrte den Daumen in die safttriefende Frucht, um sie in grobe Stücke zu reißen, und stopfte sich den Mund voll.
»Pah«, machte Salima auf ihrem Ast, verschränkte die Arme und blies sich die Ponyfransen aus der erhitzten Stirn. »Das wagt sie nicht! Sonst sag ich’s Vater!«
»Vater besteht darauf, dass wir Lehrerinnen, Erziehern und allen Dienern stets Gehorsam und Respekt zollen.« Metles Worte klangen, als zitiere sie aus einem Lehrbuch.
»Genauso wichtig findet er Gerechtigkeit – und das war einfach nicht gerecht von ihr«, sagte Salima trotzig. »Wenn mich Azina was fragt – soll ich dann so tun, als wär ich taub und stumm? Und die Lehrerin weiß doch, dass ich diese Sure auswendig kann; viermal hat sie uns die schon hersagen lassen. Mich dann trotzdem nach vorn zu befehlen und den Stock zu erheben – das ist so ungerecht! Immer hat sie’s auf mich abgesehen …« Salima redete sich immer weiter in Wut, bis ihre Wangen sich röteten und ihre dunklen Augen funkelten.
Die Schule, in die sie seit dem vergangenen Jahr ging, war ihr zutiefst verhasst. Den ganzen Vormittag mit untergeschlagenen Beinen auszuharren, wie auf den weißen Bodenmatten festgewachsen, schweigend zuzuhören und nur zu reden, wenn sie dazu aufgefordert wurde, das bedeutete für Salima ungleich größere Pein als der Stock. Die paar Streiche mit dem Bambusrohr gingen schnell vorüber, doch was danach kam, versprach doppelte Folter: auf dem brennenden Hinterteil den Rest der Schulstunde weiterhin reglos abzusitzen. Und weil Salima keine halben Sachen machte, hatte sie einmal mehr die Gelegenheit beim Schopf gepackt und einfach die Beine in die Hand genommen.
»Wenn Vater hört, dass sie uns nicht im Zaum hat, schickt er sie bestimmt zurück in den Oman.« Metles feine Züge verzogen sich kummervoll. »Dann entlässt er sie womöglich ganz aus seinen Diensten, und dann weiß sie nicht, wie sie ihr Brot verdienen soll. Und wir sind schuld.«
»Geschieht ihr recht!«, grollte Salima und pendelte zornig mit den Beinen. »Deshalb ist sie bestimmt auch so gemein. Sie hält sich für was Besseres, weil sie aus dem Oman kommt und von rein arabischem Blut ist.« Sie schnaufte wütend auf und kickte so heftig in das Blattwerk, dass sich eine Orange von ihrem Stängel löste, durch das ledrige Laub rauschte und mit einem satten Thunk! auf dem Boden aufschlug.
Ralubs Augen, die während dieses Wortwechsels beständig zwischen Salima und Metle hin und her gewandert waren, folgten betrübt der verschwundenen Orange, bevor er sich kurz über die klebrigen Finger leckte und dann die nächste abzupfte, wobei er sich sichtlich unwillig danach strecken musste.
»Nachher hast du wieder Bauchweh«, schalt Metle ihn, doch Ralub zuckte nur die Achseln, pellte die Frucht und schob sich den nächsten Brocken tropfenden Fruchtfleisches in den Mund. Erst dann setzte er zu einer Erwiderung an, doch Metle kam ihm zuvor.
»Ssschtt«, machte sie mit großen Augen. »Da kommt wer!«
Die drei spitzten die Ohren. Ralub vergaß für einen Augenblick sogar das Kauen. Von den Badehäusern drangen Laute herüber, vergnügtes Geplansche und Gelächter, eifriges Geschnatter und Gekicher, andächtiges Gebetsgemurmel. Bruchstücke dumpfer Trommelschläge und das dünne Schellengeklingel eines Tamburins, durchwoben von einem mehrstimmigen Frauengesang. Satzfetzen und Wortmelodien in Suaheli, Nubisch, Abessinisch, Türkisch, Persisch, Arabisch, Tscherkessisch, den Sprachen des Palastes und der übrigen Insel. Eine Vielfalt, die sich in den Gesichtern der Menschen spiegelte, die das fein abgestufte Farbenspiel von Sahne und Karamell über Gold- und Olivtöne, Zimt und Kaffeebraun bis hin zum tiefsten Ebenholzschwarz zeigten. Allein wenn der Sultan zugegen war, durfte nur Arabisch gesprochen werden; dies verlangte die stolze Tradition seiner Ahnen.
Das befürchtete Keifen ihrer Lehrerin blieb aus; ebenso das beharrliche Locken eines Leibdieners, vom Vater ausgeschickt, seinen ungehorsamen Nachwuchs aufzuspüren und ihnen die verdiente Standpauke zu halten.
»Da ist keiner«, bekundete Ralub daher auch, spuckte geräuschvoll einen Orangenkern hinab und gleich darauf noch einen.
»He, ihr da oben!«, ertönte eine tiefe Männerstimme unmittelbar unter ihnen.
Die Geschwister sahen sich erschrocken an und machten sich in der Baumkrone so klein wie möglich. Es knackste und raschelte, als kräftige Hände in die Äste griffen und sie auseinanderbogen. Dazwischen erschien erst ein safranfarbener Turban, dann das flächige Gesicht eines grobknochigen, noch sehr jungen Mannes, die Pockennarben auf seinen Wangen nur unzureichend von einem eben erst sprießenden Bart bedeckt. Weiß hoben sich die Zähne gegen seine nussbraune Haut ab, als er breit grinste. »Ich dachte schon, die Stummelaffen hätten über Nacht sprechen gelernt. Wie ich jedoch sehe, sind es nur die Kinder des Sultans, die die Schule schwänzen!«
»Majiiid«, quiekte Salima und konnte nicht schnell genug aus ihrer luftigen Höhe hinabsteigen, bemerkte nicht einmal das Aufjammern Ralubs, als sie ihm dabei unbeabsichtigt einen Tritt versetzte. Das letzte Stück ließ sie sich einfach in die ausgebreiteten Arme ihres älteren Halbbruders fallen und umschlang ihn mit aller Kraft.
Mit einem betont heftigen Keuchen setzte Majid sie ab. »Du bist ja richtig schwer geworden! Ich könnte schwören, du bist seit letzter Woche ein ganzes Stück gewachsen.«
Salima errötete voller Stolz und reckte sich gleich noch ein wenig mehr, während Majid nach Ralubs heldenhaftem Sprung, dessen Landung etwas wacklig geriet, auch Metle Hilfestellung leistete.
»Seit letzter Woche ist noch was passiert – guck!«, rief Salima, bleckte die Zähne und entblößte dabei eine gähnende Lücke in der Mitte ihres Oberkiefers, die ihr ein überaus kesses Aussehen verlieh. Majid bewunderte den ersten ausgefallenen Zahn seiner kleinen Halbschwester gebührend.
»Hat gar nicht wehgetan«, berichtete sie freudestrahlend, legte dann den Kopf in den Nacken, riss den Mund so weit auf wie nur möglich und rubbelte aufgeregt mit der Fingerspitze über die gezackte Kante des neuen Zahns, der gerade hervorbrach. »Ungga gommtffon ger neue!«
»Das muss gefeiert werden«, verkündete Majid mit einem dem Anlass entsprechenden Ernst. »Am besten mit einem Ausritt ans Meer.«
Salima entfuhr ein Freudengeheul, und sie begann wild auf der Stelle umherzuhüpfen. Schon so lange war sie nicht mehr am Strand gewesen, mindestens ein paar Tage nicht, dabei hatten sie das Meer doch gleich vor der Tür! Das letzte Mal, dass sie mit Majid dort gewesen war, lag sogar noch viel länger zurück.
»Ans Me-heer, ans Me-heer«, singsangte sie in einer Phantasiemelodie und tanzte um Metle herum, um sie zum Mitmachen zu bewegen. Vergeblich. Metle fuhr stattdessen damit fort, Orangen von den untersten Zweigen zu pflücken und in ihrem Obergewand zu sammeln, das sie am Saum hochhielt.
»Gibt das unseren Proviant?«, wollte Salima wissen, ihre Stimme kieksig vor lauter Vorfreude.
Metle schüttelte den Kopf so heftig, dass die von Goldschmuck beschwerten Enden ihrer Zöpfchen umherflogen. »Ich komme nicht mit. Die bringe ich Mutter, sie isst sie frisch vom Baum doch so gern, und lese ihr noch etwas vor. Dann wird ihr der Tag auch nicht so lang.« Mit einem Mal wirkte Metle viel älter als ihre neun Jahre, erwachsen beinahe.
Die Mutter von Metle und Ralub war seit einer schweren Krankheit kurz nach der Geburt ihres Sohnes gelähmt. Eigens für sie war zwischen dem Palastflügel der Frauen und dem Flussufer ein Pavillon errichtet worden, wo sie auf ihrem Lager aus Dutzenden von Polstern und Kissen die langen Stunden zwischen dem frühen Morgen und dem späten Abend zubrachte und darauf wartete, dass jemand vorbeikam, der ihr die Zeit vertrieb.
Salimas Jubellaune fiel in sich zusammen, und etwas begann hässlich in der Gegend ihres Brustbeins an ihr zu nagen. Metle war immer so selbstlos, stets darauf bedacht, anderen Gutes zu tun, von Natur aus fügsam und vernünftig. Nicht so wie ich …
»Aber du kommst doch mit?«, wandte sich Salima an Ralub, beinahe bittend.
Den Kopf gesenkt, kämpfte er mit sich, fuhr mit dem großen Zeh über die festgetretene Erde. Es war ihm anzusehen, wie gern er sich Majid und Salima angeschlossen hätte. Doch weil Ralub und Metle unzertrennlich waren wie Zwillinge und er stets dem Beispiel seiner großen Schwester folgte, straffte er sich schließlich tapfer und schüttelte den Kopf. »Ich gehe mit Metle.«
Salima verspürte den brennenden Wunsch, es den beiden gleichzutun und großmütig auf den Ausritt zu verzichten. Nicht um der Gesellschaft der beiden willen, nicht deshalb, weil sich die Mutter von Metle und Ralub gewiss auch über einen Besuch Salimas gefreut hätte, sondern einzig und allein, um ein gutes Mädchen zu sein. Nur ein Mal – ein einziges Mal …
Traurig blickte sie Majid nach, der in Richtung der Stallungen vorausgegangen war, und das Sehnen nach dem Meer, dessen Salz sie schon auf der Zunge zu schmecken glaubte, wurde zu einem Schmerz in ihrem schmalen Leib.
Morgen – morgen kann ich auch noch ein gutes Mädchen sein, durchfuhr es sie, und morgen werd ich’s auch sein! Aber heute – heute muss ich …
»Grüßt eure Mutter lieb von mir!«, rief sie Metle und Ralub über die Schulter hinweg zu, während sie in großen Sprüngen Majid hinterhersetzte, plötzlich wieder ein Jauchzen in ihrer Brust verspürend.
»Ich will auch so ein Pferd«, murmelte Salima hingerissen, nachdem einer der Stallknechte sie in den Sattel gehoben hatte. Behutsam legte sie die Arme um den starken Hals der Stute und drückte ihr Gesicht in das braune Fell, das warm war und auch genauso warm roch.
Majid lachte, als er sich hinter ihr aufschwang und einem zweiten Knecht die Zügel abnahm. »Du hast doch eben erst einen schönen Muskatesel bekommen!«
Wiegenden Schrittes setzte sich das Reittier in Bewegung, und Salima richtete sich wieder auf.
»Ich will aber lieber ein richtiges großes Pferd haben«, beharrte sie, auch wenn sie sich dabei ein bisschen undankbar vorkam. Hatte sie vor zwei Jahren ihre Reitstunden wie alle Kinder des Palastes auf einem Pferd begonnen, das vom Reitlehrer am Zaumzeug im Kreis herumgeführt wurde, hatte sie schon bald allein auf einem lammfrommen, weil fortwährend schläfrigen Esel gesessen und dann auf einem schokoladenfarbenen langbeinigen Muskatesel. Bis ihr Vater ihr vor Kurzem einen makellos milchweißen Muskatesel geschenkt hatte, eine edle Züchtung, die mitsamt dem kostbaren Geschirr ebenso teuer kam wie ein Vollblutaraber.
»Deine Beine sind doch noch viel zu kurz«, neckte Majid sie und zwickte sie leicht in den Oberschenkel, sodass sie aufquietschte. »Wenn du noch ein Stück gewachsen und groß genug bist, schenke ich dir eine von meinen Stuten.«
Salima hielt den Atem an. »Versprochen?«
»Versprochen! Welche Farbe darf es denn für die hochwohlgeborene Sayyida Salima sein?«
»Schwarz«, kam es, ohne zu zögern, genüsslich von ihr. »Schwarz und nichts anderes.«
»Sehr wohl, schwarz also«, gab Majid lachend zurück. »Nie das, was alle anderen Mädchen hübsch finden. Für dich muss es immer etwas ganz Besonderes sein, nicht wahr, Salima?«
Weil Salima nicht wusste, ob das in Majids Augen nun etwas Gutes oder etwas Schlechtes war, zog sie nur verlegen eine Schulter hoch, zwirbelte die Mähne der Stute zwischen den Fingern und blieb für eine Weile still.
Im Schritttempo zogen die Gebäude des Palastes von Beit il Mtoni vorüber: teils noch neu, teils schon in einem mehr oder minder fortgeschrittenen Stadium des Verwitterns begriffen, geweißelt, hellgelb bemalt, noch oder schon wieder in ihrem ursprünglichen, rosig und bläulich überhauchten grauen Stein. Umso üppiger wirkte all das Grün, das die Mauern umwucherte: ausladende Bananenstauden und Tamarinden mit ihrem fedrigen Laub und den wächsernen rotgeäderten Blüten in Hellgelb. Hoch, so hoch wuchs der Hibiskus und stellte seine zarten Blütenteller in Scharlach, Pomeranze und Weiß zur Schau. Minarettgleiche Palmen nickten sacht auf die Walmdächer aus Schilfrohr hinab und beschatteten die weitläufigen Dachterrassen, die Pavillons und die Balkone aus Holz.
Großzügig verteilten sich die verschachtelten Häuser um die weite Freifläche in der Mitte, die mehr einem verwilderten Garten ähnelte denn einem wirklichen Innenhof. Beit il Mtoni glich einer kleinen Stadt, und genauso lebhaft ging es dort auch zu. Von der Früh bis in die Nacht mussten sich alle Hände für die Familie des Sultans regen, und so wimmelte es überall von Menschen. Arabische Tracht mischte sich mit afrikanischer; gemeinsam war ihnen die Farbenpracht: Sittichgrün und Smaragd, Koralle und Mohnrot, Dottergelb, Lilienweiß und Pfauenblau, das Rostbraun und satte Schwarz der Erde Sansibars, oftmals in Mustern, in denen die Fröhlichkeit der Menschen eingefangen schien. Hier war Salima geboren worden, und aus Beit il Mtoni und seiner unmittelbaren Umgebung bestand ihre ganze kleine Welt.
Umso aufgeregter begann sie hoch zu Ross herumzuzappeln, als Majid seine Stute nicht wie erwartet zum Strand hinlenkte, der sich vor dem Palast erstreckte und von dem aus man an klaren Tagen die hügelige Küstenlinie Afrikas sehen konnte, sondern in die entgegengesetzte Richtung, ins verwucherte Innere der Insel hinein.
Erst als sie sich neugierig umsah, bemerkte sie, dass ihnen niemand folgte. Kein Leibdiener zu Pferd, kein Sklave zu Fuß. Ganz allein ritten sie in den Wald hinein, der sie grünschattig umfing.
»Kommt denn niemand mit uns?« Ihr Erstaunen hatte ihr Stimmchen zu einem Flüstern gedämpft.
»Ich bin auch abgehauen«, erwiderte Majid ebenfalls im Flüsterton und zupfte sie an einem ihrer Zöpfchen. »Ich hab doch dich dabei, du wirst schon auf mich achtgeben!«
Salima rang sich ein schiefes Lächeln ab, halb freudiger Stolz, halb Angst. Denn Majid war krank. Sehr krank. Von Zeit zu Zeit stürzte er besinnungslos zu Boden und wurde von heftigen Krämpfen geschüttelt, bis sich die Augen so weit verdrehten, dass nur noch das Weiße zu sehen war. Als habe ein djinn, ein Dämon, von ihm Besitz ergriffen, der ihn erst nach einer gewissen Spanne wieder aus seinen Fängen ließ. Wenn Majid dann zu sich kam, konnte er sich an nichts erinnern; er fühlte sich nur schwach und benommen und musste sich ausruhen. Vor allem dem Vater war dies eine große Sorge, sollte Majid ihm doch eines fernen Tages als Herrscher über Sansibar nachfolgen. Deshalb hatte er verfügt, dass Majid niemals allein gelassen werden dürfe. Wohin er auch ging, was er auch tat – mindestens ein Sklave musste Majid Tag und Nacht begleiten wie ein Schatten, um bei einem neuerlichen Anfall zur Stelle zu sein und zu verhindern, dass Majid sich den Kopf zerschlug oder an seiner eigenen Zunge erstickte. Doch was sollte sie, Salima, in diesem Falle ausrichten können, klein, wie sie war? Hier, im dichten Wald, durch den sie sich immer weiter von Beit il Mtoni entfernten?
Er musste ihren furchtsamen Blick aufgefangen haben, denn er stieß sie mit der Innenseite des Ellenbogens an und setzte hinzu: »Hab keine Angst, Salima. Ich hatte schon eine ganze Zeit keinen Anfall mehr. Mir geht es gut, ich fühle mich stark und gesund.«
Was Salima kaum beruhigte; das unbehagliche Gefühl in ihrer Magengrube blieb. Jedoch nicht lange – dazu gab es viel zu viel Spannendes zu sehen und zu entdecken. Die schwarzweißen Stummelaffen mit ihrem roten Rücken und dem roten Käppchen turnten keifend im Geäst über ihr herum und vertrieben mit ihren lustigen Kapriolen Angst und Sorge aus Salimas Kopf. Irgendwo bearbeitete ein Vogel mit seinem Schnabel so emsig einen Stamm, dass das Klopfen weithin hallte. Ein anderer kreischte laut, und ein dritter keckerte munter vor sich hin. Salima sperrte die Augen auf, so weit sie konnte, um einen Blick auf das gefleckte Fell eines Leoparden zu erhaschen oder vielleicht auf ein Chamäleon, das geschickt getarnt im Blattwerk vor sich hin döste.
Schmal war der ansteigende Pfad durch das Dickicht aus palmenähnlichen Pandanen, Mangobäumen, wilden Kaffeestauden und Pfeffersträuchern, aus hohen Gräsern und wild emporschießendem Gestrüpp. Nur dann und wann tauchte eine einsame Hütte auf. Dem vielen Regen – zu bestimmten Zeiten im Jahr oft tagelang – und noch mehr Sonne war es zu verdanken, dass Sansibar so saftig begrünt war. Was auch immer man der Erde anvertraute, schlug sofort Wurzeln, wuchs rasch und stark und trug reichlich Früchte. Es hieß sogar, aus einem Stück gerollter und getrockneter Zimtrinde, das man in der Stadt von Sansibar in den Boden steckte, würde im Nu ein neuer Setzling.
Schon von Weitem war der strenge Geruch der Gewürznelken-Plantagen wahrzunehmen, schwer und würzig, betäubend nahezu, darunter eine holzige Schärfe. Wie dicker dunkler Samt lag er in der Luft, umso kräftiger, je weiter der Weg anstieg, wurde mit einem Mal atemberaubend, als sich vor ihnen eine breite Schneise öffnete. So weit das Auge sehen konnte, reihten sich Bäume auf, deren glänzendes Laub fast bis zur Erde reichte. Auf dreibeinigen, sich nach oben verjüngenden Holzgestellen kletterten tiefschwarze Männer herum, bis in die Wipfel hinauf; einige von ihnen winkten ihnen zu, riefen: »Shikamoo, shikamoo, guten Tag, guten Tag!«
Es waren die Sklaven, die die Trauben von gelbgrünen bis weißrosa Knospen von den Zweigen pflückten. In der Sonne getrocknet, wurden sie zu harten braunen Köpfchen, die in einer vierzackigen Fassung auf einem Rest Stängel saßen. Sie sahen aus wie die Nägel aus Messing, die in Beit il Mtoni die Truhen aus edlem Holz zusammenhielten und schmückten. Gewürznelken waren der Reichtum von Sansibar, und ihr kräftiges Aroma war der Duft der Insel.
Wie anders war es, mit Majid allein hierherzukommen! Abenteuerlicher. Ungezähmter. Nicht mit einem ganzen Tross aus dem Palast, begleitet von einer Schar Dienerinnen und Sklaven, die mit einem Schirm in der Hand neben den herausgeputzten Rössern der Frauen des Sultans einherliefen, damit diese vor der Sonne geschützt blieben. Nicht mit Packeseln, die Teppiche, Kissen, Fächer und Geschirr mit sich führten, damit der Hausstand von Beit il Mtoni später beim Picknick bequem und vor allem standesgemäß lagern, die vorausgeschickten feinen Speisen genießen und sich an der Kunst der indischen Musiker und Tänzer erfreuen konnte.
Überhaupt, befand Salima einmal mehr, war Majid der beste große Bruder, den sie sich wünschen könnte. Nicht so wie Barghash, mit seinen vierzehn Jahren etwas jünger als Majid, der keinen Spaß verstand und nichts anzufangen wusste mit kleinen Kindern, der schnell die Geduld verlor und dann unwirsch sein konnte. So lieb sie Metle und Ralub hatte – mit Majid verband sie etwas Besonderes. Hatten nicht schon ihre Mütter sich als Schwestern betrachtet, und das nicht nur aufgrund ihrer Herkunft? Bei Majid hatte Salima immer das Gefühl, er habe nicht vergessen, wie es war, Kind zu sein; manchmal schien es gar, als verstünde er sie ohne Worte. Ob es daran lag, dass sie beide tscherkessisches Blut in den Adern hatten?
»Gleich sind wir da«, raunte Majid in ihre Gedanken hinein. Die Plantagen hatten sie hinter sich gelassen; auf dem sanft abfallenden Grund wechselten sich gartenumsäumte Dörfchen mit Reisfeldern und Getreideäckern ab, deren Halme der Wind zärtlich durchkämmte. Die einsamen Palmen bündelten sich zu Hainen, verdichteten sich zu einer Mauer, die Majids Stute gleichwohl Zugang gewährte. Der Nelkenduft war verweht; nun tränkte das Salz des Meeres die Luft und ließ Salimas Herz höher schlagen, und auch das Pferd unter ihr schnaubte – wohlig, wie es Salima vorkam.
»Halt dich fest!«, rief Majid. Folgsam krallte Salima ihre Finger in die Mähne, während Majid mit der einen Hand die Zügel fester packte und mit dem anderen Arm den Leib seiner kleinen Schwester umschlang, sie an sich drückte und sicher barg. Salima spürte, wie die Stute unruhig ihre Muskeln anspannte. Majid schnalzte kräftig mit der Zunge, und sie brachen durch den Palmengürtel hindurch, hinaus in den hellen Sand, blendend im Sonnenlicht, das auf der türkisblauen Fläche des Meeres funkelte.
Ein Jubelschrei entfuhr Salima, ging in ein freudiges Kreischen über, als das Pferd lospreschte und in einem lang gezogenen Bogen über den Strand, dann im Galopp die bewegte, schaumgekrönte Wasserlinie hinaufjagte. Eine Schar Wasservögel flog in einer Explosion aus schwarz-weißem Flügelflattern auf und zog dann unter entrüstetem Geschrei enge Kreise über ihnen. Die Hufe des Pferdes ließen pulvrige Fontänen aufstieben, als sie schneller und immer schneller in den Sand donnerten.
Mehr, mehr, ich will mehr!
Majids rhythmische Rufe, um sein Tier noch weiter anzutreiben, bekamen ein Echo aus Salimas Kehle, bis der Wind ihr die Laute aus dem Mund rupfte und ihr den Atem raubte.
Ich kann fliegen! Ich kann wahrhaftig fliegen!
Das Bedauern, als irgendwann doch die Hufschläge langsamer wurden, gedämpfter, währte bei Salima nicht lange.
»Lass mich runter«, drängte sie, noch ehe Majid die Stute, die prustend ihren Kopf schüttelte, zum Stehen gebracht hatte. »Lass mich runter, Majid, ich will ins Wasser!« Ihre Füße zuckten; alles an ihr schien zu vibrieren. »Majid!!«
»Gemach, meine Gebieterin, gemach«, sagte Majid lachend, sprang dann aber doch eilends ab und hob seine Schwester aus dem Sattel.
Salima rannte mit rudernden Armen los; hinein in das laue Nass, das zuerst an den Zehen leckte, dann an den Knöcheln, an den Waden kitzelte, immer mehr Widerstand bot, bis Salima sich einfach fallen lassen konnte. Gegen die Wucht der Wellen anzupaddeln oder sich von ihnen schaukeln zu lassen, das liebte Salima, seit sie als ganz kleines Mädchen am Strand vor Beit il Mtoni das erste Mal baden gewesen war.
»Delphine«, schleuderte sie Majid über die Schulter hinweg zu, »schau doch – Delphine!« Ihr ausgestreckter Finger war auf die schlanken bleigrauen Leiber mit der sichelförmigen Rückenflosse gerichtet, die glänzend aus den Fluten auftauchten und wieder hineinglitten. Salimas Entzücken war grenzenlos, und in großen Sätzen tollte sie ins Wasser hinein in der Hoffnung, nah genug hinschwimmen zu können. Ihre Augen leuchteten, ließen die Delphine nicht aus dem Blick, erfassten dann die weißen Segel mehrerer Schiffe, die sich am Horizont der weiten Fläche aus geschmolzenem Aquamarin und Lapislazuli entlangschoben.
Ein Gedanke keimte in ihr auf, trieb zu einer Frage aus. Ihre Nasenwurzel kräuselte sich in angestrengtem Überlegen, während ihre Beine unaufhörlich weitermarschierten. Doch dieser einen Frage folgten weitere, zogen mehr Gedanken nach sich und überwältigten sie schließlich in ihrer Fülle, sodass Salima aus dem Takt kam und stehenbleiben musste.
»Was ist, Salima?«, rief Majid hinter ihr, doch sie konnte nur stumm mit dem Kopf schütteln, schaffte es mit Müh und Not, einige Schritte rückwärts zu tapsen, bis sie wieder festen Grund unter dem Boden hatte, nicht nur Sandflächen, die das Meer nach und nach unter ihren Sohlen wegspülte.
Flaches zweitaktiges Rauschen in ihrem Rücken verriet ihr, dass Majid seine Sandalen abgestreift hatte und zu ihr hereinwatete.
»Was hast du gesehen?« Majid ergriff die Hand, die sie ihm entgegengestreckt hatte, ohne den Blick vom Horizont abzuwenden.
»Wo fahren die Schiffe hin?« Ihre Stimme klang tief vor Anspannung. »Was ist auf der anderen Seite vom Meer?«
Majid schloss die Hand fester um die Kinderfinger, beugte sich vor, sein Gesicht dicht an ihrem, und legte ihr den anderen Arm auf die Schulter, um mit seinem Zeigefinger Linien auf Meer und Himmel zu malen. »Hier vorn, da ist Pemba, das auch zu Sansibar gehört. Und da«, sein Finger deutete nach links, »setzt sich die Küste Afrikas fort, die du von der anderen Seite der Insel her kennst. Mombasa liegt dort, und ein Stück weiter hinauf kommt dann irgendwann Abessinien.«
»Wo Barghashs Mutter herkommt und die von Metle und Ralub?«
Majid bejahte.
»Und dahinter?«
»Liegt das Mittelmeer.«
»Und da dahinter?«
»Europa. Frankreich, Spanien, Portugal und weiter im Norden England.«
England. Von dort stammte ein Service aus Dutzenden von Teilen, das in Beit il Mtoni nie benutzt wurde, weil es aus einem Silber gefertigt war, das in der Luft Sansibars beständig anlief. In Ehren gehalten wurde es gleichwohl; einer der Haussklaven nahm es mehrmals am Tag aus dem Wandregal, um es neu zu polieren. Es handelte sich um ein Geschenk der Königin von England an den Sultan, ebenso wie die geschlossene Kutsche, die hinter dem Stall stand, solange Salima denken konnte, die Eisenräder rostüberkrustet, das Holz vermodert und die Seide, mit der sie ausgeschlagen war, stockfleckig. Auf Sansibar gab es nur zwei Straßen, die breit genug gewesen wären für einen solchen Wagen, und auf diesen kam man nicht sonderlich weit.
»Und da?« Salimas freie Hand tippte geradeaus in die Luft.
»Da kommt Arabien, und da liegt auch der Oman. Dahinter liegen das Osmanische Reich und Russland. Tscherkessien befindet sich auch in dieser Richtung. Und dort drüben«, Majids Finger wanderte ein gutes Stück nach rechts, »geht es dann nach Ostindien.« Aus dem Augenwinkel sah er, wie das kleine Mädchen nachdenklich auf ihrer Unterlippe kaute.
»Warst du schon einmal im Oman?«, kam es schließlich zögernd von ihr. Das Sultanat von Muscat und Oman war die Heimat ihres Vaters; von dort war er einst gekommen, um aus Sansibar das zu machen, was es heute war. Die ältesten seiner Kinder lebten noch dort, die Kinder seiner Geschwister und deren Kinder. Als Majid nickte, setzte sie hinzu: »Wie ist es dort? So wie hier?«
Majid grinste. »Kein bisschen! Nur Sand und Staub und Steine … Wie Sansibar ist es nirgendwo, das sagen alle, die schon etwas gesehen haben von der Welt.« Er hielt kurz inne, bevor er hinzufügte: »Du wirst es mit eigenen Augen sehen, in ein paar Jahren, wenn du einem deiner Vettern dort zur Frau gegeben wirst.«
Salimas Kopf bewegte sich sachte auf und ab, während sie Altbekanntes und neu Gedachtes gegeneinander abwog. Von klein auf hatte sie gehört, dass sie eines Tages in den Oman reisen würde, um dort zu heiraten. Manchmal kamen Vettern oder Basen von dort zu Besuch. Salima mochte die meisten von ihnen nicht. Es machte sie wütend, wenn sie sich mit gerümpfter Nase im Palast umsahen und sich abfällig darüber äußerten, wie »freizügig« es auf Sansibar zuging, wie »afrikanisch« hier doch vieles sei, und wenn sie sich darüber ereiferten, dass die Kinder neben Arabisch auch Suaheli im Mund führten. Doch noch nie hatte sie mit eigenen Augen gesehen, wie weit der Oman von Sansibar entfernt war.
»Aber ich komme danach doch wieder nach Hause zurück, nicht wahr?«, fragte sie ihren Bruder unsicher.
»Nein, Salima, du bleibst dann dort. Nach Sansibar wirst du nur noch zu Besuch reisen.«
Majids Hände legten sich auf ihre Schultern, und zum ersten Mal empfand sie Widerwillen gegen eine Berührung von ihm; schwer kamen ihr seine Finger vor, wie eine Last.
Frank-reich. Spa-ni-en. Por-tu-gal. Wie sieht es dort aus? Ein bisschen so wie hier? Oder ganz anders?
Ein heißes Sehnen wallte in Salima auf, nach etwas, das sie sich nicht einmal vorzustellen vermochte, und zugleich gruben sich ihre Zehen in den wasserbedeckten Sand. Als könnte sie hier Wurzeln schlagen, tief, lang und stark.
Stürmisch fuhr sie herum, schlang die Arme um Majid und vergrub ihr Gesicht an seinem Bauch.
Sehen will ich das alles. Aber nie, nie will ich für immer von Sansibar fortgehen.
Nie.
2
Hellgoldenes Morgenlicht flutete die Frauengemächer von Beit il Mtoni. Der neue Tag roch klar und rein, nach regennassem Laub und nach dem Wasser des Flusses. Noch war er kaum beschwert von der schwülen Süße der Blüten und Gewürze, die allenthalben in der Luft lag, noch hatte die feuchte Wärme sich nicht zu dampfender, lähmender Hitze zusammengebraut.
Still war es in den hohen weiten Räumen, deren dicke Mauern die Tropenglut des Tages fernzuhalten vermochten. Nur tiefe, gleichmäßige Atemzüge waren zu hören und vereinzelt leises Schnarchen. Nebenan huschten die Sklavinnen umher, darauf bedacht, ihre Herrinnen nicht vorzeitig aus dem Schlummer zu reißen, und trafen die Vorbereitungen für die aufwändige Morgentoilette.
Es war die Stunde, in der die sarari, die Nebenfrauen des Sultans, und die älteren Kinder sich noch einmal schlafen gelegt hatten. Viel zu kurz waren die heißen Nächte, viel zu bald – lange vor Sonnenaufgang – erhob man sich schon wieder zu den rituellen Waschungen, um in frischer Kleidung den lang gezogenen Rufen des Muezzins Folge zu leisten. Wer nach dem Gebet weiterer Zwiesprache mit Allah bedurfte, blieb auf, bis sich die gleißende Sonnenscheibe über den Horizont geschoben hatte. Alle anderen zogen es vor, die Spanne bis zum zweiten Aufstehen im Reich der Träume zu verbringen.
Allein Salima war wach. Zu ihren Lebensjahren fehlten ihr noch deren zwei, um mit den Großen mitzubeten, und der Hege ihrer Amme, die sie früher immer in den Schlaf zu wiegen pflegte, war sie längst entwachsen. Bestrebt, ein braves Mädchen zu sein, kniff sie die Augen zu, um noch einmal einzuschlafen. Doch ständig klappten ihre Lider wieder auf. Ganz von selbst.
Sie rollte sich auf die Seite, um die Schätze zu betrachten, die ihr der gestrige Tag beschert hatte und die sie unter schläfrigem Protest auch nicht aus den Händen hatte geben wollen, als man sie zu später Stunde in ihr Bett gesteckt hatte. Vor allem nicht diese eine Kostbarkeit, die das Schönste war, was Salima je besessen hatte: eine Puppe in einem Kleidchen aus engem Oberteil und mehreren glockenförmigen Röcken, über und über mit Rüschen und Spitze verziert, in weißen Strümpfchen und seltsamen geschlossenen Schühchen, deren Material steif war und glänzte, als sei es nass. Ein milchweißes, sich kühl anfühlendes Gesicht hatte diese Puppe, mit einem rosigen Mund, der leicht geöffnet war und je zwei Perlzähnchen oben und unten sehen ließ. Blondhaarig war sie wie Salimas viel ältere Halbschwester Sharifa. Und das Wunderbarste daran: Wenn Salima die Puppe hochnahm und wieder hinlegte, schloss diese nicht nur die meerblauen Augen mit den dichten Wimpern; aus dem weichen Leib, ungefähr da, wo die seidige Schärpe umgebunden war, kam zudem ein gedämpft krähender Laut. »Maahma«, rief die Puppe dann, und Salima wurde jedes Mal die Kehle eng vor Glückseligkeit. Ihr Vater selbst hatte ihr diese Puppe geschenkt, und Salima hatte sich gleich ein Stückchen größer gefühlt ob dieser Auszeichnung vor all den anderen Kindern.
Gewiss, ein Steckenpferd, wie Ralub es bekommen hatte, wäre auch fein gewesen. Oder ein Spielzeuggewehr aus Holz oder eine Eisenbahn aus Metall … Die Puppe in ihrem Arm hatte Salima daran gehindert, sich mit der Kinderschar um den Inhalt der gut zwei Dutzend Kisten zu balgen. Sie dafür jedoch beiseitezulegen, nein, das hatte Salima nicht über sich gebracht; zu groß war ihre Furcht, die Puppe könnte im Getümmel, das im Innenhof herrschte, Schaden nehmen oder verloren gehen, und deshalb hatte sie schweren Herzens nur zugesehen.
Einmal jedes Jahr sandte der Sultan seine Schiffe aus, um Waren in die Welt hinausliefern zu lassen. An Bord befanden sich stets auch Listen dessen, was in den Palästen des Sultans an Gütern benötigt oder begehrt wurde: Stoffe vor allem und Garne. Bänder, Glasperlen, Spangen, Schließen und Knöpfe. Geschirr, Kämme, Bücher, Duftöle und Räucherwerk – und die Uhren aus England und aus Deutschland, nach denen man auf Sansibar ganz verrückt war.
»Meinen Kindern und Frauen nur das Beste!«, lautete die Anordnung des Sultans. Und wehe dem Kapitän, der sich in England, Frankreich, Ostindien oder Amerika Plunder andrehen ließ, den die Kinder mit langen Gesichtern, die sarari mit spitzen Fingern und gerümpfter Nase bedachten! Salima hatte bislang noch nicht herausgefunden, was genau einem Handelsfahrer drohte, der auf diese Weise bei ihrem Vater in Ungnade fiel. Es musste jedoch etwas Furchtbares sein, daran hegte sie keinen Zweifel. Denn das Wort ihres Vaters war Gesetz. Hier auf Sansibar, entlang eines schmalen Streifens an der afrikanischen Küste und im Oman.
Die Ankunft der bestellten Dinge war ein großes Ereignis, das nie ohne Geschrei, Zank und Eifersüchteleien ablief. An Ort und Stelle ließen sich die Frauen, mit Scheren bewaffnet, auf der Erde nieder, um ihren Anteil an den Stoffen von den Ballen abzutrennen, bevor jemand ihnen den streitig machen konnte, und schnitten dabei nicht selten im Eifer des Gefechts gleich mit in die Gewänder, die sie am Leib trugen. Ob jung, ob alt, ob Mann oder Frau, Herrin oder Sklavin: wenn es ums Habenwollen ging, waren sie alle gleich. Und auch bei den Kindern – denen des Sultans und denen seiner Söhne, dem Nachwuchs der Ammen, der mit im Palast lebte, und bei den Sprösslingen der Diener – ging es nicht anders zu. Jedes versuchte, sich das Schönste und Beste herauszupicken unter den Trommeln, Pfeifen und Flöten, unter den Peitschen und Kreiseln, Mundharmonikas und Trompeten; unter den für Kinderhände gemachten Angeln, an deren Schnüren kleine Magneten baumelten, mit denen man metallene, bunt bemalte Fische fangen konnte. Nur gut, dass die Kinder des Sultans sich auf die Paläste der Insel verteilten und die meisten von ihnen in Beit il Sahil lebten – das dachte Salima oft, wenn es etwas Besonderes gab, so wie gestern. Bis sich die Jungen und Mädchen von den leer geräumten Kisten entfernten, die Arme übervoll mit Spielzeug, war für Salima nur eine Ente auf Rollen übrig geblieben, die mit dem Kopf nickte, wenn man sie an einer Schnur hinter sich herzog. Und eine Spieldose, in der winzige Männlein und Weiblein um einen bändergeschmückten Baum Ringelreihen tanzten, wenn man den runden Deckel aufklappte. Eine schrille, unharmonische Melodie ertönte dabei, die Salima grässlich fand und die ihr in den Ohren wehtat. Hübsch fand sie dieses Dingelchen gleichwohl.
Aus Marseille war jenes Schiff gestern gekommen, das hatte Salima im Stimmengewirr aufgeschnappt. Marseille … welch ein verheißungsvoller Name! Er klang nach der lockenden Ferne und zerging auf der Zunge! Eine Stadt, die so genannt wurde, konnte nichts anderes sein als ein Hort der Pracht und Herrlichkeit! Zumal wenn es dort derart Wunderbares zu kaufen gab wie diese Puppe …
Khalid, einer ihrer erwachsenen Halbbrüder, hatte seine vom Vater übernommene Plantage mit dem festungsähnlichen Palast im Inneren der Insel sogar nach dieser Stadt benannt.
Marseille – Laute, die weich durch den Mund flossen und den Rachen hinabtroffen wie Honig. Für Salima schmeckten sie fruchtig wie die sprudelnden Säfte, die ihr Vater von dort kommen ließ und die so herrlich auf der Zunge prickelten. Und süß – Marseille schmeckte süß! Nach zarten Blüten und herbfrischer Minze, nach würzigem Anis und säuerlicher Bergamotte, wie die französischen Bonbons, die sich ihr Vater immer liefern ließ und die er seinen Kindern bei ihren allmorgendlichen Besuchen zuzustecken pflegte.
Unter Salimas Zunge sammelte sich Speichel, und sie musste mehrmals schlucken vor Verlangen. In den Bauch eines Handelsschiffes passte unendlich viel; bestimmt hatten sich unter der Fracht des Seglers auch solche Bonbons befunden …
Auf dem Bauch robbte sie rückwärts über die gesamte Breite des Bettes und ließ sich langsam hinabrutschen, zwischen der Kante der Matratze und den Tüllwolken des Betthimmels hindurch, bis sie den mit weißen Matten bedeckten Fußboden ertasten konnte. Noch war sie zu klein, um die auf ihren gedrechselten Beinen hochgebockten Betten, unter denen bequem noch jemand zu liegen kommen konnte, alleine zu erklimmen. Doch selbst ihre Mutter griff auf die Hilfe einer Sklavin oder auf einen Rohrstuhl zurück, um auf das ihre zu gelangen – ein Stuhl, den man umtriebigen Kindern nicht gestattete, um sicherzugehen, dass sie in ihren Betten blieben. Kindern wie Salima, die nun nicht wenig stolz war, die Erwachsenen ausgetrickst zu haben.
Dem triumphierenden Kichern, das in ihrer Kehle kribbelte, gab sie dennoch nicht nach; barfuß huschte sie durch den Raum, am Bett ihrer Mutter vorbei. Salima reckte den Hals. Hinter dem feinmaschigen Gewebe konnte sie den hochgewachsenen, starkknochigen Leib erahnen, der sich doch so weich anfühlte, sah das Haar ihrer Mutter hervorschimmern: ein mehrere Ellen langer, armdicker Strang pechschwarzer Seide. Einen Atemzug lang rang Salima mit sich, vielleicht doch lieber unter das Netz zu schlüpfen und so lange zu schmeicheln oder zu toben, bis ihre Mutter oder eine Sklavin sie in das Bett hob. Für ein Stündchen der Seligkeit, in der sich Salima an ihre Mutter kuscheln und sie ganz für sich haben konnte. Ehe der Palastflügel der Frauen zum Leben erwachte und andere Kinder und die sarari sie für sich in Anspruch nahmen. Djilfidan, die Tscherkessin, war die angesehenste und beliebteste aller Frauen hier in Beit il Mtoni, das wusste Salima. Kein Tag verging, an dem ihre Mutter nicht an ein Krankenlager gerufen wurde, um aus den Büchern, die sie ihr Eigen nannte, vorzulesen und Trost und Kraft zu spenden; kein Tag, an dem nicht ihre Hilfe bei besonders kniffeligen Handarbeiten benötigt wurde, von denen sie so viel verstand wie keine Zweite, und keiner, an dem niemand ihren Rat suchte oder einfach ein Schwätzchen mit ihr halten wollte.
Die Verlockung, die von den Gedanken an die französischen Bonbons ausging, erwies sich jedoch als übermächtig – Vielleicht bekomme ich eine ganze Handvoll? Oder gar zwei? –, und Salima schlich sich durch die stets offen stehende Tür hinaus.
Im benachbarten Gemach waren die Sklavinnen tätig, nahezu geräuschlos in ihren geschmeidigen Bewegungen. In großen Krügen hatten sie Wasser aus dem Becken im Innenhof heraufgebracht, das Wasser des Mtoni, der mittels eines ausgeklügelten Systems die Palastanlage durchfloss. Bei den Badehäusern mit ihren riesigen Becken beginnend, wässerte der Mtoni Blumen, Sträucher und Bäume, füllte die Tränken der Tiere und die Zisternen der Menschen, bis er sich jenseits der vordersten Palastgebäude ins Meer ergoss. Salima stahl sich an den Sklavinnen vorbei, die damit beschäftigt waren, Jasminöl und Rosenessenz in die Waschkrüge zu träufeln und die Orangenblüten aus den am Abend zuvor mit Moschus beräucherten Kleidungsstücken zu zupfen, die über Nacht zwischen die bestickten Stoffe gelegt worden waren.
Eine Tür weiter sah Salima, wie Adilah, die derzeitige Amme, breitbeinig auf einem Stuhl hockte und ganz darin versunken war, ihren kleinen Sohn zu stillen, der rußbraun war wie sie selbst. Mit ihren nackten Zehen tippte sie dabei in sanftem Rhythmus an die niedrige Wiege, um Abd’ul Aziz, Salimas jüngsten Halbbruder, in den Schlaf zu schaukeln. Durch seine abessinische Mutter von kaum hellerer Hautfarbe als sein Milchbruder, lag der kleine Prinz splitternackt und mit dickem Bäuchlein auf seinen Kissen, augenscheinlich satt, höchst zufrieden und, wie an seinen schweren Lidern und dem herzhaften Gähnen abzulesen war, sehr, sehr müde.
Unbemerkt langte Salima am Ende des Flures an und hopste die Treppe hinab, mit jedem Satz eine Stufe nehmend. Denn wie alle Treppen in Beit il Mtoni war auch diese tückisch durch ihre hohen und unregelmäßigen Stufen, die noch dazu schief ausgetreten und von gefährlichen Einkerbungen und Rissen übersät waren. Salimas gespreizte Finger suchten bei jedem Sprung Halt an der rauen Wand; dem Treppengeländer – obwohl neu – traute sie nicht mehr, seit sein Vorgänger unlängst über Nacht einfach zusammengebrochen war, morsch geworden unter den Jahren in der feuchten, salzgetränkten Luft und dem Fraß von Ungeziefer, das als mahlendes Flüstern zu hören gewesen war. Sie atmete erleichtert auf, als sie unbeschadet unten angelangt war, und flitzte durch den Innenhof.
Feingliedrige Gazellen umstanden eine Raufe und zupften sich ganze Maulvoll an Gräsern und Kräutern heraus. In buntem Durcheinander klaubten Perlhühner, Gänse und Enten die Getreidekörner auf, die eigens für sie ausgeschüttet worden waren. Hochmütig stolzierten weiße Flamingos mit schwarzen Schnäbeln auf ihren strichdünnen Beinen umher, und ein blauschillernder Pfau blickte Salima vorwurfsvoll an, während er prahlerisch seine Schleppe auffächerte. Unwillkürlich suchte Salima mit Blicken den Boden nach mehr oder weniger gut versteckten Eiern ab, wie es den Kindern eine Gewohnheit war. Denn der oberste Koch des Palastes belohnte sie mit Naschwerk, wenn sie ihm welche brachten. Vor allem bei Straußeneiern zeigte er sich großzügig, glich doch das Aufsammeln der riesigen Eier einer Mutprobe, angriffslustig, wie diese Vögel waren und leidenschaftlich mit ihren scharfen Schnäbeln auf mögliche Eierdiebe einhackten. Doch Salima war heute auf Exotischeres aus als auf süße Reiskuchen, klebrige Mandelplätzchen und Stücke weicher halawa aus Sesam, Zucker, Honig und Pistazien.
Sie hatte das Ende der Freifläche erreicht und stürmte in das vorderste Gebäude des Palastes hinein, das unmittelbar am Meer lag. Noch eine gefährliche Treppe hinauf, noch einen Flur entlang, ohne von Leibdienern erwischt zu werden, dann konnte Salima Atem schöpfen. Auf Zehenspitzen tippelte sie durch die Gemächer ihres Vaters, in denen allerhand fremdländisches Mobiliar stand: etwas, das »Sofa« hieß, und mannshohe Schränke mit Türen. Sogar Gemälde, auf denen Menschen abgebildet waren, hingen an den Wänden. Dabei sagte die Lehrerin immer, dass kein guter Gläubiger sich solch frevelhafte Werke je ins Haus holte … Salima schnaubte verächtlich in sich hinein. Das zeigte doch nur einmal mehr, dass die Lehrerin von den wirklich wichtigen Dingen auf der Welt rein gar nichts verstand.
Auf der Türschwelle am Ende des letzten Gemachs blieb sie schließlich stehen.
Es gab keinen schöneren Ort als diesen hier. In ganz Beit il Mtoni nicht, auf ganz Sansibar nicht und auch sonst nirgends auf der Welt, dessen war Salima gewiss. Nichts konnte schöner sein als die bendjle, der gewaltige Vorbau, der weit über den Strand hinausragte, von starken Pfählen im Sand sicher gestützt. Kunstvolles, farbig angestrichenes Schnitzwerk lief um den Balkon, der genug Raum für eine ganze Festgesellschaft geboten hätte, beschattet von einem runden, zeltähnlichen Dach aus Holz, das innen mit Bordüren, Blattranken, Granatäpfeln und Blüten, groß wie Kinderköpfe, bemalt war.
Die vier Tage der Woche, die sich Sayyid Sa’id bin Sultan, Sultan von Sansibar, Muscat und Oman, nicht in seinem Stadtpalast Beit il Sahil aufhielt, war er fast immer auf der bendjle zu finden. Von hier aus konnte man über den Meeresarm hinweg mühelos bis nach Afrika sehen, mit dem aufgestellten Fernrohr sogar weit bis in das Land hinein. Die il Rahmani, das massige Kriegsschiff des Sultans, lag stets in Sichtweite und einsatzbereit vor Anker, umschwärmt von Booten und kleineren Segelschiffen. Rohrstühle für die Besucher des Sultans standen bereit, für des Sultans Hauptfrau Azza bint Sayf beispielsweise, für seine erwachsenen Kinder, mit denen er mehrmals täglich hier Kaffee trank, oder für jeden, der den Sultan um ein Gespräch ersuchte. Wie Salima an diesem Morgen.
Voller Ehrfurcht und zärtlicher Liebe ruhte ihr Blick auf dem Vater, der sie noch nicht bemerkt zu haben schien. Die Hände auf den Rücken des purpurroten Übergewandes gelegt, schritt er in Gedanken versunken auf dem Holzboden der bendjle auf und ab. Ein Bein zog er dabei leicht nach; eine Kugel steckte so tief im Fleisch, dass kein Wundarzt sie hatte herausholen können. Der fortwährende Schmerz, den ihm diese verursachte, stellte eine bleibende Erinnerung an eine jener Schlachten dar, die er in jungen Jahren geschlagen hatte, um sein Reich vor Eindringlingen zu bewahren und seine Herrschaft gegen Rebellen zu schützen. Solange Salima zurückdenken konnte, kannte sie ihn nur mit weißem Bart, doch nichts an ihm wirkte alt oder gar gebrechlich. Groß von Statur, hatte er sich die Spannkraft eines Kriegers bewahrt und strahlte mit jedem Zoll Würde und Macht aus. Sein längliches Gesicht mit den ausgeprägten Wangenknochen und der vornehm gebogenen Nase unter dem rot-gelb gestreiften Turban verriet seine edle Abkunft, und die honigfarbene Haut war noch jugendlich prall. In den großen dunklen Augen standen Güte und Warmherzigkeit; nur wer genau hinsah, konnte die Schatten der Müdigkeit und Anstrengung darunter erkennen.
Als Sultan trug er eine große Bürde, das hatte Djilfidan ihrer Tochter einmal erklärt. Nicht nur, dass er die größten Plantagen auf der Insel besaß, knapp fünfzig an der Zahl, und eigenen Handel trieb; er kümmerte sich darum, dass Güter aus Afrika über Sansibar in die Welt hinaus geschickt wurden und andere Waren von dort zurückkamen, wofür er Zölle eintreiben ließ. Kontakte mit Vertretern fremder Länder mussten gepflegt werden, mit den indischen, arabischen und afrikanischen Händlern der Insel und mit Stammesoberhäuptern vom Kontinent. Galt es, einen Urteilsspruch zu fällen, der zu wichtig war für einen kadi, einen einfachen Richter, oder für einen wali, einen Statthalter des Sultans, saß der Vater selbst zu Gericht. Sayyid Sa’id sorgte für Recht und Ordnung, Frieden und Wohlstand, und das nicht allein in seinen Palästen und Häusern, nicht allein für seine Hauptfrau und die vielen sarari, für die zahlreichen Kinder im Oman und auf Sansibar, von denen Salima viele gar nicht kannte, einige auch nicht mehr kennenlernen würde, weil sie schon gestorben waren, und manche nie anders gesehen hatte als vollständig ergraut. Nein, das Gedeihen der gesamten Insel und des dazugehörigen Stückchens Afrika ruhte in seinen Händen. Ebenso wie die Geschicke des Oman, wenn dort auch sein drittältester Sohn Thuwaini als wali des Vaters tätig war.
Zudem war das Sultanat von Muscat und Oman im Südosten der Arabischen Halbinsel ständig von den Persern bedroht. Wie schon zu Zeiten Ahmad ibn Sa’ids, der vor hundert Jahren die Dynastie der Al Bu Sa’id gründete, die Sultan Sayyid Sa’id zur höchsten Blüte geführt hatte und an deren Stammbaum Salima ein noch so junger Trieb war. Dennoch hatte der Vater für jeden Bittsteller ein offenes Ohr, für jeden, der den Rat oder den Segen des Herrschers benötigte, für arme Verwandte, die eigens aus dem Oman anreisten, um den reichen Vetter um Geld zu bitten. Und er war sich auch nicht zu fein, sich allein auf einem seiner Pferde auf die Hochzeit eines besonders verdienten Sklaven zu begeben, um dem frisch getrauten Paar seine Glückwünsche auszusprechen.
»Aguz«, rief er verblüfft aus, als er seine kleine Tochter wahrnahm. »Guten Morgen! Was machst du denn schon so früh hier?«
Aguz, »Alte«, das war sein Kosename für Salima, weil sie bis heute eine Vorliebe für die Suppe aus Milch, Reismehl, Zucker und Vanille besaß, die sonst nur Säuglinge als Beikost zur Muttermilch bekamen – und zahnlose Greise.
»Guten Morgen«, piepste Salima und fügte die offizielle Anrede hinzu: »Hbabi, Herr.« Sie strahlte ihren Vater an und zerknüllte mit vor Aufregung schweißfeuchten Fingern die Seitennähte ihres dünnen mangogelben Obergewandes, das sie über den orangeroten Beinkleidern trug.
»Na, komm schon her zu mir.« Mit der leicht geöffneten rechten Hand winkte er sie freundlich zu sich heran. Salima lief hüpfend auf ihren Vater zu, blieb dann aber verunsichert auf halbem Wege stehen, als sich seine schlohweißen Augenbrauen über der Nasenwurzel zusammenzogen. »Wie läufst du denn herum?!«
Ratlos sah Salima an sich herunter. Das Erste, was ihr ins Auge fiel, waren ihre Füße, die bis über den Spann hinauf graubraun bepudert waren von ihrem Weg über den Innenhof. Sie schob verlegen den linken Fuß über den rechten, doch ihre schmutzigen Füße waren nicht zu verbergen vor den scharfen Augen des Vaters.
»Es – es war nur so«, stotterte sie herum, »mit – mit Sandalen hätte ich zu viel Lärm gemacht und alle geweckt – und – und …«
»Das meine ich nicht«, unterbrach er sie. »Wo ist dein Schmuck?«
Salima streckte die Ärmchen vor und betrachtete die Kettchen an ihren Handgelenken, an denen winzige Anhänger gegeneinanderklimperten, betastete dann ihren Hals, um den mehrere Ketten mit Amuletten hingen: Plättchen aus Gold und Silber mit eingravierten Segenssprüchen und ein hurs, ein Wächter, ein Buch mit ausgewählten Versen des Koran im Miniaturformat, verborgen in einer Kapsel aus ziseliertem Gold mit einem eingelassenen Saphir in der Mitte. Ihre Finger wanderten weiter hinauf zu ihren Ohren und ertasteten an jedem Ohr sechs goldene Ringe, die sie trug, seit sie wenige Monate alt war. Erst als ihre Handrücken ihre Zöpfchen streifte, begriff sie: Die Goldmünzen im Haar fehlten; von all ihrem Schmuck wurden nur diese vor dem Schlafengehen abgenommen und am anderen Morgen von einer Sklavin wieder daran befestigt. Schuldbewusst sah Salima ihren Vater von unten herauf an.
»Willst du eine Prinzessin sein oder ein Bettelmädchen? Hast du keinen Stolz?« Er klang weniger zornig denn betrübt.
Salimas Kinn mit der Andeutung eines Grübchens sank auf ihre Brust hinab.
»Eine Prinzessin verlässt ihr Schlafgemach nie ohne vollständiges Geschmeide. Ebenso gut könnte sie ohne Kleidung herumlaufen! Merk dir das, Salima!« Auf ein Fingerschnipsen des Sultans hin eilte ein Leibdiener herbei. »Bring Sayyida Salima zurück in ihr Gemach!«
An der weichen Hand des Dieners verließ Salima mit hängendem Kopf die bendjle. Ihre Wangen brannten vor Scham, und sie wusste nicht, was schlimmer war: dass sie ohne die ersehnten Bonbons bleiben würde – oder dass sie den Vater enttäuscht hatte.
3
»Ich will aber nicht fort aus Mtoni!«
Salimas Protest verhallte ungehört. Ihre Mutter war ganz damit beschäftigt, die Sklavinnen anzuweisen, was alles herausgesucht und in Kisten verpackt werden musste: Obergewänder in leuchtenden Farben, aufwändig mit silbernen und goldenen Garnen bestickt, Beinkleider, Sandalen, Salimas Spielsachen, Geschmeide, Bücher und Silbergeschirr, an dem Djilfidan besonders hing. Seit Tagen schon drehte sich alles um den bevorstehenden Umzug, und Salimas anfängliche Begeisterung war in dem Maße abgeflaut, in dem all die Dinge, die sie Tag für Tag umgaben, in den Kisten verschwanden. Dass ihre Mutter ihr zudem keinerlei Aufmerksamkeit schenkte, ließ Salimas Verdrossenheit zu blanker Wut aufkochen.
»Ich will nicht nach Watoro!«, brüllte sie, die Fäuste geballt und mit dem Fuß aufstampfend. »Ich will hierbleiben!«
Djilfidan fuhr herum, die Wangen gerötet vor Konzentration und Aufbruchstimmung. »Wirst du wohl endlich still sein?!«, herrschte sie ihre Tochter mit blitzenden Augen an und fuhr fort, die im Flusswasser gewaschenen, an der Sonne getrockneten und mit der Hand glattgestrichenen Kleidungsstücke durchzusehen, die ihr die Sklavinnen nacheinander vorlegten.
Keine Metle mehr. Kein Ralub. Nur lauter fremde Gesichter.
Salimas Zorn ertrank in Fluten des Jammers. Ihre Augen brannten, füllten sich mit Tränen, die sie vergeblich mit den Fäusten dorthin zurückzupressen versuchte, wo sie herkamen. Erste Schluchzer entrangen sich ihr und schaukelten sich zu einem herzzerreißenden Weinen auf.