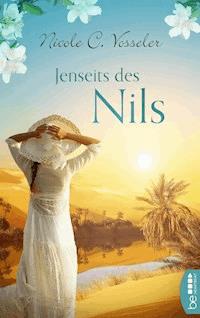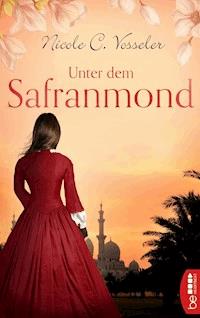
5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Östlich der Sonne, westlich des Mondes - Die Suche einer Frau nach Freiheit, Abenteuer und nicht zuletzt nach der Liebe.
Oxford, 1853. Maya Greenwood, große Bewunderin des Afrikaforschers Richard Francis Burton, träumt von exotischen Ländern und aufregenden Abenteuern. Als ihr Ralph Garrett den Hof macht, der in der britischen Armee in Indien dient, rückt ein abenteuerliches Leben in der Fremde für die junge Frau in greifbare Nähe. Ihre Familie ist jedoch gegen die Verbindung, und so brennt Maya kurzerhand mit Ralph durch. Doch er wird ins unwirtliche Arabien statt nach Indien entsandt, und Maya fällt in die Hände von Beduinen. Dort erlebt sie den wahren Orient - und muss sich eingestehen, dass der Anführer der Wüstenkrieger, der charismatische Rashad al-Shaheen, auch ihr Herz gefangen hält ...
Dieser epische Abenteuerroman über ein kaum bekanntes Kapitel britischer Kolonialgeschichte verwebt das Leben und die Reisen von Richard Francis Burton mit der fiktiven Geschichte von Maya Greenwood - inspiriert von dem "kleinen Mädchen" in Burtons Gedicht "Vergangene Lieben".
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 767
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über das Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Karte
Zitat
Widmung
Prolog
1 – Im Schatten der Türme
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2 – Das Auge Arabiens
1
2
3
4
5
6
7
8
3 – Unter dem Safranmond
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
4 – Schicksalswege
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Epilog
Schlussbemerkung
Über das Buch
Östlich der Sonne, westlich des Mondes – Die Suche einer Frau nach Freiheit, Abenteuer und nicht zuletzt nach der Liebe
Oxford, 1853. Maya Greenwood, große Bewunderin des Afrikaforschers Richard Francis Burton, träumt von exotischen Ländern und aufregenden Abenteuern. Als ihr Ralph Garrett den Hof macht, der in der britischen Armee in Indien dient, rückt ein abenteuerliches Leben in der Fremde für die junge Frau in greifbare Nähe. Ihre Familie ist jedoch gegen die Verbindung, und so brennt Maya kurzerhand mit Ralph durch. Doch er wird ins unwirtliche Arabien statt nach Indien entsandt, und Maya fällt in die Hände von Beduinen. Dort erlebt sie den wahren Orient – und muss sich eingestehen, dass der Anführer der Wüstenkrieger, der charismatische Rashad al-Shaheen, auch ihr Herz gefangen hält …
Dieser epische Abenteuerroman über ein kaum bekanntes Kapitel britischer Kolonialgeschichte verwebt das Leben und die Reisen von Richard Francis Burton mit der fiktiven Geschichte von Maya Greenwood – inspiriert von dem »kleinen Mädchen« in Burtons Gedicht »Vergangene Lieben«.
Über die Autorin
Nicole C. Vosseler wurde 1972 in Villingen-Schwenningen geboren und studierte nach dem Abitur Literaturwissenschaft und Psychologie in Tübingen und Konstanz, wo sie heute lebt. 2007 wurde die SPIEGEL-Bestsellerautorin für ihren Roman »Der Himmel über Darjeeling« mit dem Konstanzer Förderpreis in der Sparte »Literatur« ausgezeichnet. Ihre Bücher wurden bisher in acht Sprachen übersetzt. Wie die Heldinnen ihrer farbenprächtigen Romane sucht auch sie gerne mal das Abenteuer.
Mehr über die Autorin und Hintergrundinformationen zu ihren Romanen finden Sie unter: https://www.nicole-vosseler.de/
Nicole C. Vosseler
UnterdemSafranmond
beHEARTBEAT
Digitale Neuausgabe
»be« - Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Copyright © 2008/2018 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat: Ann-Kathrin Schwarz
Textredaktion: Birte Meyer
Umschlaggestaltung Guter Punkt, München www.guter-punkt.de unter Verwendung von Motiven © thinkstock sUs_angel; © shutterstock KathySG CharlesGibson; © The-hungry-JPEG
eBook-Erstellung: Olders DTP.company, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-5886-5
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Hätt ich des Himmels reichbesticktes Tuch, bestickt aus Golden- und aus Silberfaden, die blauen, die dunklen, die hellen Tücher, der Nacht, des Tages und der Dämmerung, so legt ich sie dir zu Füßen … Doch ich bin arm, hab nur meine Träume. Meine Träume leg ich dir zu Füßen. Tritt sanft darauf, du trittst auf meine Träume.
WILLIAM BUTLER YEATS
Für all die wilden Herzen dieser Welt,
Prolog
Oxford, April 1842
Die Kirchturmglocken von St. Giles am Ende der Straße, nur wenige Häuser entfernt, zählten die Stunden in die Frühjahrsnacht hinaus. Drei, vier, fünf, wiederholte Maya im Stillen. Sechs, sieben – oder war das schon der achte Schlag gewesen? In ihrer Schlaftrunkenheit hatte sich das bald neunjährige Mädchen verzählt, und als der letzte Ton verklungen war, wusste sie nicht, ob es erst elf oder schon Mitternacht war. Seufzend drehte sie sich im Bett herum und angelte nach der Decke, die sie im Traum von sich gestrampelt hatte. Im Zimmer war es kühl. Obwohl die Sonne tagsüber schon warm schien, waren die Nächte noch wenig frühlingshaft. Doch bei den Greenwoods, die in jeder Generation mindestens einen Arzt hervorgebracht hatten, war es üblich, dass sommers wie winters in den Nächten die Fenster zumindest einen Spalt geöffnet blieben, der frischen Luft und der Abhärtung wegen. So war es immer gewesen, soweit Maya zurückdenken konnte.
Angestrengt lauschte sie den Geräuschen im Zimmer. Die hörbar tiefen, gleichmäßigen Atemzüge verrieten ihr, dass ihre jüngere Schwester wie gewohnt fest schlief. Dass Angelinas Schlafgewohnheiten sich dem von ihrer Mutter und der Nanny gewünschten Rhythmus fügten, Mayas hingegen diesem irgendwie zuwiderliefen, war nicht das Einzige, was die beiden Mädchen unterschied. Wer Martha Greenwood zum ersten Mal mit ihren Töchtern sah, kam nicht umhin, teils verunsichert, teils verwirrt von einer zur anderen zu blicken. Angelina und ihre Mutter waren einander wie aus dem Gesicht geschnitten: beide zart, blass und blond, mit den gleichen großen dunkelblauen Augen, wie Puppen aus Biskuitporzellan. Maya hingegen wirkte ziemlich robust neben der zierlichen Gestalt ihrer Schwester. Selbst im Winter hatte ihre Haut einen Hauch von Farbe. Und auch wenn sie stolz darauf war, im Gegensatz zu Angelina von Natur aus Locken zu haben, ließ sich ihr Haar, dunkel wie starker Kaffee, nur selten zu einer jener kunstvollen Frisuren bändigen, die für kleine und große Mädchen so beliebt waren. Das Ungewöhnlichste an Maya aber waren ihre Augen: in der lichtbraunen Iris schimmerte es golden, wie dunkler Bernstein oder Honig, in den Sonnenstrahlen fielen. Wer die Familie näher kannte und wusste, dass Gerald Greenwood zum zweiten Mal verheiratet war, glaubte zuerst oft, Maya stammte wie ihr älterer Bruder Jonathan aus Geralds erster Ehe.
Vor gut drei Jahren waren die Greenwoods aus dem schmalen Haus in der Turl Street hierher in die St. Giles Street übergesiedelt. Zwei der Zimmer im Erdgeschoss hatte Mayas Großvater bezogen, nachdem er mit fast siebzig Jahren seine Arztpraxis aufgegeben hatte. Eines Tages, als überall im Haus noch halb oder gar nicht ausgepackte Kisten herumstanden, war Maya mit einem Glas Milch und Keksen auf das Sofa ihres Großvaters gesetzt worden, damit sie den Handwerkern nicht zwischen den Beinen herumlief, die in manchen der Räume noch zu arbeiten hatten, während Angelina oben brav ihren Mittagsschlaf hielt. Maya machte es nichts aus, Zeit mit ihrem wortkargen Großvater zu verbringen. Sein Schweigen war ihr angenehm, verglichen mit Angelinas Geplapper und den immerwährenden Ermahnungen ihrer Mutter und der Nanny, sich gerade zu halten, kleinere Schritte zu machen und leiser zu sprechen.
Sachte hatte sie mit den Beinen gebaumelt und sich im neu eingerichteten Zimmer mit den hohen Buntglasfenstern zur Straße hin umgesehen. Ihr Blick war an einem goldgerahmten Portrait hängen geblieben, das ihr nie zuvor aufgefallen war. Es musste einem der Räume im Haus ihres Großvaters entstammen, die die Kinder bei ihren sonntäglichen Besuchen nicht betreten durften. So war Maya auch bis zum Umzug, als die Möbelpacker das schwere Bett aus Eichenholz hochkant durch die Eingangstür geschoben hatten, davon ausgegangen, dass ihr Großvater gar keines besaß und auf der lederbezogenen Chaiselongue in seinem Untersuchungszimmer nächtigte, wo er ohnehin die meiste Zeit verbrachte. Doch dieses Gemälde schien ihm so wichtig gewesen zu sein, dass er es sofort aufgehängt hatte, noch ehe all seine geliebten Fachbücher ausgepackt und eingeräumt waren. Es zeigte eine Frau in einem altertümlich fließenden Gewand, das so gar nichts mit den voluminösen Röcken gemein hatte, die Maya an ihrer Mutter und auf der Straße zu Gesicht bekam. Das ebenholzschwarze Haar war nur locker aufgesteckt und wirkte auf Maya, verglichen mit den akkurat angeordneten, stramm zurechtgezurrten Lockengebilden ihrer Mutter, leicht unfrisiert. Als sie genauer hingesehen hatte, hatte sie dem Altersfirnis über Farbe und Leinwand zum Trotz bemerkt, dass die Frau ebenso merkwürdige Augen hatte wie sie selbst. Niemand sonst in ihrer Familie hatte solche Augen.
»Großvater«, hatte sie ihn damals gefragt, »wer ist das auf dem Bild?« Die knotigen Hände hatten sich fester um seinen Spazierstock geschlossen, während Dr. John Greenwood erst lange das Gemälde, dann Maya angesehen hatte. »Das ist deine Großmutter Alice, Liebes. Sie ist schon lange tot. Da hat es dich und auch Jonathan noch gar nicht gegeben. Du bist ihr sehr ähnlich.« Er hatte dabei so traurig geklungen, dass Maya nicht gewusst hatte, was sie darauf hätte sagen sollen, und ein wenig beschämt weiter an ihrem Keks herumgeknabbert hatte. Dennoch war sie seitdem froh zu wissen, dass sie die gleichen Augen wie ihre Großmutter hatte, auch wenn diese nicht mehr lebte.
Erneut schlugen die Glocken von St. Giles und seufzend wälzte sich Maya auf die andere Seite, schob ein Bein unter der Decke hervor, weil ihr nun wieder zu warm war. Seit dem letzten Winter war ihr Großvater auch im Himmel. So wie Jonathans Mutter, an die er sich aber gar nicht mehr erinnern konnte.
Ihre Mutter mochte es nicht, wenn sie »tot« statt »im Himmel« sagte; das sei eine Unart der Ärzte, schimpfte sie dann immer. Maya gab sich Mühe, darauf zu achten, auch wenn sie den Grund dafür nicht kannte. So ging es ihr mit vielen Dingen, in denen ihre Mutter sie korrigierte. Sie verstand auch nicht, weshalb sie viel häufiger ermahnt wurde als Angelina. Manchmal, wenn sie nachts aus ihrem unruhigen Schlaf aufwachte, dachte sie darüber nach und über den Tod und den Himmel. Auch über ihre Familienverhältnisse, die ihr manchmal so verworren erschienen, dass ihr darüber ganz schwindlig wurde, und über Jonathan, der ihr mit seinen fünfzehn Jahren schon so erwachsen vorkam und den sie so selten sah, seit er in Winchester zur Schule ging. Eigentlich war er ja nur ihr Halbbruder. Ob sie ihn wohl noch lieber hätte, wenn er »ganz« ihr Bruder wäre? Angelina war »ganz« ihre Schwester, und doch hatte Maya sie nicht annähernd so lieb wie Jonathan, auch wenn sie sich noch so viel Mühe gab. Immer wieder neue Gedanken, denen ständig neue Fragen folgten. Kein Wunder, dass sie morgens so müde war und gar nicht aufstehen wollte, während Angelina immer frisch und munter aus dem Bett sprang.
Jetzt war Maya gänzlich wach. Manchmal, wenn sie mit solchen Gedanken beschäftigt war, half es ihr, mit ihrem Vater darüber zu sprechen. Während alle anderen schon längst schliefen, arbeitete er oft noch in seinem Arbeitszimmer im mittleren Stockwerk oder in der Bibliothek im Erdgeschoss. Trotzdem war er immer schon aus dem Haus, ehe es der Nanny überhaupt gelungen war, Maya aus den Federn zu zerren.
Als junger Mann war er weit gereist, nach Italien und Griechenland, bis nach Vorderasien. Überall im Haus verteilten sich angeschlagene Vasen und Teller, mit Grünspan überzogene Münzen und verwitterte, mit Schnitzereien überzogene Holzstücke. Sie waren alle sehr wertvoll und blieben deshalb hinter Glas verschlossen, unerreichbar für Mayas neugierige Finger. Gerald Greenwood wusste so viel über vergangene Zeiten, unterrichtete die Studenten am Balliol College in Alter Geschichte, und trotzdem schien er selbst immer noch mehr lernen zu wollen. Für Maya aber hatte er immer Zeit, gleich wie spät es war. Achtlos schob er dann seine Papiere und Bücher beiseite, zog sie auf seine Knie und hörte ihr aufmerksam zu, sog gedankenvoll an seiner Pfeife, ehe er bedächtig antwortete.
Maya hob vorsichtig den Kopf. Unter der Zimmertür schimmerte ein Hauch blassgoldenen Lichts hervor. Sie zögerte einen Augenblick; dann stand sie auf, tapste auf nackten Füßen über den Boden und schlüpfte leise zur Tür hinaus, angestrengt darauf bedacht, ihre Schwester nicht zu wecken.
Sie tastete sich durch das Halbdunkel des Korridors, umging dabei geschickt jede knarzende Stelle des teppichbedeckten Holzbodens. Ihre Mutter jammerte immer wieder über den »hässlichen alten Kasten«, wie sie Black Hall oft nannte. Aber Maya liebte dieses Haus, gerade weil es so verschachtelt gebaut war und düstere Ecken hatte, in denen es sich im Dunkeln so wunderbar gruseln ließ. Obwohl es Platz genug gab, hielt ihre Mutter es für Verschwendung, jedem der beiden Mädchen ein eigenes Zimmer zu geben. So blieben die anderen Schlafräume für auswärtige Gäste reserviert, für Professoren aus Cambridge, aus London oder aus dem Ausland, die zeitweise hier logierten und nächtelang mit ihrem Vater und einzelnen Studenten zusammensaßen und diskutierten. Oft herrschte reges Kommen und Gehen, und ihre Mutter beklagte sich immer wieder über die viele Arbeit, die für sie damit verbunden war. Doch Maya hatte auch den Glanz in ihren Augen bemerkt, wenn sie geschäftig hin und her eilte, kleine Imbisse vorbereiten und die Zimmer herrichten ließ, frische Blumen in die Vasen stellte und dann in eleganten Kleidern die Gäste willkommen hieß.
Mit jeder Stufe, die Maya hinabstieg, wurde es heller. Der Lichtschein kam aus dem Arbeitszimmer ihres Vaters. Die Tür stand ein Stück weit offen, ließ einen Ausschnitt des dunkelroten Teppichs mit dem hellen Rankenmuster sehen und die Seitenwand des massiven Schreibtisches. Ihr Vater war nicht allein; in das Murmeln seiner so vertrauten Stimme mischte sich ein zweites. So wie sich auch der süße Geruch des Pfeifenrauches mit einem zweiten, schärferen vermengte. Mayas Herz machte einen Sprung. Richard! Richard ist da!
Richard Francis Burton, Student im zweiten Jahr am Trinity College, war ein gern gesehener Gast in Black Hall, seit er Gerald Greenwood im Haus eines befreundeten Arztes begegnet war, bei dem er in seinem ersten Universitätsjahr zur Untermiete gewohnt hatte. Mrs. Greenwood errötete wie ein Schulmädchen, wenn Richard sich mit charmanten Komplimenten für eine Einladung zum Dinner bedankte. Oft konnte man ihn und Gerald im Garten Runde um Runde vorbeispazieren sehen, in ein Gespräch über fremde Sprachen und Kulturen vertieft oder in Erinnerungen an die Landschaften und Menschen Frankreichs und Italiens schwelgend, wo Richard aufgewachsen war. Oft zogen sie sich auch zu ein paar Gläsern Brandy in Geralds Arbeitszimmer zurück, wie jetzt, zu dieser späten Stunde. Und während für Gerald seine Pfeife so typisch war, waren es für Richard seine unvermeidlichen Zigarillos. Doch wohl niemand im Haus hatte Richard so sehr ins Herz geschlossen wie Maya.
Sie schlich sich bis zu der Stufe hinab, die auf der gleichen Höhe mit der Tür des Arbeitszimmers lag, und hockte sich hin, umklammerte die gedrechselten Streben und presste das Gesicht dagegen, um ja kein Wort zu versäumen, vielleicht gar einen Blick auf Richard zu erhaschen.
»… meinen alten Herrn davon zu überzeugen, dass es keinen Sinn macht, mich zu einer Laufbahn als Kirchenmann zwingen zu wollen. Der Makel einer zeitweiligen Verweisung von der Universität in meiner Akte schien mir dafür ein guter Trick«, hörte Maya Richard mit einem vergnügten Unterton in seiner tiefen, leicht rauen Stimme erzählen. »Da traf es sich gut, dass die Vorlesung mit dem Beginn des Hindernisrennens zusammenfiel. Anstatt mir den Sermon des Professors anzuhören, traf ich mich hinter dem Worcester College mit ein paar Kommilitonen, und auf ging’s, in einem gemieteten Gespann, zum Rennen!«
»Was vermutlich nicht unentdeckt blieb«, brummte Gerald hinter seiner Pfeife hervor.
»Nein.« Maya glaubte, einen Anflug von Schuldbewusstsein herauszuhören. »Wir wurden zum Dekan zitiert, der Milde walten lassen und uns nur eine Verwarnung erteilen wollte. Also trat ich vor und argumentierte, dass keine moralische Verworfenheit darin läge, Zuschauer bei einem solchen Rennen zu sein. Ich empörte mich allerdings darüber, dass uns die Universität wie Schuljungen behandeln würde, wenn sie uns den Besuch solcher Veranstaltungen verböte. Garniert habe ich meine Rede mit Floskeln wie ›Vertrauen erzeugt Vertrauen‹ – und das war es dann: glatter Rausschmiss.«
Eine kleine Pause entstand, in der Gerald offenbar seine Pfeife neu stopfte. Denn kurz darauf drang frischer Qualm aus dem Zimmer, und er räusperte sich. »Die Universität lässt solche Rennen immer nur außerhalb des Geländes stattfinden und setzt vorbeugend wichtige Vorlesungen auf diese Termine, weil sie um eure Sicherheit fürchtet. Schon manch ein unbeteiligter Zuschauer ist bei einem solchen Rennen unter die Räder oder die Hufe geraten. Mit reiner Prinzipienreiterei oder Bevormundung hat das daher nichts zu tun.« Gerald Greenwood hielt nichts von donnernden Strafpredigten. Er war überzeugt davon, dass der menschliche Verstand die Fähigkeit zur Einsicht besaß, und seine ruhige und sachliche Art der Argumentation konnte bewirken, dass man sich für seine Verfehlungen in Grund und Boden schämte, wie Maya aus eigener Erfahrung wusste. »Aber«, beeilte Gerald sich fortzufahren, wohl um einem Einwand Richards zuvorzukommen, »du setzt ja auch alles daran, deinem Ruf als Sonderling und Quertreiber Ehre zu machen, wo du nur kannst. Wenn ich dich nur an deine lauten Partys und bösartigen Karikaturen von Professoren und Tutoren erinnern darf. Und im ersten Trimester einen anderen Studenten zum Duell herauszufordern – dazu gehört schon eine gehörige Portion Dreistigkeit.«
Jene Episode war unter den Studenten Oxfords legendär. Richard Burton hatte sich kaum an der Universität eingeschrieben, als ihn ein Student eines höheren Jahrgangs wegen seines Oberlippenbartes verhöhnte, den Richard nach italienischer Mode schmal und mit langen, herabhängenden Enden trug. Er hatte sich höflich verbeugt, seine Karte überreicht und die Spottdrossel aufgefordert, die Waffen zu wählen. Duelle waren offiziell verboten, und der ältere Student nahm Richards Fehdehandschuh nicht auf. Dennoch hatte sich Richard Burton dadurch gleich zu Beginn mit erheblichem Aufsehen an der ehrwürdigen Universität einen Namen gemacht.
»Wer wie ich auf dem Kontinent aufgewachsen ist, versteht solche Feinheiten ritterlichen Verhaltens, die hier offenbar gänzlich unbekannt sind«, verteidigte Richard sich hitzig.
Doch Gerald zeigte wenig Neigung, dieses Thema weiter zu vertiefen. »Was wird aus deinen Kommilitonen, die ebenfalls dem Rennen beigewohnt haben?«
»Verweisung vom College bis zum Ende des Trimesters. Mehr nicht.« Richard klang enttäuscht.
»Tja, mein Lieber«, seufzte Gerald und fuhr mitfühlend fort, »da bist du wohl ein wenig zu weit über dein eigentliches Ziel hinausgeschossen. Ich kann dich verstehen – auch mein Vater war nicht glücklich, dass ich damals nicht der Familientradition gefolgt und Arzt geworden bin wie er. Aber genauso brauchte es Zeit, bis ich begriff, dass mein Sohn zwar hervorragende Noten in Latein und Griechisch erzielt, aber mehr Interesse für das aufbringt, was in der Natur kreucht und fleucht, denn für alte Schriften.« Er sog deutlich hörbar ein paar Mal an seiner Pfeife. »So verlässt du also in Ungnade diese heiligen Hallen. Bedauerlich. Äußerst bedauerlich. Mir sind bislang nur wenige Studenten begegnet, deren Verstand und Fähigkeiten sich mit deinen vergleichen ließen. Andererseits gehört ein Freigeist wie du kaum an eine solche Institution. Was hast du jetzt vor?«
»Mich aufmachen, in die Kolonien von Südaustralien, Queensland, New South Wales, oder in die Vereinigte Provinz von Kanada. Von mir aus auch zur Schweizer Garde nach Neapel oder gar zur Fremdenlegion – nur so weit weg von diesem kalten, nassen Inselchen und seinen engstirnigen Bewohnern wie möglich!« Er klang so zornig und verzweifelt zugleich, dass es Maya im Innersten berührte. »Am liebsten wäre mir jedoch Indien. Ich hoffe darauf, meinen Vater davon überzeugen zu können, mir ein Offizierspatent zu kaufen, noch ehe der Krieg in den Bergen im Nordwesten Indiens vorüber ist. Womöglich bin ich zu nichts anderem zu gebrauchen, als für einen Sixpence pro Tag von den Afghanen beschossen zu werden.« Seine Worte zeugten von tiefer Bitterkeit. »Ich brenne darauf, den Afghanen eine Lektion zu erteilen – allein für das Massaker an den Soldaten und Zivilisten der Garnison von Kabul im Januar! Selbst im Krieg sollte so etwas wie Ehre gelten.«
»Aber in der Armee, Richard –«
»Ich weiß«, gab dieser verdrossen zurück, »auch dort müsste ich meinen freien Geist«, er legte einen bissigen Ton in die beiden letzten Worte, »im Dienst unterjochen lassen. Doch dort kann ich wenigstens Sprachen lernen. Sprachen, für die es noch keine Wörterbücher oder Grammatiken gibt. Sprachen, mit denen ich mich unter die Menschen dort mischen könnte, als sei ich einer von ihnen, um so ihre Sitten und Bräuche zu studieren. Wäre ich vermögend, so könnte ich mir den Luxus erlauben, auf eigene Kosten zu reisen und –«
»Du sollst doch nicht lauschen«, zischte ein feines Stimmchen hinter Maya, und sie fuhr herum. Zwei Treppenstufen über ihr stand Angelina, in dem gleichen weißen Nachthemd, wie es auch Maya trug. Mit ihrem glänzenden, blonden Haar, das auf unzählige kleine Papierstreifen aufgedreht war, sah sie aus wie ein kleiner Engel – oder vielmehr wie ein zürnender Engel, so strafend blickte ihr Kindergesicht drein.
»Aber es ist Richard«, flüsterte Maya in einem schwachen Versuch, sich zu verteidigen. »Ich muss zuhören, wenn er erzählt! Wenn ich groß bin, will ich genauso sein wie er – genauso mutig und tapfer, genauso wild, so –«
»Das geht doch gar nicht«, gab Angelina verächtlich zurück. »Du bist doch ein Mädchen!«
Zorn wallte in Maya auf und ließ sie aufspringen, die Hände zu Fäusten geballt. »Und ob das geht, wirst schon noch sehen!«, erwiderte sie heftig und lauter als beabsichtigt.
»Was ist denn hier los?« Gerald Greenwood stand im Türrahmen und starrte in einer Mischung aus Verblüffung und Belustigung auf die beiden weißen Gestalten. Wie der Blitz war Angelina die Treppe wieder hinaufgeschossen und im Dunkel des oberen Stockwerks verschwunden. Maya senkte betreten den Kopf und vergrub ihre Zehen im Flor des Treppenläufers.
»Ich wusste gar nicht, dass in Black Hall ein solch zauberhaftes Nachtgespenst sein Unwesen treibt.« Beim Klang von Richards Stimme blinzelte Maya unter halb gesenkten Lidern in Richtung Tür. Er stand jetzt neben ihrem Vater, den er um beinahe einen ganzen Kopf überragte, groß und breitschultrig wie er war. Trotz Anzug mit Krawatte und gescheiteltem, schwarzem Haar ähnelte er in seiner Gesamtheit mehr einem Italiener oder einem der Zigeuner auf dem Jahrmarkt von St. Giles denn einem Engländer. Sein Anblick, der Anflug eines Lächelns auf seinem sonst so düster wirkenden Gesicht, ließ Mayas Wangen freudig glühen.
»Bekomme ich keine Begrüßung, Prinzessin?« Er trat über die Schwelle, ging in die Knie und breitete die Arme aus. Leichten Herzens flog Maya die restlichen Stufen hinab, ihm entgegen, und warf sich in seine Umarmung. Das Gesicht an die Schulter seines Jacketts geschmiegt, sog sie den Geruch nach Tabakrauch, Wollstoff, Seife und Pomade ein, und das Schwere, Holzige, das so typisch für Richard war.
»Richard ist gekommen, um sich zu verabschieden. Er verlässt morgen Oxford und wird dann wohl sehr lange Zeit nicht nach England zurückkehren.« Maya hob den Kopf und sah ihren Vater verwirrt an, den es sichtlich bedrückte, ihr solchen Kummer bereiten zu müssen. Ihr Blick wanderte wieder zu Richards hart konturiertem Gesicht mit den hervorspringenden Wangenknochen, drang fragend, ja bittend in seine dunklen Augen, die den ihren so nahe waren, in der vergeblichen Hoffnung, dies sei nur einer seiner Scherze, mit denen er sie oft zu necken pflegte. Ernst, fast entschuldigend erwiderte er ihren Blick.
Seit Jonathan nur noch in den Ferien nach Hause kam, war Richard ihr der einzige und liebste Spielgefährte geworden. Angelina wollte immer nur mit ihren blöden Puppen spielen, und nachdem Maya aus Versehen eine Tasse des Teeservices aus Porzellan zerbrochen hatte, durfte sie sich der Puppenstube nicht einmal mehr nähern. Richard hatte im Garten gegen Maya Duelle mit Holzschwertern ausgefochten und sich nach einem guten Treffer von ihr bereitwillig unter gespielten Todesqualen ins Gras fallen lassen. Die Schaukel unter dem Apfelbaum hatte er angeschubst, höher und immer höher, so hoch, wie es ihr Vater nie gewagt hätte, bis Maya vor Freude und wohliger Angst quietschte. Auf dem Boden der Bibliothek hatten sie sich beide über den großen Atlas gebeugt, waren Mayas Kinderhände und Richards erstaunlich feingliedrige Finger entlang der Routen Marco Polos über die Seiten gewandert. So hatten sie ihre eigenen Expeditionen in den Orient geplant, von denen sie beladen mit Seide, Tee, Gewürzen, Gold und Edelsteinen nach England zurückkehren würden. Das sollte ab heute vorbei sein? Nach Indien, fiel ihr ein, und sie schluckte. Ein Kälteschauder erfasste sie, und etwas klumpte sich in ihrem Magen zusammen.
»Wenn ich nicht wach geworden wäre«, wisperte sie entsetzt, »dann hätte ich dich ja gar nicht mehr gesehen.«
»Weißt du«, Richard atmete tief durch und strich ihr leicht über den Rücken, »ich bin nicht besonders gut im Abschiednehmen. Begrüßungen sind mir lieber.«
»Aber«, platzte sie heraus, »aber du kannst nicht weg!« Ihre Finger krallten sich in den Stoff seines Jacketts, als könnte sie ihn dadurch zum Bleiben bewegen. In ihrer Not rang sie sich dazu durch, ihm ihr am besten gehütetes Geheimnis anzuvertrauen. Sie schlang die Arme um seinen Hals, drückte ihre Wange an seine Schläfe, dorthin, wo er am intensivsten roch, wie nach Lakritz, und flüsterte ihm ins Ohr: »Ich will dich doch heiraten.«
Sogleich schob sie sich beschämt von ihm weg, weil sie fürchtete, ausgelacht zu werden. Aber Richard schaute sie nur erstaunt, fast ein wenig ratlos an. Dann zog er sie wieder zu sich heran. Sein Mund so dicht an ihrem Ohr, dass die langen Enden seines Bartes sie mit jedem Laut zart kitzelten, flüsterte er zurück: »Das ist ein sehr überraschender und informeller Antrag, den du mir da machst, Majoschka.« In seiner Stimme vibrierte es vergnüglich. »An mir als Ehemann würdest du allerdings wenig Freude haben – das solltest du dir noch einmal gründlich überlegen! Ich werde aber gerne darauf zurückkommen, wenn wir uns wiedersehen. In der Zwischenzeit«, er hielt sie von sich weg und tippte mit seinem Zeigefinger auf ihre Nasenspitze, »mach brav die Aufgaben, die dein Vater dir gibt. Du weißt, ich mag keine dummen Frauen! Und ich werde dir schreiben, so oft ich kann. Einverstanden, kleine Lady?« Maya nickte wie betäubt, und Richard erhob sich.
»Danke, Professor. Für alles.« Die beiden tauschten einen kurzen, kräftigen Händedruck. »Nein, bemühen Sie sich nicht, ich finde allein hinaus.«
In einem Gefühl völliger Ohnmacht, ihre eiskalten Finger in die warme Hand ihres Vaters geschoben, sah Maya zu, wie Richard Burton die Treppe hinabeilte und einfach aus ihrer kleinen Welt verschwand.
1Im Schatten der Türme
Narren stürzen vorwärts, wo Engel leise treten.
ALEXANDER POPE
»Narren stürzen vorwärts, wo Engel leise treten!« Engel und Narren sind sich darin gleich, zu folgen ihrer Natur Gebot, ohne Hoffnung auf Lob, ohne Furcht vor Tadel.
RICHARD FRANCIS BURTONThe Kasidah of Haji Abdu El-Yezdi
1
Oxford, kurz vor Weihnachten 1853
Maya! Komm auf der Stelle zurück! Ich bin noch nicht fertig mit dir! Maya!« Martha Greenwoods Stimme überschlug sich beinahe, stach schrill von der Galerie im obersten Stockwerk bis in den letzten Winkel von Black Hall.
»Ich aber mit dir, Mutter«, presste Maya hervor, als sie die Treppen hinabpolterte und sich ihr Schultertuch überwarf.
Unten in der Halle stieß sie um Haaresbreite mit Hazel zusammen, die gerade noch das Tablett mit Tee und Biskuits retten konnte, das sie vor sich hertrug. Bestürzt sah das Dienstmädchen Maya hinterher, wie sie grußlos an ihr vorüberrannte, die verglaste Tür zum Garten hinter dem Haus aufriss und hinausstürmte. Ein eisiger Wind strömte in die Halle, und der Luftzug wirbelte ein paar Schneeflocken über die Schwelle. Hazel lauschte. Oben waren gedämpft die noch immer erregte Mrs. Greenwood zu hören und Miss Angelina, die beruhigend auf ihre Mutter einredete. Seufzend setzte Hazel das Tablett auf dem Beistelltischchen neben der Treppe ab. Den Türknauf in der Hand, sah sie zu, wie Maya durch den verschneiten Garten stapfte und stolperte: ein Schattenriss aus dunklem Tuch im trüben Licht des Winternachmittags, jeder Schritt sichtbar ein Ausdruck von Wut und Rebellion.
»Armes Ding«, murmelte Hazel mitfühlend. »Die Gnädige macht es ihr derzeit aber auch wirklich nicht leicht.« Sanft schloss sie die Tür und beeilte sich, den Tee hinaufzubringen, ehe er abkühlte.
Wütend trat Maya Schneehäufchen vor sich her, unbeeindruckt davon, dass Schuhe und Rocksäume durchnässt wurden. Erst vor dem alten Apfelbaum blieb sie stehen, fegte die dünne Schneeschicht auf der Sitzfläche der Schaukel beiseite, der sie längst entwachsen war, und ließ sich darauf fallen. Die Arme fest um sich geschlungen, die Hacken in den gefrorenen Boden gebohrt, wippte sie vor und zurück und zog die Stirn kraus. Tapfer blinzelte sie alle Tränen fort, die ihr in den Augen brannten, und starrte vor sich hin. Es war so ungerecht!
Aus dem viereckigen Ausschnitt ihres Kleides zog sie den Brief hervor, den sie ihrer Mutter vorhin entrissen hatte und der die heutige Auseinandersetzung heraufbeschworen hatte. Nachdenklich wog sie ihn in den Händen, ehe sie ihn entfaltete.
Cairo, den 4. Dezember 1853, Shepheards’ Hotel
Mein Kätzchen,
sei unbesorgt – es war nichts Ernstes, was mich aufs Lager zwang, als ich Dir zuletzt schrieb, doch nichts, was einer jungen Dame mitzuteilen ziemlich wäre. Ich fühle mich schon besser und stärker, und das mag auch an Deinen Zeilen liegen, liebste Maya.
Ich konnte die mir aufgezwungene Bettruhe nutzen, indem ich an den Skizzen etc. arbeitete, die ich in Mekka und Medina angefertigt habe; hier gibt es Künstler, die mir dabei helfen können, in Indien nicht. Die Notizen zu meiner haj, meiner Reise in der Verkleidung eines Pilgers nach Mekka und Medina, kommen aber nur langsam voran. Schreiben strengt das Gehirn an & das Gehirn den Leib.
Ich habe Dr. Johann Krapf getroffen und ihn zu seinen Erkenntnissen über die Quelle des Weißen Nils, über den Kilimandscharo & die Mondberge befragen können. Was ich von ihm erfuhr, die Geschichten arabischer Händler, die ich mitbrachte, waren das Fundament für eine Offenbarung, die ich bei der Lektüre Ptolemäus’ erhielt. Dieser schreibt nämlich: nahe Aromata, und die Höhlenbewohner zur Rechten, nach fünfundzwanzig Tagesmärschen, die Seen wohin der Nil fließt … Das ist des Rätsels Lösung, Maya, der Weg, das Ei aufrecht hinzustellen, das Zerreißen des Schleiers der Isis! Seit dreitausend Jahren haben Forscher versucht, dem Nil flussaufwärts zu folgen, um seine Quellen zu finden, bislang vergeblich. Wem dies gelingt, der wird Geschichte schreiben!
Ich bin bereit, in der nächsten Saison das Landesinnere Afrikas zu erforschen, sofern man mir Urlaub gewährt. Wenn ich nur von der Regierung finanzielle Mittel erhielte für ein paar gute Männer, die mich begleiten könnten (einen für die geographische Vermessung, einen anderen für Botanik), so hätte ich an unserem grandiosen Erfolg keinen Zweifel. Ich habe viel von Arabien gesehen. Reisen ist dort eine Freude und nichts würde mir mehr Vergnügen bereiten, als für drei oder vier Jahre an dessen östliche Gestade aufzubrechen. Aber dabei würde nichts weiter herauskommen als noch mehr Entdeckungen von Wüstentälern und Volksstämmen. Keine Pferde, keine Gewürze, und nur spärlicher Ruhm, da von Wredes Buch – lächerlich, falls die hier zu hörenden Berichte darüber wahr sind, auf welche Weise er es zusammengetragen hat – den Löwenanteil dieses Themas bereits abgehandelt hat.
Es freut mich, dass Dir jenes andere Buch gefällt, das ich Dir genannt habe – es wird Dir neue Horizonte öffnen. Lass Dich bei dessen Lektüre aber nicht erwischen; es würde Deine Frau Mama in Furcht um Deine Sittsamkeit versetzen! Bete zu Weihnachten für meine schwarze Seele und vergiss mich alten Gauner nicht.
Für immer Dein
Richard
Es war der jüngste in der langen Reihe von Briefen, die Maya durch ihre Kindheit und die Jahre des Heranwachsens begleitet hatten. Briefe aus Bombay, dem Gujarat und dem Sindh, von den Stränden Goas und den blauen Bergen von Nilgiri, aus Hyderabad und Alexandria. Namen, die allein schon nach Safran und Koriander, nach Zimt und Pfeffer rochen und schmeckten, die Sonnenglut und Abenteuer in sich trugen. Briefe, von denen man erwartete, dass einem beim Öffnen Sand entgegenrieseln würde, rotes Gewürzpulver und grüner Hennastaub. Auf Papier geschrieben, das vermeintlich mit dem Salz der Weltmeere vollgesogen war, die Klänge eines orientalischen Basars und die Stille einsamer Gebirgszüge in seinen Fasern eingefangen hatte.
Doch ginge es nach ihrer Mutter, sollte dieser Brief in ihren Händen der letzte gewesen sein. Richard Burtons Ruf eilte ihm voraus, und mittlerweile war dieser mehr als zweifelhaft. Er erntete Anerkennung für seinen Mut und seine Entschlossenheit, sein Sprachgenie und seinen Forscherdrang. Doch ein sahib, der in Indien nicht nur mit Einheimischen auf vertrautem Fuß stand, sondern offen mit seiner jeweiligen indischen Geliebten zusammenlebte, überschritt die Grenzen des guten Geschmacks und zeigte keinen Respekt für die herrschenden Sitten und Gebräuche. Einem Gerücht zufolge hatte er sogar als Geheimagent im Auftrag General Napiers ein Freudenhaus ausgekundschaftet, in dem englische Soldaten verkehrten. Sein Bericht sei so detailliert gewesen, dass er zweifellos selbst an allerlei Ausschweifungen teilgenommen hatte, bis hin zu »widernatürlicher Unzucht« mit Knaben, wie man entsetzt hinter vorgehaltener Hand tuschelte. Und nun war er in diesem Sommer in der Verkleidung eines Arabers zu den heiligen Stätten des Islam gereist, in einer für jeden guten Christen unerträglichen Perversion einer Wallfahrt, auf der er gar einen Mann getötet haben sollte.
Martha Greenwood schätzte Richard Burton als Person wie als Freund ihres Gatten. Doch er war kein geeigneter Umgang für ihre älteste Tochter, und sei es nur per Brief. Ihre Tochter, die zu verheiraten ohnehin ein aussichtsloses Unterfangen schien. Trotz Tanzstunde, trotz Klavier- und Reitunterricht, trotz gnadenlosen Mitzerrens auf jede Teegesellschaft des Städtchens fand sich einfach kein ernstzunehmender Verehrer für Maya. Und selbst die bleichen Bücherwürmer, die sich zu den Diskussionszirkeln bei Professor Greenwood einfanden, verloren schnell das Interesse, wenn Maya sich hitzig in die Gespräche einmischte und den jungen Männern wenig damenhaft ihr Wissen um die Ohren schlug. So hatte Martha es als ihre mütterliche Pflicht verstanden, den Brief entgegen ihren sonstigen Gepflogenheiten zu öffnen, als Hazel ihn zusammen mit der anderen Post überbrachte, und hatte ihre älteste Tochter schließlich zur Rede gestellt. Maya war mit ihren zwanzig Jahren schon fast ein spätes Mädchen und nicht mehr die beste Partie; umso mehr musste ihre Mutter dafür Sorge tragen, dass ihr Ruf unbefleckt blieb. Es würde keinen weiteren Kontakt zwischen ihrer Tochter und Richard Burton geben, so viel stand fest.
Mit kummervoller Miene faltete Maya den Briefbogen wieder zusammen, presste ihn zwischen ihre Handflächen und ließ die Lippen wie zum Gebet auf der Kante ruhen. »Komm zurück, Richard«, flüsterte sie, ihre Stimme heiser vor Sehnsucht, »komm zurück und hol mich fort von hier!«
Seine Briefe waren der kostbarste Schatz, den sie besaß. Briefe, die sie Wort für Wort auswendig kannte, so oft hatte sie jeden einzelnen davon gelesen. Waren sie ihr doch das Tor zu einer farbenprächtigen Welt, das sie jederzeit durchschreiten konnte, wenn ihre Tage gar zu grau, zu trostlos waren. Diese Briefe waren ihre einzige Verbindung zu Richard, und jeder von ihnen trug seine Stimme in sich, wie er ihr über Tausende von Meilen hinweg zuflüsterte:
Wie wunderschön diese orientalischen Nächte sind … Über allem schwebt der süße Duft der hukkah-Pfeifen, und überall Räucherwerk, Opium und Hanf … Stoffe, so prächtig wie für eine Prinzessin aus einem Märchen, oder wie für Dich, meine kleine Maya … Und dann erlaubte mein Hindu-Lehrer mir offiziell, die janeo zu tragen, die heilige Kordel der Brahmanen … Das fortwährende Tam-tam und Quieken der einheimischen Musik, vermischt mit den dröhnenden, brüllenden Stimmen der Bewohner, das Bellen und Kläffen der zankenden Köter und die Schreie hungriger Möwen, die sich um Brocken toten Fischs streiten, verbinden sich zu einer Mischung, die als etwas absolut Fremdes auf das Trommelfell trifft … Und ich dachte an unsere Bootsfahrt, als ich »uns zwei beide« – wie Du immer sagtest – über den Cherwell ruderte, damals, als der Flieder in voller Blüte stand … Die Luft war weich und wohlriechend, zugleich ausreichend kühl, um angenehm zu sein. Ein dünner Nebel ruhte über dem Boden und zog sich bis halb auf die Hügel hinauf, ließ deren palmenbekleidete Gipfel frei, um das silbrige Licht des Morgengrauens einzufangen … In welch weiser Voraussicht haben Dir Deine Eltern Deinen Namen gegeben! »Maya«, die Göttin der Illusion, die den Geist der Menschen betört und bezaubert. So wie Du mir über Zeit und Raum nur mehr als eine Illusion erscheinst, obschon ich doch weiß, dass es Dich wahrhaftig gibt; so wie die Erinnerung an Dich mich betört und bezaubert – Maya, Majoschka …
Sie schloss die Augen. Ihre Wangen brannten, vor Zorn und vor Kälte. Doch mit ein wenig Phantasie konnte sie sich vorstellen, dass es die Sonne war, die ihre Haut erglühen ließ. Eine Sonne, die die Luft erwärmte, den Schnee genau wie die Monate dahinschmelzen ließ, die seit jenem Sommertag vor zwei Jahren vergangen waren und Maya in das Reich ihrer Erinnerungen lockte …
***
Maya saß auf ihrem Lieblingsplatz, der Schaukel unter dem Apfelbaum, den Rücken an eines der Taue gelehnt. Ein Bein hatte sie an sich gezogen, ihr Buch darauf abgestützt; mit dem anderen stieß sie sich in gleichmäßigem Takt vom Boden ab. Ihre Schuhe lagen im Gras, und die Strümpfe ringelten sich unordentlich darum. Hier war es wie in einer grünen Laube. Hohe Sträucher – Flieder, Holunder, Liguster – schirmten den Baum vor neugierigen Blicken aus dem Haus ab. Die Innenseite der Mauer, nur wenige Schritte entfernt, war von zweifarbigem Efeu überzogen, und um den Torbogen rankte sich eine Kletterrose, die stolz ihre fülligen Blüten präsentierte. Durch das schmiedeeiserne Gitterwerk des Tores zur Black Hall Road hin waren das sich entfernende Klappern von Pferdehufen und das Knirschen von Rädern über Stein zu hören, alles in harmonischem Einklang mit dem Vogelgezwitscher in der Luft. Mayas Nase zuckte leicht, wie immer, wenn sie zufrieden war. Sie genoss die Mischung aus kühlen, glatten Grashalmen und trockener, kratziger Erde unter ihrer Fußsohle und zwischen den Zehen. Die Volants ihrer Unterröcke unter dem hellen Sommerkleid kitzelten an den nackten Beinen, wenn die Schaukel vor- und zurückschwang. Für einen Moment schloss sie die Lider, legte den Kopf in den Nacken, ließ sich ein Fleckenmuster aus Sonne und Blätterschatten ins Gesicht malen, ehe sie sich wieder über die bedruckten Seiten beugte und an ihrem sauren Apfel knabberte. Ein Schatten am Rande ihres Gesichtsfelds ließ sie aufblicken. Mit einem erstickten Aufschrei entglitt ihr das Buch, das unsanft im Gras landete.
Ein Mann stand im Garten, seinen zerdrückten Panamahut in den Händen, einen Seesack zu seinen Füßen, und beobachtete sie, mochte der Himmel wissen, wie lange schon. Alles an ihm war finster, wirkte trotz des ordentlichen Anzugs bedrohlich: das schwarze Haar, der Bart, die Glut in den dunklen Augen. Und doch verspürte Maya keine Furcht. Auch wenn die verblassten Erinnerungen, von ihrer Fantasie über die Zeit farbig übermalt und verschwenderisch ausgeschmückt, kaum ein Wiedererkennen erlaubten. Fieber und rituelles Fasten hatten ihn ausgezehrt, Sonne und Monsun, Hitze und Staub seine Haut aufgeraut und gegerbt. Das Wenige, was an jugendlicher Weichheit einst vorhanden gewesen war, hatten Wüste und Tropen abgeschliffen, war harten Gesichtszügen gewichen. Unter militärischem Drill und unstillbarem Hunger nach Erfahrungen und Eindrücken hatte jedes der vergangenen Jahre mehr als deutliche Spuren hinterlassen. Ein Lächeln schien in seinem Gesicht auf, so strahlend, dass es beinahe störend wirkte auf den Zügen, die von Natur aus so gar nicht auf Herzlichkeit ausgerichtet waren. »Bekomme ich keine Begrüßung, Prinzessin?«
Unzählige Male hatte sie sich vorgestellt, wie es sein würde. Wie er eines Tages wieder vor ihr stehen, wie sie ihm entgegenfliegen und ihn umarmen würde, ganz genau so, wie sie es in jener Aprilnacht als kleines Mädchen zum letzten Mal getan hatte. Doch nun starrte sie ihn nur an, unfähig, sich zu rühren. Zu unwirklich war diese Erscheinung, wie ein Traum oder eine Fata Morgana. Und sie mochte nicht einmal ihrem Herzen trauen, das in ihrem Brustkorb wild umhersprang.
»Nun, wenn der Berg nicht zum Propheten kommen will, so muss der Prophet sich eben zum Berg bemühen«, rief Richard und kam auf sie zu.
Endlich löste sich Maya aus ihrer Erstarrung und kletterte langsam von der Schaukel. Sie ließ den angebissenen Apfel fallen und wischte mit der Hand verstohlen über ihr Kleid. Als Richard direkt vor ihr stand, nahm er ihre Hände und musterte Maya eindringlich, doch er sagte nichts. Sein Bart zuckte leicht, wie amüsiert, als er ihre Hand, die noch klebrig war vom Saft des Apfels, an seine Lippen drückte. »Wenn das«, murmelte er in ihre Handfläche, »nicht der Geschmack des Paradieses ist!« Maya schoss das Blut ins Gesicht; sie wollte sich ihm entziehen und vermochte es doch nicht. Unvermittelt wurde Richards Blick ernst, als er mit dem Daumen über Mayas Wangenknochen fuhr, seine Augen jedes Detail ihres Gesichts abtasteten. »Du bist zu jung für solche Kummerschatten, Majoschka! Wo ist das unbeschwerte kleine Mädchen geblieben, das ich die ganze Zeit in meinem Herzen getragen habe?«
Eine einzelne Träne löste sich, floss über seine Hand, und dann begann Maya zu weinen: vor Glück, dass ihr Warten endlich ein Ende hatte, und vor Erleichterung, dass mit Richard jemand gekommen war, der um die Einsamkeit derer wusste, die anders waren, als die Gesellschaft es von ihnen erwartete. »Nicht weinen«, raunte er und hielt sie fest, wiegte sie tröstend. »Ich bin doch wieder da. Dein alter Gauner ist zurück!« Beide Hände um ihr Gesicht gelegt, bog er ihren Kopf leicht nach hinten. Sanft presste er seine Lippen auf ihre Stirn, auf die nassen Spuren auf Wangen und Kinn, und dann, nach einem kurzen Zögern, auf ihren Mund. Er schmeckte salzig, fast bitter, nach Rauch und Richard und nach der Fremde, aus der er kam. Maya zuckte kaum merklich zurück, als sich seine Zungenspitze zwischen ihre Lippen schob. Sein nach Pomade duftender Bart kitzelte an ihren Mundwinkeln, als er leise lachte. »Niemals hätte ich mir träumen lassen, dass ich der Erste sein würde, der dieser Versuchung erliegt.« Er küsste sie, bis sie nach Atem rang, küsste sie, bis sie glaubte, sich aufzulösen, in Sonnenlicht und warme Erde.
***
»Maya! Maa-yaa!« Sie fuhr zusammen und spähte durch die kahlen, weiß verschneiten Zweige der Sträucher in die Richtung, aus welcher der Ruf gekommen war. Auf der Veranda konnte sie das lavendelfarbene Samtkleid Angelinas ausmachen. »Maya? Bist du da unten irgendwo?« Es sah Angelina ähnlich, dass sie sich nicht die Mühe machte, auch nur einen Fuß in den Garten zu setzen, damit der Schnee nicht ihre Schuhe ruinierte. Stattdessen stellte sie sich auf Zehenspitzen, reckte sich und machte einen langen Hals. Obwohl ihre Schwester gewiss nicht mehr als eine Handvoll Bücher in ihrem Leben gelesen hatte, war sie leicht kurzsichtig. Aber Angelina hätte lieber einen ihrer Finger geopfert, als sich eine Brille anfertigen zu lassen. »Brillen sind nur etwas für Blaustrümpfe, und kein Mann, der etwas auf sich hält, würde sich je mit einem Blaustrumpf sehen lassen«, lautete ihr verächtlicher Kommentar zu diesem Thema. Als ob ausgerechnet Angelina je wirklich Gefahr liefe, mit diesem Spottnamen bedacht zu werden, der für gebildete, auf Unabhängigkeit und Gleichberechtigung pochende Frauen reserviert war, dachte Maya oft in einem Anflug von wohltuender Gehässigkeit. Tatsächlich war es so, dass Gentlemen jeglichen Alters es hinreißend fanden, wenn Angelina die Nasenwurzel kräuselte und ihre blauen Augen diesen gewissen Schimmer erhielten, sobald sie sich bemühte, etwas in der Entfernung scharf zu sehen. So, wie grundsätzlich immer alles als hinreißend empfunden wurde, was Angelina tat oder sagte.
Hastig verstaute Maya den Brief, sprang auf und schlüpfte durch das Gartentor nach draußen. Trotz des vielversprechenden Namens war die Black Hall Road wenig mehr als ein einfacher Feldweg, ein wie mit grobem Faden hingestichelter Saum der Stadt, ungepflastert, die Schneedecke nur von wenigen Wagenspuren durchschnitten. Jenseits der Straße schlummerten Wiesen und Äcker wie unter einem Daunenbett aus Schnee. Am Horizont klammerten sich die Astfinger grauborkiger Hainbuchen an den Himmel aus Blei, und einzelne Weißdornsträucher entfächerten ihr fedriges Gezweig. Unterhalb von Black Hall reihten sich kastenförmige Häuser aneinander, wie sie Anfang des Jahrhunderts so beliebt gewesen waren. Sie konnten es sich erlauben, in gleichmütiger Gelassenheit aus ihren hohen Sprossenfenstern nach vorne auf die elegante, baumbestandene St. Giles Street hinauszublicken. Denn sie wussten, die Gärten in ihrem Rücken waren durch hohe Mauern vor den Füchsen geschützt, die des Nachts von den Feldern herüberstromerten. Mauern, von Flechten überkrustet wie Schildkrötenpanzer, an denen Maya nun entlanglief, stadteinwärts, in Richtung des einzigen Ortes, der ihr ungestörte Zuflucht zu bieten vermochte.
2
Zwei junge Männer jagten durch die luxuriöse Halle der Euston Station, der eine im Scharlachrot der East India Company, der andere in Khaki-Uniform. Jeder einen Seesack über die Schulter geworfen, schlugen sie Haken um die livrierten Lastenträger, die Pakete schleppten oder Kisten und Koffer auf Karren vor sich herschoben. Sie eilten zwischen den Reisenden hindurch, die im Gegensatz zu ihnen noch Zeit hatten und gemütlich herumschlenderten. Vorbei an anderen, die gerade angekommen waren und Ausschau hielten nach Verwandten und Freunden, die sie abholen sollten. Um einem Zusammenprall in letzter Sekunde zu entgehen, traten zwei ältere Ladys mit entrüsteten Mienen ein paar schnelle Schritte zurück, dass ihre weiten Röcke ins Schwingen gerieten. Ein Mann mit grauem Spitzbart und Zylinderhut drohte mit seinem Gehstock und schickte ihnen lautstarke Verwünschungen hinterher. »’tschuldigung«, rief der Rotberockte hinter sich, »’zeihung«, kam das Echo seines Begleiters, und sie rannten weiter, so schnell sie ihre Beine trugen, hin zu einem der Durchgänge, die zu den Gleisen führten.
Der schrille Pfiff des Schaffners gellte über den dampfvernebelten Bahnsteig, fing sich unter dem Glasdach mit dem filigranen Netz aus Metallverstrebungen und schallte lautstark zurück. Eine Oktave tiefer antwortete die Lokomotive, stieß einen neuen Schwall an Dampf aus und ruckte seufzend an. In vollem Lauf sprangen die beiden Nachzügler auf die Trittleiter des hintersten Wagens, und der letzte Zug der »London & North Western Railway« für diesen Tag rollte aus dem Bahnhof.
»Geschafft!« Jonathan Greenwood stopfte seinen Seesack oben in die Gepäckablage. Keuchend warf er sich in das pflaumenblaue Polster des Sitzes und streckte seine schmerzenden Beine in den hohen Stiefeln von sich.
»Das war knapp!«, kam die Bestätigung vom Platz gegenüber, nicht minder außer Atem. »Hätte – hätte dieser verfluchte Dampfer auch nur ein paar Minuten später angelegt, hätten wir sehen können, wo wir heute Nacht unterkommen!«
»Immerhin hat die ›P&O Steam Navigation Company‹ ihrem Ruf alle Ehre gemacht und uns zwei Tage früher als geplant von Alexandria nach London befördert! Abgesehen davon: Eine Nacht in London hätten wir schon irgendwie hinter uns gebracht«, meinte Jonathan mit einem Augenzwinkern. Ein vielsagendes Zucken heller Augenbrauen war die Antwort, begleitet von einem kehligen Laut, halb Knurren, halb Schnurren, und beide brachen in einstimmiges Gelächter aus.
Der Zug gewann an Geschwindigkeit, ruckelte und polterte, als er über eine Weiche fuhr. Vor den im bläulichen Zwielicht des Nachmittags vorbeiziehenden Hausfassaden zeigte das moderne Panoramafenster ein schwaches Spiegelbild des Abteils. Jonathan musterte kritisch seinen durchscheinenden, leicht unscharfen Doppelgänger, als er sich über die schweißglänzende Stirn fuhr. Von Natur aus dicht und lockig, warf sein kastanienbraunes Haar aufgrund des von der Armee vorgeschriebenen kurzen Schnitts lediglich noch Wellen, die sich aber dennoch nur mit Mühe und extra viel Pomade bändigen ließen. Nach ihrer Hetzjagd durch die Straßen Londons standen einzelne Strähnen wie Teufelshörner ab. In glättender Absicht fuhr er sich mit den Handflächen über den Kopf, doch seine Bemühungen blieben erfolglos; immer wieder sprangen die Haarkringel wie elastische Sprungfedern in die Höhe. Und selbst in den ausgewaschenen Farben der Spiegelung biss sich der Rotstich seines Haares noch mit dem Scharlachrot des Uniformrocks. Er unterdrückte ein Seufzen und fühlte sich gleich darauf bei diesem Anflug von Eitelkeit ertappt, als er aus dem Augenwinkel einen amüsierten Blick auffing.
»Du hast gut lachen«, verteidigte Jonathan sich angriffslustig, »du wirkst immer wie aus dem Ei gepellt!«
Mit einer Spur von Neid hatte der sonst so großzügige Jonathan den Lieutenant gemustert, der nach ihm in die Kabine getreten war, die sie sich während der Überfahrt von Kalkutta nach Suez geteilt hatten. Dieser Lieutenant war genau jener Typ Mann, der mit seinen ebenmäßigen, aristokratischen Zügen jungen Damen einen verklärten Glanz in die Augen zauberte. Die Khaki-Uniform mit dem weinroten Besatz an Kragen und Ärmelaufschlag schien perfekt auf sein sandfarbenes Haar und den leicht gebräunten Teint abgestimmt, und er trug sie mit einer natürlichen, kraftvollen Eleganz. Jonathan hingegen schien auf ewig dazu verdammt, der gute Freund zu sein, bei dem sich die holde Weiblichkeit ausweinte, wenn ihr ein Mann vom Schlage des Lieutenants das Herz gebrochen hatte. Dass sich die Kerben links und rechts von Jonathans Mundwinkeln beim Lächeln zu Grübchen vertieften, sich dabei die winzige Lücke zwischen seinen oberen Schneidezähnen zeigte und ihm so auch mit bald Ende zwanzig das Aussehen eines Lausbuben verlieh, machte es nicht besser.
Doch die entwaffnende Offenheit in den kieselgrauen Augen, als der Lieutenant ihm die Rechte entgegengestreckt und sich als Ralph Garrett vorgestellt hatte, besänftigte sogleich Jonathans Gefühl von Missgunst. Als er sein Gegenüber dann noch anhand der Uniformfarben als Angehörigen des Corps of Guides identifiziert hatte, war Jonathan sogar ziemlich beeindruckt gewesen. Wer dieser Elitetruppe der Königlichen Armee in Indien angehörte, konnte kein verweichlichter Drückeberger sein! Was sich rasch bestätigte, denn mit Ralph ließ sich trefflich trinken und Anekdoten über den Militärdienst in Indien austauschen. Und selbst ein Ralph Garrett kannte diese gewisse Art von Liebeskummer, gegen die nur Unmengen von Whisky halfen. Noch ehe die Precursor Kurs auf die hohe See genommen hatte, hatten die beiden Freundschaft geschlossen.
»Wie bitte?!« Irritiert sah Ralph nun an sich herunter. Seine eng anliegenden Hosen waren fleckig, die Stiefel staubig, der Uniformrock an den Achseln durchgeschwitzt. Und er spürte, dass sein sonst säuberlich gescheiteltes Haar zerwühlt war, einzelne Strähnen an seinen glühenden Schläfen klebten. »Du machst wohl Scherze, mein Freund! Oder bist du blind?!«, schalt er Jonathan gutmütig. Mit den Fingerspitzen fuhr er sich über die Bartstoppeln auf Kinn und Wangen, was ein scheuerndes Geräusch ergab. »Deine Eltern werden schöne Augen machen, wenn wir wie zwei Landstreicher heute Abend vor ihrer Tür stehen.«
Jonathan grinste, und in seinen grüngesprenkelten Augen blitzte es schelmisch auf. »Die sind Kummer gewohnt!«
»Du meinst, es geht wirklich in Ordnung, wenn ich eine Nacht bei euch bleibe?«, wollte sich Ralph nochmals vergewissern. Jonathan winkte leichthin ab. »Natürlich. Bei uns ist ohnehin immer offenes Haus. Meine Mutter kümmert sich gerne hingebungsvoll um müden und hungrigen Besuch, der unangemeldet zur Tür hereinschneit.« Ralph nickte dankbar und schwieg einen Moment, kniff dann leicht die Augen zusammen. »Wie muss ich mir denn deine Familie vorstellen?«
»Warte.« Jonathan zog aus der Innentasche seines Uniformrocks eine Brieftasche hervor und entnahm ihr eine Photographie in Schattierungen von Sepia und Beige. Sie war schon etwas angeschmutzt, an einer Seite eingerissen und hatte Eselsohren. Das Abschiedsgeschenk der Greenwoods, als sie den einzigen Sohn und Bruder vor drei Jahren schweren Herzens nach Indien hatten ziehen lassen, wo er in der Armee der East India Company als Assistenzarzt seinen Dienst aufgenommen hatte. Jonathan hatte das Bild seither immer als Talisman bei sich getragen.
»Darf ich bekannt machen«, verkündete er mit einer verbindenden Geste zwischen Ralph und der Photographie, »Lieutenant Ralph Garrett, vom Corps of Guides, zweitjüngster Sohn des dritten Baron Chelten– autsch!« Mit einem Tritt vors Schienenbein erinnerte Ralph ihn daran, dass er keinen großen Wert auf »diesen Adelskram« legte, wie er selbst es immer nannte.
»Typisch«, murrte Jonathan und rieb sich die malträtierte Stelle. »Adelig, jede Menge Geld und einen luxuriösen Familiensitz, aber ein Benehmen wie ein Schusterlehrling!« Lachend wich er Ralphs erneut drohendem Stiefel aus. »Darf ich dir jetzt meine Familie vorstellen oder nicht?« Auf Ralphs gnädiges Brummen hin rutschte Jonathan auf der Kante seines Sitzes vor, hielt das Bild schräg und tippte der Reihe nach auf die einzelnen Personen. »Mein Vater Gerald Greenwood, Professor für Alte Geschichte und Philologie am Balliol College. Meine Mutter Martha Greenwood, geborene Bentham. Unser Nesthäkchen Angelina –«
Ralph schnappte sich die Photographie und betrachtete sie eingehend. Anerkennend pfiff er durch die Zähne. »Zau-ber-haft! In der Zwischenzeit muss sie zu einer echten Schönheit erblüht sein. Ist sie noch zu haben?«
»Ich warne dich! Lass bloß deine Pfoten von ihr, du Schwerenöter«, rief Jonathan belustigt und wollte Ralph das Familienportrait wieder entreißen. »Außerdem ist sie launisch und trägt ihr Näschen sehr weit oben. Selbst du wärst meinem Schwesterlein nicht gut genug«, stichelte er, während er sich mit Ralph um das Bild balgte. Letzterer errang schließlich den Sieg in ihrer Rangelei, hielt die Photographie in die Höhe und Jonathan auf Armeslänge von sich. »Da sei dir mal nicht so sicher!«, entgegnete er mit breitem Grinsen. »Ich wüsste sie schon um den Finger zu wickeln und zu bändigen!«
»Ha, keine Chance, aber ich will dir ja nicht gleich jede Hoffnung nehmen!«, konterte Jonathan und warf sich in den Sitz neben Ralph, der sich erneut in das Gruppenbild vertiefte. Er deutete auf die vierte Person, ein junges, dunkelhaariges Mädchen, das etwas abseits der übrigen Familienmitglieder stand, die geballten Fäuste halb in den Falten ihrer Röcke verborgen. »Und wer ist dieses finster dreinblickende Geschöpf?«
Die Augenbrauen zusammengezogen, starrte sie wütend dem Betrachter entgegen, als sei sie mit Gewalt dazu gezwungen worden, sich vor die Linse der Kamera zu stellen. Das trotzig vorgereckte Kinn passte nicht zu ihrer linkischen Haltung, und der fast schon verbissene Ernst in ihrem Gesicht wirkte wenig jungmädchenhaft.
»Das ist meine andere Schwester Maya.« In Jonathans Stimme schwang unverhohlene Zärtlichkeit mit. »Sie ist ein feiner Kerl, ganz anders als Angelina. Bücher sind ihr Ein und Alles. Sie würde ihre Seele dafür verkaufen, an der Universität studieren zu dürfen, und sie kann es nicht verwinden, dass dort nur Männer zugelassen sind.« Unvermittelt ernst blickte er zum Fenster, das mit fortschreitender Dämmerung und dem Schein der mittlerweile auf dem Gang entzündeten Lampen vollends zum Spiegel geworden war. Und doch schien Jonathan hindurchzusehen, in eine nur für ihn sichtbare Ferne. »Manchmal mache ich mir Sorgen, was einmal aus ihr werden soll. Sie ist so verträumt und oft so unglücklich. Als gäbe es für sie keinen Platz, an dem sie je wirklich Wurzeln schlagen könnte …«
Um eine Erwiderung verlegen, reichte Ralph ihm wortlos die Photographie zurück und klopfte ihm mitfühlend auf die Schulter. Jonathan kaute auf seiner Unterlippe, als er nachdenklich das Bild wieder verstaute und aufstand. Die Handkanten gegen das kühle Glas gestützt, schirmte er sein Gesichtsfeld beidseitig gegen das Licht in seinem Rücken ab und starrte hinaus.
»Schnee«, murmelte er schließlich hingerissen. »Ich hatte völlig vergessen, wie Schnee aussieht.«
3
Es war eine einsame, eine verwunschene Landschaft, durch die Maya lief. Die Dämmerung breitete sich langsam aus, während der Schnee förmlich zu leuchten begann, kühl und geheimnisvoll. Die Äste der noch jungen Linden beiderseits der Straße bogen sich unter ihrer harschigen Last. Dahinter lagen still die weitläufigen Parkanlagen, die zu den alterehrwürdigen Steinbauten der Colleges gehörten: Wadham zur Linken, St. John’s und Trinity zur Rechten. Maya schreckte auf, als sich aus einer Hecke eine Krähe flügelschlagend abstieß und in einer pulvrigen Fontäne aufstieg, nur den Nachhall ihres heiseren Rufens zurücklassend.
Trotz des warmen Wollkleides und den Unterröcken aus Flanell fror Maya. Ihre bestrumpften Zehen fühlten sich in den geknöpften Stiefeletten schon ganz taub an. Sie ärgerte sich, nicht an ein wärmeres Cape gedacht zu haben oder wenigstens an Handschuhe, aber jetzt wieder umzukehren stand außer Frage. Unbeirrt lief sie weiter, hauchte immer wieder in ihre rot gefrorenen Hände, ehe sie sie wieder unter den Achseln vergrub. Als sie spürte, dass sich erneut eine Haarnadel löste, schüttelte sie unwillig den Kopf, bis auch die letzte Klammer kapitulierte und ihr Haar frei den Rücken herabfiel. Sollten die Leute doch denken, was sie wollten! Ihre Mutter würde sie ohnehin dafür schelten, bei Dunkelheit alleine unterwegs gewesen zu sein. Da spielte es auch längst keine Rolle mehr, ob sie dies mit oder ohne Hut tat. Und am heutigen Tag sowieso nicht.
Heute Abend, vor dem Dinner, sollte Maya ihrer Mutter freiwillig alle Briefe Richards aushändigen, die sich über die Jahre angesammelt hatten. Die Vorstellung, ihre Mutter würde all die Zeilen lesen, die nur für Maya bestimmt gewesen waren, war ihr unerträglich. Maya war fest entschlossen, sich zu weigern. Und sollte ihre Mutter ihre Drohung wahr machen, ihr Zimmer bis in den kleinsten Winkel danach absuchen zu lassen, wenn es sein musste, auch ganz Black Hall auf den Kopf zu stellen, würde Maya es vorziehen, den dicken Packen eigenhändig ins Kaminfeuer zu werfen. Auch wenn ihr allein schon bei dem Gedanken daran das Herz zu zerreißen drohte. Sie biss die Zähne zusammen und wünschte sich, noch viel weiter weg laufen zu können als bis ans Ende der Park Street.
Die Fassade von Wadham College, spitzgiebelig und zinnengekrönt wie eine mittelalterliche Burg, starrte abweisend aus dunklen Fensterhöhlen auf die Straße. Nur hinter einer der schmalen, mehrfach unterteilten Scheiben brannte noch Licht. Ein übereifriger Professor vermutlich, der keine Ferien kannte, denn die Studenten hatten schon vor einigen Tagen die Colleges mit Sack und Pack verlassen, waren ins ganze Land ausgeschwärmt, um die Feiertage bei ihren Familien zu verbringen. Oxford atmete erleichtert auf, sobald die Scharen wilder junger Männer fort waren, zu Weihnachten wie zu Beginn der langen Sommerferien. Eine beschauliche Ruhe kehrte dann ein, ohne Radau in den nächtlichen Gassen, ohne Kneipenrangeleien und freche Streiche – kleinere Gewitter, in denen sich überbordende Lebensenergie entlud, aufgestaut im strengen Tagesablauf von frühmorgendlicher Andacht, Vorlesungen, Studierstunden und Prüfungen. Es war eine wechselseitige Hassliebe zwischen town and gown, zwischen den Bürgern der Stadt und den Studenten in ihren langen schwarzen Gewändern. Eine Hassliebe, die in früheren Zeiten gar zu manch einer bewaffneten Auseinandersetzung geführt hatte. Und dennoch war man stolz auf den schon legendären Ruf Oxfords als Hort der Gelehrsamkeit und des Wissens, schien das Straßenbild in den Ferien unvollkommen ohne die vorübereilenden Studenten, die in den weiten Umhängen wie hektisch flatternde Falter wirkten.
Ungeduldig trat Maya von einem Bein auf das andere, als sie warten musste, bis hintereinander zwei Droschken in die Broad Street abgebogen waren. Gaslaternen entlang der großzügig angelegten Straße malten schon Lichtkreise in die einsetzende Dämmerung, und die Steinmauern der Häuser waren von den ersten goldenen Rechtecken erhellter Fenster durchsetzt. Maya hastete über die Kreuzung, an der die Park Street auf die Catherine Street traf. Pferdehufe und Wagenräder hatten den Schnee in schlüpfrigen Matsch verwandelt, der stellenweise bereits gefror. Sehnsüchtig streifte Mayas Blick die einladend erhellten Schaufenster im Erdgeschoss des schlichten, schnörkellosen Eckhauses gegenüber. Auch Bagg’s Coffee House war heute so gut wie leer; nur zwei der Tische waren mit Herren mittleren Alters besetzt. Wie immer, wenn Maya hier vorbeikam, übte das Kaffeehaus einen nahezu unwiderstehlichen Reiz auf sie aus. Hier gab es zum Kaffee oder Tee nicht nur Sandwiches mit kaltem Roastbeef, mit Cheddar und sauer eingelegten Zwiebelscheiben, sondern auch Zeitungen und Magazine aus England, Frankreich und Übersee, die zur freien Lektüre auslagen. Bei Bagg’s trafen sich die Studenten und Professoren auf einen Imbiss und die neuesten Nachrichten und Artikel, Karikaturen und Fortsetzungsromane; auf ein Schwätzchen untereinander und leidenschaftliche Diskussionen über Politik, Geschichte, Literatur, Wirtschaft und die Studienbedingungen an der Universität. Diskussionen, die weder von den warnenden Blicken einer Mutter, noch von nachdrücklichen Aufforderungen, Maya möchte in der Küche frischen Tee zubereiten zu lassen, unterbrochen wurden, obwohl die Kannen noch halb voll waren und dies im Grunde Hazels Aufgabe gewesen wäre – Diskussionen in einer Freiheit, nach der Mayas Seele so sehr dürstete und die ihr doch versagt blieb. Denn Bagg’s war wie die Fakultäten der Universität für Frauen tabu – sogar für die Tochter eines angesehenen Professors des Balliol Colleges. Warum nur blieb alles, was den Verstand anregte, den Männern vorbehalten?
Maya wechselte die Straßenseite. In tiefen Schatten lag das Säulenportal des klassisch gehaltenen Clarendon Buildings, in dem die Registratur der Universität untergebracht war. Die Statuen zu Ehren der neun Musen rings um das steinerne Satteldach, die Maya von klein auf fasziniert hatten, schienen sich Kapuzenumhänge aus dem Lavendelgrau des Himmels übergeworfen zu haben. Sie lief entlang des hohen Zaunes aus schmalen Eisenstäben, nahm schwungvoll die paar Stufen vor der geöffneten Gittertür und eilte über den kleinen Platz an der Rückseite des Clarendon. Geradeaus ließen sich die Konturen des Sheldonian Theatres erahnen: ein ovaler Bau, dessen hintere, plane Front wie abgeschnitten aussah und in dem Konzerte, Vorlesungen und festliche Anlässe des Universitätslebens stattfanden. Maya war einmal mit ihrem Vater die Wendeltreppe in die Kuppel des Sheldonian hinaufgestiegen. Von dort hatten sie durch die großen Fenster einen herrlichen Blick gehabt: auf all die graubraunen Dächer, die Türmchen und ziselierten Fialen, die Zinnen und Kuppeln der Stadt. Über die Mauern, die am Tag so warm und golden aus sich heraus strahlten, im Mondlicht jedoch silberweiß glänzten. Über die samtigen Grünflächen und Gärten, die beiden glitzernden Flüsschen, die Oxford umrahmten, den Cherwell und die Isis, die sich erst ein paar Meilen weiter zur Themse verbreiterte, bis hin zu den bewaldeten Hügelkuppen ringsum. Es waren Gebäude wie das Sheldonian und das Clarendon, mit Anklängen an den Stil der alten Griechen und Römer, die Oxford so ewig wirken ließen. Gebäude wie die der Colleges mit ihren weitläufigen Flügeln und zierlichen Aufbauten. Ganz so, als sei die Zeit hier stehen geblieben, auf dieser Insel jahrhundertealter Tradition in der fortschrittlichen Ära Königin Viktorias.