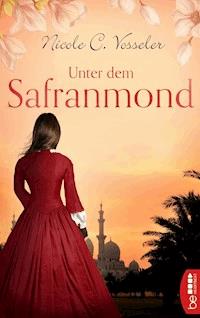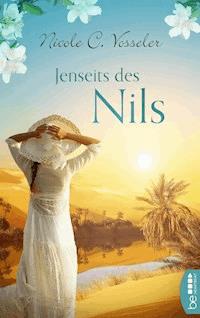
5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Große Gefühle in einer faszinierenden Welt
Es war der beste Sommer ihres Lebens, jener Sommer 1881. Ein Sommer der rauschenden Feste, der Freiheit, der ersten Liebe. Doch auf den Sommer folgt der Herbst, und Jeremy, Stephen, Leonard, Simon und Royston ziehen für Queen Victoria und ihr Empire in den Krieg. Für Grace und ihre Freundinnen beginnt eine Zeit des Wartens auf den Bruder, den Freund, den Liebsten. Doch nicht alle Männer kehren unversehrt zurück, in ein Leben, in dem nichts mehr so ist wie im Sommer. Und Grace, die sich nicht damit abfinden will, dass Jeremy im Kampf gefallen sein soll, macht sich auf, um ihn jenseits des Nils, in der unerbittlichen Wüste des Sudans, zu suchen ...
Dieser packende Roman führt Sie auf eine abenteuerliche Reise durch traumhafte und exotische Landschaften: von den grünen Wiesen Surreys über Ägypten bis in die Wüsten des Sudans.
Ein groß angelegtes Epos von Liebe und Krieg, in dem sich die Schicksale von neun jungen Männern und Frauen spannend miteinander verflechten.
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 766
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titel
Über dieses Buch
Über die Autorin
Impressum
Zitat
Widmung
Erstes Buch – Der letzte Sommer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Zweites Buch – In Liebe und Krieg
I – Feuer und Schwert
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
II – Eine Handvoll Staub
32
33
34
35
36
37
III – Die diamantene Zisterne
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Sommer 1894
Nachwort
Personenverzeichnis
Über dieses Buch
Große Gefühle in einer faszinierenden Welt
Es war der beste Sommer ihres Lebens, jener Sommer 1881. Ein Sommer der rauschenden Feste, der Freiheit, der ersten Liebe. Doch auf den Sommer folgt der Herbst, und Jeremy, Stephen, Leonard, Simon und Royston ziehen für Queen Victoria und ihr Empire in den Krieg. Für Grace und ihre Freundinnen beginnt eine Zeit des Wartens auf den Bruder, den Freund, den Liebsten. Doch nicht alle Männer kehren unversehrt zurück, in ein Leben, in dem nichts mehr so ist wie im Sommer. Und Grace, die sich nicht damit abfinden will, dass Jeremy im Kampf gefallen sein soll, macht sich auf, um ihn jenseits des Nils, in der unerbittlichen Wüste des Sudans, zu suchen ... Dieser packende Roman führt Sie auf eine abenteuerliche Reise durch traumhafte und exotische Landschaften: von den grünen Wiesen Surreys über Ägypten bis in die Wüsten des Sudans. Ein groß angelegtes Epos von Liebe und Krieg, in dem sich die Schicksale von neun jungen Männern und Frauen spannend miteinander verflechten.
Über die Autorin
Nicole C. Vosseler wurde 1972 in Villingen-Schwenningen geboren und studierte nach dem Abitur Literaturwissenschaft und Psychologie in Tübingen und Konstanz, wo sie heute lebt. 2007 wurde die SPIEGEL-Bestsellerautorin für ihren Roman »Der Himmel über Darjeeling« mit dem Konstanzer Förderpreis in der Sparte »Literatur« ausgezeichnet. Ihre Bücher wurden bisher in acht Sprachen übersetzt. Wie die Heldinnen ihrer farbenprächtigen Romane sucht auch sie gerne mal das Abenteuer.
Mehr über die Autorin und Hintergrundinformationen zu ihren Romanen finden Sie unter: https://www.nicole-vosseler.de/
Nicole C. Vosseler
Jenseitsdes Nils
beHEARTBEAT
Digitale Neuausgabe
»be« – Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Agentur: Montasser Media
Copyright © 2012/2018 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat: Dr. Stefanie Heinen
Textredaktion: Monika Hofko, München
Umschlaggestaltung: Guter Punkt, München | www.guter-punkt.de unter Verwendung von Motiven © thinkstock: KariHoglund | Arndt_Vladimir; © shutterstock: BLACKDAY | Denis Burdin
E-Book-Produktion: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN 978-3-7325-5885-8
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
… und wie das ausdauernde Kamel,
fortgetrieben von der diamantenen Zisterne
unter Palmen, das sich quält durch tiefste Mondennacht,
durch die weiße Glut des blendend Tags, die peitscht
aus den Mulden im Sand; dennoch in ihm ein Schluck
des geliebten, süßen Wassers bleibt und bewahrt
seine Schritte vor dem Fall und seine Seele
vor des Todes Bitternis.
ALFRED LORD TENNYSON,THE LOVER’S TALE
Für Jörg,
der mich ein Stück weit
durch die Wüste getragen hat,
um mir den Garten zu zeigen,
den er darin für mich schuf
Erstes BuchDer letzte Sommer
Oh wie ich lieb’ – an einem Sommerabend lau,
wenn Fluten Lichts ergießen sich im goldnen Westen
und silbern Wolken auf den milden Zephyrn
friedlich ruh’n – zu lassen weit, weit hinter mir
all niedrig Gedanken, mir Aufschub zu gönnen
von kleinen Sorgen; zu finden, fast ohne Müh’,
eine duftend Wildnis, gewandet in der Schöpfung Reiz
und dort zu wiegen in trügerischer Wonne meine Seel’.
JOHN KEATS
Es gibt Jahreszeiten im Leben eines Menschen, die sich tiefer ins Gedächtnis eingraben als die zuvor und all jene danach.
Ein Winter in der Kindheit, in dem es nicht mehr aufhörte zu schneien und die Welt still wurde unter ihrer dicken weißen Decke. Jener Winter, in dem Schneeschaufeln an den Straßen und Wegen mannshohe Berge aufhäuften, die dazu einluden, sie zu erklimmen und dann unter Freudengekreisch auf dem Hosenboden hinabzurutschen, wieder und wieder. Rot gefrorene Wangen, steife Fingerchen und Zehen, die vor dem Kaminfeuer unter Piksen und Kribbeln wieder auftauten, und der Geschmack von braunrunzeligen Bratäpfeln, säuerlich und durchtränkt von zuckriger Süße, dem kräftigen Aroma von Zimt und Nelken. Ein Herbst, in dem die Bäume in Flammen standen und das Licht der tief stehenden Sonne schwer und golden durch die Äste troff. Dieser eine Herbst, in dem sich Leib und Seele satt fühlten nach heißen Tagen und lauen Nächten; so satt von blauem Himmel und vom Duft blühender Wiesen, dass der Abschied vom Sommer leichtfiel. Jener eine Frühling, in dem die Knospen fast über Nacht aufbrachen, gerade als man glaubte, der Winter würde nie mehr enden.
Genauso gibt es Sommer, die man niemals mehr vergisst. Keiner von ihnen sollte diesen einen Sommer je vergessen, Jeremy und Grace ebenso wenig wie Leonard, wie Cecily oder wie Becky. Und auch Ada und Stephen, Royston und Simon erinnerten sich bis zu ihrem letzten Atemzug an jenen Sommer des Jahres 1881.
An jenen Sommer, der früh ins Land zog, im Mai schon, und der so reichlich seine Gaben über dem Süden Englands ausgoss. Als müsste er wiedergutmachen, was ein eisiger, von einem tosenden Schneesturm begleiteter Januar angerichtet und was ein kaltherziger Frühling versäumt hatte. Es war ein Sommer, der aus dem Vollen schöpfte, an Farben, an Wärme, an Lebendigkeit, und eine Zeit, die für sie alle so viel bereithielt. Tage, angefüllt mit Lachen und süßem Nichtstun, und durchfeierte Nächte. Enge Freundschaftsbande und erste Liebe. Ein Dasein im Jetzt, den Goldschimmer eines verheißungsvollen Morgens am Horizont, berauscht davon, jung zu sein und frei, unbezwingbar und unsterblich.
Es war in jenem Sommer, dass das Leben erst richtig begann.
Der Sommer, in dem Ada Norbury wieder nach Hause kam.
1
Schweratmig und unter einer Rauchsäule schob sich der Zug der London & Southwestern Railway von Waterloo aus südwärts, in den sonnigen Maimorgen hinein; eine dickhäutige Raupe, die sich ihren vorgezeichneten Weg durch die Wiesen und Felder fraß.
Über Adas Gesicht huschte ein Lächeln, wenn ein Waldrand, ein Dorf oder ein einsames Cottage noch genauso aussah, wie sie es in Erinnerung hatte, und ihre dunklen Augen wurden groß, wenn sie etwas entdeckten, das ihr neu war. Viel war es nicht, was sich verändert hatte; hier in Surrey schien die Zeit stehen geblieben zu sein. Sanfte Landstriche, ewig friedlich, ewig beschaulich, geradezu verträumt. Als der Zug bei Weybridge hielt, schlug Adas Herz schneller, und als die Eisenräder über die Brücke ratterten, die den Wey überspannte, wurde es groß und weit.
Changierend wie Moiréseide wand sich das seladongrüne Band des Wey durch Surrey und ergoss sich hinter Weybridge in die Themse, die seine Wasser durch London trug und schließlich dem Meer übergab. Doch noch ehe der Wey auf seinem Weg nach Norden das verschlafene Städtchen von Guildford durchfloss, nahm er bei Shalford ein Flüsschen in sich auf, von dem die Norbury-Kinder früher geglaubt hatten, es gehörte ihnen allein. Das behagliche Glucksen des Cranleigh Waters, so schmal und klein, dass er in den hohen Wiesen, im Dickicht unter den Weiden und Eschen oftmals fast verschwand, war an stillen Nachmittagen und in den noch stilleren Nächten bis in den Garten zu hören. Und immer wenn es auch nur annähernd warm genug war, liefen sie hinunter, um aus Matsch, aus Zweigen und Grasbüscheln Dämme zu bauen, um Schiffchen schwimmen zu lassen oder johlend und kreischend darin herumzuplanschen. Selbst dann noch, als sie eigentlich schon zu groß dafür geworden waren.
Sehnsucht durchzog Adas zittrige Vorfreude, dieselbe Sehnsucht, die in all den Monaten nie erloschen, nur leiser geworden war. Seit ihrem Aufbruch in dieses lockende, furchteinflößende Abenteuer, das eine schmerzliche Trennung bedeutet hatte und das letztlich nichts anderes gewesen war als eine Flucht.
Ihre Finger umklammerten eine Handvoll des festen Stoffs, aus dem ihr schmaler Rock geschneidert war, strichen ihn gleich darauf wieder glatt, sorgsam, andächtig beinah. Eine hüftlange, taillierte Jacke in demselben satten Bordeauxrot gehörte dazu und ein passendes Hütchen. Ein Modell aus Paris, nahezu unverwüstlich, Mademoiselle!, wie man ihr im Modesalon in der Rue de la Paix versichert hatte. Ein Kostüm, wie geschaffen für eine moderne, selbstsichere, weltgewandte junge Frau.
»Entschuldigen Sie bitte – fahren Sie auch bis Portsmouth?«
Ada zuckte zusammen, und das Blut stieg ihr in die Wangen. Unter halb gesenkten Lidern musterte sie scheu die ältliche Dame in Witwentracht, die bei ihr im Abteil saß und mit der sie abgesehen von einem kurzen Höflichkeitsgruß beim Einsteigen bislang kein Wort gewechselt hatte.
»Nur bis Guildford«, gab sie leise zur Antwort und brachte sogar ein kleines Lächeln zustande.
»Ach.« Die Reiselektüre, die bislang die Aufmerksamkeit der Dame gänzlich in Anspruch genommen hatte, wurde kurzerhand zugeklappt. »Sehen Sie mal an, so kann man sich täuschen! Am Bahnsteig fiel mir Ihr umfangreiches Gepäck ins Auge, und ich dachte noch, was lässt man das arme Kind ganz allein so weit reisen!«
»Es ist ja nur eine Dreiviertelstunde zu fahren – da ist es doch nicht der Mühe wert, dass man mich in London eigens abholt.« Ada bemühte sich, so zu klingen, als handle es sich dabei um eine Selbstverständlichkeit, und dennoch war sie stolz darauf, diese Fahrt allein zu unternehmen. »Ich komme gerade von einer Reise über den Kontinent zurück«, fügte sie, mutig geworden, hinzu. »Mehr als ein Jahr war ich fort, und gestern erst sind wir in Dover wieder an Land gegangen.«
Achtlos legte Adas Gegenüber das Buch nun beiseite und faltete die Hände im Schoß. »Eine Bildungsreise? Wie herrlich! Waren Sie denn auch in Italien?«
Ada nickte. »Und in Frankreich und in Deutschland. Sogar in Griechenland.«
Ein Abglanz dessen, was sie gesehen, was sie erlebt hatte, ließ ihr Gesicht aufleuchten: ihre Fahrt zu Schiff den Rhein hinab und das Heidelberger Schloss, dessen rötlicher Stein in der Abendsonne gloste; die liebliche Landschaft des Genfer Sees und die morbide Eleganz der Palazzi in Venedig. Die Türme und Kuppeln von Florenz, die Brunnen und die antiken Ruinen Roms, wo sie eine Rose auf Keats’ Grab niedergelegt hatte, und die Akropolis von Athen. Und Paris, vor allem Paris, mit all seinen zauberhaften Cafés, den Staffeleien der Maler und den kleinen Buden der Buchhändler an der Seine, dem prunkvollen Louvre und der schaurig-schönen Kathedrale von Notre-Dame.
»Wie wunderbar!« Ihre Mitreisende seufzte auf. »Nichts vermag den Horizont so zu erweitern wie das Reisen, nichts die Seele so zu erfreuen. Davon werden Sie gewiss noch Jahre zehren!«
Ada lächelte, offener diesmal. »Ich kann es kaum erwarten, meinen Eltern und meinen Geschwistern davon zu erzählen.«
Ihr Gegenüber wiegte bedächtig den Kopf, die knitterige Partie um die Augenwinkel in gütigem Wohlwollen enger zusammengezogen. »Sie müssen gewiss überquellen von all den Eindrücken, den großen und kleinen Begebenheiten während Ihrer Reise. Ach, und Ihre Familie wird so froh sein, Sie gesund in die Arme schließen zu können und Sie wieder in ihrer Mitte zu wissen!«
Ein Schatten legte sich auf Adas Gesicht, und unruhig verschränkten und lösten sich ihre Finger. In der Fremde war ein Wunsch in ihr aufgekeimt und unter Zypressen und Olivenbäumen in langen Gesprächen mit Miss Sidgwick zum Entschluss gereift. Ein Vorhaben, mit dem Ada über kurz oder lang ihren Eltern würde entgegentreten müssen. Nicht heute und auch nicht morgen. Aber bald. Noch ehe der Sommer um sein würde.
»Guild-fooord! Nächster Halt Guild-fooord!«
Der Ruf des Schaffners, der vor der Abteiltür vorbeimarschierte, und die spürbar gedrosselte Fahrt des Zuges entbanden Ada von der Notwendigkeit einer Erwiderung. Fahrig streifte sie die Handschuhe über und griff zu ihrem Täschchen.
»Ich muss aussteigen. Ihnen noch eine gute Reise.«
»Haben Sie vielen Dank. Und Ihnen ein gutes Ankommen in der alten Heimat!«
Bremsen kreischten, es gab einen Ruck, dann kam der Zug unter dem Prusten und Schnauben der Lokomotive zum Stehen. Die Tür flog auf, die Metallstufen wurden ausgeklappt, und an der Hand des bereitstehenden Schaffners stieg Ada aus.
Dampf und Rauch verschleierten den überdachten Bahnsteig und hüllten die Menschen in dichten Nebel, die vor dem klobigen Backsteinbau darauf warteten, in Richtung Portsmouth aufzubrechen oder ihre aus London eingetroffenen Lieben abzuholen. In den Schwaden, die sich nur zögerlich auflösten, luden Träger die Koffer und Reisetaschen für Guildford aus und hievten das zur Weiterfahrt bereitstehende Gepäck hinein.
»Da ist sie! Ads! Hier sind wir! Hier! Ads!«
Der altvertraute und nie wirklich abgelegte Kosename ließ Ada sich umdrehen. Lachend und leichtfüßig, wie ein Sonnenstrahl, der frühmorgendlichen Dunst durchbrach, lief Grace ihr entgegen, den Rock ihres blau geblümten Kleides mit der einen Hand gerafft, während die andere den kleinen Strohhut auf dem hellen Haar festhielt.
»Gracie!« Ein Ausruf, der einem Schluchzen gleichkam.
Die Schwestern hielten einander fest, als wollten sie sich nie mehr loslassen.
»Willkommen zu Hause, Liebes.« Die Stimme ihrer Mutter hüllte sie ein, weich und zärtlich wie eine Liebkosung.
»Mama!« Ada schmiegte sich an sie, als sei sie nicht siebzehn, sondern erst zwölf, sog den Duft nach Lavendel und Zitronenverbene ein, der für sie eins war mit Geborgenheit, solange sie zurückdenken konnte. Ihre Augen füllten sich mit Tränen, die Beckys vergnügtes Grübchenlächeln verschwimmen ließen. Und Ben, der gute alte Ben, grinste über das ganze verwitterte, apfelbäckige Gesicht und tippte sich an die Tweedmütze, bevor er sich nach den Koffern bückte, deren Anhänger mit »Ada Norbury, Shamley Green, Surrey, England« beschriftet waren.
Adas Herz schwoll an vor Glückseligkeit, bis es beinahe zerbarst.
Ich bin wieder zu Hause.
2
»… nehmen wir als Beispiel Lord Raglans Erkundungsritt in der Schlacht an der Alma.«
Colonel Sir William Lynton Norbury machte eine bedeutungsvolle Pause. Seine Augen, kühl und scharf und durchdringend, wanderten über die gut zwanzig jungen Männer, die in ihren marineblauen Uniformen immer zu zweit in den Holzbänken saßen und seinen Blick aufmerksam erwiderten.
Aus dunkelblauem Tuch war auch seine eigene Uniform, jedoch entlang der Hosennaht mit einem scharlachroten Streifen versehen, der ihn als Vorgesetzten und Ausbilder auswies, und während sich die Kadetten mit Messingknöpfen als alleinigem Zierrat begnügen mussten, bezeugten Abzeichen am Stehkragen und auf den Schulterstücken des Colonels Rang.
Hochgewachsen und sehnig, fast hager, hatte er auch lange nach seinem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst nichts von der militärisch strammen Haltung eingebüßt, die ihm in all den Jahren in Fleisch und Blut übergegangen war. Obschon es ihn heute, mit bald sechzig, zunehmend Anstrengung kostete, diese beizubehalten. Die klaren, wie herausgemeißelten Züge seines Gesichts waren mit der Zeit verwittert, abgeschliffen von den scharfen Winden des Hindukusch, ausgewaschen vom Monsun und abgeschmirgelt vom Sand der Wüste. Sengende Sonne und Fieber hatten Linien und Furchen eingegraben, das einst braune Haar zu Eisgrau abgelaugt. Äderchen waren unter dem Biss von Frost und Schnee geplatzt, überzogen Wangen und Nase mit einem feinen Netz von Rötungen. Ein Gesicht, gezeichnet von Mühsal und Krieg, von einem Leben auf Messers Schneide zwischen Töten und Getötetwerden, aber auch geprägt vom Stolz, der Krone mit Leib und Seele gedient zu haben; ein Gesicht, das den Kadetten ihre Zukunft vor Augen hielt und ihnen einen Vorgeschmack bot auf das, was sie erwartete.
»Wer erklärt sich zu einer kurzen Zusammenfassung bereit?«
Aus den Augenwinkeln bemerkte er eine Hand, die sich in der ersten Reihe hob, die Finger locker und der Ellenbogen auf der Tischplatte ruhend, aufmerksam und dennoch lässig, mehr selbstsicher denn strebsam. Dieselbe Hand, die sich immer hob, wenn es eine Frage zu beantworten galt.
Seine Wahl fiel auf einen Offiziersanwärter, der das kantige Kinn auf die Faust gestützt hatte und aus glasigen Augen in die Ferne blickte. Das Gähnen, das der Kadett unterdrückte, lief wie ein Krampf durch seine untere Gesichtshälfte, und unter der Bank wippte ein Knie zu einem unhörbaren Takt, der sich in der schnellen, pendelnden Bewegung des Federhalters zwischen zwei Fingern wiederholte.
»Kadett Digby-Jones!«
Der Kopf mit dem streichholzkurzen lichtbraunen Haar ruckte hoch, und wie ein Schachtelteufel sprang Simon Digby-Jones auf. »Bitte um Verzeihung für meine Unachtsamkeit, Colonel Sir!«
Aus großen Augen sah er den Colonel an. Grau waren sie wie Regenwolken und ebenso veränderlich: In einem Moment noch rauchig in Schuldbewusstsein, klarten sie sogleich auf, bis sie fast ins Bläuliche spielten, und der breite, geschwungene Mund verzog sich auf einer Seite nach oben. »Ich bin einfach machtlos dagegen – sobald ich den Namen Alma höre, wandern meine Gedanken in gänzlich andere Gefilde!«
Vielstimmiges, wissend-raues Gelächter brandete auf, in dem Simon Digby-Jones sichtlich badete.
Die schmalen Lippen des Colonels zuckten flüchtig unter dem silbrigen Oberlippenbart, verhärteten sich dann sogleich wieder. »Ihnen wird das Lachen schon noch vergehen, Gentlemen. Und Ihnen, Mr Digby-Jones, erst recht.«
Augenblicklich herrschte wieder Stille im Raum. Colonel Norbury entging nicht der Verschwörerblick, den Digby-Jones mit den beiden Kadetten in der benachbarten Bank wechselte, als er sich wieder setzte.
»Kadett Ashcombe!«
Royston Ashcombe, der sich mit gelangweilter Miene in die Bank geflegelt hatte, als sei er nur aus Versehen hierhergeraten, setzte sich auf und erhob sich schließlich zu seiner vollen Größe.
»Um eine bessere Sicht auf das Schlachtfeld zu erhalten, ritt Lord Raglan mit seinem Stab über den Fluss«, leierte er herunter, »an der französischen Schützenlinie unter Marschall de Saint-Arnaud zur Linken vorbei und durch die gegenüberliegende russische Schützenlinie unter General Menschikow. Oben auf dem Bergrücken angelangt, befand er diesen für eine hervorragende Geschützstellung und ließ Neunpfünder dort positionieren, mit denen er die Russen zum Rückzug zwang.« Er erwiderte das knappe Nicken des Colonels und ließ sich in die Bank zurückfallen.
»Ich würde gerne Ihre Meinung dazu hören, Gentlemen – wie ist diese Entscheidung Lord Raglans aus taktischer Sicht zu bewerten?«
Die Kadetten sahen sich verunsichert an und beschäftigten sich sogleich angelegentlich mit ihren Schreibutensilien; urplötzlich schien es nichts Wichtigeres zu geben, als die Kolben der Federhalter neu zu befüllen und Bleistifte anzuspitzen.
Colonel Norbury war für seine Fangfragen berüchtigt, besonders wenn es Schlachten betraf, in denen er selbst gekämpft hatte. Er war dabei gewesen, in jenem Krieg vor gut dreißig Jahren, lange bevor die jungen Männer geboren waren, als auf der Krim englische und französische Truppen mit den Soldaten des Zarenreichs in tödlicher Umklammerung lagen. In der Schlacht an der Alma, in der Schlacht von Inkerman, als das Regiment des Colonels mehr als die Hälfte seiner Männer verlor. Es mögen nur wenige vom 95. übrig sein – aber die sind aus Eisen gemacht, hieß es danach über dieses Regiment, und niemand hier am Royal Military College hegte Zweifel an dieser Aussage.
In der ersten Reihe war wieder eine Hand zu sehen, dieselbe wie zuvor, und geradezu herausfordernd langsam ging der Colonel darauf zu, jeder seiner Schritte ein klackender Akzent. Nur wer genau hinsah, bemerkte, dass er dabei mit dem linken Bein vorsichtiger auftrat. Ein Überbleibsel seiner schweren Verwundungen während des Aufstands in Indien, die das Ende seines aktiven Dienstes bedeutet hatten. Das Victoria Cross, die höchste militärische Auszeichnung des Empire – von vielen begehrt, doch nur den allerwenigsten für herausragende Tapferkeit im Angesicht des Feindes verliehen –, war sein Trost dafür gewesen, und hier in Sandhurst machte es Colonel Norbury beinahe zu einer Legende.
Stephen zog den Kopf ein, als sich der Colonel auf die Bank zu bewegte. So starr sich seine Augen auf die Notizen vor ihm hefteten, so fieberhaft drückte sein Daumen die Kappe des Füllfederhalters auf und zu. Knick-knack. Knick-knack. Knick-knack. Kalter Schweiß brach ihm aus, als der Colonel unmittelbar vor ihm stehen blieb und er sich von dessen Augen durchbohrt fühlte. Nimm Jeremy dran, bat er stumm. Du siehst doch, dass er sich drum reißt! Nimm ihn dran! Bitte, verschon mich heute!
»Kadett Norbury!«
Es war schlimm genug, hier sein zu müssen, in Sandhurst. Doch als Sohn des Professors für Gefechtsführung in dessen Unterricht zu sitzen war die Hölle.
Mit weichen Knien stemmte Stephen sich hoch. Er musste seine ganze Kraft zusammennehmen, um dem Colonel in die Augen zu sehen, wie es Anstand und Respekt geboten. Keine Güte oder Milde konnte er darin lesen, in diesen Augen, die den seinen so gar nicht ähnelten. Stephen und seine Schwestern hatten die braunen Augen ihrer Mutter; von ihr hatte Stephen auch den empfindsamen Mund geerbt und die hohen Wangenknochen, während er sonst bis hin zum nussbraunen Haar, fein und weich wie Daunenfedern, äußerlich ganz seines Vaters Sohn war.
»Nun?«
»Lord … Lord Raglans Ritt war eine Tat heldenhaften Mutes, Colonel Sir«, gab Stephen gehorsam das wieder, was sein Vater ihn gelehrt hatte.
»Weshalb?«
»Weil …« Stephens Stimme versagte, und jeglicher Gedanke, den er sich zuvor zurechtgelegt hatte, zerfaserte unter dem strengen Blick des Colonels und löste sich in einer weißen Wattigkeit auf, bis sein Kopf wie leergefegt war.
Die Art, wie der Colonel durch die Nase Luft holte, verriet ihm, dass dessen Geduld bereits erschöpft, aber auch, dass er gnädig entlassen war. Mit einem tiefen Ausatmen setzte sich Stephen. Und mit einem elenden Gefühl in der Magengrube.
»Da Sie offenbar ein solch großes Mitteilungsbedürfnis besitzen, Kadett Danvers«, richtete Colonel Norbury das Wort an Stephens Banknachbarn, der noch immer mit erhobener Hand dasaß, »sind wir natürlich äußerst gespannt, was Sie zu sagen haben.«
»Danke, Colonel Sir.« Ohne übergroße Eile stand Jeremy Danvers auf und nahm seine bevorzugte Haltung ein, Schultern straff, Kinn hochgereckt und die Hände hinter dem Rücken verschränkt. »Meiner Ansicht nach ist der Erkundungsritt von Lord Raglan nicht anders als fahrlässig und leichtfertig zu bezeichnen.«
Irgendwo in den hinteren Reihen zischelte jemand missbilligend, und eine Braue des Colonels schnellte hoch. »Tatsächlich? Was lässt Sie zu diesem Schluss kommen?«
»Lord Raglan nahm nicht nur in Kauf, selbst getötet zu werden – er hat auch die Mitglieder seines Stabes in Gefahr gebracht. Das Risiko, dass der Truppenverband von einem Augenblick zum anderen ohne Führung dastehen würde, war beträchtlich. Die einzelnen Divisionen wieder unter einheitlichem Kommando zu versammeln hätte kostbare Zeit verstreichen lassen. Ein Umstand, den der Feind zu seinem Vorteil hätte nutzen können. Im ungünstigsten Fall wäre eine vernichtende Niederlage unserer Truppen die Folge gewesen.«
Colonel Norbury musterte den Kadetten einige Augenblicke lang, als könnte er ergründen, was hinter dessen ebenholzdunklen Augen vor sich ging. Jeremys Gesicht mit den starken Brauen blieb unbewegt; allenfalls sein Mund, schmal und flach wie ein Einschnitt, ließ auf eine gewisse Anspannung schließen.
»Dann«, begann der Colonel langsam, »würde mich doch sehr Ihr Urteil über General Gough interessieren, der am zweiten Tag der Schlacht von Ferozeshah in seinem weißen Mantel vorausritt, um das feindliche Feuer von seinen Soldaten abzulenken.«
Einen Herzschlag lang war es totenstill im Raum.
»Es steht mir nicht zu, über die Person General Goughs ein Urteil zu fällen, Colonel Sir«, kam Danvers’ Antwort ohne langes Zögern. Seine tiefe, wie aufgeraute Stimme klang ruhig, blieb sicher. »Schließlich war ich damals nicht vor Ort – im Gegensatz zu Ihnen, Colonel Sir. Aus rein taktischer Sicht jedoch war auch dies ein unnötiges und äußerst leichtfertiges Manöver. Zugegebenermaßen wirkungsvoll, aber ohne großen Nutzen für den Ausgang der Schlacht.«
Die Augen des Colonels verengten sich, wirkten stählern. »Verstehe ich Sie richtig, Mr Danvers: Sie stellen also die kühne These auf, wir unterlägen alle einem Irrtum, wenn wir sowohl Lord Raglan als auch General Gough für ihren Heldenmut bewundern?«
»Plebejischer Nestbeschmutzer«, zischte es aus der letzten Reihe.
Nicht einmal ein Wimpernzucken ließ erkennen, ob Jeremy Danvers es gehört hatte. Der Colonel indes hatte ein Ziel gefunden, an dem sich seine Verärgerung entladen konnte. »Sie, Highmore, halten den Mund! Es sei denn, ich fordere Sie dazu auf oder Sie wissen etwas Sinnvolles beizutragen!«
»Jawohl, Colonel Sir«, presste Freddie Highmore zwischen den Zähnen hervor und verkroch sich hinter dem Rücken des Offiziersanwärters, der vor ihm saß.
Wie ein Raubvogel, der auf seine Beute hinabstößt, wandte sich Colonel Norbury wieder Jeremy Danvers zu. »Habe ich Sie richtig verstanden, Mr Danvers?!«
In einem unausgesprochenen Kräftemessen sahen sich der Colonel und der Kadett in die Augen.
»Nein, Colonel Sir. Meine Aussagen bezogen sich lediglich darauf, dass sowohl Lord Raglan als auch General Gough ein großes Risiko eingingen und dabei die Verantwortung für die ihnen unterstellten Truppen vernachlässigten. Das Ziel eines jeden Krieges muss sein, den Feind zu schlagen und dabei die eigenen Verluste so gering wie möglich zu halten.«
»Aber beide hatten doch Erfolg, nicht wahr?« Die Stimme des Colonels, brüchig geworden unter Hitze und Kälte, spröde nach Jahrzehnten des Befehlstons, klang unvermittelt geschmeidig.
»Sie hatten Glück.«
Ein Raunen brodelte durch die Kompanie.
»… respektlos und anmaßend …«, zischte jemand.
»Wofür hält der sich!«, giftete ein anderer.
Mit einer knappen Geste brachte Colonel Norbury die Unmutsäußerungen zum Verstummen.
»Mr Danvers, ich rate Ihnen dringend, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, was unsere Armee wäre ohne Männer wie Lord Raglan oder General Gough. Männer, die maßgeblich am Aufbau unseres Empires beteiligt waren und es zu dem machten, was es heute ist.«
Worte, die einen Schlusspunkt unter diese Diskussion setzen sollten, doch Kadett Danvers fuhr unbeirrt fort:
»Ich will deren Leistung nicht in Abrede stellen, Colonel Sir. Letztlich ist es jedoch die Gesamtheit der Truppen, die über Sieg oder Niederlage entscheidet. Eine erfolgreiche Schlacht, ein gewonnener Krieg ist nie auf die Taten eines einzelnen Mannes zurückzuführen, sondern auf die vieler.«
Möglich, dass Jeremy Danvers bei diesen Worten an seinen Vater dachte; zumindest lag diese Vermutung für Colonel Norbury nahe, wenn auch nichts in der undurchdringlichen Miene oder in der gleichbleibend festen Stimme des Kadetten Aufschluss darüber gab. Die Tapferkeit von Private Matthew Danvers, der damals als Invalide von der Krim zurückgekehrt war, stellte einen der Punkte in Jeremy Danvers’ Lebenslauf dar, die ungeachtet aller Bedenken für die Annahme seiner Bewerbung ausschlaggebend gewesen waren; eine alte, nie verjährte Schuld der Armee, beglichen am nachgeborenen Sohn.
»Ja, Kadett Hainsworth?«
Sämtliche Augenpaare richteten sich auf den Kadetten, der auf sein Handzeichen hin das Wort erteilt bekam.
Nicht durch sein Aussehen allein stach er in Sandhurst aus der Masse der blau uniformierten Offiziersanwärter heraus, mit dem welligen Haar in der Farbe von Honig und Weizen, das sich trotz des kurzen Militärschnitts im Nacken kräuselte, und mit den Augen, die so blau waren wie der Sommerhimmel über Surrey. Seine Züge waren nicht unbedingt vollkommen zu nennen; dafür war die Nase eine Spur zu stark geraten, das Kinn, in dem sich wie ein Fingerabdruck ein Grübchen andeutete, etwas zu herb und die Augen, deren Schnitt zu den Schläfen hin leicht abfiel, ein wenig zu schmal. Dennoch war er nicht anders als gutaussehend zu nennen. Ein Strahlen ging von ihm aus, das einen auf der Stelle für ihn einnahm, etwas Sonniges, Heiteres, Leichtes. Vor allem wenn er lächelte oder lachte, was er oft tat, und Leonard James Hainsworth Baron Hawthorne, der Sohn des Earl of Grantham, hatte auch allen Grund dazu, hatte es immer gehabt.
»Colonel Sir.« Er nickte seinem Professor zu, bevor er Danvers ansprach, der sich halb zu ihm umgedreht hatte. »Im Großen und Ganzen teile ich deine Ansicht, Jeremy. Nur – wie willst du später als Offizier deine Männer dazu bewegen, ihr Bestes zu geben? Bis zum Äußersten zu gehen?« Einen nach dem anderen sah er die umsitzenden Kadetten an, bedachte sie mit einem Lächeln, das die Kerben um seine Mundwinkel vertiefte und das ebenso gewinnend war wie schelmisch. Ein Lächeln, das unwiderstehlich anzog, das unwillkürlich ansteckte und beifälliges Murmeln auslöste. »Das kannst du doch nur erreichen, indem du selbst ihnen ein Vorbild bist und im Ernstfall alles auf eine Karte setzt! Wenn der Offizier seinen Heldenmut unter Beweis stellt, wird jeder einzelne Soldat es ihm gleichtun.«
Faul, aber begabt, der geborene Wortführer, lautete in Sandhurst das einhellige Urteil über Leonard Hainsworth. Letzteres weniger aufgrund von Herkunft und Stand, denn aus guten bis noblen Familien mit entsprechendem Grundbesitz und Vermögen stammten hier so gut wie alle; vielmehr waren es Hainsworth’ Erscheinung und sein Charakter, die ihn zum Idealbild eines Offiziers machten, und Colonel Norbury fühlte Stolz in sich aufsteigen, einen Kadetten wie ihn in diesem Jahrgang zu haben.
»Ein wichtiger Punkt, Mr Hainsworth.«
Er wartete, bis die beiden auf einen Wink von ihm Platz genommen und bis sich die Aufmerksamkeit der ganzen Kompanie wieder auf ihn gerichtet hatte.
»Was Sie sich immer, unter allen Umständen, vor Augen halten müssen: Sie werden nicht nur Offiziere sein, sondern vor allem Gentlemen. Beides ist nicht voneinander zu trennen. Sie werden nicht nur die Krieger sein, die den Frieden unserer Nation verteidigen und bewahren. Sie werden eines Tages zur Elite dieses Empires zählen.« Der Colonel hielt inne, um die Bedeutsamkeit seiner Worte hervorzuheben, und der Glanz in den Augen der Kadetten bestätigte ihn darin, dass er seine Zöglinge dort hatte, wo er sie haben wollte.
»Es wird nicht nur Ihr Recht sein, Ihre Soldaten zu führen, sondern sogar Ihre Pflicht. Ihre Männer werden zu Ihnen aufschauen und erwarten, dass Sie ihnen sagen, was sie zu tun haben. Sie werden sie dazu bringen müssen, ohne Zögern ins Feuer zu springen und durch die Hölle zu gehen. Und das werden Ihre Männer nur dann tun, wenn sie davon überzeugt sind, dass Sie das ebenfalls tun würden. Ohne Zaudern, ohne Furcht. Im Krieg, Gentlemen«, sein Blick erfasste einen Kadetten nach dem anderen, »im Krieg ist nichts jemals wirklich sicher. Das Einzige, worauf Sie sich verlassen können, ist das, was sich in der Vergangenheit bewährt hat. Und das sind neben den Strategien, die Sie bei mir erlernen, die unumstößlichen Tugenden unserer Berufung wie unseres Standes.«
Noch einmal legte er eine kurze Pause ein, und als er in seiner Ansprache fortfuhr, betonte er jedes einzelne Wort, verlieh den Silben ein metallisches Schwingen.
»Mut. Tapferkeit. Härte. Ausdauer. Ehre.«
Der Nachhall seiner Stimme blieb ein, zwei Pulsschläge lang in der Luft des Unterrichtsraums hängen, die nach Kreidestaub, mürbem Holz und feuchter Wolle roch.
Als wäre die Abfolge genau einstudiert gewesen, ertönte in der Halle die schmetternde Tonreihe des Signalhorns und verkündete das Ende dieser Stunde. Unter dem Scharren von Schuhsohlen, dem schabenden Geräusch des steifen Sergestoffes von Hosen und Uniformröcken sprangen die Kadetten auf und salutierten in strammer Haltung.
»Zwanzig Seiten zu diesem Thema bis nächste Woche. Guten Tag, Gentlemen.«
Ein Aufatmen ging durch die Kadetten, und unter sofort einsetzendem Stimmengewirr packten sie ihre Schreibsachen und Lehrbücher zusammen, setzten ihre kreisrunden Kappen auf. Die erste Hälfte dieses Tages war überstanden; ein Dienstag, der sich in seinem Ablauf nicht von den übrigen Tagen unterschied: Weckappell um halb sieben und die erste Unterrichtsstunde eine halbe Stunde später, dann ein kurzes Frühstück und die routinemäßige Untersuchung durch den Militärarzt, Morgenappell, Reitunterricht und drei Theoriestunden hintereinander bis zum Lunch. Weitere Unterrichtsstunden und Leibesübungen füllten den restlichen Tag bis zum Abendessen um acht; allein am Samstag war ihnen ein freier Nachmittag gewährt.
Leonard und Royston drängten sich zwischen den anderen Kadetten hindurch.
»’tschuldige, wenn ich dir eben in den Rücken gefallen bin.«
Mit einem entwaffnenden Grinsen ließ sich Leonard auf dem Tisch nieder, ein Bein fest am Boden, das andere locker über die Kante baumelnd. Seine nachlässig vollgestopfte Mappe stellte er auf dem Oberschenkel ab und ließ die Arme verschränkt darauf ruhen.
Jeremy sah nicht auf, räumte weiter sorgsam Lineal, Füller und Bleistifte in die dafür vorgesehenen Fächer der speckigen Ledertasche. »Nicht der Rede wert. Ich bin durchaus fähig und willens, andere Meinungen gelten zu lassen.«
Leonard lachte und machte eine halb entschuldigende, halb verständnisvolle Geste in Stephens Richtung, die dieser mit einem müden Heben der Schultern beantwortete. Derlei Anspielungen auf Geisteshaltung und Unterrichtsstil des Colonels kümmerten ihn nicht, und er verspürte auch keine Neigung, seinen Vater zu verteidigen.
»Du kommst doch am Wochenende mit nach Givons Grove, oder, Jeremy?« Simon kam von seiner Bank herübergeschlendert und schlenkerte seine Tasche am Henkel neben sich her. Seite an Seite mit Royston, einem der Größten in der Kompanie, wirkte Simon, der das vorgeschriebene Mindestmaß von vierundsechzig Inches für die Aufnahme in Sandhurst nur knapp erreichte, noch kleiner, als er tatsächlich war, nachgerade schmächtig und wesentlich jünger als achtzehn.
»Ja, das wollte ich dich auch schon –«, setzte Leonard an, brach aber ab, als er Wortfetzen aus einem Grüppchen aufschnappte, das sich gerade durch den Mittelgang auf ihn zu bewegte. Die Heiterkeit auf seinem Gesicht erlosch, und seine hellgoldenen Brauen zogen sich zusammen. Sein Bein schnellte vor und versperrte den Kadetten den Durchgang. »He, Highmore! Sag ruhig laut, was du eben so feige getuschelt hast! Oder hast du nicht genug Mumm?«
Freddie Highmores blasse Augen wichen Leonards herausforderndem Blick aus, schweiften über Royston und Simon, die ihm, spöttisch der eine, angriffslustig der andere, entgegensahen, wanderten hinüber zu Stephen, der sich zu ihm umgedreht hatte, und saugten sich dann an Jeremys Nacken fest. Unter der sommersprossigen Haut spannten sich die Kiefermuskeln stramm an. »Und ob ich den hab! Kann ruhig jeder wissen, was ich denke! Eine Schande ist das, dass eine Kanaille wie Danvers hier überhaupt zugelassen wird und dann –«
»Ah-ah«, fiel Leonard ihm ins Wort und wackelte mit dem Zeigefinger, deutete dann auf Jeremy. »Nicht mir sollst du das sagen. Sondern ihm, und zwar direkt ins Gesicht. – Wo du doch so unglaublich viel von Ehre, Tapferkeit und Anstand hältst …«, fügte er neckend hinzu, unterstrichen von einem Lächeln, das beinahe schon charmant ausfiel.
»Lass gut sein, Len«, kam es von Jeremy. In einer energischen Bewegung zurrte er die Schnalle an seiner Tasche zurecht.
Leonard und Freddie maßen sich mit Blicken, bevor Ersterer mit einem Schulterzucken das Bein herunternahm und die Kadetten um Highmore vorbeiließ.
»Du weißt, Sis und ich rechnen fest mit dir am Wochenende«, wandte er sich wieder an Jeremy.
Jeremy zeichnete mit dem Finger die Nähte im Leder nach und schwieg.
»Na komm schon!« Leonard boxte ihn gegen die Schulter. »Ist alles ganz zwanglos!« Als Jeremy ihn ansah, den Mund spöttisch verzogen, lachte er und hob die Hände. »Also schön – zumindest größtenteils zwanglos! Für den Abend leih ich dir aber gern einen Frack.«
»Du wirst wohl nicht unserer illustren Gesellschaft –«, protestierte Royston.
»… und der der Mädels!«, schnurrte Simon voller Vorfreude.
»… und der der Ladys«, nahm Royston mit hochgezogenen Brauen den Faden wieder auf, »ein Wochenende in dieser langweiligen Höhle hier vorziehen!« Drohend richtete er den Zeigefinger auf Jeremy. »Versuch gar nicht erst, dich damit rauszureden, dass du noch lernen musst! Du könntest die Prüfungen jetzt schon mit links bestehen! Im Gegensatz zu uns armen Würstchen, die wir im Schweiße unseres Angesichts noch pauken werden, bis unsere Schicksalsstunde geschlagen hat.«
»Becky ist auch eingeladen – nicht wahr, Stephen?«
Leonards augenzwinkernde Bemerkung rief eine leichte Röte auf Stephens Wangen hervor.
»Du könntest dann endlich auch Ada kennenlernen«, lenkte dieser hastig ab. »Sie kommt heute nämlich wieder nach Hause.«
Jeremy schwieg, zwei, drei Herzschläge lang. Gestreift von einem unbefangenen, überschäumenden Lachen. Einem Paar brauner Augen. Einem Duft wie von feuchten Grashalmen, von Klee und Schlüsselblumen.
Er stand auf und griff nach seiner Tasche.
»Mal sehen.«
3
Vogelgezwitscher erfüllte die Luft, die süß war von sonnendurchwärmtem Laub und Gras und durchwürzt von den herben Aromen des Kräutergärtchens. Jetzt, zur Mittagszeit, konnte man die Farben des Gartens förmlich riechen, das Safrangelb der Ringelblumen, das Königsblau des Rittersporns und das sanfte Violett des Phlox, das Scharlachrot der letzten späten Tulpen. Aus der Ferne schallte das metallische Schmettern eines Horns herüber, das die zügige Vorüberfahrt der von vier Pferden gezogenen Postkutsche nach Brighton verkündete, deren Route hinter Shamley Green vorbeiführte.
Vierhundert Morgen Land umfasste das Anwesen, gut fünf Meilen südwestlich von Guildford; ein eher bescheidener Grundbesitz, aber mit einer langen Geschichte. Als Wilhelm der Eroberer englischen Boden betrat, war Shamele, wie es damals noch hieß, bereits Teil der Ländereien des Benediktinerklosters von Chertsey Abbey, und nach der Auflösung aller englischen Klöster machte Heinrich VIII. es einem seiner Höflinge zum Geschenk – oder vielmehr dessen Frau, allenthalben als »die schöne Anne« bekannt und berühmt.
Es war gutes, es war reiches Land, das Land von Shamley Green. Saftige Weiden nährten Kühe und Schafe, und auf den Feldern gediehen Weizen, Hafer und Gerste, Mangold und Grünkohl, später Kartoffeln und Rüben, während die dichten Wälder wertvolles Eichenholz lieferten. Seit nunmehr einhundertdreißig Jahren war es das Land der Norburys, seit des Colonels Urgroßvater, ein Captain zur See und in Diensten der East India Company zu Wohlstand gelangt, es erworben hatte.
Das Lied der Meisen und Rotkehlchen in den Baumwipfeln fand sein Echo in den Stimmen der vier Frauen und in den glockenhellen, anheimelnden Klängen von Porzellan und Silber und Glas auf dem gedeckten Tisch im Garten. Über ihren Teller hinweg sah Ada immer wieder zum Haus hin, in dem sie geboren und aufgewachsen war. Außen wie innen war alles noch so, wie sie es in Erinnerung hatte und wie der Sohn jenes Captain Norbury es vor über hundert Jahren hatte erbauen lassen.
Schon von Weitem leuchtete die rote Backsteinfassade aus dem satten Grün der Rasenflächen und aus dem dunklen Laub der Eichen heraus. Ein Kontrast, der durch die weißen Rahmen der Sprossenfenster und die gleichfalls weißen Friese entlang der grauen Schindeldächer unter den zahlreichen Schornsteinen noch verstärkt wurde. Zweckmäßigkeit war der Grundsatz bei der Planung des Hauses gewesen. Hinter dem dreigeschossigen Haupthaus mit dem Eingangsportal umschlossen niedrigere Anbauten den lang gestreckten Innenhof, über den man jeden Raum des Hauses auf kürzestem Wege erreichen konnte.
Außen von männlicher Nüchternheit und eleganter Leichtigkeit, zeigte sich das Haus innen jedoch nahezu verspielt. Grün, Weiß und mattes Rot waren die vorherrschenden Farben, ergänzt von den unterschiedlichsten Hölzern, und Anker, Delphine und Fische, Muscheln und Tritonshörner, Nymphen und Neptungestalten schmückten Decken und Wandfriese, Treppengeländer und Säulen und erzählten von den Meeren der Welt.
Auch in Adas Zimmer mit den Rosentapeten, auf dessen Nachttisch zur Begrüßung ein Strauß Feldblumen neben einer Schachtel ihres Lieblingskaramells gestanden hatte, war alles unangetastet geblieben. Fremd hatte sie sich darin gefühlt mit ihrer Pariser Garderobe und ihr Reisekostüm sogleich gegen eines ihrer alten Sommerkleider getauscht. Ihr glattes braunes Haar mit den rötlichen Glanzlichtern, das sie am Morgen so sorgsam aufgesteckt hatte, hatte sie wieder gelöst, nur einige Strähnen am Hinterkopf zusammengenommen, damit sie ihr nicht ins Gesicht fielen. Ganz genau wie früher.
»Möchtest du noch ein Stück Pastete, Becky?« Constance Norbury deutete einladend auf die in Brühe eingeweichten Steinpilze, die klein geschnittenen und mit Zwiebeln und Minze gewürzten Lammkoteletts und Lammnierchen in ihrem Teigmantel, von Kindheit an Adas Leibgericht und von Köchin Bertha als Willkommensgruß an das heimgekehrte Nesthäkchen gedacht.
Beckys grün und braun gesprenkelte Augen lösten sich nur widerstrebend von den Resten auf der Servierplatte. »Vielen Dank, Lady Norbury. Sonst passe ich am Samstag womöglich nicht mehr in das neue Kleid.«
Ada schluckte den letzten Bissen hinunter, eine perfekte Mischung aus Pastete, Kartoffelbrei und Möhrchen. »Was ist am Samstag?«
»Die Hainsworths haben für das Wochenende nach Givons Grove eingeladen.« Grace trank einen Schluck und stellte ihr Wasserglas ab. »Nichts Großartiges, nur Freunde und Nachbarn.«
»Darf ich mit, Mama?«
Tapfer hielt Ada den überraschten Blicken dreier Augenpaare stand.
»Aber du wolltest doch früher nie –«, platzte Becky heraus, was in ihrer unverkennbaren hohen, schmeichlerischen Stimme zuckersüß klang und weich wie Buttertoffee.
»Ich habe meine Meinung eben geändert«, fiel Ada ihr ungewohnt trotzig ins Wort. Grace’ Finger, die sich mit festem Druck um die ihren schlossen, ließen ein glückliches Flattern in ihrem Bauch aufsteigen. Offenbar hatten die Monate im Ausland das kleine Wunder bewirkt, das sie alle erhofft hatten. Die Zeiten, in denen Ada sich ängstlich an den Rockzipfel von Mutter und Schwester gehängt, sich hinter dem Rücken von Vater und Bruder versteckt hatte, würden ab heute ein für alle Mal der Vergangenheit angehören.
»Natürlich darfst du mit«, erwiderte Constance Norbury. »Lord und Lady Grantham werden entzückt sein.« Zärtlich ruhte ihr Blick auf ihrer Jüngsten, bevor sie zur Teekanne griff.
Ada legte ihr Besteck beiseite, lehnte sich mit vollem Magen zurück und nahm die Serviette vom Schoß, ein Augenblick, auf den Gladdy nur gewartet hatte. Aus dem Welpen, der damals mit einer Handvoll Wasser aus dem Cranleigh auf den Namen des alten – und mittlerweile neuen – Premierministers Gladstone getauft worden war, war ein betagter Setter geworden, der nun seine weiß gestromerte Schnauze von dem Speichelfleck auf Adas Knie hob und den Kopf weiter oben wieder ablegte. Ada war kaum aus der Kutsche ausgestiegen, als Gladdy durch den aufstiebenden Kies auf sie zugeschossen war, an ihr hochsprang und sich jaulend im Kreis drehte und seitdem keinen Augenblick von ihrer Seite wich. Tabby hingegen, die grau getigerte Katze, die blinzelnd und die Vorderpfoten unter ihrem weißen Brustlatz vergraben unter dem Rhododendron lag, würdigte Ada keines Blickes, zur Strafe dafür, dass sie so lange weggeblieben war.
»Wie geht es Len und Sis denn?« Ada kraulte Gladdys Stirn und freute sich daran, wie der Setter selig die Augen zudrückte und die Lefzen locker hängen ließ.
»Gut. Alles wie gehabt. Len bricht reihenweise Herzen, und Sis liegen Scharen von Kavalieren zu Füßen«, spöttelte Grace mit einem warmen Unterton, der ihre Zuneigung zu den beiden verriet.
Ada lächelte.
»Tommy wirst du allerdings kaum wiedererkennen«, sagte Constance Norbury und rührte Zucker in ihren Tee. »Ein richtig großer Bursche ist aus ihm geworden.«
»Oh ja«, stimmte Grace lachend zu. »Schon fast ein kleiner Gentleman! Len ist mächtig stolz auf seinen kleinen Bruder.«
Die Art, wie Grace und ihre Mutter einander dabei ansahen, so einmütig, so vertraut, versetzte Ada einen Stich. Der umso schmerzhafter war, weil sie geglaubt hatte, sie sei darüber hinweggekommen, dass sie sich nicht mit Grace messen konnte, die nicht nur die Älteste von ihnen dreien war, sondern auch das Ebenbild ihrer Mutter. Es bedurfte schon eines zweiten, eines dritten Blickes, um Grace nicht für die jüngere Schwester von Lady Norbury zu halten, so sehr glichen sich Mutter und Tochter in Gestik und Mimik, im feinen Schnitt des ovalen Gesichts, in der anmutigen Nackenlinie, der schlanken, hochgewachsenen Gestalt und dem Haar in der Farbe eines reifen Kornfelds.
Wie viel leichter war es doch gewesen, in der Fremde eine andere zu sein. Furcht überfiel Ada. Die Furcht, dass ihr neues, noch so zerbrechliches Ich mit ihrer Rückkehr nach Hause keinen Bestand hätte. Dass sich in ihrem Leben niemals wirklich etwas ändern würde.
»Ich wünschte, ich könnte Stevie schon vor dem Wochenende sehen«, murmelte sie und streichelte Gladdy über den Rücken, was er ihr mit eifrigem Klopfen der Rute auf den Rasen vergalt. Grace war ihr immer mehr als nur eine Schwester gewesen; Freundin sogar und Verbündete. Und doch gab es eine Seite an Ada, die nur Stephen wirklich verstand.
»Wie spät ist es jetzt?« Grace wippte mit dem Fuß unter dem Tisch.
Becky sah auf die kleine silberne Uhr, die sie an einer langen Kette um den Hals trug. »Gleich Viertel vor drei.«
Grace zwinkerte ihrer Schwester zu, Schalk und Unternehmungslust im Blick. »Wenn wir uns beeilen, können wir noch zum Rugby in Sandhurst sein.«
»Danke, Ben.«
Schwungvoll stieg Grace auf den Wagen, ließ sich auf dem Lederpolster nieder und nahm Ben die Zügel aus der Hand. Der Kutscher half danach erst Ada, dann Becky in den kleinen zweirädrigen Wagen mit geöffnetem Verdeck. Der Tilbury aus dem bescheidenen Fuhrpark der Norburys war zwar alt, aber dank Bens Pflege tadellos in Schuss. Wendig und leicht, durch die übergroßen Räder höllisch schnell, war er jedoch nur für zwei Personen gedacht, sodass die Mädchen unter viel Gekicher erst einmal auf dem Sitz herumrutschten, bis sie halbwegs bequem und vor allem sicher saßen.
Ben verriegelte das Gepäckfach am Heck des Tilbury, in dem die Mädchen zuvor ihre Hüte und Handtaschen verstaut hatten, und kam wieder hinter dem Gefährt hervor.
»Ich hol Sie und Sir William dann heut Abend mit dem großen Wagen in Sandhurst ab, Miss Ada.«
Während Stephen wie alle anderen Kadetten im Wohntrakt des Colleges lebte, aber wenigstens durch die räumliche Nähe die Möglichkeit hatte, die viel zu wenigen, viel zu kurzen Wochenenden, an denen er Ausgang hatte, zu Hause zu verbringen, ließ sich der Colonel morgens und abends von Ben ins gut zwei Stunden entfernte Sandhurst und zurück kutschieren.
»Ist gut. Danke, Ben.« Ada schenkte ihm ein aufgeregtes Lächeln, zappelig vor Vorfreude.
Er tätschelte die Kruppe des stämmigen Rappen, der unruhig mit dem Kopf nickte, und trat zurück, als Grace die Zügel nahm und mit der Zunge schnalzte. »Gute Fahrt.«
Der Wagen rollte an, knirschte durch den Kies des Innenhofs und durch die Einfahrt neben den Stallungen hinaus, bog auf den Zufahrtsweg vor dem Haus ein.
»Festhalten, Mädels«, rief Grace, stemmte die Füße fester in den Boden und gab dem Pferd die Zügel. »Los, Jack, los! Zeig uns, was du kannst!«
Das Pferd preschte los, die weite Biegung entlang, die zwischen alten Eichen hindurch und dann nach Norden führte. Ada stieß einen erschrockenen Laut aus. Es fühlte sich an, als würde der Wagen in der Kurve umkippen. Vor Angst stockte ihr der Atem, und sie klammerte sich an Becky und an der Sitzlehne fest.
Erst als sie spürte, wie sicher Grace das Gefährt in der Spur hielt, konnte sie wieder Luft holen. Dennoch schlug ihr das Herz bis zum Hals, während die Wälder und die Flickenteppiche der Felder an ihnen vorüberschossen und die Kastanien mit ihren gerade aufbrechenden roten und weißen Blütenkerzen zu farbigen Schlieren zerflossen.
Ada musterte ihre Schwester von der Seite her, wie sie die Unterlippe zwischen die Zähne zog, wenn sie sich besonders konzentrieren musste, und dann wieder befreit auflachte, wenn sie Jack ein Stück des Weges einfach laufen lassen konnte, und wie ihre Augen dabei glänzten. Ihr Innerstes krampfte sich schmerzhaft zusammen, als sie gewahr wurde, wie sehr sie Grace liebte. Wie könnte sie sie auch nicht lieben? Jeder liebte Grace, der alles im Leben nur so zuflog, auch die Herzen der Menschen.
»Hast du gar keine Angst?«, rief sie ihrer Schwester ins Ohr, obwohl sie die Antwort ahnte.
»Nur davor, dass ich zu langsam bin!«, gab Grace lachend zurück, ohne die Augen von der Straße abzuwenden.
Der Wagen jagte auf ein frei stehendes Cottage zu. Ein betagter Mann in Hosenträgern über dem Hemd, eine Schildmütze auf dem nahezu kahlen Haupt, lehnte innen an der Umfriedungsmauer des Gartens und blickte müßig in die Landschaft hinaus.
»Haaallo! Mr Jenkins!«, rief Grace.
»Huhuuuu«, machte Becky und winkte ihm mit hochgereckter Hand zu.
Der frühere Pächter der Norburys, der mittlerweile zu gebrechlich war, um den Boden zu bestellen, und der sich zugunsten seines Sohnes aufs Altenteil zurückgezogen hatte, hob eine seiner zitternden, abgearbeiteten Hände und zeigte sein nahezu zahnloses Greisenlachen.
Ganz verlor Ada ihre Angst nicht bei dieser wilden Fahrt über Stock und Stein. Aber nachdem sie über die Brücke gepoltert waren, die über den Wey führte, und an der Silhouette von Guildford vorbeigeflogen waren, gewann allmählich die Freude die Oberhand. Sie hatte vergessen, wie es war, an Grace’ Seite durch die Wiesen zu sausen, die Sonne im Gesicht, den Fahrtwind auf der Haut, der ihr Haar hinter ihr herflattern ließ.
Die Wochen des Kummers im vergangenen Jahr und ihre Reise über den Kontinent, während der sie unter der fachkundigen und einfühlsamen Anleitung von Miss Sidgwick auf den Spuren der Dichter und Denker, der Maler und Bildhauer gewandelt war, hatten sie vergessen lassen, wie herrlich es war, so frei zu sein und so unbeschwert. So jung zu sein.
Erst als sie von dem Feldweg abbogen, der sie an den Ortschaften Frimley und Camberley vorbeigeführt hatte, verlangsamte Grace das Tempo. Die langen Nachmittagsschatten des Waldes legten sich kühl auf ihre erhitzten Gesichter, und Jacks Hufe klapperten in munterem Trab durch die grüne Stille. Ein Häuschen am Wegesrand kam in Sicht, und obwohl der bewaffnete und uniformierte Wächter missbilligend dreinblickte, salutierte er und ließ sie ungehindert passieren.
Während sich zu ihrer Linken der Wald fortsetzte, endete er auf der anderen Seite jäh und wurde von einer großen Wasserfläche abgelöst. Auf dem See, der halb in Surrey, halb in Berkshire lag, paddelte ein Trupp hemdsärmeliger Kadetten mit zwei Ausbildern auf einem Floß umher, das aus mit Seilen zusammengezurrten Fässern und Latten bestand. Eine andere Gruppe Offiziersanwärter war dabei, aus Balken und Brettern eine behelfsmäßige Brücke zu errichten.
Der Tilbury rollte an einem Labyrinth aus Gräben und aufgeschütteten Wällen vorüber, in dem die Kadetten sich darin übten, Feldbefestigungen anzulegen. Einige der jungen Männer ließen die Schaufel sinken und reckten den Hals; einer von ihnen pfiff gar anerkennend durch die Zähne, worauf er von seinem Ausbilder einen Schlag mit der flachen Hand gegen den Hinterkopf erhielt. Der Kadett schob die Kappe zurück, die ihm dabei in die Stirn gerutscht war, und grinste den lachenden Mädchen zu.
Majestätisch und stolz erstreckte sich vor ihnen das Royal Military College, ein lang gezogener, zweistöckiger und zweiflügeliger Bau, in Crème und Weiß gehalten und in den Farben des Königreiches beflaggt. Grace lenkte den Tilbury über den befestigten Vorplatz und hielt vor dem Portikus an. Zwischen den kannelierten Säulen erschien ein Unteroffizier und eilte die Stufen hinab, schlug vor dem Wagen die Hacken zusammen und salutierte kurz.
»Guten Tag, die Damen.« Er hielt ihnen nacheinander die weiß behandschuhte Rechte hin, um ihnen herauszuhelfen. »Miss Peckham. Miss Ada – schön, dass Sie wieder zu Hause sind! Miss Norbury.«
»Danke, Lieutenant Mellow«, erwiderte Grace, als sie aus dem Tilbury geklettert war, und übergab ihm die Zügel. »Darf ich Ihnen Jack anvertrauen?«
»Selbstredend, Miss Norbury. Ich werde veranlassen, dass man sich in den Stallungen um Pferd und Wagen kümmert.«
»Haben Sie vielen Dank!« Grace bedachte ihn mit einem offenen Lächeln, in dem nichts Kokettes lag, und doch hatte Ada den Eindruck, dass Lieutenant Mellow ungeachtet seines tadellosen Benehmens dieses Lächeln nur zu gern als Einladung zu einem Flirt aufgefasst hätte.
Grace öffnete die Gepäckklappe und holte ihre Hüte und ihre Taschen heraus. Während sie ihren Strohhut aufsetzte und mit den Nadeln feststeckte, sah sie, wie Becky versuchte, in den winzigen Laternenscheiben des Tilburys ihr Spiegelbild zu erhaschen, eine Strähne ihres wie golddurchwirkten braunen Haares feststeckte, die Fingerkuppe mit der Zunge anfeuchtete und sich die Brauen glatt strich. Grace lachte. »Komm jetzt – du bist hübsch genug!« Am Ellenbogen zog sie die murrende Freundin mit sich fort, streckte die andere Hand einladend nach Ada aus, und zügig schritten die drei über den Vorplatz in Richtung des Rugbyfelds.
Ein ohrenbetäubender Lärm empfing sie schon von Weitem. Eine Horde junger Männer in eng anliegenden und bis eine Handbreit unter das Knie reichenden roten Hosen, grasfleckigen Oberteilen mit rot-weißen Blockstreifen und passend geringelten Strümpfen tobte über den zertretenen Rasen und balgte sich um das eiförmige Leder.
»Hier!«, brüllte Leonard. Drei Kadetten seiner Kompanie, die die blaue Armbinde der gegnerischen Mannschaft in diesem Übungsspiel trugen, bedrängten ihn ungestüm, und er schleuderte den Ball von sich. Freddie Highmore hechtete danach, doch Jeremy schnellte aus vollem Lauf hoch und schnappte sich das Leder aus der Luft, ehe Highmore herankommen konnte, und rannte los. Freddie setzte ihm nach, war augenblicklich gleichauf und hackte mit dem Absatz des geschnürten, knöchelhohen Lederstiefels gegen Jeremys Schienbein. Jeremy strauchelte und verbiss sich einen Fluch, fing sich aber wieder und lief weiter.
»Gib ab!«, rief Stephen und hielt mit ausgebreiteten Armen einen Gegenspieler in Schach, während Royston einen anderen geschickt stolpern ließ.
»Friss Dreck, du Ratte«, fauchte Freddie und sprang Jeremy mit seinem ganzen Körpergewicht in den Rücken.
Jeremy ging zu Boden, doch noch im Fallen warf er das Ei von sich. Es schlingerte durch die Luft, über Royston und zwei Gegenspieler hinweg, und landete in den Armen von Simon, der sofort losspurtete.
Wieselflink wetzte er über das Feld, bis ein Gegner ihn in die Kniekehle trat und ins Straucheln brachte. Mit ausgestreckten Armen warf Simon sich der Länge nach hin, rutschte bäuchlings über den Rasen und blieb schließlich liegen – mit dem Ball gut drei Inches über der gegnerischen Torlinie.
Der Sportlehrer steckte zwei Finger in den Mund und stieß einen grellen Pfiff aus. »Und Schluss, Gentlemen! Rot gewinnt zwei zu eins!«
Donnernder Jubel hob in der einen Hälfte der Kompanie an, während die Verlierer in diesem Spiel lange Gesichter machten und wütend in den Boden kickten.
Japsend rollte sich Simon auf den Rücken; Royston, Leonard, Jeremy und Stephen stürzten sich auf ihn, klopften ihm auf die Schultern, lagen einander in den Armen und brüllten ihre Freude heraus.
»Jungs!«, rief Leonard, als er den Kopf hob. »Schaut mal!« Vier Augenpaare folgten seinem ausgestreckten Zeigefinger zum Rand des Spielfelds, an dem drei Mädchen standen, auf und ab hüpften und eifrig winkten.
»Oohhh«, machte Simon mit hochgerecktem Kinn, noch immer schnaufend. »Drei edle Jungfern, von weit her gekommen, um uns siegreiche Ritter zu feiern!«
»Quatschkopf!« Mit breitem Grinsen klatschte Leonard ihm vor die Stirn, sodass Simon sich mit theatralisch verdrehten Augen wieder rücklings fallen ließ.
»Das gibt’s doch nicht!« Stephens Augen weiteten sich vor Verblüffung; seine Züge verklärten sich, und er sprang auf. »Habt ihr gesehen, wer da ist?«, rief er den anderen über die Schulter zu, während er loslief.
Royston und Jeremy halfen dem ächzenden Simon auf, und Leonard hob das lederne Ei vom Boden auf, das Simon ihm sogleich in einem spielerischen Ringkampf wieder abjagte.
Lachend und sich gegenseitig Rippenstöße versetzend, folgten sie Stephen quer über das Spielfeld. Die vier jungen Männer waren nur noch einige Schritte entfernt, als Simon unvermittelt stehen blieb. Wie Stephen Grace umarmte und Becky unbeholfen begrüßte, die ihn mit schräg gelegtem Kopf von unten herauf anstrahlte und die Handtasche spielerisch vor ihrem Rock hin und her schwang, nahm er nur am Rande wahr; seine Aufmerksamkeit war ganz auf das Mädchen gerichtet, das zuvor auf Stephen zugelaufen und diesem um den Hals gefallen, von ihm herumgewirbelt worden war, dass ihm der Hut vom Kopf segelte und im Gras landete.
»Hey.« Simon packte Royston am Ärmel. Royston war mit Stephen und Leonard in Cheltenham zur Schule gegangen, kannte die beiden länger als Jeremy und er, die erst im vergangenen Herbst in Sandhurst zu den dreien dazugestoßen waren. »Kennst du die Kleine da, die mit Grace und Becky hier ist?«
»Das ist Ada.«
Das ist Stevies kleine Schwester? Simon brachte keinen Ton mehr heraus; seine sonst so freche Zunge war mit einem Mal wie gelähmt.
»War immer ein verschüchtertes Ding, das knallrot wurde, wenn man es ansprach, und dann wie der Blitz davonsauste, um sich zu verstecken«, erklärte Royston amüsiert und ging weiter. Sich halb umwendend fügte er hinzu: »Sieht so aus, als sei sie dem nun endlich entwachsen.«
Simons Augen vermochten sich nicht von ihr zu lösen, der Kleinsten in der Gruppe, in der es nun ein lautes, lachendes Hallo nach allen Seiten gab, als Royston und Leonard hinzutraten. Noch kleiner als Simon selbst, war sie elfenhaft schmal, wirkte beinahe kindlich mit dem runden Gesicht, der zierlichen Stupsnase. In der Tat ein Mädchen noch, wie sie in der einen Hand ihren Hut hielt und mit der anderen eine Strähne ihres offenen Haares aus dem Mund klaubte, die ihr an den Lippen kleben geblieben war. Dieser Mund, der in seiner runden Fülle verhieß, dass sie die Schwelle zum Frausein bald überschreiten würde, wie eine pralle Knospe, just bevor sie zur Blüte aufbrach. Ein Mund, der beim Lächeln die kecke kleine Spalte zwischen den oberen Schneidezähnen zeigte, die Simon von Stephen her so vertraut war und die ihm bei diesem Mädchen weiche Knie bereitete.
Das Lächeln auf Adas Zügen erlosch, als ihre Augen sich mit denen Simons trafen. Augen, groß und dunkel glänzend wie Schwarzkirschen, die verwundert blickten, fast fragend, sich schließlich scheu abwandten und dann doch voller Neugierde zu den seinen zurückkehrten.
Stumm hielt er das Leder umklammert, unfähig, sich zu rühren oder gar das Wort an Ada zu richten. Er, der sonst nie um Worte verlegen war, der mit Witz und Schlagfertigkeit das schöne Geschlecht um den Finger zu wickeln verstand.
Auch Jeremys Augen, die Simons Blick gefolgt waren, begegneten einem Paar brauner Augen, die jedoch lichter waren als die von Ada, wenn auch ungewöhnlich dunkel für jemanden mit solch hellem Haar, solch heller Haut. Ein Lächeln umspielte Grace’ Mund, und vorsichtig, zaghaft beinah hob sie die Hand zum Gruß. Jeremy hob ebenfalls die Hand, eine fast verstohlene Geste, in einem Moment, der ihnen ganz allein gehörte.
Der jedoch zerstob, als Leonard Grace aus den Ärmelrüschen eine winzige Flaumfeder zupfte, die sich während der Fahrt dort verfangen hatte.
»Los, wünsch dir was!«, forderte er sie auf und hielt ihr das Federchen auf der Fingerkuppe vor das Gesicht.
»Ja, mach, wünsch dir was!«, rief es um Grace im Chor. Gehorsam schloss sie die Lider und blies kräftig in Richtung von Leonards Hand, sodass die Daune davonsegelte.
Jeremy sah Simon von der Seite an. »Kommst du?«
Mehr eine Forderung denn eine Frage, die ungehört an Simon abprallte. Achselzuckend ging Jeremy in Richtung der Waschräume davon, ohne sich noch einmal umzudrehen.
Der schrille Pfiff, mit dem der Sportlehrer die säumigen Kadetten zur Eile ermahnte, trieb gleich darauf das Grüppchen um Grace und Ada auseinander. Leonard und Royston nahmen Grace in ihre Mitte, während Stephen von Becky in Beschlag genommen wurde, auf einem Stück gemeinsamen Weges, bevor die jungen Männer zur Turnhalle abbiegen, die Mädchen jedoch zum Collegegebäude weitergehen würden.
Allein Ada blieb zurück. Als hätte ihr jemand Bleibänder in den Rocksaum genäht, kam sie nur langsam vorwärts, und obwohl sie wusste, dass es ungehörig war, musste sie sich wie unter einem Zwang immer wieder nach dem Kadetten umdrehen, der immer noch regungslos dastand und sie auf nicht weniger ungehörige Weise anstarrte.
Eine Kaskade greller Pfifflaute drang über die Rasenfläche. »Beeilung, die Gentlemen Norbury, Ashcombe und Hainsworth! Hopphopphopp!«
Stephen gehorchte in langen Schritten dem Befehl, und zur Erheiterung von Leonard und Royston, die hinterhertrotteten, hing Becky weiterhin wie eine Klette an ihm, als wollte sie ihn ganz selbstverständlich in die Umkleide begleiten.
»Wird’s bald, Digby-Jones! Oder brauchen Sie eine Extra-Einladung?!«
Als Simon sich endlich in Bewegung setzte, ging auch ein Ruck durch Ada, und hastig stolperte sie hinter ihrer Schwester her.
»Grace! Warte! Grace!«
Atemlos hängte sie sich an den Arm ihrer Schwester.
»Grace, wer ist das?«, flüsterte sie ihr zu. »Der Kadett dort, der die ganze Zeit zu uns herübergeschaut hat?«
Grace lächelte. »Das ist Simon. Simon Digby-Jones. Er wird am Wochenende auch auf Givons Grove sein.«
Einmal sah Ada noch zu ihm hinüber.
Simon.
4
»Nochmals vielen Dank, dass ich mitfahren darf, Lady Norbury – Sir William«, zwitscherte Becky in der offenen Kutsche, vor die Jack und ein weiteres kraftvolles Pferd namens Jill gespannt waren und die an diesem Samstagnachmittag über die Landstraße rollte, nach Nordwesten, in Richtung des knapp zehn Meilen entfernten Givons Grove.
Während der Colonel nur kurz, aber durchaus wohlwollend nickte, legte seine Frau Becky den Arm um die Schulter und drückte sie an sich. »Gern geschehen. Du gehörst doch schon fast zur Familie!«
Becky strahlte über das ganze Gesicht mit den prallen Bäckchen und dem energisch spitzen Kinn und warf Stephen, der neben der Kutsche einherritt, einen triumphierenden Blick zu. Den dieser geflissentlich übersah, während er seinen Braunen flotter vorwärtstraben ließ.
»Mamas eigentliche Leistung bestand darin, deinen Vater zu überreden, dass er dich das ganze Wochenende fortlässt«, ließ sich Grace von ihrer Fuchsstute aus vernehmen.
Becky nickte heftig, einen bekümmerten Ausdruck im Gesicht, und schenkte Lady Norbury einen dankbaren Blick.
»Er wird auch einmal einen Sonntag ohne dich auskommen«, versuchte sie Becky aufzumuntern.
»Ich weiß das«, schnaufte diese. »Nur er sieht das offenbar nicht ein!«
Auf Beckys Schultern lastete seit dem frühen Tod ihrer Mutter die alleinige Verantwortung für den Pfarrhaushalt, und da die Gemeinde der Holy Trinity Church in Guildford nicht gerade klein war, sogar bis fast nach Cranleigh hinunterreichte, bedeutete dies eine schwere Bürde für das junge Mädchen – was Becky mit ihrer angeborenen Fröhlichkeit sich nur selten anmerken ließ. Wahrscheinlich gab es niemanden, der das annähernd so gut verstand wie Constance Norbury. Vierzehn war sie selbst gewesen, fast in demselben Alter wie Becky damals, als ihre Mutter schwer erkrankte, und fünfzehn, als diese starb, und in diesem Jahr oblag ihr nicht nur deren Pflege, sondern es gingen auch all die Pflichten und Aufgaben auf sie über, die es im Haushalt ihres Vaters, General Seamus Finley Shaw-Stewart, zu erfüllen galt.
Constance Norbury hatte die quirlige Pfarrerstochter so fest ins Herz geschlossen, dass es ihr ein großes Anliegen war, das auszugleichen, was das Schicksal bei Becky versäumt hatte, während es ihren beiden eigenen Mädchen in jeder Hinsicht so wohlgesinnt war. Da Reverend Peckham seine Tochter kurzhielt, gerade wenn es um die kleinen und größeren Dinge weiblicher Eitelkeit ging, war es ihr gemeinsames, gut gehütetes Geheimnis, dass Beckys neues lavendelfarbenes Nachmittagskleid und ihre gleichfalls neue Abendgarderobe, wohlverstaut in ihrem Köfferchen, ein Geschenk von Grace und ihrer Mutter waren.