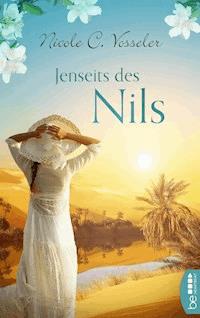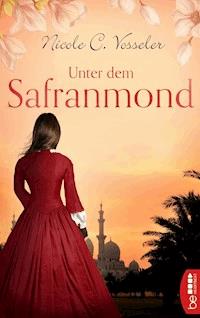4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Insel, schön wie das Paradies. Eine junge Frau, unzähmbar wie wilde Orchideen. Und eine Liebe, stürmisch und gewaltig wie der Ozean. Singapur um 1840. Das Tor zu den Schätzen Asiens. Ein Magnet für Schiffe und Menschen aus aller Welt. Hier lebt Georgina nach dem Tod ihrer Mutter weitgehend sich selbst überlassen. Im üppig wuchernden Garten am Meer kann das Mädchen mit den veilchenblauen Augen umherstreifen und ihre Einsamkeit eine Zeit lang vergessen. Eines Tages findet sie dort einen verletzten Jungen: Raharjo, der dem Volk der Orang Laut angehört, den "Meeresmenschen". Wie vom Schicksal gelenkt, kreuzen sich ihre Wege über Jahrzehnte hinweg immer wieder, und diese Liebe, die nicht sein darf, verändert nicht nur ihrer beider Leben für immer ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 624
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Kurzbeschreibung
Eine Insel, schön wie das Paradies. Eine junge Frau, unzähmbar wie wilde Orchideen. Und eine Liebe, stürmisch und gewaltig wie der Ozean.
Singapur um 1840. Das Tor zu den Schätzen Asiens. Ein Magnet für Schiffe und Menschen aus aller Welt. Hier lebt Georgina nach dem Tod ihrer Mutter weitgehend sich selbst überlassen. Im üppig wuchernden Garten am Meer kann das Mädchen mit den veilchenblauen Augen umherstreifen und ihre Einsamkeit eine Zeit lang vergessen. Eines Tages findet sie dort einen verletzten Jungen: Raharjo, der dem Volk der Orang Laut angehört, den „Meeresmenschen“. Wie vom Schicksal gelenkt, kreuzen sich ihre Wege über Jahrzehnte hinweg immer wieder, und diese Liebe, die nicht sein darf, verändert nicht nur ihrer beider Leben für immer ...
>>Nicole Vosseler schafft es wie keine andere Autorin, Bilder zum Leben zu erwecken.<< literaturschock.de
Nicole C. Vosseler
Zeit der wilden Orchideen
Roman
Edel Elements
Edel Elements
Ein Verlag der Edel Germany GmbH
© 2017 Edel Germany GmbH Neumühlen 17, 22763 Hamburg
www.edel.com
Copyright © 2017 by Nicole C. Vosseler
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Montasser Medienagentur.
Covergestaltung: Anke Koopmann, Designomicon, München.
Konvertierung: Datagrafix
Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des jeweiligen Rechteinhabers wiedergegeben werden.
ISBN: 978-3-95530-967-1
www.facebook.com/EdelElements/
www.edelelements.de/
Für alle Träumer dieser Welt,
Seltsame Anwandlungen von Leidenschaft hab ich gekannt, und ich will’s wagen zu erzählenin der Verliebten Ohr allein,was einst mir widerfahren.
William Wordsworth
Das Herz ist sein eigenes Schicksal.
Philip James Bailey
Der Himmel brannte.
Grelle Flammen loderten über den Horizont und züngelten weiter hinauf. Die ersten Wolkenbänke fingen Feuer, und unter der Glut, die von ihren Säumen hinabtroff, färbte das Meer sich rot.
Knisternd schwebte noch der Nachhall von Schüssen über dem Wasser. Ein Echo des scharfen Klirrens von Klinge gegen Klinge. Dazwischen trieb die schwache Erinnerung an Männerstimmen umher, zerrissen im Kampf und zersprengt in der Schwärze der Nacht.
Er wusste nicht mehr, wie er über Bord gegangen war, in jener Stunde, ehe die Sterne verblassten und die Dunkelheit zerfaserte. Bevor sich die Sonne am Horizont entlangrieb und den ersten Lichtfunken entzündete.
Ob er das Gleichgewicht verloren hatte, als er einem Schwertstreich auswich. Durch den Stoß der Kugel, die ihn traf. Oder ob er sich einfach hatte fallen lassen, vielleicht sogar gesprungen war, gepackt von einem unbändigen Lebenswillen, getrieben von beschämender Feigheit.
Wie ein Fels war er untergegangen in den finsteren Wassern, die ihre Fangzähne aus Salz in seine Wunden schlugen, und rasender, brüllender Schmerz hatte seinen Leib zerfetzt.
Ein Augenblick benommener Leere. Eines uferlosen Nichts.
Dann war sein Bewusstsein wieder aufgeflackert.
Seine Rippen zusammengepresst, die Lunge vor dem Bersten, hatte er um sich geschlagen und getreten. Endlich, endlich war er aus den Fluten aufgetaucht, hatte gierig Luft in sich hineingeschlungen.
Der Wind schmeckte rauchig auf der Zunge, nach rotem Staub und Asche. Ein Bein, ein Arm taub und nutzlos, paddelte er vorwärts. Durch ein Licht, golden wie geschmolzener Safran, das sich mit dem blauen Dunst des frühen Morgens mischte. Unter den Schattenrissen der Vögel, die ihre Kreise zogen und heiser den neuen Tag wachriefen. Der Insel entgegen, auf die sein innerer Kompass unbeirrbar zuhielt. Wie eine Schildkröte, die Jahrzehnte durch die Ozeane streift und doch stets zu dem Strand zurückfindet, an dem sie einstmals schlüpfte.
Das Meer verlor die Geduld, bedrängte ihn von allen Seiten, stieß ihn rau umher. Noch bevor er sie hörte, spürte er die Welle heranrollen. Gehorsam unterwarf er sich ihrem Willen, ließ sich von ihr packen und mitreißen, auch dann noch, als sie ihn jäh unterpflügte. Und wie die letzte starke Wehe, die ihn aus dem Mutterleib in diese Welt gedrängt hatte, spie sie ihn schließlich an Land wieder aus.
Ein Dröhnen in den Ohren, sein Herzschlag ein wildes Toben, robbte er atemlos voran, fort von der Flut, die ihn umtoste. Scharf rieb sich Sand in seine Wunden, Steine und Gräser scheuerten seine Haut auf.
Das glatte Weiß der Häuser warf das Licht der aufgehenden Sonne zurück, und geblendet kniff er die Augen zusammen. Schlanke Schatten lösten sich zu Bäumen auf, stumme Wächter über die gepflegten Gärten hinter niedrigen Mauern. Keiner davon stand einsam, und doch blieb dazwischen eine großzügige, luftige Weite, die keine Zuflucht bot.
Sein Blick fiel auf eine dunkle Blätterwolke. Eine übrig gebliebene Insel der Wildnis, beinahe unwirklich in den Schleiern aus Dunst und Dampf. Dort, wo das staubige Band der Jalan Pantai, an das die Wellen bereits heranbrandeten, sich zu einem Bogen krümmte.
Zu erschöpft, um sich noch bis zum Fluss durchzuschlagen, zu jung, um aufzugeben, zögerte er.
Das Kinn hochgereckt, das Rückgrat fest durchgedrückt, stand das Mädchen auf der Türschwelle des Hauses.
Alle sind sie gekommen an diesem bedeutsamen Tag. Alle meine Ritter und Edelmänner. Alle Weisen und Magier, Zauberinnen und Feen. Aus jedem noch so entlegenen Winkel meines Reiches, aus allen vier Himmelsrichtungen sind sie angereist, um mir heute ihren Dank zu bezeugen.
Die Kinderfinger geziert aufgefächert, breitete sie die Arme aus. »Erhebt euch.«
Unter dem Rascheln feinster Stoffe wogte die Menge auf wie das Meer bei Flut, als sich die Männer aus ihrer ehrerbietigen Verbeugung, die Frauen aus ihrem tiefen Knicks aufrichteten. Und wie Blumen, die sich nach der Sonne drehten, wandten sich alle Gesichter ihr zu.
Mit beiden Händen raffte sie den bedruckten Wickelrock und stieg langsam die Stufen hinunter.
Schwer drückte die Krone auf ihr Haupt, doch sie war stolz, sie zu tragen. Die Seide ihrer prunkvollen Robe flüsterte verheißungsvoll, und jeder ihrer Schritte in den goldbestickten Pantoffeln hallte von den edelsteinfunkelnden Wänden wider. Leichte Schritte waren es, mit denen sie kaum den glatten Stein des Bodens zu berühren schien.
Ein kleines Lächeln stahl sich auf das Gesicht des Mädchens, während es durch das niedrige, harte Gras weiterging.
Ehrfürchtig teilte sich die Menge vor ihr. Ein vielstimmiges Raunen schwebte durch den Saal, verklang zwischen den mächtigen Säulen aus dunklem Marmor und verlor sich unter dem Gewölbe aus Smaragd und Lapislazuli, so hoch und weit wie der Himmel selbst.
Das Herz schlug ihr bis zum Hals, und sie hatte Mühe, ihre königliche Haltung zu bewahren.
Die Blicke der Menge richteten sich auf den tapferen Recken, deram Ende des Saals sein Knie beugte. Den Kopf hielt er demütig so tief gesenkt, als wüsste er nicht, ob ihn Lohn oder Strafe erwartete für die Heldentaten, mit denen er den Bann der bösen Hexe gebrochen hatte. Scheu sah ihr das silbrigweiße Einhorn entgegen, das er am Zaumzeug neben sich hielt, die dunkelglänzenden Augen unverwandt auf sie gerichtet. Ganz so, als ob …
»Miss Georgina! Guten Morgen!«
Das Mädchen fuhr zusammen. Der prächtige Saal begann vor ihren Augen zu flirren und zerstob, und der Wind trug seine glanzlosen Überreste davon wie Blütenstaub. Über die Sträucher und Baumkronen hinweg, deren Laub er raschelnd gegeneinanderrieb, während hoch oben in den Ästen Vögel trillerten und keckerten.
»Ich hab dich doch nicht erschreckt?«
Georgina blinzelte. Zwischen Fontänen von Blüten in Purpur und Karmesin, so zart wie aus Seidenpapier gefaltete Lampions, stützte sich Ah Tong auf den Stiel seines Rechens. Ein vergnügtes Lächeln auf seinem Gesicht, das die Sonne zu vernarbtem gelbem Leder gegerbt hatte.
»Was treibst du denn so früh schon hier?«
Georginas Wangen wurden heiß; ihre Finger krampften sich um den Stoff ihres Wickelrocks, und die Grashalme stachen ihr in die bloßen Fußsohlen. In ihrer Brust sprudelte so vieles hoch, was sie Ah Tong erzählen wollte, von den Feen und Edelmännern und Rittern und von ihren Abenteuern im Zauberreich, dass sie kaum mehr Luft bekam. Doch jedes Wort legte sich schwer auf ihre Zunge, bevor sie es aussprechen konnte, und als hätte sie den Mund voll mit Kieselsteinen, blieb sie stumm.
»Hast ja Recht.« Ah Tong fuhr fort, die vergilbten Blüten zusammenzuharken. »Spring nur im Garten herum, solange es noch trocken ist.«
Georginas Blick wanderte nach oben. Die über Nacht frisch gewaschenen Wolken, denen sie vom Fenster aus freudig zugewinkt hatte, kaum dass sie aus dem Bett gehüpft war, waren inzwischen verrußt. Schwerfällig drückten sie sich gegen die Insel, und der vorhin noch lichtblaue Himmel schwitzte milchiggrau.
»Ich seh auch zu, dass ich mein Tagwerk noch verrichtet bekomm.« Ah Tong schüttelte die letzten Blüten aus den Zinken. »Bevor nicht nur der Regen über mich hereinbricht …«
Aus der ganzen Höhe seiner dürren Gestalt, um die die weiten Hosen und das langärmlige Hemd schlackerten, beugte sich Ah Tong zu Georgina hinunter, sodass der lange, dünne Flechtzopf über seine Schulter fiel.
»Sondern auch der Zorn unserer Herrin und Gebieterin.«
Wie Verschwörer sahen sie einander in die Augen, und während sich auf Ah Tongs Ledergesicht ein Grinsen ausbreitete, noch diebischer dadurch, dass seine entblößten Zähne schief und krumm waren, perlte in Georginas Kehle ein Kichern auf. Die Hand vor den Mund gepresst, schaute sie schnell zum Haus hinüber, dessen weiße Fassade glänzte wie das Innere einer Muschelschale. Denn den scharfen Augen und dem feingestimmten Gehör von Ah Tongs Frau und Georginas Ayah entging für gewöhnlich nichts, was sich in und um das Haus von L’Espoir tat, das Cempaka mit eisernem Besen und durchdringendem Gekeife regierte.
»Schau.« Ah Tong hatte aus einem der Sträucher eine leuchtend rote Blüte gepflückt, die er Georgina entgegenhielt. »Ist vorhin erst aufgegangen. Weißt du noch, wie sie heißt?«
Georgina nickte. »Bunga raya.« Ihr Mund war wieder frei, die Zunge gelöst. »Chinesische Rose. Zhu jin. Oder Hibiskus.«
»Sehr gut!« Ah Tong lachte erfreut. »Da, nimm, die ist für dich.«
Behutsam legte er die Blüte in Georginas hohle Hände, die den ausladenden Blütenkelch kaum zu fassen vermochten. Fasziniert betrachtete sie den aufragenden Blütenstempel und den Goldstaub darauf und freute sich daran, wie weich sich die Blütenblätter auf ihrer Haut anfühlten.
»Danke«, hauchte sie selig.
Ah Tong pflückte sonst nie etwas aus seinem liebevoll gehegten Garten; den letzten aller Blumensträuße hatte er für Maman geschnitten.
Im Anblick der Blüte gefangen, wandte sie sich ab und setzte vorsichtig einen Fuß vor den anderen.
Lodernde Fackeln erhellten den gewaltigen Tempel, vor Tausenden von Jahren erbaut. Im Wechselspiel von Flammenschein und Schatten flackerten Muster und geheimnisvolle Inschriften auf den starken Säulen. Aus Stein gehauene Dämonen, Göttergestalten und Fabelwesen tobten über die Wände, in einem wilden, todbringenden Tanz.
»Seht«, flüsterte sie, ihre Stimme tief und heiser vor Anspannung, »ich bringe euch das heilige Feuer.«
Konzentriert trug sie die goldene Schale vor sich her, in der die Flammen lebhaft und kräftig brannten. Eine falsche Bewegung, ein zu hastiger Schritt oder ein zu tiefer Atemzug, und das heilige Feuer, das ewiges Leben bedeutete, würde verlöschen. Für immer. Doch nicht ohne Grund war sie von den Göttern zur Hohepriesterin des Feuers erwählt worden. So besonnen, so behutsam tat sie einen feierlichen Schritt nach dem anderen, auf das große Heiligtum der Götter zu, dass all die glitzernden Geschmeide, die sie trug, nicht auch nur das feinste Klimpern von sich gaben. Selbst der schwere golddurchwirkte Brokat ihrer Gewänder schwieg.
Ah Tongs Augen folgten Georgina, während sie an den Hecken aus Bambusrohr und den blauen Blütentrauben des wilden Heliotrops entlangstelzte wie ein Kranich am Flussufer. Seine struppigen Brauen stießen über der Nasenwurzel zusammen, als der Wind Wortfetzen ihrer geflüsterten Selbstgespräche zu ihm heranwehte, sie sich schließlich langsam vor der Mangostane mit ihrer ausladenden Krone hinkniete und dem Baum die Hibiskusblüte wie eine Opfergabe darbot.
Mehr als ein Kind, das einfach in sein Spiel vertieft war, schien sich das Mädchen vollkommen in seiner Traumwelt zu verlieren. Als könnte sie nur dort frei sein und unbeschwert. Nur dort die Traurigkeit vergessen, die ihre Augen verdunkelte, seit die Mem nicht mehr da war.
»Armes Dingelchen«, murmelte Ah Tong und schüttelte einmal mehr mitfühlend den Kopf über das wunderliche Töchterchen von Tuan Findlay.
Ein blauer Funke ließ den steinernen Tempel erzittern und schwanken, ein weiterer brachte ihn zum Einsturz. Georgina blinzelte und hob den Kopf. Gebannt beobachtete sie die beiden Schmetterlinge, die einander umflatterten, Geschöpfe aus Himmelsseide, Schwimmer im Ozean aus Luft und Licht.
Sie sah ihnen nach, bis sie über die feuerfarbenen Blütenzungen der stolzen Cannalilien hinweggesegelt waren, und sprang auf. Den Kopf in den Nacken gelegt, schloss sie die Augen und breitete die Arme so weit aus, wie es nur ging. Sie stellte sich vor, winzig zu sein und gewichtslos unter einem schillernden Flügelpaar, und lief los. Schneller und schneller rannte sie und reckte sich dabei den Wolken entgegen, ein jubilierendes Kitzeln hinter dem Brustbein und bereit, sich jeden Moment in die Luft aufzuschwingen.
Die ersten Tropfen klatschten auf ihre Stirn, sammelten sich zu kühlen Bächen, die ihr über das Gesicht rannen und sich mit dem Schweiß auf ihrer Haut mischten. Jauchzend blinzelte Georgina in den Regen, hüpfte und wirbelte durch das Gras und lief weiter, dem Meer entgegen, das jenseits der Gartenmauer schäumte und brauste. Auf den Wall aus Schatten zu, der sich erst aus der Nähe zu den dichten Bäumen und Sträuchern eines Wäldchens auflöste.
Ein ungezähmtes Stück Natur, verwunschen und fast vergessen, über dem die Palmen wohlwollend mit den Köpfen nickten. Georginas Reich, ihres ganz allein, in das sich niemand sonst verirrte. Noch nicht einmal Cempaka, die davon überzeugt war, dass zwischen den Wurzeln der Bäume böse Geister hausten.
Der Regen prasselte auf die Blätter und plitschte von ihren Rändern herunter, als Georgina sich durch das Dickicht zwängte. Wie ein feuchtwarmes Tuch legte sich die Luft auf ihre Haut und Lunge. Nach Regen roch es und nach nassem Laub, nach durchtränktem Sand und roter Erde, und dazwischen wob sich der betörende Duft der wilden Orchideen, die im Dämmerlicht leuchteten wie farbige Sterne.
Ein Dschungel, in dem sie zuweilen einem menschenfressenden Tiger auflauerte, die weißschimmernde, zauberkräftige Königin aller Kobras zu beschwören versuchte oder nach dem silbrigen Einhorn Ausschau hielt, das sie auf seinem Rücken in ein fernes, märchenhaftes Land tragen würde.
Das Schönste an diesem Teil des Gartens aber war sein Pavillon. Zwischen den Backsteinen, auf denen er ruhte, spross das Unterholz so dicht, dass es aussah, als ob der Pavillon auf einem zugewachsenen See schwamm.
Georginas Feenschloss. Ein altes Herrenhaus, in dem es spukte. Robinsons einsame Insel. Der Palast eines Rajas. Eine Piratenhöhle.
Wie das große Haus von Papa für Maman erbaut, schmiegte sich der Pavillon mit dreien seiner durchbrochenen Wände in das Grün hinein. Zum Meer hin öffnete er sich auf eine luftige Veranda, und der rohe, schartige Felsen, unmittelbar vor der Mauer in rotblühende Hecken eingebettet, war Georgina mal ein Ausguck im Piratennest, mal ein Leuchtturm oder der höchste Berg der Erde, den es mühevoll und unter großen Gefahren zu besteigen galt.
Georgina sprang die Stufen zur Veranda hinauf. Das verzogene Holz knarrte unter ihren Füßen, und die Gräser, die sich zwischen den Bohlen emporreckten, kitzelten sie an den Knöcheln. Hinter der Türschwelle empfing Georgina der vertraute Geruch nach Nässe, nach Salz und modernden Stoffen, unter dem etwas Fauligsüßes schwelte.
Die Natur hatte sich den Pavillon längst zu eigen gemacht. Flechten überzogen das Dach und die Wände wie mit den Schuppen einer Echsenhaut. Bäume und Sträucher wucherten durch die Fenster herein, verdunkelten die beiden Zimmer und tauchten sie in das grünblau schillernde Licht versunkener Welten. Die Winkel, in denen sich die schimmelige Chaiselongue und das Schränkchen mit der stehengebliebenen Uhr verkrochen, waren von Moos ausgepolstert, und der Wind und die Wellen, die während des Monsuns oft über die Mauer schwappten, hatten Holz und Stein rasch altern lassen. Als hätten sich wenige Jahre zu Jahrhunderten ausgedehnt, die hier, an diesem Ort, einen Tropfen Ewigkeit umschlossen.
Sandkörner raschelten auf dem Boden, als Georgina um Tisch und Stühle herumging, und die weißen Krusten, die das Meer bei seinen Besuchen dagelassen hatte, knisterten unter ihren Sohlen. Bis Georgina jäh stehen blieb, die Augen aufgerissen und den Atem angehalten.
Nur noch das Tosen der Wellen war zu hören und der Regen, der draußen hinabrauschte und durch das undichte Dach hereintröpfelte.
Verwirrt betrachtete sie die Gestalt, die reglos und schattengleich vor ihr lag, plötzlich unsicher, was noch wirklich war und was schon Traum. In ihren Beinen zuckte es; sie wollte davonlaufen, in der erdrückenden, trostlosen Leere des Hauses, der sie sonst stets entfloh, Schutz suchen oder Ah Tong zu Hilfe holen. Doch sie konnte sich nicht rühren. Helle Aufregung und dunkle Furcht pulsierten durch ihre Adern, und schließlich ließ sie sich auf die Knie sinken.
Es war kein Mann, der zusammengekrümmt dalag, aber auch kein Kind, sondern jemand auf dem halben Weg dazwischen. Vielleicht ungefähr so alt wie Boy Three, der dafür sorgte, dass Papas Schuhe immer blank poliert waren. Dünn war dieser Junge, obwohl auf andere Art als Ah Tong; ein langgestrecktes Bündel aus scharfkantigen Ellbogen und Knien, sehnigen Schienbeinen und viel zu großen Füßen. Die eine oder andere alte Narbe und frische Schrammen waren in die kupferbraune Haut seines blanken Oberkörpers geritzt, auf der getrocknetes Salzwasser weiße Schlieren hinterlassen hatte. Wie ein angespültes Stück Treibholz sah er aus, genauso abgewetzt, genauso tot.
Georgina musste an den toten Vogel denken, den sie einmal im Garten gefunden hatte, ein zerzaustes Federknäuel mit Beinchen, starr wie aus Draht, und an Mamans wachsbleiches Gesicht, ihre Hand so kalt wie Stein.
Hin- und hergerissen zwischen Neugierde und Schaudern streckte sie die Finger aus.
Aus finsteren Tiefen trieb es ihn herauf, in eine wolkenverhangene Dämmerung, die rasch aufklarte, und das Pochen in Arm und Bein rüttelte ihn endgültig wach. Seine Lider hoben sich, und mit jedem Wimpernschlag schärfte sich das flimmernde Bild vor seinen Augen. Er war nicht allein.
Ein Ruck ging durch seinen Leib. Er wollte kämpfen oder fliehen, doch der grelle Schmerz, der durch ihn hindurchjagte, prügelte ihn sogleich nieder. Unwillig ergab er sich, und seine verkrampften Muskeln lockerten sich erst, als der helle Fleck neben ihm sich zu der weißen Kebaya eines Mädchens auflöste. Ein Kind noch, das ihn aus großen Augen anstarrte, eine Faust vor die Brust gepresst.
»Was … ser?«, raspelte er aus verätzter Kehle, mit einer Zunge wie ein verdorrtes Blatt.
Erschöpft schloss er die Augen, lauschte Stoffgeraschel und dem eiligen Trappeln nackter Füße, das sich entfernte, verstummte und wieder näherte. Das Rauschen des Regens drohte ihn erneut in der Schwärze versacken zu lassen, bis sich eine kleine, heiße Hand unter seine Schulter grub, ein spitzes Knie ihn stützte und sich der Rand eines Gefäßes an seinen Mund presste.
Unersättlich schien der Durst, mit dem er das kühle Regenwasser hinunterstürzte; er hätte alle Flüsse der Insel leertrinken können. Den Kopf weit zurückgeworfen, schlürfte er auch den letzten Tropfen aus dem Krug, bevor er sich halb aufsetzte und sich über den Mund und das nasse Kinn wischte.
»Du bist verletzt.« Das Mädchen schob sich von ihm weg. »Ich hol Hilfe!«
»Nein!«
So scharf, wie seine eigene Stimme ihm in den Ohren klang, so hart hatte er das Handgelenk des Mädchens gepackt. Dürr fühlte es sich unter seinen Fingern an, wie ein Ästchen, das sogleich entzweibrechen konnte. Es war auch ein mageres Ding, das er da vor sich hatte. Dunkel und strähnig vor Nässe hing ihr das Haar ins schmale, goldgebräunte Gesicht, das zu wenig weich, zu wenig rundlich war, um niedlich zu sein. Unkindlich beinahe in der Art, wie es sich argwöhnisch verzog. Und die verkniffenen Brauen verrieten ihm, wie weh er dem Mädchen tat, obwohl kein Laut aus seinem geöffneten Mund kam.
»Nein.« Milder hatte er klingen wollen, doch es kam genauso grob heraus wie zuvor, nur leiser. »Niemand darf wissen, dass ich hier bin. Versprichst du, keinem was zu sagen?«
Das Mädchen nickte, die Augen geweitet. Seltsame Augen waren es; dunkel, aber ohne die Glut schwarzer Augen, sondern mit einem eigentümlichen Schimmer. Von dichten Wimpernbögen eingefasst, als hätte jemand einen Pinsel angesetzt und mit Tusche geschwungene Linien gemalt, die sich zu den Schläfen hin in einer zarten Spitze aufwärts trafen. Augen, die ihn geradezu verschlangen, und seine Finger lockerten sich.
Er warf einen Seitenblick auf den langen, klaffenden Schnitt in seinen Hosen, die Ränder dunkelbraun und steif von Blut und Salz. Auf den nicht minder langen Schnitt in seinem Bein, von altem Blut überkrustet, mit frischem verschmiert.
»Kannst du Nadel und Faden besorgen? Und was zum Verbinden?«
Das Mädchen nickte wieder, zögerlicher dieses Mal.
Die Kebaya klebte auf Georginas Rücken und das nicht allein vom Regen, durch den sie ins Haus und wieder zurückgerannt war, fortwährend die Angst im Nacken, Cempaka könnte sie dabei erwischen, wie sie Schränke und Mamans Nähkorb durchwühlte und dann mit einem großen Bündel in den Armen in den Garten davonstob.
Schweiß rann ihr über die Schläfen, perlte auf ihrer Nase und sammelte sich auf ihrer Oberlippe; immer wieder fuhr sie sich mit dem Ärmel über das Gesicht und rieb die feuchten Hände an ihrem Rock trocken. Nur widerstrebend ging die Nadel durch die Haut, glitt der Zwirn hinterher. Vor Anstrengung hielt Georgina die Zähne zusammengebissen; sie gab sich alle Mühe, es genauso zu machen, wie es ihr der Junge erklärt hatte, als sie ihm nach mehreren fahrigen Anläufen schließlich die Nadel aus den entkräfteten Fingern genommen hatte.
Sie war es nicht mehr gewohnt, jemandem so nahe zu sein. Schon gar nicht auf diese Weise, bloße Haut und eine offene, blutende Wunde unter ihren Händen. Schon gar nicht einem Jungen mit brauner Haut und der tiefen Stimme eines Mannes, der nach Salz und Tang roch und ein bisschen wie sonnengetrocknetes Leder. Einem vollkommen Fremden, von dem sie noch nicht einmal den Namen wusste.
»Wie heißt du?«
Georginas Kopf ruckte hoch; ein, zwei Herzschläge lang blickte sie in seine Augen, schwarz und glänzend wie polierter Stein, dann kauerte sie sich tiefer über den Schnitt in seinem Bein.
»Georgina«, wisperte sie.
Außer Ah Tong redete sie kaum jemand bei ihrem Taufnamen an, und auch er wich oft auf Ayu aus, was Georgina dann rote Wangen und gleich ein bisschen größer machte, weil es »hübsch« bedeutete. Für Maman war sie meistens chouchou gewesen oder p’tit ange und für Papa blieb sie Georgie. Cempakas Cik-cik für »kleine Miss« klang nie freundlich oder gar respektvoll, sondern immer ein wenig verächtlich. Und wenn Cempaka sehr wütend war, schimpfte sie Georgina Hantu, weil sie wie ein Gespenst polternd umging und Unfug trieb.
»Aber meistens werde ich Nilam genannt«, fügte sie schnell hinzu.
Kartika, neben Cempaka die einzige Frau im Haus, nannte sie so; Anish, der Koch, der mit Maman und Papa damals aus Calcutta hierhergekommen war und auch die drei Boys, Chinesen wie Ah Tong, mit dem gleichen langen Zopf.
» Nilam?«
Georgina nickte, verknotete den letzten Faden und schnitt ihn mit Mamans angerosteter Nähschere ab. »Jetzt den Arm?«
Der Junge besah sich seinen Oberarm, aus dem ein Stück Fleisch herausgerissen war. Keine tiefe, aber eine hässliche Wunde, wie von einem Biss.
»Brauchst du nicht. Das heilt so.«
Georgina zuckte mit den Schultern, tauchte ein Stück Leintuch in die Schüssel mit Regenwasser, wrang es aus und tupfte vorsichtig das frische Blut von der Beinwunde.
Ohne den Blick anzuheben, fragte sie nach einiger Zeit leise: »Und wie heißt du?«
Er sah ihr zu, wie sie aus einer braunen Glasflasche eine Tinktur auf den genähten Schnitt träufelte. Sofort entzündete sich dort ein loderndes Feuer, das sich rasch weiter durch sein Bein fraß, dann zu einem heftigen Puckern abebbte.
Georgina. Bis auf die Strähnen, die ihr im schweißnassen Gesicht und am Hals klebten, war ihr Haar zu dicken, unordentlichen Wellen getrocknet, aber tiefbraun, fast schwarz geblieben. Nilam.
»Raharjo«, antwortete er schließlich, die Laute noch ungewohnt in seinem Mund.
Nicht der Name, den man ihm gegeben hatte. Sondern der Name, auf den seine eigene Wahl gefallen war. Das Versprechen, das er sich selbst gegeben hatte, wie eine Prophezeiung, dass seine Träume wahr werden würden.
Sie warf ihm nur einen kurzen Blick zu, dann zerteilte sie mit Schere und Fingern die weiße Stoffbahn, die sie mitgebracht hatte. Als wolle sie ihm zu verstehen geben, wie anmaßend ein Name, der Reichtum verhieß, für eine abgerissene Gestalt wie ihn war. Seine Wangen glühten, und in seinem Bauch flackerte es zornig auf. Dennoch zog er das Knie an, um es ihr einfacher zu machen, die Wunde zu verbinden, hielt er ihr widerstrebend den Arm hin, damit sie die Stelle, an der ihn die Kugel gestreift hatte, ebenfalls säubern und mit Stoff umwickeln konnte.
Die Anspannung, die vorhin noch hitzig durch seine Adern gekreist war und ihn aufrecht gehalten hatte, tröpfelte aus und spülte seine letzten Reserven mit fort. Eine fahle Schwerelosigkeit breitete sich in ihm aus und stieg ihm in den Kopf.
Es war schlimm genug, auf dieses kleine Mädchen angewiesen zu sein; um nicht vor ihren Augen auch noch das Bewusstsein zu verlieren, schüttelte er unwillig den Kopf und atmete tief durch.
»Drüben steht ein Bett«, flüsterte sie dicht an seinem Ohr. »Da kannst du dich hinlegen.«
Mit ihrer Hilfe kam er auf die Füße und taumelte vorwärts; er versuchte, sich so leicht wie möglich zu machen, spürte aber sehr wohl, wie schwerfällig er sich auf ihren schmalen Schultern abstützte. Der Boden schaukelte unter ihm wie die Planken eines perau im Sturm, und er hatte Mühe, sich halbwegs aufrecht zu halten. Die Beine sackten unter ihm weg, und er fiel in eine weiche Wolke hinein, die klamm war auf seiner Haut, aber herrlich kühl.
Von seiner Tapferkeit, seinem unbezähmbaren Willen war nicht viel übrig geblieben. Klein und schwach kam er sich vor, geradezu hilflos. Ein beschämendes Gefühl, eine klaffende Wunde in seinem Stolz, und dennoch war es ihm ein Trost, sich hier in Sicherheit zu fühlen. Aufgehoben.
»Danke«, murmelte er unwillkürlich und blinzelte unter schweren Lidern hervor.
Das Flüstern des Regens war verstummt. Die zarten Bänder aus Licht, die sich von draußen hereinstahlen, malten ein wechselhaftes Muster auf das Gesicht des Mädchens und ließen ihre Augen aufleuchten. Und er begriff, was an diesen Augen so seltsam war.
»Nilam«, flüsterte er. Saphir.
Sein Mund verzog sich zu einem Grinsen, bevor ihm die Lider zufielen.
Ihre Augen waren blau.
Georgina drückte sich in den Rattansessel, der kaum zwei Schritte vom Bett entfernt in der Ecke stand und leise knarzte, als sie die Füße unter sich zog.
Wieder und wieder formten ihre Lippen, ihre Zunge lautlos seinen Namen. Raharjo.
Hinter seinen Lidern zuckte es, seine Brauen waren zusammengezogen, und doch wirkten seine Züge gelöst. Vor allem sein Mund, der jetzt, im Schlaf, zu weich, zu verletzlich aussah, als dass er in dieses Gesicht gepasst hätte, in dem eine wuchtige Kinnlinie, eine starke, breite Nase und scharfe Wangenknochen miteinander im Widerstreit lagen. Ein unfertiges Gesicht, das seine Form noch nicht gefunden hatte, und doch eines, das aussah, als hätte Raharjo bereits mehr Leben gelebt als Georgina es jemals würde.
Das braungemusterte Band, verschossen und angeschmutzt, das um seinen Kopf geknotet war, vermochte kaum seinen pechschwarzen Haarschopf zu bändigen. Sonne, Wind und Salzwasser hatten ihn zu störrischen Spitzen und Wirbeln zerwühlt, und die Enden kringelten sich in seinem Nacken. Etwas Ungezügeltes, Ungestümes ging von ihm aus. Eine Ahnung von grenzenloser Freiheit. Als würde er nicht einen Flecken Erde sein Zuhause nennen, sondern die offene Weite aller sieben Weltmeere. Wie ein Pirat.
Es war dasselbe Zimmer wie eh und je, Georgina beinahe so vertraut wie ihr eigener Herzschlag. Wie ihr Atem, der sein Echo im Rauschen des Meeres fand, solange sie zurückdenken konnte. Die filigran durchbrochenen Wände und die Tür zur Veranda, durch die beständig ein Lufthauch hereinzog und der von Sand, Wasser und Salz abgeschliffene Holzboden. Das breite Bett unter dem löchrigen Moskitonetz, die Laken und Bezüge der Kissen stockfleckig und wohl schon lange nicht mehr gewechselt. Die aufgequollenen Bücher auf dem Bord, an die Georgina nur herankam, wenn sie den Sessel darunterschob, und der einfache Waschtisch mit der Lampe, der angeschlagenen Schüssel und dem Krug, aus dem sie Raharjo zu trinken gegeben hatte.
Ein Zimmer, das wohl schon viele Jahre niemand mehr betreten hatte, ehe Georgina es für sich entdeckt und in Beschlag genommen hatte.
Trotzdem war ihr dieses Zimmer nie leer vorgekommen. Wenn es im Garten von L’Espoir irgendwo spukte, dann hier, in diesen vier Wänden, die wie von einer schattenhaften Vergangenheit getränkt waren. Ein Raum voller Erinnerungen, die nicht Georginas waren, erfüllt von Traumbildern und namenlosen Sehnsüchten. Den verschwommenen, noch ungeformten Anfängen einer Geschichte, die geduldig ausgeharrt hatte, bis es an der Zeit war, sie zu erzählen. Die sich jetzt, mit diesem fremden Jungen, vielleicht nach und nach entfalten würde.
Georginas Herz begann unruhig zu flattern, ein Gefühl, schmerzlich und süß zugleich.
»Cik-cik!«
Cempakas Stimme zerriss den Kokon, der den Pavillon umgab, und schreckte Georgina auf.
»Cik-cik! Wo treibst du dich wieder herum? Muss ich dich denn immer erst irgendwo aus dem Gebüsch zerren?!«
Hastig schwang sich Georgina aus dem Sessel, voller Furcht, Cempakas Zorn könnte stärker sein als ihr Aberglaube.
»Ich komme morgen früh wieder«, flüsterte sie und zog das Moskitonetz über Raharjo zurecht, der keine Regung zeigte.
»Cik-cik!!«
Auf Zehenspitzen schlich sich Georgina aus dem Pavillon, schlängelte sich zwischen den Sträuchern hindurch und rannte durch das Gras auf das Haus zu.
Finster lastete der aufgedunsene Himmel über dem Garten, schluckte alles an Licht und an Farben. Der Wind peitschte durch die Baumkronen, und vom Meer her grollte Donner heran. Auch in Georgina toste es. Ein Sturm, berauschend und beängstigend zugleich, der sie verwirrte. Aus Leibeskräften rannte sie dagegen an, so schnell sie konnte. Wütend rieb sie sich mit der Faust über die Augen, in denen die ersten Tränen aufstiegen.
»Ah Tong! Ah Tong!«
Georginas Stimme, schrill vor Angst, ließ Ah Tong herumfahren.
Das Mädchen rannte durch den Garten auf ihn zu, strauchelte in vollem Lauf und stürzte, rappelte sich auf und rannte weiter. Selbst aus einiger Entfernung konnte Ah Tong erkennen, was für ein Aufruhr in ihr tobte.
»Miss Georgina!«
Er ließ den Rechen in die braunfleckigen Jasminblüten fallen und lief ihr entgegen, bis sie unmittelbar vor ihm scharf abbremste, außer Atem und glühende Flecken auf den Wangen.
»Was ist denn passiert?«, erkundigte er sich besorgt und ging in die Hocke. »Hat dich was erschreckt? Hast du dir wehgetan? Oder …«
Bei dem Gedanken an das Unaussprechliche geriet er ins Stocken.
Die Mauern entlang der Beach Road, in regelmäßigen Abständen von einem Durchgang oder einem Gittertor durchbrochen, waren nicht besonders hoch. Sie reichten gerade so aus, um die Gärten vor dem Meer abzuschirmen, und im Dezember, dem Monat, in dem der Monsun von Nordost am heftigsten wütete, oft nicht einmal dafür. Auch für einen Halunken wären sie nicht unüberwindlich, zumal die Gärten der einzelnen Häuser nur durch Hecken oder Bauminseln voneinander abgegrenzt waren.
Und Singapur war noch jung, wesentlich jünger als Ah Tong, noch keine fünfundzwanzig Jahre alt.
Aufstrebend, gewiss, aber ungeschliffen, die Mauern der europäischen Häuser, von Hunderten von Sträflingen aus Indien errichtet, die erst im vergangenen Jahr einen Gefängnisbau bekommen hatten, ein brüchiger, lückenhafter Firnis europäischer Lebensart. Zwischen den bunten Godowns, in denen Waren aus aller Welt umgeschlagen wurden, den Gassen von Niu Che Shui, dem umtriebigen chinesischen Viertel jenseits des Flusses und den malaiischen Siedlungen aus Holz und Palmblättern war Singapur eine rohe, unfertige Stadt. Wie alle Plätze, an denen sich Geld scheffeln ließ, ein Magnet für Glücksritter wie für Gesindel, ein quirliger morgenländischer Basar mitten in den ungezähmten Tropen.
Die Malaien und Bugis liefen dem Hörensagen nach mit ihren Dolchen immer wieder amuk. Tiger durchstreiften die Dschungel im Herzen der Insel und wagten sich gelegentlich bis an die Küste vor, und Schlangen und kaffeedunkle Skorpione versteckten sich zwischen Blättern und Gräsern. Banden der chinesischen Triaden, manchmal bis zu zweihundert Mann stark, die Gesichter geschwärzt, stürmten nachts die Häuser, um zu plündern und zu morden. Eine finstere Bedrohung, gegen die weder die winzige Garnison der indischen Sepoys etwas auszurichten vermochte noch die Handvoll freiwilliger Ordnungshüter, die sich lieber selbst in Sicherheit brachten. Und die Gewässer wimmelten von einheimischen Piraten, gierig nach Gold, nach Sklaven und manchmal auch nach Blut.
Ah Tong schluckte so heftig, dass sein knochiger Adamsapfel hüpfte. Behutsam nahm er Georgina bei den Schultern und zog sie näher zu sich heran.
»Oder … oder hat dir jemand etwas getan?«
Georgina schüttelte den Kopf, klammerte sich aber mit beiden Händen an die weiten Ärmel von Ah Tongs Hemd.
»Was ist das schon wieder für ein Geschrei?«, keifte es vom Haus her. »So früh am Morgen!«
Ah Tong unterdrückte ein Seufzen und blickte über die Schulter. Die Hände in die Hüften gestützt, stand Cempaka auf der Veranda. Ihr eigentlich hübsches, rundes Gesicht, braungolden wie Muskat, war zu einer hässlichen Grimasse des Zorns verzerrt, und in ihren dunklen Augen loderte es.
»Ist nichts weiter, Liebes! Miss Georgina ist nur erschrocken, ich kümmer mich schon!«
Cempakas Miene bekam etwas Verächtliches. Sie sah aus, als wolle sie im nächsten Augenblick Gift und Galle spucken, beließ es jedoch dabei, unwillig zu schnauben und ins Haus zurückzumarschieren. Ah Tong wandte sich wieder Georgina zu, die unter seinen Fingern zitterte.
»Na, na, Ayu, ist ja gut.« Unbeholfen streichelte er ihr über den Kopf. »Magst du mir nicht sagen, was los ist?«
Der Junge, Ah Tong! Der Junge, der sich seit gestern im Pavillon versteckt. Raharjo. Gestern war er noch ganz munter! Und heute … heute …
Georgina erstickte beinahe an den Worten, die sich in ihrer Kehle aneinanderdrängten, und ihr Mund öffnete sich von selbst.
Niemand darf wissen, dass ich hier bin. Versprichst du, keinem was zu sagen?
Sie machte den Mund wieder zu.
Der Zwiespalt, in ihrer Not einen Erwachsenen zu Hilfe zu holen, aber auch das Versprechen zu halten, das sie Raharjo gegeben hatte, drohte sie zu zerreißen.
»Heil … kräuter«, würgte sie schließlich hervor. »Kennst … kennst du dich mit Heilkräutern aus?« Sie schnappte nach Luft. »Gegen Fieber?«
Ah Tongs hohe Stirn legte sich in tiefe Querfalten. »Ein wenig.«
Er blinzelte und legte den Kopf schräg. Das Mädchen war blass um die Nase und sah aus, als würde es sich jeden Moment vor seine Füße übergeben.
»Geht’s dir nicht gut? Bist du krank?«
Dem sorgenvollen Blick Ah Tongs, der unter ihre Haut zu kriechen schien, konnte Georgina nur schwer standhalten, und rasch schüttelte sie den Kopf.
Ah Tongs Miene hellte sich auf. »Ist es für ein … Spiel?«
Georgina schlug die Augen nieder und nickte.
»Ich seh mal nach, ja?« Ah Tong stand auf. »Gegen Fieber, sagst du?«
Georgina nickte wieder.
»Aber … aber es muss echt sein, Ah Tong!«, rief sie seiner hageren Gestalt hinterher, die sich in langen Schritten entfernte.
Ah Tong wandte sich halb um, nickte ihr mit einem kleinen Lächeln zu und deutete eine Verbeugung an.
»Natürlich! Ehrenwort, Miss Georgina!«
Georgina sah ihm nach, unschlüssig, ob sie ihm hinterherlaufen sollte, obwohl Cempaka ihr strengstens verboten hatte, sich auch nur in der Nähe der Dienstbotenquartiere aufzuhalten. Ihre Knie, die zu zittern begannen, nahmen ihr die Entscheidung ab. Schlotternd und die Arme fest um sich geschlungen, rührte sie sich nicht von der Stelle und fror in der dampfenden Schwüle des Morgens.
Das braune Fläschchen mit dem kostbaren Pulver an sich gepresst, hastete Georgina in den Pavillon und kramte mit bebenden Fingern eines der Gläser und einen angelaufenen Löffel aus dem Schränkchen.
»Gleich geht’s dir besser«, murmelte sie, als sie in das benachbarte Zimmer huschte.
Mehr, um sich selbst Mut zu machen, denn Raharjo lag noch genauso reglos da, wie sie ihn vorhin aufgefunden hatte. Nur sein flacher Atem, der stoßweise ging, die Schauer, die in Abständen seinen Leib erschütterten und das Flackern hinter seinen Lidern verrieten, dass er noch am Leben war.
Sorgsam maß sie das Pulver ab und rührte es in ein Glas mit Regenwasser, stützte Raharjo im Nacken und flößte ihm Schluck um Schluck ein. So viel schwerer war er als gestern, dass sie unter der Anstrengung keuchte; so stark glühte er, dass es ihr die Brust zusammenzog. Ungeschickt bettete sie seinen Kopf zurück und ließ sich von der Kante der Matratze gleiten.
»Du musst wieder gesund werden«, flüsterte sie ihm zu, während sie auf dem Boden kauerte, ein Stück Stoff in die Schüssel mit Regenwasser tauchte, es auswrang und ihm damit über das schweißnasse Gesicht fuhr. »Hörst du? Du darfst einfach … einfach nicht sterben.«
Sie zuckte zusammen, als sich feuchtkalte Finger um ihre Hand schlossen. Starkknochig und sehnig war seine Hand, von rauen Schwielen übersät, die perlmutthellen Nägel schwarzgerändert. Eine Männerhand, in der ihre Kinderfinger beinahe verschwanden.
»Soll … soll ich nicht doch Hilfe holen?«
Raharjo deutete ein Kopfschütteln an.
»Ich kann das nicht alleine«, entfuhr es ihr kläglich.
Die Bürde, die sich damit auf sie gewälzt hatte, dass dieser fremde, verletzte Junge hier aufgetaucht war, wie vom Meer angespült, kam ihr mit einem Mal viel zu schwer vor. Zu gewaltig für ihre noch nicht einmal zehn Jahre.
Er drückte ihre Hand, und seine Brauen ruckten dabei, als wollte er ihr widersprechen.
Georgina sank in sich zusammen und legte die Wange gegen die Matratze, deren Laken muffig rochen. So dicht war ihr Gesicht an dem Raharjos, dass sie die Schweißperlen auf seiner Haut erkennen konnte. Eine winzige Narbe auf seiner Nasenwurzel, eine andere dicht unterhalb seines Brauenbogens und die Ahnung einzelner dunkler Bartstoppeln um den Mund.
»Du musst wieder gesund werden«, wisperte sie in seinen schwefligen Atem hinein.
Raharjo nickte schwach, ein kaum sichtbares Zucken um die rissigen Mundwinkel.
Seine Finger drängten sich zwischen ihre, die noch immer das feuchte Tuch umklammert hielten, und als besiegelten sie einen Pakt, verflochten sie sich ineinander.
Georgina starrte ins Dunkel.
Ihr Herz trommelte in der Brust, geriet immer wieder schmerzhaft ins Stolpern und hämmerte dann weiter. In Schüben brach ihr der Schweiß aus, durchfeuchtete ihr Nachthemd und das Laken. Ihr war speiübel, und an Schlaf war nicht zu denken. Es war die Angst, die sie wachhielt, die Angst vor dem Morgen. Davor, was sie dann im Pavillon erwarten mochte. Ob es Raharjo besser ging oder er womöglich in der Nacht an seinem Fieber gestorben war.
Am Tag verliehen die Stimmen der Männer und Frauen dem Haus einen Anschein von Lebendigkeit, ihre Schritte, ihre kleinen und großen Handgriffe und ihr Gelächter wie das Krabbeln emsiger Insekten in einem viel zu großen Bau. Des Nachts jedoch wurde die lähmende Stille spürbar, die wie ein Nachtmahr über dem Haus lastete. Als wäre die Seele von L’Espoir erloschen, seitdem es Maman nicht mehr gab.
Eine Stille, die für Georgina umso quälender war, da Cempaka nicht mehr bei ihr im Zimmer schlief.
Meist war Georgina viel daran gelegen, Cempaka aus dem Weg zu gehen, die nie sonderlich herzlich gewesen war, sie jedoch seit Mamans Tod geradezu mit Abscheu und Verachtung strafte. In Nächten wie dieser aber wäre sie froh darum gewesen, wenigstens Cempakas schlafschwere Atemzüge in ihrer Nähe zu haben.
Unaufhörlich peinigten sie die Gedanken daran, ob sie etwas falsch gemacht hatte, als sie sich um Raharjos Wunden kümmerte und es ihm deshalb jetzt so schlecht ging. Ob das Pulver, das Ah Tong ihr gegeben hatte, wirklich echt war und sie sich auch nicht in der Menge vertan hatte. Ob die Arnikatinktur, mit der Maman früher ihre aufgeschürften Ellbogen und aufgeschlagenen Knie betupft hatte, nicht inzwischen gekippt war und nun bei Raharjo alles schlimmer machte. Bange Fragen und Zweifel, die beharrlich an ihr nagten.
Ihr war zum Weinen zumute; sie sehnte sich nach jemandem, der sie in die Arme nahm und an sich drückte. Jemand, dem sie alles erzählen konnte, der sie tröstete und ihr versprach, dass alles gut werden würde. Jemand wie Maman.
Ein Geräusch ließ sie aufhorchen, und Georgina hielt den Atem an. Es klang wie Pferdehufe und Wagenräder.
Papa! Kurzerhand raffte sie das Moskitonetz beiseite, sprang aus dem Bett und lief hinaus auf den Gang. Papa ist zu Hause!
Oben an der Treppe blieb sie stehen und lauschte. Unter dem sich wieder entfernenden und schließlich hinter dem Haus verstummenden Klappern und Knirschen von Pferd und Wagen hörte sie feste Schritte, dann Stimmen. Die tiefe, trockene von Papa und den hohen Singsang von Boy One, der abends immer auf ihn wartete, um ihm Hut und Gehrock abzunehmen und ihm die Pantoffeln und etwas zu trinken brachte, gleich wie spät es auch wurde. Als unten Stille einkehrte, wartete Georgina noch einige Herzschläge, halb unruhig, halb hoffnungsvoll, bevor sie langsam die Stufen aus glatt poliertem Holz hinabstieg, in den sanften Lichtschein des unteren Stockwerks hinein.
Barfuss tapste sie über den kühlen Boden der Halle und drückte sich dann gegen den Türrahmen des Arbeitszimmers.
Die Lampe auf dem Schreibtisch schnitt einen pudrig-gelben Lichtkreis aus der Dunkelheit. Schummerlicht und tiefe Schatten zogen sich über Papierstöße und einen Stapel Briefe, ließen das halb leere Glas aufglänzen und meißelten die Züge ihres Vaters noch härter heraus. Die scharf vorspringende Nase, die sein Profil dominierte und das unnachgiebige Kinn. Der Mund, der sich in den letzten paar Jahren zu einem Strich zusammengepresst hatte und die zu beiden Seiten eingeritzten Falze. Obwohl ein erster Silberglanz sein dichtes Haar durchkämmte, waren die starken Brauen nach wie vor kohlschwarz und überschatteten seine Augen. Blau wie Georginas, nur heller und durchdringender.
Ein Ziehen machte sich in Georginas Bauch breit.
»Papa.« Dünn kam es heraus, ein bloßes Piepsen.
Über dem Brief, den er in den Händen hielt, ruckte sein Kopf hoch.
»Georgie.«
Vielleicht lag es am Licht, aber Georgina glaubte zu sehen, wie ein Leuchten in seinen Augen aufglomm, das jedoch sogleich wieder verglühte. Seine Brauen, die Georgina immer an pelzige Raupen erinnerten, zogen sich zusammen.
»Wieso bist du nicht im Bett?«
Sie zog eine Schulter hoch und zwirbelte einen Zipfel ihres Nachthemds zwischen den Fingern.
»Ich kann nicht schlafen.«
Einer ihrer Füße tastete sich über die Schwelle vor, doch weiter wagte sie sich nicht.
»Darf ich zu dir kommen?«
Hoffnung keimte in ihr auf, als sich das Gesicht ihres Vaters zu erweichen schien, und fiel dann in sich zusammen, als sich seine Miene wieder verhärtete.
»Geh zurück ins Bett. Ist schon spät«, erwiderte er und senkte den Blick wieder auf den Brief. Müde klang er, die Stimme wie aufgeschürft. »Gute Nacht.«
»Nacht«, wisperte Georgina, die Kehle eng und einen bitteren Geschmack auf der Zunge.
Mit gesenktem Kopf trottete sie in die Halle zurück und versuchte nicht an den Vater zu denken, den sie einmal gehabt hatte. Ein Vater, der viel lachte, mit ihr scherzte und spannende Geschichten zu erzählen wusste. Der sie hoch in die Luft stemmte und herumwirbelte, sie jedes Mal sicher in seinen Armen auffing, sie fest an sich drückte und ihr einen Kuss gab. Auf dessen Schoß sie sich oft kuschelte, wenn er abends im Lampenschein auf der Veranda saß, einen Arm um Mamans Schultern gelegt, bis die Flüsterstimmen der beiden und Mamans weiche Hände, die ihr über das Haar streichelten, Georgina nach und nach in einen seligen Schlummer fielen ließen. Und sie verstand nicht, warum sie nichts davon über den Abgrund hatte retten können, der sich mit Mamans Tod aufgetan hatte und Papa seither einer leeren Muschelschale glich.
Mitten in der Halle blieb sie stehen und rieb sich über die brennenden Augen. Sie wünschte sich so sehr, bei Raharjo zu sein, dass es wehtat. Aber sie war noch nie nachts allein im Garten gewesen, der in der Finsternis seine ungezähmte Seite auslebte. Von rastlosen Schatten bevölkert und erfüllt von Myriaden von Stimmen, die keckerten und raschelten, raunten und säuselten. So wie das Meer in der Nacht ungehemmt schäumte, sein zügelloses Rollen und Stampfen ein Echo seiner Tiefe.
»Gute Nacht, Nilam.«
Georgina hob den Kopf. Den ausgebürsteten Gehrock von Papa über dem Arm, stand Boy One neben der Treppe, ein mitfühlendes Lächeln auf seinem Gesicht, das im Lampenschein so hell und durchscheinend aussah wie das einer chinesischen Porzellanpuppe.
Georgina konnte nur nicken und schlich langsam die Stufen zu ihrem Zimmer hinauf.
Sie gab sich alle Mühe, Raharjo nicht unverhohlen anzustarren, während er aß, sich stattdessen ganz darauf zu konzentrieren, ein frisches Laken in Streifen zu reißen. Es gelang ihr nicht; immer wieder musste sie zu ihm hinsehen, in seligem Erstaunen, dass er nach einem Tag Fieber und zwei Tagen schläfriger Mattigkeit heute wieder munter wirkte. Ausgehungert machte er sich über Dal Tadka und Reis, die Chapatis und die Bananen her, die sie teils von ihrem eigenen Mittagessen aufgespart, teils Anish abgebettelt oder einfach aus der Vorratskammer gestohlen hatte.
Als er den bis auf die Bananenschalen leeren Teller beiseitestellte, rutschte Georgina näher. Vorsichtig schob sie sein Hosenbein hinauf und wickelte den Verband ab, um die blutverkrustete Wunde zu säubern, mit Tinktur zu behandeln und neu zu verbinden. Sie konnte nur hoffen, dass Cempaka nicht so bald auffiel, wie der Stapel Leintücher im großen Wäscheschrank rasch zusammenschmolz.
Als Raharjo zusammenzuckte, hielt sie erschrocken inne.
»Tut’s sehr weh?«
Er schüttelte den Kopf. »Geht schon.«
Georgina zog die Unterlippe zwischen die Zähne, um all die neugierigen Fragen zurückzuhalten, die ihr die Zunge versengten.
»Wie ist das …«, platzte sie schließlich heraus, als sie es nicht mehr aushielt. »Ich meine, was … wer …« Die Augen auf seine Beinwunde geheftet, verstummte sie wieder.
»Ein Kampf. Auf See.«
Langsam hob Georgina den Kopf, ein aufgeregtes Zittern im Bauch.
»Bist … bist du ein … Pirat?«
Einer seiner Mundwinkel hob sich zu einem Grinsen, das seine weißen Zähne aufblitzen ließ.
»Was weißt du schon über Piraten?«
Ihre Gedanken streiften die Märchen und Abenteuergeschichten, die Maman ihr früher vorgelesen hatte und denen sie schon bald entwachsen war. Piraten waren für Georgina keine schneidigen Freibeuter in Kniehosen, keine schmutzigen Finsterlinge mit Augenklappe und Säbel, die unter einer Totenkopfflagge segelten. Sondern die allzu wirklichen Räuber zur See, die aus China stammten oder von den unzähligen Inseln hinter dem Horizont.
Eine beständige Sorge für Papa und die anderen Händler der Stadt, aber auch für Onkel Étienne in Pondichéry; mehr als einmal hatte Georgina mitbekommen, wie ihr Vater mit einer Mischung aus Wut und Resignation davon gesprochen hatte, erneut eine vielversprechende Fracht abschreiben zu müssen. Sie wusste davon, dass die Regierung in Calcutta nach langem Drängen endlich Kanonenboote geschickt hatte, um die Piraterie auszumerzen. Doch nach wie vor waren die Seewege von und nach China und Japan, Indien, Europa und Amerika, die sich durch die Straße von Malakka fädelten wie Garn durch ein Nadelöhr, alles andere als sicher.
Den Kopf hochgereckt, erwiderte sie fest Raharjos Blick.
»Auf jeden Fall weiß ich mehr, als du mir wohl zutraust.«
Raharjo wurde nicht schlau aus diesem seltsamen Mädchen.
Sie musste ungefähr in demselben Alter sein wie seine jüngsten Schwestern, aber so unbeholfen, wie sie sich um ihn kümmerte, schien sie es nicht gewohnt zu sein, dort mit anzupacken, wo es Arbeit zu tun gab. Oft wirkte sie noch wie ein kleines Mädchen, und doch fehlte ihr die fröhliche, übersprudelnde Unbeschwertheit, die er aus seiner eigenen Kindheit kannte. Eine vorzeitige Ernsthaftigkeit umgab sie. Fast so, als ob der Schatten, den ihr schmaler Leib warf, wenn die Sonne zwischen den Regengüssen ihre Strahlen hereinschickte, finsterer war als bei anderen Menschen.
Ihre Haut war zu hell, als dass sie ein Kind dieser Insel oder vom Festland hätte sein können, aber sie sprach das Malaiisch dieser Gegend wie ihre Muttersprache. Zuweilen rutschte ihr ein Wort auf Englisch heraus, ohne dass sie es zu merken schien, und ab und zu eines in einer anderen Sprache, die verspielt klang, Französisch vielleicht.
Ihre Augen … Merkwürdige Augen hatte Nilam.
Wechselhaft wie der Himmel über der Insel. In der Tat so blau wie Saphire, vor allem, wenn sie auffunkelten, so wie jetzt. Je nachdem, wie sie den Kopf hielt und wie das Licht darauf fiel, vielleicht auch je nachdem, was in ihr vorgehen mochte, spielte ihre Farbe in das tiefe Violett der wilden Orchideen, die oben am Fluss wuchsen. Und manchmal verdunkelten sie sich so stark, dass sie genauso schwarz aussahen wie seine eigenen und die seiner Brüder und Schwestern.
Nur die Orang Putih hatten blaue Augen, aber selten so dunkles Haar wie Georgina, selten so gebräunte Haut. Vor allem gab es kaum Frauen unter ihnen, und Raharjo hatte auch noch nie ein weißes Kind gesehen, obwohl er viel auf der Insel herumgekommen war.
Das Mädchen mit den zwei Namen, das Haar immer ein wenig zerzaust, in einer fleckigen Kebaya und mit staubigen Füßen, war ihm ein Rätsel.
Nach der roten Dunkelheit des Fiebers hatten ihn die Gezeiten von Wachen und Dämmerschlaf überspült, und wann immer er zu sich gekommen war, waren seine Gedanken um dieses Rätsel gekreist. Georgina. Nilam. Cik-cik, wie sie von einer schrillen malaiischen Frauenstimme gerufen wurde, vor der sie sich fürchtete.
Der einzige Reim, den er sich darauf machen konnte, war, dass ein Orang Putih dem Drängen seiner Lenden nachgegeben und mit einer Frau der Insel dieses Mädchen gezeugt hatte, das hier, in seinem großen Haus, leben durfte, ohne dass es dafür arbeiten musste. Ein Kind zweier Welten, das wohl in keiner von beiden je Wurzeln schlagen könnte. Wohin sie sich auch wandte – sie würde immer eine Fremde sein. Kein Wunder, dass sie so einsam, so verloren wirkte.
»Nilam.«
Leise hatte er diesen Namen ausgesprochen. Behutsam, als wollte er herausfinden, welcher von beiden ihr besser behagte.
Sie hob die Augen von der Schusswunde in seinem Arm an, die sie gerade mit einem frischen Verband versah. Klarblau wie das Meer an einem sonnigen Tag waren sie jetzt, die Brauen in einer stummen Frage zu zierlichen Arabesken zusammengezogen.
»Du hast was gut bei mir. Auf ewig.«
Ihr Blick flackerte und wich seinem aus. Ihre Wangen färbten sich, und ihr Mund bog sich zu etwas wie einem Lächeln; das erste, das er an ihr sah.
»Du schuldest mir noch eine Antwort.«
Ein Grinsen zuckte auf seinem Gesicht auf. »Die Orang Putih mögen diese Insel jetzt vielleicht ihr Eigen nennen. Aber die Flüsse und das Meer – die werden immer uns gehören. Den Orang Laut.«
Orang Laut Meeresmenschen.
Seit Georgina das erste Mal von diesen Stämmen gehört hatte, Seenomaden, die nicht in Häusern lebten, sondern auf Booten, mit denen sie auf dem Meer umherzogen, hatte sie sich die Orang Laut als Fabelwesen vorgestellt. Menschen, die statt Beinen einen schuppigen Fischschwanz hatten. Geschöpfe, die an Land wie gewöhnliche Menschen aussahen, sich im Wasser aber in Meeresgetier verwandelten. Ihr Blick huschte zu Raharjos Füßen, jeder Zeh, jede Rinne und jeder Höcker wie von kunstfertiger Hand aus frischem Tropenholz geschnitzt, glatt geschmirgelt und blank poliert.
»Was ist?«
»Nichts.« Erneut schoss ihr das Blut ins Gesicht.
»Liest du mir wieder vor?«
Raharjos Kinn ruckte in Richtung des Sessels, in dem ein aufgeschlagenes Buch auf den welligen Seiten lag, der Rücken zerfasert und hochgebogen wie der aufgesperrte Schnabel eines Vogels.
Das Buch, in dem Georgina gestern gelesen hatte, während sie über Raharjos Schlaf wachte und darauf wartete, bis es an der Zeit für die nächste Dosis von Ah Tongs Fieberpulver war. Verschwommen erinnerte sie sich daran, wie sie irgendwann ihre eigene Stimme hatte murmeln hören, um der Stille im Raum, dem einschläfernden Rauschen von Meer und Regen etwas entgegenzusetzen. In dem Glauben, Raharjo schlafe zu tief, um etwas davon mitzubekommen.
»Du verstehst Englisch?«
Er legte den Kopf schräg. »Nicht alles. Aber viel.«
Sie spürte, wie seine Augen ihr folgten, als sie sich vom Bett herunterschob und das Buch holte.
»Dein Vater … Ist er Engländer?«
»Schotte. Aus Dundee. Aber er war schon sehr lange nicht mehr dort. Bevor er hierherkam, hat er viele Jahre in Calcutta gelebt. Eines Tages geht er mit mir dorthin zurück.«
Wie selbstverständlich hockte sie sich neben Raharjo, ihren Rücken gegen das Kopfteil gelehnt, das Buch auf ihren angezogenen Knien. Ein Impuls, den sie schnell bereute. Denn seine Nähe verunsicherte sie ebenso wie seine forschenden Blicke, die zwischen ihrem Gesicht und den bedruckten Seiten hin- und herwanderten. Ihre eigene Stimme klang ihr fremd in den Ohren, verzerrt und viel zu hoch, und alle paar Zeilen verhaspelte sie sich und geriet ins Stottern.
»Willst … willst du vielleicht selber lesen?«, unterbrach sie sich schließlich mit einem dünnen Auflachen und hielt ihm das Buch hin.
Der wissbegierige Glanz in seinen Augen verschwand, und die Muskeln seines starken Kiefers spannten sich an.
»Ich bin müde«, gab er heiser von sich, streckte sich der Länge nach aus und drehte Georgina den Rücken zu.
Georginas Lider flatterten. Dann begriff sie, und ihr wurde heiß.
»Entschuldige«, flüsterte sie. »Ich … ich hab nicht dran gedacht, dass du … Das war dumm von mir.«
Raharjo rührte sich nicht. Georginas Magen krampfte sich so fest zusammen, dass ihr schlecht wurde.
»Wenn … wenn du willst, bring ich’s dir bei. Ist gar nicht so schwer!«
Raharjo schloss die Augen und blieb stumm.
Sanft driftete Georgina aus tiefem Schlaf empor, ihre Kebaya durchgeschwitzt und ein klebriges Gefühl auf der Wange. Das schwere Licht des späten Nachmittags hing im Raum, und draußen schrillten die Zikaden; für den Moment musste es zu regnen aufgehört haben.
Schläfrig blinzelte sie ein paar Mal und riss dann die Augen auf.
Ihr Gesicht drückte sich gegen Raharjos braune, glatte Brust, die sich mit jedem seiner Atemzüge hob und senkte, sein Herzschlag ein ruhiges, gleichmäßiges Pochen an ihrem Ohr. Sie konnte sich nicht erinnern, eingeschlafen zu sein, und noch weniger, wie es dazu gekommen war, dass sie halb auf ihm lag, halb in seine Armbeuge geschmiegt. Ihr Blick wanderte über Raharjos flachen Bauch, über den scharfen Grat seines Hüftknochens und blieb neugierig an der feinen Linie schwarzer Härchen hängen, die sich von seinem Nabel bis unter seinen Hosenbund zog und die ihr bisher noch gar nicht aufgefallen war. Hastig sah sie weg und hob vorsichtig den Kopf.
Auch Raharjo schlief, den Arm um ihre Schultern gelegt. Ein seltsames, süßes Sehnen zitterte durch ihren Bauch, das sie verwirrte, und gleichzeitig wand sie sich vor Scham, ihm ungewollt so nahe gekommen zu sein; gewiss war es ihm unangenehm. Sie zog den Ellbogen unter sich, um sich hochzustemmen und sich unter seinem Arm durchzuwinden.
Ein leichtes Rucken ging durch seinen Körper, und Georgina versteifte sich.
Unter schweren Lidern sah er zu ihr hinunter, dann zuckte ein Lächeln um seinen Mund. Mit einem tiefen Atemzug rollte er sich halb auf die Seite, zu Georgina hin, und zog sie fest an sich.
Ein Augenblick ungläubigen Widerstands, dann gab Georgina dem Druck seines Arms nach und ließ sich wieder gegen seine Brust sinken. Atmete seine Wärme, seinen Geruch nach Meer und Tang, wie Leder und Zimt, und ihr Herz zersprang beinahe vor Glückseligkeit.
Wie ein Stein, der in ein stilles Gewässer fällt und die spiegelnde Oberfläche kräuselt, darin Wellen schlägt und Kreise zieht, formte Raharjo Georginas Tage neu.
Das ziellose Mäandern zwischen leeren Stunden war vorbei. Der unendliche, glatte Ozean aus Zeit bekam Konturen aus Stränden und felsigen Küsten, eine Struktur aus Korallenriffen und grünen, hügeligen Inseln. Einen Namen, Nusantara, der einen Kontinent aus Gewässern und Inseln beschrieb, weiter als das menschliche Auge reichte.
Galang. Bintan. Mesanak. Temiang. Singkep.
Inseln, deren Namen für Georgina so neu und fremd waren wie manche Ausdrücke in Raharjos Malaiisch. Nachts träumte sie von Welten unter Wasser, das Licht blauschillernd und türkisen, in dem es glitzerte und flirrte. Inmitten irisierend bunter Fische schwebte sie in diesen Träumen umher, zwischen Seesternen und bizarren Meerestieren in den knochenbleichen Steinwäldern der Korallen. In einer schwerelosen, friedlichen Stille.
Das Meer war das Zuhause der Orang Laut, die Heimat ihrer Ahnen, von Anbeginn aller Zeiten ihre Lebensader und ihr Schicksal.
Es war eine archaische Welt, aus der Raharjo kam, in der die Menschen noch genauso lebten wie vor Tausenden von Jahren. Indem sie fischten und nach den Schätzen des Meeres tauchten und Tauschhandel trieben. Herren der Meere, Krieger zur See, die heute Handelsfahrern Geleitschutz boten, morgen jedoch schon für sich beanspruchten, was sich an Bord der Schiffe befand, die ihre Gewässer durchsegelten. Ein Leben, das seinen eigenen althergebrachten Traditionen, Werten und Ritualen folgte, eingeknüpft in das engmaschige Netz aus Familie, Sippe und Stamm. Dem Temenggong des Sultans von Johor unterstellt, einem neptungleichen Herrscher, dessen Reich weitaus mehr Wasser denn Land umfasste. Das auf Wellen und Sand gebaut war und nicht auf Stein und doch ewig und zeitlos schien.
Gierig sog Georgina alles auf, was Raharjo ihr von dieser fremden Welt erzählte, die einem Märchen entsprungen schien und die es dennoch wirklich gab. Raharjo brachte das Abenteuer zu ihr, das sie sich in ihren lebhaftesten Tagträumen nicht kühner hätte ausmalen können. Und obwohl sie ihm in all diesen Tagen so nahe gewesen war, dass sie nicht daran zweifeln konnte, einen Jungen aus Fleisch und Blut vor sich zu haben, kam er ihr manchmal wie ein mythisches Geschöpf des Ozeans vor.
Ein junger Meermann. Ein Sohn Tritons. Oder wie einer der Selkies, von denen ihr Vater früher erzählt hatte, Robbenwesen, die ihr Fell abstreiften, um in Menschengestalt an Land zu gehen.
Während Georgina nur ein gewöhnliches kleines Mädchen war, an Land geboren und erdverhaftet.
Dessen einziger Schatz im Wissen um die Lettern bestand, durch die sich Raharjo mit ihrer Hilfe buchstabierte, ihrer beider Köpfe dicht an dicht über die Buchseiten gebeugt. Schwarze Zeichen, dürr wie Spinnenbeine, spröde wie das verschlissene Papier ihres Untergrunds. Armselig im Vergleich zu dem Zauber, der von Raharjo ausging.
»Eines Tages«, sagt Raharjo leise, den Blick über die rotblühenden Zweige hinweg auf das Meer gerichtet, »eines Tages werde ich ein reicher Mann sein. Reich und mächtig. Mit einem großen Schiff, das allein mir gehört.«
Georgina, die neben ihm auf dem Felsen hockte, musterte ihn verstohlen von der Seite. Seine dunklen Augen glosten mit einer Sehnsucht, die wie ein Echo ihrer eigenen Träume war. Sie schlang die Arme fester um ihre angezogenen Knie.
»Nimmst du mich dann mit?«, fragte sie zaghaft.
Sein Mund kräuselte sich. »Kannst du denn schwimmen?«
Beschämt schüttelte Georgina den Kopf.
Er schnitt ein Gesicht und schnalzte bedauernd mit der Zunge.
»Mir kommt keiner aufs Schiff, der nicht schwimmen kann.«
Georgina nickte schwach und zerrte an einem losen Faden ihres Sarongs herum.
»Aber«, hörte sie ihn dicht an ihrem Ohr raunen, »ich kann’s dir beibringen.« Er versetzte ihr einen leichten Stoß mit der Schulter. »Natürlich nehm ich dich mit.«
Die Spur eines Lächelns zitterte über Georginas Gesicht und sprang dann zu einem Strahlen auf, als Raharjo ihr Lächeln erwiderte.
Georgina wusste nicht, ob sie ihn mit dem leichten Schatten an Bartflaum lieber mochte oder wenn sein Kinn und die Partie um den Mund glatt und weich aussahen, nachdem er von dem alten Rasiermesser in der Schublade des Waschtischs Gebrauch gemacht hatte. Aber sie wusste, dass sie die kleinen Kerben beiderseits seiner Mundwinkel mochte, die sich zeigten, wenn er lächelte, und wie hell seine regelmäßigen Zähne in seinem braunen Gesicht aufleuchteten, wenn er grinste. Sie mochte, wie lebhaft sich seine Brauen bewegten, wenn er sprach, und sie mochte seine Augen, die sie an satte Tropfen eines schwarzen Ozeans erinnerten, mal ruhig und von einer unergründlichen Tiefe, mal von aufbrausender Natur. Und wenn er sie ansah, so wie jetzt, begann es in ihrem Bauch zu kitzeln wie von einer ganzen Handvoll Käfer.
Unwillkürlich zog sie die Knie enger zu sich heran, ein unruhiges Kribbeln in ihren Fingern, die es vermissten, sich um Raharjos Wunden zu kümmern.
»Wie geht es deinem Bein?«
Raharjo hielt den Schnitt in seinen Hosen mit zwei Fingern auf und spähte hinein, besah sich dann die rosige Stelle an seinem Oberarm.
»Heilt gut.« Mit einem kleinen Grinsen auf dem Gesicht wandte er sich ihr zu. »Die Narben werden mich immer an dich erinnern.«
Der Wind war plötzlich kühl auf ihrer Haut, und Georgina musste blinzeln.
Da war etwas in Raharjos Augen, wenn sie über die Mauer schweiften und den Segeln der Schiffe folgten, bis sie hinter dem Horizont verschwunden waren, das verriet, wie sehr er sich nach dem nassen Element verzehrte. Eine Unrast hatte in seinen Gliedern Einzug gehalten, die in dem Maße zunahm, in dem er wieder zu Kräften kam. Als bedeute es eine Folter, zu lange an Land auszuharren.
Und Georgina fürchtete den Tag, an dem der Lockruf des Ozeans übermächtig werden würde und sie Raharjo an das Meer verlor, bevor sie sein Robbenfell fand und es verstecken konnte.
Leichtfüßig lief Georgina durch den Garten, und im Takt ihrer Schritte schlug ihr Herz frei und schnell. Die Schüssel mit dampfendem Frühstückscurry und Reis an sich gedrückt, zwängte sie sich durch das Dickicht und hüpfte die Stufen zur Veranda hinauf.
»Guten Morgen«, rief sie von der Schwelle aus in das Schlafzimmer hinein, eine neugewonnene Freude in der Stimme.
Der Raum war leer.
Sie drehte sich um und schaute zum Felsen hinüber, blickte nach allen Richtungen in das dichte Grün hinein.
»Raharjo?«
Die Unterlippe zwischen die Zähne gezogen, wandte sie sich wieder um. Aus dem Augenwinkel nahm sie wahr, dass oben auf dem Bord eine Lücke klaffte; zwei der Bücher fehlten.
Als ihr Blick auf den Zweig rosablühender Orchideen fiel, der auf dem Bett lag, wusste sie es.
Zitternd stellte sie die Schüssel auf dem Waschtisch ab. Ihre Schritte über den Holzboden waren schwer und schleppend; kraftlos kroch sie auf das Bett und rollte sich eng zusammen.