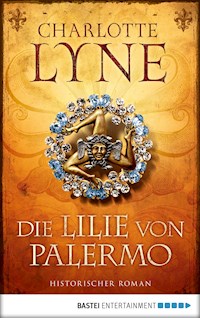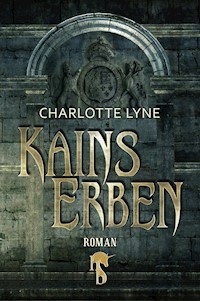6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Portsmouth 1336: Erfüllt von Hoffnungen geht die junge Dorothy in die aufstrebende Hafenstadt, um den Sohn eines berühmten Schiffbauers zu heiraten. Doch ihre Ehe entpuppt sich als Alptraum und dann bricht der Hundertjährige Krieg aus. Die französische Flotte legt Portsmouth in Schutt und Asche, und Dorothy muss über sich selbst hinauswachsen, um ihre Familie durchzubringen. Zur Seite steht ihr nur ihr Schwiegervater – doch der wird verdächtigt, seine untreue Ehefrau ermordet zu haben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1000
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Charlotte Lyne
Das Haus Gottes
Historischer Roman
Für meine Eltern Für Portsmouth am Solent
Sumer is icumen in, Lhude sing, cuccu! Groweth sed and bloweth med And springth the wde nu, Sing cuccu! Awe bleteth after lomb Lhouth after calue cu. Bulluc sterteth, bucke uerteth Murie sing cuccu! Cuccu, cuccu, well singes thu, cuccu. Ne swik thu nauer nu, Sing cuccu nu, sing cuccu. Der Sommer ist gekommen. Sing lauthals, Kuckuck! Samen sprießen, Wiesen blühen, Und der Wald schlägt aus. Sing, Kuckuck! Das Schaf blökt nach dem Lamm, Und die Kuh muht nach ihrem Kalb. Es springt der Ochse, es furzt der Bock, Sing heiter, Kuckuck! Kuckuck, Kuckuck, so schön singst du, Kuckuck. Schweig nimmermehr. Sing, Kuckuck. Sing. (Englischer Rundgesang des Spätmittelalters)
Prolog: Die Frau in der Salzwiese
Portsmouth, Hampshire, September 1322
Ihr Mann nahm die Peitsche. Sie wippte in seiner Hand, die armlange Lederpeitsche, die er benutzte, um sein gelbbraunes Fohlen einzureiten. Mit der freien Hand stieß er die Frau, die keinen Halt fand und stürzte. Schulter und Hüfte prallten hart auf die Dielen. Sie schrie. Seit sie ihrem Mann vermählt worden war, hatte niemand ihr Schmerz zugefügt. Sie erhaschte einen Blick auf sein Gesicht, das sie weiß und gefasst kannte und das jetzt die Fassung verlor und dunkel anlief. Ich habe dich geschlagen. Schlag du mich, zahl’s mir heim, und dann lass all das zwischen uns vergangen sein.
Als er die Peitsche über den Kopf hob, bedeckte sie das Gesicht mit den Armen und kniff die Augen zu. Doch der Hieb, auf den sie wartete, kam nicht. Nur die Stimme ihres Mannes peitschte auf sie nieder. »Geh«, sagte er, ganz kalt, ganz reglos. »Geh zu ihm, er soll dich nehmen. Komm nie wieder in mein Haus.«
Er verstummte, und sie hörte den Regen prasseln, hörte ihren kleinen Jungen oben nach ihr weinen. Ihr Mädchen schlief wohl, ahnte nichts von Gefahr. Mit Mühe rappelte sie sich auf die Knie. Seit Tagen hatte sie den Boden nicht gefegt, und jetzt hing all der Dreck in ihren Röcken. Sie sah auf das Gesicht ihres Mannes: Es war starr, und das Haar hing ihm in die Stirn.
Ich hab dich so lieb, mein Amselhahn. Ich bin das schlechteste Weib in der Stadt, ich sollte mit dem Strohkranz gehen, aber als wir am Wasser der Äbtissin lagen, dein Pechkopf in meinem Schoß, hatten wir es nicht schön? Behalt mich doch bei dir. Greif doch dem Rad mit deinen Zauberhänden in die Speichen und dreh es noch einmal zurück.
»Pack dich.« Er trat an ihr vorbei und warf die Tür auf. »Geh.«
Sie stemmte sich hoch. Wind blies Nässe in die Stube. Die Röcke raffend rannte sie aus der Türe in den Regen, die Gasse hinunter, deren Boden durchweicht war. Bei jedem Schritt sanken ihre Füße ein, klebten im Schlamm. Wohin laufe ich denn?, fragte sie sich jäh. Zu ihm, zu meinem hübschen, fetten Schweinchen, die Küste entlang, und wie eine nasse Katze leg ich mich vor seine Tür?
Der Himmel hing tief. Solcher Sturm war ein Vorzeichen allen erdenklichen Übels: Die Ernte mochte leiden, die Steuer steigen, ein Schiff sinken oder die Welt untergehen. Auf der gepflasterten Hauptstraße zauste Wind die Budendächer. Jeden Donnerstag war Wochenmarkt, doch Anger und Gasse waren menschenleer. Die Händler waren vor dem Unwetter unters Dach der Metzgerhalle geflüchtet. Da war niemand, der die Frau erspähen konnte, ohne Gebende, im schlammbespritzten Kleid. Kein fauler Apfel, der ihr auf dem Hintern zerplatzte, kein Hohn, der brannte: »Seht, da rennt sie, die schöne Hoch-das-Haupt, gebt ihr was auf den Weg, der Ehebrecherin!« Sie lief schneller, ließ die Marktstraße hinter sich.
Und dann roch sie das Meer. Immer roch man es, sobald man aus dem Gefängnis enger Gassen brach, und hörte seine Stimme, selbst wenn Stürme lärmten wie heute. Noch ein paar verstreute Häuser, ein Gehöft, ein Lager, dann erstreckte sich vor ihr nichts mehr als die Salzwiese und dahinter, vom Guss gepeitscht, das Grau der Meerenge, die den Namen Solent trug. Die Insel, die sonst Wellen von Wolken trennte, schien vom Meer verschluckt.
Wohin sollte sie gehen? Bis in die größere Stadt, wo ihr Geliebter sein Haus hatte, wäre sie bei diesem Wetter die ganze Nacht unterwegs. Auf einmal fühlte sie sich so schwach, dass sie keinen Fuß mehr aus den Fängen der Nässe bekam. Wie eine der Wellen stürzte das, was ihr geschehen war, über ihr zusammen. Sie ließ sich fallen, fing sich auf Händen und Knien im Schlick. Er hatte sich an ihr ergötzt, ihr Buhle, aber würde er sie jetzt noch einlassen, eine Verstoßene, ihr hübsches Hurenhaar wie Werg verfilzt, das teure Kleid in Fetzen? An ihrer Hand sah sie den Hochzeitsring, den roten Jasper, der für Schirm und Schutz stand, dreckverschmiert. Tränen rannen wie Regen. Welchen Mann gelüstete es nach einer Geliebten, die um einen anderen weinte?
Ich muss es versuchen, sagte sie sich. Mir bleibt keine Wahl, in der Nacht kommt die Springflut. Weil ihr Regen und Wind ins Gesicht trieben, drehte sie sich um. Kehrte dem Sturm den Rücken. So sah sie das Nest von Häusern, das steile Dach des Hauptgebäudes, den kurzen Glockenturm und die würfelförmigen Wohnstätten, die sich darum duckten. Die einzigen ganz in Stein errichteten Bauten, die zur Stadt gehörten. Wiewohl sie Gott gehörten, nicht der Stadt. Domus Dei hieß das Hospiz, Haus Gottes, so hatte ihr Mann es sie gelehrt. Mildtätige Brüder und Schwestern lebten dort und boten denen, die keines hatten, ein Dach. Es stand länger hier als jedes andere Haus.
Eine Regenwehe traf ihren Rücken. Nur ein, zwei Herzschläge noch, um Kräfte zu sammeln, dann stünde sie auf und ginge ihren Weg. Nicht zu dem andern. Zu den barmherzigen Brüdern und Schwestern ginge sie und bäte dort um ein Dach. Der helle Stein der aneinandergeschmiegten Gebäude schimmerte durchs Grau. So klug bist du, mein Amselhahn, und so dumm zugleich, dachte sie. Hast du nicht gewusst, dass ich zu dem andern nie wollte, sondern zu dir, dass ich mir nur nicht helfen, dich nicht zu mir zwingen konnte, mit deinem Kopf in den Sternen, hundert Jahre voraus?
Als sie den Kopf in den Regen hob, um aufzustehen, sah sie den Reiter. Vom Domus Dei kam er, auf einem Apfelschimmel, dem Schlamm an die Flanken spritzte. Bald erkannte sie ihn. In der Stadt wurde über jenen Herrn geredet, ein Verwandter des Königs sollte er sein und auf des Königs Gut King’s Green leben. Die Frau war sicher, er hatte sie auch gesehen. Rasch senkte sie den Blick ins Erdbraun, das zwischen welkem Strandflieder Blasen warf und Priele bildete. Mit einem Platschen sprang er vom Pferd. Leiseres Platschen begleitete jeden Schritt, mit dem er näher kam. Sie umklammerte ihre Knie und duckte den Kopf ins Nest der Arme.
Mit seinem Stock stach er ihr in den Nacken. »Hoch, hoch das Frätzchen, dass ich’s ansehen kann. Mein Herz will ein verlauster Affe sein, wenn das nicht Mühlen-Gregs schöne Tochter ist.«
Ihr Leib begann zu zittern, als gehöre er nicht ihr. Sie zwang sich, den Kopf aus den Armen zu recken, bis sie ein Paar Waden in besudelten Beinlingen sah. »Einlass begehr ich«, stieß sie heraus. »Ins Haus Gottes.«
»Aber ja doch.« Der Herr lachte. Kurz streifte ihr Blick sein Gesicht, sein Haar, dessen Farbe auffiel. »Zu den keuschen Schwestern willst du. Aber du warst nicht keusch, habe ich recht, Müllerstochter?«
Sie wollte aufspringen. Sich zur Seite rollen und fliehen, zu den Häusern zurück, an verschlossene Türen hämmern. Aber es war ja zu spät. Er beugte sich über sie. Als sie sich rührte, griff seine Hand in ihr Haar.
*
In der Woche vor Erntedank rief der Bürgermeister den Mann zu sich. Der Mann ging durch die Stadt zum Gildehaus, wo der Rat tagte, und auf dem Weg schlug ihm das Herz. Er war sicher zu wissen, was ihm der Bürgermeister zu sagen hatte, und zugleich sicher, dass er es nicht hören wollte. Der Bürgermeister, der Walter Deghere hieß, empfing ihn in der Schreibstube. Der Mann nahm seine Kappe ab und hielt sie in der Hand.
»Setz dich«, sagte Walter Deghere, dessen Familie seit Jahr und Tag den Ältesten der Gilde und nunmehr auch den Bürgermeister stellte. Er sprach erst weiter, als der Mann seiner Anordnung nachgekommen war. »Du weißt, was ich von dir halte. Wie ich bei deinem Vater um dich gerungen habe, einerlei, was später geschah. Ohne Ende geredet habe ich: Schick deinen Jungen in die Lateinschule, in dem steckt mehr als in uns beiden zusammen. Glaub mir, mich kommt diese Unterredung hart an. Man hat deine Frau gefunden. Auf der Salzwiese, hundert Schritte weit vom Domus Dei.«
»Tot?«, fragte der Mann, obgleich er daran keinen Zweifel hegte.
»Totgemacht«, sagte Deghere. »Um den ranken Hals ihr Gürtelband. Hör mir zu. Jeder in der Stadt weiß, was sie dir angetan hat, jeder wird verstehen, wenn du dich an ihr vergriffen hast. Aber du musst es mir sagen, ehe morgen der Sheriff aus Southampton kommt. Ihr hätte ja harte Strafe gebührt. Wolltest du ihr die selbst erteilen, hast zu derb zugefasst, und auf einmal war sie tot?«
Der Mann sagte nichts. Rührte sich nicht.
Deghere sah ihn lange an, bis ihm die Augen brannten. »Nun gut. Wirst du sie begraben?«
Der Mann saß starr, hielt die Fäuste auf den Schenkeln, schwieg.
»Begrab sie, denk an deine Kinder. Ich lege mein Wort bei Vater Stephen ein, dass die arme Verlorene in geweihter Erde ruhen darf.«
»Wo ist sie jetzt?«
»Im Domus. Der Bruder, der sie fand, hat sich erbarmt.«
Der Mann stand auf. »Ich sorge dafür, dass sie begraben wird«, versprach er und wandte sich zum Gehen.
Deghere hielt ihn nicht zurück. »Eines Tages«, rief er ihm hinterher, »wird das Leben dich lehren, wer deine Freunde sind. Für dich bete ich, dass du dann noch welche hast.«
Anderntags ging der Mann auf den Markt. Lieber hätte er keinem Menschen ins Gesicht gesehen, aber er brauchte Eisenwaren, sonst käme er mit seiner Arbeit nicht voran. Die Arbeit war alles, beschwor er sich. Um der Arbeit willen ging er zwischen den Ständen entlang wie mit der Schandmaske, die Blicke der Vorbeistreifenden scharf wie Trossenhiebe, das Hemd klebrig am Rücken, das Gewisper ein Gellen in den Ohren. Am Karren des Eisenhändlers erstand er Zwecken und Nieten. Dann kehrte er um und ging zurück durch die Gasse, bis ihm der andere den Weg verstellte. Der, den sie geliebt hatte, mit dem sie hatte gehen wollen. Er hatte nichts anderes erwartet.
Der andere war nicht größer als er, aber massiger und breiter. »Du Tier«, sagte er. »Du hast sie umgebracht.«
Der Mann wich nicht aus, sah nicht weg, sprach kein Wort. Der andere zog die Peitsche aus dem Gurt und schlug ihm übers Gesicht. »Mörder.« Dann spuckte er. »Mörder.«
1. Teil: Die Stadt im Meer
Southampton, Hampshire, April 1336
Manche würden heute sterben. Andere würden einen Sohn gebären. Manche lichteten heute Anker, andere legten an, manche wurden krank und andere genasen. Für wieder andere wäre dieser ein Tag unter vielen. Aber für sie, für Dorothy Loyes, würde es der Tag ihrer Hochzeit sein.
Vom Hof drang Geblöke bis in die Kammer unterm Dach. Dorothy stieß den Laden der Fensterluke auf, sodass weißes Aprillicht in den Raum floss, rief einen Namen und winkte. Ihr Bruder, der im morgenkurzen Schatten der Apfelbäume stand und das zappelnde Lamm auf die Bank niederdrückte, ließ das Hackbeil fallen. Mit der freien Hand zog er die Mütze. »Gott zum Gruß, Dottie Nussholzhaar.« Als das Tier, das an allen vieren um sein Leben strampelte, ihn mit einem kleinen Huf am Arm traf, lachte er und verstärkte seinen Griff. Sein Haar war so nussholzbraun wie ihres, und sein Lachen steckte an.
»Gott zum Gruß, Clement. Beeil dich, meine Brautjungfern sind schon auf der Treppe, ich höre Isemays Gekicher.«
»Dann eil dich selbst.« Der Bruder lachte wieder. Bückte sich, ohne den Bauch des Lamms freizugeben, nahm das Beil, schwang es aus und durchtrennte dem Tier mit einem Hieb Kehle und Genick. Der gelockte Kopf fiel zu Boden, noch einmal zuckten die Läufe, um nach dem Tod zu treten wie zuvor nach Clements Arm, doch dann knickten sie wie Hölzchen um und fügten sich.
Flugs ging Clement in die Hocke, griff sich Messer und Schale und öffnete dem Tier mit zwei Schnitten die Brust. Er verstand sich darauf, war schließlich Knochenhauer wie sein Vater vor ihm. In das Blut, das er in der Schale fing, würde die Mutter Milch und Talg, zerhackte Zwiebeln und Hafermehl rühren, bis die Mischung sich zu dem köstlichen schwarzen Pudding verdickte, den Dorothy jeder Honigspeise vorzog.
Ihr Bruder wartete, bis das Tier ausgeblutet war. Dann band er ihm die Hinterläufe auf den Tragbaum und zog es zum Abhängen an der Schuppenwand hoch. Dabei sang er:
Bei Tage dreschen wir die Garben. Und bei Nacht legen wir die Netze aus. Wir sind die Männer vom Solent, aus hartem Holz geschnitten, Und wenn es in den Krieg geht, gegen den Franzosen, Dann stehen wir an uns’res Königs Seite.
Dorothy liebte seine Stimme, die bebte vor Lebenslust. Aus dem Leib des aufgehängten Lamms fischte Clement blutwarme Kaldaunen. Wenn es fertig ausgenommen war, würde er es seinem Maultier über den Rücken werfen und als Gabe der Brautfamilie nach Portsmouth bringen. Erregung packte sie. Ihr Tag war gekommen, das Warten hatte ein Ende. Über Brücken und Furten ginge ihr Hochzeitszug, denn Portsmouth war anders als andere Städte: nicht ganz Festland, nicht ganz Insel. Die ins Meer gebaute Stadt.
Auf einmal hielt Clement inne, unterbrach sein Lied und sah wortlos zu ihr auf. Dorothy war, als stehe das Bild still und präge sich ihr ein: ihr Bruder bei der Schlachtbank, unter den Apfelbäumen, in deren Geäst sie als Kinder ein Tau geknotet hatten, um daran zu schwingen. ›In den Himmel, Clement‹, hatte sie gerufen, ›schau, ich schwinge in den Himmel!‹ Von morgen an würde sie auf einen anderen Hof hinausschauen, aber dieses Bild vom Hof ihres Vaterhauses verschloss sie in der Brust, um es mitzunehmen in ihr neues Leben, das sie mit so viel Spannung erwartete.
Die Tür flog hinter ihr auf. Dorothy wirbelte herum, und die Mädchen stürmten in die Kammer, die sieben Basen und Lettice, die ledige Tochter des Nachbarn, die sie dazugebeten hatte, weil die Zahl Sieben als böses Omen für eine Hochzeit galt. Ebenso verhieß es Übel, sich im Mai zu vermählen. Wer zur Jahreszeit der Lust den Bund schloss, bekam einen lüsternen Wüstling zum Mann. Im April hingegen drohte keine Gefahr. Sie, Dorothy Loyes, war stolz auf ihre Besonnenheit und ließ sich auf Gefahren nicht ein.
Isemay, mit ihren dreizehn Jahren die jüngste der Basen, lief quer durch die Kammer und warf sich ihr in die Arme. »Du gehst wirklich fort, nicht wahr, Dottie? Nichts und niemand hält dich bei uns?«
Die Base war so schmal und leicht, noch wie ein Kind. Dorothy küsste sie auf den von gelbem Geringel bedeckten Kopf. »Nichts, mein Vöglein. Ich bin siebzehn und mannbar, gerade recht. Und heiraten muss jede von uns.«
»Das freilich schon, aber nicht jede von uns zieht fort aus unserer Stadt. O Dottie, warum gehst du nur nach Portsmouth, das ist scheußlich weit weg. So nett, wie du bist, hättest du doch auch bei uns einen guten Mann gefunden.«
»Wer den besten haben kann, lässt alle guten stehen«, bemerkte Lettice, ein ungeschlachtes Geschöpf, das die zwanzig überschritten hatte und das die Basen unter sich das schale Ale nannten. Sie hatte recht, befand Dorothy. Ihr Bräutigam, an den sie kaum denken konnte, weil ihr sonst das Herz davonjagte, war der beste von allen – ausgenommen Clement, den sie schließlich nicht heiraten konnte. Symond Fletcher hatte sich für sie entschieden. Dabei hatte sie als Tochter einer Witwe nur eine spärliche Mitgift zu bieten; zudem war sie zwar keineswegs hässlich, doch auch keine berückende Schönheit, nach der die Burschen sich die Hälse verdrehten. Dorothy besaß andere Reize: einen hellen Kopf, einen Ruf ohne Makel und rege Hände, die aus weniger mehr machten. Und noch etwas, das sich schwer benennen ließ. Süße Schärfe, sagte ihr Bruder. Etwas zum Würzen, wenn die Tage bitter schmecken.
Isemay ließ den Kopf gegen Dorothys Brust sinken. »Dein Symond Honiglocke mag der beste Mann vom Solent sein, ich tät ihn trotzdem nicht nehmen, wenn ich den grausigen Schwiegervater dazubekäme.«
»Was ist gegen den alten Francis denn zu sagen?«, hielt ihre Schwester Martha dagegen.
»Der ist Symonds Großvater«, begehrte Isemay auf. »Ich spreche von dem Teufel Aimery, wenn ich an den freilich nur denke, kraust sich mir das Haar.«
»Dein Haar kraust sich, ob du dummes Zeug schwatzt oder nicht.« Martha zog die Schwester von Dorothy fort. »Hinter dem Gewäsch über Aimery Fletcher steckt nichts als Missgunst. Selbst unser Gildemeister lässt sich ein Schiff von ihm bauen, drüben in Portsmouth, nicht bei uns auf Berkhams Werft. Das schürt böses Blut.«
Das war gut gesagt. Unter den Schiffsbaumeistern fand Symonds Vater die Küste entlang nicht seinesgleichen, und das Gemunkel über faulen Zauber, das man hier und da hörte, entsprang gewiss nur der Bosheit von Neidern. Dennoch erfasste Dorothy ein Schauder. Auf einmal wurde ihr bewusst, dass sie im Hemd dastand und dass das offene Fenster Wind einließ. Sie wandte sich Martha zu. »Wir müssen uns beeilen.«
Gleich war die Missstimmung verflogen. Die Mädchen fassten nach ihr wie nach einem Geschenk, das es zu richten galt, und drängten sie auf die Bettstatt. Splitternackt wurde sie ausgezogen, ihre Haut gesalbt, Hals und Brust mit einer Essenz aus frühen Blüten betupft. Als machten die flinken Hände, die strichen und kneteten, aus dem Leib eines Kindes den Leib einer Frau. Jäh schloss Dorothy die Schenkel, derweil ihr klar wurde: Wenn wir uns das nächste Mal begegnen, teile ich ein Geheimnis, das mich von euch trennt.
Sie legten ihr die Unterkleider an, feines Leinen, kaum erschwinglich, doch für die Hochzeit seiner Schwester hatte Clement sich nicht lumpen lassen. Wenn das Geraschel und Gekicher der Mädchen abebbte, konnte sie ihn vom Hof her noch immer sein Lied singen hören. Die plumpe Lettice war ans Fenster getreten und sah hinunter, wobei ihr gewiss die Sehnsucht aus den Augen quoll. Das schale Ale war beileibe nicht die Einzige, die für Clement schwärmte. Der jedoch träumte vom Kriegsruhm, nicht vom Ehestand. Die, die ihn einmal bekam, würde an ihrem Hochzeitstag so stolz und selig sein wie heute Dorothy.
Übers Untergewand streifte Martha ihr die Kotte, in deren Hüftteil Dorothy Keile eingesetzt hatte, damit der Rock sich bauschte. Bewundernd strich die Base ihr über die Hüfte. »Du verstehst, was den Männern den Mund wässrig macht. Dabei täte bei dir solch ein Kniff nicht einmal not.« Ich weiß, dachte Dorothy. Aber ich nähe lieber dreifach als doppelt, ich will sichergehen.
Und dann halfen ihr die Basen auf die Füße und trugen von der Truhe das Brautkleid herbei. Wolltuch, mit Waid in jenem Blau gefärbt, das für Sittsamkeit stand, doch vorn, wo der Fürspan es verschloss, tief ausgeschnitten und an den Ärmeln gerafft. »Dein Symond hat ja Geschmack«, rief Isemay und schlug die Hand vor den Mund. »Nie im Leben habe ich ein so hinreißendes Kleid gesehen.«
»Erzähl uns, Ise, für das Kleid nähmst du glatt den bösen Schwiegervater mit.«
Niemand lachte, alle berochen und befingerten das Kleid. Dorothy, die kaum hatte abwarten können, es zu tragen, fühlte sich jetzt, da es ihr umgeschnürt wurde, seltsam beklommen und steif. Als gehöre das Kleid nicht ihr, als sei die ganze Hochzeit nicht um ihretwillen ausgerichtet. Was für ein Unsinn! Seit August, seit dem Jahrmarkt von Portsmouth, hatte Symond um sie geworben. Er war verrückt nach ihr wie sie nach ihm, und eine andere gab es nicht für ihn.
Spangen schlossen sich, und das Haar, das nur noch einmal vor aller Augen über ihre Schultern fallen durfte, wurde zu schimmernden Wellen gekämmt.
»Zupft es mir vorn kräftig aus, damit meine Stirn nicht so niedrig wirkt«, befahl Dorothy. Sie wollte ihm gefallen – die Augen sollten ihm übergehen! Zuletzt wand ihr Martha das Strumpfband. Heute Abend, vor dem Einzug ins Brautgemach, würde jede Jungfer versuchen, es ihr abzureißen, denn wer das Strumpfband einer Braut ergatterte, fand als Nächste einen Bräutigam. Martha war eben fertig, da ließ Gepolter die Dielen beben.
»Sie sind da, die Männer aus Portsmouth sind da!«
Die Männer aus der ins Meer gebauten Stadt. Von morgen an meine Heimat. Dem Brauch gemäß musste Symond als Ortsfremder alle ledigen Männer der Nachbarschaft zum Umtrunk laden, weil er ihnen ein heiratsfähiges Mädchen raubte. Einen Herzschlag lang, derweil eine Base ihr Karminpaste auf die Lippen rieb, schloss Dorothy die Augen und hörte dem Lärmen zu wie einem Lied.
Was würde ihr von dem Tag im Gedächtnis bleiben, von dem einen, dessen Königin sie war? Was war das Schönste, der rahmsüße Kern der Pastete? War es nicht der Augenblick, als sie in ihrem herrlichen Kleid auf die Treppe trat und unten in der Stube, in der Horde lärmender Männer, den blonden Schopf ihres Verlobten entdeckte? Symond Fletcher. Er trug einen pflaumenblauen, auf der Brust gepolsterten Surcot, geschmückt mit Tasseln und Schellen, der knapp bis auf die Schenkel fiel. Sie waren gleich alt, er schlank und sie füllig, und ihre Größen passten zueinander. Sie würden sein, was man ein schönes Paar nannte, ein glückliches Paar, das seinem Brautzug voran in ein ordentliches Leben ging. Ihre Mutter hatte ihr stets geraten: ›Sorge vor, bette dich, wie du liegen magst‹, und das hatte Dorothy getan.
Ihr Symond würde ihr alles bieten können. Sicherheit, Wohlstand und ein Ungreifbares darüber hinaus, das sie ersehnte, wiewohl ihr die Worte dafür fehlten: Sie nannte es »etwas mehr«. Solange sie denken konnte, hatte sie darauf gewartet, dass sie dieses Etwas zu fassen bekäme. Und jetzt hielt sie es doch in den Händen, oder nicht? Während sie Symond betrachtete, drehte er den Kopf nach ihr, und sie verliebte sich noch einmal in ihn. Er hatte Züge wie einer von Adel, seine Haut war weiß und seine Augen grau. Mit diesen Himmelsaugen sah er sie an, und sie hätte allen Brauch vergessen und sich hinunter, in seine Arme stürzen wollen. Ja, die kurze Zeit auf der Treppe, als alles begann, war der süßeste Teil des Tages. Wie hätte irgendetwas, das danach kam, sich mit diesem Anfang messen können?
Die Männer zogen los, um zu trinken, die Frauen luden die Mitgift auf Karren: eine Kupferpfanne, eine Abtropfpfanne, zwei Truhen voll Leinenzeug, ein schöner, dreibeiniger Zinntopf und eine trächtige Sau. Dazu ihr Rosenkranz aus Tonperlen. Dorothy war kein reiches Mädchen, aber der Bruder gab ihr, was er aufbringen konnte: »Die sollen drüben wissen, Dottie Nussholzhaar stammt aus keinem schlechten Haus.« Zwei lebende Gänse in einem Korb schleppte er noch herbei, die waren als Geschenk für den Priester gedacht.
Als das Mannsvolk aus dem Alehaus zurückkam, fanden die Versammelten sich in der Stube zum Kreis. Erst trat Clement vor, um die Posten der Mitgift aufzuzählen, dann der graubärtige Francis Fletcher, der das vom Bräutigam gestellte Wittum offenlegte. Diese Aufgabe wäre Symonds Vater zugekommen, aber gewiss bedauerte niemand, dass der Sonderling sich nicht blicken ließ. Der Bräutigam gab seiner Braut die Hälfte einer zerbrochenen Silbermünze, und damit wurden Symond Fletcher und Dorothy Loyes zu Mann und Frau.
Warum fühlte es sich noch so unwirklich an? Warum sah Symond ihr nicht in die Augen, sondern trat gleich wieder beiseite und verschwand hinter seinen Kumpanen? Sie wollte sich all dies nicht fragen, es würde sich schon finden, würde so und nicht anders seine Richtigkeit haben. Später am Tage würde ihr Bund vom Priester eingesegnet. Francis Fletcher hatte darauf bestanden, dass das in Portsmouth geschah: »Unsere Stadt mag kleiner sein als eure, aber sie ist eine Stadt aus eigenem Recht und besitzt ihre eigene Kirche.«
In Wahrheit betrachteten die aus Southampton Portsmouth als Teil ihrer Vorstadt und beharrten auf der Zollhoheit über ihren Hafen. Immer wieder kam es darüber zu Streit, aber Dorothy war das von Herzen gleichgültig. Portsmouth war die ins Meer gebaute Stadt, ein stürmischer Geist herrschte dort, und eines Tages würde die kleine Schwester die behäbige Große überflügeln. Und wer trieb einen solchen Höhenflug voran, wenn nicht die Schiffsbaumeister, die dem König schwimmende Schlachtfelder bauten? Der König gierte nach Krieg, sagte Clement. Er würde Schiffe brauchen, wie die Fletchers sie bauten.
»Lebt wohl, reizende Dottie, Tochter dieser Stadt!« Der Mann in der Haustür zog ehrerbietig die Kappe und entblößte volle, ingwerrote Locken. Gilbert Berkham, Schiffsbaumeister und Handelsherr in einem. Er musste an die vierzig Jahre alt sein, aber so sah er nicht aus. Er nährte sich redlich, sein Gesicht war glatt wie ein frisch gepflückter Apfel. Ein Mann, dem die Frauen zugetan waren und der vielleicht ebendeshalb noch unvermählt war. Es gab Gerüchte, auch er habe sich um Dorothy beworben, aber ob die der Wahrheit entsprachen, behielt Clement für sich.
Ich hätte ohnehin keinen anderen als Symond gewollt, trumpfte Dorothy im Stillen auf. Sie nickte Berkham flüchtig zu und ließ sich von ihrem Bräutigam ins Freie geleiten, in die Aprilsonne, die inzwischen hoch am blassen Himmel stand. Vom Meer herauf wehte ein scharfer Wind. Im Hof stand ein Pferd angepflockt, schon betagt, sodass es seine Reiterin nicht abwerfen würde, aber goldbraun und hochbeinig, ein Ross für eine Braut. Symond hätte sie in den Sattel heben sollen, er trat auf den Steigklotz, aber als er Dorothy vom Boden hob, geriet er ins Schwanken und ließ sie unter Ächzen wieder fallen. Sie hatte kaum begriffen, wie ihr geschah, da war schon ein anderer zur Stelle. Gilbert Berkham fing sie, schob Symond vom Klotz und stemmte dessen Braut auf den Pferderücken. Das Tier setzte sich in Schritt, und Dorothy verspürte noch immer den festen Griff um ihre Leibesmitte.
In langer Reihe – Pferde, Maultiere, Karren – zog die Gesellschaft an den Deichen des Southampton Water entlang, sodann quer über Land, durch den breit gerodeten Weg des Waldgürtels und dann wieder hinaus auf freies, flaches Feld. Man roch das Meer, ehe man es sah, doch irgendwann blitzte es mit der Sonne auf wie in tausend Splitter geteilt. Bei Ebbe zockelten sie durch die Furt vor Sudewede, dass Hufe und Räder das seichte Wasser zum Spritzen brachten. Das Siechenhaus und die schäbigen Hütten im Sumpfland sah Dorothy nicht an. Erst dahinter, im Trockenen, begann die wahre Stadt: Vor den niedrigen Häusern scharten sich Menschen, die warfen Blumen nach dem Brautzug. »Gute Leute, kommt alle«, rief Clement von seinem Schecken herunter. »Kommt alle zum Fest.«
Gefeiert wurde auf der Gasse des heiligen Thomas, vor dem Haus, das höher als die übrigen war und das von jetzt an das ihre sein würde. Musikanten spielten mit Citern und Viole auf, ein Jongleur warf Bälle, auf denen Gesichter prangten, und fiel einer zu Boden, so rief er: »Oh, oh, da ist wieder ein Kopf zerplatzt.«
Dorothy sah alledem zu, und es kam ihr vor, als verfliege es, als könne sie nichts davon festhalten, sodass es vorbei wäre, ehe sie sich fragen konnte: Gefällt es mir? Ist es so, wie ich es mir ausgemalt habe, tage- und nächtelang? Ihre Basen ließen indessen keinen Tanz aus, und die Tafel war aufs Üppigste gedeckt. Francis Fletcher, der als Geizhals verschrien war, hatte aufgetischt wie ein Verschwender. Schwein am Spieß gab es, Huhn und Wachtelpastete, Weißfisch in Tunke, dicke Bohnen und Pfeffergurken, Salat aus Schnittlauch, Zwiebeln und Nüssen. Gelbe Butter, in Bier gebackenes Brot, mehlige Äpfel, seit dem Herbst gespart, und all die runden, nach Nelken duftenden Kuchen, die die Gäste mitbrachten und die zu einem Turm gestapelt wurden. Aus Krügen wurde Ale ausgeschenkt, aus Fässern Apfelwein und Roter aus Bayonne, den Dorothy nie zuvor getrunken hatte. Er stieg ihr zu Kopf, ließ all das Bunte, Wirre um sie schwanken. Ein Trupp Gäste, wie ein Hühnerhaufen kreischend, spielte Blindekuh. Burschen warfen Kegel, Verliebte herzten einander, es wurde auf Schultern geklopft und in Hintern gekniffen, und Dorothy, die Braut, stand inmitten der Wogen wie der Anker, an dem sich alles vertäute, auf den aber kein Mensch achtgab.
Ich bin fremd, sprang es sie an. Ihr Bräutigam war ihr nach dem Brauttanz abhanden gekommen, und ihren Bruder hatte sie seit der Ankunft nicht gesehen. Jetzt erblickte sie ihn: Er tanzte mit einer Jungfer im moosgrünen Kleid, dass Haar und Röcke flogen. Als die Spielleute die Instrumente absetzten, versuchten ein paar Kumpane, Clement in ihren Kreis zu locken: »He, alter Kampfhahn, lass dir Guy vorstellen, der war beim Halidon Hill gegen Schottland dabei.«
Clement aber, der sonst keinem Kriegsgerede widerstehen konnte, ließ die Gefährten links liegen, führte seine Tänzerin an einen Tisch und zapfte Wein für sie. Jemand pfiff, als die beiden vorübergingen. Die Haarpracht des Mädchens fächerte sich schimmernd in ihrem Rücken auf. Solches Haar hatte Dorothy bisher nur einmal gesehen. Die Blonde musste Symonds Schwester sein, die sie sogar noch in Southampton die schöne Agnes nannten.
Neben Dorothy trat eine Frau, die roch, als habe sie soeben Teig zu Brot geknetet. So sah sie auch aus, die Wangen backstubenrot. Sie legte ihr die Hand auf den Arm. »Fühlst du dich einsam? Das gibt sich, Herzlein. Du wirst es gut bei den Fletchers haben, lass dir nicht Bange machen. Ein Segen, dass endlich eine Frau ins Haus kommt, die Ordnung schafft und ein Auge auf die arme Agnes hat.« Über das Brotgesicht kroch ein Schmunzeln. »Matilda heiß ich, bin das Weib des Gildeältesten. Komm Kuchen austeilen, dein Augenschmaus von Bräutigam wartet schon.«
Symond stand vor dem Turm aus Gebäck und hob ein Messer, das sie mit verflochtenen Händen fassen und durch die Kuchen ziehen mussten. Als seine Hand die ihre packte, durchjagte Dorothy, die eben noch gefroren hatte, ein Schwall Wärme. »Süßes für alle!«, schrie irgendeiner unter den Gästen. »Anis und Honig stärken Manneskraft und Weibeslust!«
Im nächsten Augenblick bezog der Himmel sich schwarz, wie es am Meer so oft geschah, ein Windstoß riss Tafelleinen in die Höhe, wirbelte Hüte von Köpfen, und gleich darauf fiel Regen. Als hätte Gott einen Vorhang vor ihren Tag gezogen. Die Gäste schnappten sich, was sie tragen konnten, und drängten ins Haus.
Nach der fahlen Sonne war es drinnen düster. Dorothy war nie zuvor in dem Haus gewesen. Es war gut zweimal so groß wie ihr Vaterhaus, der Wohnraum weit und kahl. Matilda half der Magd, tappte behäbig umher und entzündete Wandfackeln, und mit dem Licht schälten sich Konturen aus dem Grau. Auf der Treppe stand ein Mann in dunkler Kleidung, erschrocken wie ein Verbrecher. So laut, wie es auf der Gasse gewesen war, so still war es jetzt. Bis einer rief: »Aimery!«
In langen Schritten floh der Mann durch den Raum und verließ das Haus.
Was tut ein Mädchen, wenn es ins Brautbett geführt wird, was erwartet ihr Bräutigam? Nacht um Nacht hatte Dorothy über der Frage wach gelegen, aber das Bild hatte in ihrem Kopf keine Farbe angenommen. Und als es schließlich kein Bild mehr war, sondern sie leibhaftig, ohne ihr Strumpfband, das Isemay ergattert hatte, auf dem duftend bereiteten Bett saß, sagte sie: »Der Wein hat mir sehr geschmeckt«, und glaubte selbst nicht, dass sie solch belanglosen Unsinn redete.
»Den sauf denn nur«, antwortete Symond. »Soll ja schwarze Galle vertreiben, die Weiber bei Laune halten und der Vermehrung helfen. Der Großvater hat zwei Schiffsladungen davon gekauft.«
»Für uns zum Trinken?«
»Wo denkst du hin? Freiwillig gibt der ja keinen Tropfen raus, aber Agnes zapft uns unser Teil, wenn er schläft.«
»Warum hat er ihn überhaupt gekauft?«
»Er will ihn zum Jahrmarkt verscherbeln, wenn die Preise steigen. Doch was kümmert das uns?«
Als er zu ihr kam, hatte er seinen schönen Surcot und sein Hemd zu Boden geworfen. Auf seiner Haut tanzten Lichter von der Kerze, seine Weiße und Weichheit überraschten sie. Auch sein Geruch war anders als erträumt. Saurer, fand Dorothy. »Symond, warum handelt dein Großvater mit Wein? Ihr baut doch Schiffe.«
»Mein Vater baut Schiffe.« Er griff nach ihr. »Und mein Großvater schimpft ihn einen Nichtsnutz. Er sagt, wer zu was kommen will, verlegt sich aufs Handeln. Solange ich denken kann, hab ich ja deren Gezänk im Ohr.« Er schälte ihr das Kleid von den Schultern, sah nicht hin, sondern ließ sich auf sie sacken.
Aber sie war stärker als er. Heftig, ohne innezuhalten oder zu überlegen, schob sie ihn von sich. »Dein Vater mag mich nicht.« Dass Aimery Fletcher der Trauung ferngeblieben war, kam einer Beleidigung gleich, und seine Flucht aus dem Haus schlug dem Fass den Boden aus. Dorothy rückte von Symond ab und setzte sich auf. »Warum hat er der Heirat zugestimmt, wenn ich ihm so zuwider bin?«
Seufzend hob Symond den Kopf. »Das hat ja mein Großvater getan. Um meinem Vater eins auszuwischen, denk ich, weil mein Vater hoffte, ich würde eine mit mehr Geld heimführen.«
»Weshalb?«
»Weil er ja Geld braucht für das, was er treibt. Jetzt gib doch Ruhe. Was gehen denn mich die zwei verbohrten Streithähne an?«
Mich gehen sie an, wollte Dorothy rufen, während ihr Gemahl sie einhändig niederstieß. Ich werde unter einem Dach mit ihnen hausen, mit einem Schwiegervater, der mich hasst, und einem Großvater, der mich zum Zankapfel macht. Sie hatte von diesem Augenblick geträumt, von dem Honighaar, das über sein Gesicht fiel, von Liebesblicken und geflüsterten Worten. Jetzt aber wünschte sie sich, allein zu sein, daheim in Southampton, in ihrer Kammer unterm Dach. Noch lieber wollte sie mit Symond reden, doch der quetschte ihr die Zunge in den Mund, und Dorothy würgte. Gleich darauf ließen seine Hände ihre Schultern los, spreizten ihr die Beine, nestelten, zwängten. Es tat nicht weh. Im Grunde war es kaum der Rede wert, zumal die Arbeit zwischen ihren Beinen ihn vom Küssen abhielt. Vielleicht ist meine Mundhöhle zu klein, dachte sie. Und vielleicht stimmt noch anderes nicht mit mir, weil ich von Wein und Schiffen und Schwiegervätern rede, derweil mein Liebster mich nimmt. Vielleicht kann ich kein Kind empfangen? Im nächsten Atemzug besann sie sich und verwarf solch törichtes Zeug. Es gab einiges, was eine Frau für ihre Fruchtbarkeit tun konnte, und sie hatte nichts davon versäumt. Ihr Mann stieß noch zwei-, dreimal in sie, dann sackte er zusammen. Als er von ihr herunterplumpste, gab es ein furzendes Geräusch.
Ich werde es lernen, suchte sie sich zu beschwichtigen, ehe ihr Tränen kamen. Es gab noch andere Nächte, um ihren Mann zu umarmen, um etwas mehr aus dieser Sache zu machen, so wie sie es sich gewünscht hatte. Aber gab es die wirklich? Andere Nächte nach dieser einen, auf die sie all ihr Planen gerichtet hatte? Gurgelndes Schnarchen verriet, dass Symond eingeschlafen war. Dorothy tastete nach ihrem Rosenkranz, blies die Kerze aus und lag im Dunkeln wach. Manche würden morgen sterben und andere würden einen Sohn gebären, manche würden zu Eheweibern und andere zu Witwen. Für sie aber, für Dorothy Fletcher, würde der morgige Tag der erste von vielen sein.
*
Aimery hatte befürchtet, das Fest könnte tagelang währen. Es hätte ihm nichts ausgemacht, weitere Nächte auf der Werft zu verbringen, lieber trotzte er im offenen Verschlag einem Sturm als einer Horde berauschter Gäste im Haus. Aber aus Angst vor Wasserschäden bewahrte er Geräte im Schuppen des Anwesens auf, darunter den Wetzstein, den er dringend brauchte. Er hatte ihn in mühevoller Arbeit selbst behauen, um nicht von fahrenden Schleifern abhängig zu sein, die für liederliches Handwerk überhöhte Preise verlangten.
Als er vor Tagesanbruch in die Stadt zurückkehrte, war er froh, das Anwesen in völliger Stille zu finden. Die Stadträte warnten davor, im Dunkeln allein die Straßen zu durchstreifen. Aimery aber schreckte das nächtliche Portsmouth nicht, eine Stadt, die von Menschen erbaut war und dennoch in den finsteren Stunden der Natur gehörte. Dem Meer, dem dünnen Regen, den Ratten. Er schlich sich ins Haus, durchquerte den Wohnraum und die stinkende Küche und trat in den Hof.
Den schweren Wetzstein mit der Drehvorrichtung hatte er auf einem Becken befestigt, das wiederum mit Rädern ausgestattet war, sodass das Gerät sich ins Freie schieben ließ. Er lauschte dem Scharren, dann ging er zum Brunnen, schöpfte einen Eimer voll Wasser und füllte es ins Becken. Das Wasser, das eiskalt aus der Erde kam, würde den Stein während des Schleifens kühlen. Aimery tauchte die Hände hinein, genoss den kurzen Schmerz. Gleich darauf holte er sein Werkzeug aus dem Schuppen: die Schlagaxt, mit der er Planken hackte, das Beil mit der schmalen Schneide, das zum Begradigen der Schott taugte, die Keile und Messer, die wie angewachsen in der Hand lagen. Mit der Rechten führte er das Schleifgut über den Stein, mit der Linken drehte er die Kurbel und brachte das Gerät zum Surren. Am Geräusch und an den Funken, die ins Dämmerlicht stoben, maß er die Geschwindigkeit.
Sich beinahe lautlos zu bewegen, hatte er im Laufe der Jahre geübt. Für Menschen genügte es, nicht aber für die Hühner, die, auf Futter hoffend, aus der Klappe drängten und die Leiter hinunterhüpften. Drei Legehennen, mager und zerrupft, und der verschnittene Hahn. Wo war Hilda, die Magd, die das Vieh verpflegte? Das Gegacker würde das Haus aufwecken. Aimery hatte noch keine Klinge geschliffen, da stand sein Vater in der Tür.
»Etwas Besseres hast du nicht zu tun, nein?«
»Nein«, erwiderte Aimery und drehte den Stein, dass er zischte.
»Hör damit auf«, schrie sein Vater.
Aimery umklammerte den Griff des Messers. Im Augenwinkel sah er den Vater eine Faust ballen.
»Du Nichtsnutz. Gottesleugner.«
Aimery ließ den Stein ausrollen und zog die Klinge sachte über seine Fingerspitze. Als ein Tropfen Blutes austrat, legte er das Messer beiseite und hob ein anderes auf.
»Ich rede mit dir.«
»Das entginge auch einem Mann ohne Ohren nicht.«
»Was glaubst du, wer du bist? Rennst von der Hochzeit deines Sohnes fort und beschämst die Familie vor der Stadt.«
»Vor deinen Kunden, wolltest du sagen.«
»Und wenn schon«, brüllte sein Vater. »Von meinen Kunden nährt sich diese ganze missratene Sippe, dein Sohn, der schlaffe Schluck Wasser, deine Tochter, die durch die Gegend hurt, und du, dem nichts einfällt, als gutes Holz für Schiffe zu vergeuden, als könne ein Mann noch wie zu Urzeiten davon leben.«
»Zu Urzeiten war dieses Land eine Insel«, sagte Aimery und zog das Messer vom Wetzstein, um es nicht zu verderben. »Ich wüsste nicht, dass sich daran etwas geändert hat oder dass man den Wein, den du verschacherst, neuerdings mit Karren auf Inseln schafft.«
»Ich wollte, ich könnte dich und dein Drecksmaul noch einmal zu Gelump prügeln.«
»Warum tust du es nicht? Dann bist du fertig, und ich habe meinen Frieden.« Aimery glaubte, zu hören, wie der Vater mit den Zähnen knirschte. Sein Nacken schmerzte vor Anspannung, er vermochte kaum den Kopf zu drehen.
»Am Bösen zerbricht der Stock«, zischte der andere. »Ich weiß eine Strafe, die dich härter trifft.«
Aimery richtete sich auf.
Sein Vater verzog den Mund. »Bettle ruhig, das verschafft mir Vergnügen. Aber es nützt dir nichts. Von meinem Geld bekommst du für deine Windenknechte keinen Viertelpenny.«
»Es ist mein Geld ebenso wie deines.«
»Meinst du?«
Aimery sah auf die Klinge des Messers, um dessen Griff seine Hand sich krallte. »Ich arbeite dafür wie du. Du zwingst mich doch, um deine Kunden zu schwänzeln, ihnen zu schmeicheln und Zeug aufzuschwatzen, das sie im Leben und im Tod nicht brauchen.«
»Soll ich darüber lachen?« Der Vater zog die Lippen von den Schneidezähnen. »Als ob du dich zwingen ließest, als ob du zu schmeicheln verstündest! Und sag mir, Nichtsnutz, hast du wahrhaftig zum Schwänzeln einen Schwanz?«
Aimery grub die Zähne in die Lippen. Ließ das Messer fallen. »Sagst du nichts mehr?« Der Vater trat vor und schlug ihm über die Wange.
Aimery rührte sich nicht.
»Dann überlasse ich dich jetzt deinen Pflichten. Du wirst wohl zusehen müssen, wie du deinen Mast alleine auf den Schiffsrumpf hievst. Und als Nächstes erklärst du besser dem Töchterlein, dass es keine Bänder und Schühchen wie für eine Gräfin mehr gibt. Von meinem Geld ernährt sich schließlich jetzt auch noch Symonds bedauernswertes Weib, und so, wie die gebaut ist, hat sie gewiss schon nach der ersten Nacht ein Balg im Wanst.«
Kein Wort, fuhr Aimery sich an. Die Worte aber waren ihm längst entglitten wie sein Stolz. »Warum hast du Symond einer aus Southampton gegeben? Einer ohne Geld?«
Er bekam die Antwort, die er verdiente: »Symond, Freundchen? Du weißt also immerhin, wie das Kuckucksbalg heißt, das wir hätten ersäufen sollen, statt es aufzuziehen. Ja, und warum habe ich wohl den Symond der niedlichen Dottie Loyes gegeben? Weil die so ein saftiges Hinterteil hat und Kinder wie eine Karnickelzippe kriegen wird? Aber nicht doch. Weil sie kein Geld hat, habe ich ihn ihr gegeben! Nichts, was du für dein Hirngespinst verprassen kannst.«
Für mein Hirngespinst, wiederholte Aimery im Stillen. Für das Sehnen, von dem ich nicht lassen kann: den Traum, ein Schiff zu bauen, das uns überlebt.
Wieder entblößte der Vater die Vorderzähne, doch ein Geräusch ließ ihn innehalten. Vorn an der Tür zog jemand die Glockenschnur. »Das ist der Fuller, der Tuchwalker. Geh und verkauf ihm deine Pisse, vielleicht zahlt er so reichlich, dass es für einen Affen auf dem Schleifstein reicht!«
Aber es war nicht der Fuller, der allmorgendlich um den Inhalt der Nachtgeschirre bat, weil menschliche Notdurft Wollstoffe dicht und geschmeidig machte, sondern ein Handelsherr aus London, der Aimery sprechen wollte. Noch in der Tür kam er zur Sache: Er suchte einen Schiffsbaumeister, wünschte eine Kogge in Auftrag zu geben, einen tief im Wasser liegenden Hunderttonner mit zwei Wehrkastellen.
»Von Euch hört man allenthalben. Es heißt, Ihr zaubert Schiffe, von denen ein Heidengott geträumt hätte«, erklärte er sich. »Zahlt Ihr im Voraus?«, fragte Aimery.
»Das können wir halten, wie es Euch beliebt.«
Der Vater spuckte neben Aimery auf den Boden und verzog sich – seine Art, einzugestehen, dass er für diesmal verloren hatte. Gewiss wusste er, dass sein Sohn darüber keinerlei Triumph empfand.
*
Jeden Donnerstag war in Portsmouth Wochenmarkt, und einmal im Jahr, am Ende des Sommers, wurde Jahrmarkt gehalten. König Richard mit dem Löwenherzen hatte einst der ins Meer gebauten Siedlung das Marktrecht verliehen. Manch Händler aus Southampton mied den Markt von Portsmouth, weil er es als Schande ansah, dass solcher Flecken der ehrwürdigen Nachbarin Kunden rauben durfte. Für Gilbert Berkham aber war derlei ohne Belang. Als Gildemitglied war es ihm gestattet, neben seinem Handwerk Handel zu treiben, und er war entschlossen, diese Quelle auszuschöpfen. Zudem feierte an der ganzen Südküste keine Stadt so ausgelassen wie Portsmouth.
Fünfzehn Tage würde der Jahrmarkt währen. Im Morgendämmer sattelte Gilbert seinen Gaul, spannte das Maultier vor den Karren und machte sich mit seinem Lehrling Ronald auf den Weg. »Gottverdammt spät war es gestern«, brummte er dem Jungen, der das Maultier führte, zu.
»Gottverdammt sagt man nicht, Meister.«
Gilbert musste lachen, beugte sich vom Pferd und pfefferte dem Burschen eine Maulschelle. »Weißt du, was ich mit dir tue, wenn du mir wie der gottverdammte Priester kommst, he? Ich verschnüre dich und sende dich zu Aimery Fletcher.«
Der Junge blickte auf. »Wenn Ihr das doch nur tätet, Meister«, flüsterte er.
Die Antwort, die diese Bemerkung verdiente, verbiss sich Gilbert für diesmal. Der Tag war zu schön, um sich zu ärgern. Gemächlich zogen sie an der Anhöhe vorbei, auf der die Festung von Portchester thronte. Längst war die Sonne aus dem Wasser getaucht. Gilbert, zu Beginn des Jahrhunderts geboren, hatte Jahre des Hungers erlebt, ersoffene Erträge, leere Schober und ausgemergelte Dirnen. Nach diesem Sommer jedoch, der lichtreich und lang gewesen war, würden die Küstenstädte Grund zum Feiern haben. Er selbst durfte mehr als zufrieden sein, denn seine Geschäfte gingen glänzend. Aber er war nicht zufrieden. Ehe der finstere Gedanke aufkam, wies er mit der Peitsche geradeaus. »Siehst du das, Tölpel? Ist das kein Anblick für gequälte Augen?«
Die Stadt Portsmouth, die sich auf der inselgleichen Landzunge Portsea tollkühn ins Meer reckte, erhob ihre Dächer aus dem Morgenglast. Das Wasser war voll Frieden, schwappte schläfrig vor und zurück. Die Hafenanlagen, eine Zeile aus Brettern errichteter Gebäude, standen so nah an der Küste, dass eine sich bäumende Welle sie hätte küssen können. Aber hier in Portsmouth vertrauten sie auf Gott. Und sie wussten, dass sich die Häfen von Städten wie Southampton, die sich tiefer in Mündungen duckten, zur Sammlung einer Kriegsflotte weniger eigneten.
»Ich war hier einmal glücklich, weißt du das?«, entfuhr es Gilbert. »So etwas vergisst kein Menschenherz.«
Gehämmer von Zimmerleuten grüßte die Ankömmlinge. Wo die Hauptstraße begann, wurde eine dreimal mannshohe, hölzerne Hand aufgestellt, die den Besucher willkommen heißen sollte. Selbstredend würden hier wie überall Tuchhändler ihren Wollstoff strecken, dass er im Regen schrumpfte und der Käufer mit entblößtem Arsch dastand. Selbstredend würden auch hier Weiber beim Alebrauen am Malz sparen und Gewürzkrämer Pfeffer mit Sand auffüllen. Aber wer achtgab, kam auf seine Kosten.
Gilbert zügelte sein Pferd und labte sich an der Woge von Düften. Das Gewirr des Menschenlärms war Musik in seinen Ohren, und von dieser erquicklichen Musik würde es reichlich geben, wenn die Geschäfte des Tages getätigt waren. Die Gasse summte vor Schaffenslust. Buden wurden aufgeschlagen, grobe Tische gezimmert und Waren ausgelegt, derweil Kinder und Köter zwischen Beinen wimmelten, um zu stibitzen, was herunterfiel. Der Gehilfe des Barbierchirurgen spannte zwischen Pfosten einen Vorhang, um die zu zwickenden Kranken vor Blicken zu schirmen. Ein Bauchhändler, gehüllt in Fischgeruch, zog einen silbrigen Gründling aus dem Korb und brüllte. »So frisch, dass sie zappeln, meine Herren, wie Franzosenschwänzchen in englischer Brise.« Gelächter belohnte den Witzbold. Heuer zollte die Kundschaft jeder noch so faden Schmähung Frankreichs Beifall. »Es gibt Krieg«, hatte es gestern in der Schänke geheißen. »Frankreich wird unser, und der Wein fließt in Strömen, auf dass keiner mehr für ihn zu zahlen braucht.«
Am Stand des Pfeilschnitzers drängten sich Kauflustige, prüften mit flinken Fingern die Ware. Auch Aimery Fletchers Ahnen hatten einst Pfeile gefertigt, das verriet der Name. Warum zum Teufel waren sie nicht dabei geblieben? Gilbert spuckte auf den Boden. Er kaufte einen Satz Pappelholzpfeile mit geschmiedeten Vierkantspitzen. Als Städter im tauglichen Alter war er zur Übung mit dem Bogen verpflichtet. Offenbar war es dem König ernst mit seinen Plänen: Er hatte jüngst jede andere Leibesertüchtigung verboten und wünschte ein Mannsvolk kampfbereiter Bogenschützen. Nicht zu leugnen war, dass Edward Plantagenet von der Mutter her einen Anspruch auf den französischen Thron besaß, einen stärkeren als Philip von Valois, der gekrönt darauf saß. Ob aber ein Heer sich aufmachen würde, diesen Anspruch durchzusetzen, und vor allem, ob der Wein in Folge billig oder unbezahlbar würde, stand in fernen Sternen. Gilbert jedenfalls gedachte, sich mit dem roten Gascogne-Tropfen einzudecken.
Gebannt sah Ronald nach dem Anger, wo Stadtknechte im Schatten der Thomaskirche einen Dieb mit dem Ohr an den Pranger nagelten. Je lauter der Frevler zeterte, desto seliger johlte die Menge. »Grausam«, murmelte der Junge.
»Und was bitte soll man mit dem Langfinger tun, he? Vor ihm Kratzfüße vollführen?« Gilbert klatschte seinem Lehrling die Gerte aufs Gesäß und sprang vom Pferd. »Heute Abend darf er ja wählen, ob er sich das Ohr losrupft oder sich’s abschneiden lässt. Komm weiter, wir haben Geschäfte zu besorgen.«
Auf dem Karren hatte er eine Ladung dichtgewebter Wolle, die galt es zum Bestpreis zu verkaufen. Dabei nutzte er jede Gelegenheit zu einem Gespräch, denn es gab keinen besseren Ort als den Jahrmarkt, um den ersehnten Auftrag einzuheimsen: Hierher kamen Kaufleute wie Adelsherren, die einen Schiffsbaumeister suchten. Das Handwerk der Gegend rühmte sich alter Tradition, die Strände boten Platz für Werften, und was das Herz an Material begehrte, gelangte übers Meer. Allein, als hätte der Teufel seine Hand im Spiel, fand sich kein Auftraggeber. Gilbert gelang es nicht einmal, die gewünschte Menge Wein zu kaufen. Die Lage im Kanal sei heikel, hieß es, die Verschiffung stocke.
In einer Garküche bestellte er Starkbier und Schmorfleisch und fluchte sich seine Enttäuschung aus dem Bauch. »Gibt es in diesem gottverdammten Nest keinen Roten als den von Francis Fletcher? Wie macht so einer überhaupt Geschäfte, wenn er nicht einen Brocken Französisch versteht?«
»Das braucht Francis gar nicht.« Die Wirtin, bei der Gilbert gern einkehrte, weil sie dem Schmortopf kein Katzenfleisch beimischte, schob ihm den dampfenden Napf hin. »Er hat Aimery bei sich, der spricht Französisch und Latein, besser als Vater Stephen.«
Gilbert spuckte in seinen Bierkrug. »Hätte er den nicht bei sich, würde ich ihm seinen Rotwein abkaufen.«
Das Weib verpasste ihm, kaum dass er den Mund schloss, einen schmatzenden Kuss. »Die Fletchers haben dich nicht nötig, Süßmaul.«
»Scher dich zum Henker. Aimery muss einiges nötig haben, wenn er seinem Alten am Stand hilft. Hat der ihm das Geldsäckel zugeschnürt?«
»Aimery baut einem Londoner Händler eine Kogge«, beschied sie ihn. »Er ist ein mörderischer Satan, aber auf Schiffe versteht er sich. Sooft du herkommst, schwatzt du von Aimery, weißt du das? Wäre der ein Mädchen, würde ich meinen, du bist liebeskrank.«
Hasskrank bin ich, dachte Gilbert. Aimery, Pfeilmachers Bastard, baute eine Kogge, und er, der Erbe der Berkhams, hatte keinen Flusskahn im Auftragsbuch. Aimery, der schlimmer als ein Dieb war, entkam dem Pranger, und Gilbert, der Beraubte, lechzte ihm vergebens hinterdrein. Beim Verlassen der Garküche sah er ihn. Er kam die Gasse herunter, ausschreitend, als sei der Raum um ihn menschenleer. Gilbert spuckte. Sooft er hier stand, sah er den Kerl auf der Gasse, ob der nun tatsächlich dort ging oder nicht. Meinen Todfeind, dachte er. Aber der Tod, Aimery, ist zu zart für dich.
Eine köstliche Nacht zog herauf. Die Stände wurden unter die Dächer der Buden geschoben, sodass Platz zum Tanz entstand. In der Abendbläue jonglierte ein Mann mit Fackeln, Artisten schlugen Räder um Liebespaare, ein Beutelschneider floh geduckt durch ein Paar Beine, ein Klatschweib mit Schandmaske wurde durch das Treiben gezerrt. Es roch nach Honig, nach Obstwein und nach Rosenessenzen, die Frauen für solche Tage aufsparten. Es war einer der Abende, wie sie ein jeder Sommer nur in winzigen Prisen schenkte.
Gilbert aber sah vor Missmut keinen Stern. »Lass uns ein Bett auftreiben«, sagte er zu Ronald. »Ich habe keine Lust, in dem verdammten Domus Dei zu schlafen, wo die Pilger sich ihre Flohbisse kratzen.« Er war entschlossen zu gehen. Bis er die Frauen entdeckte. Die eine kannte er. Sie war Dottie Loyes, nunmehr Dottie Fletcher, und wenn ihn nicht alles täuschte, war sie schon geschwängert. Ein kräftiges, sinnliches Mädchen, mit der sich bestimmt stramme Söhne zeugen ließen. Die andere kannte er auch. Oder besser, er erkannte zwei Dinge: wer sie war, und dass er sie haben musste. So wie damals, im moorigen Schlick, der Mond über dem Domus Dei eine eisig blanke Scheibe. Er glaubte, sein eigenes Gewisper zu hören: ›Mein schönes Mädchen im Moor. Mein Goldhaar, mein Silberauge.‹
Dottie verbarg züchtig das Haar unterm Gebende, der anderen fiel es über den Rücken. Gilbert stöhnte. Rasch langte er in seinen Beutel, fischte eine Handvoll Pennys heraus und gab sie Ronald. »Hier. Bezahl den Unterstand für die Gäule und sag dem Wirt, er soll dir einen Strohsack richten. Ich habe noch etwas zu erledigen.«
»Wie üblich, Meister.«
»Wärst du nicht mein Schwesternsohn«, sagte Gilbert, »ich gäb’s dir für deine Frechheit mit dem Knüppel.« Er ließ den Jungen stehen und zwängte sich den Frauen hinterdrein. Als er sie eingeholt hatte, vertrat er ihnen den Weg. »Gott zum Gruß, Mistress Dottie. Entsinnt Ihr Euch eines Euch gewogenen Nachbarn aus Southampton?«
Anderntags holte er den Jungen ab, hieß ihn, die spärlichen Einkäufe auf den Karren zu laden, und machte sich mit ihm auf den Heimweg. Er hatte geplant, eine Woche zu bleiben, jetzt aber wollte er fort, um seinen Gedanken nachzuhängen.
»Wisst Ihr was, Meister?«
»Nein, aber du wirst es mir gewiss gleich sagen.«
»Ihr solltet heiraten. Die Mutter findet das auch.«
»Deine Mutter, meine Herzensschwester, hätte dir öfter den Arsch pfeffern sollen, statt ihre Nase in anderer Leute Belange zu stecken.«
»Aber sie hat recht«, beharrte Ronald. »Von den schlechten Frauen holt man sich Krankheiten, und der Herrgott ist auch nicht dafür. Ich soll, sagt die Mutter, darauf dringen, dass Ihr ohne Verzug zur Beichte geht.«
»Was wissen du und der Herrgott denn von schlechten Frauen, he? Ist eine schlecht, weil sie die Wollust im Leib hat, ein Nest für die Liebe, wo bei anderen Weibern ein Spalt wie an der Kirchentüre sitzt?«
Der Junge zerrte das Maultier durch die Furt und blieb stehen. »Wollt Ihr hören, was die Mutter noch sagt? Der Oheim Gilbert hat zwei Seiten, eine helle, den Leuten zugewandte, und eine, die ist düster wie der Meeresgrund, bei der sieht keiner durch.«
Gar nicht dumm, dachte Gilbert. Düster wie der Meeresgrund, wie die Nacht über der Salzwiese, über dem Domus Dei, wo die schlafen, die reinen Herzens sind. Und waren wir nicht reinen Herzens, meine Liebste, damals noch und dann nie wieder?
In Gedanken versunken ritt er weiter. Beim Überqueren einer Bodenwelle kam das Wasser in Sicht. Grau wie Eisen, schaumbefleckt. Kaum sah Gilbert aufs Meer, da spürte er den linden Wind, der nun von Tag zu Tag schwellen und schließlich dem Sommer den Garaus machen würde. Am Horizont, die Sicht nach Frankreich verstellend, erhob sich die Insel Wight. Sein Blick aber blieb nicht an deren Landmassen hängen, sondern an den dunklen Formen, die das vertraute Bild störten.
Ronald hielt das Maultier an. »Sind das Handelsschiffe?«
»Schwer zu sagen.« Der verdammte Aimery hätte vermutlich trotz des Abstands erkannt, um was für Schiffe es sich handelte, Takelung, Steuerung, und womöglich sah er ihnen noch ins Innere und erkannte die Krümmung ihrer Spanten. Aber ins Herz einer Frau siehst du nicht, Aimery, höhnte eine Stimme in Gilbert. Die Brust einer Frau ist für dich, was für gesunde Männer ein Schiff ist: ein Ding aus Planken.
»Franzosen?«, fragte Ronald.
Die große Galeere, die zwischen den Seglern einherglitt, ließ darauf schließen, denn solche Galeeren heuerten die Franzosen von verbannten genuesischen Edelleuten an. »Und wenn schon«, warf Gilbert hin. »Denen ist ja der Solent nicht verboten. Außerdem ziehen sie schon wieder ab.«
Gilbert ritt weiter, und der Junge folgte. Als sie die Landspitze vor der heimatlichen Bucht erreichten, drehte er sich im Sattel um und sah, dass die Schiffe die Meerenge verlassen hatten. Gleich darauf schrie Ronald auf. Gilbert schoss herum. Vor ihnen in der Senke lagen die ersten Häuser von Southampton und zur Linken der Strand, wo die Fischer ihre Boote hatten. Das Wasser stand in Flammen. Gelbrote Zungen sprangen auf, als spucke das Meergrau sie in die Höhe, Feuerwände zerstückelten die Sicht. Am Ufer waren Menschen zusammengelaufen, vereinzelt wurden Schreie laut, Geheule, Klagen. Eine Frau warf sich in den Sand, zwei Jungen stürmten ins seichte Wasser, brüllten wie Tiere, kehrten um. An Gilbert vorbei lief Ronald den Hügel hinunter, den brennenden Booten entgegen.
»Ron«, rief Gilbert, »verdammt, komm zurück, da unten richtet keiner mehr was aus.« Die französischen Schiffe hatten sich vermutlich tief in die Bucht gewagt und Brandpfeile auf jedes Ziel in Reichweite abgefeuert. Ehe das Warngeläut im Hafen anhob, hatten die schnellen Gefährte das Weite gesucht.
Widerstrebend trottete der Junge die Anhöhe hoch.
»He.« Gilbert tippte ihm mit der Gerte auf die Schulter. »Nimm es dir nicht so zu Herzen. Ein paar Fischerboote sind zu ersetzen. Es hätte schlimmer kommen können.«
»Was hat es zu bedeuten?« Ronald griff dem Maultier ins Kopfzeug, und schleppenden Schrittes setzten sie den Weg fort.
»Was wohl? Dass wir demnächst Krieg mit Frankreich haben. Vermutlich wird der gallische Philip die Gascogne besetzen, und wer noch Wein saufen will, muss vor Francis Fletcher einen Bückling machen.«
In der glastigen Luft tanzten Rußteilchen. »Dann werde ich also bald keine Wolle mehr karden, sondern endlich zu tun bekommen, wozu ich bei Euch in der Lehre bin«, bemerkte Ronald.
»Und das wäre?«
»Ein Schiff bauen«, erwiderte der Junge. »Ein Schiff für die Schlacht.«
*
Von dem Franzosenüberfall in Southampton erfuhr Dorothy, als Clement sie besuchte. Er kam des Öfteren, hatte aber nie viel Zeit, mit ihr zu schwatzen, sondern Dinge zu erledigen, die er nicht mit ihr besprach. Bei dem Überfall, so berichtete er, hatte niemand, den sie kannten, Schaden erlitten.
»Für diesmal hat es sich im Sand verlaufen. Nur für diesmal noch.«
»Was soll das heißen? Kommt jetzt der Krieg?«
»Bald, mein Nussholzhaar.« Er küsste ihr den Kopf und sprang auf. »Und nun muss ich gehen, und du sei mir nicht böse.«
Böse war sie ihm nicht. Aber einsam war sie. Daheim, in Southampton hatte sie zur Gesellschaft die Mutter und die Basen gehabt, aber hier richtete kaum ein Mensch das Wort an sie. Es fiel ihr schwer, sich dies einzugestehen, doch in ihrem neuen Leben erschien nichts wie verheißen. In den Tagen nach der Hochzeit, derweil sie begriff, was es bedeutete, mit den drei Männern zu hausen, träumte sie von Flucht. Das Haus war eine Höhle, kahl und selbst im Sommer düster. Sehr groß war es, zwei Stockwerke hoch und auf ein steinernes Fundament gestellt. Es besaß ein geschindeltes Dach und einen Hinterhof mit einer Hütte, in der Hugh, der Knecht, und sein Weib Hilda hausten. Einen Unterstand für Pferde und Verschläge für Geflügel und Mastschweine gab es, doch das Vieh war mager und zerrauft, und im Hof wuchsen nichts als verwahrloste, über die Erde wuchernde Bohnenranken und ein einzelner verwilderter Apfelbaum.
»Die Herren kümmert es nicht«, hatte Hilda auf Dorothys Frage mit einem Schulterzucken erklärt. Sie und ihr Mann hatten in der Hütte drei Kinder durchzubringen und Arbeit genug. Warum hätte sie sich um das welkende Gemüse sorgen sollen oder darum, wie das Essen schmeckte, das die Männer in sich hineinschaufelten? Einzig Agnes beklagte sich zuweilen, ließ ihren Löffel fallen und rief: »Sind das Erbsen oder Eicheln? Hilda, Hilda, hast du uns wieder den Fraß für das Schwein vorgesetzt?« Dann ging sie und verköstigte sich in der Garküche. Der alte Francis händigte keinem mehr als das unentbehrliche Geld aus, aber Agnes hatte immer welches.
Nicht das üble Essen und der verkommene Hof waren das Schlimmste, sondern die Stille der Tage. Im Haus nebenan wohnte Gocelin Deghere, der Gildenälteste. Seine Frau Matilda war eine freundliche Seele, aber sie hatte sieben Kinder, trug das achte im Bauch und schwatzte von nichts als Brutpflege. Dorothy war gewohnt, beim Tagwerk Stimmen zu hören, Gelächter, Singen, ein Kommen und Gehen an der Pforte. Im Haus der Fletchers herrschte Schweigen. Und das war umso unerträglicher, als Menschen darin lebten, die miteinander hätten sprechen können.
Da niemand ihr etwas erklärte, musste Dorothy selbst herausfinden, wer überhaupt was tat. Francis, graubärtig und an die siebzig Jahre alt, betrieb seinen Handel im vom Wohnraum abgeteilten Seitenzimmer. Dort klappte er des Morgens mit markerschütterndem Getöse einen Laden herunter, der wie ein Verkaufstresen auf die Gasse ragte. Dahinter kauerte er im Zwielicht und wartete auf Kundschaft. Dorothy hätte lieber auf Salz und Hafer verzichtet, als bei dem Grobian zu kaufen. Francis jedoch blieb nie auf einem Posten sitzen, weil er sich stets aufs Lager schaffte, woran nächstens Mangel herrschen würde. Mit seinen Kunden sprach er nur das Nötigste und ließ nie mit sich feilschen. Setzte er sich hernach zu Tisch, um mit seiner Familie zu essen, so leistete er sich kein Wort, das nicht vor Spott und Bitterkeit triefte.
Zumindest besitzt er eine Stimme, dachte Dorothy. Der andere, ihr Schwiegervater mit dem moorschwarzen Haar, schien nahezu stumm. Zur Arbeit in Haus und Hof leistete er nur einen einzigen Beitrag: Wenn er vor Sonnenaufgang das Haus verließ, nahm er Korn mit, das gemahlen werden musste, und abends brachte er Mehl zurück. Die Tage verbrachte er auf seiner Werft, aber das Korn trug er nach der anderen Stadtseite, zum Domus Dei, nicht wie die Nachbarn zum Abteimüller bei den Wasserläufen.