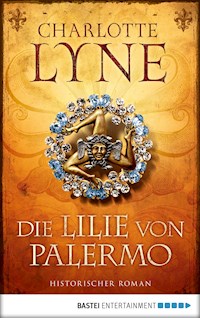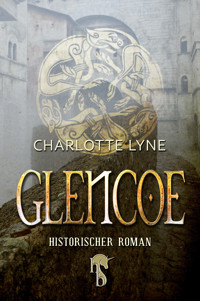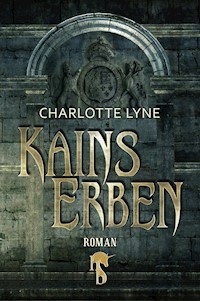6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ende 19. Jahrhundert in Mexiko: Benito Alvarez, Gouverneur von Querétaro, und seine deutsche Frau Katharina leben mit ihren Kindern Josefa, Anavera und Vincente auf ihrem Landgut. Die Eltern lieben ihre Kinder, doch Josefa fühlt sich stets zurückgesetzt, hat das Gefühl, nicht dazuzugehören. Eines Tages flieht sie in ihrem Zorn in die Hauptstadt und begegnet dort einem zwielichtigen Großgrundbesitzer, dem sie von Anfang an verfällt. Schafft Katharina es, ihre Tochter vor einem folgenschweren Fehler zu bewahren?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 791
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Charlotte Lyne
Im Tal der träumenden Götter
Roman
Meinen Eltern zur Goldenen Hochzeit23. Mai 2013
»El amor es la más peligrosa y temida forma de vivir el morir.«»Die Liebe ist die gefährlichste, am meisten gefürchtete Form,das Sterben zu leben.«Agustin Yáñez, Al filo del agua
Prolog
Eisacktal, Kronland Tirol März 1888
Sie starben beide in derselben Nacht.
Therese hätte damit rechnen müssen. Der Doktor hatte sie oft gewarnt, sie solle die Familie darauf vorbereiten, aber das war leichter gesagt als getan. Welche Familie sollte sie vorbereiten, wo doch die beiden, die in ihren Kammern vor sich hin starben, ihre ganze Familie waren? Neben ihnen gab es nur noch den Gustl, ihren verwitweten Schwager, der das arme Anndl geheiratet hatte, um an ihr Geld und an den Titel zu kommen. Letzten Endes würde er sein Ziel erreichen. Es war ja keiner mehr übrig, der ihm das Erbe streitig machen konnte.
Therese hatte nur sich selbst auf den Tod ihrer letzten Verwandten vorzubereiten. Sie war sechzig Jahre alt und würde demnächst allein in der Welt stehen. Ohne Veit. Sich darauf vorzubereiten war unmöglich, auch wenn sie seit Jahren wusste, dass der Junge ihr eines Tages genommen werden würde. Sie hatte sich an seinem bisschen Leben festgehalten wie ein Steiger am Seil. Solange Veit sie brauchte, hatte ihr Leben einen Sinn. Ohne ihn würde die Stille im Haus so unerträglich werden wie die Leere in ihrem Herzen.
Es hatte keinen Sinn, sich etwas vorzumachen. Am Nachmittag hatte der Doktor geraten, nach dem Priester zu schicken und Veit mit den Sterbesakramenten versehen zu lassen. Das allein war noch kein Zeichen dafür, dass es diesmal wahrhaftig zu Ende ging, denn die Sterbesakramente hatte der arme Bub mit seinen noch nicht zwanzig Jahren gewiss ein Dutzend Mal erhalten. Diesmal jedoch hatte der Priester, der sonst ein herzloser Eiferer war, Therese beide Hände gedrückt, als wollte er ihr die Knochen brechen. »Gott steh Ihnen bei«, hatte er gemurmelt. Da wusste Therese, dass sie das bisschen Hoffnung, das in ihr noch flackerte, aufgeben musste.
Sie sagte Franziska, dem Mädchen, sie solle ihr eine Kanne Zimtwein und einen Teller Gebäck hinstellen und sich dann um Zenta kümmern. Anschließend schickte sie den Doktor nach Hause: »Sie können sich auf den Weg machen. Es bleibt ja nichts mehr zu tun.«
»Sind Sie sicher, dass Sie zurechtkommen?«, fragte der Doktor, dem die Geldgier aus den Augen blitzte. »Vielleicht sollten Sie sich das Ende nicht antun. Wenn Sie es wünschen, bleibe ich gern die Nacht über hier.«
Und ziehen uns noch mehr Geld aus der Tasche, fügte Therese im Stillen hinzu. Dabei war es albern, aufs Geld zu achten, um es nachher dem Gustl in den Rachen zu stopfen. »Veit ist mein Neffe«, erwiderte sie, »der einzige Nachkomme meiner Familie. Ich war hier, als der Junge in die Welt gekommen ist. Ich werde auch hier sein, wenn er sie wieder verlässt.«
»Wie beliebt«, erwiderte der Doktor verschnupft und zog ab. Kurz darauf brachte Franziska den Zimtwein und einen Teller mit Pinzen und Zuckerkipferln. Kindergebäck. Wie Veit es geliebt hatte. Valentin hat es auch geliebt, durchfuhr es Therese. »Geh jetzt und sieh nach meiner Schwester«, herrschte sie das Mädchen an und ohrfeigte es, weil der Schmerz sich Luft verschaffen musste. Danach war Therese mit ihrem sterbenden Neffen allein.
Märzwind rüttelte am Fensterglas, dass es in der Stille klirrte. Dazu rasselten Veits schwere Atemzüge, doch sonst gab es in der Kammer kein Geräusch. Die rechte Hand des Jungen war verbunden, die linke lag knochig und wächsern auf dem Laken. Bei jedem anderen hätte Therese sich überwinden müssen, solche Totenklaue zu berühren, doch bei Veit fiel es ihr leicht. Sie wollte seine Hand noch einmal halten, wie sie seine kleine Kinderhand gehalten hatte.
Damals waren seine Gelenke noch nicht von der Krankheit verkrüppelt gewesen, und er war an ihrer Hand über die Wiesen gelaufen wie ein glückliches, gesundes Kind. Sie liebte ihn. Nach Valentins Tod hatte sie geglaubt nie wieder einen Menschen lieben zu können, aber in diesem Jungen war Valentin ihr noch einmal geschenkt worden. Knapp zwanzig Jahre lang. Sie waren zu Ende. Therese nahm Veits Hand in die ihre und weinte.
»Brauchst du noch etwas, mein Lieber?«, fragte sie mit krächzender Stimme. Dass keine Antwort kam, überraschte sie nicht. Sie hatte nur sichergehen wollen, dass es ihm an nichts fehlte. Ihr Bruder Valentin war ganz allein in der Fremde gestorben und lag in der Erde des Höllenlandes verscharrt. Ihr Neffe Veit sollte in der Todesstunde spüren, dass er geliebt worden war und dass sein Leben nicht spurlos verlosch.
Der Schweiß auf seiner Stirn war kalt. Behutsam rieb Therese sie trocken und deckte ihn noch fester zu. Sandte er ihr mit geschlossenen Augen ein Lächeln? Nein, auch dafür war er jetzt zu schwach. Er war immer schwach gewesen. Blutarm wie seine Mutter hieß es, ehe sie alle begreifen mussten, dass in Veits Körper ein Leiden wütete, das tausendmal tückischer war.
Er war ihnen so spät geboren worden. Sechs waren sie gewesen, fünf Schwestern und ein Bruder, und sie hatten nur dieses eine, kostbare Kind hervorgebracht. Valentins Tod hatte das Leben der Familie aus der Bahn geworfen. Zwei der Schwestern waren ihm ins Grab gefolgt, und das Anndl hatte den Gustl geheiratet, der sich mit Flittchen herumtrieb, statt seiner Frau ein lebensstarkes Kind zu machen. Die zwei bedauernswerten Bübchen, die sie bekam, waren innerhalb von Wochen regelrecht verkümmert und gestorben. Therese selbst hatte ihre Verlobung gelöst. Ihr Verlobter war Toni Mühlbach gewesen, Valentins Freund und Offizierskamerad, und sooft sie ihn ansah, drehte es ihr das Herz um. Als ihre Schwester Zenta den Toni an ihrer Stelle nahm, tat es ihr nicht einmal weh.
Und diese kränkliche Zenta hatte schließlich das ersehnte Kind geboren. Einen Jungen mit ebenmäßigen Zügen, grünen Augen und goldblondem Haar. Er sah aus wie ein kleiner wiedergeborener Valentin, und mit ihm kehrten Leben und Lachen ins Haus der Familie zurück.
Der Besitz, der Valentin hätte zufallen sollen, hatte nun wieder einen Erben. Es war kein großes, aber ein schönes, ertragreiches Stück Land, und es brachte einen Titel mit sich. Thereses Mutter hatte zwar einen Habenichts geheiratet, doch sie selbst war eine geborene von Tschiderer gewesen, und am Ende erbte sie das väterliche Gut. Ihr Sohn Valentin war sinnlos gestorben, doch ihr Enkel Veit sollte den Titel der Familie tragen.
Wie lange waren sie wunschlos glücklich gewesen? Ein paar Monate, ein Jahr? Der kleine Veit war schwächlich, doch so, wie er gepäppelt wurde, würde er gewiss gedeihen. Als er sich am Finger verletzte und die Wunde nicht heilen wollte, machte niemand sich Sorgen. Auch nicht, als er laufen lernte und am ganzen Leib blaue Flecken davontrug. Seltsam war nur, dass die Blessuren nicht verblassten, sondern beständig dunkler und größer wurden – wie eine schwarze Wolke über ihrem Glück. Dann begannen seine Gelenke zu schwellen, und bald wimmerte er Tag und Nacht vor Schmerz. Sie ließen den Arzt kommen, der Weinsteinsäure zum Kühlen und Bittersalz zum Abführen von Giften verschrieb. Nichts davon half. Als der Arzt das nächste Mal kam, schüttelte er traurig den Kopf und sagte: »Es ist die Krankheit. Die Blutsucht. Machen Sie es dem Kleinen schön, denn er wird nicht lange leben.«
Therese sah auf das geliebte Gesicht hinunter. »Das habe ich versucht«, presste sie heraus. »Es dir schön zu machen. Es war der Sinn meines Lebens.« Sie beugte sich vor und küsste ihn auf die Stirn. Sein engelsgleiches Gesicht wirkte müde – ausgezehrt vom ständigen Schmerz. Das Glas des Fensters klirrte weiter, aber Veits Atemzüge rasselten nicht mehr. Er hatte sich auf den Weg gemacht. Dort, wo er hinging, würde nichts ihn mehr quälen.
Therese hielt seine Hand, bis die letzte Wärme daraus wich. Dann wischte sie sich das Gesicht ab. Keinen Atemzug später klopfte es so heftig, dass sie zusammenzuckte. »Herein.«
Franziska steckte den Kopf in den Türspalt. Sie war von liederlicher Abkunft, schlecht erzogen, weshalb sie wie ein Hottentotte auf die Tür einschlug. »Ihre Schwester!«, rief sie. »Sie möcht Sie sprechen. Und der Priester soll kommen. Sie sagt, es geht ans Sterben.«
Therese hasste sich dafür, doch das half nicht, sie war neidisch auf Zenta, und sie hatte ein Leben lang Grund dazu gehabt. Nicht sie, die sich wie eine Mutter um ihn gekümmert hatte, war Valentins Lieblingsschwester gewesen, sondern Zenta, die meist krank im Bett lag. Nicht sie, die alles dafür gegeben hätte, hatte Veit zur Welt bringen dürfen, sondern Zenta, der für ein Kind die Kraft fehlte. Und jetzt durfte nicht sie, die ihn Tag und Nacht gepflegt hatte, Veit in den Tod folgen, sondern Zenta, die ihren sterbenskranken Sohn allein gelassen hatte. Schwerfällig, als trüge sie die Last von Jahren auf den Schultern, stand Therese auf. »Schick den Hausknecht nach dem Priester«, sagte sie zu Franziska und ohrfeigte sie leise, um dem armen Toten keinen Schrecken zu versetzen. Dann ging sie hinüber zur Kammer ihrer Schwester.
Was Zenta fehlte, hatte nie ein Arzt herausgefunden. Sie war einfach nicht stark genug gewesen, um dem Leben standzuhalten. Bettlägerig war sie, seit ihr Mann Toni vor sieben Jahren gestorben war. Ob sie jetzt wirklich auch starb? Therese schob die Tür auf. Das Gaslicht war heruntergedreht. Am Bett der Kranken brannte eine einzelne Kerze. Zenta wandte ihr nicht das Gesicht zu, doch sie flüsterte etwas, das Therese nicht verstand. Sie trat näher zu ihr heran. »Kommt der Priester?«, vernahm sie endlich das Wispern unter schleppenden Atemzügen.
»Der Hausknecht holt ihn.«
»Dann setz dich rasch, Resl. Uns bleibt kaum noch Zeit.« Therese wollte ihr sagen, dass ihr Sohn gestorben war, aber Zenta gebot ihr mit schwacher Hand zu schweigen. »Lass mich sprechen. Mir geht die Kraft aus, und ich muss dies zu Ende bringen.«
»Was?«
»Resl …« Die Worte erstickten unter einem Hustenanfall. Therese griff nach dem Becher und hielt ihn der Schwester an die Lippen, doch das Wasser rann ihr aus den Mundwinkeln. »Ich muss es dir sagen«, krächzte Zenta, sobald der Husten verebbte. »Mein Toni hat es mir gesagt, und ich hab ihm versprochen, dass ich schweig. Aber jetzt kann ich doch nicht weiter schweigen. Wenn ich nicht mehr da bin und wenn auch der Veit nicht mehr da ist – dann wärst du allein auf der Welt.«
Thereses Herz begann seltsam spitz und hoch zu klopfen, ohne dass sie wusste, warum. »Sprich«, trieb sie die Schwester an, obwohl sie sah, wie die Kranke kämpfte.
»Der Valentin …«, begann Zenta und brach ab.
»Sprich!«, rief Therese und sprang auf.
»Der Valentin und der Toni, die waren ja wie Brüder … und der Toni hat’s nicht ertragen, nicht zu wissen, wie der Valentin gestorben ist. Deshalb ist er damals nach Mexiko und hat versucht, es herauszufinden.«
»Herrgott Sakrament, das weiß ich alles!« Therese presste die Hände an die Schläfen, weil ihr zumute war, als würde ihr der Kopf platzen.
»Setz dich, Resl«, flüsterte Zenta und wartete, bis Therese ihr gehorchte. »Was der Toni damals erfahren hat, durfte ich dir nicht sagen, weil der Toni gemeint hat, dass die Menschen da drüben Kampf und Sorge genug hatten und Frieden verdient haben. Und uns täte es nur weh, alles aufzuwühlen.«
Zentas Stimme wurde schwächer. Angst erfasste Therese: Was, wenn die Schwester starb, ehe sie ihr von Veits Tod erzählen konnte? »Komm zum Ende«, fuhr sie sie an. »Was hat der Toni erfahren?«
»Der Valentin«, stieß Zenta heraus. »Der Valentin hat ein Kind in Mexiko.« Dann fiel ihr der Kopf aufs Kissen zurück. Im selben Augenblick stieß der Priester die Tür auf.
Therese erhob sich, trat beiseite und murmelte: »Machen Sie schnell.«
Keine Stunde später war Zenta tot. Sie hatte das Bewusstsein nicht wiedererlangt und nicht erfahren, dass ihr einziges Kind nicht mehr lebte. Aber sie war mit den Segnungen der Kirche gestorben, und Veit würde sie hinter der Himmelspforte empfangen. Würde die Familie dort wirklich wieder vereint sein, die Schwestern, der Toni, Veit – und Valentin? Und was ist mit mir?, durchfuhr es Therese. Sie legte ein Schultertuch um, weil sie plötzlich bemerkte, dass sie fror, und trat aus der Vordertür in den erwachten Tag.
Benommen sah sie sich um. Die Nebel, die in den Baumwipfeln gefangen waren, rissen sich frei, stiegen leuchtend gen Himmel und verflogen. Obwohl die Nacht vorbei war, hielt der Mond sich über der Bergkette und spann Fäden um ihre Gipfel. Das Pfeifen des Windes wurde zum Flüstern, das Therese in die Ohren säuselte: Valentin hat ein Kind. Valentin hat in Mexiko ein Kind …
Hier und da bedeckten noch Reste von Schnee das Land, das ihrer Familie gehörte. Es war ihre Heimat, im Schutz dieser Berge war sie aufgewachsen – wie konnte sie dieses Land dem Gustl überlassen? Valentin hat ein Kind, säuselte der frühlingshafte Wind in ihr Ohr. Therese wandte sich um, als müsste sie jemandem Antwort geben. »Wenn Valentin ein Kind hat, dann gehört ihm der Tschiderer-Hof«, sagte sie. »Wenn es dieses Kind wirklich gibt, dann fahre ich nach Mexiko und hole es nach Hause.«
Erster Teil
Querétaro, Santa María de Cleofás, Rancho El Manzanal August 1888»Welch gewaltige, welch prächtige Stadt!In ihren Straßen und Palästen wimmelt es vor Menschen.Kopflos eilen sie umher,Einander stoßend, schlagend und prügelnd.«Manuel Gutiérrez Nájera
1
Durch den Fensterspalt drang der Lärm eines glücklichen Tages.
Vicente und Enrique lieferten sich auf ihren Pferden ein Rennen, und Anavera schwang sich auf ihren ungesattelten Rappen und sprengte hinter ihnen her – im Herrensitz, wie sie von klein auf ritt. Ein paar Kaffeepflücker standen in der Sonne am Koppelzaun, brachen in Gelächter aus und applaudierten. Kurzerhand sprang Josefa auf und warf das Fenster zu. Schweiß troff ihr die Stirn hinunter, und ihre Kleider klebten ihr am Körper, doch die Hitze war leichter zu ertragen als die fröhlichen Stimmen, die sie auszuschließen schienen.
Wie lange war es ihr schon so ergangen? Bereits als Kind hatte sie hier oben am Fenster des Mädchenzimmers gesessen und gelauscht, wie die anderen draußen herumtollten, spielten, gelegentlich weinten, doch genauso schnell wieder lachten und weitertobten. Ab und zu war sie hinuntergelaufen, getrieben von Sehnsucht, sich dazuzugesellen, aber meistens war sie schnell wieder oben gewesen, im Schutz des Zimmers, wo niemand bemerken konnte, dass sie, Josefa, in Wahrheit nicht dazugehörte.
Was für ein Unsinn! Josefa schnaufte und beugte sich wieder über die Schreibmaschine. Es war eine Remington 2, das neueste Modell aus Nordamerika, das sein Farbband selbst transportierte und zwischen Groß- und Kleinschreibung unterscheiden konnte. Ihr Vater hatte ihr die Maschine aus der Hauptstadt geschickt, ein vorgezogenes Geschenk zu ihrem morgigen Geburtstag. Auf dem Kasten, neben dem Markenzeichen, waren ihre Initialen eingeprägt, J. M. A., Josefa Marta Alvarez, wie in dem schweren Goldreifen, den sie am Handgelenk trug. Ihr Vater hatte sie eigens für sie gravieren lassen, genau wie den Reifen, den er ihr zur Taufe geschenkt hatte. Sie war der Beweis dafür, dass er ihren Berufswunsch ernst nahm, und mehr noch: Die metallisch glänzende Schreibmaschine bewies, dass er sie liebte. Nicht weniger als seine anderen Kinder, denen er storchenbeinige Fohlen und Teleskope schenkte.
Sie hatte keinen Grund, sich ausgeschlossen zu fühlen. Solche Gedanken waren kindisch, und ab morgen war sie kein Kind mehr. Ihr Vater würde eigens aus der Hauptstadt kommen, um ihr ein Fest zu ihrem einundzwanzigsten Geburtstag zu geben. Die Einladungen waren lange verschickt, eine Firma aus der Stadt hatte Zelte, Tischschmuck und Girlanden geliefert, und eine Kapelle würde ihnen bis spät in die Nacht zum Tanz aufspielen. Es würde herrlich sein, einmal als Hauptperson im Mittelpunkt zu stehen – aber hundertmal wichtiger als all das war der Vater. Jeden Moment konnte er eintreffen, und dann würde er Josefa über der Schreibmaschine finden und mit funkelnden Augen lächeln, weil er stolz auf sie war.
Josefa beugte sich vor und las, was sie geschrieben hatte: »Schützt Mexikos Verfassung!«, stand als Schlagzeile über dem Artikel, und gleich darunter: »Warum ein gewählter Präsident halten muss, was er bei Amtsantritt versprochen hat«.
Sie hatte die Tasten mehrmals angeschlagen, um die Überschrift hervorzuheben, weshalb die Schrift nicht scharf, sondern leicht verwischt war. Aber umso besser gelungen war der Text. Klar und mit einer Spur Ironie hatte sie dargelegt, warum Präsident Porfirio Diaz nicht noch einmal zur Wiederwahl kandidieren durfte. Die Verfassung verbot es, und Diaz selbst hatte seinen Vorgänger, den großen Juárez, bekämpft, weil dieser das Verbot umgangen hatte. Er musste sich an seine Forderung halten, oder er verspielte das Vertrauen der Bevölkerung. Das Johlen von draußen wurde so laut, dass die Scheibe es kaum noch dämpfte, aber Josefa störte es nicht länger. Sie hatte gute Arbeit geleistet. Sie würde den Artikel Miguel schicken, und mit etwas Glück würde der ihn drucken. In El Siglo XIX, jubelte sie innerlich. Sie würde Journalistin sein, gedruckt in der größten liberalen Zeitung Mexikos.
Ihr Vater hatte für El Siglo geschrieben, schon vor Josefas Geburt und sogar als die Zeitung verboten war. Er hatte Miguel, seinen Patensohn, dort untergebracht. Sobald er Josefas Artikel las, würde er wissen, dass sie nicht weniger Talent besaß und seine Hilfe ebenso verdiente, auch wenn sie als Frau einen steinigen Weg vor sich hatte. Er würde bald hier sein. Das Leben war schön, und die trüben Gedanken verflogen wie Schmetterlingsschwärme.
Vorsichtig zog sie den Bogen aus der Maschine. Schon oft war ihr dabei das Papier zerrissen, und sie hatte alles noch einmal tippen müssen. Diesmal gelang es. Ein gutes Zeichen. Sie wollte eben ein neues Blatt einspannen, als die Tür aufflog. Ohne den Kopf zu drehen, erkannte sie ihre Schwester Anavera – an den heftigen Atemzügen wie an dem Schwall Leben, das mit ihr ins Zimmer schwappte.
»Jo, Jo, stell dir vor, Tomás ist da!«
Langsam drehte Josefa sich um. Anavera vermochte wie üblich vor Aufregung nicht stillzustehen. Ihr schwarzes Haar fiel ihr in dicken Strähnen aus dem Knoten, und ihre Wangen glühten von dem wilden Ritt. Jeder, der sie kannte, betonte, dass Josefa die schönere der Schwestern sei, aber Josefa war anderer Meinung. Mit ihren klaren Zügen, den scharfen Wangenknochen und den vor Wärme funkelnden fast schwarzen Augen war Anavera dem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten. Und wenn man Josefa fragte, war ihr Vater der schönste Mann der Welt.
»Hast du nicht gehört? Tomás ist da! Los komm, beeil dich. Er wartet auf der Veranda.«
»Um mich zu sehen, ist er bestimmt nicht hier«, versetzte Josefa. Tomás war der Sohn von Martina und Felix, den engsten Freunden ihrer Eltern. Seine Familie lebte in der Hauptstadt, und dennoch war er beinahe wie ihr Bruder aufgewachsen. Ganze Sommer über hatte Martina ihren Sohn hierhergeschickt, damit er die Segnungen des Landlebens genießen konnte. »Du weißt gar nicht, wie gut du es hast«, pflegte sie zu Josefa zu sagen. »Nirgendwo kann ein Kind glücklicher aufwachsen als auf El Manzanal.«
Auf die meisten Kinder mochte das zutreffen. Für Vicente, Anavera und die Schar ihrer Verwandten schien El Manzanal, der Rancho, auf dem ihre Familie den kostbaren Arabica-Kaffee anbaute und rassige Pferde züchtete, dem irdischen Paradies gleichzukommen. Josefa aber, die den betäubenden Duft des Kaffees hasste und sich vor Pferden fürchtete, sehnte sich nach dem Leben, das in der lichtdurchfluteten Hauptstadt tobte. Jedes Mal, wenn der Vater sie dorthin mitgenommen hatte, hatte sie sich gewünscht, sie dürfe bleiben.
»Natürlich ist Tomás deinetwegen hier!«, empörte sich Anavera. »Warum wäre er wohl gekommen, wenn nicht, um deinen Geburtstag zu feiern?«
Um dich anzuhimmeln, dachte Josefa. Bei seinem Besuch im Frühling hatte Tomás sichtlich Gefühle für Anavera entdeckt, die alles andere als brüderlich waren. Wenn Anavera das entgangen war, so nur, weil sie völlig selbstvergessen war, frei von jeder weiblichen Eitelkeit. Beneidenswert, dachte Josefa, und wieder einmal war sie zornig auf sich, weil sie an anderen so viel Beneidenswertes fand.
»Jo, was ist denn?«
»Nichts«, erwiderte Josefa schnell. »Es ist schön, dass Tomás da ist. Ist er mit Vater gekommen?«
Zwei Dinge geschahen gleichzeitig: Anaveras Gesichtsausdruck veränderte sich, und Schritte polterten die Treppe hinauf. Ehe Anavera antworten konnte, erschien über ihrer Schulter Tomás’ vertrautes Gesicht. Als sogenannter Viertel-Mestize hatte er das helle Haar und die grauen Augen seines hanseatischen Vaters, aber die dunkle Haut und die markanten Züge seiner halbindianischen Mutter geerbt. »Hola, Geburtstagskind!«, rief er und legte wie selbstverständlich den Arm um Anaveras Taille. »Bist du nicht ein Glückspilz? Unsereiner muss sich mit einem popligen Namenstag begnügen, aber Josefa Alvarez, die Rose von Querétaro, lässt sich gleich zweimal im Jahr von ihren Bewunderern feiern.«
Josefa lachte mit. Tomás war wie seine Mutter, ihre Patin Martina – sorglos, warmherzig und von einer Lebensfreude, die ansteckend war. Er und Anavera würden ein vollkommenes Paar abgeben. »Es ist ja nur, weil ich einundzwanzig werde«, sagte sie. »Vater war der Meinung, das sei einen richtigen Ball wert. Deshalb kommt er ein paar Tage her, obwohl Diaz ihn noch bis Oktober in der Hauptstadt haben will. Ist er denn schon da, Tomás? Ist er mit dir gekommen?«
Mit Tomás’ Gesicht geschah dasselbe wie zuvor mit dem von Anavera – alle Heiterkeit erlosch. Die beiden drehten die Köpfe zueinander und tauschten einen langen Blick, ehe sie sich wieder ihr zuwandten. »Josefa«, begannen sie wie aus einem Mund. Dann tauschten sie noch einen Blick, und endlich sprach Tomás weiter: »Dein Vater kann nicht kommen. Als Trostpflaster schickt er mich und mein reizendes Mütterlein obendrein. Ich weiß, das ist nur ein mieser Ersatz, aber besser als gar nichts, oder?«
Sein Lächeln war aufgesetzt, und Josefa brachte kein Wort heraus.
»Bitte versuch es zu verstehen, Jo«, sagte Anavera. »Es ist etwas Schreckliches geschehen. Vater schickt dir ein unglaubliches Geschenk, aber er kann jetzt beim besten Willen nicht aus der Hauptstadt weg.«
»Nun mal halblang.« Bemerkenswert zärtlich strich Tomás über Anaveras Wange. »Etwas Schreckliches ist ein bisschen übertrieben, meinst du nicht? Bestimmt ist es nicht mehr als ein kurioser Irrtum, der sich in ein paar Tagen in Luft auflöst.«
»Zum Teufel, komm endlich zur Sache«, brach es aus Josefa heraus. In ihrem Kopf jagte ein Gedanke den anderen. Was konnte geschehen sein, dass der Vater sein so fest gegebenes Versprechen brach? Hatte sie ihm nicht oft genug geschrieben, wie viel ihr an seinem Kommen lag? Was war wieder einmal wichtiger als sie? Wäre es um Anaveras Geburtstag gegangen, hätte irgendein Ereignis auf der Welt ihn aufgehalten?
Anavera löste sich aus Tomás’ Umarmung, trat vor und legte Josefa die Hand auf den Arm. »Du kannst ihm unmöglich böse sein, Jo. Es geht um Miguel.«
Miguel. Sein Patensohn, benannt nach seinem geliebten verstorbenen Bruder. Der Musterschüler, der seine juristischen Examen als Jahresbester abgelegt hatte und mit fünfunddreißig bereits leitender Redakteur von El Siglo war. Der Liebling, der in den Augen ihres Vaters nichts falsch machen konnte, dessen Schwächen übersehen und dessen Stärken über den grünen Klee gelobt wurden. Natürlich ging es um ihn. Über dem Wunderknaben Miguel konnte man getrost vergessen, dass man eine bedeutungslose Tochter hatte, die morgen einundzwanzig wurde.
Josefa spürte einen Klumpen in der Kehle. Sie wusste, wie ungerecht sie war. Miguel konnte schließlich nichts dafür, dass der Vater ihn vergötterte. Er war immer nett zu ihr gewesen, unterstützte sie in ihrem Wunsch, Journalistin zu werden, und hatte ihr sogar angeboten, Artikel, die sie ihm schickte, zu prüfen. Miguel hatte keine Schuld, die Schuld trug allein ihr Vater, der sie nicht wie die anderen liebte, dem jeder Fremde wichtiger war als sie. Tränen raubten ihr die Sicht. Sicher sah sie erbärmlich aus – kein Wunder, dass sie ihrem Vater gleichgültig war. Als Anavera ihr den Arm streichelte, verlor sie die Beherrschung und schlug nach ihrer Hand. »Lasst mich in Ruhe. Ihr wartet doch sowieso nur darauf, dass ihr gehen und für euch allein sein könnt.« Ihre Stimme klang scheußlich – gequetscht und verheult.
Unschlüssig blieb Anavera stehen. Durch Tränenschleier sah Josefa, wie Tomás vortrat und ihre Schwester beim Arm nahm. »Komm, gehen wir, Armadillo. Wenn Jo einen Sündenbock braucht, müssen wir uns nicht freiwillig melden.« Ohne auf Anaveras Proteste zu achten, drängte er sie hinaus auf den Gang.
Ehe er ihr folgte, drehte er sich noch einmal nach Josefa um. »Für die Rolle der verzogenen Göre wirst du allmählich zu alt«, sagte er. »Dein Vater ist untröstlich, weil er morgen nicht bei dir sein kann, aber nicht einmal er ist in der Lage, für sein Prinzesschen die Welt anzuhalten. Miguel ist verhaftet worden. Findest du wirklich, dein Vater sollte ihn im Stich lassen und zu einer Geburtstags-Fiesta fahren?«
2
Bei Sonnenaufgang hatten die Frauen das Erdloch ausgehoben, den Boden der Grube mit Steinen gefüllt und darauf ein Holzfeuer entzündet. Sobald die Holzkohle kräftig glühte, mischten sie mit ihren Schaufeln Kohle und Steine und legten ein Gitter darüber. Auf das Gitter wurde eine Auffangschale aus Ton gestellt, in die die Frauen leuchtend buntes Gemüse schichteten: Tomatillos, Chilischoten, rotviolette Zwiebeln, Kürbisspalten und Süßkartoffeln. Darüber kam ein weiteres Gitter und darauf das Lamm, mit Sträußen von Cilantro gefüllt und in Agavenblätter gewickelt. Anschließend konnte man im würzigen Dampf der Barbacoa sitzen bleiben und sie ihre sieben bis acht Stunden köcheln lassen, bis der rauchige, kräftige Braten und die nahrhafte Suppe fertig waren.
Eine grandiose Köchin war Katharina nie gewesen, aber an Festtagen mit den anderen Frauen bei der Barbacoa zu wachen hatte ihr immer Spaß gemacht. Heute war es eine willkommene Ablenkung. Außerdem kann ich so wenigstens etwas für Josefa tun, fuhr es ihr durch den Kopf, auch wenn ihr klar war, dass die Tochter auf das Essen keinen Wert legen würde.
Ihre Freundin Martina saß mit einem Mörser im Schoß auf einem Klappstuhl und zerstieß mit verbissenem Eifer Pfefferkörner. Für gewöhnlich war das Carmens Aufgabe, die eine wahre Meisterschaft darin entwickelt hatte. Carmen aber hatte ihre Schwiegertochter Abelinda ins Haus bringen müssen, nachdem die junge Frau haltlos in Tränen ausgebrochen war. »Leg sie aufs Bett, lass sie reichlich trinken und die Beine hochlegen«, hatte Martina ihr geraten. »Zur Not kann ich ihr etwas zur Beruhigung geben.«
Martina war Ärztin, und Abelinda war im sechsten Monat schwanger. Sie war ein zart gebautes Mädchen und kam vor Angst um ihren Mann fast um. Katharinas Gedanken flogen zurück zu ihrer Schwangerschaft mit Josefa. Jener Sommer war so heiß gewesen wie dieser, aber damals hatte die Regenzeit verlässlich die Felder bewässert, während in diesem Jahr drückende Trockenheit herrschte, die die Bauern um ihre Ernte fürchten ließ. Ihr Blick wanderte den Hang hinauf, an dem in langen Reihen sorgsam gestutzte Kaffeebäume standen und ihre Zweige voll blutroter Kirschen in den Himmel reckten. Zur Linken erstreckten sich endlose Koppeln, auf denen Pferde und rotgelockte Rinder grasten, und zur Rechten prangten die Apfelbäume, die ihr Vater ihnen zur Hochzeit geschenkt hatte, in voller Frucht.
Eine Woge von Dankbarkeit erfüllte Katharina. Mit seinem hochmodernen Bewässerungssystem konnte El Manzanal einen trockenen Sommer unbeschadet überstehen. Ohnehin war die Familie auf die Erträge des Ranchos kaum angewiesen, denn das, was ihr Mann als Gouverneur von Querétaro einnahm, war mehr als genug für sie alle. Ihre Kinder waren in sorglosem Wohlstand aufgewachsen und kannten weder Hunger noch Krieg.
Damals hatte es anders ausgesehen, und die rasende Furcht, die die junge Abelinda quälte, war Katharina nur allzu vertraut. Als sie in jenen Tagen begriffen hatte, dass sich in ihrem Leib neues Leben regte, hatte sie einsam und ohne einen Peso in einer belagerten Stadt gesessen, während der Vater ihres Kindes in einem sinnlosen Krieg sein Leben aufs Spiel setzte. Unwillkürlich fuhren ihre Hände auf ihren Leib so wie damals, vor einundzwanzig Jahren. Mit Josefa hatte sie es nie leicht gehabt wie mit ihren jüngeren Kindern. Während sie Anavera und Vicente einfach lieben und genießen konnte, war ihre Beziehung zu ihrer Ältesten von Anfang an kompliziert gewesen. In diesem Augenblick aber verspürte sie nichts als den Wunsch, Josefa zu beschützen, genau wie in jenem Hotelzimmer in Santiago de Querétaro in den letzten Wochen des Krieges.
Ich liebe dich, mein Kleines, sagte sie stumm und feierlich vor sich hin. Ich war dir nicht immer die Mutter, die ich hätte sein wollen, aber ich wünsche dir ein wundervolles Leben als Frau. Dann musste sie lachen, obwohl die gestrige Hiobsbotschaft wenig Anlass dazu bot.
Martina hörte auf die Pfefferkörner zu zertrümmern und sah zu ihr hinüber. »Lass mich mitlachen, Süße.«
Ihre Blicke trafen sich. »Es ist eher peinlich als komisch«, sagte Katharina. »Ich habe nur bemerkt, dass ich schon jetzt vor Rührung blind wie ein Höhlenfisch bin. Wie soll das dann erst heute Abend werden?«
Martina grinste breit wie ein Mann. »Vermutlich vergießt du einen Sturzbach, der die Bewässerungsprobleme des Landes löst. Aber tröste dich, ich habe bei Tomás auch eine Überschwemmung verursacht, und Felix war kein bisschen besser.«
Katharina seufzte. »Wenigstens hattest du Felix bei dir.« Gleich darauf biss sie sich auf die Lippe. Sie hatte sich nicht beklagen wollen – gab es nicht andere, die weit mehr Grund dazu hatten? Sie lebte in ihrem Apfelgarten, in ihrem weißen Haus im Schatten des Brotfruchtbaums, ohne Sorgen und umgeben von den Menschen, die sie liebte. Sie hatte drei prachtvolle Kinder und einen Mann, um den sie auch heute noch Scharen von Frauen glühend beneideten. »Es tut mir leid«, murmelte sie. »Ich muss dir vorkommen wie die sprichwörtliche nörgelnde Ehefrau, die ihr bei all den Problemen in der Hauptstadt ganz gewiss nicht brauchen könnt.«
Ohne zu zögern, stellte Martina den Mörser beiseite, rückte mit dem Stuhl zu ihr und legte den Arm um sie. »Nein, so kommst du mir nicht vor. Ich würde verrückt werden, wenn Felix ständig derart lange von mir getrennt wäre. Außerdem würde ich ihm die Hölle heißmachen, weil ich mir lebhaft vorstellen kann, wie er sich einsame Abende mit einem possierlichen Aktmodell vertreibt.«
Katharina lächelte schwach. »Zumindest darum musste ich mir nie Sorgen machen.«
»Nein, wohl kaum.« Martina stieß ihr den Ellbogen in die Seite. »Dein Liebster ist noch immer jede Sünde zweimal wert, aber er betet stur wie ein Bettelmönch allein die heilige Katharina an.«
Katharina lachte mit. In ihrem Inneren breitete sich Wärme aus, und zugleich verspürte sie einen stechenden Schmerz, weil sie Benito nicht bei sich hatte, weil sie den Kopf nicht an seine Brust lehnen und ihm nicht sagen konnte, wie dankbar sie ihm war. Für ihr gemeinsames Leben. Für die Kinder. Für alles, was er für Josefa getan hatte. Vor allem aber wollte sie ihm sagen, dass ihr vor Sehnsucht nach ihm noch immer das Herz galoppierte wie vor vierzig Jahren. »Ich bete ihn auch an«, sagte sie leise.
»Ich seh’s«, bemerkte Martina trocken. »Und sobald diese Sache mit Miguel geklärt ist, bekommst du ihn ja wieder. Dann feiert ihr das Fest noch einmal nach, bis euch der Schweiß aus den Poren quillt. Ist euer Leben nicht im Grunde ein einziges Fest?« Sie drehte sich zur Seite, doch Katharina entging nicht, dass sie sich bekreuzigte. Sie nannte sich mit Vergnügen eine Heidin, aber sooft die todesmutige Martina es mit der Angst zu tun bekam, floh sie in den Schutz ihres katholischen Kinderglaubens.
»Geht es dir nicht gut?«, fragte Katharina.
»Mir? Doch, natürlich«, erwiderte Martina in Gedanken versunken. »Mir geht es immer gut. Dazu bin ich auf der Welt.«
»Was liegt dir dann auf der Seele? Miguel?«
Martina gab keine Antwort.
»Ist es wirklich ein harmloser Irrtum?«, fragte Katharina weiter. »Oder hast du das vorhin nur gesagt, um Abelinda und Carmen nicht aufzuregen?«
»Sie regen sich ohnehin auf«, wich Martina ihr aus. »Und für die Kleine ist Aufregung Gift, das siehst du doch. Sie ist zu schwach für ein einziges Kind, aber ihr Leibesumfang sieht aus, als bekäme sie mindestens drei.«
»Wir sorgen uns alle um sie«, stimmte Katharina zu. »Aber jetzt kann sie uns ja nicht hören. Was ist mit Miguel, Martina? Weshalb ist er verhaftet worden?«
»Weil er trotz wiederholter Verwarnung einen zwölfspaltigen Artikel über die katastrophalen Zustände im Osten der Hauptstadt gedruckt hat«, sprudelte es aus Martina heraus. »Irgendeine ekelhafte Laus in einer geheimen Zensurbehörde hat ihn gemeldet. Der Junge weiß nicht, was Vorsicht bedeutet. Natürlich hat er völlig recht, es ist ein Unding, dass die Regierung mit wirtschaftlichem Wachstum prahlt, während die Bewohner der Slums in einem überfluteten Sumpf leben, wo ihnen ihre Kinder an verseuchtem Wasser krepieren. Aber indem er mit dem Kopf durch die Wand geht, hilft Miguel niemandem – Benito nicht, der wie ein Berglöwe um Verbesserungen kämpft, und sich selbst schon gar nicht.«
»Er hat nicht eure Erfahrung«, gab Katharina zu bedenken. Benito, Martina und Felix hatten während des zweiten Kaiserreichs für die Untergrundregierung gekämpft und dabei gelernt, im Verborgenen zu agieren. »Vergiss nicht, er ist mit der freien Presse aufgewachsen, unter Journalisten, die unverblümt ihre Meinung äußern. Dass Präsident Diaz dem wirklich ein Ende setzen will, kann er vermutlich nicht glauben. Um ehrlich zu sein, ich kann es auch nicht.«
Martinas Lächeln wurde böse. »Porfirio Diaz ist ein Diktator, mein Herzchen. Er mag ein behutsam agierender Diktator mit einer glorreichen Vergangenheit als Befreiungskämpfer sein, aber das macht ihn nicht zu einem Demokraten. Zu alledem hat er Menschen mit zwei indianischen Eltern ungefähr so lieb wie Typhus und Cholera in einem. Das gilt für die kleinen Fische wie Miguel, doch für die großen, die sich mit Hirnschmalz und Charisma als Gouverneure halten, gilt es umso mehr.«
Katharina zuckte zusammen. »Benito ist sein Kriegskamerad!«
»Na und? Wann hätte das je einen Diktator gehindert, einen Mann zu hassen? Und welcher Diktator hätte sich je von Verbrüderung über der Feldlatrine abhalten lassen, einen verhassten Gegner einen Kopf kürzer zu machen?«
Katharina sprang auf. Ich halte das nicht aus, wollte sie rufen. Nicht noch einmal. Ich hatte ein Leben, das wild und bewegt war, voller Farbe, doch vor allem voller Verstörung, Einsamkeit und Furcht. In den zwanzig Jahren, die ich in Frieden hier lebe, habe ich mich davon kaum erholt. Ich kann nicht noch einmal Angst haben, meinen Mann zu verlieren, weil wir in einem Land geboren sind, das nicht zur Ruhe kommt.
Ohne dass sie es bemerkt hatte, war Martina aufgestanden. »He, he«, sagte sie und klopfte ihr den Arm. »Du kennst mich doch. Ich drücke mich immer drastischer aus, als für das Wohl meiner Zuhörer gut ist. Mach dir keine Sorgen, hörst du? Benito ist viel zu beliebt, als dass Diaz es wagen würde, ihm ein Haar zu krümmen, andernfalls hätte er ihn als Gouverneur längst abgesägt.«
»Er stellt ihm einen Militärkommandanten zur Seite«, hielt Katharina dagegen. »Einen erzkonservativen Cachupin aus der Hauptstadt, der von den Menschen hier in Querétaro keine Ahnung hat. Vielleicht ist das der erste Schritt, um Benito abzusägen?«
Martina lachte rau auf und küsste Katharina auf die Wange. »Weißt du, dass es hinreißend ist, wie du Felipe Sanchez Torrija einen Cachupin schimpfst, als wärst du ein altes Nahua-Weib mit gelben Zähnen und Runzeln vom Keifen? Ich kann es deinem Benito nicht verdenken, dass er sich nach dir krank sehnt.«
Ein wenig gequält lachte Katharina mit. »Ich bin ein altes Nahua-Weib, und ich habe mehr Runzeln als verbleibende Lebensjahre«, sagte sie. »Meine Zähne sind nur deshalb nicht gelb, weil Stefan mir aus Europa Kalodont mitbringt, und ein Mann, der in Mexiko Geld scheffelt, um das Leben eines spanischen Grandes zu führen, ist für mich ein Cachupin, und wenn er hundertmal in diesem Land geboren ist. Das hier ist meine Heimat, Martina. Die Menschen, die ich liebe, sind Nahua – allen voran mein Mann und meine Kinder.«
Über Martinas Gesicht ging eine seltsame Regung. »Das porzellanhäutige, butterblonde Geschöpf, das heute Geburtstag hat, ist in der Tat eine Nahua, wie sie im Buche steht«, bemerkte sie trocken. »Hast du dich jetzt beruhigt? Oder sollten wir zwei Hübschen uns einen kleinen goldenen Tequila gönnen, um unsere Runzeln zu glätten?«
»Goldener Tequila klingt himmlisch«, bekannte Katharina. »Nur dass er genügt, um mich zu beruhigen, bezweifle ich.«
Martina ging in die Knie, zog die Tonflasche heran, aus der sie vorhin einige sorgsam bemessene Tropfen auf das Gemüse geschüttet hatte, und schenkte ihnen beiden einen fingerhohen Becher randvoll. Die beiden Frauen tauschten einen Blick. So hatten sie miteinander Tequila getrunken, als sie jung gewesen waren, auf Martinas Dachterrasse über dem Alameda-Park von Mexiko-Stadt, und der Scharfgebrannte aus dem Herzen der blauen Agave hatte sie nicht beruhigt, sondern das Feuer in ihnen noch angefacht. Martina lächelte. »Goldener Tequila, geh mir nach oben, nach unten, in die Mitte und ins Herz.« Sie vollführte die Bewegungen mit dem Becher, trank einen mannhaften Schluck und reichte das Gefäß an Katharina weiter.
Die Flüssigkeit brannte in der Kehle und war wie ein Versprechen: Was sich heute nicht lösen lässt, wird sich morgen schon von selber fügen. Katharina musste auch lächeln. Als Benito ihr zum ersten Mal Tequila gegeben hatte, war sie fünfzehn Jahre alt und fiebrig vor Liebe gewesen. »Kannst du eigentlich fassen, dass wir beide im Großmutteralter angekommen sind?«, fragte sie die Freundin.
»Schwerlich«, erwiderte Martina. »Aber wenn mich mein altersweiser Blick nicht täuscht, werden mein charmanter Sohn und deine entzückende Tochter es uns demnächst deutlich machen.«
»Ist das dein Ernst?«, rief Katharina. »Tomás und Josefa?«
Martina ließ ein ungläubiges Schnauben hören und schnitt eine Grimasse. »Wo hast du eigentlich deine hübschen Augen? Für Josefa ist mein Tomás ungefähr so anziehend wie der Welpe eines Straßenköters, den man flüchtig tätschelt und gleich darauf vergisst. Um die kühle Schöne von El Manzanal aus der Reserve zu locken, muss schon ein anderes Kaliber aufmarschieren.«
»Was willst du damit sagen?«, fragte Katharina, die den Sohn ihrer Freundin von Herzen gern mochte und sich für Josefa keinen besseren Gefährten hätte wünschen können. Das unkomplizierte Wesen des jungen Malers hätte ihrer Ältesten womöglich geholfen, das Leben ab und an ein wenig leichtzunehmen.
»Ich will damit sagen, dass Josefa keinen gewöhnlichen Sterblichen sucht«, erklärte Martina, »sondern einen, der ihr so überlebensgroß und unerreichbar erscheint wie der Mann, den sie am meisten verehrt. Ihren Vater.«
»Aber Benito ist doch …«
Martina winkte ab. »Benito ist sein Gewicht in Gold wert und der geborene Vater. Kein Mensch bestreitet das. Aber dass Josefas Beziehung zu ihm kompliziert ist, weißt du selbst am besten.«
»Er liebt sie, Martina. Er könnte keine andere Tochter auf der Welt so sehr lieben.«
»Mir ist das klar«, sagte Martina. »Das Elend ist nur, dass es Josefa nicht klar ist. Im Übrigen hatte ich deine süße Zweitgeborene im Sinn, als ich über baldige Großmutterfreuden spekulierte. Sollte dir entgangen sein, dass Anavera und Tomás sich bereits im zarten Alter von drei und sechs Jahren die ewige Treue versprachen, so darfst du in Kürze mit einer Erneuerung des Schwurs rechnen. Wo mein Sohn seine Augen hat, weiß ich jedenfalls. Und wenn sein neuestes Werk El Manzanal heißt, aber weder pralle Kaffeefrüchte noch blühende Agaven, sondern ein glutäugiges Mädchen mit schwarzen Zöpfen zeigt, dann sagt mir das genug.«
»Das ist ja großartig!« Katharina bemühte sich, alle beklommenen Gedanken an Josefa und alle Sorgen um Miguel und ihren Mann zu verdrängen und sich für Augenblicke der Freude hinzugeben. »O Martina, ich finde, die zwei sind füreinander geschaffen – und bekommen sie nicht ein reizendes Gespann von Schwiegermüttern?«
»In der Tat«, bemerkte Martina. »Unsere zwei Turteltauben sind zu gut, um wahr zu sein, und sie bekommen die wildesten Schwiegermütter von ganz Mexico lindo. Was meinst du, Götterschwester, ist uns das noch einen goldenen Tequila wert?«
»Zwei, meine Temazcalteci, meine Göttin der heilenden Kräfte. Auf unsere prachtvollen Kinder – und wenn ich den zweiten getrunken habe, finde ich hoffentlich den Mut, dich zu fragen, was für Sorgen ich mir um Benito und Miguel machen muss.«
»Um Benito gar keine«, sagte Martina und gab diesmal den vollgeschenkten Becher Katharina zuerst. »Militärische Leiter, die den Gouverneuren auf die Finger sehen, setzt Diaz in allen Bundesstaaten ein, nicht nur in Querétaro. Ich gebe gern zu, dass Felipe Sanchez Torrija der schlimmste Schinder von allen ist, dass ich es hasse, seinen Pinkel von Sohn zum Nachbarn zu haben, und dass ich ebendiesen Sohn verdächtige, hinter der Verhaftung von Miguel zu stecken. Im Grunde aber sind diese Militärkommandanten überall gleich – Bleichgesichter mit manikürten Händen, die zu dem Land, das sie verwalten, keinerlei Verbindung haben. Diaz will damit die Selbstverwaltung der Staaten schwächen und mehr Macht auf sich selbst vereinen. Natürlich freut er sich über jeden Gouverneur, den er aus dem Amt drängen kann, aber er ist kein Dummkopf. Schon deshalb wird er sich hüten, sich in der Öffentlichkeit an einem Volkshelden wie Benito zu vergreifen.«
»Und im Verborgenen?« Katharina sog den Duft des Tequilas ein, um gegen die aufkommende Übelkeit zu kämpfen.
»Im Verborgenen mag er durchaus hoffen, ihn durch ständige Schläge auf das Rückgrat zu zermürben. Aber dein Liebster ist ihm zu zäh, und außerdem gibt es in der ganzen Regierung keinen Mann, der seine Familie so sehr liebt. Benito würde nichts tun, das euch gefährdet, und auch nichts, das ihn auf Dauer von euch trennt. Eher tritt er zurück.«
Katharina atmete auf. Die Wärme kehrte wieder, und aus der Grube stieg in dichten Schwaden der würzige Rauch der Barbacoa. Benito hatte es ihr geschworen. Sie hatte ihn angefleht, sie könne nicht noch einmal einen Mann ertragen, der für eine Sache starb, statt für sie und seine Kinder zu leben, sie hatte mit den Fäusten auf seine Brust eingetrommelt, und er hatte ihr geschworen, es könne niemals eine Sache geben, die ihm teurer wäre als ihr gemeinsames Leben. Weil sie ihn nicht umarmen konnte, schlang sie die Arme um ihre Knie. »Und was ist mit Miguel, Martina? Er sollte auch an seine Familie denken – seine Mutter hat nur den einen Sohn, und seine Frau erwartet sein Kind.«
Außerdem liebte Benito Miguel wie ein eigenes Kind. Der Junge hatte den Namen seines älteren Bruders erhalten, an dessen Tod er sich immer noch schuldig fühlte. Ebenso schuldig würde er sich fühlen, wenn Miguel, dem Jüngeren, etwas geschah.
Ohne Heiterkeit lachte Martina auf. »Wenn du mich fragst, ist Miguel kein Mann, von dem eine Frau sich ein Kind machen lassen sollte. Jedenfalls nicht, wenn sie Wert auf ihren Seelenfrieden legt. Er ist ein liebenswerter, begabter Bursche, aber er hat diese Art von Besessenheit an sich, die einen Mann zur Not in den Tod treibt – einerlei, wer seinen Kindern dann die Mäuler stopft und wer seine Witwe tröstet.«
»Zum Teufel, Martina, für ein paar unausgegorene Artikel kann ihm doch kein Todesurteil drohen!«
Martina trank Tequila und zuckte mit den Schultern. »Das wohl nicht. Aber die Deportation nach Yucatán durchaus. Inzwischen brauchen die Plantagenbesitzer für ihr Henequen und ihre Zuckerfelder so viele billige Arbeiter, dass sie sich um politische Häftlinge geradezu reißen. Und ob ich mich lieber von einem geübten Henker aufknüpfen oder von einem menschenverachtenden Geldsack in mörderischer Hitze zu Tode peitschen lassen möchte, weiß ich nicht.«
»Das ist nicht dein Ernst!«
Über den Rand des Bechers hinweg sah die Freundin sie an. »Nicht ganz«, sagte sie. »Ich denke, Miguel wird dank Benitos Fürsprache mit einem blauen Auge davonkommen. Aber wenn er in Zukunft nicht mehr Vernunft walten lässt, ist es das, was ihm droht: Die sengende Hitze von Yucatán und die Peitsche der Plantagenbesitzer, die dort unten niemand hindert, ihre Artgenossen schlimmer als Vieh zu behandeln. Und jetzt wechseln wir das Thema, einverstanden? Heute ist Josefas Tag, den sollten wir uns durch nichts verderben lassen. Ich denke, diese Barbacoa ist prächtig gelungen, selbst wenn ihr der Pfeffer fehlt. Was meinst du, machen wir Schwiegermütter uns auf den Weg und verwandeln uns für den Ball in zwei taufrische Rosen des Südens?«
Katharina lächelte ihr dankbar zu, nahm den Mörser und erhob sich. Auf der Veranda, wo Bar und Büfett aufgebaut werden sollten, hatten die jungen Frauen begonnen Girlanden aus Blumen in den Farben Mexikos aufzuhängen. Sie entdeckte Anavera, die ihrem Vater so ähnlich sah, dass es weh tat, und mit ihrer Base Elena in den hellen Tag lachte. Josefa sah sie nicht. Vermutlich saß sie noch immer im verschlossenen Zimmer der Mädchen und ließ niemanden zu sich. Schon als Kind hatte sie auf diese Weise manchmal für Tage geschmollt. Ich werde noch einmal versuchen mit ihr zu reden, beschloss Katharina. Für Miguel konnte sie jetzt nichts tun, aber Josefa würde sie vielleicht brauchen.
Außerdem wollte sie ihr an ihrem Geburtstag sagen, wie sehr sie sie liebte – notfalls sogar durch die geschlossene Zimmertür.
Im Gehen drehte Katharina sich noch einmal vom Haus weg und nach dem Hang, über den ein Pfad in ihr Tal führte. Die Sonne hatte das Gras darauf erbarmungslos zu Stroh gedörrt. Über diesen Hang wäre Benito gekommen, wenn Miguels Verhaftung ihn nicht aufgehalten hätte. Inzwischen verlief eine Eisenbahnlinie bis nach Santiago de Querétaro, doch von dort wäre er wie immer geritten, und Katharina hätte in der Senke gestanden und auf den Hufschlag seines Pferdes gewartet wie unzählige Male zuvor.
Gleich darauf, als hätte ihr Wunsch ihn beschworen, vernahm sie den ersehnten Hufschlag. »Benito«, entfuhr es ihr. Sie warf den Mörser zu Boden und sprang los, um wie ein Mädchen ihrem Liebsten entgegenzulaufen.
Martina erwischte ihren Arm und riss sie zurück. »Nur ein Briefbote, Süße«, murmelte sie und wies auf den Jungen mit der Schirmmütze, der auf einem kurzbeinigen Schecken über die Kuppe sprengte. Am Abhang zügelte er das Pferd und hob zum Gruß einen Brief in die Höhe. Katharina kam sich töricht vor.
Der war vermutlich ein Segenswunsch für Josefa von ihrer weitverzweigten Verwandtschaft, doch ihr Magen krampfte sich zusammen. Als der Junge sein Pferd vor ihnen zum Stillstand brachte, war es Martina, die ihm den Umschlag abnahm. »Er ist für die Señora«, beteuerte er eilfertig und wies auf Katharina. »Er wurde aus Chapultepec nachgeschickt, war bald ein Vierteljahr unterwegs.«
Martina hielt Katharina den Umschlag hin. Er war groß, aus schwerem Papier gefertigt und mit Amtssiegeln und Schriftsätzen übersät. Chapultepec, hallte es in ihren Ohren. In dem idyllischen Vorort der Hauptstadt, einst einem heiligen Ort der Azteken, hatte sie vor Jahren gelebt. Es war vielleicht die einsamste Zeit ihres Lebens gewesen, und dort, im Schatten der jahrhundertealten Kapokbäume, hatte sie Josefa empfangen. Katharina drehte den Umschlag um und las die halb verwischte Adresse. In den Zeilen erkannte sie nichts als einen einzigen Namen, aber der genügte. Ihr Herz begann ihr dumpf bis in die Kehle zu klopfen. Der Brief war ihr nicht nur aus Chapultepec nachgeschickt worden, sondern kam geradewegs aus ihrer Vergangenheit.
»Willst du ihn nicht aufmachen?«, fragte Martina. Sie gab dem Jungen einen Peso, und der wendete sein Pferd und ritt davon.
»Ich will nicht«, erwiderte Katharina mit fremder, tonloser Stimme. »Aber mir wird keine Wahl bleiben.«
»Von wem ist er denn?«
»Ich weiß nicht«, sagte Katharina und riss den Umschlag auf, ohne hinzusehen. »Und ich wünschte, ich bräuchte es nicht zu erfahren.«
Sie hatte es mit Josefa nie so leicht gehabt wie mit ihren anderen Kindern, sie hatte es nie geschafft, sich so tief und innig auf sie einzulassen, und jetzt erkannte sie den Grund dafür. In ihrem Inneren hatte sie sich beständig vor dem Tag gefürchtet, an dem jemand kommen würde, um ihr Josefa wegzunehmen. Sie hatte sich nicht umsonst gefürchtet. Der Tag war da.
3
Die meisten Gäste kamen aus der näheren Umgebung. Es waren Nachbarn von den umliegenden Ranchos, Freunde aus dem Dorf und ein paar Eltern von Kindern, die Anaveras Mutter unterrichtete. Denjenigen aber, die von weiter her, vor allem aus den Städten, angereist waren, verschlug das Schauspiel, das die Sonne vollführte, den Atem. Über dem Gipfel, der über die Kaffeebäume und die sich reckenden Agaven hinausragte, begann sie zu sinken und tauchte das Tal in ein rotviolettes Licht von einer Zartheit, die nicht mehr wirklich und irdisch, sondern paradiesisch schien. Alle Gesichter bekamen einen verklärenden Schimmer, einen Zauber, der noch über der Veranda, dem Tanzplatz und den geschmückten Tischen und Stühlen hing, als das Licht schon verflogen war und die Männer der Familie herumgingen, um in den Bäumen Lampions anzuzünden, ehe es völlig dunkel wurde.
Die leisen sich wiegenden Takte der Kapelle erschienen wie ein Echo des entschwindenden Lichts. Anavera sah die offenen Münder und die vor Staunen geweiteten Augen und war wieder einmal nichts als dankbar, an einem solchen Ort geboren zu sein. Hätte ein prophetischer Geist ihr einen Wunsch für die Zukunft gewährt, so hätte sie, ohne zu zögern, gebeten: Lass mich, solange ich lebe, auf El Manzanal bleiben, in unserem weißen Haus mit den grün gestrichenen Türen.
Zwischen die Platten und Schüsseln mit den Speisen streute sie gelbe Blüten der Cempoalxochitl, dann trat sie einen Schritt zurück und betrachtete ihr Werk. Sie hätte zufrieden sein sollen. Das mit Blumen und Kerzen geschmückte Büfett wirkte festlich und einladend, und die Düfte, die sich in der Abendwärme mischten, überwältigten sie. Alles war in Fülle vorhanden, das geröstete Lamm der Barbacoa, die in seinem Rauch gegarte Suppe, Tortillas und Tamales aus goldenem Maismehl, die ihre Tante Xochitl in Stapeln gebacken hatte, Chilischoten in Walnusssauce, mit Epazote gewürzte Bohnen, Salat aus Kaktusblättern, gefüllte Chayotes, dreifarbiger Reis, Buñuelos mit Anis und klebrigem Sirup, kandierte Tamarinde und die köstliche Mole Poblano aus der dunkelsten Schokolade. Ihre Mutter hatte auftragen lassen, was der Rancho zu bieten hatte. Sie wusste, dass etliche ihrer Nachbarn am Nötigsten sparten, weil sie um ihre Ernte fürchten mussten, und umso lieber lud sie sie an ihren reich gedeckten Tisch ein.
Doch so schön die vielfarbige Tafel im Licht der Kerzen auch wirkte und so lockend die Musik herüberdrang, konnte Anavera sich nicht recht daran freuen. Sie wusste, die bunt gewürfelten Speisen aus den Früchten ihres eigenen Landes waren nicht, was Josefa sich vorgestellt hatte. Bauerngerichte. Einfaches Essen, wie es die Nahua des bergigen Hinterlandes seit Jahrhunderten zubereiteten. Eine Schar Schüler ihrer Mutter, die froh waren, sich beim Servieren etwas Geld zu verdienen, füllten aus tönernen Kannen einheimischen Rotwein und Pulque, das schaumige Getränk aus dem Mark der Agave, das den Bauern ihren Alltag erleichterte, in Becher. Es gab keinen Champagner, keine erlesenen Weine aus Europa, und das einzige fremdländische Gericht war der misslungene Hamburger Apfelkuchen ihrer Mutter. Die Musiker, die ihre Geigen und Gitarren, die Trompete und das Akkordeon jetzt mit Verve ins Crescendo führten, spielten eine Weise aus Querétaro, die zum Klatschen, Springen und Johlen einlud, keinen vornehmen Gesellschaftstanz aus den Salons von Paris.
Anavera, die all das liebte, tat das Herz weh um ihre Schwester. Mit Feuereifer hatte die Familie eine Fiesta für das Kind wohlhabender Rancheros bereitet. Josefa aber, die viel zu zart und schön und kultiviert für die rauen Bräuche des Landes war, träumte von einem Ball für die Tochter des Gouverneurs. Sie hatte schon die Enttäuschung wegen des Vaters zu verkraften, und das, was sie hier erwartete, würde ihrer Stimmung nicht aufhelfen. An der Traufe des Vordachs hing eine gigantische, mit Zuckerzeug gefüllte Piñata. Kinderkram, würde Josefa sagen. Und aus ihrer Sicht hatte sie damit natürlich recht.
Hinzu kam, dass die Heiterkeit der Familie gespielt war. Niemand wollte Josefa ihren Tag verderben, aber unterschwellig brodelte die Sorge um Miguel. Er war der Sohn ihrer Tante Carmen, das älteste der auf dem Rancho geborenen Kinder. Für Anavera, die sechzehn Jahre jünger war, war er eine Art großer Bruder, der sie Reiten und Fischen gelehrt hatte und an dessen Hand sie zum ersten Mal durch einen Tanz gestolpert war. Ihre Base Elena zupfte sie am Ärmel, als könnte sie Gedanken lesen. »Wir helfen Miguel nicht, wenn wir Trübsal blasen, Ana. Lass uns doch gehen – die anderen tanzen ja schon!«
Unter dem Rock des neuen Kleides war Elena anzusehen, wie ihr die Musik in den Beinen pulsierte. Ungeduldig trippelte sie von einem Fuß auf den anderen, und verblüfft bemerkte Anavera, dass es ihr nicht anders erging. Ja, sie wollte tanzen, wollte dieses Fest genießen, die Nacht, die sternenhell sein würde, und den verwirrenden Duft des Sommers. Aber war das gerecht? Miguel saß im Belem-Gefängnis, von dem Tomás erzählt hatte, dass die Zellen weder Licht noch Fenster hätten und die Häftlinge zu Dutzenden zwischen die schimmligen Wände eines einzigen Raums gepfercht würden. Und Josefa, die Hauptperson dieser Festnacht? Auf einem Tisch bei der Kapelle standen ihre Geschenke aufgebaut, doch die Schwester war nicht heruntergekommen. Das rote Kleid, das sie sich aus einem Pariser Modemagazin ausgesucht hatte, würde leer und schlaff vor ihrem Schrank hängen.
Wie konnte Anavera sich amüsieren, wenn es doch Josefas Fest war und Josefa sich die Seele aus dem Leib weinte?
»Wenn du nicht kommst, dann gehe ich ohne dich!«, rief Elena und wies auf die Tanzfläche, wo die Jugend der Gegend sich paarweise zum Kreis stellte, um einen Vals mexicano zu tanzen. Beinahe ein europäischer Tanz – und einer, dem selbst Josefa kaum je widerstand. Ein einzelner junger Mann drückte sich in der Reihe herum und winkte zu ihnen hinüber. Acalan, der schlaksige, schüchterne Sohn eines Pächters, an den Elena ihr Herz verloren hatte. Die Base warf Anavera einen sehnsüchtigen Blick zu. »Geh schon«, rief Anavera schnell. »Ich warte auf Josefa.«
»Willst du warten, bis du schwarz wirst?«, fragte Elena, mit einem Fuß bereits auf der Stufe der Veranda.
Anavera schüttelte den Kopf. »Sie wird schon kommen. Du lauf, lass dir den Vals nicht entgehen – und deinen Acalan erst recht nicht.«
Elena warf ihr einen dankbaren Blick zu, sprang die Stufe hinunter und eilte ihrem Liebsten entgegen. Der junge Mann, der aus ärmsten Verhältnissen stammte, wagte nicht, offen um die Nichte des Gouverneurs zu werben, und so blieben die Augenblicke, die Elena sich mit ihm stehlen konnte, seltene Kostbarkeiten. Mit einem machtvollen Schrammeln der Geigen und einem Trompetensignal begann der Tanz. Die jungen Leute, die die Becher mit Wein und Pulque gefüllt hatten, zogen mit ihren Tabletts los, um den Gästen Getränke anzubieten, und Anavera blieb allein auf der Veranda zurück. Jetzt komm schon herunter, beschwor sie Josefa stumm. Die Nacht ist so schön, und alle haben sich so viel Mühe gegeben. Warum gibst du uns eigentlich nie die Chance, dir zu zeigen, dass wir dich mehr als alles andere lieben?
Im tanzenden Licht der Lampions sah sie einen Schatten, der auf die Veranda zuschoss und sich geschmeidig wie ein Berglöwe über die hölzerne Balustrade schwang. Gleich darauf stand Tomás vor ihr, so dicht, dass sie spürte, wie sein Körper vor Erregung bebte. Sein goldbraunes Haar fiel ihm ins dunkle Gesicht, und als er es unwirsch in die Höhe blies, fiel es gleich wieder hinunter. So war Tomás. Immer berstend vor Leben. Er legte die Arme um sie.
»Weshalb will denn mein Armadillo nicht tanzen? Was ist ein Fest wert, wenn das süßeste Tierchen sich in seinem Bau verkriecht?«
Sie musste lachen. Er nannte sie Armadillo, seit sie Kinder waren. Damals war sie pummelig gewesen und hatte sich, zumindest behauptete er das, in der watschelnden Gangart eines Gürteltiers bewegt. »Ich will auf Josefa warten«, sagte sie und lehnte sich an seine Brust. »Meinst du nicht, es würde sie noch wütender machen, wenn ich mich auf ihrem Fest vergnüge, während sie es versäumt?«
Tomás küsste ihr den Scheitel. »Josefa zwingt aber niemand, ihr Fest zu versäumen«, entgegnete er. »Weißt du eigentlich, dass du von klein auf damit beschäftigt bist, Josefa vor irgendetwas zu bewahren, was sie sich selbst antut? Und dass du dafür auf alles Mögliche verzichtest? Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt nicht nach Josefas Pfeife tanzt, Armadillo. Und sosehr ihr es euch wünscht, weder du noch dein Vater könnt die Welt dazu zwingen.«
»Aber es macht mir gar nichts aus, auf sie zu warten«, protestierte Anavera.
»Dir vielleicht nicht«, sagte er. »Mir hingegen schon. Ich will mit dir tanzen. Zählt das, was ich will, vielleicht nichts?«
»Doch natürlich«, rief sie und hob die Hand, um ihm das Haar aus dem Gesicht zu streichen. »Aber wir können doch noch hundert Jahre lang tanzen. Es kommt mir einfach so ungerecht vor – ich habe es immer leicht, und Josefa hat es immer schwer.«
»Schluss jetzt mit Josefa!« Um seine Mundwinkel verkroch sich ein Lachen, doch das Blitzen in seinen Augen war echt. »Sie hat es schwer, weil sie es sich schwermacht, und wenn mir heute Abend jemand leidtut, dann nicht sie, sondern mein Freund Miguel. Aber wäre er jetzt hier, so würde er sagen: Heute Nacht kannst du nichts für mich tun, Compañero. Also trink auf mein Wohl einen Becher Wein und tanz mit deinem Armadillo.«
»Ja, du hast recht, das würde er wohl sagen. Er kommt doch bald wieder frei, nicht wahr?«
Sachte löste Tomás sich von ihr und füllte an der Bar zwei Becher mit Wein. »Dafür werden wir kämpfen«, meinte er dann. »Und dafür, dass die Freiheit der Presse gewahrt bleibt, wie unsere Verfassung es uns garantiert.«
»Wir, Tomás? Was hast denn du damit zu tun?«
»Nun, ich weiß, ich bin nur ein kleiner Kunststudent und kein gewichtiger Politiker«, erwiderte er in leicht gekränktem Ton, »aber meine Freunde und die Verfassung meines Landes kann ich trotzdem verteidigen, oder? Auf meine Weise habe auch ich mein Scherflein dazu beizutragen, dass Leuten wie diesem Sanchez Torrija das Handwerk gelegt wird, ehe sie zerstören, wofür unsere Eltern gekämpft haben.«
»Sanchez Torrija, wer ist das überhaupt?«, fragte Anavera. »Jeder redet von ihm und sagt, er wolle meinem Vater ans Leder, aber mehr als vages Gemunkel höre ich von niemandem.«
»Kein Wunder.« Tomás verzog den Mund und reichte ihr einen der Becher. »Wer weiß schon mehr als Gemunkel vom Teufel? Felipe Sanchez Torrija ist einer dieser märchenhaft reichen Großgrundbesitzer, auf deren Vermögen sich Diaz’ Regierung stützt. Das Schlimme ist, dass es ihm nicht genügt, vor Geld zu stinken und auf seinen Plantagen in Yucatán überschuldete Maya zu schinden, sondern dass er obendrein politische Ambitionen hat. Er hat von Diaz ein militärisches Kommando gefordert, ohne je in der Armee gekämpft zu haben, und Diaz hat ihn nach Querétaro versetzt, um seinem Lieblingsfeind einen Hieb zu verpassen. Wenn er deinen Vater schon nicht kaltstellen kann, will er ihm wenigstens einen Bluthund vor die Haustür setzen, der ihn in Schach hält.«
»Macht es dir Angst?«, fragte Anavera.
Tomás schüttelte den Kopf. »Es macht mir eine Wut im Bauch, von der mir übel wird. Und dass Don Felipe für sein Söhnchen das Palais neben unserem gekauft hat, macht es noch schlimmer, weil ich diesen arroganten Parasiten jeden Tag vor Augen habe. Wir vermuten, dass er es ist, der der geheimen Zensurbehörde vorsteht, und dass er Miguel wegen des Artikels angezeigt hat. Wenn ich daran denke, bekomme ich allerdings Angst – vor mir selbst. Einmal habe ich schon geträumt, ich hätte den verdammten Lagartijo erwürgt.«
Anavera stellte den Becher beiseite und umklammerte Tomás’ Gelenke. »Erwürge ihn nicht, versprich mir das. Ich habe keine Ahnung, warum du ihn einen Lagartijo nennst, aber eine kleine Eidechse ist es nicht wert, dass du vor einem Erschießungskommando endest. Und Miguel kommt dadurch auch nicht frei.«
»Versprochen, ich erwürge ihn nicht«, beteuerte Tomás. »Aber ich muss morgen in die Hauptstadt zurück, um zur Stelle zu sein, wenn Miguel mich braucht. Er ist mein Freund, ich bin es ihm schuldig. Deshalb will ich heute Nacht von dir etwas anderes als Palaver über Politik. Etwas, das ich mitnehmen und bei mir tragen kann, wenn ich es nötig habe. Wirst du es mir geben, Armadillo?«
Anavera nickte. Eine seltsame Traurigkeit überfiel sie. Nur Josefa wurde heute erwachsen, aber ihr war zumute, als ginge ihrer aller Jugend mit einem Schlag zu Ende.
»Nimm den Becher«, sagte Tomás. »Sieh mir beim Trinken in die Augen und wisch dir die Lippen nicht ab.«
Sie tat, wie ihr geheißen, und er wischte sich die Lippen auch nicht ab, neigte leicht den Kopf und küsste sie. Er hatte sie oft geküsst, doch noch nie auf den Mund. Der Kuss fühlte sich federweich an und so zärtlich wie nichts zuvor. Er sandte einen Schauder durch ihre Kehle, und er schmeckte nach dem fruchtigen Wein. Auf einmal hörte sie die Musik wieder, die schmeichelnden Bögen der Geigen und die Trompete, die nach ihr zu rufen schien.
»Ich will, dass du mit mir tanzt«, sagte Tomás mit rauer Stimme und schloss die Arme um sie.
Anavera wollte mit ihm tanzen. Sich ganz der Musik hingeben, der vertrauten Zärtlichkeit und dem Weingeschmack seiner Lippen.
»Ich will noch mehr, Armadillo«, murmelte er an ihrem Ohr, während er sie langsam in Richtung der Stufe dirigierte.
»Was?«
»Ich will, dass du mir sagst, ob du mich liebst.«
Ihr Herz vollführte einen Sprung. »Und wie!«, entfuhr es ihr, weil ihre Liebe im Schwall über sie herfiel. Sie hatte ihn ja immer geliebt, er war ihr so nah wie ihr Bruder Vicente, der mit einem Mädchen namens Chantico tanzte, aber er war nicht ihr Bruder, sondern jemand, nach dem sie sich in Nächten, die zu warm zum Schlafen waren, sehnen konnte. Er gehörte zu ihr. So wie ihr Vater, ihre Mutter, ihr Bruder und ihre Schwester, so wie die Freundinnen und Großmutter Ana, deren Tod im Winter ein Loch in ihr Leben gerissen hatte.
»Sag es mir, Armadillo. Sag: Tomás, ich liebe dich.«