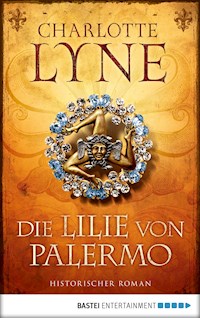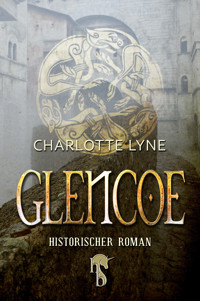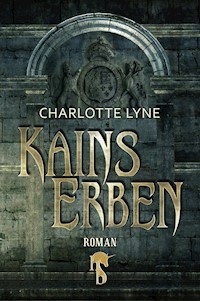6,99 €
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Berlin 1912. Die junge Bankierstochter Felice tut alles für ihren großen Traum: Sie will Jura studieren, Anwältin werden und für Gerechtigkeit kämpfen – alles Dinge, die einer Frau in der festgefahrenen Enge des Kaiserreichs verwehrt bleiben. Felice aber gibt nicht auf, und ihre Geschwister Ille und Willi, die um eigene Träume kämpfen, unterstützen sie. Nicht einmal ihrer aufflammenden Liebe zu dem Journalisten Quentin gestattet Felice, ihre Pläne zu durchkreuzen – dann aber bricht der Erste Weltkrieg aus, und die Sturmflut des Grauens reißt alle Pläne mit sich fort. Erst als das Entsetzen des Krieges endlich ein Ende findet und aus den Trümmern des alten Europa zaghaft ein neues den Kopf hebt, wagt Felice von Neuem zu hoffen – für sich selbst, für ihre Familie und auch für ihre Liebe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 787
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Charlotte Lyne
Was wir zu hoffen wagten
Historischer Roman
Für Raúl,zur Erinnerung an »Pop and Wipers«,und an Scottie Brown-Brown und Godelievein Vertretung für all die anderen.
Dem Bürger fliegt vom spitzen Kopf der HutIn allen Lüften hallt es wie Geschrei,Dachdecker stürzen ab und geh’n entzwei,Und an den Küsten – liest man – steigt die Flut. Der Sturm ist da, die wilden Meere hupfen,An Land, um dicke Dämme zu zerdrücken.Die meisten Menschen haben einen Schnupfen.Und Eisenbahnen fallen von den Brücken.Jakob van Hoddis:Weltende
Vorspann
Berlin 1918Der neunte NovemberDie Zeit ist aus. Jetzt kommen wir –Die andern, die andern.Kurt Tucholsky
1
Über der Stadt hing ein Himmel aus Eisen. Darunter aber, in den Schluchten zwischen den Häusern, gerieten Ströme in Bewegung, die nichts und niemand hätte aufhalten können. Flüssiges Blei. Wen diese Wogen aus Menschen erfassten, den rissen sie mit, und was immer sie niederwalzten, konnte sich unmöglich wieder erheben.
Hier, hinter dem Hochbahnhof Prinzenstraße, wo sich eine Fabrik an die andere reihte, füllten die Straßen sich im Handumdrehen. Felice, die sich anders als ihre Geschwister nichts aus Kino machte, hatte das Gefühl, in einem Film zu sitzen, der durch Tricks mit der Technik für unwirkliches Grauen sorgte: Beim Anblick der endlosen Kolonnen, die aus Türen, Toren und Portalen quollen, fiel es schwer zu glauben, dass die Stadt so vielen Menschen Platz bot, geschweige denn, dass ihr die jungen Männer fehlten, dass unzählige nicht zurückkommen würden.
Hatten all diese Leute – aus den Stahlgießereien, den Pulverfabriken – ihre Arbeit niedergelegt? Standen jetzt wahrhaftig die Räder des gewaltigen Mahlwerks, der Kriegsmaschinerie still?
Felice versuchte, sich durch die wogende Masse zum Eingang des Fabrikhofs durchzuschlagen, wo Recha in der Wohnung, die ihr Liebhaber ihr eingerichtet hatte, noch immer hauste. Ihr Atem ging keuchend. Vom Savignyplatz bis hierher war sie ohne Pause gerannt, während Bilder an ihr vorbeifluteten: Menschen, die alles stehen und liegen ließen und aus Häusern, Hallen und Fabriken, aus Geschäften, Schulen und Lokalen auf die Straßen eilten. Seit Wochen hatten sie starr vor Spannung auf ihre Nachricht gewartet – war sie an diesem Morgen endlich eingetroffen?
Selbst wenn es so war, stand Felices Nachricht noch immer aus, und in ihrer Bauchhöhle rumorte blanke Angst.
Gesichter glitten an ihr vorüber, leichenblass, ausgemergelt, die Augen in Höhlen. Zwischen Köpfen blitzte das Rot von Fahnen, die feuchter Wind zum Knattern brachte. Felice hatte sich bis zur Litfaßsäule vorgekämpft, wo Zeitungsjungen ihre Blätter anpriesen, als sie Recha in einem Schwall von Fabrikarbeitern auf sich zutreiben sah.
»BZ am Mittag«, brüllte ein drahtiger Bursche ohne Mütze, »schneller weg als warme Semmeln. Schnappt euch eene, oder wollt ihr eure Zukunft verpennen? Der Kaiser hat abjedankt!«
»Recha!« Felice schrie, dass ihr die Lungen schmerzten. Groß genug war sie. Wenn sie sich reckte, hallte ihr Ruf über Köpfe hinweg. »Recha, warten Sie, ich muss mit Ihnen sprechen!«
Im Gegensatz zu Felice war Recha klein und kompakt. Ihr Kopf mit den dichten, in sämtliche Richtungen strebenden Locken tauchte alle paar Schritte in der Menge unter. Würde mit ihr zu reden sein, so vertrackt die Dinge auch zwischen ihnen standen? Sie mochten sonst nichts gemeinsam haben, doch sie waren beide Schwestern. Ältere Schwestern, denen irgendwann einmal eingeschärft worden war, auf ihre kleinen Brüder zu achten.
Felice, halt Wilhelm an der Hand! Das Kindermädchen ist eine Schlampe, wenn dem Kleinen etwas zustößt, ist es deine Schuld.
Recha würde das kennen. Sie musste um Gabriel gebangt haben, wie Felice um Willi bangte, und wenn sie Nachricht von ihm hatte, würde sie nicht so grausam sein, sie ihr vorzuenthalten.
Alle hier haben Brüder, durchfuhr es Felice. Alle Frauen. Und wer keinen Bruder hat, hat Väter, Söhne, Bräutigame, ist Witwe, bevor sie verheiratet war. Wir sitzen im selben gottverdammten Boot, aber wie so oft habe ich nichts davon bemerkt. Wind zerrte an ihrem Haar und ihr Gedankenfluss stockte. Außer ihr schien jeder jemanden bei sich zu haben, der ihn bei der Hand nahm oder ihm den Arm zum Unterhaken reichte. Allein war nur Felice, die still und in verkehrter Richtung stand.
»Ebert ist Reichskanzler!«, schrie der Junge bei der Säule. »Gerade erst aus der Reichskanzlei verkündet, und die BZ ist wie immer mittenmang dabei!«
Quintus’ Zeitung, dachte Felice. Sein Blatt für Schweinehirten. Die BZ am Mittag rühmte sich, die schnellste Zeitung nicht nur des Deutschen Reiches, sondern der gesamten Welt zu sein. Noch in der letzten Viertelstunde vor Beginn des Straßenverkaufs könnten Nachrichten eingearbeitet werden, hatte Quintus behauptet.
»Wie soll denn das machbar sein?«, hatte Felice dagegengehalten. »So schnell arbeitet doch kein Setzer.«
Selbstgefällig hatte Quintus gegrinst. »Moderne Technik wirkt eben Wunder. Eines Tages werden wir schnell genug sein, von Ereignissen zu berichten, noch ehe sie überhaupt geschehen sind.«
»Habt ihr Bohnen inne Ohren?«, brüllte der Junge an der Säule. »Der Kaiser hat sich vom Acker jemacht, ihr Trantüten.«
Felice reckte sich, um Recha im Gewimmel wiederzufinden. Sie waren höchstens noch fünf Schritte voneinander getrennt, doch in dem Abstand quetschten sich Menschenleiber. Zwischen hüpfenden Köpfen sah sie Rechas Gesicht jetzt deutlich. Es war von Kälte gerötet, herzförmig und so lieblich, dass der Blick sich anschmiegen wollte, während der Lauf der Welt weiterhastete. Rechas schläfriger Liebreiz verblüffte. Auf der Leinwand verkörperte sie zerrissene Frauengestalten in düsteren, wüsten Dramen, die über ihre Zeit hinauswiesen.
Ihre Blicke trafen sich. Die Farbe von Rechas Augen ließ sich auf die Entfernung so wenig erkennen wie im Schwarz-Weiß eines Kinofilms, und doch schwärmte das filmbegeisterte Berlin davon: Recha Süßapfels Augen schillern wie Moorseen, sie sind genauso tief und nicht minder gefährlich. Felice hatte keine Ahnung, wie tief Moorseen waren. Sie hatte den Reiz von Rechas Augen für gefährlich gehalten, doch in diesem Moment war sie nichts als froh, dass die andere da war – eine, die ihr nicht fremd war, die erfassen würde, welche Angst ihr die Kehle zuschnürte.
Eine, die ich kannte, als wir noch stark und voll Hochmut und vollzählig waren, die von dem Leben weiß, das wir geführt haben oder das wir hätten führen wollen. Von all den Träumen, von Hoffnung und Dummheit. Von uns.
In der Straßenmitte gab es kein Durchkommen. Felice hob die Hand und wies nach der Linken, stieß mit dem Ellenbogen einen Mann beiseite und boxte sich in Richtung Gehsteig weiter. Recha begriff und begann, sich in dieselbe Richtung ihren Weg zu bahnen. Am Rand, bei der Häuserwand blieb eine schmale Rinne frei von Menschen. Dort standen sie still, an die Mauer gepresst und so dicht voreinander, dass ihre Atemwolken sich vermischten.
»Recha.«
»Ja, so heiß’ ich.« Rechas Blick, der sich nicht beirren ließ, hatte Felice von je her irritiert.
Die Worte entglitten ihr: »Bitte helfen Sie mir. Ich habe solche Angst.«
»Um Willi?«
Felice nickte. »Seit der Verhaftung sind wir ohne Nachricht. Es ist nicht gerecht. Willi ist so …«
»Jung«, beendete Recha ihren Satz. »Das habe ich von Gabriel auch gedacht. Von uns allen. Selbst von denen, die alt sind: Wir sind zu jung.«
Felice öffnete den Mund, doch dann schwieg sie. Sie hatte auffahren wollen, man könne einen Jungen, der vier Jahre Gemetzel überlebt hatte, nicht dafür umbringen, dass er das Metzeln leid war. Die Worte aber waren allzu naiv, sie hätten zu ihrer Schwester Ille gepasst, nicht zu ihr. Wenn die vier Jahre sie nicht gelehrt hatten, dass zwischen Recht und Gerechtigkeit Abgründe klafften, dann verfolgte sie das falsche Lebensziel. Sie musste sich an die Gesetzeslage halten, musste erreichen, dass kein Standgericht, sondern eine gründliche Untersuchung stattfand.
»Ich habe auch keine Nachricht«, sagte Recha. »Aber ich treffe mich vor dem Reichstag mit Curt Birnbaum. Wenn Sie wollen, kommen Sie mit.«
Birnbaum war Kriegsberichterstatter, nicht für Messters Woche, die Aufnahmen von vorderster Front allwöchentlich auf Kinoleinwänden präsentierte, sondern für irgendwelche unbekannten Zeitschriften. Ob er wie Quintus süchtig nach Gefahr war, süchtig nach Bildern, die sonst niemand festzuhalten wagte, wusste Felice nicht. Sie kannte ihn kaum. Er gehörte zu Wolfgangs und Rechas Bekannten, zu dem Kreis, in den Willi eingetaucht war, als wäre er nie als Sohn der Bankiersfamilie zur Nieden aufgewachsen. Vielleicht war ich neidisch, dachte Felice. Vielleicht habe ich Recha und ihre Leute abgelehnt, weil ich nicht aushalten konnte, dass mein kleiner Bruder sich die Fesseln so viel gründlicher abschütteln konnte als ich.
»Birnbaum war in Kiel?«, fragte sie.
Recha nickte. »Er hat mich angerufen. Gestern Abend. Wir wurden mitten im Gespräch unterbrochen, weil aller Telefonverkehr unterbrochen wurde.«
»Sie haben Telefon?«, entfuhr es Felice. In der Reichshauptstadt kam auf zwanzig Menschen nicht mehr als ein Anschluss und die Inhaber waren Bankiers wie ihre eigene Familie, Unternehmer, wohlhabende Bürger, keine Schauspielerinnen, die auf Kreuzberger Fabrikhöfen hausten.
»Dafür hat Wolfgang gesorgt.« Abrupt senkte Recha den Kopf. »Für alles. ›Du bist beim Film‹, hat er gesagt, ›du musst ans Fernsprechnetz. Wenn jemand eine Hauptrolle zu besetzen hat, musst du die Erste sein, die er erreicht.‹«
Die Menge scherte zu beiden Seiten aus, weil ein Krümperwagen die Straße hinunter zockelte. Der Gaul, der ihn zog, war ein klappriges Gerippe, das in den Sielen hing und kaum die Hufe hochbekam. Obenauf drängten sich Soldaten, die meisten blutjung wie Willi. Manche riefen und winkten mit Mützen, aber kaum einer lachte. Es gab keinen Überschwang, in den düsteren Mienen keine Spur von Freude.
Das waren die Männer, die zurückkamen. Vielleicht hatten sie gehofft, in diesen Straßen die Heimat zu finden, nach der sie sich gesehnt hatten. In Wahrheit aber hatten sie sich nach keinem Ort, sondern nach einer Zeit gesehnt, und diese Zeit existierte nicht mehr.
»Der Kaiser hat abjedankt«, brüllte der Junge von der BZ am Mittag schon wieder. Das Alte war fort. Aber wie sah das Neue aus, das jetzt kam?
Felice und Recha wurden vom Gewicht der Menschenleiber gegen die Hauswand gedrückt. Erst als der Wagen vorbeigerumpelt war und die Menge sie freigab, blickte Recha auf. »Ich muss weiter. Sonst verpasse ich Birnbaum.«
Ehe Felice zu einer Antwort kam, hatte Recha sich wieder dem Strom angeschlossen, auf dem ihr Kopf wie eine Boje davontrieb. Felice hatte Mühe, Anschluss zu halten. Während sie sich vorankämpfte, stiegen vor ihr Bilder vom Tag der Mobilmachung auf, als sie sich ebenso durch eine Menschenmenge ihren Weg gebahnt hatte. Damals war August gewesen, die Luft vor Hitze flimmernd, heute war November, die Wolken schwer vor Feuchtigkeit. Damals hatten die Ströme aus Männern bestanden, die Felice wie Kinder vorgekommen waren, heute wimmelte die Stadt von Frauen, und selbst die Kinder hatten etwas Altes.
»Zu Weihnachten in Paris«, hatten die Männer mit den Kindergesichtern gegrölt, sie hatten die Kaiserhymne gesungen, die Wacht am Rhein und Lieder von Filip von Schlei. Heute war kein Grölen und kein Singen zu vernehmen, nur das Trampeln von Schritten und hier und da eine Stimme, die vor Kälte rau eine Parole rief.
Der Verkehr schien bis auf die müden Militärfuhrwerke lahmgelegt. In der Wilhelmstraße, dem Regierungsviertel, das manche das Hirn der Hauptstadt nannten, hatten Soldaten einen Bierwagen in den Rinnstein gezerrt und saßen reglos, Gewehre im Anschlag, obenauf. In ihren Gesichtern stand Hunger. Hatten sie erwartet, an Tafeln empfangen zu werden, die sich unter Aal grün und Gurkensalat, Schrippen mit Hackepeter und Schweineohren bogen? Berlins Bewohner, selbst die, die Geld hatten, lebten im vierten Winter von Eintopf aus Steckrüben und einem halben Hering für den Freitag. Die hatten nichts abzugeben. Denen stand derselbe Hunger in den Gesichtern geschrieben wie denen auf dem Wagen.
Die Fassaden der Regierungsgebäude wirkten abweisend, die Fenster dunkel, ausgestorben. Lebendig gebärdeten sich nur die Zeitungsjungen: »Schluss mit dem Alten! Der Kaiser hat abjedankt!«
Entsprach das der Wahrheit? Wenn es tatsächlich gelungen war, den Kaiser zu diesem noch eben nicht einmal denkbaren Schritt zu bewegen, war die Bedingung der Amerikaner erfüllt. Auf seinem blutigsten Höhepunkt war der Krieg zum Stillstand gekommen. Wie konnte dann noch ein Mann dafür erschossen werden, dass er aufgehört hatte zu kämpfen?
Scharfer Wind trieb Felice ins Gesicht. Diese Frage gehörte in ihr Metier, sie war zu sehr zu Hause darin, um sich etwas vorzumachen. Als ihr Bruder Willi zu kämpfen aufgehört hatte, war der Kaiser noch der Kaiser gewesen und die Heeresleitung hatte keinen Frieden, sondern mit der gesamten Hochseeflotte noch einmal eine Entscheidungsschlacht gegen Britannien gewollt. Willi war kein Soldat, der nach Hause ging, weil der Krieg zu Ende war. Willi war ein Soldat, der einen Befehl verweigert hatte. Ein Deserteur, auf dessen Vergehen standrechtliches Erschießen stand.
Felice schob sich weiter, um zu Recha aufzuschließen. Über Schultern hinweg streckte sie die Hand aus, als wäre die Menschenmenge tatsächlich ein Meer und Rechas Lockenfülle ihr Rettungsseil. Sie, Felice, der es immer das Wichtigste gewesen war, keiner Gattung einverleibt zu werden, keine kleinadlige Bankierstochter oder preußische Protestantin, sondern nur sie selbst zu sein, sehnte sich auf einmal danach, zu einer Gruppe zu gehören, nicht allein von dem Strudel erfasst zu werden, der Vertrautes fortschwemmte. Auch wenn außer ihr nur noch Recha von dieser Gruppe übrig war.
Im Laufen drehte Recha sich um, lief ein paar Schritte rückwärts und hielt mit ihrem Blick den von Felice fest. Dann wandte sie sich wieder nach vorn. Der Zug nahm die Breite der Straße ein. Felice sah Menschen bis zur Kreuzung, wo sie in die Prachtstraße Unter den Linden eintauchten, dem Pariser Platz mit dem Brandenburger Tor entgegen.
»Wohin wollen die alle?«, schrie sie und kam sich dümmlich vor, ignorant wie die Prinzessin hinter dem Mond, als die sie ihre Schwester Ille verspottet hatte.
Recha drehte sich nicht noch einmal um. Stattdessen wandte ein Mann den Kopf, ein langer Lulatsch in zu dünner Joppe. Felice zwang sich, vor seinem Gesicht nicht zurückzuschrecken. Es war wie Gabriels Gesicht. In Trümmer zerfetzt und zusammengeflickt, lebendig, doch nicht länger menschlich. »Zum Reichstag«, sagte der Mann. Die Fratze des Grauens verzog sich zu etwas, das ein Lächeln gewesen sein mochte. Ein Tag fiel Felice ein, ein längst vergangener Morgen, Frühsommer Vierzehn am Spreeufer, als sie mit Quintus darüber gestritten hatte, welche Bedeutung dem Geschenk eines Lächelns zukam.
Und wenn man keines mehr zu verschenken hatte? Sie wollte die Ruine eines Lächelns erwidern, brachte ein klägliches Zucken zustande und war heilfroh, als der Mann sich abwandte. Unter ihren Mantel kroch ein Frösteln, vielleicht mehr vor Angst als vom Wind. Felice riss sich zusammen und stieß endlich zu Recha vor. Sie hatten die Kreuzung erreicht und bogen nach Unter den Linden ein.
Auch die Prachtstraße war, so weit das Auge reichte, mit Menschen gefüllt. An den Rinnsteinen reihten sich Fahrzeuge, auf denen Soldaten postiert waren. Es gab Frauen, die an Aufschlägen und Uniformlitzen sämtliche Regimenter erkannten, doch Felice war keine von ihnen. Dennoch glaubte sie, an einer Gruppe von Pickelhelmen die Sterne der Garderegimenter auszumachen.
Es musste ein Irrtum sein. Wenn die Garde aufmarschiert war, des Kaisers viel gerühmte Elite, wäre sie ja wohl eingeschritten und hätte das Feuer auf die Menge eröffnet. Aber nichts rührte sich, keine Hand, kein Lauf. Die Krakeeler von der BZ mussten recht haben: Hier herrschte kein Kaiser mehr, zog keine Heeresleitung die Zügel straff.
Damit Recha ihr nicht entglitt, griff Felice nach ihrem Arm, erwischte den weichen Pelz ihres Mantels und krallte sich darin fest. »Hat Ihnen Birnbaum etwas gesagt?«, rief sie keuchend. »Hat er Willi gesprochen, ist er gesund, wird er ordentlich behandelt?«
»Ich weiß nichts«, gab Recha zurück. »Wie gesagt, das Gespräch wurde unterbrochen. Wir hatten gerade noch Zeit, uns bei Habel zu verabreden.«
»Bei Habel? In der Destille?«
»Vermutlich eher vor der Tür.« Recha schwenkte den Kopf in Richtung der Massen. »Samstags ist bei Habel kein Platz zu bekommen, selbst wenn nicht gerade die Revolution ausbricht. Heute wird dort vermutlich gar nicht serviert.«
Eine Zeit lang wurde es zu laut, sich zu verständigen. Vor ihnen ragte das Brandenburger Tor auf, durch dessen mittlere Durchfahrt allein die kaiserliche Familie fahren durfte. Die Quadriga, die von Krieg zu Krieg zwischen Berlin und Paris hin und her geschleppt worden war, stand vor dem dunklen Himmel wie in eine Münze geprägt. Was war jetzt, wo Deutschland den großen, den alles niederwalzenden Krieg verloren hatte?
Wir nicht, dachte Felice. Wir können den Krieg nicht verloren haben, Frauen, Kinder, Jungen wie Willi, die keine Ahnung hatten. Gegen uns ist gekämpft worden wie gegen Frankreich und Großbritannien, und wenn Frankreich, Britannien und ihre Verbündeten gewonnen haben, dann muss ihr Sieg auch für uns gelten.
Sie mussten die Männer, die in Kiel gefangen saßen, befreien und etwas Neues beginnen, ehe das Alte ihnen den Sieg entriss. Würden sie dazu die Kraft aufbringen? Die Gesichter der Soldaten tanzten vor Felice im Nebel – zerschlagen, ausgehungert, mit den todmüden Augen von Greisen. Wer so viel Ende erlebt hatte, welchen Mut hatte der noch zu einem Anfang?
Aber sie waren doch so viele, die ganze Stadt im Aufbruch, sie konnten erreichen, was immer sie zu hoffen wagten!
Keine Frau, die studiert hatte, würde mehr um Erlaubnis betteln müssen, ihren Beruf auszuüben.
Kein Mann, der nach Abenteuern hungerte, würde sich dafür in einem Krieg verheizen lassen.
Kein halbes Kind würde einen Mann heiraten, der ihr zuwider war, und bei ihm bleiben, auch wenn sie lieber sterben wollte.
Die Vorstellung war atemberaubend und besänftigte für kurze Zeit Felices Angst. Ihre Hand lag um Rechas Ärmel, der Stoff ihrer Handschuhe durchnässt von eisigem Schweiß. Sie bogen in die Straße zum Reichstag ein. Über eine Tribüne hinweg starrte grotesk der hölzerne Hindenburg auf eine Welt, die er nicht begriff. Der Platz war schwarz vor Menschen, die niemand hinderte, bis auf die Stufen und unter die Fenster des Gebäudes vorzudringen.
»Schluss mit dem Krieg«, rief einer der Männer vom Wagendach. »Alle strategischen Flecken in dieser Stadt sind besetzt.«
Ein weiterer stimmte ein, gleich darauf ein dritter: »Jetzt wird man uns hören müssen. Schluss mit dem verdammten Krieg.«
Mit höchstens einer Spur Erstaunen vernahm Felice ihre eigene Stimme, dann pflanzte sich der Ruf als tausendfaches Echo fort: »Weg mit Ludendorff, Hindenburg, weg mit dem Kaiser! Nie wieder Krieg.«
2
Der Strom glich einer Soße, die zu Aspik verkocht war und nicht mehr vom Löffel floss. Felice und Recha kamen nur noch in winzigen Schritten voran. Inmitten der Menschenmassen, die auf den Reichstag starrten, entdeckte Felice einen Mann auf einer Trittleiter. Er war mager und eckig und hätte auch ohne Erhöhung die Versammelten überragt. Um die Taille hatte er sich einen Tragriemen geschlungen, der den Holzstiel eines Schildes auf seinen Schulterblättern festhielt. In grässlicher Sauklaue hatte jemand »Presse« daraufgekritzelt.
Albern, dachte Felice und erkannte ihn. Nicht nur ihr Herz, sondern ihr ganzer Körper schien zu klopfen.
Recha drehte sich um. »Ist das nicht Ihr Bekannter? Von der BZ am Mittag?«
Felice konnte nur nicken. Der Wind zerrte an Quintus’ schlecht geschnittenen Locken, auf denen er eine Schiebermütze trug, die ihm nicht stand. Sie glaubte, ihn pfeifen zu hören, wie er immer gepfiffen hatte, erst diesen seltsamen, schwermütigen Walzer, Tiralala tiralala, aus einer Operette, die ausgerechnet Der tapfere Soldat hieß, und dann das englische Lied, von dem Felice sich wünschte, sie bekäme es jemals aus dem Kopf.
Roses are shining in PicardyIn the hush of the silver dew …
Albern, albern, albern. Sie musste die Hände auf das Herz pressen, beide Hände, weil es so sehr raste.
»Ich dachte, mir hätte jemand erzählt, er wäre in ein Armierungs-Bataillon verpflichtet worden. So wie Wolfgang. Ich dachte, ich hätte gehört …«
»Ich habe das auch gehört«, fiel Felice ihr ins Wort. Der eisige Wind trieb ihr Tränen in die Augen. »Alle möglichen Leute haben es erzählt, sogar seine Schwester, diese Puppenschnitzerin. Er ist verhaftet worden und dann zum Verheizen an die Front nach Flandern geschickt. Sie hat geweint und erzählt, ihre Eltern wollten den Leichnam nach Hause holen, doch das werde nicht erlaubt.«
»Kein Wunder, oder?« Rechas Blick blieb ruhig. »Wenn kein totes Getier mehr durch die Blockade kommt, um die Leute zu füttern, warum dann tote Menschen, die niemandem nützen?«
Ehe Felice sich empören konnte, erkannte sie, dass Recha recht hatte. Berlin verhungerte. Eine Lieferung, die sich in die blockierte Stadt durchschlug, mochte Leben retten. Die Toten dagegen blieben tot, wo immer man sie hinschaffte.
Alle Toten. Bis auf Quintus Quirin, der wieder einmal jeder Regel ein Schnippchen schlug.
»Wie es aussieht, hat Ihr Bekannter es ohne Leichentransport geschafft«, sagte Recha. »Wenn Sie zu ihm gehen wollen, halte ich Sie nicht auf.«
»Um Gottes willen, nein!«, rief Felice. »Er ist nicht mehr mein Bekannter. Ich meine, wir haben uns schon entzweit, ehe er ins Gefängnis kam, wir haben nichts mehr miteinander zu tun.« Sie brach ab. Warum betrug sie sich, als wäre sie Recha Rechenschaft schuldig? »Für mich geht es einzig und allein um Willi«, setzte sie neu an. »Ich muss ihn freibekommen, das ist alles, was mich kümmert.«
Recha wies mit dem Kopf nach der Linken. »Dort drüben ist Birnbaum.«
Felice wandte sich von Quintus ab und sah, dass sie Habels Destille fast erreicht hatten. Wie Recha befürchtet hatte, platzte das Lokal aus den Nähten. Gäste mit Gläsern in den Händen quollen auf die Straße. Jäh und völlig unangebracht sehnte sie sich nach dem Babylon, nach sommerlichem Kneipenlärm, der sie aus ihrem Zimmer hinunter ins Getümmel gerufen hatte, nach den beiden Betreibern, die sie beim Namen kannten und ihr Lieblingsgetränk unaufgefordert vor sie hinstellten. Zitronenwasser und einen kleinen Kirsch. Oder nach Poetge. Nach zwei weich gekochten Eiern im Glas.
In einem Mann, der einen grauen Hut auf einem unförmigen Kopf trug, glaubte sie, Birnbaum zu erkennen. Vor einer Ewigkeit, auf einer Silvesterfeier, hatte sie geglaubt, das müsse ein Witz sein: Ein Mann, dessen Kopf wie eine Birne aussah, konnte unmöglich Birnbaum heißen. Heute interessierte sie nur, ob er Nachricht von Willi hatte. Er musste sie doch haben, sonst hätte er Recha nicht in diesen Tumult bestellt, der jeden Moment eskalieren konnte! Dass die Menge stillstand, verhieß keinen Frieden. Die Menschen lauerten auf etwas und würden sich nicht vertreiben lassen, ehe sie es bekamen.
Blindlings, ohne Rücksicht, kämpfte Felice sich durch. »Herr Birnbaum«, rief sie aus Leibeskräften, »ich bin Felice zur Nieden, Unteroffizier zur Niedens Schwester – bitte sagen Sie mir, wie es meinem Bruder geht. Ich habe mir auf sämtlichen Ämtern den Schädel eingerannt, ohne die kleinste Nachricht zu erhalten.«
Birnbaum, umringt von einer Gruppe junger Leute, drehte sich um. »Fräulein zur Nieden.« Er wirkte verwirrt, zog den Hut und kratzte sich am Kopf.
»Sie ist mit mir gekommen«, rief Recha, doch eine andere rief viel lauter.
»Feli, Feli!« Aus dem Pulk hinter Birnbaum tauchte eine Gestalt in Pelzpelerine und mit unfrisiertem blondem Haar auf. Sie stürmte auf Felice zu, dass die Umstehenden kaum schnell genug aus dem Weg springen konnten. Dabei schrie, ja kreischte sie ohne Unterlass weiter: »Feli, Feli, Feli!«
Ihre Schwester Ille.
Keine Armlänge vor sich sah Felice ihr rot geweintes Gesicht, dann warf Ille sich ihr an die Brust. Alles in ihr sträubte sich, wollte die Schwester von sich stoßen. Die Tage, in denen sie sich wie drei zu klein geratene Musketiere unter einer Decke Treue geschworen hatten, waren lange vorbei. Felice hatte Ille klargemacht, dass ihr Lebenswandel sich mit einem Mindestmaß an Anstand nicht vertrug. Sie hatte sich für ihre Schwester geschämt: Wie konnte ein Mensch so tief fallen, wie seine Würde so preisgeben?
Sie kam sich vor wie ihre Mutter, die nichts mehr hasste als Szenen. Ich bin ihre Tochter, erkannte sie. Ihr Ebenbild. Ich mache mich steif, wie sie es tat, wenn Ille hingefallen war und sich ihr in die Arme werfen wollte. Ille gab ein wimmerndes Geräusch von sich. Über ihr Gesicht liefen Tränen und Rotz.
Felice zwang sich, die Arme um den zuckenden Körper zu legen. Sie wusste, sie hätte der Schwester Fragen stellen müssen, doch Angst vor Antworten hinderte sie. Ging es um Willi? Hatte Ille Gewissheit, während Felice sich an leere Hoffnungen klammerte?
Statt ihrer fragte Recha: »Was ist denn passiert, Frau Berndt? Wo ist Gabriel?«
»Gabriel.« Ille weinte auf. »Er hat mir geholfen. Ich brauchte doch einen, der mir hilft.«
Felice befreite sich. »Der dir wobei hilft?«
»Reinhold zu suchen!« Illes Finger krallten sich in ihre Schultern. »Er ist verschwunden. Ich kam mit den Kindern vom Spielen und Reinhold war fort.«
Felice versuchte aufzuatmen. Es war nichts weiter als Illes übliches Theater, ihr ewiges Heischen nach Aufmerksamkeit. Ihr Mann Reinhold verschwand des Öfteren und für gewöhnlich war Ille darüber nicht verzweifelt, sondern froh.
»Gibste jetzt mal Ruhe, du Singuhr«, schimpfte ein Mann. »Bei dem Geplärr wird ja der Hund in der Pfanne verrückt.«
Andere, vor allem Frauen, versteckten Neugier hinter Hilfsbereitschaft: »Na na, wer wird denn so weinen? Wo drückt denn der Schuh, die Welt geht ja wohl nicht gleich unter.«
»Isse doch längst«, knurrte der Mann, dem der Hund in der Pfanne verrückt wurde. »Wozu sich also noch ins Hemde machen?«
Ille weinte. »Reinhold ist weg. Gabriel ist los und sucht ihn, aber er kann ihn ja nicht finden.«
»Sie haben Gabriel geschickt, um Ihren Mann zu suchen?«, fuhr Recha dazwischen. »Sind Sie von Sinnen? Ihr Mann hat gesagt, wenn Gabriel sich noch einmal in Ihre Nähe wagt, bringt er ihn um.«
Statt einer Antwort krümmte sich Ille wie unter Schmerzen. Felice kam es vor, als wüchse der Pulk, der sich um sie scharte, in Windeseile an, als hätte Illes privates Drama den Ereignissen um das Reichstagsgebäude die Schau gestohlen.
»Frau Berndt!«, rief Recha, packte Ille bei der Schulter und rüttelte sie. »Sagen Sie mir, was passiert ist und wo ich meinen Bruder finde, ehe ein Unglück geschieht. Mir hat er erzählt, ein Kamerad nimmt ihn auf ein paar Tage mit ins Brandenburgische, aber wenn er bei Ihnen war, ist er ja dort wohl nie angekommen.«
»Ich weiß doch nichts!« Illes Worte waren kaum zu verstehen. »Ich hab mich um meine Kinder kümmern müssen, wir waren spielen an der Blanken Helle.«
»Spielen am Pfuhl?«, platzte Felice heraus. »Bei dem Wetter?«
Ille nickte und begann, wie ein Automat ihre Rede abzuspulen: »Ich bring die Kinder oft dorthin, wenn Reinhold zu Hause ist, damit sie ihm nicht im Weg sind. Sie spielen da gerne. Manchmal, wenn es uns zu kalt wird, setzen wir uns in die Konditorei. Lise isst einen Liebesknochen und Jenny einen Windbeutel, weil sie sagt, der schmeckt nach frischer Luft. Wenn wir nach Hause kommen, ist Reinhold eingeschlafen. Wir schleichen auf Zehenspitzen ins Haus und haben unsere Ruhe.«
Ich hätte mich um sie kümmern müssen, dachte Felice. Egal, was sie tut. Sie war die Kleinste von uns und etwas in ihr ist noch immer das Kind, das aus Glanzbildern Kränze ausschnitt, sooft im Goldfischglas ein Fisch gestorben war.
Ein läppischer Vers aus einem Poesiealbum schien im Wind zu flattern wie die Schnur eines verlorenen Ballons:
Und bittend soll dies Blättchen dich erinnern:Ich möcht’ nicht ganz von dir vergessen sein.
Kalter Schweiß lief Felice den Rücken hinunter. Sie hätte erleichtert sein sollen, weil Ille nicht um Willi weinte, aber in ihrem Nacken, der sich schmerzhaft versteifte, spürte sie, dass es keinen Grund zur Erleichterung gab.
»Und heute?«, fragte Recha. »Als Sie heute von der Blanken Helle nach Hause kamen, war Ihr Mann nicht eingeschlafen?«
Verstört wandte Ille sich ihr zu. Mit dem wirren Haar, das ihr ins verschwollene Gesicht hing, wirkte sie wie eine Geisteskranke oder eine Trinkerin. »Heute? Nein, heute hat er nicht geschlafen. Die ganze Woche nicht. Er sagt, er schläft überhaupt nicht mehr.«
»Aber er war zu Hause?«
Wild, dass ihr Haar flog, schüttelte Ille den Kopf. »Nein, nein, das sage ich doch. Er war nicht zu Hause, er ist verschwunden, wir wissen nicht, wo er ist.«
»Herrgott, er wird ausgegangen sein«, sagte Felice. »Hast du mir nicht erzählt, er ist mehr in der Wirtschaft als bei euch im Haus?«
Illes wasserblaue Augen, die sonst rund waren wie bei einer Porzellanpuppe, verengten sich zu Schlitzen. Die Haut um das linke war schwärzlich verfärbt. »Heute nicht«, wiederholte sie. »Er wollte zu Hause bleiben, das hat er mir gesagt.«
»Dann hat er seine Meinung eben geändert.«
»Und was ist mit Gabriel?«, fiel Recha ein. »Was hatte Gabriel mit alledem zu tun, war er mit Ihnen am Pfuhl?«
»Nein, nein!«, rief Ille, »er war … wir haben ihn auf der Straße getroffen und er hat uns geholfen – weiter war nichts.«
»Hören Sie damit auf«, sagte Recha. »Ihr Mann ist verschwunden und mein Bruder sucht ihn? Das kann nicht stimmen, und das wissen Sie. Ich habe Ihnen gestern Nachricht gesendet, weil ich fand, es stünde Ihnen als Willis Schwester zu, von seinem Befinden zu erfahren. Ich bin Gabriels Schwester. Gestehen Sie mir dasselbe zu. Mein Bruder ist hilflos. Bei dem Aufruhr in den Straßen würde er nicht weit kommen.«
Ihre Stimme hatte beherrscht geklungen und ihr Blick verriet kein Flattern. Felice aber sah, wie sie zwischen den Worten die Kiefer spannte, dass die Knochen hervortraten. Die schöne Recha, die Selbstsichere, die nichts aus dem Gleichgewicht brachte, hatte so viel Angst wie sie selbst.
Ille verstärkte den Griff um ihre Schultern. »Gabriel«, wimmerte sie. »Großer Gott, Gabriel.«
»Gott hilft uns nicht weiter«, rief Recha. »Wo mein Bruder ist, will ich wissen.«
»Und wo sind deine Kinder?«, fuhr Felice dazwischen.
Über Illes blauschwarz verfärbte Haut rollten Tränen und brachten die Schwellungen zum Glänzen.
»Die Kinder.« Felices Kehle wurde eng. »Lise und Jenny, wo sind die?« Blitzschnell überschlug ihr Hirn Daten. Lisette, ihre ältere Nichte, war vor dem Krieg geboren worden und ging so gut wie zur Schule, aber Jenny, die kesse Bolle, über die sie an Weihnachten gelacht hatten, konnte keine vier Jahre alt sein. Ich hätte mich kümmern müssen, durchfuhr es sie von Neuem. Sie hatte keine Kinder in ihrem Leben gewollt, war zu sehr mit ihren eigenen Dingen beschäftigt. Dass Ille sie zur Patin gemacht hatte, hatte sie mehr belästigt als gefreut.
Jetzt aber war das auf einen Schlag anders. Als risse das Ende des Krieges, das Ende der bekannten Welt alles mit sich, auch sie selbst und ihren Blick. Diese Kinder gehörten zu ihrer Familie, sie hatten ein Anrecht auf Schutz. Sie konnte die Augen nicht verschließen, wenn diese Kinder sie brauchten.
»Wo sind Lise und Jenny?« Sie umfasste Illes Gelenke. »Du hast sie nicht allein zu Hause gelassen, nicht wahr?«
»Der Hermann ist ja da«, stammelte Ille. »Sie sind nicht alleine, meine Kleinen, der Hermann ist da und passt auf.«
Hermann war Illes Stiefsohn aus Reinhold Berndts erster Ehe, ein geducktes Bürschlein, das keinen gesunden Eindruck machte. Wieder rechnete Felice nach. Der Junge war zehn gewesen, als Ille geheiratet hatte, er musste sechzehn sein, so gut wie wehrfähig. Im Grunde sprach nichts dagegen, ihm die Aufsicht über seine kleinen Schwestern zu übertragen, doch bei dem Gedanken wurde Felices Nacken noch steifer. »Wir gehen sie holen«, sagte sie und wollte Ille beim Arm nehmen.
»Nein, nein!« Ille wich zur Seite und prallte gegen Recha. »Nicht dorthin zurück, bitte nicht. Gehst du mit mir zur Polizei, Feli? Ich muss doch Meldung machen, dass mein Mann vermisst wird.«
»Ich gehe mit Ihnen«, sagte Recha. »Wenn Sie Ihren Mann als vermisst melden, melde ich meinen Bruder.«
»Bitte nicht!«, flehte Ille. »Gabriel ist nichts passiert, er kommt zu Ihnen zurück. Wenn Sie ihn nicht melden, kommt er zurück und alles wird wieder gut.«
»Das möcht’ ich ja mal sehen, was wieder gut werden soll, nachdem die’s zu Gelump gedroschen haben«, knurrte ein Mann, der aus einem Halbliterglas ein Helles trank. »Und jetzt setzen die sich ab. Der Kaiser ist irgendwo in Holland und die Ratte Ludendorff macht auch, dass sie von dem sinkenden Kahn noch runterkommt.«
»Halt die Klappe, Rudi!«, brüllte einer seiner Kumpane. »Da ist einer am Fenster.«
»An wat für’m Fenster?«
»Da drüben, im Reichstag – das ist der Scheidemann!«
Im Nu brüllte alles durcheinander. Felice reckte sich und sah, dass eins der Bogenfenster des Westbalkons geöffnet worden war. Männer in Anzügen reihten sich auf wie steinerne Standbilder, aber einer scherte aus und erklomm die Balustrade. An seinem von weißem Haarkranz umgebenen Kahlschädel und den runden Brillengläsern war er als Philipp Scheidemann erkennbar, einer der führenden Köpfe der Sozialdemokraten.
»Arbeiter und Soldaten!«, rief er über das schwarze, jäh verstummte Menschenmeer hinweg. »Furchtbar waren die vier Kriegsjahre. Grausam waren die Opfer, die das Volk an seinem Blut hat bringen müssen.«
Der war nicht hier, um mit einer inhaltsleeren Rede die Leute noch einmal zu beschwichtigen. So wie er stand und ihnen entgegensah, wusste er, dass die Zeit des Stillhaltens vorbei war, dass das, was er sagen würde, ein Stich mit einem gewaltigen Spaten sein musste, der ein neues Fundament aushob.
Felice war scharfsichtig wie ein Sperber und hatte das Gefühl, dem Politiker über den Platz hinweg in die Augen zu sehen. Er war Schriftsetzer, hatte nicht studiert, galt lediglich als ein Mann, der zu reden verstand. Hatte er gute Berater, war ihm verschafft worden, was er an Informationen benötigte?
Ich wäre gern sein Berater, blitzte es Felice durchs Hirn. Das war arrogant. Sie wusste so wenig eine Lösung wie er, doch sie war gut in ihrem Beruf und hätte etwas wie das hier gebraucht: Einen Fall, den es zuvor nie gegeben hatte. Einen Spatenstich, der die Welt veränderte und das Unmögliche möglich machte.
Zugleich aber wollte sie Scheidemann zurufen: Das geht doch nicht! Nicht jetzt, wo ich den Kopf zum Platzen voll habe, wo ich nicht weiß, ob mein Bruder tot ist oder an der Angst zu sterben den Verstand verliert, wo ich nicht weiß, was meine Schwester umtreibt, nur dass es nichts Gutes ist.
Ille stöhnte und sackte auf die Knie. Felice versuchte sie zu packen, erwischte sie aber zu spät.
»Der Kaiser hat abgedankt!«, rief Philipp Scheidemann.
»Gabriel«, heulte Ille.
»Verdammt, Ille, komm zu dir!« Felice bemühte sich, sie an den Schultern hochzuziehen.
Scheidemanns Stimme hallte über den Platz: »Arbeiter und Soldaten, seid euch über die Bedeutung dieses Tages bewusst!«
Recha sprang Felice zu Hilfe und zerrte an Illes Schultern. Ille aber krümmte sich heulend vornüber und war nicht zu bewegen.
»Unerhörtes ist geschehen. Große und unübersehbare Arbeit steht uns bevor!«
Recha umschlang Illes Rücken und schüttelte sie. »Was haben Sie und Gabriel getan, worin hat mein Bruder sich verwickeln lassen?«
Felice schob sie beiseite. »Jetzt lass uns nicht alle verrücktspielen. Wichtig ist, dass du uns sagst, was mit den Kindern ist.«
»Meine Kinder«, wimmerte Ille. »Meine armen, kleinen Kinder.«
»Das Alte und Morsche ist zusammengebrochen«, deklamierte Scheidemann.
Felice und Recha gaben alles, um Ille in die Höhe zu hieven, aber die schlug um sich und biss. Ein Mann drängte sich zu ihnen durch und drehte Felice an den Schultern zu sich. »Hat jetzt keinen Sinn«, keuchte er und sah sie an. »Lass sie sich austoben. Irgendwann verlassen sie die Kräfte, dann beruhigt sie sich.«
Quintus Quirin. Die alberne Schiebermütze noch auf dem Kopf. Felice wollte sich befreien, doch die Kräfte versagten ihr. Sie ließ sich gegen ihn sinken. In ihren Ohren dröhnten nicht länger seine Prahlereien, sondern das englische Lied und die stille Stimme, mit der er versucht hatte, ihr von der zerstörten Stadt namens Wipers zu erzählen: »In der Nacht«, hat das Mädchen gesagt. »In der Nacht weint Wipers, meine Stadt.«
»Es lebe das Neue!«, schrie Philipp Scheidemann. »Es lebe die deutsche Republik!«
Ille
1912 Und die jungen Blätter blitzenUnd sie denken sich: Was mag das sein?Könnten sie, sie zögen ihre SpitzenSchleunigst wieder ein.Kurt Tucholsky
3
März
Vergiss mich nicht,Wenn uns auch Meilen trennen.Zuweilen lass dein Denken bei mir sein.
Ilsebill zur Nieden holte Atem und betrachtete andächtig die glänzenden Tintenbuchstaben. Sie griff nach der Löschwiege, die sie von Onkel Bennos Schreibtisch stibitzt hatte, und setzte sie mit Vorsicht auf, um die schöne Schrift nicht zu verwischen. Fräulein Karstedt, ihre Lehrerin, hätte sie für so viel Mühe gelobt. Ilsebill, die es gern mochte, wenn alle Welt sie Ille nannte, hasste die Schule. Sie hatte zum Stillsitzen und Herumnesteln mit Fass und Füllfeder keine Geduld. In dem Poesiealbum aber wollte sie sauber schreiben, so sauber, wie es überhaupt nur möglich war. Es war brandneu, in weinroten Samt gebunden, und sie hatte es in Zagerts Schreibwarenhandlung von ihrem eigenen – oder zumindest von eigens geliehenem – Geld gekauft.
Die Tinte schien trocken, der dunkle Glanz verblasst. Aber der Strich auf dem blütenweißen Papier sah noch immer edel aus, und darauf kam es an. Edel, das gefiel Feli. Es war eins ihrer Lieblingsworte. Bei einer ihrer Freundinnen hätte Ille die Seite mit einer ganzen Reihe von Glanzbildern verziert, aber für Feli, die das abgeschmackt gefunden hätte, hatte sie nur ein einziges eingeklebt. Das schönste. Den Schatz ihrer Sammlung, den zu verlieren wehtat. Für Felice musste es wehtun. Ille tauchte die Feder neu ein und schrieb die Verse zu Ende:
Und bittend sollDies Blättchen dich erinnern:Ich möcht’ nicht ganz von dir vergessen sein.
Wie empfindsam das abgefasst war! In ihrem linken Auge spürte sie, wie eine Träne sich löste, so gerührt war sie. Ille war oft gerührt und sie liebte es. Am schönsten war es im Lichtspielhaus, in Die arme Jenny mit der unglaublich hübschen Asta Nielsen, die im Schneesturm erfrieren musste, weil ihre Familie sie vergessen hatte. Ille wollte das nicht. Sie wollte, dass Feli, Willi und sie für immer zueinanderstanden. Deshalb hatte sie Feli dieses teure Geschenk zum Geburtstag gekauft, obwohl sie blank war wie Onkel Bennos Glatze: Um ihr zu zeigen, was sie ihr bedeutete, auch wenn Feli furchtbar komisch sein konnte, Glanzbilder hässlich fand und nicht verstand, warum Ille die Hälfte ihrer Besitztümer dafür gegeben hätte, Asta Nielsen in Abgründe sehen zu dürfen, den die Zensur für Jugendliche verboten hatte.
Asta Nielsen war einzigartig. So zart, so graziös, ganz anders als Ille und ihre Freundinnen, die in Reformkorsetts und Matrosenkragen vor üppiger Gesundheit strotzten. Es war einfach herrlich, zu weinen, wenn die zerbrechliche Asta Nielsen litt, weil die ganze Welt ihr Unrecht zufügte. Ille fühlte sich dabei, als würde sie inwendig schmelzen. Die Herren von der Zensur hatten doch keine Ahnung. Ille war siebzehn. Wenn diese alten Männer glaubten, eine Siebzehnjährige sei zu jung, um sich auf die großen Gefühle, auf Liebe, Schmerz und Sehnsucht zu verstehen, dann waren sie selbst wohl nie jung gewesen, sondern viel zu verknöchert dazu!
Onkel Benno zum Beispiel. Was verstand der von Gefühlen? Er saß in seinem Schreibtischstuhl oder am Kopf des Esstischs, klemmte sich sein Monokel vors Auge, durch das er auch nicht besser sah, und zählte auf, was Mia, die Köchin, Ottchen, das Hausmädchen, und die Mitglieder der Familie an diesem Tag wieder falsch gemacht hatten. Den berührte gar nichts, der weinte um nichts, wie ja Männer außer Willi überhaupt wenig weinten, und wenn ihm je das Herz raste, dann höchstens, weil ihm sein Schnupftabak der Marke Ratibor ausgegangen war. Anderen schnupfte er nicht. Anderes kratzte ihn nicht. Bestimmt saßen solche wie er in der Zensurbehörde, und wie wollten die nun entscheiden, ob ein Film mit Asta Nielsen für ein Mädchen wie Ille geeignet war oder nicht?
Ille griff noch einmal zur Löschwiege und ließ sie über die Buchstaben schaukeln. Die sechs Zeilen des Gedichts hatte sie mit größter Sorgfalt ausgewählt. Sämtliche Alben ihrer Freundinnen und das von Cousine Bettina hatte sie durchblättert, um etwas Passendes für Felice zu finden. Früher hatte sie selbst ein wenig zu dichten versucht, aber etwas so Herzwärmendes war ihr nie geglückt. Felice hatte über ihre Ergüsse die Nase gerümpft und inzwischen hatte Ille selbst eingesehen, dass ihr zum Dichten wie zu den meisten Dingen das Talent fehlte.
Sie war nichts Besonderes. Für Ille war das ganz in Ordnung, nur für Felice wäre sie manchmal gern eine besondere Schwester gewesen. Eine, die Felice bewundern konnte, wie Ille sie bewunderte. Je älter sie wurden, desto seltener gelang es Ille, etwas zu tun, das vor Felices Augen Gnade fand. Früher, in der Kinderzeit, hatte die ältere geklatscht, wenn Ille an der Klopfstange einen Überschlag gewagt hatte, doch die Tage waren lange vorbei. Felice war eine Erwachsene. Ab heute hätte sie sogar Abgründe im Lichtspielhaus sehen dürfen, hätte sie Kintopp nicht als Vergnügen für einfältige Dienstmädchen abgetan. Felice war nicht einfältig. Manchmal schien es Ille, ihre Schwester könne so scharf denken wie ein Mann und hundertmal schärfer als sie selbst.
»Wo lebst du eigentlich? Hinter dem Mond?«, stöhnte Felice, wenn Ille wieder einmal eine Dummheit von sich gegeben hatte, und es klang weder zärtlich noch amüsiert, sondern so, als ginge ihr die Schwester gehörig auf die Nerven. Heute aber würde es anders sein. Wenn es ihr gelang, mit ihrem Geschenk Felice ein Lächeln, ein Wort der Anerkennung zu entlocken, hatten sich Geldausgabe und Mühe mehr als gelohnt.
Behutsam schloss sie den Deckel des Albums, nahm es in beide Hände und stand auf, um es hinüber in den Salon zu tragen, wo die Geburtstagsgesellschaft schon um den Kaffeetisch versammelt sitzen würde. Geschenke gehörten eingewickelt, doch Ille hatte kein Papier gefunden, das mit dem Schimmer des Samtes hätte mithalten können. Also pflückte sie nur im Vorbeigehen dem Strauß Treibhausrosen, den Ottchen ihr auf den Frisiertisch gestellt hatte, eine Blüte ab und streute die blassen Blätter über das fast schwarze Rot. Der Blick in den Spiegel, den sie erhaschte, verriet ihr, dass alles perfekt war: Das Altrosa der taillierten Spitzenbluse, der Samt des Albums und die hellen Blütenblätter harmonierten und der halb aufgelöste griechische Knoten, in dem sie ihr Haar trug, passte dazu. Ihr Herz vollführte einen kleinen Satz. Es war so schön, zu schenken, noch schöner, als beschenkt zu werden.
Sie durchmaß das Zimmer, das alle drei Geschwister als Kinderstube geteilt hatten, das sie seit Kurzem jedoch allein bewohnte. Willi war mit seinen achtzehn Jahren ein junger Herr, obwohl er Asta Nielsen in Abgründe so wenig sehen durfte wie Ille. Dass er sich noch länger mit seinen Schwestern ein Zimmer teilte, hatte Mutter im letzten Herbst für unschicklich erklärt.
Guter Rat war teuer gewesen. Zu Mutters Kummer waren sie räumlich beengter als es Familien ihres Standes zukam, da im Obergeschoss der Villa ein Beamter der Reichspost samt Gattin und Kindern hauste. Zum Ausgleich benötigten sie jedoch keine Armee von Personal, wie sie zur Führung eines großen Haushalts nötig war. Kurzerhand war Ottchen, das einstige Kinderfräulein, das in die Rolle des Hausmädchens hineingewachsen war, ins Dienstbotenquartier unter der Treppe umgesiedelt worden. Ihre frühere Kammer hielt seitdem als Junggesellenzimmer für Willi her.
Felice fand das ungerecht. Schließlich war sie es, so erklärte sie, die bis tief in die Nacht über Büchern saß und Licht und Ruhe zum Studieren brauchte. Dass aber sie nun einmal ein Mädchen war und das Studieren ihr Privatvergnügen, während Willi als jungem Herrn ein angemessener Raum zustand, konnte man ihr nicht erklären. Felice fand alles und jedes ungerecht. Sie war so geboren und rannte sich lieber an einer Wand die Stirn blau, als sich mit etwas, das sich eben nicht ändern ließ, abzufinden.
Mutter dachte gar nicht daran, dafür zu sorgen, dass ihre Tochter ebenfalls ein eigenes Zimmer bekam, aber Felice war wild entschlossen, sich eines zu nehmen. Ohne Umschweife rief sie sich Moritz, den Nachbarssohn, ins Haus, schleppte mit seiner Hilfe ihr Bett und Vaters Pult ins Balkonzimmer in der Beletage und erklärte fortan den zugigen Raum, in dem Ottchen Geranien angezüchtet hatte, zu ihrem Revier.
Benno beschwerte sich, ein Mann könne in seinem eigenen Haus nicht einmal in Frieden auf dem Balkon sitzen, aber Benno beschwerte sich so oder so. Er hatte auch vorher nie auf dem Balkon gesessen, und so richtig war die Villa ja auch nicht sein Haus. Die neue Regelung spielte sich ein. Ille vermisste ihre Geschwister und sehnte sich nach den Nächten, in denen sie sich unter dieselbe Decke verkrochen, Geheimnisse geflüstert und Rollmöpse und Spreegurken geteilt hatten, aber selbst sie sah ein, dass sie dafür zu groß waren und dass die Zeiten sich änderten.
Einen Film sehen wollen, in dem Asta Nielsen den Zensoren die Schamröte ins Gesicht trieb, und zugleich mit Schwester und Bruder Kinderkram treiben, das ging nicht zusammen. Ein Kind blieb keiner. Aus tapsigen Welpen wurden ausgewachsene Schäferhunde, die nicht in Wohnungen gehörten, und aus verspielten Kindern wurden Mädchen, die alt genug waren, sich zu verlieben.
Ille hatte sich noch nie verliebt – höchstens in Leo Peukert auf der Leinwand oder sogar ein bisschen mehr in Asta Nielsen, aber noch nie in einen echten Menschen. Sie konnte es kaum erwarten, bis es so weit war. Warum nicht heute? Sie freute sich auf den Abend. Daran zu denken, was ihr bevorstehen mochte, war beinahe so aufregend wie die Sache mit dem Poesiealbum.
Sobald sie den Flur betrat, hörte sie Stimmen. Cousine Bettina babbelte, Tante Ariane steuerte von Zeit zu Zeit ihr »Oh je«, »Was du nicht sagst« oder »Alles muss Grenzen haben« bei, und dann machte Onkel Benno dem Ganzen ein Ende, indem er die Faust auf den Tisch knallte und knurrte: »Kann ein Mann in seinem eigenen Haus nicht einmal in Frieden Kaffee trinken?«
»Ach du grüne Neune.« Das war Oma Hertha, die sich in Wahrheit aus der ganzen Familie nichts machte und nur Felices wegen hier war. »Was machen Sie denn für einen Fez, hat Ihnen Ihr Käffchen vielleicht jemand weggenommen? Nee? Na also. Dann ist ja alles in Butter und Sie brauchen sich nicht aufzuregen. Ist Gift fürs Herz, Bennochen.«
Onkel Benno blaffte kurzatmig, er sei nicht Oma Herthas Bennochen, Mutter stöhnte, als würde sie in Ohnmacht sinken, und Tante Ariane ereiferte sich, wenn ihre Tochter und sie nicht willkommen seien, könnten sie ja gehen. Es war alles wie immer. Jeder erfüllte die Rolle, in der er sich seit Jahren eingerichtet hatte, von niemandem kam etwas Unverhofftes oder gar Schockierendes. Ille gefiel das. Es gab ihr das Gefühl, sich zurechtzufinden, während die Welt dort draußen verwirrend und voller Irrwege war. Warum Felice sich wünschte, ein Mann zu sein, begriff sie nicht. Sie selbst war heilfroh, dass sie ein Mädchen war und eines Tages ein beschütztes Heim wie dieses haben würde, in dem das Leben nach fest gefügten Regeln ablief.
Felice war anders. Felice sagte oft etwas Schockierendes, wenn sie im Familienkreis beieinandersaßen, genau genommen sagte sie selten etwas, das nicht schockierte. Ille hatte den Gedanken kaum zu Ende gedacht, als ihr auffiel, dass im Kanon der Stimmen die von Felice fehlte. Auch die von Willi, aber der mochte sich genau wie sie selbst verspätet haben. Felice hingegen war das Geburtstagskind. Wenn sie nicht dabei war, welchen Sinn hatte dann die Feier?
Ille schob die Tür zum Salon auf und prallte um ein Haar mit Mia zusammen, die den Servierwagen mit zwei leer gegessenen Etageren hinausschob. Wieso machte das Mia? Das Reich der Köchin war die Küche. Für gewöhnlich stellte sie die gefüllten Platten und Schüsseln auf die Durchreiche zum Flur, wo Ottchen sie abholte, um bei Tisch zu bedienen.
»Bitte um Verzeihung, gnädiges Fräulein«, nuschelte Mia, schob den Wagen aber unbeirrt weiter, sodass Ille ihr ausweichen musste. Ein Blick in den Raum bestätigte ihre Befürchtung: Auf der Neu-Renaissancegarnitur, um den ausgezogenen Kaffeetisch, der mit dem weißen Tafelleinen gedeckt worden war, saßen Onkel Benno, Mutter, Oma Hertha, Tante Ariane und Cousine Bettina. Alle waren so ordentlich aufgereiht wie die Möbel aus wuchtiger, dunkler Eiche und der Zierrat, die tanzende Schäferin aus Meißen, die im immer gleichen Winkel zur Konfektschale mit dem Kirschmuster und dem Kerzenhalter aus Bronze stand.
Auf der Anrichte stapelte sich eine kleine Zahl Gegenstände, die wohl Felices Geschenke darstellten: eine Schachtel feiner, mit Spitze umsäumter Taschentücher, ein Stoß Tischwäsche für die Aussteuer, ein Satz silberner Serviettenringe und Spemanns goldenes Buch der Sitte, in dem Graf und Gräfin Baudissin darlegten, wie man sich als Menschenkind aus gutem Hause ein wohlgefälliges Leben zimmerte. Dass Felice sich einen dieser Gegenstände gewünscht hatte, konnte sich Ille beim besten Willen nicht vorstellen.
Den einzigen Farbfleck, das einzige bisschen Unordnung in all der Mustergültigkeit bildeten Willis Zeitschriften, die Lichtbild-Theater und die brandneue, farbig illustrierte Bild und Film, die auf den Beistelltisch mit der staubgrauen Zimmerpalme geworfen waren.
Auch die Tafel war ein Bild der Ordnung, jede Kuchengabel und jede Zuckerzange hatte ihren Platz. Die Etageren mit den schicken Schnittchen auf englische Art waren offenbar als Erste leer geschlungen worden, obwohl Onkel Benno gegen solchen Firlefanz protestiert hatte. Verblieben waren eine Platte mit Spritzkuchen aus der Konditorei, Mias Nusstorte mit Johannisbeergelee und der Streuselkuchen von Oma Herthas Mädchen Jette, nicht elegant, aber heiß geliebt. Willi, der die quadratischen Stücke dieses Kuchens in sich hineinstopfte, als hätte er ein Loch, wo sie wieder herausplumpsten, fehlte. Vor allem aber fehlte Felice.
»Sieh an, eine Tochter des Hauses bequemt sich.« Onkel Bennos Stimme klang nach Schnupfen, obwohl er gesund war. »Schießklasse drei zumindest. Dass Schießklasse zwei es nicht für nötig hält, ihre eigens versammelte Verwandtschaft mit ihrer Gegenwart zu beehren, haben wir ja zur Kenntnis genommen.«
Schießklasse zwei und drei, so nannte er Felice und Ille. Onkel Benno war Rittmeister des Dragonerregiments Prinz Albrecht von Preußen, all sein Reden und Denken entstammte dem Leben beim Militär. Als Schießklasse eins, die höchste Rangstufe unter den Schützen, bezeichnete er Willi, obwohl Felice die Erstgeborene war. Aber Willi war eben der Sohn des Hauses. Der Stammhalter. Als Felice vor Jahren danach gefragt hatte, hatte sie von Onkel Benno zur Antwort erhalten: »Schießklassen dienen der Unterteilung nach Wert, meine Beste. Dass dir zur höchsten Klasse gewisse Erheblichkeiten fehlen, solltest selbst du inzwischen gelernt haben.«
Felice würde es womöglich nie lernen. Als sie jünger gewesen waren, noch in den Zeiten unter einer Decke, war sie eines Nachts herausgeplatzt: »Es ist nicht gerecht, dass Benno in unserem Haus das Sagen hat. Wenn ich groß bin, gehe ich zum Gericht und lasse ihn vor die Tür setzen.«
Willi hatte gelacht und sie gedrückt: »Ach Felchen. Onkel Benno kannst du so gar nicht verknusen, was?«
»Kann ich nicht. Und mein Onkel ist der auch nicht.«
Ille dagegen erinnerte sich, wie sie sich als kleines Mädchen gewünscht hatte, Onkel Benno wäre ihr Vater. Warum wusste sie selbst nicht genau. Onkel Benno mochte sie nicht, sie war Schießklasse drei, die getrost ignoriert werden durfte, und wenn er überhaupt das Wort an sie richtete, dann nur, weil sich kein anderer zum Ausschimpfen fand. Sie mochte ihn selbst nicht sonderlich, obwohl sie Menschen sonst fast immer mochte. Es war vermutlich nur der Wunsch, mit Vater, Mutter und Geschwistern unter einem Dach zu leben wie die anderen, zu wissen, wer in der Familie zu wem gehörte und es denen, die fragten, erklären zu können.
»Wer ist denn der?«, wollten ihre Freundinnen wissen und Ille hatte darauf keine Antwort. Ein entfernter Vetter ihres Vaters war er, sein Treuhänder, Vormund der Kinder und Verwalter des Erbes. Doch das alles war kein Grund, unter einem Dach mit ihm zu wohnen. In Wahrheit hatte das Bankhaus zur Nieden Vater nicht mehr allein gehört, als er vom Pferd fiel und starb. Ein Teil davon gehörte Rittmeister Benno von Cosel, aber so etwas konnte man nicht den Freundinnen erzählen.
Noch weniger konnte man ihnen erzählen, dass Onkel Benno des Nachts ins elterliche Schlafzimmer ging, das die Mutter jetzt allein bewohnte. Es war unanständig wie die Szenen in Asta Nielsens Filmen, die die Zensur hätte herausschneiden wollen, nur war es nicht aufregend und kein bisschen schön. Willi behauptete, Onkel Benno riebe sich die Glatze mit Margarine ein, damit sie glänzte, und vor der Vorstellung von seiner Margarinenglatze in Mutters blitzsauberem Bett ekelte sich Ille. Wäre er ihr Vater gewesen, hätte alles gepasst, und damit, dass er kein netter Vater gewesen wäre, hätte sich leben lassen. Die wenigsten Mädchen, die sie kannte, hatten nette Väter. So aber passte es nicht. Es musste behandelt werden, als existiere es nicht, obwohl doch jeder darüber tuschelte, und dabei fühlte sich Ille, als stakse sie über brüchiges Eis.
»Ja, Kleenchen, was ist dir denn?«, fragte Oma Hertha. »Kiekst ja in die Gegend, als hätte sich hier bei uns ein Gespenst hingehockt.« Wie um das Gespenst zu suchen, sah sie sich nach allen Seiten um, dann wandte sie sich wieder Ille zu. »Und was haste da Hübsches? Nun setz dich doch erst mal, leg das hin und dann gibt’s was von Omas Kuchen mit tüchtig Sahne.«
»Wo ist Feli?«, fragte Ille und schloss die Finger um das Poesiealbum fester.
»Das sagte ich bereits«, schoss Onkel Benno zurück. »Deine Schwester hat es vorgezogen, der familiären Kaffeetafel den Rücken zu kehren. In meinen Augen ein höchst ungehöriges Benehmen, aber was diesbezüglich in diesem Hause geduldet wird, kennt offenbar keine Grenzen. Du setz dich jetzt auf deinen Platz. Ich werde nicht noch gestatten, dass der Ungehorsam deiner Schwester Schule macht.«
Mia kehrte mit dem Servierwagen zurück, um Kaffee nachzuschenken, und Ille setzte sich auf ihren Platz neben Cousine Bettina. Die wollte sich das Poesiealbum schnappen, aber Ille ließ es nicht los. Nur die Rosenblätter fielen herunter. Auf dem Servierwagen standen keine frisch mit Schnittchen gefüllten Etageren, sondern lediglich die Sahneschüssel und das Milchkännchen. Ille hatte Hunger. Sie hatte öfter Hunger, als einer Dame guttat, und sie hätte gern in etwas Herzhaftes gebissen.
»Warum ist denn Felice gegangen?«, wagte sie sich vor. »Es ist doch ihr Geburtstag.«
»Sie will nicht mit zur Guestphalia«, rief Cousine Bettina, ehe ein anderer zu Wort kam. »Schön dumm ist sie, gehen wir eben allein.«
Mutter seufzte und stützte den Kopf in die Hände.
»Unsere Abendgestaltung passt der Dame nicht«, hielt Onkel Benno fest, trank den Rest aus seiner Kaffeetasse und fingerte unter dem Revers des Rocks nach seinen Zigaretten. »Bedauerlicherweise wird sie sich aber abfinden müssen, denn ich habe nicht vor, ihretwegen meine Pläne zu ändern.«
»Sag ich doch, um die Guestphalia geht’s«, tuschelte Cousine Bettina zu Ille herüber. »Sie will da nicht hin, sagt sie. Wie dumm kann man denn sein? Andere würden sich nach solcher Gelegenheit alle zehn Finger ablecken.«
Mutter seufzte von Neuem, verdrehte die Augen und bekam höchstwahrscheinlich Migräne. Sie ließ sich von Mia einen einzelnen Tropfen Milch in ihren Kaffee geben und zischte: »Geh in die Küche und brüh mehr Kaffee auf, wir werden uns hier eben behelfen müssen. Der Ottilie kannst du sagen, dass ich Ihr den Tag vom Lohn abziehe.«
»Warum lasst ihr die Püppi nicht selbst entscheiden, wie sie feiern will«, meldete sich wiederum Oma Hertha zu Wort, während sie Ille ein gewaltiges Stück Streuselkuchen aufschaufelte und es unter einem Berg Sahne begrub. »Wenn sie zu diesem Westfalen-Dingens nicht mag, dann geh ich eben mit ihr den Opa Paul begießen und hinterher auf ein Ei im Glas zu Poetge. Ist schließlich ihr Geburtstag, da soll sie doch tun, was ihr Spaß macht.«
»Mutter, mein Vater hieß Edgar!«, rief Illes Mutter schrill, zog den Kopf ein und presste die Hände auf die Schläfen.
»Es muss ja alles seine Grenzen haben«, murmelte Tante Ariane.
»Höchst aufschlussreich, Ihre Einstellung.« Onkel Benno ließ die elegante Zigarettenschachtel mit dem Schriftzug Duke of Edinbourgh auf die Tischplatte prallen. »Ist etwa unter diesem Dach die Moderne ausgebrochen, haben hier Suffragetten das Sagen, stehen die Anliegen der Tochter neuerdings über denen des Hausherrn? Heute ist beileibe nicht nur dieser Geburtstag, sondern das Stiftungsfest meiner Studentenverbindung. Vereinbart ist, dass die gesamte Familie sich auf dem Stiftungsball sehen lässt, doch für Schießklasse zwei ist eine solche Einladung wohl nicht Ehre genug. Lieber tummelt sie sich in einer Kaschemme für Friedhofsgärtner. Heute allerdings wird das Fräulein sich fügen müssen, ob es ihr schmeckt oder nicht.«
Oma Hertha gab Kontra, Tante Ariane und Cousine Bettina mischten ebenfalls mit und Ille mit ihrem Poesiealbum stand da wie bestellt und nicht abgeholt. Sie hatte sich so sehr auf den Tag gefreut. Auch auf den Abend. Für gewöhnlich durften zu den Veranstaltungen von Onkel Bennos Studentenverbindung nur Herren, aber einmal im Jahr gab die Verbindung einen Ball, zu dem die Gattinnen und erwachsenen Kinder der Mitglieder eingeladen waren. Onkel Benno hatte sie noch nie mitgenommen, was daran liegen mochte, dass sie weder seine Gattin noch seine Kinder waren. Heute jedoch hätten sie alle zusammen hingehen sollen und es hätte herrlich sein sollen, voller junger Männer, die studierten und standesgemäß zur Auswahl standen. Ille hatte eigens ein Kleid dafür bekommen, eins aus blauem Taft, kein bisschen kindlich und ohne Matrosenkragen.
Warum wollte Felice nicht mitkommen, warum wollte Felice nie das, was andere wollten?
»Schießklasse eins könnte übrigens seine Visage auch so langsam blicken lassen.« Onkel Benno klopfte sich mit der Zigarette auf den Handrücken. »Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Könige. Und des Kaisers nicht minder. Aber der junge Herr zur Nieden hat es wohl nicht nötig, wenngleich ich diesen ganzen Aufwand letztlich seinetwegen treibe. Vorausgesetzt, er fällt bei all diesen Eskapaden nicht auch noch durchs Abitur.«
»Bennochen, ich glaub, Sie müssen zum Arzt«, sagte Oma Hertha. »Der soll Ihnen was für die Nerven geben, bevor Sie der Schlagfluss erwischt.«
Ehe Onkel Benno platzen konnte, entstand Lärm an der Vordertür. Hannes, der Hausdiener, der nur stundenweise kam und sich dazu um den Garten kümmerte, war gegangen, um verspätete Gäste einzulassen, die aber hatten bereits einen Schlüssel benutzt. Ille hörte die fröhliche Stimme ihres Bruders, gefolgt vom wiehernden Kichern von Ottchen.
»Ob wir im Kintopp waren, willst du wissen?« Ottchen schien vor guter Laune zu sprühen. »Ach was, alter Hannes, viel besser. Wir waren da, wo se den Kintopp machen. In Babelsberg!«
»Da hört doch alles auf.« Benno, der an seiner Zigarette gezogen hatte, brach in bellenden Husten aus.
Mutter hielt sich noch immer die Schläfen. »Ich wünschte, du würdest mit diesen Zigaretten ins Herrenzimmer gehen, statt uns die Luft zum Atmen zu rauben.«
»Wir haben kein Herrenzimmer mehr, wie du dich erinnern dürftest«, versetzte Onkel Benno noch immer hustend. »In dem, was mir als ein solches zugestanden hätte, nächtigt der Nachwuchs des Postbeamten.«
Wie auf ein Zeichen wandten alle die Gesichter zur Decke, wo zeitgleich Schritte laut zu werden schienen. »Die gehen wieder im Kreis.« Mutter seufzte und presste ihren schmalen Kopf wie eine Nuss in den Zangen des Nussknackers. »Immer im Kreis, im Kreis, im Kreis. Zum Verrücktwerden ist das.« Sie fuhr zu Onkel Benno herum. »Und du geh mit deinem Qualm, wohin du willst, eine Ecke wird sich ja wohl finden lassen. Aber einen Salon vollrauchen, in dem Damen beim Gebäck sitzen, das ist degoutant.«
Onkel Bennos Antwort blieb ihnen erspart, denn im nächsten Augenblick polterten Willi und Ottchen ins Zimmer.
»Schwesterherzchen«, rief Willi und breitete die Arme aus. »Auch wenn du derzeit als Sargnagel für Onkel Benno, Mutter und Tante Ariane gleichzeitig fungierst – meinen allerherzlichsten, brüderlichsten Glückwunsch zum Eintritt ins sagenumwobene Reich der Erwachsenen.«
Ottchen trug einen Hut, den Ille nie an ihr gesehen hatte, einen kleinen Turban mit einer echten Aigrette, die beim Gehen wippte. Als würde sie mitten in Mutters vollgestelltem Salon Tango tanzen, wozu sie Ille zu alt, zu plump und zu wenig exotisch vorkam. Das Jackenkleid, das sie trug, passte farblich, drohte aber, in der Taille und über den Hüften aus den Nähten zu platzen.
Willi, der bei aller Glückseligkeit inzwischen bemerkt hatte, dass Felice fehlte, ließ die Arme sinken. »Ja, wo hat sie sich denn versteckt, unser Geburtstagskind?«
»In Babelsberg wart ihr?«, rutschte es Ille heraus. »Da, wo Asta Nielsen dreht?« Wenn es stimmte, dass man vor Neid grün wurde, dann musste ihr Gesicht einer Frühlingswiese gleichen.
»Genau da und nirgendwo anders.« Willi strahlte und legte den Arm um sie. »Das müsstest du sehen, Kleine, dir würden die Augen aus dem Kopf kugeln. Einen gigantischen Kasten aus Glas hat die Bioscop sich dort als Atelier hinstellen lassen. Das ist die Zukunft, Ille, von jetzt an wird’s bei uns Filme geben, von denen die in Paris nicht mal träumen. Und gerade heute ist die erste Klappe geschlagen worden zum neuen Film mit Asta Nielsen. Totentanz soll er heißen und sensationell wird er werden, so was hat die Welt noch nicht zu Gesicht gekriegt.«
»Im Abitur stecken und sich rumtreiben«, wetterte Onkel Benno vor sich hin, doch niemand achtete auf ihn. »Wann hat es das in einem ordentlichen Haus je gegeben, wann?«
»Und du hast Asta Nielsen wirklich gesehen?« Ille gab sich Mühe, ganz ruhig zu sprechen, aber die Worte purzelten, wohin sie wollten. »So ganz leibhaftig und von Nahem?«
»Ganz leibhaftig und von Nahem.« Willi zwickte sie in die Seite. »Und ob du’s glaubst oder nicht – sie ist in Wirklichkeit noch tausendmal hübscher als auf Zelluloid.«
»Gequirlter Quark.« Das war Ottchen. »Ich wette, unterm Rock hat sie Beine wie vom Storch im Poker gewonnen, und diese zarte Lilienhaut, liebe Güte, die hat bei Tageslicht ja auch so ihre Macken.«