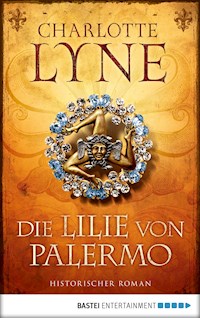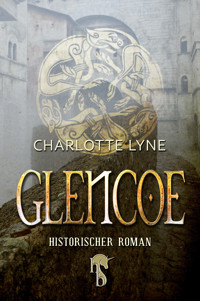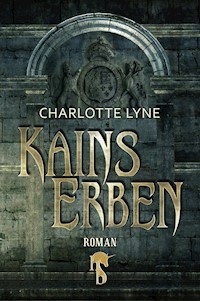6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
England, 16. Jahrhundert, Regierungszeit des großen Tudor-Königs Henry VIII. Drei Kinder, Fenella, Anthony und Sylvester, wachsen in Portsmouth auf. Ihre Welt sind Werften und Schiffe, ihr Lebensraum ist das Meer. Ein unzerstörbares Band von Freundschaft und Liebe verbindet sie miteinander, auch durch die härtesten Proben hindurch, die das Leben ihnen stellt. Und in verhängnisvoller Weise scheint das Schicksal der drei mit dem des Lieblingsschiffes von König Henry (oder Heinrich) Tudor verbunden zu sein, der „Mary Rose“, von deren triumphalem Stapellauf bis zu ihrem tragischen Untergang.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 892
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Charlotte Lyne
Kinder des Meeres
Historischer Roman
Für Maren
Wem der große Wurf gelungen,Eines Freundes Freund zu sein …
FRIEDRICH SCHILLER, AN DIE FREUDE
Your good ship, the flower,
I trow, of all ships that ever sailed.
ADMIRAL EDWARD HOWARD AN
KÖNIG HENRY VIII. ÜBER DIE MARY ROSE
Erster Teil
Werftkinder1511-1524
Nel dolce tempo de la prima etadeChe nascer vide et ancor quasi in erbaLa fera vogila che per mio mal crebbePerché cantando il duol si disacerba,Canterò com'io vissi in libertade.
Von der süßen Zeit der ersten Lebensjahre,In der die rasende Sehnsucht, die zu meinem Unglück weiterwuchs,Noch neugeboren war wie ein junger SprossWill ich singen, wie ich in Freiheit lebteWeil Singen den Schmerz lindert.
FRANCESCO PETRARCA, CANZONIERE
1Fenella
PORTSMOUTH, 19. Juli 1511
Fenella galt nicht als Zeugin. Wer in späteren Jahren jemanden suchte, der von der Tragödie jenes Tages zu berichten wusste, tat ihre Aussage ab. »Du warst zu jung«, behaupteten die Leute. »Du erinnerst dich nicht.«
Fenella aber erinnerte sich. Jede Einzelheit hatte sich ihr ins Gedächtnis gebrannt und würde dort bis an ihr Lebensende schwelen.
Es war einer jener saftlosen Sommertage, an denen der Himmel weder blau noch grau war, es herrschte eine unbestimmte Kühle, in der man sich ständig den Mantel vor der Brust zusammenzog, weil man einen Windstoß oder einen Regenguss erwartete. Was das Wetter anging, hätte man den Tag vergessen können. Fenellas Heimatstadt Portsmouth jedoch würde ihn so wenig vergessen wie Fenella selbst. Für sie beide war es ein Tag ohnegleichen – der Stapellauf der Mary Rose.
Der Tag, an dem der junge König, der achte Henry, seine Stadt besuchen würde. Noch vor wenigen Jahren hatte diese Stadt sich als Verfemte unter dem päpstlichen Interdikt geduckt, und jetzt erwies der schönste König der Christenheit ihr die Ehre.
Fenella mochte ein nutzloses Mädchen sein, doch sie wusste, dass die Stadt diesen Triumph ihrem Trockendock zu verdanken hatte, der Sensation des Schiffbaus, die in Europa einzigartig war. König Henry kam, um seinem brandneuen Schiff den Segen zu geben, ehe es aus der Werft hinausglitt, an Seilen geschleppt und dem Tower von London entgegen.
Monatelang hatten Fenella und ihre beiden Freunde auf diesen Tag gewartet. Sie waren die Werftkinder, wuchsen auf zwischen den Kammern der Docks, den Winden und Kränen, Hobeln und Sägen und den Schiffsleibern, die wie die Riesen fremder Sagen über der Wasserfläche aufragten. Versteckt hinter Holzstößen dachten sie sich Geschichten aus, in denen sie als furchtlose Helden die Weite der Meere durchsegelten. Die Geschichten, die sich um das Schiff Mary Rose rankten, waren die schönsten, die sie sich je erzählt hatten, und sie hatten sie nachgespielt, bis die Geschichten wirklicher geworden waren als die Welt, die sie umgab.
Heute würde die Mary Rose ihre Reise antreten. In London sollte sie aufgetakelt und für den Kriegsdienst gerüstet werden, denn der junge König war anders als sein Vater, der vor lauter Geiz den Weg in den Krieg gescheut hatte. Henry VIII. wollte England zu nie gekannter Größe führen, wollte dem Inselreich auf Europas Landkarte einen Platz verschaffen. Er würde sein Schiff wie einen bis an die Zähne bewaffneten Kriegshelden ausstatten lassen. Neben dreißig Kanonen aus Gusseisen sollte sie auf ihr Batteriedeck sieben aus Bronze bekommen, tonnenschwere Vorderlader, die durch verschließbare Geschützpforten auf gegnerische Schiffe feuern konnten.
Jene Geschützpforten waren die neuste Errungenschaft im Schiffbau. Die wenigen, die die Bordwand der Mary Rose zierten, waren zwar vorerst nicht mehr als ein Versuch, doch sie setzten ein Zeichen. Ein Schiff mit Geschützpforten, so hatte Fenellas Freund Anthony es ihr erklärt, war zu mehr gedacht als zum bloßen Verschiffen von Truppen. An seine Planung durfte sich nur ein Meister wagen, einer mit der Erfahrung von Jahrhunderten und dem Mut eines Augenblicks.
»Geschützpforten bauen heißt nicht, irgendwo in einen Körper ein paar Löcher zu schlagen.« Während er sprach, furchten sich Anthonys pechschwarze Brauen. »Das Problem ist der Schwerpunkt. Liegt er zu hoch, gerät das Schiff aus dem Gleichgewicht. Setzt man die Pforten aber zu dicht über den Wasserspiegel, läuft man Gefahr, dass Wasser in den Schiffsleib dringt.«
Fenella war stolz, weil Anthony mit ihr darüber sprach. Andere sahen über Fenella hinweg wie über Treibsel am Kieselstrand, aber Anthony sprach mit ihr, als verberge sich mitten im Treibsel eine Perle. Mit Sylvester sprach er natürlich auch. Was er ihnen von Schiffen erzählte, gehörte zu ihren Geheimnissen, über die sie vor dem Rest der Welt schwiegen wie drei Gräber. Fenella, Sylvester und Anthony. Die Werftkinder, die der Mary Rose beim Wachsen zugesehen hatten.
Die Schiffbauer, die sie gebaut hatten, gehörten zu den besten, die in Europa aufzutreiben waren. Der König hatte sie aus Portugal und Genua kommen lassen, damit sie seine eigenen Leute unterwiesen.
»Das ist eine Schande, oder nicht?«, hatte Anthony gefragt. »Unser Land liegt vom Meer umgeben, und dennoch haben wir keinen Mann, der uns ein solches Schiff bauen könnte.«
»Warum haben wir keinen?«, hatte Fenella zurückgefragt.
»Weil sich bei uns kein König je darum geschert hat. Wäre ich König von England, ich würde kein Handwerk so hoch schätzen wie den Schiffbau.«
»Ich wünschte, du wärst König von England, Anthony«, sagte Fenella und stellte sich seine Schultern unter königlichem Purpur vor.
»Ich nicht«, erwiderte Anthony.
»Was wärst du dann gern?«
Wind zerzauste sein Haar, und sein Blick schweifte ab. »Schiffbauer«, sagte er.
Anthonys Vater, Mortimer Fletcher, war Schiffbauer, und die Leute um den Hafen sagten, so lange die Stadt Portsmouth stehe, habe es hier immer Fletchers gegeben, die Schiffe bauten. Eine goldene Nase verdiente sich niemand damit. Seit jedoch der neue König regierte, winkten dem Schiffbauerhandwerk bessere Zeiten. Wer heute ein Schiff konstruierte, hielt die Welt in den Händen, für den gab es keine Grenze als den Himmel.
Fenellas Vater war kein Schiffbauer. Er wäre gern als Offizier einer Kriegsmarine zur See gefahren, doch der Geiz des alten Königs hatte seinen Traum zerstört. Stattdessen war er Beamter der Werftaufsicht geworden, weshalb er zur Feier des Stapellaufs im Hafen erwartet wurde. In aller Frühe legte er seine Uniform an, die grüne, gezaddelte Schecke mit den aufgestickten Buchstaben HR für Henricus Rex, einer auf jeder Seite der Brust.
»Warum nimmst du nicht Fenella mit?«, fragte Fenellas Mutter. »James Sutton und Mortimer Fletcher kommen gewiss nicht ohne ihre Söhne.«
»Aber Fenella ist kein Sohn«, brummte der Vater.
»Dafür kann sie so wenig wie ich«, erwiderte die Mutter wie immer, wenn er sie darauf hinwies, dass ihr einziges lebendes Kind dem falschen Geschlecht angehörte.
James Sutton war der brillanteste Schiffbauer von ganz Hampshire, und er und Mortimer Fletcher galten als Freunde des Vaters. Ihre Söhne, Sylvester und Anthony, waren Fenellas Freunde. Anthony war ihr lieber als Sylvester, der anrührend hübsch war und so süß zur Laute sang, dass es im Herzen wehtat. Sylvester machte sich nichts daraus, denn ihm war Anthony lieber als Fenella. Dass sie beide Anthony liebten, dass sie auf der Werft aufwuchsen und für Anthony Traumgeschichten von Schiffen erdachten, verband sie fester als ein geteertes Tau.
Seufzend bückte sich ihr Vater und hob Fenella, die für ihr Alter leicht war, auf die Arme. Fenella machte sich an seiner Brust stocksteif. Der Silberklang der Fanfaren und die Sehnsucht nach der Zauberwelt der Schiffsgeschichten lockten sie mit wilden Kräften, doch es verletzte ihren Stolz, dass ihr Vater sie ohne Zögern gegen einen Sohn getauscht hätte. Wenn du mich nicht willst, glaube nur nicht, ich könnte dich wollen.
»Gib auf die Kleine acht. Sie ist alles, was wir haben.«
»Das ist nicht anders, als hätten wir nichts.«
Fenellas Mutter verdrehte die Augen. Sie war älter als andere Mütter und hatte fünf Söhne geboren und begraben.
Der Vater schob die Tür auf und schleppte Fenella hinaus in den kühlen, grauenden Tag. Die schmale Gasse hinunter sprudelten Ströme von Menschen. Die Festmusik schwoll, und die Morgenluft war salzig und sämig wie der Teig, den die Magd Dinah des Abends in der Küche knetete, um ihn in der Frühe zu Broten zu backen, denen vor Frische die Kruste platzte. Der Duft machte Fenella Appetit. »Dieses Kind hat immer Hunger«, pflegte ihr Vater zu klagen. »Statt eines Sohnes habe ich eine Raupe bekommen, die mir die Haare vom Kopf frisst.«
Die Haare des Vaters hingen schlaff aus der Bundhaube. Fenella rührte sie nicht an. Sie hatte Hunger, weil das Meer ihn ihr machte.
Über seine Schulter hinweg sah sie Dinah, die nicht nur die Pflichten einer Magd, sondern auch die einer Kinderfrau versah und ihnen als ein stummer Schatten folgte. Ehe sie die Schranken vor den Docks erreichten, gab der Vater Fenella an den Schatten weiter. Mit einem Sohn auf den Armen zeigte ein Mann sich gern, doch eine unerwünschte Tochter gehörte in die Obhut eines Weibes.
Die zwei Wachmänner am Tor senkten eben die Spieße, um den Vater passieren zu lassen, als sich hinter ihnen ein Geschrei erhob. Zwei weitere Wachen schleiften ein mit bunten Lumpen behängtes Skelett von einer Frau durch die Menschenmenge. »Schon wieder Thomasin, die Hexe«, sagte einer der Torwächter zu Fenellas Vater. »Wenn der König zu hören bekommt, was die kreischt, ist der Stadt ihr großer Tag verdorben.«
»Euer Blendwerk von Schiff ist verflucht!«, kreischte die Lumpenfrau. »Es liegt kein Segen darauf, nicht mehr als auf dem Turm zu Babel! Jede Planke daran wird in Menschenleben bezahlt.«
»Wer hat die überhaupt reingelassen?«, fragte der Vater missgelaunt.
»Weiß der Himmel.« Sein Bekannter zuckte die Achseln. »Manch einer glaubt ja, es bringt Unglück, wenn er sich an der vergreift.«
Die Wachen an den Schranken schoben die Balken einen Spaltbreit auf, damit ihre Gefährten die Lumpenfrau hindurchstoßen konnten. Die setzte sich mit erstaunlichen Kräften zur Wehr und kreischte sich die Seele aus dem Leib: »Prahlhänse seid ihr und Gotteslästerer, ihr Leute von Portsmouth! Euer stolzes Schiff verlieren werdet ihr und die Blüte eurer Jugend dazu.«
Schaulustige drängten hinterdrein und ergingen sich in Salven von Gelächter. »Komm schon, Thomasin, erzähl uns was Hübsches von der Zukunft, dann lässt dich schon einer am Ale nippen!«
»Wie steht's um meine Sterne, Thomasin? Die blonde Nichte vom Waldmüller, geht die zur Ernte mit mir ins Heu?«
Einer der Spötter riss einem Wachmann den Spieß weg und bohrte der Thomasin das Stielende ins Hinterteil. Die Frau wurde vornüber geschleudert, sodass die Torwachen sie packen und hinaus auf die Straße stoßen konnten. Dinah, die unter Fenellas Gewicht ächzte, seufzte erleichtert auf und wollte dem Vater durch das Tor folgen, doch Fenella richtete sich in ihren Armen auf und spähte über ihre Schulter.
Thomasin, die im Schlamm der Straße kniete, stützte sich auf die dürren Arme und hob den Kopf. Schmieriges Haar hing ihr in Strähnen über das Gesicht. »Du, Mädchen«, sagte sie zu Fenella. »Du glaubst, dort im Becken wartet dein Vergnügen, doch in dem Becken wartet der Tod.« Es hatte nichts Wirkliches. Es war eine Szene wie aus einer ihrer Geschichten, ein Höhepunkt, auf den Sylvester ein Lied hätte dichten können.
»Kommst du jetzt weiter?«, knurrte der Vater Dinah an, aber die hatte Mühe, ihr Gleichgewicht zu halten, weil Fenella sich über ihre Schulter beugte.
»Lauf weg, lass dich nicht auf die Werft schleppen!«, sagte Thomasin zu Fenella. »Wenn du nicht fliehst, kommst du von dem Totenschiff im Leben nicht los. Du magst auf deine Freunde vertrauen, aber manchem muss ein Freund erst drei Mal das Leben retten, ehe er weiß, was er an ihm besitzt.«
Ein Lastenträger schleppte an seinem Joch zwei Bottiche vorbei und trat der Wahrsagerin auf die Hand. Die schrie auf, und im selben Augenblick gelang es Dinah, Fenella von ihrer Schulter zu zerren. »Nun aber weiter, junge Dame, und bloß nicht hingehört, was die Hexe schwatzt. Sonst wird's am Ende wahr.« So schnell sie auf ihren dicken Beinen konnte, folgte sie dem Vater ins Gedränge.
Fenella wünschte, sie hätte nicht hingehört. Die Worte der Alten machten ihr ein flaues Gefühl, und über das, was sie bedeuteten, wollte sie nicht nachdenken. An gar nichts wollte sie denken, nur an Anthonys Schiff. Schließlich war dies noch immer der Tag, auf den sie seit Monaten gewartet hatten.
Es war das Meer, das den Sturm in ihr besänftigte und die grausigen Worte zum Verstummen brachte. Über die Menschenmenge hinweg war das Meer nicht zu sehen, doch sein Duft war unverkennbar. Er erfüllte Fenella mit der vertrauten Erregung und machte die wirren Warnungen der Alten vergessen.
Vorn am Kai, wo die Schiffe warteten, stand die Tribüne für den König, geschmückt mit Girlanden im Rot und Weiß der Tudorrose. Fenella erhaschte einen Blick auf ihn, König Henry VIII., den strahlenden Herrscher, um den die ganze Welt England beneidete. In seiner roten, pelzbesetzten Schaube wirkte er groß, ja regelrecht ausladend. Obgleich er kaum zwanzig Jahre alt war, nahm er so viel Raum ein, dass die winzige Königin – die spanische Katherine, die ein paar Jahre älter war – neben ihm fast verschwand.
Es war aufregend, sie beide zu sehen, den König, der Englands Geschicke lenkte wie ein Steuermann sein Schiff, und die Königin, die seine Erben gebären würde. Gefeiert aber wurde an diesem Tag eine andere: die Verheißungsvolle, die Einzigartige, die Heldin ihrer Geschichten. Mary Rose. Der Viermaster zu fünfhundert Tonnen, der zu neuen Ufern segeln und ihrem Land Ruhm ohne Ende einbringen würde.
Tatsächlich waren es zwei Schiffe, die heute vom Stapel liefen, doch Fenella klangen Anthonys Worte im Ohr: »Das andere wird bald vergessen sein. Einmal wird man nur noch wissen, dass die Mary Rose hier gebaut worden ist.«
Wenn einer darüber urteilen konnte, dann Anthony. In den zwei Jahren, seit die Mary Rose aufs Kiel gelegt worden war, war er, sooft er entwischen konnte, an ihre Dockkammer gelaufen, um zuzusehen, wie aus Haufen von Planken und Knieholz, Kisten voll Nieten und Kübeln voll Harz der Schiffsrumpf in die Höhe wuchs. Gleich nach seiner Krönung hatte der König die Karacke in Auftrag gegeben. Anthony kannte jeden ihrer Spanten, jeden genialen Zug ihrer Konstruktion und jeden Fehler, der dabei vertuscht worden war. In gewisser Weise war sie nicht weniger sein Schiff als das König Henrys.
Wenn sein Vater ihn am Dock der Mary Rose erwischte, bog er seinen Körper wie einen Zweig vornüber, klemmte sich seinen Kopf zwischen die Beine und bestrafte ihn mit dem doppelten Riemen, den er um die Taille trug. Wenn Fenella Anthony hinterher wiedersah, wagte sie nicht, die Hand nach ihm auszustrecken, weil etwas um ihn war, das ihn unberührbar machte.
»Hat dein Vater dich sehr hart hergenommen?«, fragte sie scheu.
Er hob den Kopf, zog seine Brauen schräg in die Stirn und fragte zurück: »Was schert mich, was mein Vater tut? Das Schiff ist alles wert.«
»Alles, Anthony?«
»Wenn es mehr als alles gibt, auch das.«
Sie liebte es, dass er den Kopf so hoch trug, dass niemand ihm beikommen konnte. In den Augen der Leute taugte er nicht mehr als ein Straßenköter, doch in ihm steckte ein Kern, der wie ein Diamant war und den nur die Werftkinder, nur Fenella und Sylvester, kannten.
Bei der Aussicht, Anthony zu Gesicht zu bekommen, begann Fenella zu zappeln, bis Dinah gottergeben aufstöhnte und sie zu Boden gleiten ließ. Ehe die Kinderfrau sie bei der Hand packen konnte, lief Fenella ihr mit fliegenden Röcken davon. Sie kannte ihr Ziel, das Podium vor den Gleitschienen, auf dem die Schiffbauer die Arbeit in den Docks beaufsichtigten. Von dort würden sie gute Sicht auf die Mary Rose haben, viel besser als im Gedränge, wo man gar nichts sah. Vor allem aber würde Anthony dort sein.
Sie sah ihn schon von Weitem, dazu Sylvester und den unvermeidlichen Ralph, Anthonys Bruder. Fenella hasste ihn, wie sie Sylvesters Schwester Geraldine hasste. Dinah behauptete, sie sei nur neidisch, weil sie selbst keine Geschwister hatte, aber wer hätte Geschwister wie Ralph und Geraldine haben wollen? Selbst wenn sie ihr kaum Beachtung schenkten, waren die beiden ihre Feinde. Geraldine Sutton bedrohte die Welt, die Fenella liebte, und Ralph Fletcher bedrohte den Freund, der sie ihr schuf.
Unter den Schiffbauersöhnen galt Ralph als der Begnadete, der das Handwerk in eine glänzende Zukunft führen sollte. Mortimer Fletcher zumindest würde vor Stolz auf seinen Erstgeborenen eines Tages platzen. Ralph wurde nie mit dem Kopf zwischen die Beine geklemmt und mit dem Riemen verdroschen, wenn er sich an einem der Docks herumtrieb, sondern gelobt und wie ein hoher Gast hofiert. Der Gedanke erfüllte Fenella mit Zorn. Sie war ein Niemand, ein bedeutungsloses Mädchen, aber ihr Sinn für Gerechtigkeit war wütend wie das Meer, wenn es sich unter Winterstürmen auf den Strand warf.
Die drei Jungen – Anthony, Ralph und Sylvester – standen nicht bei ihren Vätern im Pulk, sondern zwischen den Gleitschienen, am Rand der jetzt leeren Dockkammer. Anthony stützte die Hände auf einen Pfahl und reckte sich, um seine Schöne zu sehen, seine Mary Rose, die in dieser Kammer auf Kiel gelegt worden war. Der Pfahl half ihm. Vor Jahren, als er gerade laufen gelernt hatte, hatte ein Unfall ihm die Knochen gebrochen. Etwas in seinem linken Knie war nicht mehr richtig zusammengewachsen. »Der fügt sich nicht«, sagten die Leute, »den kann keiner zügeln. Dass der sich das Bein zerschlagen hat, ist kein Wunder, sondern Gottes Strafe.«
Anthony sprach nie darüber. Wie ein Wolf in der Falle kämpfte er, um den Makel zu vertuschen, doch wenn er sich wie jetzt auf Zehenspitzen halten wollte, brauchte er eine Stütze.
Alle Fletchers hatten dunkles Haar, aber das von Anthony war schwarz. Vermutlich hatte er es von seiner Mutter, über die alles Erdenkliche gemunkelt wurde, auch wenn sie kaum je ihr Haus verließ. »Um die ganze Familie ist etwas Dunkles«, pflegte Fenellas Mutter zu sagen. In seinem Handwerk jedoch war Mortimer Fletcher beinahe so erfolgreich wie der gefeierte James Sutton. »Wartet nur ab, bis mein Sohn ein Mann ist«, hatte Fenella ihn prahlen hören. »Mein Ralph wird den formidablen James in den Schatten stellen. Dann brauchen wir auch keinen Nasehoch aus Genua oder Portugal mehr, der uns erklärt, wie man eine Karacke baut. Mein Ralph wird es tun. Mein Ralph wird Englands König eine Flotte schaffen.«
Jetzt allerdings war Ralph nicht damit beschäftigt, sich im Flottenbau zu bilden, sondern damit, seinen Bruder zu quälen. Wie so oft, wenn der Vater nicht hinschaute, sprang er hinter ihn und trat ihm gegen das verkrüppelte Bein. Meist verlor Anthony das Gleichgewicht, schlug lang hin, und wer dabeistand, brach in Gelächter aus. Der jüngere der Fletcher-Söhne galt als unnahbar und tückisch, sein Lächeln kannte kein Mensch, und es gab kein Missgeschick, das die Leute ihm nicht gönnten.
Wenn Ralph ihm zusetzte, stand Anthony auf verlorenem Posten. Der Bruder war einen Kopf größer als er und so stämmig, wie er selbst schmal und sehnig war. Mit seinen Tritten brachte Ralph ihn ins Schwanken. Anthony kippte zur Seite wie ein Schiff mit falsch gesetztem Schwerpunkt, doch ehe er diesmal stürzen konnte, verlieh der Pfahl ihm Halt. Vielleicht war es auch die Mary Rose, die ihm Halt gab. Er drehte sich nicht nach seinem Peiniger um, sondern sah dem leisen Schaukeln des Schiffes zu, als wäre Ralph nicht vorhanden. Die zweite Karacke, Peter Pomegranate, lag schräg dahinter, sodass die majestätische Mary Rose sie fast völlig verdeckte. Auch der Würdenträger, der die Festrede hielt, stellte sich an den Vordersteven der Mary Rose, unter das Rondell mit der Tudorrose, das ihr in den Leib geschnitzt war. Die arme Peter missachtete er, wie Anthony Ralph missachtete. Machtvoll erhob sich über seinem Kopf das Vorderkastell, ragten die Masten in den blassen Himmel. Die Außenwand des Schiffes war glatt wie aus einem Guss.
Anthony hatte Fenella erklärt, dass künftig alle Karacken nach der Kraweelbauweise, Stoß auf Stoß, gebaut werden würden, während man sie früher wie Hausdächer geklinkert hatte. »Im Mittelmeerraum baut man schon seit Jahrhunderten so.«
»Und warum, Anthony?«
Er hatte ihre Hand genommen und sie so behutsam über die glatte Fläche gestrichen, dass sie sich keinen Splitter einzog. Im Sonnenaufgang hatten sie sich hergeschlichen. Die Schläge, die er dafür bekommen würde, hielten ihn nicht ab. »Spürst du das? Es macht sie windschlüpfrig und viel stärker belastbar, weil Kraft von einer Kante zur anderen geleitet wird.«
Fenella nickte und streichelte mit ihm die Wand der erst zur Hälfte beplankten Karacke.
»Außerdem kann man Geschützpforten hineinschneiden, jede Art von Öffnung, die man braucht, solange man sich darauf versteht.«
»Du verstehst dich darauf, nicht wahr?«
»Nein«, sagte er. »Noch nicht. Aber ich glaube, ich bin einer von denen, die es lernen können.«
Sie hatte die Hand gehoben und flüchtig eines seiner Augen berührt. Seine Augen waren ein Mosaik aus goldbraunen Funken, die glitzerten, sooft er von Schiffen sprach.
Jetzt blickte sie wieder auf, zur Takelung der fertiggestellten Karacke. Noch waren die Spiere nackt, doch schon bald würden sich Segel daran blähen und ungestüm an ihrem Tauwerk zerren. Fenella wünschte, sie könnte näher bei Anthony stehen und seine Augen sehen. Kurz erwog sie, sich bemerkbar zu machen, doch so vertieft, wie er in die Betrachtung seiner Mary Rose war, hätte er für sie keinen Blick gehabt. Sylvester betrug sich genauso, hielt sich zurück und überließ Anthony seinem tiefsten Glück. Hin und wieder versuchte er, Ralph von ihm abzulenken, aber so zaghaft, wie er vorging, hatte er keinen Erfolg.
Die Zuschauer applaudierten, und der Redner trat ab. Sackpfeifer, die zugleich ihre Tabortrommeln schlugen, spielten eine Weise, die nach Weite und Wagnis klang. »Fang dieses Kind ein, Mädchen«, vernahm Fenella die Stimme ihres Vaters. »Wozu bezahle ich dich?«
Ehe Fenella ausweichen konnte, hatte Dinah sie gepackt und von den Jungen weggezerrt. »Du bleibst jetzt bei mir, junge Dame. Was glaubst du, wer du bist, eine Hafengöre?« Erbarmungslos schleifte sie Fenella an den Rand des Pulks. Von hier aus konnte sie das Schiff nicht mehr sehen, aber Anthony und die zwei anderen sah sie noch immer genau.
Den Augenblick der Unruhe nutzte Ralph, um Anthony das Gewicht seines Körpers in den Rücken zu rammen. Anthony krümmte sich vornüber auf den Pfahl, richtete sich jedoch blitzschnell wieder auf und drehte sich um. Ralph stieß einen Schrei aus und verschränkte die Arme vor dem Gesicht, als hätte der Bruder ihn geschlagen, auch wenn der nicht einmal eine Hand gerührt hatte.
»Beim heiligen Nicolas!«, erhob sich eine Stimme. »Kann nicht jemand diese Flegel zur Räson bringen?«
Wie ein Pfeil schoss Mortimer Fletcher aus dem Pulk und versetzte Anthony zwei schallende Ohrfeigen.
Gequält schrie Sylvester auf. »Nicht!«, presste er heraus, doch sein Protest blieb so gut wie unhörbar. »Anthony hat doch nichts getan.«
»Lass gut sein, Mortimer.« Das war James Sutton, Sylvesters Vater, auffällig schön mit seinem weißen Haar zur fast goldenen Haut und der gütigste Mann auf der Welt. Er trat vor und hob die Hand, als wolle er Anthonys Gesicht vor weiteren Schlägen schützen. »Wegen der kleinen Rangelei musst du den Jungen nicht vor aller Augen kränken.«
Mortimer Fletcher sah aus, als hätte er James Sutton gern erwürgt, doch er schluckte sein Schimpfwort hinunter und trollte sich zurück an seinen Platz. Anthony stand reglos am Pfahl und sandte Sylvester einen zornigen Blick. Sobald sein Vater und James Sutton sich zurückgezogen hatten, wandte er sich wieder der Mary Rose zu.
Fenella hätte ihm gern zugerufen, dass er ein Held war und Ralph eine hohle Schweinsblase, aber dafür hätte sie sich denselben zornigen Blick gefangen wie Sylvester. Anthony wollte weder Mitleid noch Bewunderung. Er wollte sein Schiff, sonst nichts.
Lange dauerte es nicht, bis Ralph auf etwas Neues sann. Wieder näherte er sich seinem Bruder und wisperte etwas in sein Ohr. Fenella stand zu weit weg, um ihn zu hören, doch sie kannte das Gift, das er versprühte: »Kannst du nicht auf deinen Beinen stehen, Krüppel? Brauchst du den Pfahl, damit du nicht in die Jauche plumpst?«
Damit traf er Anthony, wo er schutzlos und empfindlich war, und Fenella wusste, warum Ralph es tat: weil in Wahrheit nicht er, sondern Anthony der Begnadete war, der die Meister aus Portugal und Genua in Erstaunen versetzte. Ralph war krank vor Neid und bestrafte seinen Bruder dafür, dass dieser besaß, was er nie haben würde: Talent.
Anthony stand still, den Blick auf die Mary Rose gerichtet.
»Mit dem Älteren ist Fletcher gesegnet«, hörte Fenella einen der Werftaufseher sagen. »Aber mit dem Jüngeren ist er verflucht. Siehst du, wie gebannt er dieses Schiff anstarrt? Das hat etwas Teuflisches, oder?«
»Er ist von dem Schiff besessen«, erwiderte sein Nachbar. »Und er hat das Böse im Blick.«
Fenella betete, Anthony möge die gehässigen Worte an sich abprallen lassen. Eines Tages würde er ein Schiff wie dieses bauen, ein nie dagewesenes, das die Welt umrunden konnte. Ganz vorn am Bugspriet würde er stehen und aus dem Hafen hinaussegeln, fort von Ralph, fort von seinem Vater, fort von allem, was ihm Schmerz zufügte und ihn niederhielt.
Ralph trat einen Schritt zurück. Dass der Bruder ihn nicht beachtete, fachte seinen Zorn noch an. Der Stein, den er aufhob, war so groß wie zwei Fäuste. Mit einem Seitenblick versicherte er sich, dass niemand hinsah. Dann holte er zum Wurf aus.
Es war der Augenblick, auf den Anthony gewartet hatte, der, in dem die Schlepper anzogen und sich die Karacke in Bewegung setzte. Ihre große, dunkle Gestalt glitt aus der Enge des Beckens in die Freiheit, und Anthony musste Abschied nehmen. Nur noch einmal durfte er seinem Schiff seinen Segen geben, nicht jubelnd, wie der König es tat, sondern reglos und schweigend.
Ralphs Stein traf ihn an der Schulter und schlug den Augenblick entzwei. Anthony knickte in der Hüfte ein, dann fing er sich und fuhr herum wie ein Geschoss. Noch Jahrzehnte später hieß es, in seinen Augen habe rohe Wut gelodert, aber Fenella sah nichts als Erschrecken. Mit der Kraft eines Geschöpfs, das sich aufs Höchste bedroht fühlt, stieß er blindlings zu. Der Stoß traf seinen Bruder vor der Brust. Ralph war darauf nicht gefasst und taumelte drei Schritte rückwärts. Der dritte Schritt führte über den Rand. Haltlos baumelte sein Fuß ins Leere.
Vor Überraschung gelang es Ralph nicht einmal zu schreien. Er drehte sich um seine Achse und ruderte mit beiden Armen nach Halt, doch vor ihm war nichts als Luft. Anthony sprang hinzu, aber ehe er den Bruder greifen konnte, stürzte dieser hintüber ins Becken. Jede Einzelheit brannte sich Fenella ins Gedächtnis, aber keine so tief wie das Geräusch: Ralph fiel nicht ins Wasser, sondern schlug mit dem Kopf auf die steinerne Begrenzung. Dinah schrie und vergaß, Fenellas Schultern festzuhalten. Mit einem Satz entfloh sie und erhaschte einen Blick ins Becken. Aus Ralphs Schädel, der wie ein Ei geplatzt war, sickerten ihm Blut und gallertige Flüssigkeit ins Haar.
Mortimer Fletcher rannte an den Rand und stürzte auf die Knie. Sein Oberkörper schwankte, seine Hände rissen sich Haare aus, und sein Geheul klang wie das dunkle Grollen eines Tieres. Dann rückte die Menge nach und drängte Fenella beiseite.
Der Versuch, zu Anthony zu gelangen, war sinnlos. Fünf Aufseher stürzten sich gleichzeitig auf ihn, schwangen Knüppel und ließen Hiebe auf jeden Teil seines gekrümmten Körpers prasseln. Zu ihren Füßen sackte er zusammen. Fenella sah nur noch, wie er den Kopf reckte und in den leeren, grauen Himmel starrte, ehe ein Knüppelhieb ihn vor der Stirn traf.
Euer Blendwerk von Schiff ist verflucht, hallte es ihr durch den Schädel. Jede Planke daran wird in Menschenleben bezahlt. Sie wandte sich ab, zur Tribüne. Der hübsche rotgewandete König hatte nicht einmal den Kopf gedreht. Auch die Mary Rose glitt unbeirrt weiter übers Wasser, aus dem Hafen von Portsmouth, als hätten die Menschen, deren Schicksal sich hier entschied, nichts mit ihr zu tun.
2Sylvester
PORTSMOUTH, April 1520
Bis zu dem Tag, an dem die Mary Rose vom Stapel gelaufen war, hatte Sylvester mit seinen Freunden in den Anlagen der königlichen Werft gespielt. Zwischen den Docks tummelten sich die Kinder der Arbeiter beim Fangen und Verstecken, doch am liebsten bewaffneten sie sich mit den Resten der Planken und spielten Krieg gegen Frankreich. Sylvester und Fenella mieden wilde Spiele, um Anthonys lahmes Bein und seinen Stolz zu schonen. Stattdessen schufen sie sich hinter den Holzstößen eines Lagers, wo es nach Seetang, Baumharz und dem Pech der Kalfaterer roch, ein geheimes Reich.
Das Reich der Werftkinder. Hier waren sie die alleinigen Herrscher, hier bauten sie sich in ihren Träumen Schiffe, die über die Grenzen der bekannten Welt hinwegsegelten. Zum Zirpen von Sylvesters Kinderlaute sangen sie seine selbst erdichteten Lieder vom Heldentum auf See. Sooft Sylvester an jene Jahre seiner Kindheit dachte, erkannte er, dass er damals glücklich gewesen war, bis in den letzten Winkel seines Wesens glücklich, wie es später nie mehr möglich war.
Manchmal war Geraldine mitgekommen, obwohl sie die Docks und das Meer verabscheute. Sie fand, Anthony Fletcher sei erbärmlich schlecht erzogen und Fenella Clapham hölzern wie eine Schiffsplanke, ließ Fenella links liegen und traktierte Anthony mit feinen Spitzen. Damit tat sie Sylvester sogar mehr weh, als Ralph Fletcher es vermochte, weil er Ralph hassen konnte, seine Zwillingsschwester Geraldine hingegen lieben musste. Auch wenn er wusste, dass sie nur mitkam, um ihre verwunschene Welt zu verhöhnen, hörte er nie auf zu hoffen, sie würde eines Tages darin einen Platz für sich entdecken.
Dann war der Rumpf der Mary Rose fertiggestellt, und unter den Klopfhölzern und Stemmeisen der Kalfaterer errang sie ihre Seetüchtigkeit. Ein paar Wochen lang vergaß Sylvester, dass er eine Schwester besaß. Das Schiff beherrschte das Traumreich ihrer Spiele. »Die Mary Rose ist unser Schicksal«, sagte Sylvester und war unendlich stolz, dass ihm dieser Satz eingefallen war. Zu der Zeit las er gern Abenteuer von tapferen Recken, wie Thomas Malory sie in seinem Tod des Königs Arthur beschrieb. Der Satz klang wie eine bedeutungsschwangere Zeile aus dem Buch.
Fenella lachte auf: »Du redest wie der Priester, Syl.« Anthony aber wandte langsam den Kopf, sandte ihm seinen dunklen Blick, und dann lächelte er. Anthonys Lächeln war selten und flüchtig wie ein Regenbogen. Stolz trieb Sylvester Hitze in die Wangen. Sein Freund Anthony konnte machen, dass er sich stark fühlte, wie niemand anders es konnte.
Keine Woche darauf war der Zauber zerbrochen. Nach dem Tag, an dem die Mary Rose vom Stapel gelaufen und Ralph gestorben war, spielte kein Kind mehr zwischen den Becken der Werft. Ohnehin wuchs Sylvester aus dem Alter heraus, in dem ein Sohn vielversprechender Eltern sich in Traumspielen verlieren durfte. Sie lebten in einem Zeitalter des Umbruchs, das einem Mann von Verstand alle Türen öffnete, auch wenn er schlichter Herkunft war. Noch immer war nach dem Krieg der Rosen der Adel ausgedünnt und dürstete nach frischem Blut. Zudem umgab sich Henry, ihr König, gern mit Männern von niederem Stand. Von Kardinal Wolsey, seinem engsten Berater, hieß es, er sei der Sohn eines Schlachters aus Ipswich.
Im Jahr nach dem Stapellauf zog England in Frankreich wie in Schottland in den Krieg. König Henry hatte in Portsmouth fünf Brauhäuser errichten lassen, um den Durst seiner Mannschaften zu stillen, doch er brauchte auch Offiziere, die auf seinen Schlachtschiffen das Kommando führten. Genug Herren von Adel gab es nicht, also wurde nach Männern bürgerlicher Herkunft gesucht, die sich auf Schiffe verstanden und gebildet und manierlich waren. Sylvesters Vater war einer dieser Männer.
England schlug sich in beiden Kriegen glorreich, und im Triumph kehrten die Truppen heim. Sylvesters Vater wurde für seine Leistung mit der Erhebung in den Ritterstand und der Pacht über ein ertragreiches Stück Land belohnt. Er erfüllte sich seinen Lebenstraum, indem er das geziegelte Fachwerkhaus, in dem seine Kinder geboren worden waren, umfassend ausbauen und erweitern ließ, sodass es reichlich Platz für eine lebhafte Familie und einen endlosen Strom von Gästen bot. Zwischen den hölzernen Balken ließ er es weißeln, legte einen prachtvollen Garten an und nannte es Sutton Hall.
Was ihn selbst betraf, so war er damit am Ziel seiner Wünsche, doch seinem Sohn sollte jeder Weg offenstehen. Das neue England, so hatte Henry VIII. verkündet, würde ein Garten der Bildung werden, also suchte James Sutton nach einem Gelehrten, der seinem Sohn zu dieser Bildung verhalf. Er fand ihn in Benedict, dem Dekan von Sankt Thomas, einem Theologen von zwar wenig spektakulärem, doch solidem Ruf. Mit Sylvester sollten vier weitere hoffnungsvolle Söhne aus Kleinadel und gehobenem Bürgertum unterrichtet werden.
Vor Beginn des Unterrichts bestürmte Sylvester seinen Vater: »Kann Vater Benedict nicht auch Anthony nehmen? Er ist klüger als wir alle zusammen, und wenn er nicht zur Schule darf, gehe ich auch nicht hin.«
Sein Vater strich ihm über den Kopf und verlor sich flüchtig in Gedanken. »Ich spreche mit Mortimer Fletcher«, versprach er schließlich. »Glaub mir, dein Anthony liegt mir nicht weniger am Herzen als dir.«
Seit Anthonys Vater seinen Erstgeborenen verloren hatte, war er nur noch ein Schatten. Mortimer Fletcher war mit Sylvesters Vater in den Krieg gezogen, weil er nie wieder ein Schiff bauen wollte und sonst nichts zu tun wusste. Vielleicht tat er es auch, um seinem Zweitgeborenen aus dem Weg zu gehen, den er fürchtete wie der Teufel das Weihwasser. Damals bei den Docks hatten die Aufseher Anthony niedergeschlagen wie ein gefährliches Tier, hatten ihm die Hände auf den Rücken gekettet und ihn ins Stadtgefängnis verschleppt. Gewiss hatte sein Vater geglaubt, damit sei er ihn los, aber so leicht räumte sich sein Problem nicht aus der Welt. Nach drei Wochen erbitterter Verhandlungen hatte man ihm Anthony zurückgeschickt. Die Ratsherren waren zu der Erkenntnis gekommen, dass sie keinen knapp achtjährigen, verkrüppelten Schiffbauerssohn an den Galgen knüpfen mochten, weil der einem anderen einen Stoß versetzt hatte, wie Jungen es nun einmal taten. Auch wenn der andere an dem Stoß gestorben war. »Hängt das Untier auf!«, hatten Leute in den Gassen geschrien, aber es hatten ja auch Leute in Jerusalem »Kreuzigt ihn!« geschrien. Statt sich die Hände in Unschuld zu waschen, hatte der Rat der Stadt Portsmouth es vorgezogen, sie sich gar nicht erst schmutzig zu machen.
Beinahe wäre Anthony trotzdem gestorben. Musste ein Kind nicht daran sterben, dass man es halb besinnungslos schlug, es in eine Zelle für reißende Bestien sperrte und ihm sein Essen durch eine Luke zuschob? Als sie ihn herausließen, hatte er das Sprechen verlernt und ertrug nicht, wenn andere zu ihm sprachen. Sylvester tat das Einzige, was ihm einfiel: Tag für Tag setzte er sich mit seiner Laute zu ihm und sang ihm ihre erdichteten Schiffslieder vor. Anthony starb nicht. Er fand seine Stimme wieder und erholte sich.
Somit war Mortimer Fletcher gezwungen, die Frucht seiner Lenden aufzuziehen, musste den Galgenstrick, der seinen Liebling auf dem Gewissen hatte, kleiden, ihm Nahrung hinstellen und ihn unter seinem Dach dulden. Auf die Hilfe seiner Frau konnte er nicht zählen. Es gab Gerüchte, die schwarzbraune Lettice, einst eine dunkle, sinnliche Schönheit, habe nach dem Tod ihres Ältesten den Verstand verloren und sich völlig in ihre eigene Welt zurückgezogen. Als Sylvesters Vater Mortimer mit dem Vorschlag kam, Anthony zur Schule zu schicken, war er daher nur allzu erleichtert, ihn tagsüber los zu sein. Unter den Vätern der anderen Jungen gab es Gemurre, aber letzten Endes fügten sie sich. An dem, was Sylvesters Vater wollte, kam in Portsmouth niemand vorbei, also musste man den kleinen Satansbraten mit knirschenden Zähnen dulden.
Untier. Galgenstrick. Kleiner Satansbraten. Sylvester und Fenella hörten jedes dieser Worte, mit dem die Leute ihren Freund bezeichneten. »Jedes einzelne tut mir weh, als ob mir jemand eine Ohrfeige gibt«, vertraute Sylvester Fenella an.
»Dir gibt die keiner«, verwies sie ihn. »Es ist Anthony, der sie bekommt, nicht mit der flachen Hand, sondern mit der Faust.«
»Ich weiß.« Sylvester schlug den Blick zu Boden. »Am liebsten würde ich ihm meine Hände auf die Ohren pressen, sobald das Pack seine Hetzreden anfängt. Aber er sieht mich immer an, als dürfte ihn kein Mensch berühren.«
Fenella sandte ihm einen ihrer Blicke, die er nicht zu deuten wagte. Sie hatte graue Augen. Wie die Nebel über dem engen Meer, das Solent hieß. Wie ihre Heimatstadt Portsmouth: grau, nicht auffällig, doch voller Geheimnisse.
Immerhin hatte Sylvester erreicht, dass Anthony Vater Benedicts Schulstube besuchen durfte. Anthony schien ihm dankbar dafür zu sein, auch wenn er darum keine Worte machte. Er folgte dem Unterricht mit ungeteiltem Interesse, schweigsam und begierig, jede Silbe aufzunehmen. Es war, als hätte er seine einstige Hingabe an den Schiffbau jetzt, wo ihm die Werft verboten war, durch die ermüdenden Lektionen des Dekans ersetzt.
Sylvester hingegen langweilte sich in der Schule. Er hätte gern Lukrez gelesen, Cicero, die wiederentdeckten Querdenker der Antike, über die brillante Geister in ganz Europa sich die Köpfe heißredeten. Der Dekan aber setzte ihnen stumpfe, ewig gleiche Beschreibungen von Feldzügen vor. Starrsinnig wie ein blinder Esel hielt er am Althergebrachten fest, während Sylvesters Hirn nach Neuem gierte. Außerhalb des Schulgebäudes gärte und brodelte die Welt wie ein Vulkanschlund. Aus Deutschland vernahm man Unerhörtes: Ein Mönch, ein Draufgänger namens Martin Luther, hatte eine Liste von Thesen an eine Kirchentür genagelt, die das Gemäuer des Christentums erschütterten. Sylvester war fasziniert von dem Gedankengut, das keine Grenzen und Verbote akzeptierte, sondern sie leichthin niederriss. Die neue Lehre glich dem Schiff, das sie sich als Kinder erträumt hatten und das sich von Ankerketten nicht aufhalten ließ.
Oft wünschte Sylvester sich, aufzubegehren und Vater Benedict zu widersprechen, wenn der von seinem Pult herab eine Lehrmeinung für unumstößlich erklärte, die ihm überholt und anfechtbar vorkam. Warum soll für die, die kein Latein können, nicht ein Text der Bibel übersetzt werden?, hörte er sich rebellisch in den Raum rufen, als der Dekan die Bewegung der Lollarden verteufelte, die für eine englische Fassung der Bibel kämpften. Hat Gott Sein Wort nicht uns allen hinterlassen? Hat Jesus nicht zu Fischern und Bettlern gesprochen, die von der Sprache der Römer kein Wort verstanden?
Im Raum herrschte Schweigen, nachdem Vater Benedict geendet hatte. Sylvester öffnete den Mund, doch das Krächzen, das sich seiner Kehle entrang, hörte nur er selbst.
Auf Vater Benedicts Pult lag ein Stock, ein biegsames Holz, viel härter als die Birkenrute, die Lehrer für gewöhnlich benutzten. Sobald Sylvesters Blick auf den Stock fiel, rutschte ihm der Heldenmut in die Hosen. Wie brachte ein Lollarde es fertig, für seine Lehre ins Feuer zu gehen, auf einem Scheiterhaufen stillzustehen, während das eigene Fleisch zu Asche verkohlte? Sylvester hatte Angst vor Schmerzen. Noch mehr Angst hatte er davor, niedergeschrien und gedemütigt zu werden. Dabei hatte er in Wahrheit keinen Grund, sich zu fürchten. Vater Benedict wies ihn nie anders als milde zurecht und rührte den Stock nicht an. Er war schließlich Sylvester Sutton, der Sohn von Sir James, dem beliebtesten Mann von Portsmouth. Einem wie ihm zerrte kein Lehrer die Hosen vom Hintern, um ihn über einem Schulpult durchzuprügeln, und dass ihn ketzerische Gedanken berauschten, sah man ihm nicht an.
Noch etwas anderes berauschte Sylvester: Er war sechzehn, der Frühling brach an, und auf einen Schlag schien die Stadt voller Mädchen zu sein. Die Mädchen schwangen ihre Hüften, und ihre Zöpfe hüpften unter ihren Hauben; sie steckten die Köpfe zusammen, gerieten miteinander ins Tuscheln, und manch eine drehte verstohlen den Kopf nach ihm. Oft hielt er es in Vater Benedicts Unterricht kaum aus, weil es ihm vor lauter Frühling und Mädchen in den Lenden kribbelte und weil sich mit dem Kribbeln in den Lenden nicht stillsitzen ließ.
»Master Sylvester!«, rief Vater Benedict ihn auch jetzt mit einem Schnarren in der Stimme zur Ordnung und senkte die Hand auf den Stock. »Glaubt Ihr, der Verlauf der Gallischen Kriege prägt sich Eurem Gedächtnis ein, wenn Ihr statt auf die Zeilen aus dem Fenster stiert?«
»Nein, natürlich nicht«, stammelte Sylvester und sprang auf. Hastig senkte er den Blick aufs Buch, wobei er feststellte, dass er keine Ahnung hatte, wovon auf der Seite die Rede war.
Die Mitschüler lachten. Nur Anthony lachte nicht. Er war ebenfalls aufgestanden und sah dem Dekan unbeirrt entgegen, als könne sein Blick Sylvester beschirmen. Vater Benedict klopfte mit dem Stock auf die Tischplatte. Einen Herzschlag lang spürte Sylvester, wie ihm aus den Poren im Nacken der Schweiß brach.
»Ihr seid hier nicht nur, um Euch im Lateinischen zu üben«, ermahnte ihn der Dekan, »sondern auch, damit Ihr lernt, Eure niederen Triebe zu beherrschen, wie es dem Allmächtigen gefällt. Versündigt Euch nicht! Der Schlund der Hölle kennt keine Wiederkehr.« Noch einmal klopfte er mit dem Stock aufs Pult, dann ließ er ihn liegen, und Sylvester atmete auf. Seine niederen Triebe würde er auch in den nächsten Tagen nicht besser beherrschen. Wenn es das war, was der Allmächtige verlangte – weshalb füllte er dann die Welt mit schönen Mädchen?
Im selben Frühling lernte Sylvester, dass die Schönheit seiner Schwester Geraldine die der anderen in den Schatten stellte. Schön war an jedem Mädchen etwas, wenn man nur gut genug hinschaute, doch Geraldines Schönheit, ihre blauäugige, glänzende Makellosigkeit, gehörte einer anderen Sphäre an. Manchmal, wenn sie beide allein waren, tanzte Geraldine stumm zu den Weisen, die Sylvester auf seiner Laute spielte. In diesen seltenen Augenblicken erkannte Sylvester, dass kein anderer mit ihr hätte tanzen können, dass kein gewöhnlicher Mann ihr gewachsen war.
Ihr Vater erhielt zwei Anträge für sie, beide von Söhnen aus gutgestellten adligen Familien, doch Geraldine lehnte einen wie den anderen ab. Tantchen Micaela, die seit dem Tod der Mutter ihren Haushalt führte, verlegte sich aufs Schimpfen: Hätte sie als Jungfer es gewagt, einen akzeptablen Bewerber zurückzuweisen, so hätte ihr Vater ihr jedes Widerwort aufs Hinterteil gezählt und der Familie des jungen Mannes mitgeteilt, seine Tochter sei entzückt.
Vermutlich war Tantchen Micaelas Vater tatsächlich ein Mann von solchem Schlag gewesen, denn er hatte seine zarten Töchter, Micaela und Juana, in fast noch kindlichem Alter übers Meer geschickt, allein mit einem spanischen Koch zur Begleitung. Im Gefolge der königlichen Braut Katherine waren die Schwestern aus ihrem sonnigen Aragon ins neblige Zwielicht Englands gelangt. Prinzessin Katherine heiratete den Kronprinzen Arthur und nach seinem Tod dessen Bruder, den frisch gekrönten König Henry, und etliche Damen ihres Hofstaats fanden Bräutigame unter des Königs Untertanen. Die schöne Juana fand James Sutton.
Sylvester erinnerte sich nicht an seine Mutter, die gestorben war, kaum dass ihre Zwillingskinder geboren waren. Er wusste nur, dass sie goldblond gewesen war, wie man es von keiner Spanierin erwartete, und dass sein Vater sie geliebt hatte und an ihrem Tod beinahe selbst gestorben wäre. Die Bediensteten im Haus erzählten sich, nachdem das Schweißfieber Juana Sutton dahingerafft hatte, sei sein Haar in einer einzigen Nacht schneeweiß geworden.
Dass er nicht zerbrochen war, verdankte James Sutton Micaela, Juanas Schwester, die samt Carlos, dem Koch, ins Haus gekommen war, um für ihn und seine Kinder zu sorgen. Sylvester hatte sie sein Leben lang als sein Tantchen gekannt, als immerwährende Präsenz, die über Hof und Herd herrschte, Nasen putzte, Kleider zurechtzupfte, kandierte Pflaumen austeilte und schimpfte, wenn er ohne Haube aus dem Haus lief. Erst in diesem Frühling, in dem er sechzehn wurde, fiel ihm auf, dass Geraldine einen Gutteil ihrer Schönheit von Micaela geerbt hatte. Im Grunde bemerkte er es erst, als Anthony, mit dem sonst über dergleichen kein Reden war, zu ihm sagte: »Deine Tante ist eine schöne Frau.«
Sie war tatsächlich schön. Blond, grazil und voll Leben, aber nicht makellos wie Geraldine. Micaela wuchs in strohigen Büscheln Haar aus den Ohren, und das, fand Sylvester, machte ihre Schönheit irdisch. So wie ihr Wesen.
Geraldine war anders. Unirdisch und fehlerlos. Aus Furcht vor Haarbüscheln untersuchte sie jeden Morgen mit einem Spiegel ihre Ohren.
»Dein Vater ist ein Lamm!«, schimpfte Tantchen Micaela auf Geraldine ein. »Warum erlaubt er dir törichtem Küken, die Hand eines Edelmannes auszuschlagen, he?«
Der Vater lachte darüber und strich dem Tantchen über die Wange. »Sei nicht so streng mit ihr, Mica. Frag sie lieber, warum sie sie ausschlägt, die edelmännische Hand.«
»Weil ich von hier fort will«, erwiderte Geraldine. »Irgendwohin, wo nicht jeder Tag gleich verläuft, wo nicht alles gewöhnlich und belanglos ist und zwischen Schafsdung und Fischgestank versauert. Warum beschaffst du mir keine Stellung bei Hof, Vater? Ich will dorthin, wo schillerndes Licht ist, Glanz und Erregung, Luft, die nicht stillsteht und stinkt.«
Der Vater stand auf und schloss seine Tochter in die Arme. »Haben wir geahnt, Mica, dass unter unserem Dach ein Stern heranwächst?« Er senkte den Kopf und küsste Geraldines Scheitel. »Meine Bachstelze, du hast dir den falschen Vater ausgesucht. Einen mit Beziehungen hättest du gebraucht, einen, der dir den Himmel bieten kann, an den ein Stern gehört.«
Geraldine befreite sich. »Dann wirst du dir eben Beziehungen schaffen müssen«, erwiderte sie. »Davon, dass du bei deinen Rosen stehst und Stecklinge hegst, bekommst du jedenfalls keine.«
Ihr Vater liebte seine Rosen. Seine Kinder aber liebte er mehr und Geraldine noch mehr als Sylvester. Sie war immer die Stärkere, Kühnere, Geschicktere von beiden gewesen, und sie war schön, sie war der Engel von Portsmouth. Mit den Wünschen seines Sohnes ging der Vater großzügig und vernünftig um, doch die Wünsche seiner Tochter waren ihm Befehl.
Im Frühling des Jahres 1520 saß König Henry seit elf Jahren auf Englands Thron, und Sylvesters Vater begann, seine zahllosen Bekannten für seine Tochter um Vermittlung zu bitten. Geraldine sprach Tag und Nacht davon, dass sie im Herbst nicht mehr hier sein würde. Am Hof in London würde sie leben, wo der König die Fenster aufriss, damit der neue Wind den alten Mief davontrug.
Der Gedanke, seine Schwester zu verlieren, schmerzte Sylvester, doch ihm war klar, dass sie nicht aufzuhalten war. Sie langweilte sich in Portsmouth zu Tode. Über die schmachtenden Blicke, mit denen die Männer sie bedachten, sah sie hinweg, als wären sie Luft. Auch mit ihrem Bruder verbrachte sie ihre Zeit nur, weil sie nichts Besseres zu tun fand. Über seine Freunde urteilte sie härter denn je: »Dass du mit der Schiffsplanke Fenella Clapham herumstreunst, mag noch angehen, aber vor dem Unaussprechlichen sollte dir schaudern. Wer sich mit dem Teufel zum Würfeln setzt, verspielt seine Seele, Sylvester.«
Die maßlose Schmähung traf Sylvester schmerzhafter, als wenn sie ihn selbst beschimpft hätte. Anthony und Fenella waren die Pfeiler seiner Welt. Sooft Fenella ihre gebrechliche Mutter allein lassen konnte, rannte sie die Straße zu Sankt Thomas hinauf, um ihre Freunde vom Unterricht abzuholen. Dann gingen sie zu dritt über die Brücke, die über den Creek aus der Stadt hinausführte, setzten sich am Ufer des Wasserlaufs ins Schilf und sprachen von Gott und der Welt. Nur von Schiffen sprachen sie nicht mehr. Seit jenem Tag, an dem die Mary Rose vom Stapel gelaufen war, war Anthony die Werft verwehrt, und an dieser Wunde wollte keiner rühren.
Wenn Sylvester Fenella vor dem Haus des Dekans warten sah, kam es ihm vor, als vollführe sein Herz einen Sprung. Nichts Gewaltiges, nur eine Art wiederkehrendes Zeichen, mit dem das Herz Fenella grüßte. Die kleine Regung blieb Fenella vorbehalten. Keins der anderen Mädchen, die sein Herz zum Flattern brachten, war wichtig genug für solch einen Sprung.
Anthony schien sich in diesem Frühling von ihm zu entfernen. Sylvester hätte über Etliches mit ihm sprechen wollen, das er weder seinem Vater noch Fenella anvertrauen konnte. Nicht nur über das Kribbeln in den Lenden und den Hüftschwung einer drallen Seilerstochter, sondern auch über das Buch, das er las, ein schmales Bändchen, das ein Niederländer namens Erasmus verfasst hatte und das Julius vor der verschlossenen Himmelstür hieß.
Jede Zeile darin war so unerhört, dass Sylvester der Atem stockte. Der Verfasser ließ den verstorbenen Papst Julius vor die Himmelspforte treten und sie verschlossen finden, weil all das Geld, das er für seine Kirche angehäuft hatte, seine Kriege und Prachtbauten dem christlichen Glauben keinen Nutzen gebracht hatten. Wann hätte je ein Mann gewagt, mit derart ätzendem Witz und so viel geschliffener Frechheit über ein Oberhaupt der Kirche herzuziehen? Sylvester las das Buch heimlich, unter dem Pult in Vater Benedicts Schulstunde. Hätte er es daheim herumliegen lassen, wäre Tantchen Micaela vermutlich tot umgefallen.
Anthony fiel nicht tot um, als Sylvester ihm von dem Buch erzählte. Er zuckte nicht einmal mit einem schwarzen Kranz Wimpern. »Wenn es dir Spaß macht, Sylvester«, murmelte er, und in seinen Augen stand jener abwesende Ausdruck, als glitte das, was Sylvester ihm erzählt hatte, an ihm vorbei. So war es jetzt oft. Der Freund entzog sich, und was hinter seiner Stirn vorging, ließ sich um nichts in der Welt ergründen. Umso schärfer beobachtete ihn Sylvester. Es regte ihn auf, dass Anthony sich selbst genügte, dass er noch immer in ein inneres Reich verschwinden konnte wie in ihrer Zeit als Werftkinder. Nur dass Sylvester zu dem Reich keinen Zutritt mehr hatte.
Am Anfang eines jeden Monats händigte Vater Benedict jedem Jungen zwei Bögen Papier aus, auf denen sie ihre Übungen anfertigen sollten. Das Papier war Vater Benedicts Heiligtum. Beständig hielt er Predigten darüber, wie sich durch sorgsame Arbeit und aneinandergedrängte Buchstaben das kostbare Gut aufs Sparsamste verwenden ließ. Dennoch kam kaum ein Schüler mit den zwei Bögen aus. Zu viel musste gestrichen, verbessert und noch einmal von vorn begonnen werden. Ihre Väter kauften daher Papier dazu, um ihnen Vater Benedicts Strafen zu ersparen. Mortimer Fletcher kaufte keines, aber Anthony wurde trotzdem nie bestraft. Monat für Monat füllte er die Bögen mit engen, schönen, nach vorn geneigten Buchstaben. Nie musste er etwas wegstreichen, nie quetschte er ein Wort über das andere, sondern gab stets zwei makellose Seiten ab.
»Wie bringst du das fertig?«, fragte Sylvester.
Anthony zuckte mit einer Schulter. »Ich schreibe es erst auf, wenn ich es mir im Kopf zurechtgemacht habe.«
Sylvester bewunderte ihn. Für ihn selbst war es sinnlos, derlei auch nur zu versuchen, wie es auch sinnlos war, gegen Anthony Schach zu spielen. Anthony sah aus, als schliefe er ein oder wäre in Gedanken so weit weg wie der Weltumsegler Ferdinand Magellan, aber während er schlief oder die Welt umsegelte, setzte er Sylvester in ein paar gleichmütigen Zügen matt.
Dann kam der Frühling. An diesem Dienstag prallte die Sonne ins Fenster, ließ den Staub im Luftzug flimmern und die Schattenflecken auf dem Holz des Pultes tanzen. Auf Anthonys Hälfte lag sein aufgeschlagenes Textbuch und daneben das Papier mit seiner Übersetzung in sparsamer, gestochener Schrift. Anthony schien in die Arbeit versunken zu sein, hielt den Blick gesenkt und die Brauen in die Stirn gewölbt. Hätte Sylvester nicht unter dem Pult eine Schrift des Erasmus gelesen, er hätte nicht bemerkt, was sein Freund tat.
Der hielt sein zweites Blatt Papier auf den Knien und ließ ein gespitztes Stück Kohle in fieberhafter Hast darüber gleiten. In alle Richtungen breitete das Netz der Linien sich über den Bogen aus, und im Nu schälte sich aus dem Gewirr ein Bild. Flüchtig glaubte Sylvester, die Mary Rose zu erkennen, doch der Rahmen aus Krummholzspanten wies völlig neue, ihm fremde Züge auf.
Du bist ein Verräter!, durchzuckte es ihn. Wenn du nicht davon loskommst, wie kannst du es mir, deinem Freund, verschweigen? Haben wir diese Leidenschaft denn nicht geteilt?
In seinem Zorn bemerkte Sylvester nicht, wie Vater Benedict den Stock packte und auf ihren Platz zuschoss. Als er ausholte, war es zu spät. Mit einem Pfeifen zerschnitt der Stock die Luft und sauste krachend auf die Platte des Pultes nieder. Das Tintenfass stürzte um, und ein schwarzer Strom ergoss sich über Anthonys sauber beschriftetes Papier. Noch einmal holte Vater Benedict aus und ließ den Stock über Anthonys Hände schnellen. Die Zeichnung entglitt seinen Fingern und segelte zu Boden.
Der, der schrie, war Sylvester. Anthony biss sich auf die Lippen und blieb stumm.
»Steh auf«, befahl Vater Benedict. Jede Ader in seinem Habichtsgesicht war knüppeldick angeschwollen.
Anthony erhob sich. Reglos, mit geradem Rücken, stand er da, wie er gestanden hatte, wann immer Ralph ihn schikaniert oder sein Vater ihn sich vorgenommen hatte. Er ist ein Held, hatte Sylvester damals gedacht, aber Anthony war mehr. Er sah aus, als verfüge er über die Fähigkeit, sich wegzunehmen und von allen Quälereien unbehelligt zu bleiben.
»Heb das auf!«, schrie der Dekan ihn an.
Anthony ging in die Hocke, wobei er das verkrüppelte Bein zur Seite strecken musste. Er hatte es so oft geübt, dass er selbst dabei nichts von seiner eigentümlichen Anmut verlor. Mit dem Blatt in der Rechten erhob er sich wieder. Quer über den Handrücken zog sich ein Striemen, der beim Zusehen anschwoll.
»Gib das her!«
Dieses Mal gehorchte Anthony nicht. Er blieb stehen und hielt das Blatt, die Zeichnung des Schiffes, mit den zitternden Fingern der verletzten Hand umklammert.
»Gib das her, habe ich gesagt.« Die Stimme des Dekans wurde gefährlich leise. Als Anthony sich noch immer nicht rührte, hob er von Neuem den Stock.
»Nicht!« Sylvesters Stimme war ein Wimmern.
Der Dekan beachtete ihn nicht, sondern schlug über Anthonys Hände. Muskeln zuckten, Haut platzte auf, doch die Finger umklammerten das Papier noch fester. Ungerührt ließ der Dekan den Stock fallen und schnappte sich das Blatt. Mit einem Ratschen zerriss es. Zwischen den Zähnen stieß Anthony einen zischenden Schmerzlaut aus.
»Ein Schiff«, sagte der Dekan und betrachtete die Zeichnung. »Dafür vergeudest du teures Material, das dir für deine Arbeit übergeben worden ist – um ein Schiff zu zeichnen?«
»Ja, ehrwürdiger Vater«, sagte Anthony.
»Und du weißt, was dich das kostet?« Während Vater Benedict mit einer Hand das abgerissene Schiff festhielt, hob er mit der zweiten den Stock auf.
»Ja, ehrwürdiger Vater.«
Sylvesters Innerstes krampfte sich zusammen. Der Dekan würde Anthony schlagen, ihm Kopf und Schultern auf das Pult pressen und mit dem pfeifenden Stock nicht nur auf den schmählich entblößten Hintern, sondern auf seine völlig schutzlose Würde einpeitschen. War eine Tracht Prügel nicht das Mindeste, was Anthony verdiente, dafür dass er ihre Freundschaft verriet und verheimlichte, wovon er noch immer träumte?
Sylvester presste sich die Hände auf den Magen. Ihm war gleichgültig, was Anthony verdiente, er wünschte sich nichts, als ihn zu schützen. »Ich habe es gezeichnet!«, rief er und konnte seinen Todesmut nicht fassen. »Anthony hat es sich angeschaut, weil ich ihn darum gebeten habe.«
Ohne den Kopf zu Sylvester zu wenden, fragte der Dekan: »Ist das wahr?«
»Nein, ehrwürdiger Vater«, sagte Anthony. »Es ist meines. Master Sylvester hätte es nicht zeichnen können.«
»Warum nicht?«
»Weil nur ich es kann.«
Der Blick des Dekans senkte sich auf die zerrissene Zeichnung. Eine Zeitlang betrachtete er sie mit zusammengekniffenen Augen, dann stopfte er sie sich in den Gürtel. »Fünfundzwanzig«, sagte er und packte Anthonys Schulter.
»Und was ist damit?«, schrie Sylvester, zog sein Buch unter dem Pult hervor und hielt es Vater Benedict entgegen. »Ich lese eine verbotene Schrift, umstürzlerisch wie die von dem Luther – das verdient ja wohl eher Schläge als ein paar harmlose Linien auf Papier.«
Ohne Anthonys Schulter freizugeben, nahm der Dekan das Buch und betrachtete es. »Lob der Torheit«, las er den Titel. »›Von Desiderius Erasmus‹. Was soll daran verboten sein? Dieser Erasmus ist ein Freund Thomas Mores, der im Rat des Königs sitzt. Und unser König ist im Glauben fest und unverwandt.« Er gab Sylvester das Buch zurück. »Glaubt mir, Master, wenn ich annehmen müsste, Ihr würdet Ketzerschriften lesen und wärt vom Satan entsandt, dann würde ich mir nicht die Hände schmutzig machen, indem ich Euch das verzärtelte Gesäß versohlte. Ich würde Euch der Diözese in Winchester melden, damit man Euch auf einen Scheiterhaufen bindet und verbrennt.«
Kurz war es, als hielte der Raum den Atem an.
»Ehrwürdiger Vater«, sagte Anthony dann.
»Was hast du noch zu reden?«
»Kann ich mein Schiff wiederhaben?«
Die anderen Jungen brachen in Gekicher aus.
Der Dekan gab Anthony einen Blick, aber keine Antwort. »Nach vorn«, befahl er dann. »Beug dich über mein Pult.« Er ließ seine Schulter los, versetzte ihm jedoch keinen Stoß. Anthony ging von selbst.
»Und Ihr schert Euch nach draußen«, sagte Vater Benedict. »Der Unterricht ist für heute beendet.«
Ungläubig verharrten die Jungen auf ihren Plätzen.
»Ich habe gesagt, Ihr sollt gehen!«, herrschte Vater Benedict sie an. »Der da wird seine Strafe einstecken müssen, aber von Euch erlaube ich keinem, sich daran zu ergötzen.«
Sylvester ließ die Schultern hängen, während er sich hinaus ins Licht der Frühlingssonne schlich. Die Übrigen waren ihm längst vorausgeeilt.
Er blickte auf und sah Fenella unter dem Vordach. Jäh verspürte er den lächerlichen Wunsch, sich ihr in die Arme zu werfen.
»Wo ist Anthony?«, fragte Fenella ohne ein Wort der Begrüßung.
»Er schlägt ihn!«, brach es aus Sylvester heraus.
»Wer? Der Dekan?«
Sylvester nickte. »Fünfundzwanzig Hiebe, nicht mit der Rute, sondern mit diesem abscheulichen Stock. Er hat unter dem Tisch ein Schiff gezeichnet – oh Fenella, er hat uns belogen! Er ist überhaupt nicht davon frei, er würde noch genau wie damals alles auf sich nehmen, um ein Schiff zu bauen.«
Mit Schrecken sah er, wie hinter Fenella ein zweites Mädchen hervortrat. Seine Schwester Geraldine. Der letzte Mensch, dem er jetzt begegnen wollte. »Guten Morgen, Bruder«, sagte sie. »Da mich sonst in dieser Stadt niemand schert, wollte ich, dass du es als Erster erfährst.«
»Dass ich was erfahre?«
»Ich gehe an den Hof!« Triumphal warf Geraldine den Kopf in den Nacken, dass ihr Haar sich aus dem Flechtwerk löste. »Vaters Bekannter in der Admiralität hat mir eine Stellung verschafft – im Haushalt von Königin Katherine.«
»Wie soll er denn davon frei sein?«, fragte Fenella, als wäre Geraldine nicht vorhanden. »Für ihn wäre das, als wäre er frei von sich selbst und ohne Halt. Seine Schiffe sind der schmale Span der Welt, den er begreift.«
Sylvester erkannte, dass sie recht hatte. Und noch mehr: Anthony war geboren, um Schiffe zu bauen; er besaß ein Talent, mit dem sich niemand messen konnte. Wer ihn von Schiffen fernhielt, nahm nicht nur ihm, sondern der Welt etwas weg. »Aber wir dürfen das doch nicht geschehen lassen!«, rief er. »Vater Benedict zerschlägt ihm die Würde, er prügelt ihn durch wie einen Lumpen!«
Geraldines Lachen klang künstlich, bis ins Mark erschrocken. »Mut hat er, der Herr Dekan, das muss man ihm lassen.«
»Mut?«, fuhr Sylvester auf. »Weil er uns nach draußen geschickt hat und es mit einem allein aufnimmt? Anthony ist ein Hänfling, Geraldine. Und ein Krüppel. Er kann sich nicht wehren.«
Geraldines himmelblaue Augen weiteten sich, bis das Weiße sichtbar war. »Wer den Teufel prügelt, den pfählt sein Stock.«
»Anthony ist weder ein Krüppel noch ein Hänfling«, sagte Fenella, noch immer, ohne Geraldine zu beachten. »Wenn er sich nicht wehrt, dann weil er es nicht will, und seine Würde kann ihm niemand nehmen.«
Sylvester stockte. Fenella hatte nicht unrecht. Dass er sich auch gegen einen hochgewachsenen, stämmigen Burschen wehren konnte, hatte Anthony bewiesen, und doch hatte das, was dabei geschehen war, ihn fast zerstört.
Geraldine ließ ihren scharfen Blick von einem zum anderen schweifen. Sie schwiegen alle. Bis Anthony kam. Er trug sein Wams über dem Arm. Nur in Hemd und Beinkleidern gab sein Körper preis, was Fenella gesagt hatte: Er war kein Hänfling, sondern ein schmales Bündel Sehnen und Muskeln. Selbst jetzt, nach der erlittenen Demütigung, war in seinen Hüften ein Schwingen verborgener Kraft.
Wir alle sind noch Jungen, stellte Sylvester fest, aber er ist schon ein Mann. Einer, der nicht nur weiß, wie die Spanten einer Karacke ausgerichtet werden, sondern auch, wie es sich anfühlt zu töten. Anthony sah erschöpft aus, das Gesicht gerötet und verschwitzt. Sylvester hätte gern die Arme um ihn gelegt und ihm zugeflüstert, dass er ihn stärker als jeden anderen fand. »War es schlimm?«, fragte er.
»Nein«, sagte Anthony und ging weiter.
»Vater Benedict ist ein verfluchter Schinder.«
»Nein«, sagte Anthony noch einmal.
»Findest du, es ist sein Recht, dich zu schlagen?«, herrschte Sylvester ihn an. »Keiner von uns hat je von ihm Schläge bezogen. Uns achtet er, aber dich hat er behandelt wie einen verbockten Lümmel, der keine Achtung verdient. Warum du ihn noch verteidigst, begreife ich nicht.«
Anthonys bronzebraune Augen hielten ihm unbewegt stand. »Er hat mich angefasst«, sagte er. »Er hat sich die Hände an mir schmutzig gemacht und hatte keine Angst.«
Sylvester schwieg verblüfft. Jetzt wurde ihm klar, warum Geraldine gesagt hatte, der Dekan besitze Mut. Er wollte Anthony umarmen, doch er wagte es heute so wenig wie sonst. Selbst Mortimer Fletcher ließ seit Ralphs Tod die Finger von ihm. Er war unberührbar geworden wie einer mit dem Aussatz. War Vater Benedict nach neun Jahren der erste Mensch, der Hand an Anthony legte?
Unvermittelt trat Fenella vor. Sie stellte sich Anthony in den Weg und schloss ihm die Hände um die Wangen. Eine Weile lang ließ sie sie unbewegt liegen, dann begann sie, ihn zu streicheln. Anthony erstarrte nur einen Herzschlag lang. Gleich darauf entspannte er sich, senkte halb, wie in Träumen, die Lider und überließ sich ihren Händen. Fenella streichelte ihm lange die Wangen, ehe sie die Hände an seinem Hals hinuntergleiten ließ und ihm über die Schultern strich.