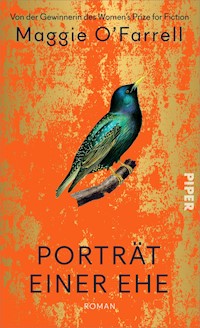Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Summe eines Lebens: Der dramatische Roman »Das Haus mit der blauen Tür« von Maggie O'Farrell jetzt als eBook bei dotbooks. Zwischen Liebe, Trauer und Hoffnung … John war die große Liebe ihres Lebens: Er ließ Alices Herz höherschlagen und brachte sie zum Lachen – doch nun ist er bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen. Voller Trauer steigt die junge Frau in einen Zug nach Schottland, der sie zu ihrer Familie bringen soll. Aber kurz bevor sie zuhause ankommt, beobachtet sie an einem Bahnhof etwas so Ungeheuerliches, dass sie sofort zurück nach London fährt. Ihre rasenden Gedanken beschäftigt eine einzige Frage: Wie lange schon? Seit wann hütet ihre Familie das Geheimnis, das Alice durch diesen einen zufälligen Blick aufgedeckt hat – war vielleicht ihr ganzes Leben eine Lüge? Plötzlich fahren ihre Gedanken Achterbahn: Erinnerungen an ihre Kindheit, ihre Jugend und an die glückliche Zeit mit John im Haus mit der blauen Tür wirbeln durcheinander und erscheinen plötzlich in einem ganz neuen Licht … Ein bewegender Roman über gebrochenes Vertrauen und den Mut, sich dem Leben auch in seinen dunklen Stunden zu stellen. Jetzt als eBook kaufen und genießen: »Das Haus mit der blauen Tür« von Maggie O'Farrell, der Autorin des internationalen Bestsellers »Judith und Hamnet«. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 542
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Zwischen Liebe, Trauer und Hoffnung … John war die große Liebe ihres Lebens: Er ließ Alices Herz höherschlagen und brachte sie zum Lachen – doch nun ist er bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen. Voller Trauer steigt die junge Frau in einen Zug nach Schottland, der sie zu ihrer Familie bringen soll. Aber kurz bevor sie zuhause ankommt, beobachtet sie an einem Bahnhof etwas so Ungeheuerliches, dass sie sofort zurück nach London fährt. Ihre rasenden Gedanken beschäftigt eine einzige Frage: Wie lange schon? Seit wann hütet ihre Familie das Geheimnis, das Alice durch diesen einen zufälligen Blick aufgedeckt hat – war vielleicht ihr ganzes Leben eine Lüge? Plötzlich fahren ihre Gedanken Achterbahn: Erinnerungen an ihre Kindheit, ihre Jugend und an die glückliche Zeit mit John im Haus mit der blauen Tür wirbeln durcheinander und erscheinen plötzlich in einem ganz neuen Licht …
Ein bewegender Roman über gebrochenes Vertrauen und den Mut, sich dem Leben auch in seinen dunklen Stunden zu stellen.
Über die Autorin:
Maggie O’Farrell, geboren 1972 in Nordirland, ist in Wales und Schottland aufgewachsen. Sie hat bei der Poetry Society und als Literaturredakteurin für den Independent on Sunday gearbeitet. Mit ihrem Debütroman »Das Haus mit der blauen Tür« feierte sie ihren internationalen Durchbruch. Inzwischen hat sie sieben Romane veröffentlicht und wurde 2010 mit dem Costa-Award für britische und irische Autoren geehrt. Maggie O’Farrell lebt mit ihrem Mann, dem Autor William Sutcliffe, und ihren Kindern in Edinburgh.
Maggie O’Farrell veröffentlichte bei dotbooks bereits »Das Jasminzimmer« und »Das Hotel im Schatten der Wälder «.
***
eBook-Neuausgabe November 2021
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 2000 unter dem Originaltitel »After you’d gone« bei Review, London. Die deutsche Erstausgabe erschien 2000 unter dem Titel »Seit du fort bist« im Hoffmann und Campe Verlag.
Copyright © der englischen Originalausgabe 2000 by Maggie O’Farrell
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2000 Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg
Copyright © der Neuausgabe 2021 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock / Yuliya Machulan / Natalia Bostan / Konmac / udovichenko / Spiroview Inc / Jurjanephoto / Artiste2d3d
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ae)
ISBN 978-3-96655-348-3
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Liebe Leserin, lieber Leser, in diesem eBook begegnen Sie möglicherweise Begrifflichkeiten, Weltanschauungen und Verhaltensweisen, die wir heute als unzeitgemäß oder diskriminierend verstehen. Bei diesem Roman handelt es sich um ein rein fiktives Werk, das vor dem Hintergrund einer bestimmten Zeit spielt oder geschrieben wurde – und als solches Dokument seiner Zeit von uns ohne nachträgliche Eingriffe neu veröffentlicht wird. Diese Fiktion spiegelt nicht unbedingt die Überzeugungen des Verlags wider.
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Versand zweimal im Monat – unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Das Haus mit der blauen Tür« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Maggie O’Farrell
Das Haus mit der blauen Tür
Roman
Aus dem Englischen von Claus Varrelmann
dotbooks.
FÜR MEINE MUTTER,
weil sie nicht wie Ann ist
Was geschehen ist, geschieht ständig
ANDREW GREIG
Die Vergangenheit tut sich überall auf
MICHAEL DONAGHY
Prolog
An dem Tag, an dem sie versuchen würde, sich umzubringen, spürte sie, daß es wieder Winter wurde. Sie hatte mit angezogenen Knien auf der Seite gelegen, geseufzt, und ihr warmer Atem hatte in der kalten Luft des Schlafzimmers eine kleine Dampfwolke gebildet. Sie drückte erneut die Luft aus den Lungen und schaute zu, was passierte. Dann tat sie es noch einmal und noch einmal. Dann wickelte sie sich aus der Bettdecke und stand auf. Alice verabscheute den Winter.
Es mußte etwa fünf Uhr morgens sein; sie brauchte nicht auf die Uhr zu schauen, das Licht hinter den Vorhängen verriet es ihr. Sie hatte fast die ganze Nacht lang wach gelegen. Im schwachen Schein der Morgendämmerung hatten die Wände, das Bett und der Fußboden den graublauen Farbton von Granit angenommen, und als sie durch das Zimmer ging, war ihr Schatten ein körniger, unscharfer Fleck.
Im Badezimmer drehte sie den Kaltwasserhahn auf, beugte sich hinunter und trank, indem sie den Mund direkt an den eisigen Strahl hielt. Während sie sich mit dem Handrücken über das Gesicht wischte, füllte sie den Zahnputzbecher, um die Pflanzen auf dem Badewannenrand zu gießen. Sie hatte sich schon so lange nicht mehr um sie gekümmert, daß die ausgedörrte Erde das Wasser nicht aufnahm, sondern es sich auf der Oberfläche in vorwurfsvoll wirkenden, quecksilbrigen Tropfen sammelte.
Alice zog sich rasch an, streifte sich die Sachen über, die zufällig auf dem Boden herumlagen. Sie stellte sich ans Fenster, schaute kurz nach unten auf die Straße, ging dann die Treppe hinunter, hängte sich ihren kleinen Rucksack über die Schulter und schloß die Haustür hinter sich. Dann ging sie einfach los, den Kopf gesenkt, eng in ihren Mantel gewickelt.
Sie lief ziellos durch die Straßen. Sie kam an Läden mit heruntergelassenen, durch Vorhängeschlösser gesicherten Rolläden vorbei, an Wagen der Straßenreinigung, die mit großen runden Bürsten den Rinnstein schrubbten, an ein paar Busfahrern, die schwatzend und rauchend an einer Straßenecke standen und sich die Finger an Plastikbechern voll dampfendem Tee wärmten. Die Männer starrten ihr hinterher, aber das sah sie nicht. Sie sah nichts außer ihren Füßen, die sich unter ihr bewegten, die in gleichmäßigem Rhythmus aus ihrem Blickfeld verschwanden und wieder darin erschienen.
Es war beinah hellichter Tag, da stellte sie fest, daß sie am Bahnhof King’s Cross angekommen war. Taxis bogen auf den Vorplatz ein und verließen ihn wieder, Menschen gingen durch die Türen. Sie betrat den Bahnhof mit der vagen Absicht, einen Kaffee zu trinken oder eine Kleinigkeit zu essen. Aber kaum stand sie in der neonbeleuchteten Halle, blieb ihr Blick wie gebannt an der riesigen Tafel mit den Abfahrtszeiten hängen. Zahlen und Buchstaben stürzten übereinander; Städtenamen und Zeitangaben, gespeichert auf halbverdeckten, elektrisch betriebenen Rollregistern wanderten in regelmäßigen Abständen weiter nach oben. Sie las sich die Namen vor: Cambridge, Darlington, Newcastle. Ich könnte an jeden dieser Orte fahren. Wenn ich wollte. Alice tastete nach der massigen Armbanduhr unter ihrem Ärmel. Die Uhr war entschieden zu groß für sie, das Gehäuse breiter als ihr Handgelenk, und sie hatte zusätzliche Löcher in das abgewetzte Armband stechen müssen. Sie schaute auf die Uhr, und erst, als sie den Arm automatisch wieder gesenkt hatte, wurde ihr bewußt, daß sie die Bedeutung der Ziffern gar nicht wahrgenommen hatte. Sie hob die Uhr erneut vor ihr Gesicht, und dieses Mal paßte sie auf. Sie drückte sogar auf den kleinen Knopf an der Seite, durch den der winzige, graue Bildschirm – auf dem Flüssigkeitskristalle, die sich ständig bewegten, Uhrzeit, Datum, Höhe über dem Meeresspiegel, Luftdruck und Temperatur anzeigten – papageienblau beleuchtet wurde. Es war die erste Digitaluhr, die sie je getragen hatte. Sie hatte John gehört. Sie verriet ihr, daß es 6 Uhr 20 war. Und zwar an einem Samstag.
Alice schaute wieder hoch zur Abfahrtstafel. Glasgow, Peterborough, York, Aberdeen, Edinburgh. Alice blinzelte. Lies das noch mal: Edinburgh. Sie könnte nach Hause fahren. Ihre Familie besuchen. Wenn sie wollte. Sie schaute sich die oberste Zeile in der Spalte an, um festzustellen, wann der Zug abfuhr – 6 Uhr 30. Wollte sie? Dann lief sie rasch zum Fahrkartenschalter und unterschrieb mit klammen Fingern ungelenk einen Beleg. »The Scottish Pullman to Edinburgh« stand auf dem Schild des Waggons, in den sie stieg, und fast hätte sie gelächelt.
Sie schlief unterwegs, den Kopf gegen das vibrierende Fenster gelehnt, und sie war im ersten Moment überrascht, als sie in Edinburgh ihre Schwestern am Ende des Bahnsteigs auf sie warten sah. Aber dann fiel ihr ein, daß sie Kirsty vom Zug aus angerufen hatte. Kirsty hatte den kleinen Jamie in einem Tragetuch dabei, und Beth, Alices jüngere Schwester, hielt Annie, Kirstys Tochter, an der Hand. Sie stellten sich auf die Zehenspitzen und winkten, als sie Alice entdeckten. Kirsty hob Annie auf ihre Hüfte, und die beiden Schwestern rannten auf sie zu. Dann umarmte sie beide gleichzeitig, und obwohl sie wußte, daß die Überschwenglichkeit der beiden nur ihre Besorgnis kaschierte, und sie ihnen unbedingt zeigen wollte, daß es ihr gutging, wirklich gut, konnte sie nicht anders, als den Kopf abwenden, sobald ihre Schwestern sie an sich drückten, und Annie auf den Arm nehmen und so tun, als vergrabe sie das Gesicht am Hals des Kindes.
Sie schleppten sie mit ins Bahnhofscafé, nahmen ihr den Rucksack ab und stellten einen Kaffee vor sie hin, bedeckt von einer weißen, mit ein paar Tupfern Schokoladenpulver verzierten Schaumschicht. Beth hatte am Tag zuvor eine Prüfung gehabt, und sie erzählte, welche Fragen gestellt worden waren und wie die Aufsichtsperson gerochen hatte. Kirsty, die Windeln, Fläschchen, Puzzles und Knetmasse dabeihatte, hielt Jamie mit einem Arm fest, während sie gleichzeitig Annie routiniert einen Laufgurt umschnallte. Alice stützte das Kinn in die Hände, hörte Beth zu und beobachtete Annie, wie sie ein Stück Zeitung mit grünem Buntstift vollmalte. Das von Annies ruckartigen Bewegungen ausgelöste Vibrieren der Tischplatte pflanzte sich über die Violinbögen von Alices Unterarmen fort und hallte in ihrem Schädel wider.
Sie stand auf und verließ das Café, um auf die Toilette zu gehen, während Kirsty und Beth gerade das Programm für den restlichen Tag besprachen. Sie lief durch den Wartesaal zu dem supermodernen Bahnhofsklo, dessen Eingang hinter einem stählernen Drehkreuz lag. Ihre Abwesenheit von dem Kaffeehaustisch, an dem ihre Schwestern mit ihrer Nichte und ihrem Neffen saßen, dauerte nicht länger als vier Minuten, aber in dieser Zeit sah sie etwas derart Eigenartiges, Unerwartetes und Grauenvolles, daß es ihr vorkam, als hätte sie beim Blick in den Spiegel festgestellt, daß ihr Gesicht nicht so aussah, wie sie geglaubt hatte. Alice schaute genau hin, und es war, als würde das, was sie sah, sie von dem entfernen, was ihr noch geblieben war. Und von dem, was sie zuvor schon verloren hatte. Sie schaute von neuem und dann noch einmal. Sie war sich sicher, obwohl sie sich dagegen sträubte.
Sie stürmte hinaus aus der Toilette und schob sich durch das Drehkreuz. Mitten in der Halle blieb sie für einen Augenblick reglos stehen. Was würde sie ihren Schwestern erzählen? Darüber kann ich jetzt nicht nachdenken, sagte sie sich, das kann ich einfach nicht; dann ließ sie im Geiste etwas Schweres, Breites, Flaches darauf niedersausen, und es verschloß die Ränder, so fest wie die einer Muschel.
Sie ging schnell zurück ins Café und griff nach ihrem Rucksack, der neben ihrem Stuhl stand.
»Wo willst du hin?« fragte Kirsty.
»Ich muß weg«, sagte Alice.
Kirsty starrte sie an. Beth erhob sich.
»Weg?« echote Beth. »Wohin?«
»Zurück nach London.«
»Was?« Beth machte einen Satz auf sie zu und hielt den Mantel fest, den Alice gerade anzog. »Das kannst du nicht tun. Du bist doch gerade erst angekommen.«
»Ich muß aber.«
Beth und Kirsty tauschten einen kurzen Blick.
»Wieso … Alice … was ist passiert?« rief Beth. »Sag schon, was hast du? Bitte, geh nicht. Du kannst nicht einfach so verschwinden.«
»Ich muß«, murmelte Alice erneut und ging los, um herauszufinden, wann und wo der nächste Zug nach London abfuhr.
Kirsty und Beth nahmen die Kinder, ihre Taschen und den Baby-Krimskrams und liefen hinter ihr her. In Kürze würde ein Zug fahren, also rannte Alice zu dem Bahnsteig, gefolgt von ihren Schwestern, die immer wieder ihren Namen riefen.
Auf dem Bahnsteig umarmte sie die beiden. »Wiedersehen«, flüsterte sie. »Tut mir leid.«
Beth brach in Tränen aus. »Ich versteh dich nicht«, schluchzte sie. »Erzähl uns, was los ist. Warum fährst du schon wieder?«
»Tut mir leid«, sagte sie erneut.
Beim Einsteigen verlor Alice plötzlich das Koordinationsvermögen. Der Abstand zwischen der Bahnsteigkante und den Waggonstufen verwandelte sich in ihren Augen in einen breiten, schier unüberquerbaren Graben, und ihr Gehirn übermittelte ihrem Körper anscheinend nicht die richtige Entfernungsangabe: Sie streckte ihre Hand nach der Klinke aus, um sich über den Graben hinwegzuziehen, griff aber daneben, taumelte und kippte rückwärts gegen den Mann, der hinter ihr stand.
»Nur die Ruhe«, sagte er, faßte sie am Ellbogen und half ihr hoch. Als sie sich hingesetzt hatte, stellten sich Beth und Kirsty ganz dicht vor das Fenster. Kirsty weinte jetzt ebenfalls, und sie winkten wie wild, als der Zug abfuhr, und rannten, so lange sie konnten, neben ihm her, aber dann wurde er zu schnell, und sie blieben zurück. Alice schaffte es nicht zurückzuwinken, schaffte es nicht, sich die vier blonden Köpfe anzuschauen, die über den Bahnsteig sausten und zwischen dem Rahmen des Zugfensters wie Gestalten in einem flackernden Super-8-Film aussahen.
Ihr Herz pochte so laut in ihrer Brust, daß die Ränder ihres Sichtfeldes hektisch im selben Rhythmus pulsierten. Regentropfen schlängelten sich quer über die Fensterscheibe. Sie vermied es, ihrem Spiegelbild in die Augen zu schauen, das in einem seitenverkehrten, schräg geneigten Geisterzug über die Felder huschte, während sie in Richtung London brauste.
Im Haus war es bei ihrer Rückkehr eiskalt. Sie fummelte am Heizkessel und am Thermostat herum, las sich die unverständlichen Bedienungsanleitungen laut vor und studierte dabei die Schaubilder, auf denen es vor Pfeilen und Skalen nur so wimmelte. In den Heizkörpern keuchte und gluckste es, und sie verströmten die erste Wärme der kalten Jahreszeit.
Im Badezimmer steckte sie die Finger in die Blumentöpfe. Die Erde fühlte sich feucht an.
Sie hatte eigentlich gerade vor, wieder nach unten zu gehen, als sie sich einfach dort hinsetzte, wo sie war – auf die oberste Stufe. Sie schaute erneut auf Johns Uhr und war erstaunt, daß es erst fünf Uhr nachmittags war. Sie vergewisserte sich dreimal: 17:02. Das bedeutete ohne jeden Zweifel fünf Uhr. Ihre Fahrt nach Edinburgh kam ihr inzwischen unwirklich vor. War sie wirklich dort gewesen und zurückgekehrt? Hatte sie wirklich gesehen, was sie gesehen zu haben glaubte? Sie wußte es nicht. Sie umklammerte mit den Händen die Knöchel und ließ ihren Kopf auf die Knie sinken.
Als sie ihn wieder anhob, hatte der Regen aufgehört. Im Haus herrschte eine eigenartige Stille, und es schien urplötzlich dunkel geworden zu sein. Ihre Finger taten weh, und als sie sie bewegte, machten die Gelenke scharfe, knackende Geräusche, die von den Wänden widerhallten. Sie zog sich am Geländer hoch und ging, an die Wand gestützt, langsam die Stufen hinunter.
Im Wohnzimmer angekommen, stellte sie sich vors Fenster. Die Straßenlaternen waren angegangen. Gegenüber flackerte das Licht des Fernsehers hinter den Tüllgardinen. Ihre Mundhöhle fühlte sich geschwollen und wund an, so, als hätte sie glühendheiße Bonbons gelutscht. Von irgendwoher tauchte Lucifer auf, sprang geräuschlos auf die Fensterbank und rieb den Kopf gegen ihre gefalteten Hände. Sie strich mit den Fingerspitzen über das samtige Fell an seinem Hals und spürte, wie er schnurrte.
Sie knipste eine Lampe an, und die Pupillen des Katers verengten sich so rasch, als würde man einen Fächer zusammenklappen. Er sprang auf den Fußboden und strich laut maunzend um ihre Füße. Sie beobachtete ihn, als er durchs Zimmer schlich, ihr immer wieder kurze Blicke zuwarf und seinen langen schwarzen Schwanz hin und her schwenkte. Im Licht der Deckenlampe konnte man meinen, in seinem einfarbigen Fell die Schemen einer gestreiften Katze schimmern zu sehen. Aus einer entlegenen Ecke ihres Bewußtseins drang eine Stimme: Er hat Hunger. Der Kater muß gefüttert werden. Füttere den Kater, Alice.
Sie ging in die Küche. Der Kater rannte vor ihr durch die Tür und begann, am Kühlschrank hochzuspringen. Auf dem Regalbrett, wo sie immer sein Futter aufbewahrte, entdeckte sie lediglich eine ältliche Pappschachtel mit Trockenfutter sowie die bräunlichen Rostringe von Dosen, deren Inhalt längst verspeist war. Sie kippte die Schachtel aus. Drei Brocken fielen aufs Linoleum. Nachdem Lucifer sie eine Weile beschnüffelt hatte, zerkaute er sie sorgsam.
»Hab ich dich vernachlässigt?« Sie streichelte ihn. »Ich geh schnell was für dich holen.«
Lucifer folgte ihr dicht auf den Fersen, erschrocken, weil es für ihn so scheinen mußte, als hätte sie es sich anders überlegt und wollte ihn jetzt doch nicht füttern. An der Haustür nahm sie ihre Schlüssel und ihr Portemonnaie aus dem Rucksack. Der Kater schlüpfte gemeinsam mit ihr hinaus und setzte sich auf die Eingangsstufe.
»Bin gleich zurück«, murmelte sie und zog die Pforte hinter sich zu.
Vielleicht lag es an dem Rhythmus ihrer Schritte auf dem Asphalt oder vielleicht daran, daß sie sich draußen zwischen lauter Menschen statt im kühlen, abgeschlossenen Inneren des Hauses befand, jedenfalls fiel ihr, während sie auf der Camden Road zum Supermarkt ging, alles wieder ein. Sie sah sich selbst in der Kabine, deren weiße Plastiktrennwände mit aufgespießten Herzen und Liebeserklärungen vollgekritzelt waren. Sie sah sich, wie sie die Hände an dem mit silbrigen Wasserkügelchen gesprenkelten Edelstahlwaschbecken wusch. Sie versuchte, diese Bilder zu verdrängen. Versuchte, an etwas anderes zu denken, an Lucifer, an die Dinge, die sie im Supermarkt sonst noch kaufen könnte. Sie hatte den glänzenden Seifenspender betätigt; grellrosa Seife hatte sich auf ihrer nassen Handfläche gekringelt und war im Wasser zu öligen Blasen aufgeschäumt. Hinter ihr in den Kabinen hatten zwei Teenager über ein Kleid gesprochen, das eine von ihnen an diesem Tag kaufen wollte. »Glaubst du nicht, daß es irgendwie ein bißchen zu rüschig ist?«
»Zu rüschig? Tja, jetzt wo du’s sagst.«
»Du blöde Kuh!« Was war dann passiert? Was sich ein paar Augenblicke später ereignet hatte, war so verwirrend, daß es ihr schwerfiel, einen klaren Gedanken zu fassen … Brauchte sie sonst noch etwas? Milch vielleicht? Oder Brot? … Alice hatte sich dann zum Handtrockner umgedreht, auf den Metallknopf gedrückt und die Hände abwechselnd übereinander gehalten. In dem Gehäuse war auf der Vorderseite einer dieser kleinen Spiegel eingelassen. Alice hatte nie begriffen, wozu die dienten. Angeblich war es möglich, sich die Haare zu fönen, wenn man die Düse herumdrehte, aber sie hatte nie das Bedürfnis verspürt, sich in einer öffentlichen Toilette die Haare zu fönen … Was würde sie tun, wenn sie wieder zu Hause war? Vielleicht ein bißchen lesen. Sie könnte sich eine Zeitung kaufen. Wie lange war es eigentlich her, seit sie zuletzt eine Zeitung gelesen hatte? … Der Raum schien aus lauter Spiegelflächen zu bestehen – die schimmernden Keramikkacheln, die Stahlwaschbecken, der Spiegel über ihnen und der Spiegel am Handtrockner … Vielleicht sollte sie Rachel anrufen. Sie konnte sich nicht erinnern, wann sie zuletzt mit ihr gesprochen hatte. Rachel war womöglich sauer auf sie … Die Stimmen der Mädchen waren von den Wänden widergehallt. Eine von beiden hatte sich in ihrer Kabine auf die Toilette gestellt und schaute über die Trennwand zu ihrer Freundin hinunter. Alice war aus irgendeinem Grund – warum? warum hatte sie das getan? – näher an den Handtrockner herangetreten, und durch den neuen Blickwinkel war etwas, das sich hinter ihr befand, in dem winzigen quadratischen Spiegel aufgetaucht … Vielleicht wollte Rachel nicht mir ihr sprechen. Das wäre allerdings sonderbar. Sie hatten sich noch nie zuvor verkracht. Vielleicht würde sie sich im Laden einen Korb nehmen oder einen Einkaufswagen, ja, am besten einen Einkaufswagen. Sie würde all das hineintun, was sie brauchte. Dann müßte sie für eine Weile nicht mehr herkommen. Aber wie würde sie das alles nach Hause transportieren … Während sie die Hände weiterhin unter den heißen Luftstrom gehalten hatte, hatte sie in den Spiegel gestarrt und sich dann langsam zu ihnen umgedreht, so langsam, daß es ihr hinterher vorgekommen war, als hätte es mehrere Minuten gedauert.
Inzwischen stand Alice am Fußgängerüberweg. Bei der Ampel gegenüber leuchtete die grüne, energisch ausschreitende Figur. Auf der anderen Straßenseite sah sie den Supermarkt; die Kunden liefen durch die neonbeleuchteten Gänge. Es kam ihr so vor, als würde sich das Leben auf einen Fluchtpunkt verengen. Leute strömten an ihr vorbei, überquerten die Straße, gingen weiter. Aber sie blieb stehen.
Jemand stieß sie von hinten an, und sie wurde bis an den Rand des Bürgersteigs geschoben. Die grüne Figur begann zu blinken. Ein paar Nachzügler liefen noch schnell über die Straße, ehe das Licht umsprang. Die strammstehende rote Figur erschien, und nach einem kurzen Moment der Stille gaben die wartenden Fahrer Gas. Als die Autos an ihr vorbeisausten und ihr dabei Abgase ins Gesicht bliesen, kam ihr deren Wuchtigkeit beneidenswert vor – kantenlose, glatte Gebilde aus Stahl, Glas und Chrom. Alices Schuhsohlen lösten sich vom Asphalt, und sie trat vom Kantstein hinunter.
Teil I
Kapitel 1
Alice sieht von ihrem Vater nichts außer seinen Schuhsohlen. Sie sind blaßbraun, zerschrammt von dem Schotter und dem Belag der Bürgersteige, die er entlanggegangen ist. Alice darf ihm abends, wenn er von der Arbeit kommt, auf dem Bürgersteig vor ihrem Haus entgegenlaufen. Im Sommer trägt sie dabei manchmal ihr Nachthemd, und dann wickeln sich die Falten des hellen Stoffs um ihre Knie. Aber nun ist es Herbst – wahrscheinlich bereits November. Die Schuhsohlen wölben sich um den Ast eines Baums hinten im Garten. Alice drückt den Kopf so weit in den Nacken, wie sie kann. Die Blätter rascheln und schlagen gegeneinander. Ihr Vater flucht. Sie spürt, daß ein Schrei wie Tränen in ihr aufsteigt, dann wird das rauhe orangefarbene Seil, das sich wie eine Kobra windet, von dem Ast heruntergelassen.
»Hast du’s?«
Sie packt das gewachste Ende des Seils mit ihren Handschuhen. »Ja.«
Die Äste erzittern, als sich ihr Vater herabschwingt. Er legt Alice kurz eine Hand auf die Schulter, dann bückt er sich und hebt den Autoreifen hoch. Sie ist fasziniert von den Rillen, die in Schlangenlinien die Lauffläche durchziehen, und dem Metallgewebe unter dem dicken schwarzen Gummi. »Das ist der Gürtel, der hält das Ganze zusammen«, hatte der Mann im Laden zu ihr gesagt. Die abgeschabten, glatten Stellen, die plötzlich die gewundenen Kerben unterbrechen, lassen sie erschaudern, und sie weiß nicht genau, warum. Ihr Vater wickelt das orangefarbene Seil um den Reifen und macht einen dicken, festen Knoten.
»Darf ich jetzt schaukeln?« Ihre Hände packen den Reifen.
»Nein. Erst will ich ausprobieren, ob er auch mein Gewicht aushält.«
Alice schaut zu, wie ihr Vater auf den Reifen springt, um sich zu vergewissern, ob für sie keine Gefahr besteht. Sie blickt nach oben, sieht den Ast im selben Takt wie der Reifen wippen und blickt rasch wieder auf ihren Vater. Was wäre, wenn er herunterfiele? Aber er steigt ab und hebt sie mühelos hinauf, denn ihre Knochen sind so klein, weiß und biegsam wie die eines Vogels.
Alice und John sitzen in einem Café in einem Dorf im Lake District. Es ist Frühherbst. Sie hält ein Stück Würfelzucker zwischen Daumen und Zeigefinger, und das Licht, das darauf fällt, verwandelt die Kristalle in die zusammengeballten Zellen eines komplexen, unter einem Mikroskop betrachteten Organismus.
»Wußtest du«, sagt John, »daß man bei einer chemischen Analyse von Würfelzucker in den Zuckerdosen von Cafés deutliche Spuren von Blut, Sperma, Kot und Urin gefunden hat?«
Sie verzieht keine Miene. »Nein, das wußte ich nicht.«
Er hält ihrem starren Blick stand, bis seine Mundwinkel nach unten wandern. Alice bekommt einen Schluckauf, und er zeigt ihr, wie man ihn los wird, indem man versucht, von der falschen Seite aus einem Glas zu trinken. Durch das Fenster hinter ihnen ist ein Flugzeug zu erkennen, das einen dünnen weißen Streifen über den Himmel zieht.
Sie beobachtet Johns Hände, wie sie ein Brötchen durchbrechen, und ist sich plötzlich sicher, daß sie ihn liebt. Sie schaut weg, guckt aus dem Fenster und sieht erst jetzt den weißen Streifen, den das Flugzeug hinterlassen hat. Inzwischen hat er sich so weit aufgelöst, daß er ganz bauschig wirkt.
Sie überlegt kurz, John darauf aufmerksam zu machen, läßt es aber sein.
Der Sommer in Alices sechstem Lebensjahr war heiß und trocken. Das Haus ihrer Familie hatte einen großen Garten, und da man vom Küchenfenster die Terrasse und den Garten überblickte, brauchten Alice und ihre Schwestern, wenn sie draußen spielten, bloß hochzuschauen, und sie sahen ihre Mutter, die auf sie Obacht gab. Die geradezu groteske Hitze trocknete sogar die Wasserreservoirs aus, etwas, das in Schottland noch nie dagewesen war, und Alice ging mit ihrem Vater zu einer Pumpe am Ende der Straße, um in runden Emailbottichen Wasser zu holen. Das Wasser prasselte auf die trockenen Böden. Auf halber Höhe zwischen dem Haus und dem hinteren Rand des Grundstücks war ein Gemüsebeet, wo sich Erbsen, Kartoffeln und Rote Bete durch die dunkle, schwere Erde ihren Weg ans Tageslicht bahnten. An einem besonders warmen Tag in jenem Sommer zog Alice sich völlig aus, nahm Klumpen jener Erde und beschmierte ihren ganzen Körper mit dicken Tigerstreifen.
Sie kroch in die Hecke und erschreckte die gehorsamen, ängstlichen Kinder von nebenan mit ihrem Raubtiergebrüll, bis ihre Mutter gegen die Fensterscheibe klopfte und rief, sie solle sofort damit aufhören. Sie zog sich ins Gebüsch zurück, sammelte Zweige und Blätter und baute ein Versteck, das einem Wigwam ähnelte. Ihre jüngere Schwester kam zu dem Versteck und verlangte plärrend, hineingelassen zu werden. Alice sagte, hier dürfen nur Tiger rein. Beth betrachtete erst die Erde, dann ihre eigene Kleidung und schließlich das Gesicht ihrer Mutter im Fenster. Alice saß, bedeckt mit ihren Streifen, in der moderigen Dunkelheit, knurrte und schaute durch das Dach ihres Verstecks auf ein dreieckiges Stück Himmel.
»Du hast gedacht, du wärst ein kleiner Negerjunge, stimmt’s?«
Sie sitzt in der Badewanne, ihr Haar hat sich in lauter tropfende Stacheln verwandelt, und ihre Großmutter seift ihr den Rücken, die Brust und den Bauch ein. Die Hände ihrer Großmutter fühlen sich wie aufgerauht an. Das Wasser ist graubraun, voll mit der Gartenerde, die an Alices Haut geklebt hat. Von nebenan dringt der gleichmäßige Tonfall ihres Vaters herüber, der gerade telefoniert. »Reib dich nie wieder mit Erde ein, hörst du, Alice?«
Unter Wasser sieht ihre Haut heller aus. Sieht abgestorbene Haut so aus?
»Alice? Du mußt mir versprechen, daß du so was nie wieder tust.«
Sie nickt und spritzt Wasser auf die Kacheln neben der gelben Wanne.
Ihre Großmutter trocknet ihr den Rücken ab. »Die Stummel von Engelflügeln«, sagt sie, als sie über Alices Schulterblätter reibt. »Jeder Mensch war einst ein Engel, und hier waren die Flügel.«
Sie verdreht den Kopf, um zu sehen, wie die spitzen, rechtwinkligen Knochendreiecke unter ihrer Haut nach außen und dann wieder nach innen klappen, so, als übte sie dafür, himmelwärts zu fliegen.
John sieht quer über den Kaffeehaustisch Alice an, die aus dem Fenster sieht. Sie hat heute ihre langen Haare nach hinten gebunden, was ihr das Aussehen einer spanischen Niña oder einer Flamencotänzerin verleiht. Er stellt sie sich vor, wie sie am Morgen ihr glänzendes, dichtes Haar gebürstet hat, ehe sie es im Nacken zusammensteckte. Er greift über die leeren Kaffeetassen hinweg nach dem dicken Haarknoten. Sie wendet ihm erstaunt den Blick zu.
»Ich wollte bloß wissen, wie sich das anfühlt.«
Sie berührt den Knoten selbst, ehe sie sagt: »Ich denke oft darüber nach, mir das Haar ganz kurz schneiden zu lassen.«
»Tu’s nicht«, sagt John rasch. »Du darfst es niemals abschneiden.« Die Aureolen ihrer Augen weiten sich vor Verblüffung. »Möglicherweise sind sie die Quelle deiner Kraft«, fügt er in dem schwachen Versuch, einen Witz zu machen, hinzu. Er will das Haar von der silbernen Spange befreien und sein Gesicht darin vergraben. Er will dessen Duft bis tief in seine Lungen einsaugen. Er hat den Geruch schon einmal in der Nase gespürt. Bei ihrer ersten Begegnung stand sie mit einem Buch in der Hand in der Tür zu seinem Büro, und ihr hüftlanges Haar schwang so gleichmäßig, daß er fast glaubte, ein glockenähnliches Geräusch zu vernehmen. Er will es im Dunkeln bis in den letzten Winkel erkunden und zwischen den Strähnen erwachen.
»Willst du noch einen Kaffee?« fragt sie, und als sie sich umdreht, um nach der Kellnerin zu schauen, sieht er, wie sich die kürzeren Haare in ihrem Nacken aufstellen.
Einige Zeit nachdem John den zweiten Becher Kaffee getrunken hatte, streckte er die Arme aus und nahm Alices Kopf zwischen die Hände. »Alice Raikes«, sagte er, »ich fürchte, ich muß dich jetzt küssen.«
»Mußt du das?« sagte sie in ruhigem Ton, obwohl ihr das Herz laut im Brustkorb pochte. »Du meinst also, jetzt wäre der passende Moment dafür?«
Er rollte theatralisch mit den Augen und legte die Stirn in tiefe Falten, um den Eindruck zu erwecken, er dächte ernsthaft nach. »Ich finde, es spricht eigentlich nichts dagegen.«
Dann küßte er sie, zuerst sehr zart. Sie küßten sich lange mit verschlungenen Fingern. Nach einer Weile löste er sich von ihr und sagte: »Wenn wir nicht bald von hier verschwinden, wird man uns wahrscheinlich bitten zu gehen. Ich glaube, man würde es nicht schätzen, wenn wir hier auf dem Tisch miteinander schlafen.« Er hielt ihre Hand so fest umklammert, daß ihre Knöchel zu schmerzen begannen. Sie suchte mit der anderen Hand unter dem Tisch nach ihrem Rucksack, ertastete aber bloß Johns Beine. Er klemmte ihre Hand zwischen seinen Knien fest.
Sie lachte. »John! Laß mich los!« Sie versuchte, ihre Hände wegzuziehen, aber er verstärkte den Druck seiner Beine. Er lächelte sie an, einen verdutzten Ausdruck auf dem Gesicht.
»Wenn du mich nicht losläßt, können wir weder von hier verschwinden noch miteinander schlafen.«
Er gab ihre Hände sofort frei. »Da hast du vollkommen recht.«
Er schnappte sich ihren Rucksack vom Boden und half ihr ungeduldig in den Mantel. Als sie zur Tür hinausgingen, drückte er sie fest an sich und atmete dicht an ihrem Haar.
Als Alice ein kleines Mädchen war, hingen im Wohnzimmer ihres Elternhauses Vorhänge aus schwerem dunkelvioletten Damast, an der Außenseite mit einer dünnen Isolierschicht aus einem vergilbten, schwammähnlichen Material versehen. Diese Vorhänge konnte Alice nicht leiden. Es machte ihr ungeheuren Spaß, große Placken der Schwammschicht abzukratzen, woraufhin der violette Stoff an diesen Stellen fadenscheinig aussah und das Licht durchließ. Einmal an Halloween starrten Beth und Alice, nachdem die Schwestern das weiche Fleisch eines Kürbisses ausgekratzt und quadratische Augen sowie einen schiefen Mund in die Schale geschnitten hatten, ehrfurchtsvoll auf das flackernde, unheimliche Licht aus seinem Innern. Kirsty hatte zuviel Kürbis gegessen und bekam gerade in einem anderen Zimmer des Hauses eine Medizin. Alice wußte hinterher nicht, ob sie wirklich geplant hatte, die Vorhänge anzuzünden, jedenfalls stand sie plötzlich neben ihnen, ein brennendes Streichholz in ihrer kleinen Hand, und hielt die züngelnde Flamme an die Vorhänge. Sie fingen erstaunlich rasch Feuer; der Damast verglühte zischend, während die Flammen nach oben wanderten. Beth begann zu schreien, die lodernden Flammen breiteten sich über die Zimmerdecke aus. Alice sprang vor Freude und Aufregung in die Luft und klatschte laut brüllend in die Hände. Dann kam ihre Mutter ins Zimmer gestürmt und zerrte sie weg. Sie schloß die Tür, und die drei standen starr vor Entsetzen in der Diele.
Ann rennt, immer zwei Stufen auf einmal, die Treppe hinunter. Die Schreie von Beth werden immer lauter. Es sind ernstgemeinte, entsetzte Schreie. Das Wohnzimmer ist voller Qualm, die Vorhänge brennen. Beth stürzt sich schluchzend auf Ann und klammert sich mit aller Kraft an ihre Knie. Ann kann sie für einen Moment nicht bewegen, dann sieht sie Alice. Sie starrt gebannt auf die Flammen, ihr Körper ist ganz verkrampft und verrenkt vor Begeisterung. In der rechten Hand hat sie ein abgebranntes Streichholz. Ann stolpert vorwärts und packt ihre Tochter bei der Schulter. Alice windet sich wie ein Fisch an der Angel. Ann ist fassungslos, wieviel Kraft ihre Tochter plötzlich hat. Es gibt eine Rangelei, Alice spuckt und schimpft, aber dann gelingt es Ann, ihre Hände zu packen und sie, obwohl sie um sich tritt, zur Tür zu schleifen. Sie schließt ihre drei Töchter in der Diele ein und rennt in die Küche, um Wasser zu holen.
John schläft tief und fest. Der Rhythmus seines Atems gleicht dem eines Tiefseetauchers. Sein Kopf liegt auf Alices Brustbein. Sie schnuppert an seinem Haar. Ein leichter Holzgeruch wie von einem frisch angespitzten Bleistift. Der Duft eines Shampoos. Zitrone? Sie atmet erneut ein. Ein leichter Hauch des Zigarettenqualms im Café.
Sie legt die Hand auf seinen Brustkorb und spürt, wie sich seine Lungen heben und senken. Das wispernde Ticken ihres eigenen Pulsschlags pocht gegen ihr Trommelfell.
Sie rutscht unter ihm heraus und zieht die Knie an die Brust. Sie hat Lust, ihn aufzuwecken. Sie will reden. Sein Körper ist gebräunt, schimmert mattgolden, nur seine Schamgegend ist bleich und wirkt dadurch verletzlich. Sie legt eine Hand auf seinen Penis, der gekrümmt an seinem Bein liegt. Der Penis zieht sich etwas zusammen. Sie lacht und legt sich auf ihn, drückt die Nase und den Mund an seinen Hals. »John? Bist du wach?«
Meine Mutter hat das Feuer mit Wasser gelöscht. Noch Jahre später verunstalteten die schwarzen Rußstreifen die Decke. Zwar redeten meine Eltern oft davon, das Zimmer zu streichen, aber das Feuer wurde nie erwähnt, es wurde nie darüber gesprochen. Kein einziges Mal fragten sie mich, was mich veranlaßt hatte, die Vorhänge in Brand zu setzen.
Ann tastet im Dunkeln nach der Zigarettenpackung auf ihrem Nachttisch. Als sie das Feuerzeug anzündet, schaut sie zu Ben hinüber, um festzustellen, ob sie ihn geweckt hat. Er macht im Schlaf ein etwas überraschtes Gesicht. Sie zieht an der Zigarette und spürt, wie der beißende Rauch ihre Lungen füllt. Sie ist von einem Traum über das Internat aufgewacht, auf das man sie als Mädchen geschickt hat, und jetzt kann sie nicht wieder einschlafen. Sie ist wieder sieben Jahre alt, steht in unbequemen Schnürschuhen am Eingang zum Internatsgebäude und schaut zu, wie sich das Auto ihrer Eltern auf der Kiesauffahrt entfernt. Sie ist zu verstört, um zu weinen. Die Nonne, die neben ihr steht, nimmt ihr den kleinen Koffer ab. »Da wären wir nun«, sagt sie.
Ann weiß nicht, wen sie mit »wir« meint: Sie hat sich noch nie in ihrem Leben einsamer gefühlt. Das werde ich euch nie verzeihen, denkt Ann, und in diesem Moment verwandelt sich die Liebe, die sie bisher für ihre Eltern empfunden hat, in ein Gefühl, das Haß sehr nahe kommt.
Sie verbringt die folgenden elf Jahre in dem Internat, wo die Nonnen ihr beibringen, wie man bei Tisch Obst vorschriftsmäßig ißt. Siebenundzwanzig Mädchen stellen sich in einer Reihe auf, siebenundzwanzig Äpfel und siebenundzwanzig Obstmesser in Händen, um zuzuschauen, wie Schwester Matthews mit geschickten Bewegungen die feste Schale eines Apfels in eine grüne Spirale verwandelt und sie auf den bereitstehenden Teller fallen läßt. Ein andermal stellen sie sich hinter dem Gebäude vor einem längsseits halbierten alten Auto auf, um zu lernen, wie eine Frau aus einem Auto aussteigt, ohne daß man ihren Unterrock sieht. Als Ann einsteigt, stört sie das klaffende Loch zu ihrer Rechten. Die Karosserie endet dicht neben ihrem Sitz, und dahinter beginnt die feuchte, neblige Landschaft Dartmoors. Schwester Clare klopft gegen das Fenster. »Na los, Ann. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit.«
Ann betrachtet sich im Rückspiegel. Sie neigt nicht zu Rebellion, sondern zu stillem Trotz. Sie erhebt sich elegant von dem Sitz, und der Stoff ihres Rocks bildet im richtigen Augenblick die gewünschten Falten.
»Sehr gut, Ann. Habt ihr anderen gesehen, wie Ann das gemacht hat?«
Ann bleibt stehen, ehe sie das Ende der Reihe erreicht hat. »Schwester Clare? Was ist, wenn man am Steuer sitzt? Funktioniert das dann genauso?«
Schwester Clare ist perplex. Was für eine Frage. Sie denkt kurz nach, dann lächelt sie. »Mach dir darüber keine Sorgen. Dein Ehemann wird dich fahren.«
Die Nonnen verteilen dicke Wälzer, und die Mädchen balancieren sie auf dem Kopf. Diejenigen, die sich die Haare hochgesteckt haben, werden getadelt. Die Mädchen sollen in einer Acht durch die Turnhalle schreiten. Ann verabscheut diese Übung noch mehr als alles andere; sie kann es nicht leiden, in ein geometrisches System eingezwängt zu werden, am Ende wieder am Ausgangspunkt anzukommen. Trotzdem meldet sie sich, als gefragt wird, wer als erste gehen will, und erfüllt die Aufgabe perfekt. Die Nonnen loben sie, und die anderen Mädchen ebenfalls, allerdings weniger enthusiastisch. Sie nimmt das Buch von ihrem Kopf, und während die anderen Mädchen die Übung absolvieren, schlägt Ann es auf und beginnt zu lesen. Das Buch ist voll mit Abbildungen und Querschnitten von Pflanzen. Sie folgt mit dem Finger dem Weg des Wassers durch die Pflanze, von dem Geäst der Wurzeln durch den Stengel bis hin zu den Blüten. Sie liest weiter und erfährt, wie Pflanzen befruchtet werden. Sie findet es ermutigend, wie sanft die Pollen auf die Staubgefäße treffen, und sie hofft, daß es bei Männern und Frauen genauso ist und die geflüsterten Gerüchte, die im Schlafsaal die Runde machen, nicht stimmen. Sie hat stundenlang heimlich ein Exemplar von Lady Chatterleys Liebhaber studiert und war hinterher auch nicht klüger. Ging es denn nicht doch nur um Erblühen und Samen?
Zur völligen Überraschung ihrer Eltern, der Nonnen, der Schulleitung und von Ann selbst schnitt sie bei der Abschlußprüfung gut ab und bekam einen Studienplatz in Biologie an der Edinburgh University. Edinburgh gefiel Ann; sie mochte die hohen, ehrwürdigen Gebäude aus grauem Stein, die kurzen Tage, die sich um fünf Uhr, mit dem Anschalten der Straßenbeleuchtung, in Abende verwandelten, die zwei Gesichter der Hauptstraße mit den prächtigen Läden auf der einen Seite und der Grünfläche der Princes Street Gardens auf der anderen. Sie mochte die kleine Wohnung direkt am Meadow Park, die sie sich mit zwei anderen Mädchen teilte; die Wohnung lag im obersten Stock eines Mietshauses, das Treppenhaus war kalt und zugig, und das Wohnzimmer, in dem sie abends zu dritt saßen und eine Kanne Tee nach der anderen tranken, kaum wärmer.
Das Universitätsleben gefiel ihr nicht. Jeder Tag schien neue Wissenslücken bei ihr zu offenbaren. Sie fand die Vorlesungen verwirrend und die Seminare demütigend; sie war eine der wenigen Frauen in ihrem Semester, und die Männer kommandierten sie entweder herum oder ignorierten sie. Sie fanden sie distanziert und altmodisch und zogen die Gesellschaft der freizügigeren Studentinnen der Krankenpflege vor. Sie war zu gelangweilt und zu stolz, um irgendeinen der Dozenten um Hilfe zu bitten. An dem Tag, an dem sie die Ergebnisse der Abschlußprüfung des ersten Studienjahrs erhielt, machte Ben Raikes ihr einen Heiratsantrag. Sie kannte ihn seit genau einem halben Jahr. Zwei Tage nach ihrer ersten Begegnung hatte er ihr gesagt, daß er in sie verliebt sei; das war ein überraschendes und, wie sie später herausfinden sollte, für seine Verhältnisse ungewöhnlich spontanes Geständnis. Sie wußte nicht, was sie antworten sollte, also schwieg sie. Das schien ihn jedoch nicht zu stören, er stand einfach neben ihr auf dem Platz vor der St. Giles’ Cathedral und lächelte sie an. Er ging mit ihr zum Tanzen – für sie etwas völlig Neues – und drückte sie dabei fest an sich, eine Hand auf ihrem Rücken, die Wange an ihrem Haar. Er hatte die Angewohnheit, die Tanzschritte abzuwandeln, die ihr die Nonnen mit unerbittlicher Strenge beigebracht hatten. Das brachte sie zum Lachen. Er hatte klare blaugrüne Augen und ein nettes Lächeln. Einmal, als er sie in der Wohnung besucht hatte, hatte er ihr Blumen mitgebracht – gelbe Rosen, die gewölbten Blütenblätter zu schmalen gelben Mündern übereinandergeschoben. Als er gegangen war, schnitt sie die Enden der Stengel unter fließendem Wasser an und stellte sie in einem Marmeladenglas auf ihren Schreibtisch. Jedesmal, wenn sie das Zimmer betrat, zog das leuchtende Eidottergelb ihren Blick auf sich.
Den Heiratsantrag machte er ihr im Meadow Park. Als sie ja sagte, war ihr klar, daß sie das nur tat, weil sie die Vorstellung nicht ertrug, wieder bei ihren Eltern wohnen zu müssen. Seit sie Ben Raikes kennengelernt hatte, war ihr bewußt geworden, daß ein wichtiger Teil von ihr stets abwesend war, ein Teil, der durch Liebe niemals vollständig wiederhergestellt werden könnte. Er nahm ihre Hand und küßte sie und sagte, seine Mutter werde sich freuen. Sie berührte den Abdruck seines Kusses, während sie zurückgingen. Der Ring, den er ihr schenkte, sandte einen Kranz aus Lichtblitzen an die Decke, wenn sie nachts wach lag.
Kapitel 2
Das Telefon läutete schrill. Ben spürte im Schlaf, wie Ann das Bett verließ. Später wird er versuchen, sich einzureden, daß er aufschreckte und sich bemühte, dem Gespräch zu lauschen. Aber er wird genau wissen, daß er wieder einschlief, denn er wird sich daran erinnern, daß beim Aufwachen Anns Hand auf seiner Brust lag und ihre Finger seinen Hals berührten. Seine Augenlider öffneten sich wie Falltüren. Er konnte ihr Gesicht nicht genau erkennen, das Halbdunkel verwischte die Umrisse, aber Worte erreichten ihn nur als einzelne Geräusche, noch bar jeder Bedeutung. »Ein Unfall«, sagte Ann wieder und wieder zu ihm, »ein Unfall«, und: »Alice.«
Alice ist seine Tochter. Ein Unfall.
»Wach auf, Ben, wir müssen aufstehen. Alice liegt im Koma. Los, Ben, wach auf.«
Ist das meine Stimme, die ich da höre? Es kommt mir vor, als befände ich mich im Inneren eines Radios, würde auf Ätherwellen aufwärts und abwärts schweben, von denen eine jede mit verschiedenen Stimmen erfüllt ist – manche erkenne ich wieder, manche nicht. Ich kann die Bandbreite nicht bestimmen.
Dieser Ort fühlt sich sauber an. Der Geruch nach einem Antiseptikum kribbelt in meiner Nase. Bei einigen Stimmen erkenne ich, daß sie außerhalb von mir ertönen, es sind jene, die aus größerer Entfernung wie durch Wasser zu mir dringen. Und dann gibt es jene Stimmen in mir – alle möglichen Geister.
Warum ist das Leben nicht so eingerichtet, daß man eine Vorwarnung erhält, ehe etwas Schlimmes passiert? Ich habe etwas gesehen. Etwas Furchtbares. Was hätte er dazu gesagt?
Ann hält Alice am Kinn fest und mustert ihr Gesicht. Alice, die an solch ein Verhalten ihrer Mutter nicht gewöhnt ist, schaut aufmerksam zu ihr hoch.
»Woher kennst du dieses Lied?«
Alice hat vor sich hin gesungen, während sie im Garten nach Blumen für den Miniaturgarten suchte, den sie gerade in einem Schuhkarton anlegt.
»Äh. Weiß nicht. Aus dem Radio, glaube ich«, antwortet sie ausweichend, beunruhigt. Wird sie gleich ausgeschimpft werden?
Ihre Mutter starrt sie weiter an. »Es ist ein Lied von einer Kassette, die ich erst gestern gekauft habe. Du kannst es unmöglich woanders gehört haben.«
Ann scheint nun mit sich selbst zu sprechen. Alice zappelt herum, sie hat es eilig, sich wieder ihrem winzigen Garten zu widmen. Sie will Cocktailstäbchen für ein paar Stangenbohnen klauen.
»Ich habe das Gefühl, Alice, daß du sehr musikalisch bist. Mein Vater war ein hervorragender Musiker, und offenbar hast du sein Talent geerbt.«
Alice beschleicht ein ungewöhnliches, prickelndes Gefühl. Ihre Mutter lächelt sie bewundernd an. Alice schlingt die Arme um ihre Hüften und drückt sich an sie.
»Wir müssen dich zum Unterricht schicken, um deine Begabung zu hegen und zu pflegen. Du darfst sie nicht vergeuden. Weißt du, wenn mein Vater eine Note hörte, wußte er sofort, welche es war. Er hatte das absolute Gehör und ist mit vielen verschiedenen Orchestern überall auf der Welt aufgetreten.«
»Bist du mit ihm mitgefahren?«
»Nein.« Ann schiebt Alice abrupt von sich weg. Alice schlendert durch den Garten, ihren Schuhkarton-Garten hat sie ganz vergessen. Sie ist musikalisch! Was für eine Rolle spielt es, daß sie nicht hübsch ist, so wie ihre Schwestern. Sie hat etwas, das sie heraushebt, von den anderen unterscheidet. Das absolute Gehör. Hegen und pflegen. Sie läßt die neu gelernten Ausdrücke auf der Zunge zergehen.
Ihre Großmutter kommt in den Garten, um die Wäsche von der Leine zu nehmen. Alice läuft hüpfend zu ihr hinüber. »Weißt du was, Oma? Ich bin musikalisch! Ich soll Unterricht kriegen.«
»Tatsächlich?« sagt Elspeth. »Na, hoffentlich steigt dir das nicht zu Kopf.«
Einmal die Woche wurde ich zu einer Frau in unserer Nähe geschickt, um Klavierunterricht zu bekommen. Mrs. Beeson war großgewachsen, spindeldürr und hatte langes graues Haar, das sie normalerweise zu Kränzen zusammengerollt auf dem Kopf feststeckte, manchmal aber auch wie einen fettigen grauen Vorhang über die Schultern fallen ließ. Sie trug lange, orangefarbene Häkeljacken. Wenn sie redete, bildeten sich in ihren Mundwinkeln Spucketropfen. Während des Unterrichts in ihrem düsteren Wohnzimmer lag meistens ihre große gefleckte Katze schnurrend auf dem Klavier.
Ich lernte, meine Hände beim Spielen so zu halten, als wollte ich zwischen den Fingern eine Apfelsine einklemmen, und die schwarzen Punkte auf den Notenblättern auf die glatten weißen oder die dünnen, fingerartigen schwarzen Tasten zu übertragen – geh du alter Esel Heu fressen, frische Brötchen essen Affen des Gesangsvereins – ich lernte die Bedeutung der ausdrucksvollen italienischen Spielanweisungen und wie ich meinen Anschlag auf sie einstellen mußte.
Ich übte fleißig. Das Klavier stand bei uns zu Hause direkt neben der Küche, und meine Mutter öffnete oft die Tür, um mir zuzuhören. Meine Finger wurden muskulös, ich hielt meine Nägel kurz, ich merkte mir die genaue Anzahl der Kreuze und ›bs‹ bei jeder Tonart, und wenn ich nervös war, trommelte ich den Fingersatz verschiedener Tonleitern auf irgendeine Unterlage.
Ich legte eine Prüfung nach der anderen ab, mühte mich monatelang ständig mit den drei gleichen Stücken ab, um sie dann in einem muffigen Gemeindesaal vor einem teilnahmslosen Prüfer darzubieten. Ich glaube, ich war wirklich davon überzeugt, daß ich Talent hatte: Die Urkunden, die meine Mutter einrahmte, besagten es schließlich, oder?
Alice war seit einer Dreiviertelstunde auf der Party gewesen. Die erste halbe Stunde hatte Mario sie mit Beschlag belegt, aber sobald er betrunken genug war, ließ sie ihn stehen und verzog sich in eine Ecke des überfüllten Zimmers. Es war das Zimmer eines Studenten im zweiten Studienjahr, und die Wände waren mit Postern der Stone Roses und der Happy Mondays bepflastert; das Bett hing unter dem Gewicht von sechs Leuten durch, und ein Mädchen in einem engen weißen Catsuit tanzte auf dem Schreibtisch und versuchte durch lautes Rufen, die Aufmerksamkeit einiger der glupschäugigen Jungs auf sich zu ziehen.
Alice fand die Jungs hier sonderbar: Entweder waren sie hochgradig introvertiert und besaßen ein immenses Wissen über irgendein abseitiges Fachgebiet, oder sie waren unglaublich arrogant, hatten jedoch überhaupt keine Ahnung, was sie mit ihr reden sollten. Es war das erste Mal, daß sie sich in Gesellschaft so vieler Engländer befand. Am ersten Tag hatte ein Junge namens Amos sie gefragt, wo sie herkomme. »Schottland«, hatte sie geantwortet.
»Aha, und wieviel Tage hat die Fahrt hierher gedauert?« hatte er in völlig ernstem Tonfall von ihr wissen wollen.
Sie schaute sich in dem verrauchten Zimmer um und beschloß, der Party noch fünf Minuten zu geben und dann zu verschwinden. Mario winkte ihr quer durch den Raum zu, Alice trank ihren Becher mit lauwarmem, sirupartigen Wein leer und lächelte halbherzig zurück.
Mario war ein Italoamerikaner aus New York, sehr reich und sehr gutaussehend. Er war dank seines Vaters für ein Jahr zum Studieren in England. Als Alice ihn fragte, wie er es geschafft hatte, in das Austauschprogramm aufgenommen zu werden, sagte er: »Mein Vater hat seine Brieftasche gezückt«, und brach in schallendes Gelächter aus. Sie hatte ihn in ihrer ersten Woche an der Universität kennengelernt, als sie durch die Korridore der Universitätsbibliothek gelaufen war. Sie hatte gesehen, wie er sie anlächelte, und ihn nach dem Weg in den Nordflügel gefragt. Er bot ihr an, sie dorthin zu bringen, aber statt dessen führte er sie in die Cafeteria, wo er sie zu Tee und Kuchen einlud. Er schickte ihr Blumen, die ihr Zimmer mit einem schweren, süßen Duft erfüllten, und rief sie zu allen Tages- und Nachtzeiten an. Er wollte Schauspieler werden und hatte die Angewohnheit, ihr an öffentlichen Orten lange Passagen aus Theaterstücken vorzutragen. Er hatte eine wild gelockte schwarze Mähne, die ihm fast bis auf seine muskulösen Schultern reichte. Sie hatte ihr Lebtag noch nie jemanden wie ihn kennengelernt, er wirkte imposant und farbig verglichen mit den bläßlich-wohlerzogenen Menschen, die sie bisher hauptsächlich gekannt hatte. Außerdem fühlte sie sich durch sein Interesse geschmeichelt: Viele Frauen waren hinter Mario her.
Am vorigen Abend waren sie nach einem Kinobesuch durch die leeren Straßen der Innenstadt gelaufen. Plötzlich drückte Mario sie gegen das Metallgitter eines leeren Marktstandes und küßte sie leidenschaftlich. Sie war überrascht. Sein Körper fühlte sich hart und heiß an, und seine Hände glitten über ihren Körper. Er preßte sein Becken gegen ihres, wodurch ihr Rücken gegen den Eisenstab hinter ihr gedrückt wurde.
»Mein Gott, Alice, ich hab den dicksten Ständer aller Zeiten«, stöhnte er, den Mund an ihrem Hals.
»Ständer?« brachte sie mühsam heraus.
»Ständer. Du weißt schon, Erektion. Willst du meinen Schwanz sehen?«
Sie lachte ungläubig. »Was? Hier?«
»Klar. Warum denn nicht? Es ist niemand in der Nähe.« Er knöpfte ihr Hemd auf und begann, an ihren Brüsten zu knabbern.
»Sei doch nicht albern, Mario. Wir sind mitten in der Stadt.«
Alice merkte, wie er ihren Rock hochschob und nach ihrem Slip tastete.
»Mario!« Sie wand sich und schob ihn weg. »Laß das gefälligst.« Er packte sie an den Hüften und wollte sie erneut küssen, aber sie riß sich los. »Was zum Teufel ist nur los mit dir?« brüllte er, das Gesicht rot vor Erregung.
»Nichts ist mit mir los. Wir sind mitten in der Stadt. Ich will nur nicht verhaftet werden, das ist alles.«
Sie wollte weggehen, aber Mario erwischte sie noch am Arm und riß sie herum. »Mein Gott, Alice, ich bin auch nur ein Mann. Findest du nicht auch, daß ich bisher sehr geduldig gewesen bin? Ich habe heute eine Packung Kondome gekauft, falls es das ist, worüber du dir Sorgen machst. Ich nahm an, wir würden vielleicht eines brauchen.«
»Das hast du also angenommen?« höhnte sie. »Tja, da hast du wohl was Falsches angenommen.«
»Verdammte Scheiße, man könnte ja fast auf den Gedanken kommen, daß du noch Jungfrau bist, mein Schatz.«
Sie starrten sich an, Mario außer Atem und Alice stocksteif vor Zorn. »Übrigens, nur zu deiner Information, ich bin es noch«, sagte sie leise und lief weg.
Mario holte sie vor dem dunklen Schaufenster einer Buchhandlung ein. »Es tut mir furchtbar leid, Alice.«
»Verschwinde.«
»Alice, bitte.« Er zog sie an sich und schlang die Arme so fest um sie, daß sie kaum noch Luft bekam und keine Chance hatte weiterzugehen.
»Geh weg. Ich will nach Hause.«
»Alice, es tut mir leid. Es war blöd von mir, so was zu sagen. Ich hatte ja keine Ahnung. Ich meine, wieso hast du mir das nicht erzählt?«
»Was meinst du damit, wieso ich es nicht erzählt habe? Was hätte ich denn sagen sollen? Guten Tag, ich heiße Alice Raikes und bin noch Jungfrau.«
»Ich hatte einfach keine Ahnung. Du wirkst so … ich weiß auch nicht … ich meine, ich habe es dir nicht angesehen.«
»Du hast es mir nicht angesehen?« Ihre Wut kehrte zurück. »Woran erkennst du das denn normalerweise?« Sie versuchte vergebens, sich aus seinem Griff zu befreien. »Laß mich los, Mario.«
»Das kann ich nicht.«
Ihr wurde bewußt, daß er am ganzen Körper zitterte, und sie stellte mit Entsetzen fest, daß er weinte. Er umarmte sie und schluchzte lautstark an ihrem Haar. »Alice, es tut mir furchtbar leid. Bitte, verzeih mir. Bitte verzeih mir, Alice.«
Sie spürte eine Mischung aus Widerwillen und schlechtem Gewissen. Sie hatte noch nie einen Mann weinen sehen. Leute gingen an ihnen vorbei und starrten sie an. Sie legte ihm die Hände auf die Schultern und schüttelte ihn. »Mario, es ist in Ordnung. Wein nicht.«
Er löste endlich seine Umklammerung, hielt sie mit ausgestreckten Armen fest und betrachtete sie mit forschendem Blick. Seine Miene war verzweifelt, sein Gesicht tränenverschmiert. »Mein Gott, wie wunderschön du bist. Ich verdiene dich nicht.«
Sie unterdrückte den spontanen Drang zu lachen. »Nun komm schon, Mario, laß uns gehen. Die Leute gucken ja schon.«
»Das ist mir egal.« Er warf sich gegen eine Mauer. »Ich habe dich gekränkt, und das verzeihe ich mir nicht.«
»Du redest dummes Zeug, Mario. Ich gehe jetzt.«
Er griff nach ihren Händen. »Geh nicht. Sag mir, daß du mir verzeihst. Verzeihst du mir?«
»Ja.«
»Sag: ›Ich verzeihe dir, Mario.‹«
»So ein Unsinn.«
»Sag es! Bitte.«
»In Ordnung. Ich verzeihe dir, Mario. Gut. Ich geh’ dann jetzt. Tschüs.«
Sie marschierte die Straße hinunter und ließ ihn an die Mauer gelehnt zurück, in einer Pose schweren Leids. Gerade, als sie um die Ecke biegen wollte, hörte sie, wie er ihren Namen rief. Sie drehte sich um. Er stand mitten auf der Straße, die Arme in einer überaus dramatischen Geste weit gespreizt.
»Alice! Weißt du, warum ich mich heute abend so aufgeführt habe?«
»Nein.«
»Weil ich in dich verliebt bin! Ich bin in dich verliebt!«
Sie schüttelte den Kopf »Gute Nacht, Mario.«
Am nächsten Tag klopfte er an ihre Tür, als Alice sich gerade mit kritischer Theorie beschäftigte. Er lächelte sie strahlend an und überreichte ihr einen Strauß leicht verwelkter Chrysanthemen.
»Ich habe dir doch gesagt, daß wir uns heute nicht treffen können, Mario. Ich habe zu arbeiten.«
»Ich weiß, Alice. Aber ich mußte einfach vorbeischauen. Ich bin die ganze Nacht wach gewesen und am Flußufer entlangspaziert.« Er schlang eine Hand um ihre Hüfte und gab ihr einen tiefen Zungenkuß. »Weißt du, ich habe das ernst gemeint, was ich gestern abend gesagt habe.«
»Oh. Gut. Du kannst nicht bleiben, Mario. Ich muß ein Referat schreiben.«
»Kein Problem. Ich verspreche, ich werde dich nicht ablenken.« Er strich mit den Händen seitlich über ihren Körper.
»Du störst mich bereits.«
Er ging durch das Zimmer und setzte sich aufs Bett. »Ich tu’s auch nicht wieder. Versprochen.«
Sie las weiter. Er kochte sich in der winzigen Kochnische des Zimmers einen Tee. Er blätterte einige ihrer Bücher durch und legte sie geräuschvoll wieder ab. Er fummelte an den Reglern ihrer Stereoanlage herum, inspizierte ihre CD-Sammlung und fing schließlich an, Liegestütze zu machen.
»Hör auf damit.«
»Womit?«
»Mit dem Gekeuche. Ich kann mich nicht konzentrieren.«
Er rollte sich auf den Rücken und schaute zu ihr hoch. »Weißt du was, du arbeitest zu viel.«
Sie versuchte, ihn zu ignorieren. Er begann, einen ihrer Fußknöchel zu streicheln. »Alice«, flüsterte er.
Sie stieß ihn weg. Er packte ihren Knöchel. »Alice.«
»Mario. Du gehst mir wirklich auf die Nerven.«
»Komm, gehen wir ins Bett.« Er fuhr mit der Hand bis zu ihrem Oberschenkel hoch und legte den Kopf in ihren Schoß.
»Okay, das reicht jetzt. Raus hier.«
»Nein, nicht ehe ich das gekriegt habe, weswegen ich hier bin.« Er lächelte anzüglich. »Weißt du, wieso ich heute hergekommen bin?«
»Ehrlich gesagt, nein.«
»Ich bin hergekommen«, er hielt inne und küßte sie auf die linke Brust, »um dich deiner Jungfräulichkeit zu berauben.«
Ich klammerte mich mit beiden Händen am unteren Treppenpfosten fest und schaukelte hin und her. Das hatte man mir verboten, da es dem Holzgeländer schadete, aber meine Mutter hatte Besuch, und ich wollte lauschen.
»Mein Vater war sehr musikalisch«, erklärte sie in ihrem aufgesetzt-geselligen Tonfall, »und ich habe mir immer sehnlichst gewünscht, daß eine meiner Töchter sein Talent geerbt hätte.«
»Und haben sie’s?« erkundigte sich die Besucherin.
»Ich dachte früher, bei Alice wäre es der Fall. Sie spielt Klavier, aber sie ist nicht besonders begabt. Sie strengt sich wirklich an, die Resultate sind jedoch leider nur durchschnittlich.«
Ich lief durch die Diele und die Küche in den Garten. Mit der rechten Hand testete ich im Gehen die Elastizität meines kleinen Fingers. Er fühlte sich zart, zerbrechlich an. Ich hätte ihn mit einem heftigen Ruck durchbrechen können.
Es war, als habe eine große Schale voll warmer Flüssigkeit, die ich in meinem Inneren mit mir herumgetragen hatte, ein Leck bekommen. Das Gefühl der Wärme verschwand unaufhaltsam. Ich war wütend auf mich selbst, weil ich so naiv gewesen war, und auf meine Mutter, weil sie erst diese Hoffnungen in mir geweckt und sie dann bei einer müßigen Plauderei mit einer dämlichen Nachbarin wieder zerstört hatte. Draußen war es schon fast dunkel, aber ich stürmte wutentbrannt kreuz und quer durch den Garten und riß Blumenblätter aus, bis meine Hände bluteten.
Zufällig kam meine Großmutter mit einem Stapel frischgewaschener Handtücher ins Badezimmer, als ich meine Hände in lauwarmem Wasser badete. Sie sah mich, legte die Handtücher auf dem Rand der Wanne ab, strich mir übers Haar und klemmte lose Strähnen hinter meinen Ohren fest. »Alice Raikes, wie kommt es, daß du so mit dem Leben haderst?«
Ich schwieg. Bitter schmeckende Tränen rannen meine Wangen hinunter.
»Magst du mir erzählen, wieso du so weinst? Oder lieber nicht? Ist heute in der Schule etwas Schlimmes passiert?«
Ich schaute hoch und erblickte unser beider Gesichter im Spiegel. »Ich bin so furchtbar häßlich«, platzte es aus mir heraus, »und ich kann überhaupt nichts.« Heftig schluchzend rang ich nach Luft.
»Tja, Liebes, ich muß zugeben, daß du schon mal besser ausgesehen hast.«
Ich sah mir mein Gesicht an und lachte. Meine Augen waren aufgequollen und blutunterlaufen und meine Wangen mit Erde und Streifen von Blattgrün beschmiert. Meine Großmutter drückte meine Schultern mit ihren kräftigen Händen.
»Weißt du denn nicht, wie hübsch du bist? Liegt es daran, daß du blonde Locken haben willst, so wie deine Schwestern?« Ich ließ den Kopfhängen. »Hab ich’s mir doch gedacht.« Sie drehte mich zu sich herum. »Alice, ich verrate dir jetzt ein Geheimnis. Hier drin«, sie legte ihre Hand auf meinen Solarplexus, »genau hier ist bei dir ein großer Vorrat an Liebe und Leidenschaft für einen anderen Menschen. Du hast eine enorme Liebesfähigkeit. Weißt du, die hat nicht jeder.«
Ich hörte ihr mit feierlicher Miene zu. Sie klopfte mir gegen die Nase. »Paß nur auf, daß du nicht alles an den falschen Mann verschwendest.« Sie wandte sich ab, um sich die Handtücher zu nehmen. »Und jetzt husch ins Bett. Du bist doch bestimmt ganz erschöpft von dem vielen Weinen.«
Ich gab nicht auf. Ich ging weiterhin einmal die Woche in Mrs. Beesons flohverseuchtes Wohnzimmer, damit sie mich mit Tonleitern und dem richtigen Anschlag piesackte. Irgendwie wirkte die Erklärung meiner Mutter befreiend auf mich. Ich hörte auf, wie besessen eine Prüfung nach der anderen abzulegen, sondern spielte nur noch, worauf ich Lust hatte. Mrs. Beeson rief meine Mutter an, um ihr zu sagen, daß ich meinen Ehrgeiz verloren hatte und eine »ganz passable Pianistin« werden könnte, wenn ich mich etwas mehr anstrengte. Daran hatte ich jedoch kein Interesse mehr.
Alice schaute hinunter in Marios gerötetes, grinsendes Gesicht. Sie hatte bereits beschlossen, eines Tages mit ihm zu schlafen, fand aber, daß es für sein schon jetzt beträchtliches Ego nicht gut sei, ihn entscheiden zu lassen, wann der richtige Zeitpunkt war. Momentan hatte er seine Hände unter ihrem Hemd und mühte sich mit dem Verschluß ihres BHs ab. Sie versuchte, seine Arme zu fassen zu bekommen. Sie rangelten miteinander.
»Hör auf, Mario. Ich schlafe heute nicht mit dir. Das ist mein Ernst.« Er schlug sich mit der Hand gegen den Kopf und rief: »Und wann dann? Ich will mit dir schlafen! Unbedingt!«
»Ich muß arbeiten. Ich habe noch ein Referat zu schreiben.«
Er warf sich mit dem Kopf nach unten auf den Boden und begann, stöhnend herumzurollen.
»Ich werde mit dir schlafen.« Alice merkte, daß Mario plötzlich mucksmäuschenstill war. »Aber nicht jetzt.«
»Okay. Aber warte bitte nicht zu lange. Meine Eier sind schon so dick wie Wassermelonen.«
Sie lachte und wandte sich wieder ihren Büchern zu. Nach einiger Zeit stellte sie fest, daß er eingeschlafen war. Später gingen sie dann zu der Party.
John lief die Treppe hoch, immer zwei Stufen auf einmal. Typisch Alice, ein Büro in der obersten Etage eines fünfstöckigen Gebäudes zu haben. Oben sah er durch die Glastür, daß Alice ganz allein in dem Raum war. Sie saß kerzengerade da, eine Hand auf dem Telefonhörer, so, als hätte sie gerade ein Gespräch beendet. Er marschierte hinein, legte ihr die Arme um die Schultern und küßte sie auf den Hals, nachdem er die schwere Haardecke angehoben hatte. »Ich habe mich gefragt, ob du vielleicht Lust hättest, mit mir zu Mittag zu essen«, flüsterte er.
Sie fühlte sich in seinen Armen wie erstarrt an. Ihr Gesicht war blaß und reglos.
»Was ist los?«
Sie sagte kein Wort. Er hockte sich neben sie und griff nach ihrer Hand. »Alice? Was hast du?«