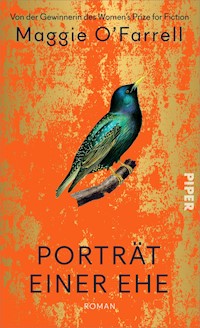9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Von Anfang an bestimmt der Tod ihr Leben: als Maggie O'Farrell im Alter von 8 Jahren beinah an einer unbekannten Virusinfektion starb. Als sie mit 15 aus Übermut und Freiheitsdrang einen törichten Fehler beging. Als sie in der Idylle des Lake District eine zutiefst verstörende Begegnung hatte. Oder als sie in einer unterbesetzten Klinik mit inkompetentem Personal bei der Geburt ihrer ersten Tochter fast gestorben wäre. An den unterschiedlichsten Orten, zu unterschiedlichen Zeiten lenkte der Tod Maggie O'Farrells Leben. Ihre tiefgründige, außergewöhnliche Geschichte stellt existenzielle Fragen: Wie würde ich handeln, wenn ich in tödliche Gefahr geriete? Was stünde für mich auf dem Spiel? Und, nicht zuletzt, wer würde ich danach sein? »Ich bin, ich bin, ich bin« ist ein Buch, das man mit einem neuen Gefühl der Verletzlichkeit aus der Hand legt, mit dem Gefühl, dass jeder neue Herzschlag zählt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de/literatur
Übersetzung aus dem Englischen von Sabine Roth
ISBN 978-3-492-99104-9
Deutsche Erstausgabe
April 2018
© 2017 Maggie O’Farrell
Titel der englischen Originalausgabe: »I am, I am, I am« bei Tinder Press, London 2018
© der deutschsprachigen Ausgabe:
Piper Verlag GmbH, München 2018
Covergestaltung: zero-media.net, München
Datenkonvertierung: abavo GmbH, Buchloe
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Inhalt
Cover & Impressum
Widmung
Zitat
Hals
Lunge
Rückgrat, Beine, Becken, Bauch, Kopf
Ganzer Körper
Hals
Unterleib
Baby und Blutbahn
Lunge
Kreislauf
Kopf
Schädeldach
Eingeweide
Blutbahn
Ursache unbekannt
Lunge
Kleinhirn
Tochter
Danksagung
Zitatnachweis
Für meine Kinder
Ich holte tief Luft und lauschte dem Prahlen meines Herzens. Ich bin, ich bin, ich bin.[1]
Sylvia Plath, Die Glasglocke
Hals
1990
Hinter einem Felsblock hervor tritt mir ein Mann in den Weg.
Wir stehen, er und ich, am abseitigen Ufer eines dunklen Gebirgssees, der in der Gipfelmulde verborgen liegt. Der Himmel über uns ist milchig blau; in dieser Höhe wächst nichts mehr, sodass wir allein sind mit den Felsen und dem stillen schwarzen Wasser. Breitbeinig steht er da in seinen Bergstiefeln, auf dem schmalen Weg, und er lächelt.
Mir wird mehreres klar. Dass ich ihm vorhin schon begegnet bin, weiter unten im Tal, wo wir uns gegrüßt haben, freundlich, aber kurz, wie unter Wanderern üblich. Dass mich auf diesem abgelegenen Pfad niemand hören wird. Dass er auf mich gewartet haben muss, dass er das Ganze geplant hat, sorgsam, methodisch, und ich ihm in die Falle gegangen bin.
All dies begreife ich in einem Sekundenbruchteil.
Der Tag – ein Tag, an dem ich beinahe sterbe – hat für mich früh begonnen, mit dem Weckerrasseln gleich im ersten Licht. Ich bin in meine Uniform geschlüpft, aus dem Wohnwagen geklettert und leise die Steintreppe in die verlassene Küche hinuntergestiegen, um dort die Öfen, die Kaffeemaschinen, die Toaster einzuschalten, fünf große Brotlaibe aufzuschneiden, die Wasserkessel zu füllen und vierzig Papierservietten zu großblütigen Orchideen zu falten.
Ich bin seit kurzer Zeit achtzehn, und ich habe mich abgeseilt. Von allem: Zuhause, Schule, Eltern, Prüfungen, der Warterei auf die Noten. Ich habe mir einen Job weit weg von allen gesucht, die ich kenne, in einem »ganzheitlichen alternativen Zentrum«, wie es sich nennt, am Fuß eines Berges.
Ich serviere das Frühstück, ich räume das Frühstück ab, ich wische die Tische sauber, ich erinnere die Gäste daran, ihre Schlüssel abzugeben. Ich gehe in ihre Zimmer, ich mache ihre Betten, ich ziehe neue Wäsche auf, schaffe Ordnung. Ich hebe Kleidungsstücke, Handtücher, Bücher, Schuhe, ätherische Öle und Yogamatten vom Boden auf. Und erahne aus den Geschichten, die diese in den Zimmern verstreuten Gegenstände erzählen, wie weit Schein und Sein auseinanderklaffen. Der penible, leicht oberlehrerhafte Herr, für den es immer ein ganz bestimmter Tisch sein muss, eine spezielle Seife, zu hundert Prozent fettfreie Milch, steht auf flauschig weiche Kaschmirsocken und Boxershorts aus üppig gemusterter Seide. Die Frau, die mit hochgeschlossener Bluse, niedergeschlagenen Augen und herauswachsender Dauerwelle beim Abendessen sitzt, hat eine nächtliche Doppelgängerin, die eine Sadomasokluft mit reiterischem Einschlag trägt: Zaumzeug, winzige Ledersättel, eine zierliche, aber gefährlich aussehende silberne Gerte. Im Zimmer der Eheleute aus London, die als Paar so sagenhaft, so beneidenswert perfekt wirken – sich über den Esstisch bei ihren schön manikürten Händen halten, lachend von Spaziergängen durch die Dämmerung zurückkommen, mir ihre Hochzeitsfotos zeigen –, spricht aus allem Trauer, ein verzweifeltes Hoffen. Auf den Ablagen im Bad liegen Teststreifen für den Eisprung. Auf den Nachtkästchen stapeln sich Hormonpräparate. Ich rühre nichts davon an, um zu signalisieren: Ich habe das nicht gesehen, nicht wahrgenommen, ich weiß von nichts.
Den ganzen Vormittag sichte und sortiere und richte ich die Leben anderer. Ich beseitige menschliche Rückstände, tilge jeden Hinweis darauf, dass sie gegessen, geschlafen, gevögelt, gestritten, sich gewaschen, Kleider getragen, Zeitungen gelesen haben, ich putze Haare, Hautschuppen, Bartstoppeln, Blut und Nagelschnipsel weg. Ich wische Staub, zerre den Staubsauger an seiner langen Leine hinter mir her über die Korridore. Und dann, gegen Mittag, bleiben mir mit etwas Glück bis zur Abendschicht vier Stunden, in denen ich tun kann, was ich will.
Also habe ich den Aufstieg zum See gemacht, wie so oft in meiner Mittagspause, nur bin ich heute aus irgendeinem Grund bis zum hinteren Ufer gegangen. Warum? Das weiß ich nicht mehr. Vielleicht war ich früher als sonst mit der Arbeit fertig, vielleicht haben die Gäste weniger Chaos hinterlassen, sodass ich eher aufbrechen konnte. Vielleicht hat mich der helle Sonnentag von meiner gewohnten Route weggelockt.
Mein bisheriges Leben hat mir keinen Anlass gegeben, der Natur zu misstrauen. Ich habe einen Selbstverteidigungskurs gemacht, im Gemeindezentrum der kleinen schottischen Küstenstadt, in der ich meine Oberschuljahre verbracht habe. Der Lehrer, ein massiger Mann im Judoanzug, malte uns mit schaurigem Gusto die verschiedensten Gefahrensituationen aus. Später Abend, ihr kommt aus einem Pub – unter seinen abnormal buschigen Augenbrauen sah er von einer zur anderen –, und so ein bulliger Typ springt aus einer Seitengasse und packt euch. Oder: Ein enger Gang im Nachtklub, und ein Betrunkener drängt euch an die Wand. Oder: Es ist dunkel, es ist neblig, ihr wartet an der Ampel, und dieser Kerl zerrt an eurer Handtasche und stößt euch zu Boden. Die Gruselszenarien mündeten stets in derselben Frage, die er uns schon fast schadenfroh stellte: Also, was macht ihr?
Und so rammten wir fiktiven Angreifern die Ellbogen in die Gurgel, nicht ohne dabei die Augen zu verdrehen, schließlich waren wir halbwüchsige Mädchen. Wir übten, immer schön abwechselnd, unsere markerschütternden Schreie. Wir beteten pflichtgetreu und genervt die Schwachpunkte des männlichen Körpers herunter: Auge, Nase, Kehle, Weichteile, Knie. Wir hielten uns für bestens gerüstet, jederzeit imstande, es mit dem im Hinterhalt lauernden Unbekannten, dem besoffenen Grapscher, dem Handtaschenräuber aufzunehmen. Wir verließen uns darauf, dass wir es schon schaffen würden, uns aus ihrem Griff zu winden, das Knie hochzureißen, mit den Fingernägeln nach ihren Augen zu stechen; wir würden den Weg aus diesen bedrohlichen und dabei seltsam erregenden Szenarien schon finden, dachten wir. Krach schlagen, die Aufmerksamkeit auf uns ziehen, nach der Polizei schreien – die Botschaft, die wir verinnerlichten, war klar. Seitengasse, Nachtklub, Pub, Bushaltestelle, Ampel: Die Gefahr ging von der Stadt aus. Auf dem Land oder in ländlichen Städtchen wie unserem – wo es keine Nachtklubs gab, keine Seitengassen, nicht einmal eine Ampel – kamen solche Dinge nicht vor. Wir konnten uns frei bewegen.
Und doch steht hier, oben auf dem Berg, dieser Mann und versperrt mir den Weg.
Entscheidend ist jetzt, dass ich den Schein wahre, dass ich meine Angst überspiele. Also gehe ich weiter, setze einen Fuß vor den anderen. Wenn ich mich umdrehe und loslaufe, wird er mich im Nu eingeholt haben, und es ist etwas so Entlarvendes, Endgültiges am Wegrennen. Wegrennen hieße, die Dinge beim Namen zu nennen, die Situation zuzuspitzen. Die einzige Möglichkeit ist, so zu tun, als wäre nichts, als wäre das alles völlig normal.
»So klein ist die Welt«, sagt er zu mir, und sein Blick wandert über mein Gesicht, meinen Körper, meine nackten, schlammverschmierten Beine. Es ist ein Blick, der mehr abschätzend ist als lasziv, mehr berechnend als begehrlich: der Blick eines Mannes, der die Logistik für etwas ausarbeitet, Maß nimmt für die Tat.
Ich kann seinen Blick nicht erwidern, ihn nicht direkt ansehen, aber ich nehme eng stehende Augen wahr, eine beträchtliche Körpergröße, gelblich weiße Vorderzähne, zwei um die Rucksackträger geschlossene Fäuste.
Ich muss mich räuspern, um meine Antwort herauszubringen: »Stimmt.« Ich glaube, ich nicke dazu. Ich schiebe mich seitwärts um ihn herum, und sein Geruch streift mich, ein scharfes Gemisch aus frischem Schweiß, dem Leder seines Rucksacks und einem beißend chemischen Rasieröl, das mir vage vertraut vorkommt.
Ich bin an ihm vorbei, ich lasse ihn zurück, der Weg liegt offen vor mir. Er hat für seinen Hinterhalt den Scheitelpunkt der Tour gewählt, wird mir klar: Bis hier ging es konstant bergauf, auf den nächsten Metern beginne ich meinen Abstieg zum Gästehaus, zu meiner Abendschicht, zur Arbeit, zum Leben. Von jetzt an führt der Weg nur noch talwärts.
Ich versuche einen Schritt anzuschlagen, der selbstsicher ist, entschlossen, aber nicht furchtsam. Ich fürchte mich nicht, das sage ich mir immer wieder, über das brandungsartige Rauschen meines Pulses hinweg. Vielleicht, denke ich, bin ich frei, vielleicht habe ich die Situation fehlgedeutet. Vielleicht ist es ganz normal, jungen Mädchen auf einsamen Bergpfaden aufzulauern und sie dann einfach gehen zu lassen.
Ich bin achtzehn. Gerade eben. Ich weiß so gut wie nichts.
Doch. Dass er hinter mir herkommt, weiß ich. Ich kann das Knirschen seiner Sohlen hören, das Wetzen seiner Hosenbeine – irgendein atmungsaktives Allwettermaterial.
Und da ist er wieder, im Gleichschritt neben mir. Er kommt dicht heran, vertraut, sein Arm an meiner Schulter, als wäre er ein Freund, als wären wir Klassenkameraden, die von der Schule nach Hause gehen.
»Herrliches Wetter«, sagt er und schaut mich dabei an.
Ich halte den Kopf gesenkt. »Ja«, sage ich, »wirklich.«
»Richtig heiß. Ich überlege, ob ich vielleicht schwimmen gehe.«
Er hat eine komische Sprechweise, fällt mir auf, während wir im Sturmschritt den Weg hinabmarschieren. Schleppend, das r weich, das t überhart, sein Ton stumpf, fast ausdruckslos. Vielleicht hat er leicht »einen weg«, wie die Leute sagen – so wie der Mann, der früher in unserer Straße wohnte und seit dem Krieg nichts mehr weggeworfen hatte. Sein Vorgarten war so überwuchert von Efeu, dass es wie beim Dornröschenschloss aussah. Wir Kinder versuchten immer zu raten, was sich unter den Blätterbuckeln verbergen könnte: ein Auto, ein Zaun, ein Motorrad? Der Mann trug Strickmützen und dazu gemusterte Pullunder und zu kleine, vormals »gute« Anzüge mit einem dichten Filz von Katzenhaaren darauf. Bei Regen legte er sich einen Müllsack um die Schultern. Mal rückte er mit einer Reißverschlusstasche voller Kätzchen bei uns an, mit denen wir spielen sollten; dann wieder ließ er mit wildem Blick betrunkene Schimpfkanonaden wegen irgendwelcher verschwundener Postkarten vom Stapel, und meine Mutter musste ihn beim Arm nehmen und zurück in sein Haus bringen. »Ihr bleibt hier«, sagte sie dann zu uns, »ich bin gleich wieder da«, und führte ihn resolut die Straße hinauf.
Vielleicht, denke ich, und Erleichterung durchflutet mich, steckt nicht mehr dahinter als das. Dieser Mann ist vielleicht wie unser alter Nachbar, dieser exzentrische Außenseiter, der mittlerweile längst tot ist, sein Haus entrümpelt, der Efeu weggehackt und verbrannt. Vielleicht sollte ich Mitleid haben wie meine Mutter. Gütig gegen ihn sein.
Ich drehe mich zu ihm um, während wir Schulter an Schulter am Ufer entlangstürmen. Ich lächle sogar.
»Schwimmen«, sage ich. »Das klingt erfrischend.«
Zur Antwort legt er mir die Schnur seines Feldstechers um den Hals.
Einen oder zwei Tage später betrete ich das Polizeirevier in der nahe gelegenen Stadt. Ich warte in einer Schlange von Leuten, die Meldung über verlorene Brieftaschen, streunende Hunde und zerkratzte Autos machen.
Der Polizist hinter seinem Schalter hört mich mit schief gelegtem Kopf an. »Hat er Sie verletzt?«, ist seine erste Frage. »Hat er Sie berührt, dieser Mann, Sie geschlagen, Sie bedrängt? Hat er irgendetwas Unsittliches gesagt oder getan?«
»Nein«, sage ich, »nicht direkt, aber …«
»Aber was?«
»Er hätte«, sage ich. »Er war kurz davor.«
Der Polizist mustert mich von oben bis unten. Ich trage abgeschnittene, geflickte Jeans, mehrere durch den Ohrknorpel gepiercte Silberringe, löchrige Turnschuhe, außerdem ein T-Shirt mit dem Bild eines Dodos und der Aufschrift: »Have you seen this bird?« Ich habe eine Mähne – kein anderer Ausdruck dafür passt –, zottlige Haare, in die mir ein Gast, eine mild blickende Holländerin, die mit ihrer Harfe und ihrem Filzset reist, Perlen und Federn geflochten hat. Ich sehe nach dem aus, was ich bin: eine Jugendliche, die zum ersten Mal allein lebt, in einem Wohnwagen im Wald irgendwo am Arsch der Welt.
»Also« – der Polizist lehnt sich breit über seine Kladde –, »Sie waren spazieren, Sie haben einen Mann getroffen, Sie sind ein Stück mit ihm gegangen, er war etwas merkwürdig, aber dann sind Sie heil nach Hause gekommen. Ist das Ihre Aussage?«
»Er hat«, sage ich, »mir die Schnur von seinem Feldstecher um den Hals gelegt.«
»Und dann was?«
»Er …« Ich halte inne. Ich hasse diesen Mann mit seinen struppigen Augenbrauen, seinem Bierbauch, seinen dicken, ungeduldigen Fingern. Ich hasse ihn möglicherweise noch mehr als den Mann oben am Bergsee. »Er hat mir irgendwelche Enten auf dem See gezeigt.«
Der Polizist versucht nicht einmal, sich das Grinsen zu verkneifen. »Verstehe«, sagt er und lässt seine Kladde zuklappen. »Wie fürchterlich.«
Wie hätte ich diesem Polizeibeamten begreiflich machen sollen, dass ich die Gewalttätigkeit des Mannes fühlen konnte, dass sie von ihm abstrahlte wie die Sommerhitze von einem Stein? Ich habe die Minuten am Schalter des Polizeireviers wieder und wieder Revue passieren lassen und mich gefragt: Gab es irgendetwas, das ich hätte anders machen, das ich hätte sagen oder tun können, um zu verhindern, was danach geschah?
Ich hätte sagen können: Ich will Ihren Vorgesetzten sprechen. Holen Sie bitte Ihren Chef. Das würde ich heute sagen, mit dreiundvierzig, aber damals? Ich wusste gar nicht, dass so etwas möglich war.
Ich hätte sagen können: Hören Sie, dieser Mann hat zwar gerade mir nichts getan, aber jemand anderem wird er etwas tun. Bitte nehmen Sie ihn fest, bevor es dazu kommt.
Ich hätte sagen können, dass ich einen Riecher für heraufziehende Gewalt habe. Dass von mir lange Zeit etwas ausging, das andere zur Gewalt reizte, ohne dass ich je begriff, was genau es war. Wer als Kind drangsaliert oder verprügelt wird, der vergisst nie das Gefühl der Ohnmacht und des Ausgeliefertseins, die Absolutheit, mit der die Stimmung binnen eines Lidschlags, eines einzigen Atemzugs von Wohlwollen in Brutalität umschlagen kann. Dieses Gespür geht ins Blut über wie ein Antikörper. Man lernt schnell, die Vorboten solch unvermittelter Aggression zu erkennen: diese ganz eigene Schwingung in der Luft, dieses Sirren. Man entwickelt Antennen für die nahende Gewalt und entsprechend eine Anzahl an Taktiken, um sie von sich abzuwenden.
In der Schule, auf die ich ging, schien die Gewalt allgegenwärtig. Sie hing in der Luft wie Rauch, in der Aula, den Korridoren, den Klassenzimmern, den Gängen zwischen den Bankreihen. Backpfeifen klatschten, Ohren wurden lang gezogen, Tafellappen flogen mit schmerzhafter Treffsicherheit; ein Lehrer hatte die Angewohnheit, die Schüler, die er nicht mochte, beim Hosenbund zu packen und gegen die Wand zu donnern. Bis heute höre ich den Anprall von Kinderschädeln auf viktorianischen Fliesen.
Bei gröberen Verstößen wurden die Jungen zur Rektorin zitiert, die sie mit dem Rohrstock schlug. Mädchen schlug sie mit einem Gymnastikschuh. Ich pflegte meine Gymnastikschuhe zu betrachten, diese schwarzen Stoffschuhe mit dem hufeisenförmigen Elastikeinsatz überm Spann, in denen wir zum Reckturnen antreten mussten – insbesondere die grau-beigen gerippten Sohlen –, und mir vorzustellen, wie sich das anfühlen mochte: Gummi auf nacktem Fleisch.
Die Rektorin war Gegenstand angstvoller Verehrung – ihr sehniger Hals, die klauenartigen Hände. Ihre mit einer Silbernadel am Pullover festgesteckten Schals. Ihr Büro mit den dunklen Wänden und dem ochsenblutfarbenen Teppich. Wenn ich zu ihr gerufen wurde, um meine Lesekünste vorzuführen, sah ich mich im Geist auf diesem Teppich stehen, den Rock hochgezogen in Erwartung meines Schicksals, gewappnet für den ersten Hieb.
Es färbte auf die Schüler ab, wie auch nicht. »Brennnessel« war besonders beliebt. Unterarme wurden gewrungen, bis die Haut Falten warf wie ein nasser Lappen. Haarbüschel wurden halb ausgerissen, Finger umgebogen, Absätze traten auf Zehen nieder, Hälse wurden im Schwitzkasten gewürgt – die Schläger verfügten über ein sich stets erweiterndes Arsenal an Schikanen. Ich hatte das Pech, nicht mit dem einheimischen Akzent zu sprechen, bei der Einschulung schon lesen zu können, ein Äußeres zu haben, das, wie man mir sagte, abartig war, anstößig, eine inakzeptable Provokation, ich trug Röcke, die zu oft gekürzt und wieder ausgelassen worden waren, war kränklich und fehlte deshalb oft längere Zeit, ich stotterte, wenn ich aufgerufen wurde, besaß keine Lackschuhe und so weiter und so fort. Ein Junge aus meiner Klasse fing mich einmal hinter dem Ziegelschuppen ab und hob mich wortlos an den Trägern meines Sommerkleids so hoch, dass mir die Säume tief in die Achseln schnitten. Weder er noch ich erwähnten diesen Vorfall hinterher mit einer Silbe. Aus einer Gruppe auf dem Pausenhof löste sich irgendwann ein größeres Mädchen mit glänzend-dunklem Pony und schrammte mein Gesicht an der Rinde eines Baums hin und her. In meinem ersten Halbjahr an der Gesamtschule drosch mir ein zwölfjähriger Skinhead mitten in der Chemiestunde die Faust ins Gesicht. Wenn ich mir mit der Zungenspitze über die Oberlippe fahre, spüre ich heute noch die Narbe.
Als mir der Mann die Schnur seines Feldstechers um den Hals schlang – auch wenn er dabei etwas von einer Schar Eiderenten sagte, die er mir zeigen wollte –, wusste ich deshalb sofort, was mir bevorstand. Ich konnte es riechen. Ich sah es förmlich, wie es sich verdichtete und in der Luft zwischen uns glitzerte. Dieser Mann war nur einer mehr in einer langen Reihe von Schikaneuren, der sich an meiner Sprache stieß, an meinen Schuhen, an weiß der Geier was, und mich dafür büßen lassen wollte. Er würde mir Gewalt zufügen, und es gab nichts, wodurch ich ihn daran hindern konnte.
Spiel das Spiel mit, sagte ich mir. Das ist deine einzige Chance. Einen Schläger darfst du nicht herausfordern, du darfst ihn nicht mit sich selbst konfrontieren. Du darfst ihm nie zeigen, dass du ihn durchschaust, dass du ihn als das erkennst, was er ist.
Also blickte ich durch den Feldstecher, für die Dauer eines Herzschlags nur. Ach, sagte ich, Eiderenten, so was, und ich duckte mich seitlich aus der Schlinge dieses Riemens. Er kam mir nach, natürlich kam er mir nach, versuchte mich wieder einzufangen mit seiner Schlaufe aus schwarzem Leder, aber diesmal war ich auf der Hut, ich lächelte ihm entgegen, plapperte über Eiderenten, was für faszinierende Vögel, kam daher der Begriff »Eiderdaunen«, waren es ihre Federn, mit denen Daunenkissen gefüllt wurden? Im Ernst? Wie spannend. Erzählen Sie mir mehr darüber, erzählen Sie mir alles, was Sie über Enten wissen, über Vögel, du liebe Güte, wie gut Sie sich auskennen, Sie gehen wohl sehr oft Vögel beobachten. Ja, nicht wahr? Erzählen Sie mir noch mehr, was ist der seltenste Vogel, den Sie je gesehen haben, nur müssen Sie es mir beim Gehen erzählen, was, schon so spät, ich muss wirklich los, ich muss runter, meine Schicht fängt an, doch, ja, dort unten arbeite ich, sehen Sie die Schornsteine da? Das ist das Haus. Eigentlich ganz nah. Die warten bestimmt schon auf mich. Manchmal gehen sie mir sogar entgegen, wenn ich spät dran bin, doch, mein Chef wird sicher schon unruhig. Er geht auch oft diesen Weg, die ganze Belegschaft geht ihn, er weiß, wo ich unterwegs bin, ganz bestimmt weiß er es, ich hab’s ihm ja vorhin noch gesagt, wahrscheinlich ist er schon aufgebrochen, würde mich nicht wundern, wenn er jetzt gleich um die Ecke biegt. Doch, klar können wir das machen, wir gehen in die Richtung, und beim Gehen können Sie mir noch mehr über Vögel erzählen, das fände ich toll, bitte, aber ich muss mich wirklich beeilen, die unten warten schon.
Zwei Wochen später kommt ein Polizeiauto den Serpentinenweg zum Gästehaus hochgefahren, und zwei Leute steigen aus. Ich sehe sie von einem der oberen Fenster, wo ich Kissen in die Bezüge stopfe. Ich weiß augenblicklich, weshalb sie hier sind, darum bin ich, als mein Name gerufen wird, schon auf dem Weg die Treppe hinunter.
Diese beiden haben nichts gemein mit dem Polizisten auf dem Revier. Sie tragen Zivil, und sie sind ernst, konzentriert. Sie zeigen meinem Chef, Vincent, ihre Dienstmarken und Ausweise mit einem Ausdruck ruhiger, routinierter Neutralität.
Sie wollen mich an einem Ort sprechen, wo wir für uns sind, also führt Vincent sie in ein unbelegtes Zimmer. Er kommt mit herein, weil er ein netter Mann ist und ich nur wenige Jahre älter bin als seine Kinder, deren Rufe und Schreie aus dem Garten hinterm Haus zu uns hereinschallen.
Ich sitze auf einem Bett, das ich am Morgen gemacht habe, und der Polizist sitzt an dem verschnörkelten Korbtisch, an dem manche Gäste ihren Morgentee trinken; die Polizistin setzt sich neben mich aufs Bett.
Vincent macht sich unter misstrauischem Murren im Hintergrund zu schaffen – rückt ein Kristallgehänge vor dem Fenster zurecht, wischt nicht existierenden Staub vom Kaminsims, klappert mit dem Kaminbesteck herum. Er ist ein ehemaliger Hippie, ein Haight-Ashbury-Veteran, und hält entsprechend wenig von der »Bullerei«, wie er sie nennt.
Die Polizeibeamten ignorieren ihn auf eine höfliche, beiläufige Art. Sie interessieren sich, sagt mir die Frau, für einen Mann, der mir kürzlich auf einer Wanderung begegnet ist. Ob ich ihnen möglichst genau schildern kann, was passiert ist?
Das kann ich. Ich fange am Anfang an, erwähne, dass ich ihn schon weiter unten getroffen habe, dass er in die Gegenrichtung weitergegangen und dann plötzlich vor mir aufgetaucht ist. »Keine Ahnung, wie er das geschafft hat«, sage ich, »es gibt nämlich keine Abkürzung, jedenfalls weiß ich von keiner.« Sie lauschen mit beherrschter Spannung, nickend, sie ermuntern mich zum Weiterreden. Ihr Blick weicht keine Sekunde von meinem Gesicht; ich habe ihre ungeteilte Aufmerksamkeit. Als ich zu der Stelle mit dem Feldstecher komme, hören sie auf zu nicken. Sie starren mich an, alle beide, ihre Augen geweitet, reglos. Es ist ein seltsamer, geballter Moment. Ich glaube nicht, dass einer von uns atmet.
»Die Schnur von einem Feldstecher?«, fragt der Mann.
»Ja«, sage ich.
»Und er hat sie Ihnen um den Hals gelegt?«
Ich nicke. Sie sehen weg, senken den Blick; die Frau notiert sich etwas in ihr Heft.
Ob ich wohl bereit wäre, fragt sie und reicht mir einen Ordner, mir ein paar Fotos anzuschauen und ihnen zu sagen, ob ich den Mann auf einem davon erkenne?
An diesem Punkt schaltet mein Chef sich ein, er kann nicht anders. »Du brauchst nichts zu sagen, das weißt du, gar nichts musst du denen sagen. Sie braucht Ihnen überhaupt nichts zu sagen.«
Die Polizistin bringt ihn mit einer Handbewegung zum Schweigen, während ich auch schon mit dem Finger auf ein Foto tippe.
»Der da«, sage ich.
Die Beamten sehen hin. Die Frau notiert sich wieder etwas in ihr Heft. Der Mann dankt mir; er nimmt den Ordner.
»Er hat jemanden umgebracht«, sage ich. »Oder?«
Sie wechseln einen kryptischen Blick, schweigen aber.
»Er hat jemanden erwürgt. Mit der Schnur von seinem Feldstecher.« Ich schaue von einem zum anderen, und wir alle wissen, dass es wahr ist. »Oder?«
Vincent drüben an der Wand flucht leise. Dann kommt er zu mir und gibt mir sein Taschentuch.
Das ermordete Mädchen war zweiundzwanzig. Sie kam aus Neuseeland und wollte mit ihrem Freund eine Rucksacktour durch Europa machen. An dem fraglichen Tag fühlte er sich nicht gut und blieb in der Jugendherberge, während sie allein auf den Berg stieg. Sie wurde vergewaltigt, erwürgt und dann notdürftig verscharrt. Ihr Leichnam wurde drei Tage später entdeckt, nicht weit von dem Pfad, auf dem ich gegangen war.
All dies weiß ich nur, weil ich es die Woche darauf in der Lokalzeitung las; die Polizei gab mir keine Auskunft. Ich sah die Schlagzeile im Fenster eines Kiosks, ging hinein, um die Zeitung zu kaufen, und vom Titelblatt sah mich ihr Gesicht an. Sie hatte helles, mit einem Tuch zurückgebundenes Haar, Sommersprossen, ein freundliches, argloses Lächeln.
Ich denke an sie, vielleicht nicht jeden Tag, aber fast jeden. Ich bin mir ihres Lebens bewusst, das ausgelöscht worden ist, verkürzt, während das meine aus irgendeinem Grund weitergehen durfte.
Ich habe nie erfahren, ob sie ihn gefasst haben, ob er überführt wurde, verurteilt und eingesperrt. Bei der Befragung hatte ich das deutliche Gefühl, dass die Kriminalbeamten ihm auf der Spur waren, ihn vielleicht sogar festgenommen hatten, dass sie von mir nur die passende Aussage brauchten. Vielleicht waren die DNA-Spuren eindeutig. Vielleicht hatte er gestanden. Vielleicht gab es noch andere Zeugen, andere Opfer, andere Mädchen, die mit knapper Not davongekommen waren und vor Gericht aussagten; ich wurde nie kontaktiert und war zu unbedarft oder schlicht zu verstört, um bei der Polizei anzurufen und zu sagen: Was ist passiert, habt ihr ihn erwischt, ist er hinter Gittern? Kurz darauf ging ich aus der Gegend fort, darum erfuhr ich es auch später nicht. Damals waren die Nachrichten noch nicht allgegenwärtig, ließen sich Informationen nicht überall sofort abrufen. Heute finde ich keine Spur dieses Verbrechens, keinen Hinweis darauf im Internet, obwohl ich mehrfach gesucht habe.
Ich weiß nicht, weshalb er mich verschont hat und sie nicht. Ist sie panisch geworden? Hat sie wegzulaufen versucht? Hat sie geschrien? Hat sie den Fehler gemacht, an das Monster in ihm zu rühren?
Über lange Zeit hinweg habe ich von dem Mann geträumt. Er erschien mir in einer Vielzahl von Verkleidungen, aber immer mit Rucksack und Feldstecher. In den dunklen Wirren mancher Träume erkannte ich ihn nur an diesen Requisiten, und dann dachte ich: Schau an, du mal wieder. Gibt es dich immer noch?
Es ist kein Erlebnis, das sich leicht in Worte fassen lässt. Ich behalte es für mich oder habe es bislang immer für mich behalten. Ich habe seinerzeit niemandem davon erzählt, nicht meinen Freunden, nicht meiner Familie; es schien nicht möglich, das, was passiert war, in zusammenhängende Sätze zu fassen. Streng genommen weiß nur ein Mensch davon, nämlich der Mann, den ich schließlich geheiratet habe, und ihn kannte ich schon viele Jahre, als ich es ihm sagte. Das war an einem Abend in Chile, als wir im Speiseraum unseres Hostels saßen, und sein Gesicht spiegelte beim Zuhören ein so abgrundtiefes Entsetzen wider, dass ich mir nur schwer vorstellen kann, es jemals wieder jemandem zu erzählen.
Was diesem Mädchen zugestoßen ist und um ein Haar mir zugestoßen wäre, will sich nicht zur Anekdote formen oder in geläufige erzählerische Bahnen lenken lassen, um beliebig am Esstisch oder am Telefon wiederholt zu werden. Es ist eine jener Geschichten, die vom Bösen handeln, vom Grauen selbst, von unseren schlimmsten Fantasien. Es ist eine Geschichte, die an einem wortlosen, dunklen Ort unter Verschluss gehalten sein will. Der Tod hat mich gestreift auf jenem Pfad, so dicht, dass ich seine Hand spüren konnte, aber gepackt und niedergerungen hat er das andere Mädchen, nicht mich.
Bis heute darf mich niemand um den Hals fassen, weder mein Mann noch meine Kinder, noch der freundliche Arzt, der einmal meine Mandeln abtasten wollte. Ich zucke zurück, ehe mir überhaupt klar wird, warum. Ich ertrage keinerlei Berührung dort. Schals, Polokragen, Ketten, sämtliche Oberteile oder Blusen, die den Hals in irgendeiner Weise umschließen – all das ist mir ein Grauen.
Neulich hat meine Tochter zur Spitze eines Hügels gezeigt, an dem wir auf dem Weg zur Schule vorbeikommen.
»Können wir da mal raufsteigen?«
»Sicher«, sagte ich mit einem schnellen Blick zu der grünen Kuppe hinauf.
»Nur du und ich?«
Ich schwieg einen Moment. »Wir können alle zusammen gehen«, sagte ich. »Die ganze Familie.«
Hellhörig, wie sie ist, spürte sie sofort, dass ich auswich. »Warum nicht nur wir zwei?«
»Weil … die anderen sicher auch Lust hätten.«
»Aber warum nicht du und ich?«
Weil, dachte ich, mir dazu die Worte fehlen. Weil ich nicht ansatzweise ausdrücken kann, welche Gefahren hinter der nächsten Kurve auf dich lauern, hinter Wegbiegungen, Felsblöcken, im Dickicht der Wälder. Weil du erst sechs bist. Weil es in der Welt Menschen gibt, die dir wehtun wollen, ohne dass du je begreifen wirst, warum. Weil ich noch keinen Weg gefunden habe, dir diese Dinge zu erklären. Aber ich finde ihn.
Lunge
1988
Es ist spät, Mitternacht fast, und eine Gruppe Teenager sitzt am äußersten Ende der Hafenmauer. Die Stadt liegt in der Rundung der Bucht, ein Band aus Lichtern über dem Sand. Der Hafen ist ihr Treffpunkt; hier finden sie zusammen, auch ohne sich abzusprechen; etwas an seiner exponierten Lage an der Schwelle zwischen Land und Meer scheint sie anzuziehen, besonders abends.
Sie bleiben lange hier draußen. Sie langweilen sich, auf diese geisttötende Art, die typisch ist für ihr Alter. Sie sind alle um die sechzehn. Sie haben ihre ersten Prüfungen abgelegt und warten jetzt auf die Noten, warten darauf, dass der Sommer zu Ende geht, dass die Schule wieder anfängt, dass ihre Zukunft Form annimmt, die Touristen abreisen, sie warten, warten. Manche warten darauf, dass ein verkorkster Haarschnitt herauswächst, dass ihre Eltern ihnen das Autofahren erlauben oder ihr Taschengeld aufstocken oder endlich schnallen, wie beschissen es ihnen geht, dass der Junge oder das Mädchen ihrer Wahl Notiz von ihnen nimmt, dass die Kassette kommt, die sie im Musikladen bestellt haben, dass ihre Schuhe kaputtgehen, damit sie neue bekommen, dass der Bus um die Ecke biegt, dass das Telefon klingelt. Sie warten, alle warten sie, weil das Warten die Hauptbeschäftigung von Teenagern in Küstenstädten ist. Darauf, dass etwas endet, dass etwas beginnt.
Zwei von ihnen sind miteinander gegangen, haben sich getrennt und wiedergefunden. Manche haben schon den Führerschein, andere noch nicht einmal mit den Fahrstunden begonnen. Einer raucht, aber der Großteil nicht. Das hier sind nicht die Schüler, die Drogen nehmen oder sich besaufen und herumvögeln.
Alle haben Ferienjobs, Dienstleistungen unterschiedlicher Art für die Touristen, die während der Sommermonate in jeder Ritze der Stadt zu stecken scheinen wie Sand in einem Schuh. Zwei der Jungen arbeiten als Abfallaufklauber auf dem Golfplatz, ein Mädchen als Verkäuferin in dem Eiswagen am Strand.
Einer dieser Teenager bin ich. Ich kellnere abends in einem Golfhotel. Während ich hier sitze, auf dem kühlen Vulkanstein der Hafenmauer, meine Füße über der Tiefe baumelnd, rieche ich den Hotelmief in meinen Haaren – Zigaretten, aufgewärmtes Essen, Frittenfett, verschüttetes Bier an meinem Ärmelaufschlag. Einen Geruch nach Großküche und Kneipe und dem Urlaub anderer Leute.
Als eins von den Mädchen fragt, wer sich traut, von der Hafenmauer ins Wasser zu springen, fühle ich mich nicht groß unter Druck. Ich habe schon öfter miterlebt, wie sich die Dynamik innerhalb einer Gruppe verschiebt, ins Gefährliche kippt. Wenn jemand einen Einzelnen oder alle zusammen zu etwas herausfordert, das riskant oder illegal oder beides ist, kann der Abend schnell Schlagseite bekommen. Wie damals, als ein Mädchen wollte, dass wir alle auf einen langsam fahrenden Güterzug aufsprangen. Oder als einer von den Jungs auf das Dach eines aufgelassenen Karussells kletterte, abrutschte und den Rest des Halbjahrs in Gips verbrachte. Oder als ein anderes Mädchen brennende Streichhölzer in sämtliche Abfallkörbe der Strandpromenade warf. Oder als zwei Jungen am Auto des Schulleiters die Reifen zerstachen und die Scheibenwischer abmontierten.
Heute erzähle ich diese Geschichten meinen Kindern, und sie schauen mich mit großen Augen an. So was hast du gemacht?, fragen sie. Nicht ich, sage ich dann, aber die Leute, mit denen ich zusammen war. Es wird Zeiten geben, sage ich ihnen, wenn ihr Teenager seid und mit den anderen loszieht und jemand etwas vorschlägt, von dem ihr wisst, dass es keine gute Idee ist, und ihr euch entscheiden müsst, ob ihr mitmacht oder nicht. Ob ihr mit dem Strom schwimmt oder dagegen. Ob ihr den Mund aufmacht und sagt: Nein, ich finde, das sollten wir lieber lassen. Nein, ich will das nicht. Nein, ich gehe heim.
Mir ist es immer leichtgefallen, mich aus einer Gruppe auszuklinken, mich gegen den Anführer oder die Anführerin zu stellen. Gangs, Cliquen, Dazugehören, damit hatte ich nie viel am Hut. Die angesagten Leute sind nicht meine Leute und waren es eigentlich noch nie. Das ist es also nicht, was mich antreibt, als ich dort oben auf der Hafenmauer die Beine anziehe, mich hochrapple in dem schwachen Wind, der vom Meer heranweht, und sage: »Ich mach’s.«
Ende der Leseprobe