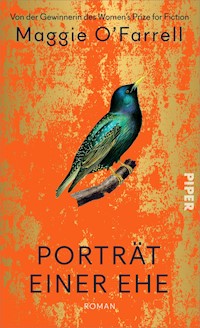Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wenn Liebe zur Obsession wird: Der psychologisch fesselnde Roman »Das Jasminzimmer« von Maggie O'Farrell jetzt als eBook bei dotbooks. Ein neues Zuhause, das noch immer den Geist seiner alten Bewohnerin zu atmen scheint … Es wird Zeit für einen Tapetenwechsel – und deswegen ist die Lebenskünstlerin Lily begeistert, bei einer Ausstellungseröffnung den charmanten Architekten Marcus kennenzulernen, der ihr ein WG-Zimmer in seinem Loft anbietet. Doch vom ersten Moment an hat Lily das Gefühl, dass hier etwas nicht stimmt: Der Raum sieht aus, als habe Marcus' Exfreundin ihn gerade erst verlassen, sogar der Jasminduft ihres Parfüms liegt noch in der Luft. Aber warum sollte Sinead Hals über Kopf geflohen sein – und was verbirgt Marcus hinter seiner Mauer aus Schweigen? Je länger Lily bei ihm wohnt, umso mehr hat sie das Gefühl, dass etwas Schreckliches in diesem Zimmer passiert ist. Ist sie nun selbst in eine Falle geraten? »Eine feinsinnige, dramatische Analyse der Art und Weise, wie eine vergangene Liebe die Gegenwart heimsuchen kann«, feierte ›The Daily Telegraph‹ diesen Bestseller in England. »Dieses Buch ist Gegenwartsliteratur in Höchstform!« lobte auch ›The Bookseller‹. Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der dramatische Schicksalsroman »Das Jasminzimmer« von Maggie O'Farrell ist eine Hommage an Daphne du Mauriers »Rebecca«, die auch Leserinnen der Bestsellerautorinnen Jodie Picault und Kristin Hannah begeistern wird. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 422
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Ein neues Zuhause, das noch immer den Geist seiner alten Bewohnerin zu atmen scheint … Es wird Zeit für einen Tapetenwechsel – und deswegen ist die Lebenskünstlerin Lily begeistert, bei einer Ausstellungseröffnung den charmanten Architekten Marcus kennenzulernen, der ihr ein WG-Zimmer in seinem Loft anbietet. Doch vom ersten Moment an hat Lily das Gefühl, dass hier etwas nicht stimmt: Der Raum sieht aus, als habe Marcus’ Exfreundin ihn gerade erst verlassen, sogar der Jasminduft ihres Parfüms liegt noch in der Luft. Aber warum sollte Sinead Hals über Kopf geflohen sein – und was verbirgt Marcus hinter seiner Mauer aus Schweigen? Je länger Lily bei ihm wohnt, umso mehr hat sie das Gefühl, dass etwas Schreckliches in diesem Zimmer passiert ist. Ist sie nun selbst in eine Falle geraten?
»Eine feinsinnige, dramatische Analyse der Art und Weise, wie eine vergangene Liebe die Gegenwart heimsuchen kann«, feierte ›The Daily Telegraph‹ diesen Bestseller in England. »Dieses Buch ist Gegenwartsliteratur in Höchstform!« lobte auch ›The Bookseller‹.
Über die Autorin:
Maggie O’Farrell, geboren 1972 in Nordirland, ist in Wales und Schottland aufgewachsen. Sie hat bei der Poetry Society und als Literaturredakteurin für den Independent on Sunday gearbeitet. Mit ihrem Debütroman »Das Haus mit der blauen Tür« feierte sie ihren internationalen Durchbruch. Inzwischen hat sie sieben Romane veröffentlicht und wurde 2010 mit dem Costa-Award für britische und irische Autoren geehrt. Maggie O’Farrell lebt mit ihrem Mann, dem Autor William Sutcliffe, und ihren Kindern in Edinburgh.
Maggie O’Farrell veröffentlichte bei dotbooks bereits »Das Haus mit der blauen Tür« und »Das Hotel im Schatten der Wälder«.
Die Website der Autorin: https://www.maggieofarrell.com/
***
eBook-Neuausgabe März 2022
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 2000 unter dem Originaltitel »My Lover’s Lover« bei Review, London. Die deutsche Erstausgabe erschien 2003 unter dem Titel »Die Freundin meines Freundes« bei Hoffmann und Campe.
Copyright © der englischen Originalausgabe 2000 by Maggie O’Farrell
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2003 by Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg
Copyright © der Neuausgabe 2022 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Covergestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock / Yuliya Loginova / Polly Sharai / Keith Heaton / Sven Hansche / Temphotto / Anna Vershynina / Karel Bock / Terdsak L
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ae)
ISBN 978-3-96655-347-6
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Das Jasminzimmer« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Maggie O’Farrell
Das Jasminzimmer
Roman
Aus dem Englischen von Claus Varrelmann
dotbooks.
Für Catherine und Bridget
mit all meiner Liebe
Jetzt,
schon beinah von euch gegangen,
bin ich stärker anwesend denn je
Ali Smith
Good loyers make great enemies
Ben Harper
TEIL EINS
As I was going up the stair,I met a man who wasn’t there.He wasn’t there again today;I wish that man would go away.
Anonymus
Kapitel 1
Sie drückt die metallschwere Tür des Taxis auf, um auszusteigen, und umklammert dabei Zigaretten, Kleingeld und dornige Rosenstiele. Sarah sagt über das Wagendach hinweg etwas zu ihr, und sie wendet sich halb um. Zu spät merkt sie, dass sie mit dem Fuß am Kantstein hängen bleibt, und im nächsten Moment hat sie den Halt verloren und kippt vornüber.
Lily sieht, wie sich die Welt um die eigene Achse dreht, ihr Haar, leichter als sie selbst, saust an ihrem Gesicht vorbei, ihre Finger lassen die Rosen los und werfen Münzen. Sie beschreibt einen Bogen und sieht, dass auf dem Bürgersteig ein Mann auf sie zugeht. Es kommt ihr irgendwie merkwürdig vor, dass er allein ist, denn er wirkt in dieser blitzartigen Momentaufnahme wie jemand, der nur selten ohne Begleitung ist. Er schreitet mit einer gewissen Entschlossenheit aus, als wollte er in der Luft einen Abdruck seiner selbst hinterlassen. Dann prallen Beton und Schotter auf ihren Körper und schürfen die Haut von ihren Händen ab.
Als Finger fest wie Efeu ihren Ärmel umklammern, schaut sie auf. Seine Augen sind von einem erstaunlichen, eindeutigen Blau. Die Blumen liegen zerquetscht unter ihr, und gelber Farbstoff zieht in ihre Kleidung ein. Er hilft ihr auf, spricht mit ihr, fragt sie: »Ist alles in Ordnung, bist du verletzt?« Ihre Hände fühlen sich wund an, wie verbrüht, und als sie sie anschaut, sieht sie, dass kleine Blutperlen in akkuraten Reihen aus der Haut hervorquellen. Dann ist Sarah um das Taxi herumgelaufen und hält sie am Arm, drückt Papiertaschentücher auf die Abschürfungen und bedankt sich bei dem Mann. Als Lily sich umsieht, ist er verschwunden.
»Meine Güte«, sagt Sarah und mustert sie. »Bist du okay?«
»Ja«, sagt sie und lacht jetzt verlegen. »Alles in Ordnung. Ich weiß gar nicht, was da passiert ist.« Und sie gehen durch die Nachtluft zur Party. Ein monotoner, dröhnender Rhythmus ist durch die Wände des Hauses zu spüren.
Drinnen sind die Zimmer und Flure voller Menschen und dicker Wolken aus Rauch. Es ist die Vernissage einer Freundin von Sarah, aber niemand schaut sich die Kunst an – fotorealistische Gemälde, auf denen Menschen und Tiere von Flammen verzehrt werden. Lily würde am liebsten den Kopf bis unter die Zimmerdecke strecken, denn dort wäre die Luft wahrscheinlich besser. Ihre verletzten Hände fühlen sich empfindlich an, geschält wie Eier.
Sie trennt sich von Sarah, die sich in dem großen Raum mit einem Mädchen in einem türkisfarbenen Kleid unterhält. Das Kleid hat einen seidigen, zarten Pelzkragen, dessen Härchen vereinzelt wie Seetang an der feuchten Haut des Mädchens kleben. Die Leute scheinen alle vom gleichen Typ zu sein oder dieselbe Uniform zu tragen. Die Frauen sind klein und knabenhaft, haben kurz geschnittene Haare und schwarz geschminkte Augen. Die Männer sind geräuschvoll, blähen selbstzufrieden ihre Kleidung auf und halten Zigaretten zwischen den fleischigen Fingern. Vielleicht liegt es am Sturz oder an dem Schmerz in ihren Händen, aber es macht ihr zu schaffen, wie weit entfernt alle scheinbar sind, als würde sie sie durch das falsche Ende eines Fernrohres betrachten.
Am Tisch mit den Getränken nimmt sie sich einen zerbrechlich wirkenden Plastikbecher mit saurem, blassem Wein. Neben ihr fächelt sich eine Frau mit dem Ausstellungskatalog energisch Luft zu, und der Rand ihres Bechers ist mit einem Abdruck ihrer grellen, purpurroten Lippen beschmiert. Lily hält ihren Becher hoch über den Kopf und bahnt sich einen Weg zwischen Menschengruppen und wehenden Gesprächsfetzen hindurch, hin zu Rücken und Schultern eines Mannes, den sie kennt. Sie hört, wie die Beine ihrer schwarzen Kordhose beim Gehen aneinander scheuern – das Geräusch verstohlener, samtener Reibung. Ein Mann, mit dem sie eine Weile zusammengewesen ist, war von dieser Hose besessen gewesen. »Vel-our cô-te-lé«, sagte er immer, wenn er sie ihr auszog, und betonte dabei jede einzelne Silbe mit gekünsteltem französischem Akzent.
Eine Hand schnellt zwischen zwei Menschen hindurch und packt sie am Arm. Die Haut ist braun, die Nägel der gekrümmten Finger silbern lackiert. Sie starrt überrascht auf die Hand hinunter, schaut dann um den Rücken einer gedrungenen Frau mit borstigen Haaren herum und sieht Phoebe, Sarahs Freundin, die in der Galerie arbeitet. »Hi«, sagt sie. »Wie geht’s?«
»Komm her und unterhalte dich mit uns.« Phoebe zieht an ihr. Die Schürfwunden an ihren Handtellern und –gelenken schmerzen und drohen aufzureißen. »Das ist mein Cousin Marky Mark.« Phoebe tritt zur Seite und Lily erblickt den Mann, der ihr vom Bürgersteig aufgeholfen hat. Phoebe deutet mit ausgestreckter, nach oben gedrehter Hand auf sie. »Das ist Lily.«
Lily macht ein paar Schritte nach vorn. Im Licht sieht er anders aus. Die Ärmel seines hektisch gemusterten Hemdes sind hochgekrempelt, einer weiter als der andere, so dass sie sehen kann, wo seine Bräune aufhört. Die Haut über seinem gewölbten Bizeps ist blass, milchig weiß, seine Unterarme tiefbraun. Auf seinen Fingern sind grüne Tintenflecken, und er balanciert den Absatz seines rechten Schuhs auf der Spitze des linken.
»Marky Mark?«, wiederholt sie, als sie so nah ist, dass er es hören kann. »Was für ein komischer Name.«
»Ich heiße Marcus«, murmelt er und richtet seinen glitzernden blauen Blick auf sie. Er mustert kurz ihr Gesicht, dann lächelt er. »Wie geht’s deinen Händen?«
Lily hält seinem Blick stand. Sie lässt sich von flirtenden Männern nicht einschüchtern. »Danke, gut.«
»Was ist mit deinen Händen?«, fragt Phoebe, aber keiner von beiden antwortet.
»Kann ich mal sehen?«, fragt er.
Sie hält ihm ihr Handgelenk hin. Er nimmt seine Bierdose in die andere Hand, greift nach ihrem Arm und umfasst ihn. Seine Haut ist erstaunlich warm. Dort, wo seine Fingerspitzen ihren Arm drücken, weicht das Blut zurück.
»Hmm«, sagt er und beugt sich vor. »Übel. Das müsste sorgfältig gereinigt werden.«
Lily zieht den Arm zurück. »Ich werd’s überleben.«
Wieder lächelt er. »Das wirst du bestimmt.«
»Was ist los? Was ist passiert?«, zwitschert Phoebe.
»Lily ist hingefallen«, antwortet Marcus und sieht Lily immer noch an. »Draußen. Sag mal, machst du das öfter, dass du dich –«
»Eigentlich nicht«, unterbricht sie ihn.
»– vor den Leuten auf den Boden wirfst?«
Es entsteht eine Pause.
»Nein«, wiederholt sie. »Tu ich nicht.«
»Marcus«, hebt Phoebe offenbar ungehalten und in schrillem, herrischem Ton an. »Erzähl mir von dir.«
Lily sieht ihn fragend an und merkt, dass sich zwischen ihnen dreien etwas ändert. Markus schaut schnell zu Phoebe hin und bewegt den Mund, als wollte er etwas sagen. Phoebe starrt ihn eindringlich an, und er erwidert den Blick seiner Cousine mit seltsam verzogener, beinahe gequälter Miene und drückt dabei sonderbarerweise eine Hand auf sein Brustbein.
»Wie fühlst du dich?«, erkundigt sich Phoebe so leise, dass sie fast flüstert.
Es geht um etwas Persönliches, Vertrauliches. Lily schaut von einem zum anderen und will plötzlich nicht mehr in der Nähe der beiden sein. Worum es sich auch handeln mag, es betrifft sie nicht.
»Also, ich –« Er hält inne. Langsam reibt er sich mit den Fingerknöcheln die Nase, ohne dabei die Bierdose schräg zu halten. Im Flur geht jemand an der Küchentür vorbei und sagt gerade: »Und sie hat nichts gewusst, hat es nie erfahren.« Marcus holt tief und geräuschvoll Atem und betrachtet scheinbar das Linoleum. Lily stellt erschrocken fest, dass er womöglich weinen wird. Aber dann grinst er und sagt: »Ich glaube, ich muss mir jemand Neues für das Zimmer suchen.«
Unvermittelt brechen er und Phoebe in wildes Gelächter aus. Phoebe johlt geradezu und stützt sich auf Marcus, während die beiden kichern und schniefen und hicksen und sich die Augen wischen. Lily lächelt den beiden zu und dreht sich zu der Wand aus Menschen und Geräuschen um. Im Weggehen hört sie Phoebe hinter sich sagen: »Was um alles in der Welt ist passiert?«
Gestern Abend ist das Radio, von dem er seit langem glaubte, es wäre kaputt, stotternd zum Leben erwacht. Plötzlich glitten die brüchigen, von einer Frau gesungenen Vokale einer ihm unverständlichen Sprache in die Wendeltreppengänge seiner Ohren.
Aidan blättert eine Seite der Zeitschrift um und probiert versuchsweise einen Schluck des brühheißen Kaffees. Er hatte eine Weile dagelegen und den Leuten der fernen Radiostation gelauscht, die irgendwo gesendet wurden und sich in seinem Zimmer ausbreiteten. Er hatte nicht wieder einschlafen können, und eine halbe Stunde später hatte er auf dem Rand der Matratze gesessen, einen Schraubenzieher in der Hand, die Einzelteile des Radios um ihn herum, und versucht, den Wackelkontakt zu finden.
Die Zeitschrift hat er im Café gefunden. Es geht darin um »Lifestyle-Themen«, wird ihm verkündet, und es sind lauter Soap-Opera-Stars in Unterwäsche abgebildet, deren Namen ihm überhaupt nichts sagen. Er verbringt ein paar Minuten damit, die Fragen eines lächerlichen Tests mit dem Titel »Sind Sie immun dagegen, sich zu verlieben?« zu beantworten und erzielt eine blamabel niedrige Punktzahl, die ihn als äußerst ansteckend einstuft. Er fängt noch einmal von vorne an und mogelt bei den Antworten, bis er sich über sich selbst ärgert und sich einem Artikel über das alljährliche Testicle Festival in Montana zuwendet.
Er ist im Kino gewesen, und er weiß, dass er dann eine Weile nicht schlafen kann, also hat er diese Kaffee-Bar gesucht, die spät abends noch offen ist. Er musste ausgehen, die Wohnung verlassen, so tun, als hätte er sowieso etwas anderes vorgehabt. Er sollte eigentlich bei Phoebes Vernissage sein, aber er konnte sich einfach nicht überwinden. Er sitzt auf einem hohen Barhocker mit einem Eisenring für die Füße, und vor ihm ist ein Spiegel. Er vermeidet es, sich selbst in die Augen zu sehen und betrachtet stattdessen den Raum hinter ihm. Die Menschen unter den hellen Leuchtstoffröhren wirken blass und vitaminarm. Zigaretten klemmen zwischen Fingern oder liegen in Aschenbechern, Beine sind übereinander geschlagen, Füße wippen, Servietten werden auf Tischplatten gefaltet wie eine Ziehharmonika. Niemand redet viel. Die Italiener hinter der Theke murmeln sich einsilbig etwas zu und starren auf den großen Fernsehschirm, auf dem die Spieler zweier Mannschaften kreuz und quer über eine grellgrüne Rasenfläche rennen. Draußen ziehen Nachtschwärmer an der Glastür vorbei.
Ohne Vorwarnung überkommt ihn ein gewaltiges Gähnen, und sein Kiefergelenk knackt – ein verblüffendes, unangemessen lautes Geräusch, das sich in seinem Kopf anhört wie ein Pistolenschuss. Er unterdrückt den Drang zu lachen und schaut sich kurz um, weil er sehen will, ob es jemand gehört hat. Was würde er sagen? Tut mir Leid, Sie gestört zu haben, aber das war bloß mein Mandibula-Gelenk. Ein Mann streift ihn im Vorübergehen, er zieht gerade seinen Mantel an. Der Kellner schüttelt an der Tür ein krümelloses Tischtuch aus. Jemandem, der in einer Ecke steht, rutscht eine Tasse Kaffee aus den Fingern, sie zerspringt, und eine heiße, dunkle Kaffeelache breitet sich auf dem regelmäßigen Schachbrettmuster des Linoleums aus.
Lily huscht auf der Suche nach einem zweiten Badezimmer die Hintertreppe der Galerie hinauf. Im Erdgeschoss gibt es eine Toilette, aber vor der Tür windet sich bereits eine lange Schlange. Auf ihrer Haut kühlt der Schweiß ab, der ihr ausgebrochen ist, weil sie mit zu vielen Menschen in einem Raum eingepfercht war. Während sie die Stufen hochsteigt, stellt sie sich vor, dass sie eine Wolke aus Wassermolekülen hinter sich herzieht.
Die Galerie befindet sich in einem jener viktorianischen Reihenhäuser, die in langen Zeilen über die ganze Stadt verteilt sind. Alle haben in etwa denselben Grundriss, aber dort, wo normalerweise das Bad ist – im ersten Stock an der Rückseite des Hauses –, findet Lily ein kleines Büro vor, in dem ein schwacher Geruch nach feuchtem Kaffeepulver hängt.
Sie stützt sich auf das spiralförmige Treppengeländer und schaut nach unten. Aus der Entfernung klingen die Stimmen der Leute wie das hohe, monotone Quaken von Fröschen. Dann hört sie noch etwas – jemand kommt mit schweren Schritten die Treppe herab.
Der Fußboden erzittert, während Marcus vom Obergeschoss nach unten geht. Sie richtet sich auf und wendet sich ihm im Halbdunkel zu. Er kommt auf sie zu und legt ihr wortlos einen Arm um die Schultern und den anderen um die Taille. Sein Körper ruht in ganzer Länge an ihrem. Er beugt den Kopf und drückt die Lippen in die leichte Vertiefung unter ihrem Wangenknochen.
Lily ist so perplex, dass sie reglos verharrt. Sie steht da, umschlossen von seinen Armen, atmet den Geruch seiner Haare, seiner Haut, seines Wollpullovers, seines Weinatems ein. Sein Gesicht ist feucht, als hätte er es gerade gewaschen.
Dann spürt sie etwas völlig anderes. Ein Luftzug, winzig, kaum wahrnehmbar, eine leichte Störung in der Atmosphäre. Es ist noch jemand da. Noch jemand ist in der Nähe und beobachtet sie. Sie macht sich von ihm los und dreht den Kopf. Es ist niemand zu sehen. Sie reckt den Kopf, um an ihm vorbeizuschauen. Auch dort ist niemand. Sie schaut ihn ein wenig ratlos an. Sie würde ihm gerne eine Frage stellen, aber sie weiß nicht genau, wie sie lauten soll. Der Augenblick vibriert zwischen ihnen, und er ist von einer seltsamen, fiebrigen Klarheit bestimmt: Sie kann hören, wie sein Herz Blut pumpt, wie ihre Schuhsohlen elektrisch geladen über den Teppich streifen. Überall sind Strukturen: Er kratzt sich am Kopf, und Haarschäfte knistern auf Haut, Fingernägel über Follikel. Ihre Kleidung bewegt sich mit ihren Körpern, Freudenfeuer aus Seide an Baumwolle, Wolle an Jeansstoff.
Er sucht etwas in seiner Gesäßtasche. »Ich will dir etwas zeigen.« Er vollführt mit den Händen eine ausladende, kreisförmige Bewegung, wie ein Zauberer, der die letzte Überraschung eines Tricks enthüllt. Er öffnet eine Hand und hält sie ihr hin. Auf seiner Handfläche liegt ein länglicher Papierstreifen. »Ein Stück Papier«, sagt er.
Lily berührt mit den Fingern die Stelle, wo seine Lippen sie berührt haben. »Das sehe ich selbst.«
»Willst du es haben?«
Sie betrachten beide den Zettel, der auf seiner ausgestreckten Hand einer winzigen Startbahn gleicht. Sie bewahrt ihre ernste Miene. »Eigentlich nicht.«
»Wie wär’s, wenn ich meine Telefonnummer darauf schreibe?«
Lily lacht.
»Na?«, sagt er.
»Nein«, sagt sie aus einer unerklärlichen Streitlust heraus, »auch dann nicht.«
»Das ist sehr unhöflich«, sagt er. Er zieht das Stück Papier mit beiden Händen auseinander und lässt es dann mit einem kurzen Ruck knallen. »Hat deine Mutter dir denn keine Manieren beigebracht?« Auf das Treppengeländer gelehnt, schreibt er mit der dünnen Mine eines Druckbleistifts Zahlen auf den Zettel. »Hier«, sagt er und steckt ihn in ihre Tasche. »Versprich mir, dass du mich anrufst.« Er lässt die Hand in ihrer Tasche stecken und zieht sie an sich. »Versprochen?«
Und weil sie nicht bereit ist, ihm zu geben, was er haben will, oder zumindest noch nicht, weil sie nicht bereit ist, seinen Regeln zu gehorchen, fragt sie: »Ist bei dir wirklich ein Zimmer frei?«
Er zwinkert. Die Hand in ihrer Tasche bewegt sich, erstarrt und zieht sich dann zurück. »Vielleicht. Wieso?«
»Ich kenne jemand, der ein Zimmer sucht.«
»Wer denn?«
»Ich. Seit zwei Monaten wohne ich wieder bei meiner Mutter, und das macht mich wahnsinnig.«
Er betrachtet ihr Gesicht sehr konzentriert, und sie weiß, dass er dabei an etwas anderes denkt. »Du«, sagt er, als würde er das Wort auf die Goldwaage legen. Dann schluckt er. »Ja«, sagt er, »ja, das stimmt. Jetzt musst du dich bei mir melden«, ruft er, während er die Treppe hinunterstürmt.
Kapitel 2
Sekunden verstreichen. Lily starrt zu den geschlossenen, undurchsichtigen Fenstern hoch und wartet. Nichts.
»Marcus!«, ruft sie erneut und lässt den Blick über die Ziegelwand schweifen, als wäre von ihr irgendeine Reaktion zu erwarten. Der Hof, der sich hinter dem schmalen Eingang erstreckt und auf drei Seiten von Lagerhäusern mit breiten Fenstern umgeben ist, laugt die Kraft ihrer Stimme aus, schluckt die Dezibel. Sie seufzt und schaut auf den Notizzettel, um die Hausnummer zu überprüfen, die er ihr gegeben hat, ehe sie wieder an die Tür tritt. Es gibt vier Klingeln, und neben der obersten steht: »Sinead + Marcus«. Die Klingel funktioniere nicht, hatte er gesagt. Sie müsse laut rufen, hat er gesagt. Er werde dann gleich nach unten kommen.
Sie geht ein paar Schritte zurück, weg von der Tür und schirmt die Augen mit der Hand gegen das trübe Licht des grellen Himmels ab. Die oberen Fenster wirken ausdruckslos und undurchdringlich und spiegeln ihre Gegenstücke auf der anderen Hofseite. Sie schaut durch den Hofeingang die Straße entlang. Zwei ältere Leute in beigefarbenen Regenmänteln überqueren quälend langsam die Straße, gefolgt von einem arthritisch aussehenden Terrier mit Tartan-Überzieher. Sie könnte einfach gehen. Sie könnte einfach zurück zur U-Bahn-Station marschieren, nach Hause fahren, sich abschminken, die Strumpfhose ausziehen, die ihren Bauch einschnürt, und sich in den bläulich flimmernden Schein des Fernsehers setzen. Sie könnte die Sache abhaken und gehen. Sie klimpert mit den Schlüsseln in ihrer Tasche, während sie über diese Möglichkeit nachdenkt.
Aber dann holt sie tief Luft, stellt sich vor, wie sich ihre Lungenbläschen mit Sauerstoff füllen und dunkel färben. »MARCUS!«, brüllt sie. Ihre Stimme ist viel lauter als erwartet, und sie kichert vor Überraschung und klammheimlicher Freude über den Lärm, den sie verursachen kann. Sein Name prallt von den feuchten Pflastersteinen ab, vom blanken Fensterglas und von den Windschutzscheiben der Autos, die entlang der Bürgersteige hocken. Dann geht über ihr ein Fenster auf, und ein Mann erscheint. Es ist nicht Marcus. Der Mann hat schwarze Haare. Und er runzelt die Stirn. Sie mustern einander einen Moment.
»Er ist nicht da«, ruft er nach unten, während er sich mit einer Hand auf der Fensterbank abstützt und mit der anderen die Haare aus seinen Augen streicht. Er sieht aus, als wäre er aus tiefem Schlaf hochgeschreckt.
»Oh«, sagt Lily. »Weißt du, wann er wieder da ist?«
Der Mann schüttelt den Kopf und zuckt die Achseln.
»Ich war um sieben hier mit ihm verabredet.«
Der Mann schaut auf die Uhr. Lily tut es nicht. Sie weiß, es ist ungefähr zehn nach.
»Keine Ahnung.« Er schaut hinunter auf Lily. Lily wartet ab. »Komm doch so lange rein.«
»Danke«, murmelt sie.
Kurz darauf öffnet sich die schwere graue Tür zur Straße hin. Sie geht nach außen auf, und der Mann drückt mit einem Fuß dagegen. Lily muss sich unter seinem Arm hindurch ducken. »Danke«, sagt sie.
Er mustert sie neugierig mit ernster Miene; sie strahlt ihn an. Mürrische Menschen lösen stets diesen Impuls in ihr aus – ihnen ihre schlechte Laune zu vermiesen. Dann lässt er die Tür ins Schloss fallen, und schlagartig ist es stockfinster. Lily zuckt zusammen und hebt die Hand, um nach einer Wand, einer Oberfläche zu tasten. Sie würde es nie offen zugeben, aber sie hat sich im Dunkeln schon immer unwohl gefühlt. Sie ist zusammen mit einem völlig fremden Mann in der Eingangshalle eines großen Lagerhauses eingesperrt. Sie erinnert sich vage, eine Treppe gesehen zu haben, die nach oben führt und dann eine Biegung macht, aber ist diese Treppe links oder rechts von ihr?
»Ganz schön dunkel hier«, hört sie sich zu dem Miesepeter sagen, aber ihre Stimme klingt hoch und dünn.
Sie bekommt keine Antwort. Lily schlurft mit ausgestrecktem Arm dorthin, wo ihrer Einschätzung nach die Treppe sein könnte. Die Oberfläche des Fußbodens fühlt sich körnig an. Unter ihren Füßen knirscht es.
»Hier entlang.«
Die Stimme ist ganz dicht an ihrem Ohr und außerdem nicht mehr da, wo sie eben noch war. Er muss um sie herumgegangen sein, und sie hat es nicht einmal bemerkt.
»Gibt’s hier denn kein Licht?«, sagt sie und dreht das Gesicht in die Richtung, aus der seine Stimme kam.
»Doch, oben.«
Seine Stimme ist jetzt weiter weg, weiter oben. Offenbar hat er begonnen, die Treppe hochzusteigen. Eine unerklärliche Furcht durchdringt sie wie eine chemische Substanz, ihr Kopf wird heiß, ihr Atem geht schnell. Sie schimpft mit sich selbst, weil sie sich so anstellt, aber Salzwasser prickelt auf ihren Augenlidern, als es schlagartig hell wird wie beim Aufleuchten eines Blitzlichts: Die Haustür geht auf und jemand – Lily ist geblendet und kann nicht sehen, wer es ist – kommt herein. Die Tür schlägt zu, Licht wird angeknipst, und vor ihr steht Marcus mit einem Fahrradhelm unter dem Arm. Seine Haare sind nass, samtig-kurz, mit feinen Netzen aus Wassertröpfchen bedeckt.
»Entschuldige bitte«, sagt er. »Ich bin zu spät, stimmt’s?« Er schiebt den Ärmel seiner Jacke zurück, um auf die Uhr zu schauen. »Ja. Tut mir wirklich Leid. Mich hat so ein blöder Kollege aufgehalten, deshalb konnte ich nicht weg, und ...« Er tritt dicht an sie heran, so dicht, dass sie den Regen an ihm riechen kann, packt sie am Arm und zieht sie in Richtung Treppe. »Komm, gehen wir rauf. Wozu noch mehr Zeit verschwenden. Hat Aidan dir aufgemacht? Wo ist er überhaupt? Wieso hat er dich hier im Dunkeln stehen lassen?«
Sie folgt ihm auf der Höhe seiner Schuhe – ein anderes Paar als neulich auf der Party – die Treppe hinauf. Die Treppe ist hoch, schmal und ausgetreten: dünne, biegbare Dielenbretter und ein hölzerner Handlauf, gestrichen mit rutschiger, billiger Farbe. Sie gehen zwei, drei, vier Etagen hoch, und in der vierten ist eine Tür angelehnt. Marcus öffnet sie und hält sie für Lily auf.
»Hereinspaziert.«
»Danke«, sagt sie, und als sie im Türrahmen dicht an ihm vorbeigeht, sehen sie sich versehentlich in die Augen.
Aber sie denkt nicht darüber nach, denn sie schaut sich in dem Zimmer um, in das sie geführt worden ist. Nie hätte sie in einem derart heruntergekommenen, schmutzigen Gebäude mit so etwas wie diesem riesigen, hallenden Raum gerechnet. Blank geschrubbte, polierte Dielen erstrecken sich von der Stelle, an der sie steht, bis zu einer Küche in der einen Ecke, einem großen Tisch in der anderen und hohen, breiten Fenstern in der gegenüberliegenden Wand. Rote Lampenschirme hängen von der fünf Meter hohen Decke; die Wand zwischen der Eingangstür und der Küche ist hellgrün gestrichen; die übrigen sind weiß und mit lauter Bücherregalen vollgestellt.
Marcus ist inzwischen hereingekommen, zieht gerade seine Jacke aus und wirft seine Tasche auf einen Stuhl. Lily geht weiter, und ihre Schuhe machen dabei klackende Geräusche auf dem polierten Holz.
»Lily ist wegen des Zimmers hier«, sagt Marcus.
Aidan, der an der langen Küchentheke steht, lässt etwas fallen. »Wegen des Zimmers?«, zischt er und streckt den Kopf vor, so als hätte Marcus etwas Unanständiges gesagt. »Was soll das heißen?«
Seine Wut lässt sie ruckartig innehalten wie einen Hund, wenn das Ende der Leine erreicht ist. Sie schaut erst Aidan und dann Marcus an.
Marcus sagt nichts, beobachtet ruhig den anderen Mann. Dann zuckt er die Achseln. »Na ja, wir brauchen jemand, der sich an den Kosten beteiligt und so.«
»Oh.« Aidan nimmt einen Eiswürfelbehälter und biegt ihn, so dass das Eis laut knackt. Es dampft, als er ihn gegen den Rand eines großen Wasserglases schlägt. Lily hört, wie die Eiswürfel beim Aufprall splittern. »Tatsächlich.«
Marcus, den Aidans bösartiger Ton nicht zu beeindrucken scheint, reibt sich den Kopf. Sie sehen zu, wie Aidan das Glas packt und quer durch den Raum marschiert. Dann öffnet er eine schwere Flügeltür und verschwindet, wie die Assistentin eines Zauberers in einer Kiste.
»Achte gar nicht auf ihn«, sagt Marcus, während er in einer Schublade kramt.
»Wo ist er hin?«, fragt sie.
»Wie meinst du das?«
»Wohin ist er?« Sie zeigt auf die Tür.
»Oh.« Er lacht. »Das ist der ehemalige Fahrstuhlschacht. Da ist sein Zimmer.«
»Im Fahrstuhlschacht?«
»Ja. Es ist ziemlich groß. Ungefähr zwölf mal vierzehn.«
»Ach so.« Sie hat keine Ahnung, wie groß das ist.
»Bist du noch nie in einem Loft gewesen?«
»Nein. Ich habe Fotos gesehen, aber so etwas noch nie.«
»Anfangs«, er ist zur Küche gegangen und stellt den Eiswürfelbehälter wieder in den Kühlschrank mit der Stahlverkleidung, »war es bloß eine leere Hülle.«
Lily lehnt sich an die Vorderseite der Theke. »Eine leere Hülle? Wirklich? All das gab es nicht?«, und sie schwenkt den Arm und zeigt auf die Küche, die Lampen, die Wand aus Glasbausteinen, hinter der sie das Bad vermutet, und die beiden Türen, die hinter Aidans Fahrstuhlschacht neben den Fenstern von dem großen Raum abgehen. »Das habt ihr eingebaut?«
»Richtig.«
»Aidan und du?«
»Nein.« Seine Stimme, die plötzlich ganz leise ist und tief aus seinem Körper zu kommen scheint, lässt Lily aufblicken. Eine Pause entsteht. Marcus hat den Kopf gesenkt und fährt mit den Fingern über den seitlichen Rand der Theke. »Meine Freundin und ich.«
Die Worte lösen bei Lily ein Gefühl aus, als wäre der Boden unter ihren Füßen aus Reispapier. Er hat eine Freundin. Er hat eine Freundin. Diese Tatsache kreist immer wieder in ihrem Kopf, und weil sie merkt, dass er sie ansieht, muss sie lächeln und nicken, obwohl sie sich fühlt, als hätte sie keine Haut mehr. »Sinead?«, fragt sie, und der Name fühlt sich in ihrem Mund merkwürdig an. Sie hat ihn noch nie ausgesprochen, wird ihr klar, ihre Lippen und ihre Zunge haben noch nie gemeinsam diese Abfolge von Lauten geformt.
Marcus schaut sie an, und das Blau seiner Augen ist wie der massigste, kälteste Eisblock. »Ja. Woher weißt du –«
»Es steht an der Klingel.«
»Oh. Oh ja. Stimmt«, sagt Marcus, dessen Stimme immer noch schwankt. Lily spürt, wie Verwirrung in ihren Hinterkopf kriecht. Er richtet sich auf, scheint etwas von seinen Schultern abzuschütteln. »Wie wär’s, wenn ich dir das Zimmer zeige?«
Sie geht ihm nach, weiter in die Wohnung hinein, und währenddessen formt sie im Geiste ein Bild. Ihr Vorname legt nahe, dass sie Irin ist, deshalb gibt Lily ihr lang wallendes, leuchtend rotes Haar und lebendige, grüne Augen. Sie ist klein, zierlich und gepflegt, und ihre Haut hat die Farbe von Buttermilch, mit einem Schneesturm aus Sommersprossen. Sie hat einen weichen, vollen, üppigen Körper. Sie spricht seinen Namen mit weichem, lang gezogenem »r«. Lily versucht, diese Details im Geiste zusammenzufügen, aber irgendwie ergeben sie kein einheitliches Bild, verschmelzen nicht miteinander.
Als er vor einer Tür am anderen Ende des Lofts stehen bleibt, sieht Lily, dass eine vom Boden bis zur Decke reichende Trennwand eine Fläche abschließt, die früher offenbar eine Nische war. Sie dreht den Kopf herum und sieht, dass direkt gegenüber von dem Zimmer, das sie gerade betreten wollen, ein weiteres auf genau dieselbe Weise eingebaut worden ist.
»Ihr habt ziemlich viel Arbeit hier reingesteckt, oder?«, sagt sie.
»Ja, haben wir. Aber für mich war das kein so großes Problem«, sagt Marcus. »Ich arbeite nämlich gewissermaßen ... in dieser Branche.«
»Bist du Bauunternehmer?«
Er schüttelt den Kopf. »Architekt.«
Sie will gerade fragen, was Sinead macht, doch dann betritt sie das Zimmer und ist einen Moment lang sprachlos. Es ist rechteckig, und die Decke wirkt in diesem abgeschlossenen Raum noch höher. Die Außenwand wird von einer weiten Glasfläche bestimmt. Die Vorhänge sind zurückgezogen; und über den Innenhof hinweg blickt Lily in ein Zimmer, wo sich eine Frau in einem lila Kleid über einen Computerbildschirm beugt und mit einem Mann spricht, der ihnen den Rücken zuwendet.
Aber weder das Raumgefühl noch die Abmessungen noch die Aussicht noch das tiefe Indigoblau der Wände verblüffen sie, sondern der Umstand, dass in diesem Zimmer offenbar durchaus noch jemand wohnt: Vor dem halb geöffneten Schrank liegen etliche Kleidungsstücke – aus den Formen und Materialien schließt Lily, dass sie einer Frau gehören – auf dem Boden. Der Schreibtisch ist mit einem Durcheinander aus losen Blättern und Bücherstapeln bedeckt; aufgereiht auf der Fensterbank stehen Nagellackflaschen, deren schillernd blaue, orange, violette, grüne und dunkelrote Farben wie Katzenaugen glitzern. Das Bett sieht aus, als wäre wer auch immer eben erst aufgestanden, das Laken ist zu lauter kleinen Wipfeln aufgewühlt, die Überdecke zurückgeschlagen, die Kissen haben runde Dellen, überall auf der Matratze liegen zerknüllte Papiertaschentücher. An der Wand hängen Schwarzweißfotos von Marcus, der mit ausgestreckten Armen einen Strand entlangrennt, von einer älteren Frau, die eine fauchende, getigerte Katze unter dem Arm trägt, und wieder von Marcus, der einbeinig auf einem Dach balanciert, womöglich dem Dach des Lagerhauses. Am Bett steht ein Glas Wasser, und daneben liegt ein Buch, in dem ein Stift als Lesezeichen steckt. Es wirkt, als wäre jemand nur kurz hinausgegangen, um etwas aus der Küche zu holen oder ans Telefon zu gehen. Lily fühlt sich unbehaglich, als würde diese Person jeden Moment zurückkommen, sie hier stehen sehen und fragen: »Was macht ihr in meinem Zimmer?«
Marcus rührt sich, und Lily sieht, dass er zwei Schritte weiter hinein in das Zimmer geht. Beim Schreibtisch bleibt er stehen und nimmt die Blätter einer Sukkulente zwischen Daumen und Zeigefinger. Die Sehnen in seinem Nacken wölben sich unter der Haut.
»Was hat das zu bedeuten?«, platzt Lily heraus. »Ist das hier das Zimmer? Ich meine, das Zimmer, das du vermieten willst?« Er nickt.
»Aber warum – wem gehört das ganze Zeug? Wessen Zimmer ist das?«
Marcus verschränkt jetzt die Arme, aber er scheint sich eher selbst zu umschlingen, schiebt die Hände unter die Arme, drückt die Finger gegen den Brustkorb. »Es ist ... es war ...«, seine Stimme ist kaum zu hören, »... es war Sineads Zimmer.«
»Sineads Zimmer?«, wiederholt Lily unwillkürlich, bevor sie die Bedeutung seiner Worte erfasst. »Oh«, sagt sie ratlos, »ich –«
»Tut mir Leid, dass ... das alles«, er macht eine vage Handbewegung, »noch hier ist. Ich hatte vor ... ich dachte, es wäre mittlerweile alles ... weggeschafft worden. Aber ...« Er verstummt und fasst wieder die Pflanze an. »Sie ... sie ...« Lily versucht, die Situation in den Griff zu bekommen, die Unterhaltung auf ein anderes Thema zu lenken, aber ihre Kehle ist wie zugeschnürt. Ein Teil von ihr will ihn berühren, und ein anderer will so schnell wie möglich weg von hier und nie wieder zurückkommen. Was auch immer der Grund gewesen sein mag, dass diese Frau so eilig verschwunden ist, etwas Erfreuliches war es nicht. »Was?«, sagt er, und sein Gesicht wirkt im hellen Licht der Glühbirne seltsam verändert.
»Sie ... äh ... sie hat das Zimmer in einer schönen Farbe angestrichen.«
»Ja.« Marcus drückt die Hand gegen die vertikalen, leuchtend blauen Latten. »Das hat sie.«
Sie schließen die Tür, indem sie sich beide dagegenstemmen, und als sie klickend ins Schloss gefallen ist, bleiben sie dicht beieinander stehen.
»Was ist, gefällt es dir?« Er berührt ihre Schulter, zieht sie aber nicht zu sich heran, und der Abstand zwischen ihnen hat die Länge und Breite einer dritten Person.
»Das Zimmer?« Sie presst die Lippen zusammen. Sie ist beunruhigt, verwirrt; sie würde gerne fragen, was passiert ist, wieso sie gegangen ist, wann sie gegangen ist. Was in aller Welt kann jemand veranlassen, derart überstürzt zu verschwinden? Was kann eine Beziehung so rasch beenden, dass man nicht einmal seine Kleider mitnimmt? Das Zimmer kommt ihr wie der Schauplatz eines Unfalls vor – man ist auf perverse Weise gezwungen, hinzuschauen, möchte aber auf keinen Fall beteiligt sein. Sein angespanntes Gesicht ist nah bei dem ihren und wirkt erwartungsvoll, und der Druck seiner Hände, die sie heiß auf ihren Armen spürt, bringt sie durcheinander. Etwas sagt ihr, dass sie gehen soll, jetzt sofort, die Treppen hinunterlaufen und durch die Hofeinfahrt und niemals zurückzukehren. »Es ist ein tolles Zimmer«, hört sie sich sagen.
»Dann ziehst du also ein?«, sagt er, und ein Lächeln breitet sich auf seinem Gesicht aus. »Du willst hier wohnen?«
»Ja«, sagt sie und nickt, mehr zu sich selbst als zu ihm. »Will ich.«
Er lehnt seine Stirn an ihre. Sie küssen sich nicht, aber sie fahren mit den Händen über den Körper des anderen, langsam und zögernd, wie Schlittschuhläufer, die nicht sicher sind, ob das Eis sie trägt.
Kapitel 3
Als Kind hat Aidan einmal ein Jahr lang geschwiegen. Ohne besonderen Grund – er wollte bloß sehen, ob er das konnte. Eines Morgens wachte er auf und beschloss, dass es ab sofort so sein würde, seine Lippen würden verschlossen bleiben, seine Zunge reglos im Mund liegen, ein reines, klares Schweigen würde ihn umhüllen, und der Lärm in seinem Kopf würde nur ihn selbst etwas angehen und nicht nach außen dringen.
Die Reaktion seiner Eltern verwandelte sich wie Lackmuspapier von Verzweiflung in Zorn und dann in Sorge. Mit blauem Stift schrieb er Nachrichten für sie auf einen Spiralblock. Er wurde zu einem Psychiater geschickt, der ihn aufzuschreiben bat, welche Eigenschaften er mit verschiedenen Farben verband. Seine Mitschüler nannten ihn »Spasti« oder »Mongo«, bis seine Schwester Jodie sie bei den Haaren packte und ihre Köpfe wie Rumbakugeln schüttelte. Und als das Jahr um war – er war der Einzige, der das Datum noch wusste –, saß er am Frühstückstisch und spürte, dass Worte in ihm aufstiegen wie der dünne Quecksilberfaden in einem Thermometer.
Aidan sitzt auf einem Stuhl, die Beine übereinander geschlagen, den Kopf in eine Hand gestützt. Er bereut, dass er seine Jacke auf den Vorschlag des Mannes hin nicht ausgezogen hat: Er vergisst immer wieder, dass die Klimaanlagen in diesem Land nicht so stark sind wie in den USA. Der Stuhl ist weich und hat harte Kunststoffarmlehnen, und er drückt gegen die Stelle zwischen seinen Schulterblättern. Aidan findet keine bequeme Sitzposition. Was ihm lächerlich vorkommt, denn wahrscheinlich hat sich ein orthopädischer Spezialist monatelang mit der optimalen ergonomischen Konstruktion dieses drehbaren, verstellbaren, rückenfreundlichen Apparats beschäftigt. Sechs Stockwerke unter ihm rauscht die Wardour Street. Er befindet sich in der Personalabteilung der Firma, für die er arbeiten wird. Ihm gegenüber, auf der anderen Seite des Schreibtischs, sitzt ein Mann und redet. Das menschliche Gehirn ist in der Lage, pro Sekunde bis zu fünfundvierzig verschiedene phonetische Einheiten zu entschlüsseln. Vielleicht, denkt Aidan, spricht dieser Mann doppelt so schnell wie ein normaler Mensch, denn er versteht nichts von dem, was er sagt; seine Stimme kommt bei Aidan als ein gedämpftes, unverständliches Gemurmel an. Der Mann will ihn überreden, den Vertrag zu unterschreiben, der zwischen ihnen auf dem Tisch liegt. Er hat Aidan um den Termin gebeten, um mit ihm darüber zu sprechen. Aidan hat jedoch nicht vor zu unterschreiben. Haben Sie nichts Besseres zu tun?, will er ihn fragen: Ziehen Sie sich etwas anderes an, und gehen Sie raus unter Menschen, amüsieren Sie sich.
Aber stattdessen schaut er ostentativ auf die Uhr und staunt: Er ist in einer Viertelstunde mit seiner Schwester zum Mittagessen verabredet. Bei der Armbewegung klimpert es metallisch in seiner Jackentasche. Die Schlüssel. Das hätte er beinahe vergessen.
»Ich muss dringend los«, sagt Aidan freundlich und rutscht auf dem unbequemen Stuhl nach vorne.
Der Mann schaut ihn beunruhigt an. »Nun ja«, sagt er. »Vielen Dank, dass Sie so ... kurzfristig konnten.« Er nimmt einen Stift in die Hand und bietet ihn Aidan erwartungsvoll an.
Aidan schüttelt lächelnd den Kopf. »Wenn Sie die Änderungen vorgenommen haben, die ich mit Bleistift eingetragen habe«, er zeigt auf die eng beschriebenen Seiten, »dann reden wir noch einmal darüber.«
»Oh.« Der Mann wirkt niedergeschlagen und fummelt am seidigen Flor seiner Krawatte herum. »Oh. In Ordnung. Ich werde das weitergeben.«
Aidan nickt. »Danke.« Er geht durch die metallene Schwingtür hinaus und nimmt die Treppe nach unten zur Straße.
Lily sitzt in der Agentur, wo sie arbeitet, und gibt die Honorarabrechnungen von Fotografen ein. Ein Stapel auseinander gefalteter Zettel liegt links neben ihr auf dem Schreibtisch. Sie nimmt einen nach dem anderen in die Hand, tippt eine Zahl in eine Spalte, drückt die Eingabe-Taste und wartet, bis die träge Festplatte den Vorgang gespeichert hat. Eine Hand spielt mit einer Büroklammer und verbiegt den akkurat gebogenen Draht. In einer anderen Ecke des Büros reißt eine Frau die Klappen des Fotokopierers auf und knallt sie fluchend wieder zu.
Lily glaubt nicht an Karriere. Vor einigen Jahren hatte sie eine »ordentliche Anstellung«, wie ihre Mutter es nannte, oder war zumindest auf dem besten Weg dorthin, als sie als Dolmetscherin arbeitete und die sonderbaren Ansichten, Wünsche und Einwände von Diplomaten und Politikern übersetzte. Aber – und das hat sie noch niemandem gegenüber zugegeben – nach ein paar Wochen hatte sie festgestellt, dass sie die für das Übersetzen zuständige Synapse in ihrem Kopf nicht mehr abstellen konnte. Sie lieferte eine permanente akustische Untermalung ihres Lebens wie ein Wasserhahn, den man irgendwo nicht zugedreht hatte. Immer, wenn Lily sich mit Freunden unterhielt, fernsah oder Radio hörte, wurden alle Worte, die sie hörte, von einem kleinen, unzugänglichen, unkontrollierbaren Teil ihres Gehirns beharrlich ins Französische übersetzt. Und als der Übersetzungsteufel in ihr anfing, jeden einzelnen Vorgang ihres täglichen Lebens, und sei er auch noch so unbedeutend, zu kommentieren (Ouvres ton Portemonnaie, prends les pièces – tu as la monnaie? Oui – et mets les l’une après l’autre dans la machine, appuies sur le bouton, et maintenant ou vas-tu encore?, plärrte er, während sie in einer U-Bahn-Station vor dem Fahrkartenautomaten stand), entschloss sie sich zu einer drastischen Maßnahme. Inzwischen hat sie das Problem im Großen und Ganzen unter Kontrolle; nur manchmal flüstert ihr innerer Dolmetscher ihr noch etwas über sie selbst auf Französisch zu.
Also hat sie drei Jobs – von denen ihr keiner viel bedeutet und keiner nach Feierabend ihre Gedanken stört oder beherrscht –, durch die sie an sechs Tagen die Woche von neun bis achtzehn Uhr beschäftigt ist. Von Montag bis Donnerstag erledigt sie verschiedene Verwaltungs- und Organisationsarbeiten für eine Gruppe von Agenten, die Schauspieler vertreten. Freitags passt sie in Stoke Newington auf einen meist friedlichen kleinen Jungen namens Laurence auf, damit seine Mutter zum Yoga und in einen Töpferkurs gehen kann. Lily soll ihm Französisch beibringen, aber die Möglichkeiten der verbalen Kommunikation mit einem Anderthalbjährigen sind begrenzt, auf Französisch oder in einer anderen Sprache. Samstags arbeitet sie als BH-Verkäuferin in der Dessous-Abteilung eines großen Kaufhauses, zusammen mit Sarah, die dadurch ihre Wochentagsexistenz als Kunststudentin teilweise finanziert.
Ihrer Mutter erzählt Lily, dass sie Geld spart, um eine Magisterarbeit zu schreiben. Sich selbst redet sie manchmal ein, dass sie spart, um eine lange Reise zu machen. Oder sich eine Wohnung zu kaufen. Oder einen Computer. Oder um einen Kursus zu absolvieren, in dem sie dann lernt, etwas Außergewöhnliches, Aufregendes zu tun. Sie spart für irgendetwas, das weiß sie, für eine verschwommene Zukunft, die in ihrer Vorstellung noch keine Konturen hat. Wenn es sich ihr eines Tages offenbart, was es auch ist, sagt sie sich, wird sie über die nötigen finanziellen Mittel verfügen, um es zu erreichen. Und außerdem vertreiben ihr die Jobs die Zeit, und sie geben ihrem Leben Struktur und Schwung.
Lilys Telefon klingelt, und sie zuckt zusammen.
»Hallo, hier ist der Empfang. Ein Mann will zu Ihnen. Er sagt, er hat einen Schlüssel für Sie.«
Marcus. Das ist Marcus. Lily verharrt einen Moment lang regungslos und spürt in den Ohren ihren Puls. Dann speichert sie die Datei ab, an der sie gearbeitet hat, und steht auf. In der Rauchglaswand des Büros wirkt sie schwarz gekleidet und geht sich selbst entgegen, steuert auf einen Frontalzusammenstoß mit einer düsteren Doppelgängerin zu.
Vor der Theke im Eingangsraum steht, freimütig beäugt von der Empfangssekretärin, Aidan und neben ihm auf dem Boden eine große Reisetasche. Lily bleibt abrupt stehen. »Hi«, sagt sie. Aidan wirkt größer und kräftiger, als sie ihn Erinnerung hat. Er ist nicht so mager wie auf dem Bild, das sie im Geiste von ihm hatte, sondern gut gebaut, mit Schultern, die einen Großteil des Raumes hinter ihm verdecken.
»Tag«, sagt er und hebt sein Kinn als Andeutung eines Nickens an.
Die Sekretärin tippt mit einem Kugelschreiber gegen ihre Fingernägel, grinst und zwinkert Lily zu. Lily ignoriert sie. Aidan streckt ihr seine nach oben gewandte Hand entgegen. »Die hier sind für dich.« An seinem Mittelfinger baumelt ein Schlüsselbund.
Lily geht zu ihm und nimmt ihn sich. »Danke.«
»Der große ist für die Haustür. Der silberne ist für die Wohnungstür. Und der andere für ... na, ja, für das andere Schloss.«
»Okay. Prima. Vielen Dank.«
Er zuckt die Achseln und greift nach seiner Tasche.
»Ähm ... wo fährst du hin?«, fragt sie, in der Hoffnung, ihn einen Moment aufzuhalten. Es wäre eigenartig, wenn er sofort wieder gehen würde. Immerhin wohnen sie ab jetzt zusammen.
»Nach Japan.«
»Oh.«
»Dienstreise.«
»Aha.« Unvermittelt überkommt sie der Drang zu lachen, und sie tut so, als müsse sie husten, damit sie sich die Hand vor den Mund halten kann und er ihr Lächeln nicht sieht. Ihr ist klar, dass dieser Mann aus irgendeinem Grund eine Abneigung gegen sie hegt, und er soll wissen, dass sie es weiß. Und dass es ihr egal ist. Sie beschließt, ihn mit noch ein paar Fragen zu quälen. »Was machst du beruflich?«
»Ich bin Trickfilmen«
»Was für Filme sind das, die du machst?«
»Äh ... Werbespots.«
»Ah ja.«
»Und Musikvideos.«
»Oh.«
»Und ab und zu Spielfilme.«
»Das hört sich ja spannend an.«
»Es ist ... na ja, also ... es ist ganz in Ordnung.«
Lily schenkt ihm ein überschwängliches Lächeln. Er wendet den Blick ab, schaut auf seine Füße, auf den Bürgersteig draußen, auf das Furnier der Empfangstheke. Sie beschließt, von ihm abzulassen. Er hat genug gelitten. »Also«, sie lässt die Schlüssel von einer Hand zur anderen wandern, »dann sehe ich dich vermutlich, wenn du wieder da bist.«
»Hmm, ja. Also, bis bald.« Er geht rückwärts und dann zur Tür hinaus und hat sich die Tasche ungeschickt über die Schulter gehängt.
»Tschüs!« Sie winkt ihm nach, bis er außer Sicht ist.
Als sie an ihren Schreibtisch zurückkehren will, spricht Sonia sie an, die Frau, die den defekten Fotokopierer beschimpft hat. »Wer war denn dieser GAK?«, will sie wissen und versperrt Lily mit den Händen in den Hüften den Weg.
Lily unterdrückt einen Seufzer. Sonia hat die lästige Angewohnheit, für alles Abkürzungen zu benutzen. GAK bedeutet »Gut aussehender Kerl«.
»Ja, wer war das?«, ruft eine andere Frau von ihrem Schreibtisch aus. »Der sah ja echt klasse aus.«
Lily lacht und setzt sich auf ihren Stuhl. Sie schaut zu der Stelle hinüber, wo Aidan und sie gestanden haben, als bestünde die Chance, eine Art Nachbild von ihm zu erblicken. »Das ist mein neuer Mitbewohner.«
»Nett«, sagt Sonia, während sie mit einem Stapel Papiere hantiert und einige davon zu Boden fallen. »Sehr nett. Lädst du mich mal zum Essen ein?«
»Klar«, sagt Lily und greift nach der nächsten Abrechnung. »Aber er ist kein GAK. Er ist ein EKB.«
Sonia schaut hoch. »Ein was?«
»Ein echter Kotzbrocken.«
Offenbar hat sie dabei ruckartig den Arm bewegt oder ist auf ihrem Stuhl herumgerutscht, denn plötzlich fallen die Schlüssel vom Tisch auf den Teppichboden. Lily bückt sich, um sie aufzuheben, und zum ersten Mal fragt sie sich, ob sie wohl früher Sinead gehört haben.
Aidan geht davon, durch das fahle, fast waagerechte Licht der tief stehenden Wintersonne kann er die Straße kaum sehen. Es ist windstill heute, und die kalte, reglose Luft verstärkt das Geräusch seiner Schritte, das Krachen eines Automotors ein Stück die Straße hinunter, die abgehackten Rufe aus einem Fenster über ihm. Er zittert unter seiner Kleidung.
Vor einem Laden hat er die Idee, nach oben in die Herrenabteilung zu gehen und sich ein Hemd zu kaufen. Er bleibt vor einer Auslage mit ein und demselben Hemd in zwölf verschiedenen Farben stehen und ist unfähig, sich für eines zu entscheiden. Aus Lautsprechern, die in der Deckenverkleidung verborgen sind, rieselt die Instrumentalversion eines Popsongs. Er geht um einen Ständer mit Krawatten herum und betastet ein Paar Socken. Dann fährt er mit dem Fahrstuhl wieder nach unten, umringt von Touristen und reichen, beschäftigungslosen Frauen mit ausdruckslosen Gesichtern.
Die Wohnung im Lagerhaus ist leer, als Lily dort ankommt. Mühsam steigt sie mit einem Rucksack auf dem Rücken die schmale Treppe hinauf, die eine Hand am Geländer, in der anderen einen Koffer, der ihr ständig gegen das Bein schlägt. Diane, ihre Mutter, hatte angeboten, sie herzufahren und ihr beim »häuslichen Einrichten« zu helfen, aber etwas Schrecklicheres kann Lily sich nicht vorstellen. Nachdem die Wohnung, die sie gemietet hatte, überschwemmt worden war, war sie gezwungen gewesen, wieder zu ihrer Mutter zu ziehen, sich klein zu machen und wieder so zu leben wie als Teenager, in dem Haus zu wohnen, in dem sie geboren worden war – »haargenau in dem Bett dort«, erzählte Diane bereitwillig jedem, der es hören wollte. Lilys Vater hatte Frau und Tochter bereits vor etlichen Jahren wegen seiner Sekretärin verlassen und damit bedenkenlos dem männlichen Klischee entsprochen, wie Lily schon immer fand.
Da sie Aidans Erklärungen zu den Schlüsseln vergessen oder ihm nicht richtig zugehört hat, braucht sie an der Tür eine Ewigkeit und fummelt an den Schlössern und Riegeln herum.
Drinnen ist es unnatürlich still und friedlich. Der Kühlschrank, an dessen Ummantelung etliche Notizzettel befestigt sind, vibriert. Am Wasserhahn der Küchenspüle hängt eine quecksilbrige Wasserperle. Die roten Deckenlampen tauchen den Raum in ein höllisches, brennofenartiges Licht. Als sie über die Dielen zu dem Zimmer geht, das nun ihr gehört, machen ihre Schritte auf den Dielen krachende, hallende Geräusche. Sie zieht an der Türklinke, aber ohne Erfolg; sie versucht es noch einmal, mit mehr Kraft. Offenbar hat sich das Holz der Tür verzogen. Sie steckt die Schlüssel in die Tasche und zerrt mit beiden Händen. Dann fällt sie rückwärts um und landet unsanft auf dem Boden. Einen Moment bleibt Lily voller Schmerzen sitzen und reibt sich fluchend das Kreuz. Aber mit einem Mal hält sie inne, denn sie kann jetzt in das Zimmer sehen. Langsam, ohne die Augen von dem abzuwenden, was sie jenseits des Türrahmens sieht, streift sie den Rucksack von den Schultern und stolpert durch die Tür, eine Hand gegen ihren schmerzenden Rücken gepresst.
Alles ist kahl. Es könnte ein anderes Zimmer sein. Die blauen Wände sind leer, der Schreibtisch ist weg, ebenso die Nagellackflaschen, die Bücher aus dem Regal, und sogar das Bett ist weg. Den Platz der großen Matratze mit dem zerwühlten Laken nimmt ein neu gekauftes Bett ein, das noch in Kunststofffolie verpackt ist. Dicht daneben, nahe der Zimmerecke ist eine kleine Vertiefung in der Wand – eine Delle, als wäre etwas aus dem Verputz gerissen worden, ein irritierender Makel in der ansonsten vollkommenen Farbfläche. Lily setzt sich aufs Bett, und unter ihr knittert die Plastikfolie. Das kahle Zimmer macht sie nervös, misstrauisch, als ließe die Leere Platz für etwas, für etwas anderes als sie.