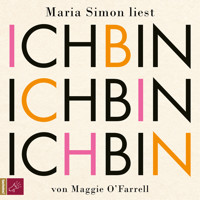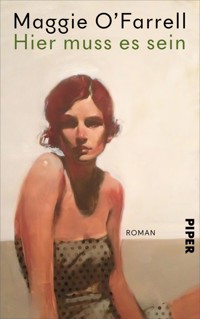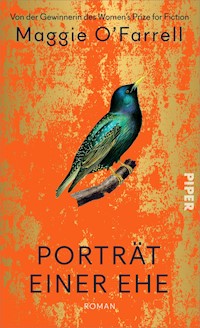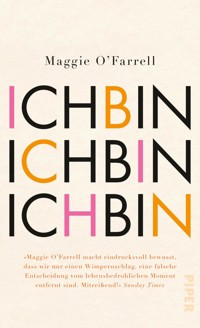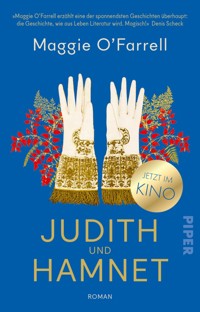
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Über ein halbes Jahr in der Top 10 der Sunday Times Einer der fünf besten Romane des Jahres der New York Times »Maggie O'Farrell erzählt eine der spannendsten Geschichten überhaupt: die Geschichte, wie aus Leben Literatur wird. Magisch!« Denis Scheck Agnes sieht ihn und weiß: Das wird er sein. Dabei ist der schmächtige Lateinlehrer aus Stratford-upon-Avon noch nicht einmal achtzehn. Egal, besser, sie küsst ihn schnell. Besser, sie erwartet ein Kind, bevor ihr einer die Heirat verbieten kann. Vierzehn Jahre später sind es drei Kinder geworden. Doch wie sollen sie auskommen, solange ihr Mann wer weiß was mit diesen Theaterstücken treibt? Er ist in London, als der elfjährige Hamnet die Beulen am Hals seiner Zwillingsschwester Judith ertastet. Als Agnes im Blick ihres Sohnes den Schwarzen Tod erkennt. Maggie O'Farrell entdeckt den bedeutendsten aller Dramatiker neu, als Liebenden und als Vater. Vor allem aber erzählt sie zum ersten Mal die unvergessliche Geschichte seiner eigensinnigen, zärtlich kühnen Frau: Agnes. »Judith und Hamnet verknüpft auf grandiose Weise Liebe und Tod, untröstliche Trauer und Hoffnung, Hamnets einsames Sterben und sein Fortleben im Werk des abwesenden Vaters.« Frankfurter Allgemeine Zeitung »Maggie O'Farrell ist eine absolute Ausnahmeerscheinung. Offenbar kann sie beim Schreiben so ziemlich alles tun, was sie will.« The Guardian »Judith und Hamnet ist ein brillanter Roman.« Süddeutsche Zeitung »O'Farrells Geniestreich besteht darin, die Spärlichkeit der Informationen über Shakespeares Privatleben als literarische Chance zu begreifen – und in der Verbindung, die sie zwischen seinem toten Sohn und seinem großartigsten Stück herstellt.« The New York Times »Was Maggie O'Farrells Schaffen auf eine andere Stufe hebt, sind ihre scharfsinnige Beobachtungsgabe und ihre Figuren, so herzzerreißend lebendig, dass man sie manchmal direkt in den Arm nehmen will.« The Sunday Times »Es gibt Bücher, die stoßen eine Tür auf und schubsen einen hinein in ein Jetzt, das so nah, so absolut erscheint wie der eigene Herzschlag. Jede Zeile hat bei Maggie O'Farrell etwas Pulsierendes, und zugleich spürt man in jedem Moment, wie fragil der Lebensstrom ist und dass jede Fülle plötzlich vorbei sein kann.« Brigitte »Maggie O'Farrell gelingt es meisterlich, sich in die Gefühle von Agnes, einer Frau, die im 16. Jahrhundert lebte, hineinzuversetzen.« Deutschlandfunk »Eine zu Tränen rührende und doch tröstliche Geschichte über Liebe und Tod in Pandemie-Zeiten.« MDR Kultur »Ein Buch wie ein schimmerndes Wunder.« David Mitchell
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:www.piper.de/literatur
Aus dem Englischen von Anne-Kristin Mittag
Die englische Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel Hamnet bei Tinder Press, einem Imprint der Headline Publishing Group, Hachette UK, London.
Die Zitate zu Beginn und nach Teil II stammen aus: William Shakespeare, Hamlet, herausgegeben, übersetzt und kommentiert von Holger Klein, Reclam 2014.
Der ebenfalls zu Beginn zitierte Beitrag von Stephen Greenblatt, »The Death of Hamnet and the Making of Hamlet«, wurde erstmals in der New York Review of Books (21. Oktober 2004) veröffentlicht.
© Maggie O’Farrell, 2020
© Piper Verlag GmbH, München 2020
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Inhalt
Cover & Impressum
Widmung
Historische Anmerkung
Zitate
I
Ein Junge kommt eine …
Wenn man in Hewlands am Fenster steht …
Schwer atmend steigt Hamnet …
Auf einmal gibt es nichts Großartigeres, als Latein …
Hamnet schreckt auf …
Eliza sagt zu Agnes …
Agnes durchquert das Zimmer …
Es ist nach zwölf …
Drei wuchtige Schläge …
Eines Frühlingsmorgens …
Damit im Sommer …
An einem Sommernachmittag …
Einen Stofflappen in der Hand …
Kurz vor ihrem zweiten Geburtstag …
Elizas Brief wird …
Gegen Ende …
Agnes schreckt aus dem Schlaf …
II
Ein Zimmer. Lang und schmal …
Dank
Für Will
Historische Anmerkung
In den 1580er Jahren hatte ein Paar, das in der Henley Street, Stratford, wohnte, drei Kinder: Susanna, dann Hamnet und Judith, die Zwillinge waren.
Der Junge, Hamnet, starb 1596 im Alter von elf Jahren.
Etwa vier Jahre später schrieb sein Vater ein Stück namens Hamlet.
Er ist tot und fort, Fräulein,Er ist tot und fort,Zu Häupten Rasen ihm grasgrün,Am Fuß ein Grabstein dort.
Hamlet Vierter Akt, Fünfte Szene
Tatsächlich sind Hamnet und Hamlet der gleiche Name, völlig austauschbar in den Aufzeichnungen von Stratford im späten sechzehnten und frühen siebzehnten Jahrhundert.
Stephen Greenblatt»The Death of Hamnet and the Making of ›Hamlet‹«
I
Ein Junge kommt eine Treppe herunter.
Der Abgang ist schmal und macht einen scharfen Knick. Der Junge nimmt, indem er sich an der Wand entlangschiebt, eine Stufe nach der anderen mit polternden Stiefelschritten.
Beinahe am Fuß der Treppe hält er kurz inne und schielt noch einmal über die Schulter hinauf, ehe er kurz entschlossen die letzten drei Stufen überspringt, wie er es immer tut. Beim Aufkommen stolpert er und schlägt mit den Knien auf dem Steinfußboden auf.
Es ist ein drückender, windstiller Tag im Spätsommer. Lange Bahnen aus Licht fallen durch das Zimmer im Erdgeschoss, und von draußen brennt die Sonne herein, sodass die Fenster wie vergitterte Platten Gelb im Putz leuchten.
Er steht auf und reibt sich die Knie. Blickt hierhin, die Treppe hoch. Blickt dorthin, ratlos, welchen Weg er einschlagen soll.
Das Zimmer ist leer. Nur das Feuer schwelt auf seinem Rost vor sich hin, orangefarbene Glut unter zart aufsteigenden Rauchspiralen. Die wunden Knie des Jungen pochen im Takt seines Herzschlags. Er verharrt mit einer Hand auf dem Riegel der Treppentür, die verschrammte lederne Spitze seines Stiefels in der Luft, bereit zum Sprung, zur Flucht. Seine hellen, beinahe goldenen Haare stehen ihm in kleinen Büscheln vom Kopf ab.
Es ist niemand da.
Er seufzt, atmet tief die warme, staubige Luft ein und geht durchs Zimmer zur Haustür und auf die Straße hinaus. Vom Lärm der Wagen, Pferde, Händler und anderen Menschen, die einander zurufen, von einem Mann, der einen Sack aus dem ersten Stock wirft, bekommt er nichts mit. Der Junge schlendert am Haus entlang und in den nächsten Eingang hinein.
Bei seinen Großeltern riecht es nach der ewig gleichen Mischung aus Holzrauch, Politur, Leder und Wolle, ähnlich und doch auf unbestimmbare Weise anders als in dem angrenzenden Zweizimmerhäuschen, das sein Großvater in eine schmale Lücke neben das größere Haus gebaut hat. Dort wohnt der Junge mit seiner Mutter und seinen Schwestern. Manchmal wundert er sich darüber, schließlich sind die beiden Wohnungen nur durch eine dünne Flechtwand getrennt, und trotzdem hat die Luft hier eine andere Note, einen anderen Geruch und eine andere Temperatur.
In diesem Haus pfeift es förmlich, so quirlig ist der Durchzug, so laut das Klopfen und Hämmern aus der Werkstatt seines Großvaters, das Pochen und Rufen der Kunden am Fenster, das lärmende Treiben auf dem Hinterhof, das Kommen und Gehen seiner Onkel.
Doch heute nicht. Der Junge steht im Durchgang und lauscht auf ein Lebenszeichen. Von hier aus kann er erkennen, dass die Werkstatt zu seiner Rechten leer ist. Die Hocker an den Werkbänken sind verwaist, die Werkzeuge liegen unbenutzt da, während die Handschuhe auf der Ablage daneben aussehen wie absichtlich hinterlassene Handabdrücke. Das Verkaufsfenster ist geschlossen und fest verriegelt. Niemand ist im Speisezimmer zu seiner Linken. Auf dem langen Tisch ein Stoß Servietten, eine unangezündete Kerze, ein Haufen Federn. Mehr nicht.
Aus seiner Kehle dringt ein Ruf, ein fragendes Geräusch. Einmal, zweimal gibt er diesen Laut von sich und wartet mit schief gelegtem Kopf auf eine Antwort.
Nichts. Nur das Knarren von Holzbalken, die sich sanft in der Sonne ausdehnen, das Seufzen eines Lufthauchs unter Türen und von Zimmer zu Zimmer, das Wispern von Leintüchern, das Knacken des Feuers, die unbestimmbaren Geräusche eines Hauses, das im Stillstand ist, leer.
Seine Finger krampfen sich um das Eisen der Türklinke. Die Hitze des Tages treibt ihm selbst jetzt noch den Schweiß auf die Stirn und den Rücken hinunter. Der Schmerz in seinen Knien wird stärker, stechend und verfliegt wieder.
Der Junge öffnet den Mund. Einen nach dem andern ruft er die Namen aller, die hier wohnen. Seine Großmutter. Die Magd. Seine Onkel. Seine Tante. Den Lehrling. Seinen Großvater. Der Junge probiert sie nacheinander durch, und kurz kommt ihm sogar der Gedanke, seinen Vater zu rufen, nach ihm zu schreien, doch der Vater ist Meilen und Stunden und Tage weit weg in London, wo der Junge noch nie war.
Aber wo, fragt er sich, sind seine Mutter, seine große Schwester, seine Großmutter, seine Onkel? Wo ist die Magd? Wo sein Großvater, der tagsüber eigentlich immer zu Hause ist und für gewöhnlich in der Werkstatt dabei anzutreffen, wie er seinen Lehrling schikaniert oder seine Einnahmen notiert? Wo sind denn alle? Wie können nur beide Häuser leer sein?
Der Junge wandert den Durchgang entlang. An der Tür zur Werkstatt bleibt er stehen und wirft einen prüfenden Blick über die Schulter, ehe er eintritt.
Die Handschuhwerkstatt seines Großvaters darf er nur sehr selten betreten. Es ist sogar verboten, in der Tür haltzumachen. »Steh da nicht bloß untätig herum«, brüllt sein Großvater dann. »Kann ein Mensch nicht mal ein ehrliches Stück Arbeit verrichten, ohne dass die Leute stehen bleiben und ihn angaffen? Hast du nichts Besseres zu tun, als da herumzulungern und Maulaffen feilzuhalten?«
Hamnet hat einen raschen Verstand: Dem Schulunterricht kann er mühelos folgen. Er erfasst Sinn und Logik dessen, was ihm gesagt wird, und er kann sich Dinge ohne Weiteres einprägen. Verben und Grammatik und Zeitformen und Rhetorik und Zahlen und Rechenergebnisse kann er sich so leicht ins Gedächtnis rufen, dass dies gelegentlich den Neid der anderen Jungen weckt. Ebenso leicht lässt er sich aber auch ablenken. Ein Karren, der während einer Griechischstunde auf der Straße vorbeifährt, lässt seine Gedanken unweigerlich von der Schiefertafel abschweifen. Er grübelt, wohin der Karren wohl unterwegs und mit was er beladen sein könnte, und dann das eine Mal, als sein Onkel ihn und seine Schwestern auf einem Heuwagen mitgenommen hatte, wie wunderbar das war, wie das frisch geschnittene Heu duftete und pikste und die Räder zum müden Hufschlag vorwärtsruckelten. Mehr als zweimal ist er in den letzten Wochen gezüchtigt worden, weil er nicht aufgepasst hatte (und die Großmutter hat gesagt, wenn das noch einmal, nur ein einziges Mal, vorkomme, würde sie seinen Vater verständigen). Die Lehrer können sich keinen Reim darauf machen. Hamnet lernt schnell und kann aus dem Gedächtnis zitieren, aber mit dem Kopf einfach nicht bei der Sache bleiben.
Beim Kreischen eines Vogels in der Luft kann er mitten im Satz abbrechen, als hätte es ihm aus heiterem Himmel die Sprache verschlagen. Sieht er aus dem Augenwinkel jemanden ins Zimmer kommen, kann er alles stehen und liegen lassen – essen, lesen, seine Schularbeiten –, und demjenigen entgegensehen, als sei er herbeigeeilt, um ihm eine wichtige Nachricht zu überbringen. Er neigt dazu, sich der wirklichen, greifbaren Welt um sich herum zu entziehen. Körperlich ist er zwar noch anwesend, gedanklich aber woanders, jemand anderes, an einem Ort, den nur er selbst kennt. »Wach auf, Kind«, schreit seine Großmutter dann und schnalzt mit den Fingern vor seinem Gesicht. »Komm zurück«, zischt seine große Schwester Susanna und schnippt ihm gegens Ohr. »Pass endlich auf«, brüllen seine Lehrer. »Wohin bist du gegangen?«, flüstert Judith ihm zu, wenn er schließlich wieder im Hier und Jetzt aufwacht, sich blinzelnd umsieht und feststellt, dass er zurück ist, zu Hause, am Tisch im Kreis der Familie, und seine Mutter ihn verschmitzt ansieht, als wüsste sie ganz genau, wo er gewesen ist.
Genau so ist Hamnet, als er jetzt das verbotene Reich der Handschuhwerkstatt betritt, entfallen, wozu er eigentlich hergekommen ist. Für einen Moment ist alles wie weggewischt – dass es Judith nicht gut geht und jemand nach ihr sehen muss, dass er ihre Mutter oder Großmutter oder irgendwen finden muss, der vielleicht weiß, was zu tun ist.
Von einer Stange hängen Felle herab. Hamnet kennt sich gut genug aus, um den rostroten getupften Balg eines Hirsches zu erkennen, das feine, schmiegsame Ziegenleder, die kleineren Felle von Eichhörnchen, die grobe, borstige Wildschweinhaut. Als er näher tritt, geht durch die Felle ein Rascheln und Raunen, gerade so, als könnte noch ein Fünkchen Leben in ihnen stecken, genug, um ihn zu hören. Hamnet streckt einen Finger aus und berührt die Ziegenhaut. Sie fühlt sich so unerfindlich weich an, wie Flussalgen, die an seinen Beinen entlangstreichen, wenn er an heißen Tagen schwimmen geht. Die Haut schwingt sanft hin und her, die Beine wie im Flug gespreizt, einem Vogel ähnlich oder einem Ghul.
Hamnet dreht sich um und betrachtet die zwei Arbeitsplätze an der Werkbank: den gepolsterten aus Leder, glatt gescheuert von den Kniebundhosen seines Großvaters, und den harten Holzhocker für Ned, den Lehrling. An der Wand darüber hängen die Werkzeuge. Er weiß genau, welche zum Schneiden, zum Dehnen, welche zum Stecken und Nähen sind. Aber der schmalere der beiden Handschuhstrecker – der für Frauen – ist nicht an seinem Platz. Er liegt auf dem Tisch, an dem Ned sonst mit gesenktem Kopf, gebeugten Schultern und eifrigen, flinken Fingern arbeitet. Hamnet weiß, dass sein Großvater den Jungen schon beim geringsten Anlass anbrüllt – oder Schlimmeres –, deshalb nimmt er den Handschuhstrecker, wiegt das warme Holz kurz in der Hand und hängt ihn dann an seinen Haken zurück.
Gerade als er die Schublade herausziehen will, in der die Garnknäuel und die Knopfschachteln aufbewahrt werden – sachte, sachte, weil er weiß, dass die Lade quietscht –, dringt ein Geräusch, ein leises Scharren oder Knarzen, an sein Ohr.
In Sekundenschnelle ist Hamnet im Durchgang und draußen auf dem Hof. Seine Aufgabe fällt ihm wieder ein. Was macht er da nur? Trödelt in der Werkstatt, während seine Schwester leidet – er muss Hilfe holen.
Eine nach der anderen reißt er die Tür zum Küchenhaus, zum Sudhaus, zur Waschküche auf. Allesamt leer, dunkel und kühl. Er ruft noch einmal, ein wenig heiser jetzt, der Hals kratzt ihm schon vom Schreien. Er lehnt sich an die Mauer des Küchenhauses und befördert eine Nussschale mit einem Tritt quer über den Hof. Er weiß weder ein noch aus. Irgendjemand sollte doch da sein. Irgendjemand ist immer da. Wo stecken bloß alle? Was soll er tun? Wie kann es sein, dass niemand zu Hause ist? Dass seine Mutter und Großmutter nicht wie sonst drinnen Ofentüren aufwuchten oder in irgendwelchen Töpfen über dem Feuer rühren? Er steht im Hof und blickt sich um: die Durchgangstür, die Sudhaustür, die Tür zu ihrem Haus. Wo soll er hin? Wen kann er zu Hilfe rufen? Und wo sind die anderen?
Jedes Leben hat seinen Kern, seinen Dreh- und Angelpunkt, von dem alles ausgeht, zu dem alles zurückkehrt. Für die abwesende Mutter ist es dieser Moment: der Junge, das leere Haus, der verwaiste Hof, der ungehörte Schrei. Wie er da hinterm Haus steht und nach den Menschen ruft, die ihn gefüttert, gewickelt, in den Schlaf gewiegt, bei seinen ersten Schritten an die Hand genommen und ihm beigebracht haben, einen Löffel zu benutzen, auf eine Brühe zu pusten, bevor er davon isst, sich beim Überqueren einer Straße in Acht zu nehmen, schlafende Hunde nicht zu wecken, einen Becher vor dem Trinken auszuspülen, nicht ins tiefe Wasser zu gehen.
Für den Rest ihres Lebens wird dieser Moment ihr zuinnerst eingeprägt sein.
Hamnet scharrt mit den Stiefeln durch den Streusand im Hof, wo noch die Überbleibsel eines Spiels herumliegen, mit dem Judith und er sich vorhin erst die Zeit vertrieben haben: Mit Kiefernzapfen an Schnüren haben sie die Jungen der Küchenkatze gelockt und an der Nase herumgeführt. Kleine Geschöpfe sind das, mit Gesichtern wie Stiefmütterchen und weichen Polstern an den Pfoten. Die Katze hatte sich in einem Fass in der Speisekammer verkrochen, um sie zur Welt zu bringen, und sie dort wochenlang versteckt. Hamnets Großmutter hatte überall nach dem Wurf gesucht, weil sie ihn, wie sonst auch, ertränken wollte, doch die Katze hatte das zu verhindern gewusst und ihre Jungen in Sicherheit gebracht. Jetzt sind sie halb ausgewachsen, die zwei, laufen herum, klettern an Säcken hoch, jagen Federn und Wollresten und Blättern nach. Judith hält es kaum ein paar Stunden ohne sie aus. Meistens steckt eins in ihrer Schürzentasche, eine verräterische Ausbuchtung, ein spitzes Ohrenpaar, das hervorlugt, woraufhin die Großmutter wieder losschreit und mit der Regentonne droht. Dann raunt Hamnets Mutter ihnen zu, dass die Jungen zu groß sind, um noch ertränkt zu werden. »Sie könnte es jetzt nicht mehr«, sagt sie, wenn die drei unter sich sind, und wischt Judith die Tränen aus dem entsetzten Gesicht. »Sie hätte gar nicht den Mumm dazu. Die Kleinen würden sich doch wehren, sie würden kämpfen.«
Jetzt schlendert Hamnet zu den verlassenen Kiefernzapfen, deren Bänder sich durch die zerstampfte Erde schlängeln. Die Kätzchen sind nirgends zu sehen. Mit der Fußspitze stupst er einen Zapfen an, der in einem ungleichmäßigen Bogen fortkullert.
Er sieht zu den beiden Häusern hoch, den vielen Fenstern des großen und dem dunklen Eingang seines eigenen. Normalerweise wären er und Judith hellauf begeistert, plötzlich allein zu sein. In genau diesem Moment würde er mit Engelszungen auf sie einreden, dass sie mit ihm aufs Dach des Küchenhauses klettert, wo ein Pflaumenbaum seine Zweige über die Nachbarsmauer reckt. Sie biegen sich unter dem Gewicht der vielen Pflaumen, deren rotgoldene Haut vor Reife schier platzt; schon vor Tagen hat Hamnet sie durch eines der oberen Fenster bei seinen Großeltern erspäht. Wenn dies ein normaler Tag wäre, würde er Judith trotz ihrer Einwände aufs Dach hinaufschieben, damit sie ihre Taschen mit gestohlenen Früchten vollstopfen kann. Arglos, wie sie ist, tut sie nicht gern etwas Unehrliches oder Verbotenes, und doch kann Hamnet sie gewöhnlich mit ein paar Worten umstimmen.
Als sie aber heute mit den Katzenjungen spielten, die ihrem verfrühten Tod entronnen waren, hatte Judith gesagt, dass sie Kopfschmerzen habe und ihr der Hals wehtue, dass ihr kalt sei, dann warm. Sie war hineingegangen, um sich hinzulegen.
Hamnet kehrt ins Haupthaus zurück. Gerade als er vom Gang auf die Straße hinaustreten will, hört er etwas, ein Klicken oder Knarren, ein winziges Geräusch nur, aber eindeutig das eines anderen Menschen.
»Hallo?«, ruft Hamnet. Er wartet. Nichts. Stille flutet aus dem Speisezimmer und der Stube dahinter. »Wer ist da?«
Einen Augenblick, nur einen kurzen Augenblick lang, schwelgt er in der Vorstellung, dass sein Vater aus London heimgekehrt sein könnte, um sie zu überraschen. Das war schon vorgekommen. Sein Vater ist da, er steht gleich hinter dieser Tür und hält sich vielleicht nur zum Spaß versteckt, um sie ein wenig hinters Licht zu führen. Wenn Hamnet ins Zimmer tritt, wird sein Vater hervorspringen; seine Tasche und sein Geldbeutel werden mit Geschenken vollgestopft sein; er wird nach Pferden, nach Heu, nach vielen Tagen auf der Straße riechen; er wird seinen Sohn in die Arme schließen, und der wird die Wange an die groben, kratzigen Verschlüsse am Wams seines Vaters drücken.
Natürlich ist es nicht sein Vater. Hamnet weiß es einfach. Der Vater würde auf seine Rufe antworten, er würde sich nie so verstecken, wenn niemand zu Hause ist. Dennoch spürt Hamnet beim Betreten der Stube ein sickerndes, sackendes Gefühl der Enttäuschung in der Brust, als er dort seinen Großvater neben dem niedrigen Tisch sieht.
Im Zimmer ist es düster, vor fast alle Fenster sind die Vorhänge zugezogen. Sein Großvater kauert mit dem Rücken zu ihm und ist mit irgendetwas zugange: Papieren, einem Stoffsack, Rechenmünzen. Auf dem Tisch steht ein Krug, daneben ein Becher. Die Hand seines Großvaters umkreist unschlüssig diese Gegenstände; sein Kopf ist gebeugt, sein Atem geht stoßweise und schnaufend.
Hamnet räuspert sich höflich.
Wutentbrannt schwenkt sein Großvater herum und rudert mit den Armen, als müsse er einen Angreifer abwehren.
»Wer da?«, schreit er. »Wer ist das?«
»Ich bin’s.«
»Wer?«
»Ich.« Der Junge tritt in den schräg durchs Fenster fallenden Lichtstreifen. »Hamnet.«
Sein Großvater lässt sich wieder auf den Stuhl plumpsen. »Du hast mir einen Heidenschrecken eingejagt«, ruft er. »Was schleichst du hier so herum?«
»Bitte entschuldige«, sagt Hamnet. »Ich habe gerufen und gerufen, aber keiner hat geantwortet. Judith ist …«
»Sie sind nicht da«, schneidet ihm sein Großvater mit einer knappen Handbewegung das Wort ab. »Was willst du nur immer mit diesen ganzen Weibern?« Er packt den Krug und zielt damit auf seinen Becher. Die Flüssigkeit – Ale, denkt Hamnet – schwappt heraus, ein Teil in den Becher, ein Teil daneben auf den Tisch. Fluchend tupft sein Großvater mit dem Ärmel die Papiere ab, und Hamnet kommt zum ersten Mal der Gedanke, dass er vielleicht betrunken sein könnte.
»Weißt du, wo sie sind?«, fragt er.
»Was?«, sagt der Großvater, immer noch mit seinen Papieren befasst. Seine Verärgerung über den angerichteten Schaden scheint wie ein Rapier aus ihm herauszufahren und auf der Suche nach einem Gegner durchs Zimmer zu wandern, und kurz kommt dem Jungen das Haselholz seiner Mutter in den Sinn, wie es zum Wasser hinzieht, nur dass er keine Wasserader ist und die Wut seines Großvaters nicht die zitternde Wünschelrute. Diese Wut ist schneidend, scharf und unberechenbar. Hamnet hat keine Ahnung, was ihm blüht oder was er jetzt tun soll.
»Steh da nicht so untätig rum«, faucht sein Großvater. »Jetzt hilf mir schon!«
Hamnet macht einen schlurfenden Schritt nach vorn, dann noch einen. Er ist auf der Hut, die Worte seines Vaters immer im Hinterkopf: »Halt dich von deinem Großvater fern, wenn er wieder eine seiner Launen hat. Sieh zu, dass du einen weiten Bogen um ihn machst. Hörst du?«
Das hatte ihm der Vater bei seinem letzten Besuch gesagt. Sie hatten dabei geholfen, einen Wagen von der Gerberei auszuladen, als John, sein Großvater, ein Bündel Felle in den Schmutz fallen ließ und vor Wut ein Schälmesser gegen die Hofmauer schleuderte. Der Vater hatte Hamnet sofort beiseite- und hinter sich gezogen, aber John war ohne ein weiteres Wort an ihnen vorbei ins Haus gestürmt. Da hatte der Vater Hamnets Gesicht zwischen beide Hände genommen, die Finger in seinem Nacken eingerollt und ihn fest angesehen. »Deinen Schwestern wird er nichts tun, aber um dich mache ich mir Sorgen«, murmelte er mit gerunzelter Stirn. »Du weißt, welche Launen ich meine, oder?« Hamnet hatte genickt, sich zugleich aber gewünscht, dass der Moment andauern, der Vater seinen Kopf noch länger so halten möge: Es gab ihm ein Gefühl von Leichtigkeit und Sicherheit, davon, bis ins Innerste erkannt und geschätzt zu werden. Gleichzeitig spürte er eine zähe Unruhe in sich aufwogen wie eine Mahlzeit, die sein Magen nicht vertrug. Er dachte an das schneidende Hickhack der Worte zwischen seinem Vater und Großvater, und wie der Vater sich unaufhörlich am Kragen herumzerrte, wenn er mit seinen Eltern am Tisch saß. »Schwör es mir«, hatte sein Vater mit heiserer Stimme gesagt, als sie da im Hof standen. »Schwöre. Ich muss wissen, dass du in Sicherheit bist, wenn ich nicht da bin, um dafür zu sorgen.«
Hamnet nimmt an, dass er sein Wort hält. Er bleibt weit zurück, auf der anderen Seite des Kamins. Hier kann ihn sein Großvater nicht kriegen, selbst wenn er wollte.
Der Großvater leert seinen Becher mit einer Hand, schüttelt mit der anderen die letzten Tropfen von einem Blatt Papier. »Nimm das«, befiehlt er und hält es ihm hin.
Hamnet beugt sich vor, als ob ihm die Füße am Boden festgewachsen wären, und nimmt es mit den Fingerspitzen entgegen. Die Augen seines Großvaters sind zu wachsamen Schlitzen verengt, seine Zunge guckt aus dem Mundwinkel hervor. Er sitzt zusammengekauert auf seinem Stuhl – eine alte, traurige Kröte auf einem Stein.
»Und das hier.« Sein Großvater hält ihm noch eine Seite hin.
Mit gebührendem Abstand beugt sich Hamnet ein zweites Mal vor. Wie stolz sein Vater jetzt wäre, wie zufrieden.
Flink wie ein Fuchs macht sein Großvater einen Satz nach vorn. Alles geht so schnell, dass Hamnet gar nicht weiß, wie ihm geschieht: Das Blatt segelt auf den Boden zwischen ihnen, sein Großvater packt ihn am Handgelenk, dann am Ellbogen und zerrt ihn in die Lücke, den Abstand, den er nach den Worten des Vaters hatte einhalten sollen. Im nächsten Moment hebt der Großvater auch die andere Hand, die immer noch den Becher hält. Hamnet sieht nur noch Schlieren vor sich – rot, orange, die Farben des Feuers, die auf ihn einstürzen –, ehe er den Schmerz spürt. Es ist ein scharfer, stechender, knüppelharter Schmerz. Der Becherrand hat ihn direkt unter der Augenbraue getroffen.
»Das wird dir eine Lehre sein«, sagt sein Großvater ruhig, »dich so an Leute heranzuschleichen.«
Tränen schießen Hamnet in die Augen.
»Und flennst noch wie ein kleines Mädchen? Genauso eine Memme wie der Vater«, setzt der Großvater verächtlich hinzu und lässt los. Hamnet springt zurück und stößt mit dem Schienbein gegen das Faulbett. »Immer nur am Heulen und Jammern und Klagen. Kein Rückgrat. Kein Verstand. Das war von Anfang an sein Problem. Hat immer gleich gekniffen.«
Hamnet rennt auf die Straße hinaus. Er wischt sich mit dem Ärmel übers Gesicht und tupft das Blut ab, macht dann die eigene Haustür auf und steigt hastig die Treppe hinauf, wo neben dem großen, mit Vorhängen versehenen Bett ihrer Eltern eine Gestalt auf dem Strohsack zusammengesunken ist. Sie trägt noch immer das braune Leinenhemd, dazu eine weiße Haube, deren Bänder sich lose an ihrem Hals herunterschlängeln, und liegt auf statt unter der Decke. Nur die Schuhe hat sie von sich geschleudert, die jetzt wie ein Paar leere Hülsen umgestülpt neben ihr liegen.
»Judith«, sagt der Junge und berührt ihre Hand. »Geht es dir besser?«
Die Lider des Mädchens heben sich. Sie starrt ihren Bruder einen Augenblick lang wie aus weiter Ferne an, ehe ihr die Augen wieder zufallen. »Ich schlafe«, murmelt sie.
Sie hat das gleiche herzförmige Gesicht wie er, den gleichen spitzen Haaransatz, das gleiche unbändige kornfarbene Haar. Die Augen, die so flüchtig auf ihm lagen, sind von der gleichen Farbe – einem warmen, goldgesprenkelten Bernsteinton –, dem gleichen Schnitt wie seine eigenen. Der Grund dafür: Sie teilen sich einen Geburtstag, so, wie sie sich einmal den Leib ihrer Mutter geteilt haben. Der Junge und das Mädchen sind Zwillinge, im Abstand von wenigen Minuten geboren. Sie ähneln einander so sehr, als wären sie in derselben Glückshaube auf die Welt gekommen.
Er schließt seine Finger um ihre – die gleichen Nägel, die gleiche Form der Knöchel, obwohl seine schon etwas größer, breiter, schmutziger sind – und schiebt den Gedanken beiseite, wie klamm und heiß sie sich anfühlen.
»Wie geht es dir?«, fragt er. »Besser?«
Sie rührt sich, krümmt ihre Finger in seinen. Ihr Kinn hebt und senkt sich wieder. Unterhalb des Kehlkopfs entdeckt der Junge eine Schwellung. Und eine weitere, wo ihr Hals in die Schulter übergeht. Er starrt sie an. Ein Paar Wachteleier unter Judiths Haut. Blass und oval liegen sie dort eingebettet, als warteten sie nur darauf zu schlüpfen. Eins an ihrem Hals, eins an ihrer Schulter.
Sie flüstert etwas, ihre Lippen teilen sich, die Zunge bewegt sich in ihrem Mund.
»Was hast du gesagt?«, fragt er und beugt sich hinunter.
»Dein Gesicht«, wiederholt sie. »Was ist mit deinem Gesicht?«
Er fasst sich an die Augenbraue und fühlt die Schwellung dort, das nasse, frische Blut. »Nichts. Es ist nichts«, erwidert er gedankenverloren. Und fährt eindringlicher fort: »Pass auf, ich hole jetzt den Arzt. Ich bin bald wieder da.«
Sie sagt noch etwas.
»Mama?«, wiederholt er. »Sie … sie kommt. Sie ist nicht weit.«
In Wirklichkeit ist sie über eine Meile weit weg.
Agnes hat von ihrem Bruder ein Stück Land bei Hewlands gepachtet, das sich von dem Haus, in dem sie geboren wurde, bis zum Wald erstreckt. Hier hält sie Bienen in geflochtenen Hanfkörben, die von einem emsigen, hoch konzentrierten Summen erfüllt sind. Es gibt Reihen von Kräutern, Blumen, Pflanzen und Stielen, die sich an Stützzweigen heraufwinden. »Agnes’ Hexengarten«, nennt ihre Stiefmutter es nur und verdreht die Augen.
In den meisten Wochen kann man Agnes dabei zusehen, wie sie die Reihen dieser Pflanzen abschreitet, Unkraut jätet, die Hand auf die Windungen ihrer Bienenstöcke legt, hier und da einen Trieb beschneidet und bestimmte Blüten, Blätter, Kapseln und Samen in einem Lederbeutel an ihrer Hüfte verschwinden lässt.
Heute aber ist sie von ihrem Bruder herbeigerufen worden, der den Schäferssohn losgeschickt hat, weil mit den Bienen etwas nicht stimmt – sie haben den Stock verlassen und sammeln sich in den Bäumen.
Agnes umrundet die Körbe und lauscht auf das, was die Bienen ihr mitteilen. Sie mustert den Schwarm im Obstgarten, einen auf sämtliche Äste verteilten schwärzlichen Fleck, der vor Empörung regelrecht bebt. Etwas hat die Bienen in Aufruhr versetzt – das Wetter, ein Temperaturwechsel oder vielleicht ein Störenfried? Eines der Kinder, ein verirrtes Schaf, ihre Stiefmutter?
Sie lässt ihre Hand von unten in einen der Körbe hineingleiten und fährt an der Schicht der verbliebenen Bienen entlang. Im kühlen, fließenden Schatten der Bäume steht sie in einem einfachen Gewand, der dicke Zopf ist unter einer weißen Bundhaube auf ihrem Scheitel festgesteckt. Keine Bienenkappe bedeckt ihr Gesicht – sie trägt nie eine. Von Nahem würde man sehen, dass ihre Lippen sich bewegen, weil sie die Insekten, die ihren Kopf umkreisen, sich auf ihren Ärmel oder in ihr Gesicht verirren, mit kleinen Geräuschen und Klicklauten beschwichtigt.
Sie zieht eine Honigwabe aus dem Korb und geht in die Hocke, um sie in Augenschein zu nehmen. Die ganze Oberfläche wimmelt von etwas, das ein einziges lebendiges Gebilde zu sein scheint, braun mit goldenen Streifen, die Flügel wie winzige Herzen. Es sind Hunderte Bienen, die sich an ihre übervolle Wabe klammern, ihre Arbeit, ihren Lohn.
Sie hebt ein schwelendes Rosmarinbündel und fächelt damit sanft über die Wabe. Eine Rauchfahne zieht durch die stille Augustluft. Die Bienen fliegen geschlossen auf und schwärmen aus, eine Wolke ohne Ränder, ein Netz in der Luft, das wie von Zauberhand immer wieder ausgeworfen wird.
Sachte, sachte schabt sie das bleiche Wachs in einen Korb, und der Honig löst sich als vorsichtiger, beinahe widerstrebender Tropfen von der Wabe. Zäh wie Harz, orangegolden, scharf nach Thymian und der blumigen Süße von Lavendel duftend, rinnt er in den Topf, den Agnes bereithält, ein anschwellender, verschlungener Faden, der sich von der Wabe nach unten zieht.
Plötzlich ist da das Gefühl einer Veränderung, eines Lufthauchs. Als wäre ein Vogel lautlos über sie hinweggeflogen. Noch immer in der Hocke, blickt Agnes auf. Die Bewegung erfasst ihre Hand, und Honig tropft ihr aufs Handgelenk, läuft ihr über die Finger und am Topf herunter. Agnes runzelt die Stirn, legt die Honigwabe ab und steht, sich die Fingerspitzen leckend, auf.
Sie überblickt die strohgedeckten Dachvorsprünge von Hewlands zu ihrer Rechten, das weiße Geröll der Wolken darüber, die rauschenden Äste des Waldes zu ihrer Linken, den Bienenschwarm in den Apfelbäumen. In der Ferne treibt ihr zweitjüngster Bruder eine Schafherde mit einer Gerte den Reitweg hinunter, umkreist von dem hierhin und dorthin tollenden Hund. Alles ist so, wie es sein sollte. Einen Moment lang starrt Agnes auf den holprigen Zug der Schafe, ihre dahinhuschenden Klauen, ihr schmutziges, schlammverkrustetes Fell. Eine Biene landet auf ihrer Wange; sie streicht sie weg.
Später, und für den Rest ihres Lebens, wird sie glauben, dass sie, wenn sie nur auf der Stelle aufgebrochen wäre, ihre Taschen, ihre Pflanzen, ihren Honig zusammengesucht und den Weg nach Hause angetreten, wenn sie nur ihr plötzliches, namenloses Unbehagen ernst genommen hätte – dass sie dann vielleicht hätte ändern können, was als Nächstes geschah. Wenn sie die schwärmenden Bienen sich selbst überlassen hätte, anstatt sich daranzumachen, sie wieder in ihre Körbe zu locken. Vielleicht hätte sie dann abwenden können, was kam.
Aber sie tut nichts dergleichen. Sie tupft sich den Schweiß von Stirn und Hals, ermahnt sich, nicht albern zu sein. Sie setzt einen Deckel auf den vollen Topf, wickelt die Honigwabe in ein Blatt. Drückt ihre Hand auf den nächsten Korb, um ihn zu lesen, ihn zu verstehen. Sie lehnt sich dagegen und spürt, wie es in ihm rumort und vibriert: eine Kraft, eine Spannung wie ein aufziehendes Unwetter.
Hamnet trabt die Straße entlang, um die Ecke, wo er einem Pferd ausweichen muss, das geduldig zwischen den Deichseln eines Wagens steht, und um eine Gruppe von Männern herum, die vor dem Rathaus mit ernster Miene die Köpfe zusammenstecken. Er kommt an einer Frau mit einem Säugling auf dem Arm vorbei, die ein älteres Kind anfleht, schneller zu gehen, doch bitte Schritt zu halten, begegnet einem Mann, der einem Esel aufs Hinterteil schlägt, einem Hund, der von dem aufblickt, was auch immer er gerade frisst, und dem rennenden Jungen nachsieht. Der Hund bellt einmal, wie in scharfem Tadel, ehe er sich wieder seinem undefinierbaren Fraß widmet.
Hamnet kommt zum Haus des Arztes – er hat die Frau mit dem Säugling nach dem Weg gefragt – und hämmert an die Tür. Wieder sieht er Judith vor sich und hämmert noch fester. Er donnert, er trommelt, er schreit.
Die Tür öffnet sich, und das schmale, verärgerte Gesicht einer Frau taucht auf. »Was machst du denn da?«, ruft sie und wedelt mit einem Tuch nach ihm, als wolle sie ihn wie ein Insekt verscheuchen. »Mit dem Krach weckst du ja noch die Toten auf. Fort mit dir!«
Sie will die Tür schon schließen, als Hamnet einen Satz nach vorn macht. »Nein«, sagt er. »Bitte. Es tut mir leid, gnädige Frau. Ich brauche den Arzt. Wir brauchen ihn. Meine Schwester … ihr geht es nicht gut. Kann er kommen? Kann er jetzt gleich kommen?«
Eisern hält die Frau die Tür mit ihrer geröteten Hand fest, mustert Hamnet jedoch eingehend, als lese sie in seinen Zügen, wie ernst die Lage sein mag. »Er ist nicht da«, sagt sie schließlich. »Er ist bei einem Patienten.«
Hamnet muss hart schlucken. »Wann ist er denn wieder zurück, bitte?«
Die Tür gibt ein wenig nach. Er stellt einen Fuß hinein, bleibt aber mit dem anderen auf der Straße stehen.
»Kann ich nicht sagen.« Sie taxiert ihn, mustert den Fuß, der sich so zudringlich in ihre Diele schiebt. »Was ist mit deiner Schwester?«
»Ich weiß es nicht.« Er versucht, sich Judith ins Gedächtnis zu rufen, wie sie da mit geschlossenen Augen auf der Decke lag, ihre Haut rot und blass zugleich. »Sie hat Fieber. Sie ist im Bett.«
Die Frau runzelt die Stirn. »Fieber? Hat sie Bubonen?«
»Bubonen?«
»Beulen. Unter der Haut. Am Hals, unter den Armen.«
Hamnet starrt die Frau an, die kleine Falte zwischen ihren Brauen, den Rand ihrer Haube, die eine Stelle neben ihrem Ohr wund gerieben hat, die drahtigen Locken, die hinten herausstehen. Er denkt an das Wort »Bubonen«, den vagen pflanzlichen Klang, der mit seinen Wölbungen das Ding nachahmt, das es bezeichnet. Kalte Angst erfasst seine Brust und hüllt sein Herz augenblicklich in knackenden Frost.
Die Stirn der Frau legt sich in noch tiefere Falten. Sie stößt Hamnet zurück, stößt ihn aus ihrem Haus hinaus.
»Geh«, sagt sie mit verkniffener Miene. »Geh nach Hause. Sofort. Verschwinde.« Sie will die Tür schließen, setzt dann aber durch einen winzigen Spalt nicht unfreundlich hinzu: »Ich will den Arzt bitten, zu euch zu kommen. Ich weiß, wer du bist. Du bist der Junge des Handschuhmachers, nicht? Der Enkel. Aus der Henley Street. Ich will ihn bitten, bei euch vorbeizuschauen, wenn er zurück ist. Geh jetzt. Mach auf dem Heimweg nicht halt.« Und ruft ihm noch hinterher: »Behüt dich Gott.«
Hamnet läuft zurück. Die Welt kommt ihm mit einem Mal greller vor, die Menschen lauter, die Straßen länger. Der Himmel ist von einem flirrenden, stechenden Blau. Das Pferd steht noch vor seinem Karren; der Hund liegt jetzt zusammengerollt in einem Eingang. Bubonen, denkt er wieder. Er hat das Wort schon einmal gehört. Er weiß, was es bezeichnet, was es bedeutet.
Nie und nimmer, denkt er, als er in seine Straße einbiegt. Das kann nicht sein. Es kann einfach nicht sein. Davon – er wird es nicht beim Namen nennen, wird dem Wort nicht erlauben, Gestalt anzunehmen, nicht einmal in seinem Kopf – hat man in dieser Stadt seit Jahren nichts mehr gehört.
Jemand wird zu Hause sein, wenn er an die Tür kommt, er weiß es. Wenn er sie öffnet und über die Schwelle tritt. Wenn er nach jemandem – irgendjemandem – ruft. Jemand wird antworten. Jemand ist da.
Was er nicht ahnt, ist, dass er auf dem Weg zum Arzt an der Magd, seinen beiden Großeltern und seiner älteren Schwester vorbeigerannt ist.
Seine Großmutter Mary war auf Liefergängen eine Gasse unten beim Fluss entlanggekommen und hielt sich mit gezücktem Stock einen ausgesprochen übellaunigen Hahn vom Leib. Hinter ihr Susanna, die mitgenommen worden war, um Marys Handschuhkorb zu tragen – Hirschleder, Ziegenleder, mit Fehfutter, Wollfutter, bestickt oder ohne Muster. »Ich weiß beim besten Willen nicht«, sagte Mary, als Hamnet ungesehen am Ende der Gasse vorbeischoss, »warum du den Leuten nicht wenigstens in die Augen schauen kannst, wenn sie dich grüßen. Unter ihnen sind einige der bestzahlenden Kunden deines Großvaters, da wäre ein Funken Höflichkeit nicht verkehrt. Ich will doch meinen, dass …« Susanna trottete hinter ihr her, verdrehte die Augen, ächzte unter dem Korb voller Handschuhe. Wie abgetrennte Hände, dachte sie und übertönte die Stimme ihrer Großmutter mit ihrem eigenen Seufzer, löschte sie mit dem Anblick eines Stücks Himmel aus, das oben durch die Häuser schnitt.
John, Hamnets Großvater, war unter den Männern vor dem Rathaus gewesen. Er hatte die Stube und seine Bücher verlassen, nachdem Hamnet zu Judith hochgegangen war, und stand mit dem Rücken zu ihm, als er zum Arzt eilte. Hätte der Junge im Vorbeilaufen den Kopf gedreht, hätte er gesehen, wie sein Großvater sich in diese Gruppe hineindrängte, sich zu den anderen Männern beugte und sich an ihre widerstrebenden Arme klammerte, wie er ihnen auf die Pelle rückte, in den Ohren lag und sie drängte, mit ihm in die Schenke zu gehen.
John war zu dieser Sitzung nicht eingeladen worden, hatte aber gehört, dass sie stattfand, und war in der Hoffnung dort aufgekreuzt, die anderen zu erwischen, bevor sie sich zerstreuten. Er will doch nur wieder als Mann von Bedeutung und Einfluss gelten und das Ansehen wiederherstellen, das er einmal gehabt hat. Er kann das, das weiß er. Alles, was er braucht, ist ein offenes Ohr bei diesen Männern, die er seit Jahren kennt und die ihn kennen, die sich für seinen Fleiß und seine Treue zu dieser Stadt verbürgen könnten. Wenigstens könnten Rat und Obrigkeit ihn begnadigen oder ein Auge zudrücken. Schließlich war er einmal Bürgermeister, dann hoher Ratsherr; früher saß er in der vordersten Kirchenbank und trug eine scharlachrote Robe. Haben diese Männer das etwa vergessen? Wie kann es sein, dass sie ihn nicht eingeladen haben? Früher hatte er Einfluss, früher herrschte er über sie alle. Früher war er jemand. Jetzt aber ist er auf jeden lumpigen Heller angewiesen, den sein Ältester aus London heimschicken kann – und wie hatte der ihn als Halbwüchsiger zur Weißglut getrieben, wenn er auf dem Marktplatz herumlümmelte und seine Zeit vergeudete. Wer hätte gedacht, dass er es einmal zu etwas bringen würde?
Johns Laden floriert noch einigermaßen, weil die Menschen immer Handschuhe brauchen werden, und wenn diese Männer von seinen heimlichen Geschäften im Wollhandel wissen, von seiner Vorladung, nachdem er nicht zur Kirche gegangen ist, und den Geldstrafen für das Abladen von Unrat auf der Straße – dann sei’s drum. John kann gut leben mit ihrer Missbilligung, ihren Bußgeldern und Forderungen, ihrem abfälligen Gemurmel über den Ruin seiner Familie, dem Ausschluss von den Ratssitzungen. Sein Haus ist eins der schönsten der Stadt: Das kann ihm keiner nehmen. Was er aber nicht ertragen kann, ist, dass keiner von ihnen etwas mit ihm trinken, keiner das Brot an seinem Tisch brechen oder sich an seinem heimischen Feuer wärmen will. Vor dem Rathaussaal meiden die Männer seinen Blick und setzen ihre Unterhaltung fort. Sie schenken seinen einstudierten Worten über die Verlässlichkeit des Handschuhgewerbes, seine Erfolge und Triumphe so wenig Gehör wie seinen Einladungen in die Schenke oder zum Abendessen daheim. Sie nicken reserviert, wenden sich ab. Einer tätschelt ihm den Arm und meint: »Gewiss, John, gewiss.«
Darum geht er allein in die Schenke. Nur für ein Stündchen. Spricht ja nichts dagegen, wenn ein Mann einmal für sich bleibt. Er wird hier im dämmerigen Zwielicht sitzen und den verirrten Fliegen zusehen, die unentwegt den brennenden Kerzenstummel auf dem Tisch umkreisen.
Judith liegt auf dem Bett, und die Wände scheinen sich nach innen zu wölben und dann wieder auszubeulen. Nach innen, nach außen, innen, außen. Die Pfosten des elterlichen Bettes krümmen und winden sich wie Schlangen; die Decke über ihr kräuselt sich wie die Oberfläche eines Sees; ihre Hände wirken gleichzeitig zu nah und sehr weit weg. Die Linie, wo der weiße Verputz an das dunkle Holz der Deckenbalken grenzt, schimmert und bricht sich. Ihr Gesicht und ihre Brust sind heiß, glühend, schweißnass, ihre Füße dagegen eiskalt. Sie fährt zitternd zusammen, einmal, zweimal, ein regelrechter Krampf, und sieht, wie die Wände sich wieder zu ihr beugen, sie umringen, von Neuem zurückweichen. Sie macht die Augen zu, um die Wände, die Schlangenbettpfosten, die ruhelose Zimmerdecke zu vergessen.
Augenblicklich ist Judith woanders. An vielen Orten zugleich. Sie geht über eine Wiese, wobei sie sich fest an eine Hand klammert. Die Hand gehört ihrer Schwester Susanna, mit langen Fingern und einem Muttermal am vierten Knöchel. Ihre Schwester will nicht so bei der Hand gehalten werden: Die Finger legen sich nicht um Judiths, sondern bleiben stocksteif. Judith muss mit aller Kraft zupacken, damit sie ihr nicht entgleiten. Susanna durchquert das hohe Gras mit großen Schritten, und jedes Mal ruckt ihre Hand in Judiths. Wenn Judith loslässt, kann es sein, dass sie im Gras versinkt. Dass sie verloren geht und nie mehr gefunden wird. Es ist wichtig – überlebenswichtig –, dass sie diese Hand festhält. Sie darf niemals loslassen. Vor ihnen, das weiß Judith, läuft ihr Bruder. Hamnets Kopf hüpft im Gras auf und ab. Sein Haar ist von der Farbe reifen Weizens. Er schnellt vor ihnen durch die Wiese wie ein geölter Blitz, wie ein Komet.
Dann ist Judith in einer Menschenmenge. Es ist Nacht und kalt; die eisige Dunkelheit wird hier und da vom Schein einer Laterne unterbrochen. Sie glaubt, es ist das Lichtmessfest. Judith befindet sich in und auch über der Menge, auf zwei starken Schultern. Ihr Vater. Ihre Beine sind um seinen Hals geschlungen, und er hält sie an beiden Knöcheln, während sie die Hände in seinem Haar vergräbt. Dickes, dunkles Haar hat er, wie Susanna. Mit dem kleinsten ihrer Finger tippt sie den silbernen Ring in seinem linken Ohr an. Darüber lacht er – sie spürt, wie das Donnergrollen sich von seinem Körper auf ihren überträgt – und schüttelt den Kopf, damit der Ohrring gegen ihren Fingernagel klimpert. Ihre Mutter ist auch dort, und Hamnet und Susanna, und ihre Großmutter. Judith ist diejenige, die ihr Vater ausgewählt hat, auf seinen Schultern zu sitzen: sie allein.
Ein gewaltiges Licht lodert auf. Kohlenbecken brennen gleißend hell um ein Holzpodium, das sich auf gleicher Höhe mit ihr befindet, dort auf den Schultern des Vaters. Auf dem Podium stehen zwei Männer in goldenen und roten Gewändern mit vielen Quasten und Bändern; auf den Köpfen tragen sie hohe Hüte, und ihre Gesichter schimmern kreideweiß, mit geschwärzten Augenbrauen und rot gefärbten Lippen. Einer der beiden stößt einen gellenden Schrei aus und schleudert einen goldenen Ball nach dem anderen. Aus dem Stand springt der auf die Hände und fängt den Ball mit den Füßen. Ihr Vater lässt ihre Knöchel los, um zu klatschen, und Judith klammert sich an seinen Kopf. Sie hat Angst, dass sie fallen, von seinen Schultern rücklings in die wimmelnde, unruhige Menge kippen könnte, die nach Kartoffelschalen riecht, nach nassem Hund, Schweiß und Kastanien. Der Schrei des Mannes hat ihr Furcht eingeflößt. Sie mag die Kohlenbecken nicht, mag die gezackten Augenbrauen der Männer nicht, mag nichts von all dem. Stumm fängt sie an zu weinen, die Tränen laufen ihr über die Wangen und sammeln sich wie Perlen im Haar ihres Vaters.
Susanna und ihre Großmutter Mary sind noch nicht zu Hause. Mary ist stehen geblieben und unterhält sich mit einer Frau aus der Gegend; sie machen einander Komplimente oder winken ab, tätscheln sich gegenseitig den Arm, aber Susanna ist nicht auf den Kopf gefallen. Sie weiß, dass diese Frau ihre Großmutter nicht leiden kann. Ständig blickt sie sich verstohlen um, schaut über die Schulter, ob jemand sie wohl im Gespräch mit Mary ertappt, der Frau des in Ungnade gefallenen Handschuhmachers. In der Stadt gibt es viele, die früher einmal Freunde waren und jetzt die Straßenseite wechseln, um ihnen nicht zu begegnen. So ist es schon seit Jahren, aber seit ihr Großvater eine Geldstrafe zahlen musste, weil er nicht zum Gottesdienst kam, haben viele der Einwohner von Stratford jeden Anschein von Höflichkeit fahren lassen und gehen nun grußlos an ihnen vorüber. Susanna sieht, wie ihre Großmutter sich so vor der Frau aufpflanzt, dass diese nicht vorbeikann und keine andere Wahl hat, als mit ihnen zu sprechen. Sie sieht das alles. Und das Wissen darüber brennt sich ihr ein und lässt schwarze Brandflecken zurück.
Judith liegt allein auf ihrem Bett, öffnet und schließt die Augen. Sie kann sich keinen Reim darauf machen, was aus diesem Tag geworden ist. Im einen Augenblick zogen Hamnet und sie für die Jungen der Katze noch Kiefernzapfen über den Hof – ständig auf der Hut vor ihrer Großmutter, weil die ihr aufgetragen hatte, das Anmachholz zu hacken und den Tisch zu polieren, während Hamnet seine Schularbeiten macht –, und im nächsten hatte sie plötzlich ein flaues Gefühl in den Armen und Schmerzen im Rücken, ein Kratzen im Hals. »Ich fühle mich nicht gut«, hatte sie zu ihrem Bruder gesagt. Der hatte von den Kätzchen zu ihr aufgeblickt, und seine Augen waren über ihr Gesicht gewandert. Jetzt liegt sie auf diesem Bett und hat keine Ahnung, wie sie hierhergekommen oder wohin Hamnet gegangen ist oder wann ihre Mutter zurückkommt oder warum eigentlich keiner da ist.
Auf dem Markt hat es die Magd nicht eilig, ihre Auswahl unter der zweiten Melkung zu treffen, während sie mit dem Milchmann schäkert.
»Sieh mal einer an!«, sagt er, ohne den Eimer loszulassen.
»Oho«, erwidert die Magd und zerrt am Henkel. »Willst du’s mir nicht geben?«
»Was geben?«, fragt der Milchmann mit hochgezogenen Brauen.
Agnes hat ihren Honig geerntet und steuert jetzt, einen Sack und den brennenden Rosmarin in der Hand, auf den Bienenschwarm zu. Sie wird die Tiere in den Sack streichen und wieder in ihren Korb setzen, aber behutsam, ganz behutsam.
Der Vater ist zwei Tagesritte entfernt in London. In diesem Moment geht er mit großen Schritten durch Bishopsgate in Richtung Themse, wo er sich einen der flachen, ungesäuerten Pfannkuchen kaufen will, die dort an Ständen angeboten werden. Er hat heute einen mörderischen Hunger in sich, ist schon damit aufgewacht, und sein Frühstück aus Ale und Porridge und die Pastete zum Mittagessen haben ihn nicht zu stillen vermocht. Er achtet auf sein Geld, trägt es nah am Körper und gibt nie mehr aus als nötig. Seine Arbeitskameraden ziehen ihn gern damit auf. Es heißt, er bunkere Goldsäcke unter den Dielen seiner Unterkunft; darüber kann er nur lächeln. Natürlich stimmt es nicht: Alles, was er verdient, schickt er nach Stratford oder führt es in seinen Satteltaschen mit sich, wenn er selbst die Heimreise antritt. Keinen Groat gibt er aus, wenn es nicht absolut notwendig ist. Und heute, an diesem Nachmittag, ist der Pfannkuchen eben eine solche Notwendigkeit.
Ein Mann geht neben ihm her, der Schwiegersohn seines Wirtes. Er redet, seit sie das Haus verlassen haben. Hamnets Vater hört nur von Zeit zu Zeit hin, was er erzählt – irgendetwas von bösem Blut mit dem Schwiegervater, einer nicht erbrachten Aussteuer, einem unerfüllten Versprechen. Lieber achtet er auf die Sonnenstrahlen, die wie Leitern in die schmalen Häuserlücken herunterreichen und die regenglänzende Straße zum Leuchten bringen; er richtet seine Gedanken auf den Pfannkuchen, der am Fluss auf ihn wartet, den strengen Seifengeruch der Wäsche, die über ihren Köpfen flattert, seine Frau – flüchtig –, wie sich das Zwillingspaar ihrer Schulterblätter spannt und spreizt, wenn sie ihre schweren Haare hochsteckt, die Naht seines Stiefels, die sich offenbar gelockert hat, und dass er jetzt dem Schuster einen Besuch abstatten muss, vielleicht sogar nachher. Doch erst muss er den Schwiegersohn des Wirtes und sein verdrießliches Geschwätz loswerden.
Und Hamnet? Er betritt wieder das in einer Lücke, einer Leere erbaute Häuschen. Er ist sich jetzt sicher, dass die anderen wieder da sind. Judith und er werden nicht länger allein sein. Jetzt wird jemand daheim sein, der weiß, was zu tun ist, jemand, der die Sache in die Hand nimmt und ihm sagt, dass alles gut wird. Er tritt ein und lässt die Tür hinter sich zufallen. Er ruft, dass er zurück ist, wieder zu Hause. Wartet auf eine Antwort, aber da ist nichts: nur Stille.
Wenn man in Hewlands am Fenster steht und den Hals zur Seite reckt, kann man den Rand des Waldes sehen.
Man mag es für einen ruhelosen, tiefgrünen, unsteten Anblick halten: Der Wind liebkost, zaust, bewegt das Blättermeer; jeder Baum spricht auf die Zuwendungen des Wetters in einem etwas anderen Rhythmus als sein Nachbar an, krümmt und rüttelt und wirft seine Äste hin und her, als versuchte er, der Luft, der Erde zu entkommen, die ihn ernährt.
An einem Morgen im Vorfrühling, ungefähr fünfzehn Jahre bevor Hamnet zum Arzt eilt, steht ein Lateinlehrer an diesem Fenster und zieht abwesend an dem Ring in seinem linken Ohr. Er betrachtet die Bäume. Angesichts ihrer versammelten Gegenwart – wie sie da aufgereiht entlang der Grenze des Gehöfts stehen – muss er an den Prospekt eines Theaters denken, eine dieser gemalten Täuschungen, die zügig ausgerollt werden, damit die Zuschauer wissen, dass sie sich jetzt an einem Naturschauplatz befinden, dass die Stadt oder die Straßen der vorangegangenen Szene hinter ihnen liegen und sie auf waldigem, unerschlossenem, womöglich schwankendem Grund stehen.
Auf seinem Gesicht zeigt sich ein leichtes Stirnrunzeln. Er bleibt am Fenster und presst die Fingerspitzen einer Hand gegen das Glas, bis sie weiß werden. Die Jungen sitzen hinter ihm. Sie konjugieren Verben, von ihrem Hauslehrer vorübergehend unbeachtet, der ganz in den Kontrast zwischen dem stechend blauen Frühlingshimmel und dem frischblättrigen Grün des Waldes versunken ist. Die Farben scheinen miteinander zu ringen, um Lebhaftigkeit zu wetteifern: Grün gegen Blau, eins gegen das andere. Die lateinischen Verben der Kinder plätschern über ihn hinweg und durch ihn hindurch, wie der Wind durch die Bäume. Irgendwo in dem Bauernhaus ertönt eine Klingel, erst kurz, dann hartnäckiger. Schritte kommen den Gang entlang, eine Tür knallt zu. Einer der Jungen – der jüngere, James, weiß der Lehrer, ohne sich umzudrehen – seufzt, hustet und räuspert sich, ehe er wieder ins gemeinsame Aufsagen einfällt. Der Lehrer rückt sich den Kragen zurecht, streicht sich das Haar glatt.
Wie Nebel im Marschland wälzen sich die Verben voran, zwischen seinen Füßen hindurch, seine Schultern hinauf und darüber hinweg, um durch die Ritzen in der Bleifassung des Fensters nach draußen zu sickern. Er lässt es geschehen, dass der Singsang der Worte in einer dumpf dröhnenden Wolke aufgeht, die den Raum bis hinauf zu den hohen, geschwärzten Deckenbalken erfüllt. Dort schlägt sie sich mit den Rauchkringeln und -schwaden des Feuers nieder, das auf dem schornsteinlosen Rost schwelt. Er hat den Jungen aufgegeben, das Verb »incarcerare« zu konjugieren: Die hart aufeinanderfolgenden K-Laute scheinen an den Wänden zu kratzen, als suchten die Wörter selbst nach einem Weg hinaus.
Sein Vater, der Handschuhmacher, hat den Lehrer dazu verdonnert, zweimal die Woche herzukommen, da er irgendwie in der Schuld von Hewlands steht, seit eine Vereinbarung oder ein Geschäft mit dem Freisassen, dem der Hof einmal gehört hat, geplatzt ist. Der Freisasse war ein breitschultriger Mann gewesen, der einen knüppelförmigen Schäferhaken am Gürtel trug, und sein offenes, ehrliches Gesicht hatte etwas an sich gehabt, das dem Lehrer recht gut gefallen hatte. Letztes Jahr aber war der Bauer plötzlich verstorben und hatte mitsamt all seiner Morgen Land und seiner Herden eine Frau und acht oder neun Kinder hinterlassen (wie viele, weiß der Hauslehrer nicht so genau). Es war ein Vorfall, den sein eigener Vater mit kaum verhüllter Schadenfreude begrüßt hatte. Nur der Alte wusste, worum es sich bei dem Darlehen handelte: Der Lehrer hatte mitbekommen, wie sein Vater einmal spätnachts, im Glauben, niemand würde es hören (der Lehrer ist sehr gut darin, heimlich zu lauschen), frohlockte: »Verstehst du nicht? Die Witwe weiß nichts davon, und wenn doch, wird sie es nicht wagen, mir damit anzukommen. Geschweige denn dieser zurückgebliebene Schafskopf von ältestem Sohn.«
Wie es aussieht, hat die Witwe oder ihr Sohn jedoch haargenau das getan. Und die Vereinbarung hat (wie der Lehrer den belauschten Gesprächen entnahm, die hinter der Schlafkammertür seiner Eltern stattfanden) irgendetwas damit zu tun, was sein Vater mit einer Ladung Schaffelle des Freisassen angestellt hat. Offenbar hatte der Vater dem Bauern einst versichert, die Felle würden zur Weißgerbung geschickt, und der Bauer hatte ihm geglaubt. Doch dann hatte sein Vater darauf bestanden, dass die Wolle drangelassen werde, was den Bauern misstrauisch gemacht und aus irgendeinem Grund zu dieser ganzen Schererei geführt hat. Über diesen letzten Punkt ist sich der Hauslehrer nicht im Klaren, da seine Mutter vom Gequietsche und Gequengel Edmonds, ihres jüngsten Kindes, aus der geflüsterten Unterhaltung gerissen wurde.
Inzwischen hat der Vater des Lehrers wohl irgendein neues zwielichtiges Vorhaben, von dem keiner wissen soll; so viel steht fest. Falls jemand sie fragt, sollen er und seine Geschwister so tun, als seien die Schaffelle für Handschuhe bestimmt. Da es ihnen gar nicht in den Sinn gekommen war, die Felle könnten für irgendetwas anderes gedacht sein, standen die Kinder vor einem Rätsel. Wofür brauchte ihr Vater, der erfolgreichste Handschuhmacher der Stadt, sie denn sonst?
Es gibt jedenfalls eine Schuld oder Geldstrafe, und ihr Vater kann oder will nicht zahlen, doch die Witwe oder der Sohn des Bauern lässt nicht locker, und nun sieht es so aus, als stelle er selbst die Bezahlung dar. Seine Zeit, sein Latein, sein Verstand. Zweimal die Woche, hat sein Vater zu ihm gesagt, müsse er die eine Meile aus der Stadt hinauslaufen, am Bach entlang zu diesem tief liegenden Gutshaus zwischen Schafsherden, und dort die Jungen mit dem Unterricht quälen.
Dieser Plan war natürlich ohne ihn ausgeheckt, das Netz um ihn herumgesponnen worden. Sein Vater hatte ihn eines Abends in die Werkstatt gerufen, als die Geschwister sich schon fürs Bett fertig machten, und ihm gesagt, er solle nach Hewlands gehen, um »den Jungen da mal ein bisschen Bildung einzutrichtern«. Der Lehrer hatte in der Tür gestanden und seinen Vater scharf angesehen. Wann, hatte er gefragt, ist das beschlossen worden? Sein Vater und seine Mutter polierten gerade die Werkzeuge für den nächsten Tag.
»Geht dich nichts an«, versetzte sein Vater. »Du brauchst nur zu wissen, dass du gehst.«
»Was, wenn ich nicht mag?«
Scheinbar ohne diesen Einwand zu hören, schob der Vater ein langes Messer zurück in seine lederne Hülle. Die Mutter hatte ihm einen Blick zugeworfen, dann ihren Sohn angesehen und kaum merklich den Kopf geschüttelt.
»Du gehst«, sagte sein Vater schließlich und legte den Lappen hin. »Und damit Schluss.«
Der Wunsch, von diesen beiden Menschen loszukommen, aus dem Zimmer zu rauschen, die Haustür aufzureißen und auf die Straße zu rennen, stieg in dem Sohn auf wie die Säfte in einem Baum. Und – ja, seinen Vater zu schlagen, diesem Körper ein Leid zuzufügen, ihm mit seinen eigenen Fäusten und Armen und Fingern alles zurückzugeben, was ihm selbst angetan worden war. Alle sechs waren sie von Zeit zu Zeit zur Zielscheibe des väterlichen Jähzorns, seiner Hiebe und Übergriffe und Ohrfeigen geworden, aber keiner mit so regelmäßiger Brutalität wie der älteste Sohn. Er wusste nicht, warum, aber etwas an ihm hatte schon immer die Wut und Enttäuschung seines Vaters angezogen. Wie sich die schwielige väterliche Hand um die weiche Haut seines Oberarms schließt und ihn eisern gepackt hält, damit der Vater mit der anderen, stärkeren Hand Schläge auf ihn herabhageln lassen kann – diese Empfindung hat sich ihm tief ins Gedächtnis gegraben. Der Schock eines Hiebes, der ihn plötzlich und scharf von oben trifft; das reißende Brennen eines hölzernen Werkzeugs an der Rückseite seiner Beine. Wie hart waren die Knochen einer Erwachsenenhand, wie zart und weich dagegen das Fleisch eines Kindes. Wie mühelos waren doch diese jungen, noch unfertigen Knochen zu biegen und zu stauchen. Der Groll und die ohnmächtige Erniedrigung – übergossen, durchtränkt war er damit in den endlosen Minuten einer Tracht Prügel.
Die Wutausbrüche seines Vaters zogen aus dem Nichts auf wie ein Sturm, und genauso rasch verzogen sie sich. Es gab kein Muster, keine Vorwarnung, keine rationale Erklärung; nie war es der gleiche Anlass, über den er in Rage geriet. Und dennoch entwickelte der Sohn schon in jungen Jahren ein Gespür dafür, wann einer dieser Ausbrüche drohte, und eine Reihe von Finten und Ausweichmanövern, um den Fäusten seines Vaters zu entgehen. So wie ein Astronom aus dem Kurs der Planeten und Sterne winzige Bewegungen und Veränderungen abliest, um das Kommende vorherzusehen, wurde dieser älteste Sohn ein Meister darin, die Launen und Mienen seines Vaters zu deuten. Am Zuschlagen der Haustür, wenn sein Vater von der Straße eintrat, und dem Takt seiner Schritte auf dem steinernen Boden konnte er sagen, ob ihm Prügel bevorstanden oder nicht. Eine verschüttete Kelle Wasser, ein Stiefel am falschen Ort, ein Gesichtsausdruck, der als nicht respektvoll genug empfunden wurde – all dies konnte seinem Vater als Vorwand dienen.
Ungefähr im letzten Jahr aber ist der Sohn hoch aufgeschossen. Er ist jetzt größer als sein Vater, stärker und jünger und schneller. Von seinen Besorgungsgängen zu verschiedenen Märkten der Gegend, zu abgelegenen Gehöften, zur Gerberei und zurück, mit Säcken von Fellen oder fertigen Handschuhen auf dem Rücken, sind seine Schultern und sein Nacken breit und muskulös geworden. Dem Sohn ist nicht entgangen, dass die Übergriffe in letzter Zeit nachgelassen haben. Vor ein paar Monaten gab es einen Moment, da kam sein Vater spätabends aus der Werkstatt und steuerte, als er den Sohn im Flur vorfand, ohne ein Wort auf ihn zu, hob den Weinschlauch in seiner Hand und zog ihn ihm quer übers Gesicht. Der Schmerz war von der brennenden Sorte, nicht dumpf, nicht bohrend, nicht schneidend: Er hatte etwas Scharfes, Reißendes, Peitschenartiges. In seinem Gesicht würde, das wusste der Sohn, eine fleckige rote Spur zurückbleiben. Der Anblick des Striemens schien seinen Vater noch mehr zu reizen, denn er hob den Arm zu einem zweiten Schlag, doch der Sohn streckte die Hand nach oben. Er packte den Arm seines Vaters. Er stemmte sich mit aller Kraft dagegen und spürte zu seiner eigenen Überraschung, dass der Körper des Vaters nachgab. Er konnte diesen Mann, diesen Leviathan, dieses Ungeheuer seiner Kindheit ohne große Mühe an die Wand zurückdrängen. Was er tat. Dort hielt er ihn mit der Spitze seines Ellbogens in Schach und schüttelte den väterlichen Arm wie den einer Puppe, bis der Weinschlauch zu Boden fiel. Dann schob er das Gesicht nah an das des Vaters heran und stellte dabei fest, dass er auf ihn herabsehen musste. »Das«, sagte der Sohn, »war das letzte Mal, dass du mich geschlagen hast.«
Als er jetzt am Fenster in Hewlands steht, wird das Bedürfnis zu verschwinden, sich aufzulehnen, auszubrechen, so stark, dass es ihn bis an seine Grenzen erfüllt: Keinen Bissen bekommt er von dem Teller herunter, den ihm die Bauernwitwe hingestellt hat, so randvoll ist er von dem innerlichen Drang wegzulaufen, so weit weg von hier, wie seine Füße und Beine ihn tragen.
Das Latein plätschert weiter dahin, die Verben kehren wieder, vom Plusquamperfekt zurück zum Präsens. Gerade will er sich zu seinen Schülern umdrehen, als er zwischen den Bäumen eine Gestalt auftauchen sieht.
Einen Augenblick lang glaubt der Lehrer, es sei ein junger Mann. Er trägt eine Mütze, ein ledernes Wams, Stulpenhandschuhe; er tritt mit einer Art männlicher Unbekümmertheit oder Selbstgewissheit hinter den Bäumen hervor, legt die Strecke mit ausgreifenden, gestiefelten Schritten zurück. Auf seiner ausgestreckten Faust sitzt ein Vogel: haselnussbraun, mit cremeweißer Brust und schwarz geflecktem Gefieder. Gebändigt, zusammengekauert hockt er da und schwankt bei jeder Bewegung seines Gefährten, seines Vertrauten, vor und zurück.
Dieser Mensch, dieser falkenzähmende Jugendliche, wird wohl zum Gesinde gehören. Oder er ist ein Verwandter der Familie, vielleicht ein Vetter auf Besuch. Dann bemerkt der Lehrer den langen Zopf, der über der Schulter hängt und bis über die Hüfte reicht, und dass das Wams eng um eine Form geschnürt ist, die sich auf halber Höhe verdächtig nach innen wölbt. Er sieht die hochgerafften Röcke, die jetzt hastig über die Strümpfe herabgezogen werden. Ein blasses, ovales Gesicht unter der Mütze, eine gewölbte Stirn, ein voller roter Mund.
Da tritt er näher an die Scheibe, lehnt sich an die Fensterbank und beobachtet, wie die junge Frau mit flappenden Röcken, den Vogel auf der Faust, von rechts nach links durch den Fensterrahmen marschiert. Jetzt ist sie auf dem Hof angelangt, bahnt sich ihren Weg zwischen den Hühnern und Gänsen hindurch und ist um die Ecke verschwunden.
Er richtet sich auf, das Stirnrunzeln ist verschwunden, und ein Lächeln deutet sich unter seinem spärlichen Bart an. Hinter ihm ist das Zimmer verstummt. Er ruft sich ins Gedächtnis, wo er ist: der Unterricht, die Jungen, die Konjugationen.
Er dreht sich um und legt die Fingerspitzen aneinander, wie ein Lehrer es seiner Meinung nach tun sollte. Wie seine eigenen Schulmeister vor gar nicht allzu langer Zeit.
»Ausgezeichnet«, sagt er zu seinen Schülern.
Sie blicken zu ihm auf wie Pflanzen, die sich der Sonne zuwenden. Er lächelt ihre weichen, unfertigen Gesichter an, die im Licht des Fensters blass wirken wie nicht aufgegangener Teig. Er gibt vor, nicht zu bemerken, dass der Ältere seine Schiefertafel mit einem sich wiederholenden Spiralmuster vollgemalt hat und seinen Bruder mit einem geschälten Zweig unter dem Tisch traktiert.
»Jetzt«, sagt er zu ihnen, »hätte ich gerne, dass ihr euch an der Übersetzung des folgenden Satzes versucht: ›Ich danke Euch, mein Herr, für Euren freundlichen Brief.‹«
Sie beginnen, sich über ihren Schiefertafeln abzuquälen, der Ältere (und Dümmere, weiß der Lehrer) atmet durch den Mund, während der Jüngere den Kopf auf den Arm legt. Und was nützen den beiden diese Stunden schon? Sind sie nicht ohnehin dazu bestimmt, Bauern zu werden wie ihr Vater und ihre älteren Brüder? Dann wiederum – was hat es ihm denn eigentlich gebracht? Jahr für Jahr an der Lateinschule, und man sieht ja, was er nun davon hat: eingesperrt in diese rauchgeschwängerte Halle, wo er den Söhnen eines Schafbauern Konjugationen und Wortstellung einbläuen muss.
Er wartet, bis die Jungen so gut wie fertig sind, bevor er fragt: »Wie heißt diese Dienstmagd? Die eine mit dem Vogel?«