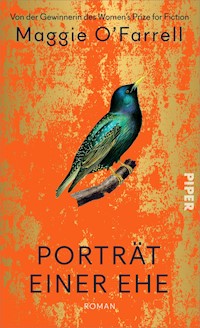
19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das vergessene Leben der Lucrezia de' Medici Florenz, 1557: Lucrezia de' Medici ist gerade einmal zwölf Jahre alt, als ihr Vater sie per Brief mit Alfonso II. d'Este verlobt. Eigentlich war ihre ältere Schwester Maria dem Herzog von Ferrara versprochen, doch als diese überraschend verstirbt, tritt Lucrezia an ihre Stelle. Und wider Erwarten eröffnet sich der jungen Herzogin in Ferrara eine neue Welt: Plötzlich darf sie, die ihrer Familie immer als zu eigensinnig, zu störrisch und sensibel galt, selbst entscheiden, ob sie durch die Gärten flanieren oder sich ihrer geliebten Staffelei zuwenden will. Diese Freiheit aber ist an eine Bedingung geknüpft: Alfonso erwartet von ihr einen Sohn. Als dieser auf sich warten lässt, lernt Lucrezia seine dunkle, bedrohliche Seite kennen. »O'Farrell gelingt das Kunststück, die bekannte Geschichte poetisch-zärtlich neu zu erzählen.« FAZ über Judith und Hamnet (Women's Prize for Fiction & British Book Award 2020)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:www.piper.de/literatur
Die englische Originalausgabe erschien 2022 unter dem Titel The Marriage Portrait bei Tinder Press, einem Imprint der Headline Publishing Group, Hachette UK, London.
Von Maggie O’Farrell liegen im Piper Verlag vor:
Ich bin, ich bin, ich bin
Judith und Hamnet
Der Übersetzer dankt der Fachstelle Kultur des Kantons Zürich und der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia für ihre großzügige Förderung durch Werk- und Unterstützungsbeiträge.
ISBN 978-3-492-07176-5
© Maggie O’Farrell 2022
© Piper Verlag GmbH, München 2022
Gesetzt aus der Bembo
Satz: Eberl & Koesel Studio, Krugzell
Druck und Bindung: GGP Media GmbH, Pößneck
Printed in Germany
Impressum ePUB
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:www.piper.de/literatur
Aus dem Englischen von Thomas Bodmer
Die englische Originalausgabe erschien 2022 unter dem Titel The Marriage Portrait bei Tinder Press, einem Imprint der Headline Publishing Group, Hachette UK, London.
Der Übersetzer dankt der Fachstelle Kultur des Kantons Zürich und der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia für ihre großzügige Förderung durch Werk- und Unterstützungsbeiträge.
ISBN 978-3-492-60284-6
© Maggie O’Farrell 2022
© Piper Verlag GmbH, München 2022
Covergestaltung: Cornelia Niere
Coverabbildung: Natural History Museum, London / Bridgeman Images und Shutterstock.com
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Historische Notiz
Motti
Ein schauriger, einsamer Ort
Die unglücklichen Umstände von Lucrezias Zeugung
Der erste Tiger der Toskana
Reh, geschmort in Wein
Sieben Galeeren, beladen mit Gold
Das Ende der Mahlzeit
Alles wird anders
Der wahre Grund der Reise
Etwas in einem Buch Gelesenes
Irgendwo im Dunkeln
Die Herzogin Lucrezia an ihrem Hochzeitstag
Verbrannte Erde
Schlafender Mann, ruhender Herrscher
Der Fluss schlingt sich in einem Bogen
Honigwasser
Hocherhobenen Hauptes
Schwestern von Alfonso II., mit Abstand gesehen
Das Hochzeitsporträt von Lucrezia, Herzogin von Ferrara
Etwas Bösartiges und Räuberisches
Das Untermalen und das Übermalen
Nachbemerkung der Autorin
Dank
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
560 verließ die fünfzehnjährige Lucrezia di Cosimo de’ Medici Florenz, um ihr Leben als Ehefrau von Alfonso II. d’Este, dem Herzog von Ferrara, zu beginnen.
Weniger als ein Jahr später war sie tot.
Als offizielle Todesursache wurde »Faulfieber« angegeben. Doch gab es Gerüchte, ihr Mann habe sie ermordet.
Hier an der Wand meiner letzten Herzogin Bild,
Als wäre sie am Leben, sieht sie aus.
Robert Browning, »Meine letzte Herzogin«
Die Frauen werden die meiste Zeit vom Willen, von der Laune, von den Befehlen der Väter, Mütter, Brüder, Ehemänner gezwungen, im engen Raum ihrer Kemenaten eingeschlossen auszuharren; und fast untätig sitzen sie nun dort und wenden – halb mit, halb wider Willen – vielfache Gedanken hin und her.
Giovanni Boccaccio, »Das Decameron«
Ein schauriger, einsamer Ort
Fortezza bei Bondeno, 1561
Lucrezia nimmt Platz am langen Esstisch, der zu fahlem Glanz poliert und vollgestellt ist mit Geschirr, auf dem Kopf stehenden Kelchen und einem Kranz aus Tannenzweigen. Ihr Mann setzt sich neben sie, nicht an seinen gewohnten Platz am anderen Ende des Tisches, sondern so dicht neben sie, dass sie ihren Kopf auf seine Schulter legen könnte, wenn sie wollte. Er entfaltet seine Serviette, richtet das Messer aus und zieht die Kerze zu ihnen hin, als Lucrezia mit seltsamer Klarheit – als blickte sie durch gefärbtes Glas oder vielmehr als täte sie dies mit einem Mal nicht mehr – begreift, dass er beabsichtigt, sie zu töten.
Sie ist sechzehn Jahre alt, seit einem knappen Jahr verheiratet. Ihr Mann und sie sind den größten Teil des Tages unterwegs gewesen, sind, um das bisschen Tageslicht in dieser Jahreszeit zu nutzen, im Morgengrauen aus Ferrara losgeritten zu einer Jagdhütte, wie er sagte, draußen im Nordwesten des Herzogtums.
Das sei doch keine Jagdhütte, hatte Lucrezia sagen wollen, als sie ihr Ziel erreichten: ein Gebäude mit hohen Mauern aus dunklem Stein, auf der einen Seite flankiert von dichtem Wald und auf der anderen von einer Flusswindung des Po. Am liebsten hätte sie sich im Sattel umgewandt und gefragt: »Wozu hast du mich hierhergebracht?«
Doch sie sagte nichts, ließ ihre Stute folgen auf dem Weg durch triefende Bäume, über die gebogene Brücke hinein in den Hof des seltsamen, befestigten, sternförmigen Gebäudes, das ihr schon da merkwürdig menschenleer vorkam.
Die Pferde sind mittlerweile weggeführt worden, sie hat den durchnässten Umhang und Hut abgelegt, während Alfonso sie beobachtete, mit dem Rücken zum Kamin stehend, wo ein Feuer lodert; nun bedeutet er den bäuerlichen Bediensteten im Schatten des Saals vorzutreten, die Teller mit Essen zu füllen, Brot zu schneiden, Wein in die Kelche zu gießen, und Lucrezia erinnert sich plötzlich an die heiser geflüsterten Worte ihrer Schwägerin: »Dir wird die Schuld zugeschoben werden.«
Lucrezias Finger umklammern den Rand ihres Tellers. Dass ihr Mann ihren Tod will, steht ihr so klar vor Augen, als hätte sich ein dunkel gefiederter Raubvogel auf der Armlehne ihres Sessels niedergelassen.
Das ist der Grund für ihre hastige Reise an einen so schaurigen, einsamen Ort. Er hat sie hierhergebracht, in diese steinerne Festung, um sie zu ermorden.
Verblüffung reißt sie aus ihrem Körper, und beinahe lacht sie: Sie schwebt unter der gewölbten Decke und blickt hinab auf sich und ihn, wie sie am Tisch sitzen, Brühe schlürfen und sich gesalzenes Brot in den Mund schieben. Sie sieht, wie er sich zu ihr herüberlehnt, wie seine Finger leicht auf der nackten Haut ihres Handgelenks ruhen, während er ihr etwas sagt; sie sieht sich ihm zunicken, das Essen herunterschlucken, Worte sagen über die Reise und die interessante Landschaft, die sie durchquert haben, als stünde alles zum Besten, als wäre dies ein normales Abendessen, nach dem sie zu Bett gehen würden.
In Wirklichkeit, denkt sie, noch immer oben unter dem schwitzenden Mauerwerk der Saaldecke, war die Reise von der Stadt hierher langweilig, durch öde und gefrorene Felder, der Himmel so schwer, dass er schlaff auf die Wipfel der kahlen Bäume herabzuhängen schien. Ihr Mann hatte die Pferde im Trab gehen lassen, Meile um Meile war sie im Sattel auf und ab geruckelt, mit schmerzendem Rücken, die Beine wund gerieben von den nassen Strümpfen. Trotz der mit Eichhörnchenfell gefütterten Handschuhe waren ihre Finger starr vor Kälte gewesen, während sie die Zügel umklammerten, und die Mähne ihrer Stute war schon bald von Eis überzogen. Ihr Mann war vorangeritten, mit zwei Wächtern hinter sich. Als die Stadt dem Land gewichen war, hatte Lucrezia ihr Pferd anspornen, ihm die Fersen in die Flanken drücken, seine Hufe über Stock und Stein fliegen lassen, durch das flache Tal galoppieren wollen – doch sie wusste, dass sich dies nicht ziemte, dass ihr Platz hinter ihrem Mann war oder, falls sie dazu aufgefordert wurde, neben ihm, nie aber vor ihm, und so trabten sie weiter und weiter.
Nun, da sie am Tisch den Mann anblickt, von dem sie vermutet, dass er sie ermorden will, wünscht sie, sie hätte es getan und ihre Stute zum Galopp angespornt. Sie wünscht, sie wäre an ihm vorbeigejagt, kichernd vor Lust am Verbotenen, mit flatterndem Umhang und flatterndem Haar, während der eisige Schlamm von den Hufen aufspritzte. Sie wünscht, sie wäre den fernen Hügeln entgegengeprescht, um sich in den felsigen Klüften und Höhen zu verlieren, wo er sie nie gefunden hätte.
Die Ellbogen zu beiden Seiten seines Tellers aufstützend, erzählt Alfonso, wie er als Kind schon in diese Hütte – er beharrt auf dem Wort – gekommen sei, wo sein Vater ihm das Jagen beigebracht habe. Sie hört, er habe Pfeil um Pfeil auf eine Zielscheibe an einem Baum schießen müssen, bis seine Finger bluteten. Sie nickt und gibt in den richtigen Momenten mitleidiges Gemurmel von sich, doch viel lieber würde sie ihm in die Augen blicken und sagen: »Ich weiß, was du im Schilde führst.«
Würde er sich davon überrumpelt, ertappt fühlen? Hält er seine Frau für naiv, weltfremd, kaum dem Kinderzimmer entwachsen? Sie sieht es alles. Sie sieht, wie sorgfältig und umsichtig er sein Vorhaben geplant hat, wie er sie von den anderen getrennt und sichergestellt hat, dass ihr Gefolge in Ferrara zurückbleibt, dass sie allein ist, dass niemand aus dem castello hier ist, nur sie und er, zwei Wachen draußen und drinnen eine Handvoll Leute vom Land, die sie bedienen.
Wie will er es anstellen? Ein Teil von ihr würde ihn gern fragen. Mit einem Messer in einem dunklen Gang? Mit seinen Händen um ihren Hals? Mit einem Sturz vom Pferd, der wie ein Unfall wirken soll? Zweifelsohne hat er all diese Möglichkeiten im Repertoire. Aber es müsste schon gut gemacht werden, wäre ihr Rat, denn ihr Vater ist keiner, der die Ermordung seiner Tochter einfach so hinnehmen würde.
Sie setzt den Kelch ab, hebt das Kinn, wendet den Blick ihrem Mann, Alfonso II., Herzog von Ferrara, zu und fragt sich, was als Nächstes geschehen wird.
Die unglücklichen Umstände von Lucrezias Zeugung
Palazzo, Florenz, 1544
In den folgenden Jahren sollte Eleonora die Art, wie ihr fünftes Kind gezeugt wurde, bitter bereuen.
Stellen Sie sich Eleonora im Herbst 1544 vor: Sie befindet sich im Kartenraum des Florentiner Palazzos und hält sich eine Landkarte dicht vors Gesicht (sie ist ein wenig kurzsichtig, würde das aber niemals zugeben). Ihre Hofdamen stehen etwas abseits, so nah beim Fenster wie möglich: Es ist zwar schon September, doch in der Stadt ist es drückend heiß. Als würde unten im Hof die Luft gebacken; Schwall um Schwall schwappt aus dem steinernen Rechteck zu ihnen hoch. Der Himmel hängt tief und reglos; kein Hauch bewegt die Seidentücher vor den Fenstern, und die Flaggen auf dem Schutzwall des Palazzos hängen schlaff herab. Die Hofdamen fächeln sich Luft zu und tupfen sich die Stirn lautlos seufzend mit einem Taschentuch ab. Sie alle fragen sich, wie lange sie noch hier in diesem getäfelten Raum ausharren müssen, wie viel Zeit Eleonora noch mit dem Betrachten dieser Karte verbringen will und was sie daran bloß so interessant finden mag.
Eleonoras Augen durchstreifen die Silberstiftdarstellung der Toskana: die Gipfel von Hügeln, das aalartige Geschlängel von Flüssen und die nordwärts aufsteigende, zerklüftete Küstenlinie. Ihr Blick schweift über die Landstraßen, die sich verknoten für die Städte Siena, Livorno und Pisa. Eleonora ist sich ihrer eigenen Seltenheit und ihres Wertes wohl bewusst: Sie hat nicht nur einen Körper, der eine ganze Reihe von Erben hervorzubringen vermag, sondern auch ein schönes Gesicht mit einer Stirn wie geschnitztes Elfenbein, weit auseinanderliegenden tiefbraunen Augen und einem Mund, der schön ist, ob sie nun lächelt oder schmollt. Darüber hinaus verfügt sie über einen raschen, unsteten Verstand. Sie kann im Gegensatz zu den meisten Frauen aus dem Gekritzel auf dieser Karte Kornfelder, Weinberge, Ernten, Bauernhöfe, Klöster und Zehnten zahlende Bauern herauslesen.
Sie legt die Karte hin, und gerade als ihre Hofdamen die Röcke raffen, um in besser belüftete Räumlichkeiten aufzubrechen, nimmt Eleonora eine andere Karte. Sie studiert das Gebiet nahe der Küste; dort scheint nichts verzeichnet zu sein außer ein paar vagen, unregelmäßigen Wasserflächen.
Wenn Eleonora eines nicht ertragen kann, dann ist das Nutzlosigkeit. Unter ihrer Ägide ist jeder Raum, jeder Gang, jedes Vorzimmer dieses Palazzos renoviert und mit einem Zweck versehen worden. Jede nackte Wand ist geschmückt und verschönert worden. Keinem ihrer Kinder, keiner ihrer Bediensteten oder Hofdamen ist auch nur eine Minute der Untätigkeit gestattet. Von morgens bis abends werden sie auf Trab gehalten durch einen Stundenplan, den Eleonora aufgesetzt hat. Wenn sie nicht schläft, erfüllt sie eine Aufgabe: schreibt Briefe, lernt Sprachen, erstellt Pläne und Listen oder überwacht die Erziehung und Betreuung ihrer Kinder.
In Eleonoras Kopf regen sich Ideen, was mit dem Marschland zu tun wäre. Man muss es trockenlegen. Nein, man muss es bewässern. Man könnte Feldfrüchte anpflanzen. Man könnte eine Stadt bauen. Man könnte Seen anlegen, um Fische zu züchten. Oder ein Aquädukt oder ein –
Ihre Gedanken werden unterbrochen durch das Geräusch einer aufspringenden Tür, gefolgt von Stiefeln auf dem Boden: ein selbstbewusster, zielstrebiger Schritt. Sie dreht sich nicht um, sondern lächelt vor sich hin, während sie die Karte gegen das Licht hält und sieht, wie die Sonne Berge, Städte und Felder aufleuchten lässt.
Eine Hand legt sich auf ihre Hüfte, eine andere auf ihre Schulter. Sie spürt das gesprenkelte Stechen eines Bartes an ihrem Hals, den feuchten Druck von Lippen.
»Was treibst du, mein fleißiges Bienchen?«, flüstert ihr Mann ihr zu.
»Ich mache mir Gedanken über dieses Gebiet hier«, sagt sie und hält weiter die Karte hoch, »hier an der Küste, siehst du?«
»Mmm«, sagt er, lässt einen Arm um sie gleiten, vergräbt sein Gesicht in ihrem hochgesteckten Haar und drückt ihren Leib mit seinem gegen die harte Tischkante.
»Wenn wir es trockenlegten, könnte man es nutzen, für Landwirtschaft oder Häuser und …« Sie bricht ab, denn er macht sich an ihren Röcken zu schaffen, hebt sie hoch, damit seine Hand ungehindert von ihrem Knie über ihren Oberschenkel hoch und immer höher wandern kann. »Cosimo«, tadelt sie ihn flüsternd, doch es ist gar nicht nötig, denn ihre Hofdamen sind dabei, sich mit raschelnden Röcken aus dem Zimmer zurückzuziehen, auch Cosimos Berater gehen, drängeln an der Tür, begierig wegzukommen.
Die Tür fällt hinter ihnen ins Schloss.
»Die Luft dort ist schlecht«, fährt Eleonora fort, mit den blassen, schmalen Fingern auf die Karte weisend, als wäre nichts, als stünde kein Mann hinter ihr und versuchte, sich durch die verschiedenen Schichten ihrer Unterkleider einen Weg zu bahnen, »übel riechend und ungesund, und wenn wir …«
Cosimo dreht sie herum und nimmt ihr die Karte aus der Hand. »Ja, mein Schatz«, murmelt er, während er sie erneut gegen den Tisch drückt, »alles, was du sagst, alles, was du willst.«
»Aber Cosimo, du musst nur mal …«
»Später.« Nachdem er die Karte auf den Tisch geworfen hat, hebt er Eleonora hoch und setzt sie, in der Masse ihrer Röcke wühlend, darauf. »Später.«
Eleonora seufzt resigniert, und ihre Katzenaugen verengen sich zu Schlitzen. Sie sieht ein, dass er von seiner Absicht nicht abzubringen ist. Dennoch packt sie seine Hand.
»Versprichst du es mir?«, fragt sie. »Versprichst du mir, dass ich dieses Land nutzen darf?«
Seine Hand kämpft mit ihrer. Sie tun nur so, das ist ein Spiel, wie beide wissen. Cosimos Arm ist doppelt so dick wie ihrer. Er könnte ihr das Kleid binnen Sekunden vom Leib reißen, mit oder ohne ihre Zustimmung, wäre er eine andere Sorte Mann.
»Ich verspreche es«, sagt er, küsst sie, und sie lässt seine Hand los.
Noch nie, überlegt sie, während er in Gang kommt, hat sie sich ihm verweigert. Und wird es auch nie tun. Es gibt in ihrer Ehe viele Bereiche, in denen sie das Sagen hat, mehr als andere Frauen in ähnlichen Positionen. Ihm ungehinderten Zugang zu ihrem Körper zu gewähren, findet sie, ist ein kleiner Preis für all die Freiheiten und Möglichkeiten, die ihr gewährt werden.
Sie hat bereits vier Kinder und beabsichtigt, mehr zu bekommen, so viele, wie ihr Mann in sie hineinzupflanzen gewillt ist. Eine Herrscherfamilie muss groß sein, um dem Herzogtum Stabilität und Langlebigkeit zu verleihen. Vor ihrer Heirat mit Cosimo drohte diese Dynastie abzusterben, Geschichte zu werden. Und jetzt? Sind Cosimos Herrschaft und die Macht der Region gefestigt. Dank Eleonora gibt es im Kinderzimmer oben bereits zwei männliche Erben, die man dazu ausbilden wird, in Cosimos Fußstapfen zu treten, und zwei Mädchen, durch deren Verheiratung man sich mit anderen Fürstenhäusern verbinden kann.
Sie versucht, sich auf diesen Gedanken zu konzentrieren, denn sie möchte wieder schwanger werden, möchte nicht mehr an die ungetaufte Seele denken müssen, die sie letztes Jahr verloren hat. Sie spricht nie darüber, sagt niemandem, nicht einmal ihrem Beichtvater, dass das perlgraue Gesicht und die gekrümmten Finger dieses Kindes sie noch immer in ihre Träume verfolgen, dass sie sich nach ihm sehnt und sein Verlust in ihr ein großes Loch hinterlassen hat. Das beste Heilmittel gegen diese verschwiegene Schwermut ist, sagt sie sich, so rasch wie möglich wieder ein Kind zu bekommen. Sobald sie wieder schwanger ist, wird alles gut sein. Ihr Körper ist stark und fruchtbar. Das toskanische Volk nennt sie »la fecundissima«, die Fruchtbarste, und das trifft die Sache. Beim Gebären hat sie auch nie so höllische Qualen gelitten, wie man ihr hatte weismachen wollen. Als sie das Haus ihres Vaters verließ, nahm sie Sofia, ihr eigenes Kindermädchen, mit, und diese kümmert sich jetzt um die Sprösslinge. Eleonora ist jung, schön, ihr Mann liebt sie, ist ihr treu und ihr zuliebe zu allem bereit. Sie wird das Kinderzimmer oben unter dem Dach füllen; sie wird es mit Erben vollstopfen, Kind um Kind um Kind gebären. Warum nicht? Nie mehr wird ihr ein Kind vorzeitig entgleiten; das wird sie nicht zulassen.
Während sich Cosimo in der Hitze der Sala delle Carte Geografiche abrackert, seine Berater und Eleonoras Hofdamen im Zimmer draußen lustlos warten, gähnen und einander resignierte Blicke zuwerfen, wendet sich Eleonoras Geist von dem verlorenen Kleinen ab und wieder dem Marschland zu, gleitet dahin über das Schilf, die gelben Schwertlilien, die Büschel struppigen Grases. Er windet sich durch Nebel und Dünste. Er stellt sich Ingenieure vor, die mit Röhren und anderem Gerät anrücken und alles, was klamm, nass und unerwünscht ist, austrocknen. Er schafft üppige Ernten, fette Nutztiere und Dörfer, bevölkert von willigen, dankbaren Untertanen.
Sie legt ihre Arme auf die Schultern ihres Mannes und richtet, während er den Höhepunkt der Lust erreicht, ihren Blick auf die Karten an der gegenüberliegenden Wand: das alte Griechenland, Byzanz, das Römische Reich in seiner ganzen Größe, Sternbilder, unerforschte Ozeane, wirkliche und erfundene Inseln, Berge, deren Gipfel in Gewittern verschwinden.
Unmöglich hätte sie voraussehen können, dass sich dies als Fehler erweisen würde, dass sie ihre Augen schließen und ihren Geist zurück in diesen Raum hätte bringen müssen, zu ihren ehelichen Pflichten, ihrem starken, gut aussehenden Mann, der sie nach all diesen Jahren immer noch begehrt. Wie hätte sie wissen sollen, dass das Kind, das aus diesem Akt hervorgehen würde, so anders als alle anderen sein würde, deren Wesen so freundlich und deren Temperament so ausgeglichen ist? So leicht vergisst man das Prinzip der mütterlichen Prägung. Sie wird sich später Vorwürfe machen dafür, dass sie so abgeschweift, so unaufmerksam gewesen war. Ärzte wie Priester hatten ihr eingeschärft, dass der Charakter eines Kinds durch die Gedanken der Mutter im Augenblick der Empfängnis bestimmt wird.
Doch es ist zu spät. Hier im Kartenraum ist Eleonoras Geist unruhig, ungezähmt, er schweift, wohin er will. Sie schaut sich Karten an, Landschaften, Wildnisse.
Cosimo, Großherzog der Toskana, stößt zum Schluss sein gewohntes knurrendes Keuchen aus und zieht seine Frau sanft an sich; sie wiederum, gerührt, aber auch etwas erleichtert – es ist wirklich heiß –, lässt sich vom Tisch herabhelfen. Sie ruft nach den Frauen, auf dass sie sie in ihre Gemächer geleiten. Ihr sei nach einer Pfefferminz-tisana, sagt sie, einem Nickerchen und einem frischen Unterhemd.
Als ihr neun Monate später ein Kind gezeigt wird, das brüllt und sich windet und sein Wickelzeug von sich wirft, ein Säugling, der weder ruht noch schläft und sich nur durch ständige Bewegung trösten lässt, ein Kind, das die Brust der von Sofia sorgfältig ausgewählten Amme wohl ein paar Minuten lang akzeptiert, sich aber sonst nicht weiter stillen lässt, ein Kind, dessen Augen immer offen sind, als hielten sie nach fernen Horizonten Ausschau, da überkommt Eleonora beinahe so etwas wie Schuld. Ist sie verantwortlich für die Wildheit dieses Kindes? Liegt es an ihr? Sie sagt es niemandem, schon gar nicht Cosimo. Die Existenz dieses Kindes macht ihr Angst, nagt an ihrer Überzeugung, eine gute Mutter zu sein und Nachkommen gebären zu können, die an Körper und Geist gesund sind. Dass eines ihrer Kinder so schwierig ist, so widerspenstig, bringt ihr Bild von sich und ihrer Rolle hier in Florenz bedrohlich ins Wanken.
Bei einem Besuch im Kinderzimmer, wo sie einen ganzen Morgen lang die kreischende Lucrezia im Arm zu halten versucht, bemerkt sie, wie der Lärm sich auf die vier älteren Geschwister auswirkt, die sich die Ohren zuhalten und in ein anderes Zimmer laufen. Furcht ergreift Eleonora, das Verhalten des Säuglings könnte die anderen beeinflussen. Werden auch sie plötzlich nicht mehr fügsam sein und sich nicht mehr trösten lassen? So beschließt sie, ohne langes Federlesen, Lucrezia aus dem Kinderzimmer zu nehmen und in einem anderen Teil des Palazzos unterzubringen. Nur eine Zeit lang, sagt sie sich, bis das Kind sich beruhigt hat. Sie zieht Erkundigungen ein und stellt danach eine andere Amme an, eine der Köchinnen. Eine breithüftige, fröhliche Frau, die mit Freuden bereit ist, sich um Lucrezia zu kümmern, denn ihre eigene, knapp zwei Jahre alte Tochter tapst schon über die Fliesen und kann abgestillt werden. Jeden Tag schickt Eleonora eine ihrer Hofdamen hinunter in die Küchen, um sich nach dem Befinden des Säuglings zu erkundigen; sie ist sich sicher, ihre Pflicht dem Kind gegenüber zu erfüllen. Unglücklich dabei ist nur, dass Sofia, Eleonoras ehemaliges Kindermädchen, Lucrezias »Verbannung« lauthals missbilligt und auch nicht einsieht, was an der von ihr ausgewählten Amme nicht gut gewesen sein soll. Doch Eleonora ist ungewöhnlich hartnäckig: Das Kind wird fern von der übrigen Familie in der Kellerküche untergebracht, bei den Dienern und Dienstmädchen, im Lärm von Kochtöpfen und in der Hitze der riesigen Feuer. Ihre ersten Monate verbringt Lucrezia in einem Waschkessel, überwacht von der kleinen Tochter der Amme: Die tätschelt die winzige geballte Faust des Säuglings und ruft die Mutter, wenn dessen Gesicht sich zu einem Heulen verzerrt.
Als Lucrezia laufen lernt, entgeht sie knapp einer Katastrophe mit einem umgekippten Topf siedenden Wassers, weshalb sie wieder nach oben geschickt wird. Fern vom vertrauten Lärm und Dampf der Küchen und konfrontiert mit vier Kindern, an die sie sich nicht erinnern kann, schreit sie zwei Tage lang. Sie schreit nach ihrer Amme, nach den Holzlöffeln, an denen sie gegen die Schmerzen des Zahnens lutschen durfte, nach den Kräutersträußen, die an den Fenstern hingen, nach der Hand, die ihr ein warmes Stück Brot oder ein Stück Käse entgegenstreckte. Sie will nichts zu tun haben mit diesem Zimmer unter dem Dach, wo sich Bett an Bett reiht, wo lauter gleich aussehende Kinder sie mit schwarzen Augen ungerührt anstarren, einander etwas zuflüstern, dann unvermittelt aufstehen und davongehen. Die Erinnerung an einen riesigen schwarzen Topf, der neben ihr umkippt, und an einen Schwall zischend heißer Flüssigkeit beunruhigt sie. Sie verweigert sich den Armen und Schößen der Kinderzimmerfrauen, erlaubt ihnen nicht, sie anzukleiden oder ihr etwas zu essen zu geben. Sie will die Köchin von drunten, ihre Milchmutter; sie will beim Dösen, geborgen in ihrem breiten Schoß, eine Strähne ihres glatten Haars zwischen Daumen und Finger halten. Sie will das liebe Gesicht ihrer Milchschwester, die für sie singt und sie mit einem Stock in der Asche des Feuers zeichnen lässt. Sofia schüttelt den Kopf und murmelt, sie habe es Eleonora immer schon gesagt, dass es nicht gut ausgehen werde, wenn man das Kind in den Keller schicke. Lucrezia isst nur, wenn man Nahrung neben ihr auf den Boden legt. Wie bei einem wilden Tier, bemerkt Sofia.
Als Eleonora all dies von Sofia hört, die darauf beharrt hat, in die Gemächer ihres ehemaligen Schützlings zu gehen und, die Fäuste in die Hüften gestemmt, neben dessen Bett Aufstellung zu nehmen, seufzt die Herzogin und steckt sich eine frisch geknackte Mandel in den Mund. In wenigen Tagen wird sie erneut gebären, ihr Bauch ragt unter den Laken auf wie ein Berg; sie hofft auf einen Jungen. Diesmal hat sie nichts dem Zufall überlassen und ihr Schlafgemach mit Gemälden von gesunden jungen Männern ausstatten lassen, die männlichen Beschäftigungen nachgehen: Speere werfen oder Zweikämpfe austragen. Die ehelichen Pflichten durften nur hier vollzogen werden, zur großen Enttäuschung von Cosimo, der immer eine Vorliebe gehabt hat für hastige Akte in einem Korridor oder einem Zwischengeschoss. Doch Eleonora wollte auf keinen Fall den gleichen Fehler wie beim letzten Mal begehen.
Als Vierjährige will Lucrezia im Gegensatz zu ihren Schwestern keine Puppen bemuttern, sich zum Essen nicht an den Tisch setzen oder mit ihren Geschwistern spielen; sie bleibt lieber allein, rast wie eine Wilde von einem Ende des Laufgangs zum andern oder kniet sich vors Fenster, um stundenlang hinauszuschauen auf die Stadt und die fernen Hügel dahinter. Als sie sechs ist, zappelt sie so herum, statt einem Maler brav Modell zu sitzen, dass Eleonora die Geduld verliert und sagt, dann gebe es eben kein Porträt, Lucrezia könne zurück ins Kinderzimmer gehen. Mit acht oder neun weigert sie sich, Schuhe zu tragen, sogar als Sofia ihr für ihre Widerspenstigkeit eine Ohrfeige verpasst. Als sie mit fünfzehn schließlich verheiratet werden soll, macht sie ein Riesentheater wegen des Brautkleids, das Eleonora persönlich in Auftrag gegeben hat, eine traumhaft schöne Kombination von blauer Seide und Goldbrokat. Lucrezia platzt unangekündigt in die Gemächer ihrer Mutter und ruft, sie werde es nicht tragen, auf keinen Fall, es sei ihr zu groß. Eleonora, die an ihrem scrittoio sitzt und gerade einer ihrer liebsten Äbtissinnen schreibt, versucht, Ruhe zu bewahren, und sagt Lucrezia klar und deutlich, das Kleid werde, wie sie wisse, eigens für sie geändert. Doch natürlich geht Lucrezia zu weit. Warum, fragt sie wutentbrannt, müsse sie ein Kleid tragen, das für ihre verstorbene Schwester Maria entworfen worden sei? Sei es nicht schon schlimm genug, dass sie Marias Bräutigam heiraten müsse? Müsse sie wirklich auch noch Marias Kleid tragen? Als Eleonora ihren Stift beiseitelegt, löst sich ihr Geist vom Schreibtisch, geht auf ihre Tochter zu und weiter zurück zu deren Zeugung, erinnert sich daran, wie ihre, Eleonoras, Augen über die Karten früherer Länder geschweift waren, über fremde, wilde Meere voller Drachen und anderer Ungeheuer, gepeitscht von Winden, die Schiffe weit von ihrem Kurs abbringen konnten. Was für einen Fehler hatte sie damals gemacht! Wie oft ist sie davon heimgesucht und wie schwer bestraft worden!
Am anderen Ende des Zimmers sieht Eleonora das tränenüberströmte, kantige Gesicht ihrer Tochter, das sich voll Hoffnung und Erwartung öffnet wie eine Blume. Hier ist meine Mutter, denkt Lucrezia, wie Eleonora weiß, die kann mich vielleicht retten vor dem Kleid, vor der Hochzeit. Vielleicht wird alles gut.
Der erste Tiger der Toskana
Palazzo, Florenz, 1552
Ein ausländischer Würdenträger kam nach Florenz und brachte dem Großherzog das Gemälde eines Tigers. Das Geschenk gefiel Cosimo ausgesprochen gut, und so äußerte er schon bald den Wunsch, ein derart furchterregendes, einzigartiges Tier zu besitzen. Im Keller seines Palazzos hatte er zur Belustigung von Besuchern eine Menagerie einrichten lassen, und er fand, ein Tiger wäre eine exzellente Bereicherung für seine Sammlung.
Er gab seinem consigliere ducale Vitelli den Befehl, einen Tiger finden, fangen und nach Florenz bringen zu lassen. Vitelli, der so etwas befürchtet hatte, seit das Gemälde am Hof eingetroffen war, stieß einen stillen Seufzer aus und machte in seinem Hauptbuch eine entsprechende Eintragung. Er hoffte, der Großherzog würde sich die Sache ausreden lassen oder sie sogar vergessen in Anbetracht der republikanischen Aufstände in Siena.
Doch Cosimo dachte nicht daran, Vitellis geheime Hoffnungen zu erfüllen.
»Wie geht es voran mit dem Tiger?«, fragte er eines Tages unvermittelt, als er auf der Terrasse stand und sich für seine täglichen Übungen bereit machte, indem er den lucco ablegte und sich seine Waffen umschnallte. Der überrumpelte Vitelli nestelte am Verschluss seines Hauptbuchs herum und murmelte etwas von Schwierigkeiten auf den Seewegen aus dem Osten. Darauf fiel Cosimo nicht herein. Er fixierte Vitelli mit dem linken Auge, während das rechte nach etwas schielte, das außerhalb von Vitellis Gesichtsfeld lag.
»Das zu hören enttäuscht mich«, sagte Cosimo, während er zwei in Scheiden steckende Dolche in seine Stiefel schob, wie er es immer tat, bevor er sich außerhalb der Mauern des Palazzos begab. »Das enttäuscht mich zutiefst. Wie Sie wissen, ist das Gehege im Keller bereit: Man hat es gesäubert und die Gitterstäbe verstärkt.« Von einem neben ihm stehenden Diener nahm er einen Ledergürtel entgegen und schloss ihn um seine Hüfte. »Was für ein Jammer, es leer stehen zu lassen. Da gehört unbedingt etwas hinein – oder jemand.«
Cosimo ergriff seinen Degen, einen leichten, eleganten mit einer verzierten Klinge, von dem Vitelli wusste, dass er ihn besonders gern mochte. Er ließ ihn durch die Luft sausen, und einen Moment lang landete der Blick beider Augen, vor Belustigung blitzend, auf Vitelli.
Der Großherzog steckte den Degen zurück in die Scheide an seinem Gürtel und verließ die Terrasse; Vitelli hörte ihn raschen, zielstrebigen Schrittes die Treppe hinabgehen. Hinter Vitelli raschelten und flüsterten die Sekretäre, ganz aufgeregt, vermutete er, weil sie Zeugen dieser kleinen Machtdemonstration geworden waren; einen hörte er eindeutig ein Kichern unterdrücken.
»Zurück an die Arbeit«, schnauzte er und klatschte laut in die Hände. »Das gilt für alle.«
Die Sekretäre schlichen sich davon, Vitelli ging zu seinem Schreibtisch, setzte sich schwerfällig hin und brütete eine Weile, bevor er zu Tintenfass und Feder griff.
Die Nachricht von dem seltsamen Wunsch des Großherzogs nach einem Tiger ging über einen Emissär, einen Botschafter, einen Kapitän, einen Seidenhändler, den Berater eines Sultans, einen Vizekönig, einen Gewürzhändler, den Staatssekretär im Palast eines Maharadschas, den Vetter des Maharadschas, den Maharadscha selbst und seine Frau bis zu seinem Sohn, zurück zum Staatssekretär, von dort zu einem Haufen Soldaten und schließlich zu den Bewohnern eines abgelegenen Dorfes in Bengalen.
Gefangen und in einem Netz an einen Pfahl gebunden, wurde der Tiger aus der heimatlichen Hitze, dem Regen und dem Urwald fortgebracht. Wochen und Monate reiste er übers Meer in einem feuchten, salzüberkrusteten Frachtraum, bevor er im Hafen von Livorno abgeladen wurde. Von dort ging es landeinwärts in einem Holzkäfig, festgezurrt an einem Karren, der von sechs verängstigten Maultieren gezogen wurde.
Als Vitelli erfuhr, dass der Konvoi mit dem Raubtier sich Florenz nähere, ließ er mitteilen, man solle außerhalb der Stadtmauern warten, bis es dunkel werde. »Fahrt damit«, befahl Vitelli, »auf keinen Fall bei Tageslicht durch die Stadt; versteckt den Karren im dichten Gehölz und bleibt dort bis zum Einbruch der Nacht.«
Noch nie, wusste Vitelli, war in Florenz ein Tiger gesehen worden. Die Leute würden drängeln und kreischen, wenn sie so eine Kreatur erblickten; Frauen würden vor Schreck in Ohnmacht fallen, junge Männer um die Wette versuchen, das Tier in seinem Käfig zu reizen, vielleicht sogar mit Stöcken und Speeren zu stechen. Und was, wenn der Tiger in Raserei verfiele und seine Fesseln sprengte? Er könnte durch die Straßen jagen, Kinder und Bürger zerfleischen. Da war es doch klüger, beschloss Vitelli, die dunklen Stunden nach Mitternacht abzuwarten; so würde sie niemand hören, niemand etwas davon erfahren.
Außer der kleinen Lucrezia, die mit ihren beiden älteren Schwestern im Bett lag, im Zimmer unter dem Dach des Palazzos. Lucrezia mit dem ernsten Blick und dem hellen, dünnen Haar – im Unterschied zu all ihren Geschwistern, die das glatte, rotbraune Haar ihrer spanischen mamma geerbt hatten. Lucrezia, die schmächtig und klein war für ihr Alter und jede Nacht an den Rand der Matratze gedrängt wurde von Maria, die spitze Ellbogen besaß und gern in der Mitte des Bettes alle viere von sich streckte. Lucrezia, die nie tief schlief.
Sie allein hörte das Heulen der Tigerin, als der Karren durch das Tor des Palazzos rollte: ein tiefer, hohler Ton, als bliese Wind durch eine Röhre. Einmal, zweimal drang er traurig durch die Nacht, bevor er in einem heiseren Grollen verebbte.
Lucrezia fuhr auf im Bett, als hätte man sie mit einer Nadel gestochen. Was war das für ein Geräusch, für ein fremdes Heulen, das sie im Traum erreicht und wach gerüttelt hatte? Sie drehte den Kopf erst auf die eine, dann auf die andere Seite.
Ihr Gehör war außerordentlich scharf: Es kam vor, dass sie hörte, was ein Stockwerk unter ihr gesagt wurde oder am anderen Ende des größten Prunksaals. Die Akustik des Palazzos war sonderbar: Töne und Schwingungen, Geflüster und Schritte konnten sich über Balken verbreiten, hinter Marmorreliefs, das Rückgrat von Statuen empor oder durch das Rauschen der Springbrunnen. Bereits mit sieben Jahren hatte Lucrezia entdeckt, dass sie, wenn sie ihr Ohr an ein Paneel oder einen Türrahmen drückte, allerlei in Erfahrung bringen konnte: die Ernennung eines Kardinals, die erwartete Ankunft eines weiteren Geschwisterkinds, den Aufmarsch einer fremden Armee auf der anderen Seite des Flusses, den plötzlichen Tod eines Feindes in den Straßen von Verona, das baldige Eintreffen einer Tigerin. Diese Gesprächsfetzen, die keineswegs für sie bestimmt waren, schlichen sich in ihren Kopf und setzten sich dort fest.
Schon wieder dieses Heulen! Kein Brüllen, wie es Lucrezia erwartet hätte, das Heulen klang vielmehr rau, sehnsüchtig und verzweifelt. Wie eine Kreatur, die gegen ihren Willen gefangen worden war, dachte Lucrezia, eine Kreatur, auf deren Bedürfnisse keinerlei Rücksicht genommen wurde.
Lucrezia entwand sich den Laken und den Falten von Marias Nachthemd und glitt aus dem Bett. So ungeschickt sie sich in der Tanzstunde auch anstellte – wofür sie vom Lehrer regelmäßig gerügt wurde –, so lautlos konnte sie sich durchs Kinderzimmer schleichen, wobei ihre Füße all den Fliesen, die knirschten oder wackelten, auszuweichen wussten. Auf Zehenspitzen ging sie am Bett vorbei, in dem ihre Brüder, die Glieder ineinander verschlungen, in einem Haufen lagen, vorbei an dem schmalen Rollbett, wo Pietro, der Jüngste, fest in den Armen seiner balia lag. In der Nähe der Tür schliefen zwei weitere Kindermädchen, doch Lucrezia machte zwei große Schritte über sie hinweg und schob die beiden Türriegel zurück.
Sie schlich hinaus und den Korridor hinunter, hielt inne, um sich zu vergewissern, dass Sofia, das älteste der Kindermädchen, so regelmäßig schnarchte wie gewohnt, und ließ dann ihre kleine Hand über ein Paneel in der Wand gleiten. Beim ersten Versuch verpasste sie den Messingriegel, doch beim zweiten fand sie ihn. Das Paneel schwang nach innen, und durch eine schmale Öffnung, die kaum größer war als Lucrezia selbst, verschwand das Mädchen aus dem Korridor.
Der Palazzo war durchlöchert von zahlreichen Geheimgängen: Lucrezia stellte sich das riesige Gebäude mit den dicken Mauern manchmal vor wie einen Apfel, durch den sich Würmer gefressen hatten. Sie hatte gehört – von Sofia, die keine Ahnung hatte, dass Lucrezia viel von dem neapolitanischen Dialekt verstand, den die drei Kindermädchen untereinander sprachen –, dass diese Gänge angelegt worden waren, damit der Herzog und seine Familie flüchten könnten, wenn der Palast angegriffen würde. Angegriffen von wem, hätte Lucrezia am liebsten gefragt, tat es vernünftigerweise aber nicht: Es war nützlich zu verstehen, was die Kindermädchen einander über die Köpfe ihrer Schützlinge hinweg sagten, und dass sie dazu fähig war, sollte sie nicht verraten.
Dieser Geheimgang war eine Abkürzung zum größeren Innenhof, wohin man über eine gewundene, rutschige Treppe mit unregelmäßigen Stufen gelangte. Lucrezia hatte keine Angst, wirklich nicht. Doch sie hielt den Atem an und hatte mit der einen Hand den Saum ihres Nachthemds gepackt, um nicht zu stolpern. Wie lange würde es wohl dauern, bis man sie fände, wenn sie hier hinter den Mauern stürzte und sich verletzte? Würde man sie hören, wenn sie riefe?
Die Stufen wanden sich um sich selbst wie ein zusammengerolltes Seil. Die feuchte Luft schien zu stehen, als hätte hier ein Lebewesen lange in der Falle gesessen. Lucrezia zwang sich dazu, den Kopf zu heben und einen Fuß vor den anderen zu setzen; sie habe, sagte sie sich, schon Schlimmeres erlebt. Und der Gedanke an das Tier spornte sie an. Sie würde diese Tigerin sehen, musste es einfach tun.
Gerade als die Finsternis und der Geruch sie zu übermannen drohten, kündigte ihr ein schmaler Lichtstreifen an, dass sie ihr Ziel erreicht hatte. Sie tastete nach dem Türverschluss, einem kleinen, kalten Schnäpper, drückte darauf, und schon befand sie sich auf der gedeckten Treppe, von deren schrägen Fenstern man zum Innenhof hinabsah. Zu dieser samtschwarzen Nachtzeit waren keine Wachen oder Bediensteten zu sehen; Lucrezia vergewisserte sich mehrmals. Dann wagte sie sich hinaus.
Von unten konnte sie das ängstliche Wiehern der Maultiere hören, das Scharren ihrer Hufe – und dann ein wütendes Grollen wie von fernem Donner.
Sie stützte die Hände auf das Marmorsims und blickte hinab.
Der Innenhof war düster, nur hier und dort erleuchtet von Fackeln, die in Halterungen an den Säulen steckten. Sechs Maultiere standen da, die hintereinander angeschirrt waren. Um sie herum machten sich Männer von Lucrezias Vater zu schaffen, wie an ihrer rot-goldenen Livree zu erkennen war. Sie umkreisten den Karren, jeder mit einem spitzen Stock in der Hand, und riefen einander Warnungen und Befehle zu. »Zurück, nicht so nah, ganz ruhig, pass auf, deine Hand, halt den Zaum, langsam.«
Einer nahm eine Fackel aus der Halterung über sich; er schwang sie Richtung Karren, ein feuriger Halbkreis in der Dunkelheit. Ein Fauchen ertönte, die Männer lachten. Erneut wurde die Fackel geschwungen, und wieder hörte Lucrezia die wütende Angst der Kreatur.
Dann, sich am Fenstersims festklammernd, sah sie sie: eine geschmeidige, biegsame Gestalt, die sich von einer Seite des Käfigs auf die andere bewegte. Es war weniger ein Gehen als ein Fließen, als wäre die Kreatur etwas Geschmolzenes, Flüssiges, wie das, was aus Vulkanen quoll. Es war schwierig, die Stäbe des Käfigs von den dunklen Streifen auf ihrem Fell zu unterscheiden. Sie war orange, poliertes Gold, fleischgewordenes Feuer; sie war Kraft und Wut, böse und erhaben; sie trug auf ihrem Körper die Gitterstäbe eines Gefängnisses, als wäre sie, immer schon zur Gefangenschaft bestimmt, eigens dafür gebrandmarkt worden.
Die Maultiere sträubten sich gegen ihr Geschirr, warfen die Köpfe zurück und entblößten verängstigt die Zähne. Sehen konnten sie die Tigerin ihrer Scheuklappen wegen nicht, aber sie spürten sie, rochen sie, wussten, dass sie da war, ganz nah bei ihnen. Und sie wussten: Wäre da nicht dieser Holzkäfig, würde die Tigerin alles in diesem Hof zerfleischen, Maultiere wie Menschen.
Es gab einen plötzlichen Ruck vorwärts, und Maultiere, Karren und Käfig wurden von einem Durchgang verschlungen wie Nahrung von einem Mund. Lucrezia stand da, starrte hinab in den leeren Innenhof, wo Kohlenpfannen züngelten und flammten, als wäre nichts Aufregendes passiert.
Der Palazzo von Lucrezias Vater war ein veränderliches Gebäude, unstet wie eine Wetterfahne. Manchmal kam er ihr vor wie der sicherste Ort der Welt, ein Bergfried, umgeben von einer Garnison, um die Kinder des Großherzogs zu schützen wie Glasfiguren in einer Vitrine; manchmal aber war er so bedrückend wie ein Gefängnis.
Er beherrschte eine der größten Piazze von Florenz, seine Rückseite war dem Fluss zugewandt, und seine Mauern ragten über den Untertanen auf wie riesige, zerklüftete Felswände. Die Fenster waren schmal und so hoch oben angebracht, dass niemand hineinschauen konnte. Aus seinem Dach wuchs ein quadratischer Turm, dessen riesige Glocken zur vollen Stunde schlugen und der Bevölkerung so die Uhrzeit verkündeten. Zinnen umgaben ihn auf allen Seiten wie die Krempe eines Huts; nur ganz selten durften die Kinder dort hinauf. Stattdessen gingen sie mit Sofia täglich in den gedeckten Laufgang, um frische Luft zu schnappen. Ihre mamma glaube, körperliche Ertüchtigung tue Kindern gut, sagte Sofia, und so wurden sie dazu ermuntert, dort Fangen zu spielen, von einer Schießscharte zur anderen zu rennen und von dort aus das Treiben auf der ihnen zu Füßen liegenden Piazza zu beobachten.
Vom einen Ende des Laufgangs aus war es möglich, die Statue zu sehen, die neben dem Eingang des Palazzos stand, eine weiße Figur, die zur Seite schaute, als wollte sie den Blicken aller vor ihr ausweichen, und über deren Schulter eine Steinschleuder hing. Lucrezia mochte einen Blick erhaschen auf ihre Eltern, wie sie um den Sockel der Statue auf ihre gedeckte Kutsche zugingen, ihre Mutter, wenn es Winter war, in Pelze gehüllt, und im Sommer in bunte Seide. Gelb, rot und violett wie Trauben waren ihre Gewänder. Sah sie die Kutsche vorfahren, lehnte sich Lucrezia so weit über die Brüstung, wie sie nur konnte, und versuchte, das Geräusch der Schritte ihrer Eltern zu erhaschen: das elegante Trippeln ihrer Mutter, das entschlossene Schreiten ihres Vaters, dessen Hutfeder im Rhythmus seiner Schritte auf und ab wippte.
Sofia, die behauptete, überall im Palazzo gewesen zu sein, sagte, die Mauern seien so dick wie drei der Länge nach aneinandergelegte Männer. Es gebe einen Raum nur für Waffen, mit lauter Schwertern und Rüstungen an den Wänden, und einen anderen voller Bücher. Buch neben Buch, sagte sie, während sie ihnen mit einem Lappen die Gesichter schrubbte oder ihre Kittel zuknöpfte, Bücher auf Regalen, die hoch über ihren Kopf aufragten. Ein ganzes Leben würde man brauchen, um die alle zu lesen, vielleicht noch länger. Ein anderer Saal sei geschmückt mit Karten aller Orte auf der Welt und aller Sterne am Himmel. Dann gebe es ein Gewölbe, das mit Eisen ausgeschlagen sei, mit einer Tür mit vielen Riegeln, und darin werde der Schmuck ihrer mamma aufbewahrt, alles, was sie vom spanischen Hof mitgebracht habe, und alles, was der Papa ihr geschenkt habe; dieses Gewölbe allerdings habe Sofia noch nie mit eigenen Augen gesehen, denn die einzige Hand, die es aufzuschließen vermöge, sei die des Herzogs. Und dann gebe es einen Saal so lang und groß wie eine Piazza, dessen Decke bemalt sei. »Womit?«, fragte Lucrezia, dem Waschlappen ausweichend, um dem Kindermädchen in die Augen zu blicken und zu schauen, ob es auch die Wahrheit sage, ob es diese Fresken wirklich gesehen habe. »Ach, Engel und Putten und große Krieger und Schlachten«, erwiderte das Kindermädchen und rückte Lucrezias Kopf wieder zurecht, »solche Sachen halt.«
Wenn Lucrezia Mühe mit dem Einschlafen hatte, was oft vorkam, dachte sie nach über diese Räume, die sie sich aufeinandergetürmt vorstellte wie die Bauklötze ihrer kleinen Brüder: der Waffenraum, der Kartenraum, der bemalte Raum, der Schmuckraum. Ihre Schwester Isabella sagte, sie würde am liebsten den Schmuck sehen; Maria sagte, sie würde gern die vergoldeten Putten an der Decke sehen. Francesco, der eines Tages Herzog werden sollte, sagte herablassend, er habe all diese Räume längst gesehen. Mehrmals. Giovanni, ein Jahr jünger als Isabella, verdrehte die Augen, wofür ihm Francesco einen Tritt gegen das Schienbein verpasste.
Niemand fragte, welchen Raum Lucrezia gern sehen würde, und so sagte sie nichts. Hätte man sie gefragt, hätte sie geantwortet: die Sala dei Leoni, den Löwenraum. Es hieß, ihr Vater habe eine Menagerie in einem besonders gesicherten Raum irgendwo im Kellergeschoss. Vor allem die Löwen zeige er gern ausgewählten Gästen und lasse sie manchmal gegen andere Tiere kämpfen: Bären, Keiler und sogar einen Gorilla. Eine Dienerin, die ihnen das Essen aus den Küchen hochbrachte, erzählte im Flüsterton, diese Löwen liebten den Herzog so sehr, dass er sie in ihrem Gehege besuchen könne. Das tue er mit einem Stachel in der einen Hand, auf den ein Stück Fleisch gespießt sei, und einer Peitsche in der anderen. Die Kinder hatten die Sala dei Leoni noch nie gesehen – Francesco freilich bestand darauf, er sei schon dort gewesen –, doch je nachdem, wie der Wind stand, konnten sie das gedämpfte Heulen und Brüllen der Tiere hören. An heißen Tagen stieg ein ganz besonderer Geruch zum Laufgang hoch, vor allem an der Rückseite des Palazzos, der an der Via dei Leoni lag: ein schwerer, überwältigender Geruch von Mist und Schweiß. Maria und Isabella beschwerten sich darüber und banden sich Halstücher vors Gesicht; doch Lucrezia verharrte dann im Laufgang über der Straße in der vergeblichen Hoffnung, einen Blick auf einen peitschenden Schwanz oder eine dunkle, struppige Mähne zu erhaschen.
Als Lucrezia am Morgen nach der Ankunft der Tigerin erwachte, war das Schlafzimmer so still, dass sie einen Augenblick lang glaubte, ihre Ohren seien mit Wachs verstopft. Ihr Gesicht war tief ins Kissen gedrückt, und als sie den Kopf hob, stellte sie fest, dass sie ausgestreckt in der Mitte des Bettes lag, allein. Keine Schwestern, die sie auf die Seite geschoben hätten. Keine Brüder im Bett gegenüber. Und keine Säuglinge im Rollbett.
Von der Stille wie betäubt, betrachtete sie den Raum: die gekalkten Wände, die zusammengefalteten Bettdecken, die Steinstufen zur Fensterbank, den Wasserkrug auf einem Regal.
Durch die offene Tür hörte sie die Geräusche ihrer Geschwister beim Frühstück: das Quengeln und Kreischen der drei jüngsten, das Klappern von Löffeln und Tellern.
Wie eine Schwimmerin bewegte Lucrezia Arme und Beine in den kühlen, leeren Laken. Einen Moment lang war sie versucht, sich wieder ins Kissen zu vergraben und zu schauen, ob der Schlaf noch einmal über sie kommen würde, doch dann fiel ihr der Anblick einer rollenden, geschmeidigen Schulter ein, die von schwarzen Streifen überzogen war. Da fasste sie einen klaren Vorsatz: Sie musste dieses Tier von Nahem sehen. Unbedingt. Etwas anderes kam nicht infrage. Sie wollte vor ihm stehen und sehen, wie das Schwarz der Streifen mit dem Orange im Fell verschmolz. Konnte sie sich zur Sala dei Leoni hinunterschleichen? Es gab ihres Wissens keinen Geheimgang, der dorthin führte, und wenn sie die Korridore und Laufgänge benutzte, würde sie bestimmt von jemandem aufgegriffen. Wie, wie, wie könnte sie nur dort hingelangen?
Beschwingt von diesen Gedanken, glitt sie aus dem Bett. Die Fliesen schienen sich mit ihrer kalten, rauen Oberfläche unter Lucrezias Füßen zu wölben. Hastig kleidete sie sich an, zog die wollene sottana über ihr Hemd und zwängte die Füße in die Schuhe. Die Luft im Zimmer war kalt und unbewegt; Lucrezia kam sich vor, als watete sie durch einen eiskalten See.
Während ihr weitere Möglichkeiten, die Tigerin zu sehen, durch den Kopf flackerten, hielt sie an der Schwelle zum nächsten Zimmer inne. An der einen Seite des Tisches saßen ihre älteren Schwestern und Brüder – vier säuberlich der Größe nach aufgereihte Kinder mit dem gleichen rotbraunen Haar. Sie lagen alle je ein Jahr auseinander: Maria war zwölf, Francesco elf, Isabella zehn, Giovanni neun. Sie folgten aufeinander wie Treppenstufen. Die Geschwister hatten die Köpfe zusammengesteckt und flüsterten über ihrem Brot und der Milch. Auf der anderen Seite des Tisches saßen die Kindermädchen mit ihren jüngeren Schützlingen, den drei kleinen Jungen, die ebenfalls der Größe nach aufgereiht waren: Garzia war drei, Ferdinando knapp zwei und Pietro noch kein Jahr alt.
Um Lucrezia herum gab es eine verblüffende Lücke von mehr als zwei Jahren auf jeder Seite. Es gab keine Kinder zwischen Giovannis und Lucrezias Geburt und keine zwischen ihr und Garzia. Sie hatte einmal Sofia gefragt, warum das so sei. Warum sie keinen Bruder oder keine Schwester habe, die ihr vom Alter her näher seien. Sofia, die gerade mit Ferdinando gekämpft hatte im Bestreben, ihn auf den Nachttopf zu setzen, weil sie beschlossen hatte, es sei Zeit, hatte verärgert gesagt: »Vielleicht brauchte deine arme Mutter einfach mal eine Pause.«
Nun ging Lucrezia seitwärts auf den Tisch zu, einen Fuß neben den anderen setzend. Sie stellte sich vor, sie sei die neue Tigerin, die auf starken Pfoten voranschlich und alle, die sie sahen, in Schrecken versetzte.
Allem Anschein nach hatte man nicht für sie gedeckt. Auf dem Stuhl, der sonst ihrer war, saß die Amme, die unter ihrem Brusttuch Pietro stillte: An seinen darunter hervorragenden Füßen sah Lucrezia, wie seine Zehen sich beim Saugen krümmten und streckten.
Einen Augenblick lang stand sie da zwischen der Amme und Giovannis ihr zugewandtem Rücken, dann streckte sie die Hand aus und griff nach einem Stück Brot. Stehend schlug sie ihre Zähne hinein. Sie war die Tigerin, die einen Feind zerfleischte. Beinahe lächelnd ließ sie den Blick über den Tisch schweifen. Mitten unter ihnen war eine Tigerin, und sie hatten keine Ahnung davon: Maria, die ihren Arm um Isabellas Schulter gelegt hatte und gerade etwas zu Francesco sagte, Garzia, der sich auf Sofias Schoß wand, weil er hinunter und herumrennen wollte.
Erst als Lucrezia Milch in eine Schüssel goss und sie zu schlappen begann, wurde sie wieder sichtbar.
»Lucrè!«, gellte Sofia. »Hör sofort auf! Gott im Himmel, was würde deine Mutter dazu sagen?« Sie ließ Garzia los, der sofort zu seinen Bauklötzen rannte, und ging auf sie zu. »Und was ist mit deinen Haaren passiert? Bist du in einen Sturm geraten? Warum trägst du dein Unterkleid verkehrt herum? Dieses Kind«, sagte sie, zu den anderen Kindermädchen gewandt und Lucrezia das Kleid über den Kopf zerrend, »bringt mich noch ins Grab!«
Während Sofia ihr die Knoten aus dem Haar bürstete und die Milch vom Kinn wischte, stand Lucrezia still wie die Statue vor dem Tor des Palazzos. Etwas anderes kam nicht infrage. Sofia war beinahe so breit wie hoch, ihre Handflächen waren schwielig und ihre Schultern stark. Ihr Lächeln, das man selten sah, war voller Lücken: Sie hatte kaum noch Zähne. Ungehorsam oder Gezappel wurde nicht geduldet. Das hier war ihr Kinderzimmer, wie sie ihnen immer wieder einbläute, und da hatte sie das Sagen. »Das ist meiner Mutter ihr Kinderzimmer, du blöde Kuh«, hatte Isabella einmal gemurmelt, und die Strafe war rasch und schrecklich ausgefallen: sechs Streiche mit der Rute und ohne Essen ins Bett.
Nachtragend war Sofia jedoch nicht. Am nächsten Tag hatte Lucrezia aus dem Augenwinkel beobachtet, wie eine erstaunlich geläuterte Isabella Sofia umarmt, ihre Wange geküsst und ihr etwas zugeflüstert hatte. Sofia hatte beim Lächeln die schwarzen Zahnlücken entblößt, Isabella den Arm getätschelt und sie zum Tisch gewinkt.
Sofia zerrte die Bürste durch Lucrezias Haar, sie hatte ein paar Spangen zwischen den Lippen und hielt Lucrezia mit der anderen Hand am Ohr fest. Gleichzeitig brachte sie es fertig, der balia zu sagen, sie solle aufhören, Pietro zu stillen, und ihn stattdessen ein Bäuerchen machen lassen; Francesco zu befehlen, sein Essen nicht herunterzuschlingen, sondern es ordentlich zu kauen; und Marias Frage nach den Unterrichtsstunden an diesem Morgen zu beantworten.
Lucrezia zuckte zusammen, als die Borsten sich in einem Knoten verhakten, doch sie schrie nicht auf. Das hätte auch nichts genützt: Machte man ein Geräusch, konnte es vorkommen, dass Sofia die Bürste aus dem Haar riss und einem damit blitzschnell gegen die Beine schlug. Lucrezias Ohr glühte bereits unter Sofias Griff.
Sie dachte sich weg aus dieser Situation, diesem Augenblick. Stellte sich stattdessen wieder die Sala dei Leoni im Keller unten vor. Die Tigerin würde auf sie zuschleichen, ein Grollen in der Kehle, aber beißen würde sie nicht, nein: Sie würde Lucrezia mit ruhigem Blick betrachten, Lucrezia würde zur Antwort ihrerseits ein kehliges Geräusch ausstoßen und –
Ein scharfer Ruck an ihrem Ohr riss sie ins Kinderzimmer zurück. Um sie herum wurde gerufen und gehöhnt. Sie hatte etwas verpasst – so viel war klar. Zum ersten Mal, seit sie aufgestanden war, schauten ihre älteren Geschwister sie an, kicherten und zeigten auf sie. Isabella krümmte sich vor Lachen und hielt sich die Hand vor den Mund.
»Was?«, fragte Lucrezia und rieb sich das Ohr.
»Du hast …«, weiter kam Giovanni vor lauter Kichern nicht.
»Was habe ich?«, fragte sie wütend, ohne zu begreifen, warum sie von allen angestarrt wurde. Sie schlang ihre Arme um Sofias vertraute Mitte und vergrub ihr Gesicht darin.
»Geknurrt hast du«, hörte sie Maria mit eisiger Missbilligung sagen.
»Wie ein Bär«, sagte Isabella. »Ach, du bist einfach zu komisch, Lucrè.«
Sie hörte die anderen aufstehen und aus dem Zimmer gehen, und noch immer redeten sie über Lucrè, die sich für einen Bären gehalten habe.
Sofia strich ihr mit festem Druck über den Rücken. Lucrezia drückte ihre Nase in Sofias Schürze und atmete den Geruch ein, der nur ihrem Kindermädchen gehörte: Hefe, Schweiß und ein würziger Hauch, der an Zimt erinnerte.
»Komm«, sagte Sofia, »lass mich wieder los.«
Lucrezia hob den Kopf, um das Kindermädchen anzublicken, dessen Taille sie immer noch umfangen hielt. Sie spürte, wie das Geheimnis der Tigerin sich in ihr bewegte, wie ein buntes Band, das sich zwischen ihren Rippen durchschlängelte. Sollte sie Sofia erzählen, was sie gesehen hatte? Würde sie es tun?
»Warum hast du keine Zähne?«, fragte sie stattdessen.
Sofia gab ihr mit der Bürste einen Klaps auf den Kopf.
»Weil«, sagte sie, »jemand deine Mutter und ihre Schwestern und Brüder stillen musste und man für jedes Kind einen Zahn verliert. Manchmal auch zwei oder drei.«
Das verwunderte Lucrezia. Sie blickte hinüber zur Amme, die nun den Kittel zuknöpfte, während Pietro auf ihrer Schulter lag. Würden ihr auch die Zähne ausfallen? Alle auf einmal? Kinder und Zähne, Milch und Geschwister. Hatten wegen ihr und Maria, Francesco, Isabella und Giovanni alle balie einen oder gar drei Zähne verloren?
Sofia bückte sich, um Garzia auf ihre Hüfte zu hieven, und Lucrezia sah zu, wie ihr nächstjüngerer Bruder Sofias Hals umschlang und etwas plapperte.
»Aber«, setzte Lucrezia an, »warum ist …?«
»Genug gefragt«, sagte Sofia. »Zeit für den Unterricht. Lauf.«
Lucrezia schlenderte ins Unterrichtszimmer, wo der Antikelehrer Karten und Tabellen entrollte, redete und redete und mit einem Zeigestock bald hier-, bald dorthin deutete. Francesco starrte aus dem Fenster; Maria beugte sich beflissen über ihre Schiefertafel und notierte, was der Lehrer über den Trojanischen Krieg erzählte; neben ihr saß Isabella und machte, sobald der Lehrer ihr den Rücken zuwandte, Giovanni gegenüber Grimassen. Grimassen, begleitet von klauenartig gekrümmten Fingern, wie Lucrezia feststellen musste. Und mit einer gewissen Bestürzung wurde ihr klar, dass es immer noch um ihr unbeabsichtigtes Knurren ging.
Lucrezia setzte sich an ihren Platz hinten im Zimmer, einen kleinen Schreibtisch hinter dem größeren, den sich Maria und Isabella teilten. Sie nahm erst seit ein paar Monaten am Unterricht teil, seit sie sieben war, alt genug nach Meinung ihres Vaters, um unterrichtet zu werden.
Der Antikelehrer, ein junger Mann mit einem Spitzbart, stand vor ihnen mit ausgestreckter Hand, und sein Mund bewegte sich, ging auf und zu, während er redete. Danach, wusste Lucrezia, würde der Musiklehrer kommen und sie ihre Instrumente hervorholen lassen. Und danach käme der Zeichenlehrer, und Lucrezia würde langweiligerweise das Alphabet aufschreiben müssen, während die anderen Zeichenunterricht erhielten. Lucrezia hatte gefragt, ob sie nicht auch daran teilnehmen dürfe – das war das Fach, das sie am meisten interessierte: die Welt auf plattem Papier umzusetzen, das, was jemand durch die Augen und das Gehirn wahrnahm, in die Finger und dann die Kreide strömen zu lassen – doch man hatte ihr gesagt, sie müsse warten, bis sie zehn sei. Die Tage, Monate und Jahre vor ihr schienen unendlich, öde in ihrer absoluten Vorhersehbarkeit.
Lucrezia grübelte noch immer über das Stillen von Kindern. Und Sofias verlorene Zähne. Und die Tigerin. Und ihre verschiedenen Sehnsüchte: das wilde Tier zu sehen, am Zeichenunterricht teilnehmen zu dürfen, wieder einmal in eine der Villen auf dem Land zu gehen, wo sie und ihre Geschwister reiten lernten und durch die Gärten rennen durften. Ihre Gedanken lösten sich von den Worten des Lehrers und trieben immer weiter ab. Lucrezia stellte sich vor, sie wäre wieder ein Säugling, würde gestillt von einer klauenlosen Tigerin, einer sanften Kreatur mit seidenweichem Fell und zärtlichen Pfoten, und diese winzige Lucrezia würde jeden ihrer Tage im Löwenhaus verbringen, an die warme Flanke der Tigerin geschmiegt, und niemand würde je dort hinkommen und nach ihr suchen –
Ein Schlag des Zeigestocks auf eine Landkarte riss sie aus dieser Fantasie und zwang sie, sich kurz auf das zu konzentrieren, was der Antikelehrer sagte.
»Und wo gerieten die griechischen Schiffe auf der Überfahrt nach Troja in eine Flaute?«
Francesco blinzelte, Maria verzog die Lippen, als ginge ein geringschätziger Gedanke durch ihren Kopf; ihr Ellbogen lag auf Isabellas Ärmel, und diese flüsterte Maria etwas ins Ohr.
Aulis, dachte Lucrezia. Sie nahm ihren Stift und zeichnete auf die Rückseite des vor ihr liegenden Blattes eine lange Horizontlinie, durchbrochen von den Masten unbeweglicher Schiffe; sie stellte sie groß dar, mit eingeholten Segeln und gespannten Tauen, die vom Bug unter Wasser zu unsichtbaren Ankern führten. Dann zeichnete sie einen Altar, auf dessen Stufen Menschen standen. Beim Zeichnen fiel ihr ein, was der Zeichenlehrer ihren Geschwistern in der Woche zuvor über Perspektive beigebracht hatte, als Lucrezia ihre Buchstabenformen hätte üben sollen. Dieser Theorie zufolge hatte die Welt verschiedene Schichten und Tiefen, wie ein Ozean, und ließ sich darstellen durch Linien, die zusammenliefen und sich schnitten. Das wollte Lucrezia ausprobieren.
»Isabella?«, sagte der Lehrer, die Augen zusammengekniffen.
Isabella wandte den Kopf von Maria ab. »Ja?«
»Wo, bitte schön, gerieten die Griechen in diese Flaute?«
Aulis, dachte Lucrezia erneut. Sie fügte ihrer Zeichnung eine junge Frau in einem langen Gewand hinzu, die auf den Altar zuging, und runzelte die Stirn beim Versuch, die Linien des Wegs zusammenlaufen zu lassen, wie das die Gesetze der Perspektive verlangten, auf das hin, was der Lehrer einen Fluchtpunkt genannt hatte.
Isabella tat, als gäbe sie sich große Mühe. »Beginnt der Name des Ortes vielleicht mit einem Y?«, fragte sie, den Kopf kokett schräg haltend und dem Lehrer ein möglichst gewinnendes Lächeln zuwerfend.
»Nein«, sagte der Lehrer ungerührt. »Giovanni? Maria?«
Beide schüttelten die Köpfe. Der Lehrer seufzte. »Aulis«, sagte er. »Wisst ihr nicht mehr? Das haben wir letzte Woche besprochen. Und wie brachte Agamemnon, der große König, die Götter dazu, ihm günstigen Wind zu schicken?«
Stille. Isabella griff sich ins Haar und schob sich eine widerspenstige Strähne hinters Ohr; Francesco zupfte an seinem Ärmel herum.
Indem er seine Tochter opferte, wusste Lucrezia. Sie versah den Altar mit Vorhängen, die so schlaff herabhingen wie die Takelung der Schiffe. Aber Achilles, der so tat, als wartete er beim Altar, den würde sie nicht zeichnen.
»Was tat Agamemnon«, versuchte es der Lehrer noch einmal, »um den Wind zu bekommen, dank dem die griechische Flotte nach Troja weitersegeln konnte?«
Seiner Tochter die Kehle durchschneiden, sagte sich Lucrezia. Sie erinnerte sich an jedes Wort dieser Geschichte, die ihnen der Lehrer vergangene Woche erzählt hatte; so funktionierte nun mal ihr Geist. Wörter drückten sich in ihr Gedächtnis wie eine Schuhsohle in weichen Lehm, der dann trocknete und hart wurde, wodurch der Abdruck für immer erhalten wurde. Manchmal fühlte sie sich so voll, ja übervoll mit Wörtern, Gesichtern, Namen, Stimmen, Dialogen. Dann pochte ihr Kopf vor Schmerz, und sie wurde durch die Schwere all dessen, was sie in sich trug, aus dem Gleichgewicht gebracht und taumelte gegen Tische und Wände. Dann steckte Sofia sie ins Bett, zog die Vorhänge zu und hieß sie eine tisana trinken, und dann schlief Lucrezia. Wenn sie danach erwachte, kam ihr Kopf ihr vor wie ein aufgeräumter Schrank: immer noch voll, aber geordneter.
Im Schulzimmer fragte der Lehrer noch immer nach Agamemnon und dem Wind. Lucrezia legte den Kopf auf die Arme und flüsterte der jungen Frau auf ihrer Zeichnung eine Warnung zu. Sie hieß Iphigenie, ein Name, den Lucrezia nie zuvor gehört hatte. »Pass auf«, sagte Lucrezia lautlos zu ihr, »pass auf.« Sie fand es unerträglich, dass Iphigenies Vater sie zu diesem Opfer überlistete, indem er ihr weismachte, sie werde verheiratet. Mit Achilles, dem herzlosen, aber großartigen Kämpfer, dessen Mutter eine Meernymphe war. Iphigenie ging fröhlich auf den Altar zu, von dem sie glaubte, es sei ein Hochzeitsaltar, der sich dann aber als Opferaltar erwies: Agamemnon schnitt ihr mit einem Messer die Kehle durch.
Lucrezia mochte nicht darüber nachdenken, wollte das Bild nicht sehen: das ahnungslose Mädchen, das aufblitzende Messer, das unheimlich ruhige und heiße Meer, den heimtückischen Vater, das schäumend über den Altar strömende Blut. Sie wusste: Diese Geschichte würde sie nachts heimsuchen. Iphigenie, deren durchgeschnittene Kehle einem leuchtenden Halstuch glich, würde zu dem Bett schlurfen, in dem Lucrezia lag, sie würde nach den Laken tasten und Lucrezia mit ihren kalten, blutigen Fingern zu berühren versuchen.
Beinahe wimmernd schob sie ihre Zeichnung unter eines der Bücher und drückte sich so heftig gegen die Lider, dass sie bunte Sterne sah; sie hörte den Lehrer »Iphigenie», »Opfer« und »Tochter« sagen, aber auch: »Was ist mit ihr? Ist sie krank?«
Maria hatte eine Antwort parat: »Ach, schenken Sie ihr bloß keine Beachtung. Das tut sie, um auf sich aufmerksam zu machen. Mama sagt, wenn sie das tut, soll man sie einfach ignorieren, dann hört sie von selbst auf.«
»Ist das so?« Die Stimme des Lehrers klang unsicher, ganz anders, als wenn er über die Griechen und die Trojaner, ihre Schiffe und Belagerungen sprach. »Sollten wir vielleicht, die, äh, das Kindermädchen holen?«
Lucrezia nahm die Finger von den Lidern. Die Szene vor ihr war so hell, dass sie einen Augenblick lang wie geblendet war. Dann stellte sie fest, dass ihre Geschwister und der Antikelehrer sie anstarrten.
Und hinter ihm, sah Lucrezia, trat gerade ihr Vater ins Zimmer.
Als Erstes dachte sie bei seinem Anblick: Tigerin. Er hat eine Tigerin im Keller versteckt. Isabella setzte sich sofort aufrechter hin, als hätte sie einen Stock verschluckt. Giovanni machte sich emsig an seiner Tafel zu schaffen. Francesco hob die Hand.
»Ja, Francesco«, sagte der Lehrer in neutralem Ton; aber Lucrezia sah, dass seine Wangen gerötet, seine Schultern angespannt waren: Er wusste ebenso gut wie die Kinder, dass Großherzog Cosimo I., der Herrscher über die Toskana, das Zimmer betreten hatte.





























