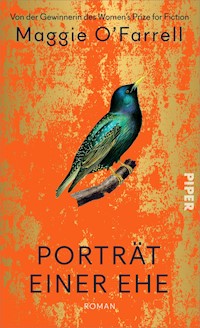4,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Beginn einer großen Liebesgeschichte: Der gefühlvolle Schottlandroman »Das Hotel im Schatten der Wälder« von Maggie O’Farrell als eBook bei dotbooks. Stella, eine leidenschaftliche junge Frau, genießt ihr Londoner Stadtleben in vollen Zügen – bis sie eines Tages eine Begegnung mit einem Fremden hat, der jemandem aus ihrer Vergangenheit wie aus dem Gesicht geschnitten ist. Auf einmal fühlt ihr Zuhause sich eng und bedrückend an, sodass Stella nicht anders kann: sie flieht. Doch schon bald wird ihr klar, dass sie sich den Ereignissen von damals stellen muss. Also reist sie in das abgelegene Hotel in Schottland, in dem sie vor Jahren mit ihrer Familie die Ferien verbrachte. Hierhin hat es auch Jake verschlagen, der auf der Suche nach seinen Wurzeln ist. Obwohl Stella eigentlich nur allein sein möchte, schafft Jake es, sie aus der Reserve zu locken. Nach und nach fasst sie Vertrauen zu ihm und sie verlieben sich – aber auch auf Jake scheint etwas zu lasten. Was ist sein Geheimnis? »Maggie O’Farrell hat ein magisches Talent für emotionale Szenen, die unter die Haut gehen.« Independent Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der einfühlsame Liebesroman »Das Hotel im Schatten der Wälder« von Maggie O’Farrell beschreibt auf eingängige Weise die Gefühlswelt und die Erinnerungen zweier Menschen, deren Begegnung so außergewöhnlich ist wie ihre Vergangenheit. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 516
Veröffentlichungsjahr: 2021
Sammlungen
Ähnliche
Über dieses Buch:
Stella, eine leidenschaftliche junge Frau, genießt ihr Londoner City-Leben in vollen Zügen – bis sie eines Tages auf der Straße einen Fremden sieht, der einem Mann aus ihrer Vergangenheit wie aus dem Gesicht geschnitten ist. Und mit einem Mal sind sie wieder da: so viele Erinnerungen, die Stella längst vergessen glaubte. Auf einmal fühlt sich die Stadt so eng und bedrückend an, dass Stella nicht länger davonlaufen kann – sie muss sich den Ereignissen von damals stellen. Also reist sie in das abgelegene Hotel in Schottland, in dem sie vor Jahren mit ihrer Familie die Ferien verbrachte. Hierhin hat es auch Jake verschlagen, der auf der Suche nach seinen Wurzeln ist. Obwohl Stella eigentlich nur allein sein möchte, schafft Jake es, sie aus der Reserve zu locken. Nach und nach fasst sie Vertrauen zu ihm und sie verlieben sich – aber auch auf Jake scheint etwas zu lasten. Was ist sein Geheimnis?
Über die Autorin:
Maggie O’Farrell, geboren 1972 in Nordirland, ist in Wales und Schottland aufgewachsen. Sie hat bei der Poetry Society und als Literaturredakteurin für den Independent on Sunday gearbeitet. Mit ihrem Debütroman »Das Haus mit der blauen Tür« feierte sie ihren internationalen Durchbruch. Inzwischen hat sie sieben Romane veröffentlicht und wurde 2010 mit dem Costa-Award für britische und irische Autoren geehrt. Maggie O’Farrell lebt mit ihrem Mann, dem Autor William Sutcliffe, und ihren Kindern in Edinburgh.
Bei dotbooks erscheinen von Maggie O’Farrell:
»Das Haus mit der blauen Tür«
»Das Jasminzimmer«
***
eBook-Neuausgabe November 2021
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 2004 unter dem Originaltitel »The Distance Between Us« bei Review/Headline, London. Die deutsche Erstausgabe erschien 2005 unter dem Titel »Bevor wir uns trafen« bei Goldmann.
Copyright © der englischen Originalausgabe 2004 by Maggie O’Farrell
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2005 Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2021 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock / Zelenaya Tropa / Dean Drobot / Moolkum / gemphoto / Stephen Bridger / rock ptarmigan / Malivan_Iuliia
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ae)
ISBN 978-3-96655-349-0
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Versand zweimal im Monat – unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Das Hotel im Schatten der Wälder« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Maggie O’Farrell
Das Hotel im Schatten der Wälder
Roman
Aus dem Englischen von Claus Varrelmann
dotbooks.
Ich weiß, dass unser Leben sich über Nacht ändern kann, allerdings dauert es normalerweise längere Zeit, bis wir begreifen, was passiert ist, bis wir erkennen, dass wir eine andere Richtung eingeschlagen haben.
Jay McInerney
Ich reiste an diese Orte … um mich ihnen zugehörig zu fühlen, um mir von ihnen den Weg weisen zu lassen.
Geoff Dyer
Sie war meine Gefolgsmännin, mein zweites Ich, meine Doppelgängerin; wir waren einander vollkommen unentbehrlich.
Simone de Beauvoir
Teil 1
Kapitel 1
Beim Aufwachen liegt er ausgestreckt wie ein Seestern auf dem Bett, und sein Verstand arbeitet auf Hochtouren. Im anderen Teil des Zimmers dreht sich der Ventilator zu ihm hin und dann von ihm weg, so als wäre er beleidigt. Er hört neben sich die Seiten eines Buches raschelnd in die Höhe wehen. Das Apartment ist in tintendunkles Licht getaucht, und Neonblitze zucken über die Zimmerdecke. Es ist Abend.
»Scheiße«, sagt er und hebt seinen Kopf mit einem Ruck. Zwischen seinen Schulterblättern dehnt sich etwas Weiches, für seinen Körper Wesentliches und reißt wie feuchtes Papier. Während Jake fluchend nach der schmerzenden Stelle auf seinem Rücken tastet, erhebt er sich ungelenk und schlittert auf Socken über die Holzdielen ins Bad.
Als er sein Gesicht im Spiegel sieht, erschrickt er. Die Falten der knitterigen Bettdecke haben rötliche Striemen auf Wange und Schläfe hinterlassen, und die Haut sieht dadurch sonderbar wund aus. Sein Haar steht wie nach einem Stromstoß in die Höhe und scheint in den letzten Stunden gewachsen zu sein. Wie hat es passieren können, dass er eingeschlafen ist? Er hatte gelesen, den Kopf in die Hände gestützt, und das letzte, woran er sich erinnert, ist die Szene im Buch, in der ein Mann auf einer Strickleiter in einen aufgelassenen Brunnen hinabsteigt. Jake schaut auf seine Armbanduhr. Zehn nach zehn. Er ist bereits zu spät dran.
Ein Nachtfalter flattert ihm ins Gesicht, prallt dann gegen den Spiegel, und der zarte, pudrige Belag auf den Flügeln hinterlässt sprenkelige Abdrücke auf dem Glas, ein schemenhaftes Abbild des Insekts. Jake tritt zurück, beobachtet es einen Moment lang, verfolgt seine Flugbahn und versucht dann, es zwischen seinen gewölbten Händen einzufangen. Vergebens. Das verängstigte Tier fliegt kreisend zur Lampe empor, aber Jake probiert es erneut, diesmal mit Erfolg, und der verwirrte Falter wirft sich gegen den Käfig aus Jakes Händen.
Jake schiebt den Fenstergriff mit dem Ellbogen zur Seite und drückt dann das Fenster auf. Das Dröhnen des Straßenlärms neunzehn Stockwerke weiter unten schallt zu ihm herauf. Jake lehnt sich hinaus, quer über die Wäscheleinen, öffnet die Hände und wirft den Falter nach oben. Das Tier stürzt einen Moment in die Tiefe, dreht sich orientierungslos herum, fängt sich dann aber, erwischt einen warmen Aufwind aus einer Klimaanlage in einer der unteren Etagen und verschwindet in der Dämmerung.
Jake schlägt das Fenster zu. Er hastet durch das Apartment, sammelt Brieftasche, Schlüssel und Jacke auf, zieht sich die Schuhe an, die unter einem Kleiderhaufen bei der Wohnungstür stehen. Es dauert ewig, bis der Fahrstuhl kommt, und als er endlich da ist, riecht die Kabine nach Schweiß und abgestandener Luft. In der Eingangshalle sitzt der Hausmeister auf einem Hocker neben der Tür. Über ihm hängt die reich verzierte, rotgoldene Dekoration für das Chinesische Neujahrsfest – ein pausbäckiges Kind mit pechschwarzem Haar reitet auf einem rosa Schwein.
»Gung hei fat choi«, sagt Jake im Vorbeigehen.
Auf dem Gesicht des Mannes erscheint ein Grinsen, das den Blick auf seine Zahnlücken freigibt.
»Gung hei fat choi, Jik-ah!« Er klopft Jake so kräftig auf die Schulter, dass dessen Haut prickelt und brennt wie bei einem Sonnenbrand.
Draußen auf der Straße zersplittern Taxireifen das reflektierende Licht in den Pfützen, und eine U-Bahn lässt den Bürgersteig erzittern. Jake legt den Kopf in den Nacken, um zu den Gebäudespitzen hinaufzuschauen. Der Wechsel vom Jahr des Ochsen zum Jahr des Tigers steht unmittelbar bevor. Als Kind hat er sich das Jahr an diesem Tag um Mitternacht als eine seltsame Tiermutation vorgestellt, als ein Wesen, das mitten in der Verwandlung begriffen ist.
Er geht los und stößt fast mit einer winzigen älteren Frau zusammen, die einen Karren voller zusammengefalteter Pappkartons schiebt. Jake tritt zur Seite und geht dann Richtung Süden, vorbei an den Basketball-Feldern, an einem kleinen roten Schrein am Straßenrand mit einigen abgebrannten Räucherstäbchen, vorbei an Männern, die in einem yum chai-Laden an Tischen sitzen und Mah-Jongg-Täfelchen klackend hin und her bewegen, vorbei an dichten Reihen verzierter Motorräder, filigranen Bambusgerüsten, vorbei an Restaurant-Bassins, in denen todgeweihte Fische im trüben Wasser auf der Suche nach Sauerstoff die Kiemen spreizen.
Aber Jake sieht nichts von alledem. Er schaut hinauf in die immer dunkler werdenden Wolken, läuft in seinen Turnschuhen mit den dünnen Sohlen summend über den Bürgersteig. Die Luft ist durchweht von Weihrauch, Feuerwerksqualm und dem heimatlichen Salzgeruch des Hafens.
Der Bus kommt nicht. Stella wickelt ihren Schal fester um den Hals und stellt sich auf Zehenspitzen, um die Straße entlangzuschauen. Autos, Autos, Taxis, Motorräder, ab und zu ein Fahrrad, Autos und noch mehr Autos. Aber kein Bus. Sie schaut hoch zu der Anzeige, die ihr eigentlich verraten sollte, wie lange sie noch warten muss. Aber dort steht nichts.
Sie zieht ihren einen Mantelärmel über dem Handschuh hoch, um auf die Uhr zu sehen. Sie hat heute Spätdienst und wird unpünktlich sein, wenn sie noch länger wartet. Stella denkt nach. Ist es besser, an der Haltestelle auf den Bus zu warten, der ja irgendwann auftauchen muss, oder sich lieber gleich zu Fuß auf den Weg zu machen und ein paar Minuten zu spät zu kommen? Sie könnte die U-Bahn nehmen, aber die nächste Station ist zehn Minuten zu Fuß entfernt, und womöglich wird nicht sofort ein Zug fahren. Sie wird zu Fuß gehen. Das ist jetzt wahrscheinlich das Schnellste.
Nachdem Stella sich mit einem kurzen Blick über die Schulter vergewissert hat, dass noch immer kein Bus in Sicht ist, marschiert sie los. Es ist kalt, ungewöhnlich kalt für die Jahreszeit, der Boden überfroren, mit einer Reifschicht bedeckt, die unter ihren Füßen knirscht. Die Farbe des Himmels ist ein unwägbares Grau, überzogen von einem wilden Muster aus kahlen Ästen.
Sie ist für einige Wochen nach London zurückgekehrt – sie hofft, dass es dabei auch bleiben wird –, um für eine Late-Night-Show im Radio zu arbeiten. Sie hat hier eine winzige Wohnung am Rande von Kennington, die aber meistens vermietet ist, weil sie sich viel im Ausland aufhält. Ein Monat in Paris, ein Job in Moskau, ein halbes Jahr in Helsinki. Sie weiß noch nicht, wohin es sie als Nächstes verschlagen wird – vielleicht nach Rom, Madrid oder Kopenhagen. Stella bleibt nicht gerne allzu lange am selben Ort.
Sie läuft nordwärts Richtung Themse, ihr Atem dampft, ihr Körper fühlt sich unter den verschiedenen Kleiderschichten zu warm an. Als sie auf die Waterloo Bridge hinaus tritt und sich der Fluss vor ihr auftut, ist ihr, als spalte sich die Stadt in zwei Teile. Irgendwo hat sie gelesen, die Brücke sei ausschließlich von Frauen gebaut worden, und zwar während des Zweiten Weltkriegs. Die Fußwege sind heute verwaist. Autos brausen an ihr vorbei, aber rechts und links der Fahrbahnen ist niemand.
An der Kreuzung springt Jake auf die hintere Plattform einer Straßenbahn, als sie gerade ratternd losfährt. Die untere, nur matt erleuchtete Etage ist proppenvoll – die Leute sitzen nebeneinander auf den Bänken oder klammern sich an die Haltestangen. Direkt neben Jake hat ein alter Mann mit Weste und verwaschener Hose einen Vogelkäfig auf dem Schoß. Der Vogel, der auf der schwingenden Sitzstange hockt, mustert Jake aus seinen kleinen schwarzen Knopfaugen von der Seite. Die Köpfe der beiden einzigen Westler in der Straßenbahn schwanken über denen der Chinesen hin und her.
Jake stürmt die hölzerne Treppe hinauf. Er setzt sich ganz vorne hin, streckt den Kopf aus dem Fenster, hält das Gesicht in den Fahrtwind und schaut zu, wie die unordentlichen, mit Neonschrift voll gekritzelten Häuserzeilen von Wanchai in das riesige, aus Beton und spiegelndem Glas bestehende Einkaufszentrum übergehen.
Jake hat dunkles Haar, und wenn er lange genug in der Sonne war, hat seine Haut fast denselben Farbton wie die seines Freundes Hing Tai, aber seine Augen haben die Farbe tiefen Wassers. Er hat einen britischen Pass, eine britische Mutter und auch einen britischen Vater. Allerdings hat Jake weder Großbritannien noch seinen Vater je gesehen, und er war niemals auch nur in der Nähe von Europa.
Stella sieht eine einzelne Gestalt vom anderen Ende der Brücke her auf sie zukommen. Einen Mann. Zusammengeschrumpft durch die Entfernung. Stella könnte die Hand heben und ihn mit Daumen und Zeigefinger umschließen. Wie von einem Seil gezogen gehen die beiden Schritt um Schritt aufeinander zu. Der Mann wird immer deutlicher zu erkennen: Er ist groß, kräftig, trägt eine grüne Jacke.
Stella schaut den Fluss hinunter auf das Riesenrad, das glitzert, als wäre es mit Pailletten besetzt, und auf die Menschen, die ameisengroß auf der South Bank entlangwuseln. Dann richtet sie ihren Blick wieder geradeaus, auf die Brücke, und sie erschrickt so heftig, dass sie beinahe stolpert. Sie muss sich an der Mauer festhalten, um nicht hinzufallen, und ihr Herz schlägt stotternd, als sei es verunsichert.
Stella starrt hinunter auf das braune, strudelnde Wasser des Flusses und schaut dann wieder den Mann an. Er ist erneut ein Stück näher herangekommen, und Stella fragt sich, ob er immer größer und größer werden wird, bis er über ihr aufragt, gewaltig und erschreckend wie ein Brockengespenst. Er sieht sie jetzt direkt an, die Hände in den Taschen vergraben.
Sie kann es nicht fassen, einfach nicht fassen. Er hat diese leicht aufgedunsene, hellrosa Haut, dasselbe dichte, rote Kraushaar und tiefe, ins Gesicht eingegrabene Augenhöhlen.
Es ist, als sei die Zeit zurückgespult worden, als hätten die Jahre sich selbst verschluckt. Stella ist sich sicher, dass sich die Haut des Mannes nasskalt und elastisch anfühlen würde und sein Haar einen eigenartigen feuchten Tiergeruch verströmt.
Inzwischen ist er fast bei ihr angekommen, er ist nahe bei ihr, so nah, dass sie ihn berühren könnte, und unten in ihrer Kehle bildet sich ein Schrei.
»Alles in Ordnung, junge Frau?«
Ihre behandschuhten Finger krallen sich am Geländer fest. Er ist Schotte. Genau wie sie gedacht hätte. Stella nickt, schaut immer noch auf den Fluss, dessen Oberfläche sich wie die Rückenmuskeln einer Schlange bewegt.
»Wirklich?« Er steht kurz außerhalb ihres Blickfeldes. Stella ist unfähig zu atmen, scheint nicht in der Lage zu sein, die Lungen zu dehnen, damit sie Luft aufnehmen. »Das sieht mir aber nicht so aus.«
Sie nickt erneut. Sie will nicht, dass er sie sprechen hört, ihre Stimme hört. Sie muss weg von hier. Ohne ihn anzusehen, setzt sie sich in Bewegung, zieht sich am Geländer entlang. Sie ist gezwungen, dicht an ihm vorbeizugehen und sie spürt seinen Atem auf ihrem Haar, als er sagt: »Na gut, wenn Sie meinen«, und bei diesen Worten erschaudert sie, verkrampft sich ihr ganzer Körper. »Also tschüss«, sagt er.
Stella verdreht den Kopf, um ihm nachzuschauen. Derselbe schwerfällige Gang, die Füße nach außen gedreht, die wuchtigen Schultern zusammengesackt. Er wendet sich noch einmal um. Bleibt einen Moment lang stehen. Dann geht er weiter. Also tschüss.
Zwei Laster donnern dicht hintereinander an ihr vorbei und wirbeln die Luft um sie herum auf. Sie läuft mit unsicheren Schritten los, ihr Mantel flattert, zerrt an ihr, die Gebäude der Innenstadt schwanken vor ihren Augen. Ein heftiger, zerrender Schmerz breitet sich in ihrer Brust aus, so als wollte ein lebendiges Wesen, das Zähne und Klauen hat, mit Gewalt aus ihr heraus. Sie stolpert, landet mit Handflächen und Knien auf dem Bürgersteig, und ehe sie sich hochrappelt, schaut sie sich um.
Er ist verschwunden. Vor ihr erstreckt sich die Brücke mit ihren lang gezogenen Bögen, es ist kein Fußgänger darauf zu sehen.
Mühsam steht sie auf. Ihre Handflächen sind voller Sand und Dreck. Ihr Haar ist feucht von Tränen und klebt in dem beißenden Februarwind an ihrem Gesicht. Sie schaut nach rechts und links, ohne genau zu wissen, was sie sucht.
Auf der gegenüberliegenden Straßenseite sieht sie ein erleuchtetes Taxischild näher kommen. Sie läuft auf die Fahrbahn, einen Arm hochgestreckt. Ein Auto bremst quietschend und weicht ihr aus. »Bitte anhalten«, murmelt sie leise. »Bitte.«
Das Taxi wird langsamer und stoppt. Stella rennt hinüber, öffnet die Tür und steigt ein.
Jake poltert die Stufen hinunter, als die Straßenbahn zu der S-Kurve kommt, die in den Stadtteil Central führt. Er mag es, den ruckartigen Richtungswechsel unter den Füßen zu spüren, mag es, sich im Stehen auf die gegenläufige Bewegung gefasst zu machen. Er springt vor dem imposanten, futuristischen Bankgebäude auf die Straße und geht an der verglasten Eingangshalle entlang, in der sich leere Rolltreppen unermüdlich hinauf- und hinunterbewegen.
Er erklimmt die steile ansteigende Straße Lan Kwai Fong, bahnt sich einen Weg durch die bereits ziemlich dichte Menschenmenge. Die Kopfsteinpflasterstraße ist von Bars und Nachtclubs gesäumt, allesamt voller Westler, die in den Anwaltskanzleien, Zeitungsredaktionen, Schulen, Radiosendern, IT-Abteilungen auf der Insel Hongkong arbeiten, jeden Abend mit der Fähre zu ihren Wohnungen auf Lamma oder Lantau zurückkehren, nachdem sie hier einen Zwischenstopp eingelegt haben, um gemeinsam mit Freunden ein paar Drinks zu kippen. Jake würde von sich aus nicht herkommen, aber Mels Clique trifft sich gerne hier.
Jake betrachtet Hongkong oft als eine Art Überlaufrohr Europas. Die Menschen, die sich diese Stadt aussuchen, verlassen ihre Heimat und ihre Familie meist aus einem ganz bestimmten Grund, und zwar einem, den sie nicht verraten. Sie befinden sich in unterschiedlichen Stadien der Ablösung oder laufen vor etwas davon oder sind auf der Suche nach einem flüchtigen Wirkstoff, durch den sie ihre Persönlichkeit vervollständigen können. Oder sie hoffen zumindest, dass ihnen das Gefühl, dass in ihrem Leben etwas fehlt, nicht nach Übersee folgen wird. Wenn man nur weit genug fortgeht, wird das eigene Ich einen womöglich nicht einholen.
Oben auf dem Hügel angekommen, betritt Jake die Iso Bar. Drinnen ist er sofort von eiskalter Luft aus der Klimaanlage umgeben und von lauter Menschen, die mit einem Glas in der Hand dicht gedrängt in Gruppen beieinander stehen. Er lässt auf der Suche nach Mel den Blick über die Menge schweifen. Plötzlich steht sie direkt vor ihm. Noch ehe ihre Blicke sich treffen, drückt sie ihm einen Lippenstift-Kuss auf die Wange und dreht sich zu ihren Freunden um: »Hab ich euch nicht gesagt, dass er zu spät kommen würde? Hab ich’s euch nicht gesagt?« Im trüben Halbdunkel verschwimmen ihre Gesichtszüge vor seinen Augen. Sie hat ihr helles, dünnes, fast farbloses Haar zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden und hält die Hände hinter seinem Rücken umklammert.
»Tut mir Leid, ich bin eingeschlafen«, brüllt Jake, um die Musik zu übertönen. »Keine Ahnung, wie mir das passieren konnte. Ich habe gelesen, und dann bin ich von einer Sekunde zur nächsten –«
»Du warst bestimmt müde.« Sie lächelt zu ihm hoch.
»Ja.«
Er löst sich aus der Umarmung, um die anderen zu begrüßen. Sie nicken ihm lächelnd zu, heben ihr Glas, und Lucy, Mels beste Freundin, gibt ihm einen raschen, beiläufigen Kuss, ehe sie sich wieder dem Mann zuwendet, mit dem sie sich gerade unterhält. Jemand reicht Jake ein hohes Glas, das beschlagen und deshalb glitschig ist.
»Wir fahren morgen nach Lantau«, schreit Mel über den Lärm hinweg, nachdem sie sich bei Jake untergehakt und zu einem ihrer Kollegen hinuntergebeugt hat, »um uns den Buddha anzuschauen. Jake will in den Bergen wandern.«
»Und du wirst ihn wirklich begleiten?«, fragt der Kollege amüsiert.
»Ja.« Mel nickt und sieht ihn direkt an. »Sofern er mich mitnimmt.« Sie drückt seinen Arm. »Weißt du, ich dachte, ich sollte es mal ausprobieren.«
»Aber du findest so was doch schrecklich!«
Nina stellt das Telefon neben sich auf den Boden, wählt die Vorwahl für London und dann die Nummer des Anschlusses. Nach kurzer Stille signalisiert das pulsierende Schnurren, dass es am weit entfernten anderen Ende der Leitung klingelt.
Sie wartet stirnrunzelnd ab, klappt eines der Sandwiches auf, die Richard am Morgen für sie gemacht hat, und zupft die silbrigen, halbmondförmigen Zwiebelscheiben heraus. Er weiß doch genau, dass sie keine rohen Zwiebeln mag. Dann hallt ein Seufzen durch den elektrischen Äther, gefolgt von den harschen Lauten einer Mailbox-Ansage. Hi, Sie sind mit Stella Gilmore von der James Karl Show verbunden. Ich bin entweder gerade nicht an meinem Platz oder –
Nina legt auf, fügt das Sandwich wieder zusammen und schiebt sich eine Ecke davon in den Mund.
»Noch zwölf Minuten!«, verkündet Lucy mit Blick auf ihre Uhr. »Dann verwandeln wir uns alle von Hühnern in Schweine!«
Mel sieht Jake an, einen leichten Ausdruck von Angst im Gesicht. »Stimmt das, Jake?«
»Von Ochsen in Tiger«, murmelt er. »Und es sind eigentlich nicht wir, sondern –«
»Los, gehen wir in die Bar mit dem DJ unten an der Straße«, sagt Lucy. »Na los, kommt schon!«
Sie stürzen ihre Drinks hinunter und verlassen das Lokal. Die Luft draußen ist lauwarm, und ein dünner Nieselschleier streift ihre Gesichter. Auf der Straße drängen sich die Menschen, ein Meer aus Köpfen wogt zwischen ihnen und den Gebäuden gegenüber. Jake muss sich an die Wand quetschen, um ein paar junge Japaner vorbeizulassen. Lucy stolpert über den Randstein und prallt seitlich gegen Jake. Mel greift nach seiner Hand. Auf der anderen Straßenseite singt eine Horde Engländer »Auld Lang Syne«.
In einem Londoner Großraumbüro fängt ein Handy an zu klingeln. Ein gedämpftes Geräusch, so als läge das Handy unter einem Mantel oder einem Aktenordner. In den umliegenden Arbeitsnischen verdrehen mehrere Leute den Kopf und lauschen mit fragender Miene. Als sie davon überzeugt sind, dass es nicht ihr Handy ist, wenden sie den Blick wieder ab.
Stellas Büronachbarin nimmt ihre Kopfhörer ab und schaut auf Stellas Schreibtisch. Der Stuhl ist vom Computer weggedreht. Statt Stella dort sitzen zu sehen, hat sie einen freien Blick hinaus auf die ungleichmäßigen Schornsteine und die schwarz angelaufenen, vom Regenwasser polierten Dächer der Häuser an der Regent Street.
Soll sie rangehen? Stella lässt das Ding öfters liegen, wenn sie Feierabend macht. Es hat in der letzten Stunde schon etliche Male geklingelt. Offenbar will irgendjemand sie dringend erreichen. Das Klingeln hört genauso abrupt auf, wie es begonnen hat. Die Frau setzt die Kopfhörer wieder auf. Sie wird es Stella erzählen, wenn sie kommt.
Der Lärm auf der Straße schwillt an, so als hätte jemand am Lautstärkeregler gedreht. Die Leute rufen und lachen und schreien. Dicht vor Jake trägt ein Mann einen kleinen, zerbrechlich aussehenden Papierdrachen mit gebleckten Zähnen vor sich her, der aus den Nasenlöchern Feuer speit. Jake drängelt sich zwischen den unzähligen Leibern hindurch in Richtung der Bar, Mel direkt hinter ihm, gefolgt von Lucy. Die anderen sind mit der menschlichen Dünung verschmolzen.
Immer mehr Leute quellen aus Türen, begeben sich in das Gewühl. Jake wird von Schultern, Ellbogen, Hüften und Füßen angerempelt, hin und her gestoßen. Er verdreht den Kopf und schaut die Straße hinauf. Ist das Getümmel dort weniger dicht? Nein. Weitere Köpfe tauchen auf, schweben aus Seitengassen heran, die D’Aguilar Street ist auf halber Höhe durch eine Barrikade der Polizei versperrt. Er spürt, wie sein Herz immer hastiger pocht, sich überschlägt, und er umklammert Mels Finger.
Von allen Seiten wird geschubst und gedrückt. Jake vergisst immer wieder, wie egoistisch sich Leute in solchen Situationen benehmen. Drei Männer, alle mit roten Party-Hüten, schieben sich unter Einsatz ihrer Ellbogen vorbei, und einer davon tritt Jake mit voller Wucht auf den Fuß. Ständig strömen weitere Menschen auf die Straße. Plötzlich findet Jake es sehr warm. Er schaut erst in die eine, dann in die andere Richtung, unfähig, sich zu entscheiden, was sie tun, wohin sie gehen sollen. Mel sagt etwas zu ihm, und als er sich zu ihr umdreht, stolpert er und stürzt beinahe. Er hält sich am Erstbesten fest, das er zu fassen bekommt – dem Mantel einer Frau links neben ihm – und zieht sich wieder hoch. Die Frau wirft ihm reflexartig einen panischen Blick zu, wendet sich aber ohne ein Wort ab, als Jake sich entschuldigt. Die Menschen um ihn herum rücken immer näher, drücken fast gegen seinen Brustkorb.
»Ich will hier weg«, sagt Mel. »Jake, ich will weg von hier.«
»Ich auch«, sagt er. »Lass uns versuchen –«
Seine Worte werden nicht ihr Ziel erreichen, denn es passiert mehreres, sehr schnell und fast gleichzeitig.
Hinter ihnen verliert ein Mann mit mehreren Bierflaschen in Händen das Gleichgewicht und kippt vornüber. Er lässt die Flaschen los, und sie fallen zu Boden und zerspringen. Bier spritzt über das Kopfsteinpflaster, hinterlässt schaumige, dunkle, rutschige Flecken. Jake schiebt sich zurück in das dichte Gedränge auf dem Bürgersteig und zieht Mel mit sich. Plötzlich pflanzt sich von der Spitze des Hügels ausgehend eine heftige Welle fort. Jake sieht, wie der Bierflaschen-Mann versinkt. Dann rutscht Lucy aus, wird von ihnen getrennt, und sie verschwindet, als sich die Menschenmenge über ihrem Kopf schließt.
Francesca ist im Garten und beugt sich über den Natterkopf, den sie in einer Gärtnerei in Arran gekauft hat und der, wie sie gerade entdeckt hat, die ersten schwarzen Frostflecken hat. Francesca hasst Frost, hasst ihn noch mehr als die grünen Blattläuse mit ihren Saugnapffüßen, die im Sommer auf ihren Rosen herumkrabbeln, noch mehr als die orange geränderten Schnecken, die ihre Brunnenkresse abnagen. Sie hat es jedoch nie über sich gebracht, die Schnecken umzubringen. Die Vorstellung, die Tiere mit Chemikalien zu vergiften oder mit Salz zu bestreuen, findet sie grausam, unerträglich.
Sie zittert und wickelt Archies Strickjacke fester um ihren Körper. Die tief hängenden Wolken am Himmel über Edinburgh sehen aus wie der Bauch einer Gans. Die kalte Luft hat heute den metallischen Beigeschmack bevorstehenden Schneefalls.
Ihr Körper reagiert schneller auf das elektronische Trillern als ihr Verstand. Noch ehe sie begriffen hat, was es ist, hat sie sich schon aufgerichtet und dem Haus zugewandt. Das Telefon. Das neue Telefon, das Stella ihr geschenkt hat.
Sie nimmt den Hörer ab und drückt aufs Geratewohl eine der Tasten, aber das Trillern hört nicht auf Francesca seufzt und greift nach ihrer Brille, die sie an einer Kette um den Hals hängen hat, und schaut sich die Tasten näher an. Auf einer davon ist ein winziger Telefonhörer abgebildet. Möglicherweise ist das die richtige.
»Hallo?«, sagt sie versuchsweise, erwartungsvoll.
»Hast du noch immer nicht gelernt, wie man den Apparat bedient?«
Es ist Nina, da ist sie sich ziemlich sicher. Sie und ihre Schwester klingen am Telefon sehr ähnlich, und keine von ihnen hält es je für nötig, sich mit Namen zu melden. »Doch, natürlich«, lügt Francesca, um Zeit zu schinden. Welche von beiden es auch ist, sie wird beleidigt sein, wenn Francesca sie mit dem falschen Namen anspricht. »Ich war bloß im Garten.«
»Oh.« Es entsteht eine Pause, in der Francesca hört, wie die Anruferin an einer Zigarette zieht. Also eindeutig Nina. »Wie geht’s dir übrigens?«
»Danke, gut. Viel zu tun. Dein Vater ist in München.«
»Wieso?«
»Ich weiß nicht genau. Eine Konferenz vermutlich.«
»Hör mal«, verkündet Nina. »Ich kann jetzt nicht mit dir reden. Ich habe in fünf Minuten einen Termin. Ich wollte bloß wissen, ob du heute schon mit Stella gesprochen hast.«
»Stella?«, wiederholt Francesca nachdenklich. Stella ist diejenige von den beiden, um die sie sich keine Sorgen zu machen braucht. »Nein.«
»Wann hast du sie das letzte Mal gesprochen?«
»Letzte Woche. Glaube ich. Oder vielleicht vorletzte Woche.«
»Aber heute nicht?«
»Nein. Wieso?«
»Nur so. Ich kann sie nicht erreichen. Ich habe mehrere Nachrichten hinterlassen, aber sie hat mich noch nicht zurückgerufen.« Nina zieht erneut an der Zigarette. »Sie ist verschwunden.«
Francesca fühlt sich stets etwas im Nachteil, wenn es um ihre beiden Töchter geht. Sie fand das Verhältnis der beiden schon immer zu eng, fand, dass sie zu sehr aufeinander bezogen waren. Ihr fällt etwas ein, und sie sagt frohgemut: »Vielleicht hat sie sich einen Tag freigenommen, oder sie –«
»Das hätte sie mir gesagt«, unterbricht Nina sie.
Francesca weiß nicht, was sie sagen soll. Da bei Nina Ablenkungsmanöver immer gut funktionieren, fragt sie: »Wieso kommst du nicht nachher vorbei? Vielleicht gibt es ja einen schönen Film im Fernsehen. Ich koche dir etwas zum Abendessen.«
»Okay«, meint Nina. »Mal sehen.«
Wieder und wieder brüllt Mel Lucys Namen, und sie versucht mit aller Kraft, sich aus Jakes Griff zu befreien. Geschrei, Schweiß und warmer, stechender Bierdunst brandet ihnen aus der Menge entgegen. Jake bemüht sich, Mel festzuhalten und sich gleichzeitig vorwärts zu schieben, um Lucy zu finden. Dann nähert sich eine weitere gewaltige Wellenbewegung, und Jake spürt, wie er den Boden unter den Füßen verliert, und beide werden sie von einer Woge aus Körpern von Lucy weggetragen, hin zum Fenster einer Bar, in der Menschen zu den Klängen von Musik tanzen, die nur sie allein hören können. Jake wird gegen eine kalte, körnige Wand geschoben. Mel ist von ihm weggerissen worden. Er will sich freikämpfen, stemmt die Ellbogen in die ihn umgebenden Leiber, um genug Platz zum Atmen zu haben, und stößt sich mit den Füßen an der Wand ab. Seine Lunge fühlt sich kochend heiß an, luftleer, zusammengequetscht.
»Mel!«, brüllt er. »Melanie!« Aber in dem Lärm kann er seine eigene Stimme nicht hören. Ein blonder, bärtiger Mann wird an seinen Rücken gepresst, und eine junge Filipina klammert sich, rhythmisch schluchzend, an den Kragen seiner Jacke. »Mel!«, schreit er erneut und versucht sich umzudrehen.
Die Menge zerrt ihn wieder gewaltsam mit sich, dieses Mal in eine andere Richtung, den Hügel hinunter, und er spürt etwas unter seinen Füßen, etwas Weiches, Nachgiebiges. Ist es ein Mensch? Panik flackert in ihm auf, und er will nach unten sehen, aber er ist eingeklemmt zwischen einem kreischenden Teenager mit hennarotem Haar und einer Frau mit weit aufgerissenen, starren Augen. Jake schaut sie an, sieht das Schwarz ihrer Pupillen, ihren schlackernden Kopf, ihren herabhängenden Unterkiefer.
Jake versucht, sich durch kräftigen Druck mit den Beinen Platz zu verschaffen, legt den Kopf in den Nacken und holt tief Luft. Nieselregen streift federleicht sein Gesicht. Hoch oben wölbt sich der Himmel, schwarz, flach und still, silbrig durchbrochen. In der Ferne ertönen Sirenen. Die durchdringenden Schreie des Teenagers neben ihm verwandeln sich in ein Wimmern. Er hört eine undeutliche, metallisch klingende Lautsprecherstimme, die in zwei Sprachen dazu auffordert, Ruhe zu bewahren, zu bleiben, wo man ist, Ruhe zu bewahren. Hört Musikschwaden aus den Bars ringsum. Das entfernte Knistern des Feuerwerks im Hafen. Das stolpernde, pochende Rauschen des Bluts in seinen Ohren. Das furchtbare Schweigen der Frau mit dem starren Blick.
Es ist halb fünf und Stellas Büronachbarin ist genervt. Stella und sie müssen noch einen Gast für die Sendung in der nächsten Woche aussuchen; eine von beiden sollte ein Buch gelesen haben, oder zumindest Teile davon, und die Interviewfragen für James aufgeschrieben haben, andauernd rufen hartnäckige PR-Agenten an, um ihre Klienten für die Sendung anzubieten, und bei der ganzen Telefoniererei bleibt ihr keine Zeit, das Interview dieser Woche vorzubereiten. Wo zum Teufel ist Stella?
Wieder klingelt das Telefon. Sie reißt den Hörer hoch. »Guten Tag, James Karl Show, Sie sprechen mit –«
»Maxine«, sagt eine leise Stimme in beiläufigem Ton, »entschuldigen Sie die Störung, hier ist –«
»Nina«, unterbricht Maxine sie, jetzt noch genervter. Stellas Schwester. Sie würde die Stimme jederzeit wiedererkennen. Nina ruft etwa zwanzig Mal am Tag an, zumeist aus völlig nichtigem Anlass. Maxine und eine Kollegin machen regelmäßig den Scherz, dass Stellas Schwester nicht in der Lage ist, sich eine Tasse Tee zu kochen, ohne Stella vorher zu fragen. »Sie ist nicht da«, blafft Maxine.
»Das habe ich mir schon gedacht«, blafft Nina zurück. »Wissen Sie, wo sie ist?«
»Ich wär’ froh, wenn ich’s wüsste. Sie sollte um eins hier sein, ist aber noch nicht aufgetaucht.«
»Wo war sie heute Vormittag?«
»Das weiß ich nicht.«
»Hatte sie eine Verabredung?«
»Keine Ahnung.«
»Wann ist sie gestern Abend gegangen?«
Maxine seufzt. Das Letzte, wonach ihr momentan der Sinn steht, ist ein Kreuzverhör durch Stellas bescheuerte Schwester. »Nina, ich stecke bis zum Hals in Arbeit und –«
»Wann ist sie weggegangen?«, wiederholt Nina.
»Himmelherrgott«, murmelt Maxine. »Ich weiß nicht genau … halb eins. Vielleicht auch um eins. Nachdem die Sendung zu Ende war.«
Maxine hört das Klicken von Ninas Feuerzeug.
»Soll ich ihr etwas ausrichten?«, fragt Maxine und dreht dabei unablässig ihren Stift zwischen den Fingern. Sie muss sich weiter um die Interviewfragen kümmern – James kriegt einen Wutanfall, wenn er sie um fünf noch nicht hat. Maxine winkt durch die Glastrennwand einer anderen Frau in dem Großraumbüro zu. Die Frau macht eine Trinkbewegung, will wissen, ob Maxine einen Kaffee möchte. Maxine streckt nickend den Daumen in die Höhe.
»Nein«, sagt Nina, »nicht nötig«, und legt auf.
»Auch Ihnen noch einen schönen Tag«, murmelt Maxine ins Leere.
Erneut wird er von der Menge mitgezerrt, dieses Mal den Hügel hinauf, und die Enge wird so schlimm, dass er keine Luft mehr bekommt. Sein Blick verschwimmt, er nimmt die Szenerie um ihn herum nur noch undeutlich wahr, und ein starker Schmerz breitet sich von seiner Schulter über den Rücken aus. Das Wichtigste ist jetzt, nicht zu stürzen, sagt er sich wieder und wieder, aufrecht zu bleiben, nicht zu Boden zu gehen. Seine Rippen knacken bedrohlich, ihm ist, als würden seine Muskeln keinen Sauerstoff bekommen, seine Gliedmaßen fühlen sich taub und kribbelig an, und Jake ist überzeugt, dass es so weit ist, sein Ende naht, dass nichts und niemand so etwas überstehen kann, und sein Geist ist reglos, ruhig und schwer wie geschmolzenes Blei.
Plötzlich wird er gegen den Rücken eines Mannes geschleudert, und der Mann dreht sich wütend um. »He, passen Sie doch auf!«
Der Mann wendet sich wieder seinen Begleitern zu. Jake starrt die Leute an. Sie trinken und plaudern. Er hat einen Teil der Menge erreicht, der ahnungslos ist, der immer noch das soeben angebrochene Jahr des Tigers feiert.
Der Mann, mit dem er zusammengestoßen ist, sagt gerade: »Ich meine, was würdet ihr tun, wenn ein Kunde euch in eines dieser Lokale mitnehmen würde, wo im Fenster platt gedrückte Schweineköpfe liegen?«
Die Frau neben ihm wirft kichernd den Kopf in den Nacken. »Augen zu und durch!«, kreischt sie, und alle lachen.
Plötzlich entspannt sich die Situation. Die Menschen um ihn herum lösen sich von ihm. Es ist, als sei eine Membrane durchlöchert worden: Der Menschenstrom ebbt langsam ab. Jakes Beine geben nach wie schmelzendes Plastik, und er sinkt auf das Kopfsteinpflaster. Dann hockt er da, keuchend, nach Atem ringend, saugt Luft in seine wunden Lungen, registriert die starren Blicke, das Gemurmel der Menschen in seiner Nähe. Es ist auf einmal viel stiller als zuvor.
Jake hebt den Kopf und blickt die Straße hinunter.
Nina geht auf dem Heimweg quer durch die Meadows und schaut kurz in Richards Praxis vorbei. Sie lässt die Sprechstundenhilfe links liegen (die nicht mit Nina redet, weil Nina sie einmal bei der alljährlichen Praxisfeier aus Versehen eine fette Kuh genannt hat) und marschiert vorbei an den wartenden Patienten schnurstracks ins Arztzimmer.
Richard legt gerade einen komischen, aus Stahl und schwarzem Schlauch bestehenden Apparat in eine Schachtel. »Hallo, schöne Frau«, sagt er, als er sie sieht, und küsst sie auf die Stirn, was Nina nicht leiden kann, aber sie will deswegen jetzt keinen Streit anfangen. »Wieso bist du hier?«
»Um dich zu sehen.« Nina setzt sich auf die Untersuchungsliege und schlägt die Beine übereinander.
»Wie schön«, sagt er, aber sie bemerkt, wie er einen raschen Blick auf die Uhr wirft.
»Ich mache mir Sorgen wegen Stella«, sagt sie.
»Ach ja?« Er schiebt Unterlagen auf seinem Schreibtisch zusammen und schaut auf seinen Computermonitor.
»Sie ist spurlos verschwunden.«
Er schreibt etwas auf einen der Zettel. »Spurlos verschwunden?«, wiederholt er – ein Trick, der sie davon überzeugen soll, dass er ihr zuhört. »Aber das ist sie doch andauernd, oder? Es ist ein fester Bestandteil … der Stella-Gilmore-Show.«
»Was meinst du?«
»Der Trick, wo sich jemand in Luft auflöst.« Richard schaut hoch. Nina sieht, wie er den Stift hinlegt, sieht, wie er sich selbst ermahnt, nur mit Vorsicht über ihre Schwester zu reden. In der Anfangszeit ihrer Beziehung – vor etlichen Jahren – hat sie ihm einen Dosenöffner an den Kopf geworfen, als er sie gefragt hat, ob sie nicht auch fände, Stella sei ein klein wenig flatterhaft.
»Aber sie sagt mir vorher immer Bescheid. Ich …«, sie zuckt unbehaglich die Achseln, »… ich habe irgendwie das Gefühl, dass ihr etwas zugestoßen ist.«
Richard kommt zu ihr herüber. »Bestimmt ist mit ihr alles in Ordnung«, sagt er und streicht ihr über die Wange. »Wann hast du zuletzt mit ihr gesprochen?«
»Gestern Abend«, sagt Nina und bereut es sofort. Sie sieht, wie er den Mund verzieht, sieht, wie ihm die Diagnose »hysterisch« durch den Kopf geht. »Aber ich habe seitdem einen Haufen Nachrichten für sie hinterlassen.«
»Sie wird wieder auftauchen«, sagt er in beruhigendem Ton. »Sie ist wahrscheinlich bloß im Stress, meinst du nicht auch?«
Nina antwortet nicht. Sie legt sich auf die Liege, ihre spitzen Absätze zerreißen dabei die Papierabdeckung. Richard legt ihr eine Hand auf die Hüfte. Durch den dünnen Stoff ihres Rocks spürt sie die Wärme der Hand.
»Vielleicht sollte ich dich mal untersuchen«, sagt er, schiebt den Rocksaum hoch und hakt seinen schwieligen Daumen unter einen der Strümpfe.
Nina starrt die Decke über ihr an, lauscht dem Rascheln des Papiers auf der Liege, dem Voranschreiten des Sekundenzeigers der Wanduhr, Richards Atemzügen.
»Nein«, sagt sie, setzt sich auf und zieht den Rock hinunter. »Ich muss Stella suchen.«
Jake steht an einem mit Plastik beschichteten Tisch und hält sich mit der rechten Hand den linken Arm. Der Schmerz in seiner Schulter ist grauenvoll, bohrend, durchdringend, und der Arm baumelt abgewinkelt herab, so als gehöre er gar nicht zu ihm. Sein Gesicht blutet auf einer Seite. Er wischt es immer wieder mit dem Ärmel ab, der dadurch inzwischen von roten Tigerstreifen übersät ist. Krankenschwestern, Pfleger und Sanitäter wuseln um ihn herum, geschäftig, wie elektrisiert.
Jake beugt sich erneut über den Tisch. »Melanie Harker«, sagt er zu der Frau am Empfang. »Ist sie hier? Im Krankenhaus?«
»Nehmen Sie bitte Platz«, erwidert sie, ohne ihn anzuschauen. »Ein Arzt wird sich gleich um Sie kümmern.«
»Ich brauche keinen Arzt«, sagt er. »Ich muss Melanie finden.« Das helle Licht der Leuchtstoffröhren tut ihm in den Augen weh. »Was ist mit Lucy Riddell? Ist sie hier?«
Die Frau guckt ihn streng an. »Nehmen Sie bitte Platz.«
Wenn er den Kopf zu schnell bewegt, fangen die Wände und Flure um ihn herum an zu schwanken. Um nicht das Gleichgewicht zu verlieren, hält er sich am Rand des abblätternden Tisches fest. Seine Hand zittert wie die eines alten Mannes. Er staunt immer noch, mit welcher Leichtigkeit seine Lungen sich ausdehnen und zusammenziehen, ausdehnen und zusammenziehen. Er glaubt, er wird das hier niemals überstehen.
Ein Mensch in einem weißen Arztkittel huscht durch die Schwingtüren in einen Korridor. Jake folgt ihm und stützt sich beim Gehen an der Wand ab.
»Entschuldigung«, sagt er, während er an der blassgrün gestrichenen Wand des Korridors entlangstolpert, »Entschuldigung.«
Der Arzt wirft ihm einen kurzen Seitenblick zu, ohne seine eiligen Schritte zu verlangsamen.
»M’goi, m’goi.« Jake wechselt ins Kantonesische. »Gau meng ah. Ich suche Melanie Harker. Ist sie hier?«
Der Arzt bleibt abrupt stehen und starrt ihn jetzt aufmerksam an, ist wie alle Chinesen fassungslos angesichts eines Kantonesisch sprechenden gweilo. »Melanie Harker«, wiederholt der Arzt, der ihn weiterhin anstarrt. »Ja. Sie ist hier. Ich habe sie vorhin gesehen. Sie ist …« Er verstummt. »Sind Sie ein Verwandter?«
»Nein … ja …« Jake versucht, eine Erklärung zu formulieren. Er füllt das scheinbar riesige Volumen seiner Lungen aus dem unbegrenzten Vorrat an Luft, der ihn umgibt. »Sie ist meine … meine Freundin. Ihre Familie lebt in England«, stößt er hervor. »In Norfolk«, fügt er hinzu, ohne zu wissen, warum.
Der Arzt, der vor Erschöpfung dunkle Ringe unter den Augen hat, mustert ihn. »Hat man Sie schon untersucht?«
»Nein.« Jake schüttelt ungeduldig den Kopf. »Nicht nötig, mir geht es gut. Ich will wissen –«
»Sie sehen aber nicht aus, als ginge es Ihnen gut«, sagt der Arzt, holt eine Stiftlampe aus einer Tasche seines Kittels und leuchtet damit in Jakes Augen. Als er seinen linken Arm berührt, zuckt Jake zusammen, denn ein glühender Schmerz schießt den Arm hinunter. »Das muss geröntgt werden«, sagt der Arzt. »Der Arm ist gebrochen. Sie stehen unter Schock. Wir werden Sie über Nacht hier behalten. Neihih ming m ming ah?«
»Ngor ming. Aber wann kann ich –«
»Melanie Harkers Zustand«, unterbricht ihn der Arzt, »ist kritisch. Sie liegt auf der Intensivstation.«
Jake starrt eine Wandleuchte an. Eine Fliege hat sich in ihr verfangen und knallt immer wieder mit dem Kopf gegen den Milchglasschirm. Es kommt Jake so vor, als wären diese Bewegung und dieses Geräusch in seinem Kopf. Er öffnet den Mund, um eine Frage zu stellen, aber ihm fällt partout nicht ein, wie sie lauten könnte.
»Ich erkundige mich, ob Sie sie besuchen dürfen«, sagt der Arzt in sanfterem Ton als zuvor.
Stella sitzt auf dem Fußboden, an die Wohnungstür gelehnt, noch immer in ihren Mantel gehüllt. Das gesamte Zimmer wirkt fremd auf sie. War sie es, die das Bild an der Wand gekauft hat, und auch die Vase, die Bücher dort? Gehört das alles ihr? Wohnt tatsächlich sie hier oder jemand anders? Stimmt es, dass sie ein ganzes Wochenende damit verbracht hat, mit einer Maske vor dem Mund die Dielen abzuschleifen und zu wachsen? Warum hat sie das getan? Zu welchem Zweck?
Jenseits des dicken grünen Schafts einer Amaryllis sieht Stella sich selbst im Spiegel. Ihr Gesicht wirkt blutleer und hebt sich deutlich von ihrem Haar ab. Sie hat die langfingrigen Hände ihres Vaters, die grünen Augen, das dunkle Haar ihrer Mutter und, wie sie kürzlich erstaunt feststellte, als sie in der Wohnung ihrer Großeltern ein altes, bräunliches Foto entdeckte, das Gesicht einer Ururgroßtante aus Isernia. Ein Mischmasch, das Ergebnis des Aufeinanderprallens verschiedener Gene.
Das erneute Klingeln des Telefons lässt sie zusammenfahren, lässt sie den Blick von sich selbst abwenden. Sie zupft an der geflochtenen Naht ihrer Handschuhe. Es klingelt vier, fünf, sechs Mal, dann springt der Anrufbeantworter an, und sie hört, wie sich die Worte ihrer Schwester in die Stille hinein abspulen.
Stella senkt den Kopf, hält sich die Ohren zu.
Jegliche Farbe scheint aus Mels Haut gewichen zu sein. Sie ist so bleich, dass sie sich kaum von den magnesiaweißen Laken und Wänden abhebt. Neben ihr piepsen und seufzen Apparate. Irgendwo über ihr summt die Klimaanlage.
»Mel?« Jake greift nach ihren Fingern. Sie sind trocken und kühl, eine lose Ansammlung von Knochen. An ihrer anderen Hand ist ein grauer Plastikclip befestigt, der wie der Mund eines winzigen Krokodils aussieht. »Ich bin’s, Mel«, flüstert er.
Unter ihren rot marmorierten Lidern bewegen sich die Augen, dann lösen sich die Wimpernreihen voneinander. Sie braucht eine Weile, bis sie ihn erkennt. Sie öffnet den Mund, aber es dringt kein Laut heraus. Er sieht sie einatmen und schlucken. Alles, was sie tut, kostet übermäßig viel Zeit und Mühe. Er will ihr sagen, dass es keine Rolle spielt, dass sie nicht zu reden braucht, aber sie sagt beim Ausatmen seinen Namen, und ihre Hand zuckt unter seiner. Dann bildet sie mit den Lippen ein Wort, das er nicht versteht.
»Wie bitte?«, flüstert er und beugt sich dichter über sie. Sie riecht nicht wie sonst. Zu dem Krankenhausgeruch nach gestärkter Wäsche und Antiseptika gesellt sich ein sonderbarer, säuerlicher Duft wie von etwas, das zu lange im Dunkel gelagert wurde.
»Lucy«, flüstert Mel. »Lucy.«
Jake wendet den Blick ab, als er »Sie ist nicht hier« sagt. Es fällt ihm schwer zu lügen, er hat noch nie besonderes Talent dafür besessen. Er befürchtet immer, dass die Wahrheit offenkundig ist, dass man sie von seinem Gesicht ablesen kann, so als wäre sie auf seine Haut projiziert. Lucy liegt in der Leichenhalle tot in einem Kühlfach, mehrere Etagen unter Mels Bett. »Sie ist in ein anderes Krankenhaus verlegt worden«, denkt er sich rasch aus. »Das Queen Mary. In Happy Valley.«
Mel lässt den Blick über ihn schweifen, über den Gipsarm, die Schulterschlinge, die leuchtenden, blauen Flecken in seinem Gesicht. »Geht’s dir gut?« Die Worte kommen stoßweise, abgehackt, als wäre jedes ein eigener Satz.
»Ja.« Er nickt. »Ich habe bloß einen gebrochenen Arm. Und eine ausgekugelte Schulter. Aber das macht nichts. Wie fühlst du dich?«
Sie bewegt den Kopf auf dem Kissen, seufzt, und durch den Atem beschlägt die Sauerstoffmaske. Jake sieht, wie aus ihren Augenwinkeln Tränen rinnen, sich wie ein Flussdelta ausbreiten. Erneut bewegt sie den Mund.
Er beugt sich zu ihr hinunter, berührt ihre Wange mit den Lippen, streicht ihr das feuchte Haar aus der Stirn. »Was hast du gesagt?«, fragt er.
»Ich habe Angst«, hört er. Ihrer beider Gesichter sind so dicht beieinander, dass er sehen kann, wie ihre Zunge die Worte formt. »Jake, ich will nicht …« Sie sucht mit den Augen seinen Blick, bis sie ihn findet. »Ich will nicht sterben –«
»Das wirst du auch nicht«, erwidert er eilig, ehe ihm klar wird, dass der Satz noch nicht zu Ende ist.
»– ohne dich vorher geheiratet zu haben.«
Der über das Bett auf der Intensivstation geneigte Jake blinzelt unwillkürlich. Fast würde er »Was?« sagen, aber er hält sich rechtzeitig im Zaum. Er hat sie genau verstanden. Es ist ein derart absurdes Anliegen von ihr, dass sich tief in seinem Inneren der Wunsch regt loszulachen. Das kann sie unmöglich ernst gemeint haben. »Mel«, hebt er an, unsicher, was er sagen will, was er sagen sollte. Was sagt man in so einem Fall? Zu einer Frau, die man erst seit vier Monaten kennt?
»Ich will nicht … Ich ertrage die Vorstellung nicht zu sterben«, ihre Stimme wird höher, steigt nach oben wie ein Blatt, das der Wind hochwirbelt, »… ohne … ohne mit dir verbunden zu sein.« Inzwischen schluchzt sie, und es kommen Leute angerannt, die raschen Schritte klackern auf den Fliesen. »Ich ertrage es nicht, ohne …«
Eine Krankenschwester rückt die Sauerstoffmaske auf Mels Gesicht zurecht. Mel wehrt sich, versucht weiterzusprechen, aber nun ist auch der Arzt da, er macht sich an einem Apparat zu schaffen und bittet sie, nicht zu reden, still zu liegen.
»Vielleicht …« Jake versucht es von neuem, schafft es aber nicht, seine Gedanken zu sortieren. Er würde alles dafür geben, sich einen Moment lang hinlegen zu können, seine Augen vor dem brutalen Licht zu verschließen, sich auf einem frisch gestärkten Laken auszustrecken, von einer der Krankenschwestern gesagt zu bekommen, was er tun soll. »Lass uns erst einmal abwarten, wie es dir morgen geht«, sagt er. Er ist sich bewusst, wie unaufrichtig diese Worte klingen, und er sieht die Bestürzung in ihrem Blick.
»Sie sollten wissen, dass sie die Nacht nicht überleben wird«, sagt der Arzt, der rechts neben Jake steht, auf Kantonesisch zu ihm, in sanftem, aber eindringlichem Ton. Jake dreht sich zu ihm um und schaut ihn an. Er spürt wieder den vibrierenden, bohrenden Schmerz in seinem Arm und seiner Schulter. Es kommt Jake plötzlich unglaublich heiß in dem Raum vor. Er sieht wieder Mel an. Ihre Augen funkeln und glitzern.
»Es tut mir Leid«, sagt der Arzt.
Stella zittert vor Kälte, ihre Haut ist von winzigen Hubbeln überzogen, ihre Zähne klappern. Die Heizung ist nicht eingeschaltet. Vor einer Weile hat sie den Arm ausgestreckt und das Licht angeknipst. Über ihr strahlt eine Glühbirne gelblich. Sie hat keine Ahnung, wie spät es ist. Es scheint ihr, als wären das Haus und auch die ganze Stadt verschwunden, hätten sich aufgelöst, wären in die Nacht geflohen. Das Telefon hat noch zwei Mal geklingelt, dann nicht mehr. Die Nachbarn haben sehr laut ferngesehen. Aber auch das ist inzwischen vorbei. Dieses erleuchtet, kastenförmige Zimmer scheint einsam und allein im finsteren Raum zu schweben.
Stella macht die Augen ganz fest zu. Es muss eine Methode geben, wie sie verhindern kann, dass diese Sache weiterhin ihr Leben beherrscht. Wie oft ist ihr so etwas schon passiert? Wie oft hat sie ihn im Gesicht eines Fremden auf der Straße, in der Eisenbahn, in einem Pub, einem Fahrstuhl oder einem Laden gesehen? Diese Erscheinungen entstellen ihr tägliches Leben wie Schlucklöcher, an deren Rändern die Erde gefährlich abbröckelt.
Stella steht rasch auf. Durch die plötzliche Bewegung wird ihr für ein paar Sekunden schwarz vor Augen, und ihre Gelenke schmerzen. Ein kleines Insekt flattert kurz um ihren Kopf herum, nähert sich dann kreisend dem Licht. Sie steht einen Moment lang da und beobachtet es, und auf einmal hat sie eine Idee. Sie überkommt sie von außen, wie ein Blitz, der auf einen Blitzableiter trifft, und kaum ist der Gedanke da, hat sie sich bereits entschieden.
Sie wird schlagartig aktiv, läuft wie ein bis zum Anschlag aufgezogenes Spielzeug durch die Wohnung und sammelt alles Mögliche zusammen: Kleidung, eine Straßenkarte, ihren Kompass, ihre Brieftasche, ein paar Bücher. Sie holt eine Reisetasche oben aus dem Schrank, stopft die Sachen hinein und zerrt den Reißverschluss zu.
Der Priester ist ein Bekannter von Hing Tai. Er begrüßt Jake als Jik-ah, sagt ihm, wie Leid ihm das alles tut. Eine ernst dreinblickende Krankenschwester mit dickem schwarzem Haar, das dauergewellt und von einem spitz zulaufenden Häubchen bekrönt ist, fungiert als Trauzeugin. Als das erste Morgenlicht im Jahr des Tigers in den kleinen Raum dringt, legt Jake die eine Hand auf die von Mel und die andere auf den schwarzen Ledereinband eines Buches, an dessen Inhalt er nicht glaubt, und sagt: »Ja.«
Es hat draußen gefroren, als sie ihren Wagen aufschließt. Sie muss mehrere Minuten lang dasitzen, bis die heiße Luft, die aus dem Armaturenbrett bläst, den Sternenregen auf der Windschutzscheibe beseitigt hat.
Die Schlüssel für ihre Wohnung steckt sie in einen an eine Freundin adressierten Umschlag. Auf der Fahrt aus London hinaus hält sie an einem Briefkasten und schiebt den Umschlag durch den breiten roten Schlitz.
Sie ist überrascht, wie viel Verkehr mitten in der Nacht herrscht. Als sie ein Autobahnschild mit der Aufschrift »Nordengland, Schottland« sieht, drückt sie das Gaspedal durch und lächelt beinahe.
Teil 2
Kapitel 2
Stella schiebt ein Messer unter die Lasche des Briefumschlags. Das dicke, cremefarbene Papier reißt, die Ränder fasern aus wie Mull. Als sie den Finger in den Umschlag schiebt, um den Brief herauszuholen, bebt plötzlich das Haus.
Sie schaut hoch. Ein Paar penibel zugeschnürter Wanderstiefel kommt die Treppe herunter. Stella beobachtet sie einen Moment, dann legt sie den Brief hin, steht von ihrem Stuhl auf und versteckt sich hinter einer hohen Pflanze, die auf einem Ständer steht. Stella hat heute Morgen bereits Frühstück serviert, die Küche geputzt, zwei Buchungsanfragen entgegengenommen und hat keine Lust auf eine Plauderei mit einem Gast.
Der Mann aus Zimmer vier läuft beschwingt durch die Diele, gekleidet wie für eine Polarexpedition, mit einer Brille, die ihm an einem Band um den Hals baumelt. An der Eingangstür angekommen, schiebt er den Kopf schildkrötenartig nach vorne und streckt die Hand mit emporgewandter Handfläche aus, um zu überprüfen, wie das Wetter ist. Mit der anderen Hand kratzt er sich den Hintern. Stella kräuselt die Nase, und ihr entfährt ein ersticktes Kichern, das in der geräumigen Hoteldiele hin- und herschnellt wie ein Tischtennisball.
Der Mann hört auf, sich zu kratzen und schaut sich um. Stella hält den Atem an, sucht fieberhaft nach einer einleuchtenden Erklärung, wieso sie eingezwängt hinter einer Topfpflanze steht. Aber er sieht sie nicht. Ihre Halsmuskeln fangen an wehzutun, weil sie sich so sehr verkrampft, aber sie kann sich jetzt unmöglich blicken lassen.
Als sie hört, wie die Eingangstür zuschlägt, entspannt Stella sich und dehnt mit hochgereckten Armen ihren Rücken, sodass die Wirbel einer nach dem anderen knacken. Sie setzt sich wieder auf den Stuhl, legt den Brief auf den Tisch, streicht mit dem Handballen darüber, glättet die Kringel und Gedankenstriche ihrer Mutter.
Ihre Mutter schreibt seit eh und je mit Füllfederhalter. Stella weiß, wo sie ihn aufbewahrt – in der kleinsten Schublade rechts in ihrem Schreibtisch –, und sie weiß genau, wie ihre Mutter ausgesehen haben muss, als sie die zierliche, gravierte Feder in die Tinte tauchte. Sie kann sich den Anblick ebenso gut vorstellen wie ihr eigenes Spiegelbild: Erst hat sie die Luft aus dem Plastikkolben gedrückt, sodass kleine Bläschen im Tintenfass aufstiegen, und dann Tinte in den Füller eingesaugt wie Blut in eine Spritze. Dann hat Francesca vermutlich die Beine an den Knöcheln übereinander geschlagen, hat ein Blatt Papier auf die Schreibunterlage gelegt, die sich exakt in der Mitte auf dem am Erkerfenster stehenden Schreibtisch befand, und sich nach einer eigenartigen zeigenden Handbewegung, die an einen Dirigenten erinnert, der die Orchestermusiker zur Ruhe anhält, vorgebeugt, den Füller auf den makellosen Briefbogen gedrückt, und sie hat mit den Worten begonnen: Liebste Stella.
Stella schaut hinunter auf den mehrseitigen Brief: Dein Vater und ich, ist zu sehen. Dann: geben uns alle Mühe zu verstehen, wieso du das getan hast. Sie überspringt ein paar Zeilen … wir können nicht begreifen, wieso jemand eine feste Stelle, und zwar eine sehr gute Stelle, in London einfach so aufgibt … sie blättert um … das ist wirklich schwer nachvollziehbar …
Stella hebt den Blick, weg von dem Brief, und sieht durch das Fenster. Sie kann von ihrem Platz aus quer über das Tal schauen – durch die Bäume hindurch, deren Äste sich im Wind hin und her wiegen, den Bach entlang, der sich durch ein Marsch- und Moorgebiet windet, hin zu den jenseits davon gelegenen Häusern des Dorfes. Es ist ein schöner Tag, über den Himmel jagen Wolkenfetzen. Die glitzernde Oberfläche des Sees kräuselt sich im Wind. Hinter dem Hotel wird die Gegend felsiger, rauer, steigt in Richtung der Berggipfel immer steiler an, die Hänge durchzogen von reißenden Bächen. Stella schaut nicht oft aus den Fenstern auf der Rückseite.
Sie wendet den Blick wieder der Treppe zu, die auf einer Seite von goldgerahmten Gemälden in trüben, düsteren Farben gesäumt ist. Ein Mann mit buschigem Backenbart funkelt sie an, einen toten Hasen über die Schulter geworfen. Ein schielendes Kind unbestimmten Geschlechts mit einer Schottenmütze auf dem Kopf ist neben einer Harfe abgebildet. Der mottenzerfressene Hirschkopf am oberen Ende der Treppe hängt, wie Stella auffällt, etwas schief.
Sie hält den Brief immer noch in der Hand. Er endet mit Alles Liebe und Gute. Dann die glatt gestrichenen Schnörkel der Unterschrift ihrer Mutter. Alles Liebe und Gute.
Stella reibt ihre Sandalen aneinander und die Schnallen verhaken sich. Sie hat die Finger unter die Oberschenkel geschoben. Sie kaut den letzten Rest der fettigen Wurst und schluckt ihn hinunter. Ihr Teller ist jetzt leer, abgesehen von den Bohnen. Alles andere hat sie aufgegessen. Sie hat äußerst penibel darauf geachtet, sich keine der Bohnen in den Mund zu stecken, hat sie am Tellerrand zusammengeschoben, darauf geachtet, dass sie mit nichts in Berührung gekommen ist.
Zu ihrer Rechten an dem viereckigen Tisch sitzt ihre Großmutter, die Ellbogen aufgestützt, und redet von Beilagentellern. Gegenüber schneidet Nina ihr Essen mit gesenktem Blick in gleichmäßige geometrische Formen. Immer, wenn ihre Mutter wochentags arbeiten muss, hütet ihre Großmutter – ihre schottische Großmutter, die Mutter ihres Vaters bei ihnen ein. »Wer sonst würde euch Abendessen kochen?«, fragt sie in einem Ton, der Stella verrät, dass eine Antwort überflüssig ist. Unter dem Tisch schlängelt sich der Kater ungesehen zwischen Knöcheln und Stühlen hindurch, streicht mit seinem seidigen Fell über Schienbeine.
Stella legt ihr Messer und ihre Gabel, die nicht zusammenpassen, so unauffällig und leise wie möglich aneinander. Die Gabelspitze stößt mit einem ganz leisen Klick gegen das Porzellan, aber vielleicht hat es niemand gehört, und niemand wird etwas bemerken.
»Aber Archie, bestimmt wird einer deiner Kollegen dir dabei helfen können …« Die Stimme der Großmutter verhallt, und es breitet sich Stille aus. Stella hält den Blick fest auf die gleichmäßigen Falten ihres Schuluniformrocks gerichtet. Sie spürt die Gegenwart ihrer Großmutter neben sich, und sie spürt, dass sie zu ihr herüberschaut. Oder, genauer gesagt, auf ihren Teller.
»Willst du die dicken Bohnen denn nicht essen, Kleines?« Die Stimme ihrer Großmutter klingt melodiös, bewusst beiläufig.
Stellas Vater baut die Bohnen in einem Gemüsebeet an, das den anderen Bewohnern des Hauses missfällt, denen Rosen oder Alpenveilchen lieber wären. Stella macht es großen Spaß, die Bohnen zu pflücken, die länglichen, wulstigen Hülsen aus den dichten Blätterkränzen herauszulösen und dann abzuzupfen; es macht ihr großen Spaß, die Hülsen zu öffnen und die makellose Reihe aus Bohnen vorzufinden, eingebettet in eine silbrige Samtschicht. Aber wenn sie von Oma Gilmore über zwanzig Minuten gekocht worden und auf einen Teller gehäuft worden sind, haben sie sich völlig verwandelt: An den Bohnenhälften klebt faltige harte Haut, die beim Kauen quietschend an den Zähnen reibt. Die Bohnen sind trocken und schmecken so ekelhaft, dass einem der Appetit vergeht. Stella bekommt sie beim besten Willen nicht hinunter.
»Nein, will ich nicht«, sagt Stella.
»Wie bitte?«, sagt Oma Gilmore, noch immer in schmerzhaft höflichem Ton.
»Vielleicht –«, unterbricht Stellas Vater sie, aber sie bringt ihn mit einer raschen Geste zum Schweigen.
»Na los.« Oma Gilmore beugt sich hinüber, nimmt Stellas Gabel und schiebt drei von den grünen Dingern darauf. »Probier sie einfach mal. Womöglich schmecken sie dir ja.«
Stella presst die Lippen aufeinander und lehnt sich zurück, als die Gabel sich auf sie zubewegt.
»Mach den Mund auf«
Ein Geruch nach Wachs und Moder dringt ihr in die Nase. Sie schüttelt den Kopf
»Mach den Mund auf, Stella.«
Mit starrem Blick schaut sie die drei Bohnen vor ihrem Gesicht an. Soll sie es wagen? Aber sie stellt sich vor, wie das kühle, feste Gemüse ihre warme feuchte Zunge berührt, wie sich ihre Speicheldrüsen krampfhaft bemühen, beim Zerkauen zu helfen: Sie muss schlucken, und im selben Moment überkommt sie ein Brechreiz. Sie ringt hustend nach Luft. Ihre Großmutter nutzt es offenbar sofort aus, dass sie den Mund öffnet, denn es stößt etwas Metallisches gegen ihre Zähne, und ihr ist, als werde ihr ganzer Mund mit dem gummiartigen Gemüse vollgestopft.
Stella würgt, ihr Mund füllt sich mit beißender Flüssigkeit und die Bohnen fliegen hinaus auf das Tischtuch. Schluchzend legt sie die Hände wie ein Fallgitter vors Gesicht.
»Pass auf« – ihre Großmutter legt ruckartig die Gabel hin – »ich habe nicht vor, mich deswegen mit dir zu streiten. Du wirst so lange sitzen bleiben, bis du deinen Teller leer gegessen hast.« Sie schaufelt die ausgespuckten Bohnen zurück auf Stellas Tisch. »Und das gilt auch für die hier.«
Stella hört ihren Vater etwas murmeln.
»Archie«, ermahnt ihn ihre Großmutter, »sie muss es lernen.«
Durch die Spalte zwischen ihren Fingern sieht Stella, wie ihre Großmutter den Tisch abräumt und wie ihr Vater Nina Wasser nachschenkt. Bei Einbruch der Dunkelheit wird ihre Mutter aus dem Café heimkommen, wird nach Zigarettenrauch, Seifenlauge und Kaffee riechen und eine Packung Gelato di Cioccolata für sie und Gelato di Fragola für Nina mitbringen. Ihr ist hinter ihrem Schutzschild aus Händen inzwischen sehr warm, und die Arme tun ihr weh, aber sie wird sie trotzdem nicht herunternehmen. Sie beobachtet, wie die anderen nacheinander weggehen. Nina wirft ihr beim Aufstehen einen kurzen unverständlichen Blick zu.
Stella löst die Hände vom Gesicht. Es herrscht Schweigen. Ihre Großmutter liest draußen auf einem Gartenstuhl die Zeitung. Sie hört die Geräusche eines Radios. Schritte aus dem Zimmer über ihr. Es kommt ihr so vor, als wären alle anderen Menschen sehr weit weg. Auf der Fensterbank hockt der gestreifte Kater. Zwecklos. Der Kater frisst keine Bohnen. Er schaut nicht einmal auf den Teller. Er hat nicht vor, sie zu fressen.
Dann geht hinter ihr mit einem seufzenden Laut eine Tür auf. Stella dreht sich nicht um. Wer mag das sein? Es ist Nina, sie schleicht ohne Schuhe über den Teppichboden. Stella beobachtet sie, das Gesicht von den getrockneten Tränen ganz steif. Ihre Schwester legt einen Finger auf die Lippen, gerade und deutlich wie ein Ausrufungszeichen.
Nina beugt sich hinunter, streckt die Hand aus und greift nach der Gabel. Sie spießt die Bohnen einzeln auf, sticht ihnen direkt ins Herz. Sie öffnet den Mund, schiebt die Gabel hinein. Kurz darauf kommt sie wieder zum Vorschein, leer und glänzend. Nina kaut schnell und konzentriert und schluckt. Einmal. Zweimal. Dann grinst sie, legt die Gabel hin und huscht aus dem Zimmer.
Im Anfang war Nina. Stella ist sicher, dass Ninas Gesicht das Erste ist, was sie je gesehen hat – jedenfalls ist es das Erste, woran sie sich erinnert. Ihre Mutter erzählte ihnen, Nina habe stundenlang an Stellas Bettchen gestanden und sich über das Gitter gebeugt.
Für Stella waren sie selbst und ihre Schwester lange Zeit ununterscheidbar. Sie dachte, Nina wäre sie oder sie wäre Nina, oder dass sie ein und dieselbe Person, ein Lebewesen wären. Jahrelang glaubte sie, dass es irgendeine Art von Verbindung zwischen ihren beiden Blutkreisläufen gab und sie darum, wenn sie sich schneiden würde, prompt mit ansehen müsste, wie auch aus Ninas Körper eine tiefrote Flüssigkeit austräte.