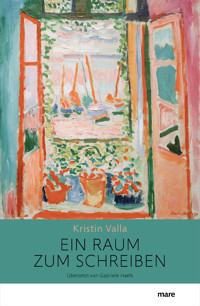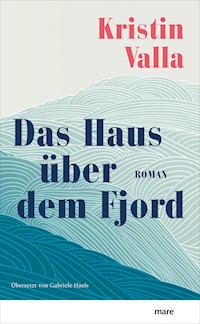
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: mareverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mit Anfang 30 kehrt Elin, die als Journalistin in Oslo arbeitet, in ihr nordnorwegisches Heimatdorf zurück, um nach dem Tod der Mutter ihr Elternhaus aufzulösen. Ihre Kindheit endete jäh, als sie mit zehn Jahren die beiden älteren Brüder und den Vater durch einen Erdrutsch verlor, der ein Stück der Küste ins Meer riss. Während ihres Aufenthaltes trifft Elin ihre Jugendliebe Ola wieder, den besten Freund ihres ältesten Bruders, der sie nach dem Unglück damals auffing und mit dem sie doch nie richtig zusammenfand. Und dann entdeckt sie beim Aufräumen Hinweise auf ein großes Geheimnis ihrer Eltern, das ein ungeahntes Licht auf das Verschwinden ihres Vaters wirft und Elin auf eine Spurensuche bis in ein französisches Dorf führt. Endlich eröffnet sich für Elin die Chance, sich mit ihrer Vergangenheit zu versöhnen und ihren eigenen Weg zu gehen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 364
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Kristin Valla
Das Haus über dem Fjord
Roman
Aus dem Norwegischen von Gabriele Haefs
Die Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel Ut av det blå im Kagge Forlag, Oslo.
Copyright © Kristin Valla 2019
Der Verlag dankt NORLA für die Förderung dieser Übersetzung.
© 2022 by mareverlag, Hamburg
CovergestaltungNadja Zobel, Petra Koßmann / mareverlag
CoverabbildungiStock.com / marukopum
Datenkonvertierung E-BookBookwire
ISBN E-Book: 978-3-86648-811-3
ISBN Hardcover-Ausgabe: 978-3-86648-649-2
www.mare.de
Inhalt
Sommer 1985
Herbst 2007
Frühjahr 2008
Sommer 2008
Sommer 2019
Quickton gibt es nur in den Ländern des Nordens.
Vor mehreren Jahrtausenden, als auf dem Festland das Eis schmolz, wurden Sand und Ton vom Gletscherwasser mitgeschwemmt. Tonpartikel lagerten sich auf dem Meeresboden ab, und das Salz im Meer verband den Ton zu einer festen Masse.
Als das Gewicht der Eismassen verschwand, hob sich die Erde. Der Meeresgrund wurde zur Oberfläche. Der Ton lag dort wie ganz normales Land, auf dem man Felder anlegen, Tiere halten, Häuser bauen konnte. Auf dem Getreide und Wälder wuchsen. Auf dem Kühe grasten. Die Menschen lebten gern in dieser grünen Umgebung mit Blick aufs Meer.
Die Zeit verging. Tausend Jahre, dann weitere Jahrtausende. Das Salz, das den Ton gebunden hatte, wurde langsam von Regen und Grundwasser ausgespült. Ein Kartenhaus, so würden die Forscher es später beschreiben, so verletzlich, dass schon die geringste Überbelastung oder äußere Einwirkung den Ton in Bewegung setzen könnten.
Aber das wussten die Menschen nicht. Sie kamen nicht auf den Gedanken, dass der Erdboden unter ihnen verschwinden könnte. Sie lebten ihr ganz normales Leben. Bestellten den Boden. Bauten Häuser. Legten Gärten an.
Die Menschen hatten es gut, dort oben auf dem Ton.
Sommer 1985
Wir hatten es schon länger knallen hören. Seit einigen Wochen wurde unten am Sørfjord gearbeitet, abends wurde gesprengt, tagsüber gegraben, gewaltige Maschinen, die die Steinmassen zum Ende des Strandes beförderten.
Nach und nach hatten wir uns daran gewöhnt. Schliefen meistens sogar dabei ein. Die E6 sollte nicht mehr durch den Ort führen, wie sie es immer getan hatte, vorbei an Geschäften und Postamt und dem Bahnhof, wo zweimal am Tag die Nordlandsbahn hielt, jetzt sollte ein Tunnel quer durch das Gebirge führen, das würde Zeit sparen. Acht Minuten, hatte ich gehört.
Sie seien jetzt fast fertig, sagte Mama, sie hatte unten bei Seljelids angerufen, um sich zu vergewissern, dass die alte E6 noch immer offen war, eine letzte Sprengladung, dann wären sie durch. Sie stand auf der Veranda und hielt Ausschau nach Papa, mit der Hand schirmte sie die Sonne ab, sie wirkte besorgter als sonst, fast ängstlich. Ich verstand nicht, was sie so nervös machte. Er verspätete sich nicht zum ersten Mal. Sicher redete er noch mit irgendwem, das passierte ihm häufiger, er blieb sozusagen an den Leuten hängen.
Sie stellte uns immer Aufgaben, wenn sie in dieser Stimmung war. Vegard stand im Flur und bügelte sein Hemd, Thomas machte Ordnung im Spielzimmer, sammelte alles vom Boden auf und stopfte es in die Kisten, bis sich die Deckel nicht mehr schließen ließen. Es war sinnlos, jetzt damit anzufangen, fand ich, wir wollten doch los.
Mich hatte Mama in die Badewanne gesteckt. Ich sollte mir die Haare waschen, das war meine Aufgabe. Nicht dass sie schmutzig gewesen wären, ich hatte sie schon am Vorabend gewaschen und gekämmt, es war wegen des Festes. Das Sommerfest war das gleiche wie im letzten Jahr und auch im vorletzten Jahr, Papas Vetter in Bjerka lud ein, in seinem Garten wimmelte es unter den Birken von Verwandtschaft. Ich klatschte mir einen dicken Schaumklecks mitten auf den Kopf und grinste Vegard an, der in der Badezimmertür stand.
»Du siehst total bescheuert aus«, sagte er.
»Selber bescheuert«, sagte ich.
Mama kam herein und nahm die Handbrause, sie trug noch immer ihren Morgenrock, hatte immer Angst, nass zu werden. Sie richtete den Strahl auf meinen Kopf, wie üblich hatte sie vergessen, eine Hand ins Wasser zu halten.
»Au, das brennt!«
»Ist es jetzt besser?«
»Kälter.«
»So?«
Als ich kleiner war, hatte ich immer geschrien, weil sie an meinen Haaren ziepte, aber daran hatte ich mich jetzt gewöhnt. Sie schaffte es einfach nicht anders.
»Thomas? Bist du angezogen?«, rief sie in den Flur hinaus.
»Du hast gesagt, ich soll aufräumen.«
»Dazu haben wir keine Zeit. Du musst dich waschen und dich anziehen.«
»Dann sag doch nicht, dass ich aufräumen soll. Herrgott noch mal!«
Thomas kam herein und spritzte sich Wasser auf die Brust. Er nahm Deo, es roch wie das, was Vegard benutzte. Mama besorgte die Deos bei Sara im Laden, bei Sachen, die für uns bestimmt waren, kam es nicht so drauf an. Für sich selbst kaufte sie dort nie irgendetwas.
Ich zog den Stöpsel aus der Badewanne und stand auf. Mama trocknete mich mit steifen Bewegungen ab.
»Eine halbe Stunde, dann fahren wir«, sagte sie.
»Aber Papa ist noch nicht da«, sagte ich.
Mama seufzte.
»Wir müssen es noch mal im Büro probieren.«
Sie hatte wie immer für alle Sachen zum Anziehen herausgelegt. Hemd und Hose für Vegard und Thomas, ein Kleid für mich. Vegard und Thomas durften etwas anderes tragen, wenn ihnen das Bereitgelegte nicht gefiel, für sie kaufte Mama nichts mehr, ohne vorher zu fragen. Bei mir war das anders.
»Das da?«, fragte ich und zeigte auf das Kleid, das am Schrank hing.
»Stimmt damit etwas nicht?«
»Das ist für Babys.«
»Ist es nicht. Schau her. Größe: zehn Jahre. Und wenn mich nicht alles täuscht, bist du zehn.«
»Muss ich ein Kleid anziehen? Kann ich nicht in Hose und Hemd gehen, wie Vegard und Thomas?«
»Wir wollen auf ein Fest.«
»Auf ein Sommerfest. Da wollen wir doch spielen.«
»Du ziehst ein Kleid an.«
Zehn Minuten später sah ich das Auto in der Auffahrt. Papa stellte den Kombi dicht vor der Gartenmauer ab, nahm den Diplomatenkoffer vom Beifahrersitz und schaute zum Fenster im ersten Stock hoch. Ich hatte nicht das Gefühl, dass er mich dort sah. Vielleicht blendete die Sonne zu stark.
Vom Treppenabsatz aus konnte ich beobachten, wie die Haustür geöffnet und wie der Diplomatenkoffer in den Flur gestellt wurde. Papa lächelte Mama an, als sie die Treppe hinunterkam, wobei ihre Hand auf dem leicht abgerundeten Geländer ruhte. Sie war fertig geschminkt und hatte sich die Haare zu Locken gedreht. Blonde, leichte Wellen fielen auf ihre Schultern.
»Ich hab im Büro angerufen«, sagte sie. »Da hieß es, du seist vor vierzig Minuten gefahren.«
»Bin ich auch«, sagte Papa.
Mehr sagte er erst, als Mama zu ihm ging und sich an ihn lehnte, sein Mund lag dicht an ihrem Ohr, während sie redeten. Ich hörte nicht, was sie sagten, duckte mich jetzt hinter das Treppengeländer, wollte eigentlich nicht von ihnen gesehen werden. Papa legte die Arme um Mama. Für einen kurzen Augenblick durchlief ein Zittern Mamas Körper. So standen die beiden eine Weile da, die Köpfe aneinandergelegt, sie hatten sich nicht wie sonst mit einem Kuss begrüßt. Dann löste sich die Umarmung auf.
»Da sitzt du also, Elin?«, fragte Papa und zwinkerte mir zu.
»Du kommst aber spät«, sagte ich und lief zu ihm nach unten.
»Ich weiß«, sagte er. »Machen wir also, dass wir fertig werden, damit wir losfahren können?«
Das Kleid war in London gekauft worden, und es war mit blauen Blümchen und Sternchen bestickt. Unten am Rocksaum gab es eine dunkelblaue Kante, in der Mitte saß ein Gürtel, der sollte um die Taille gebunden werden, obwohl alle wussten, dass ich keine Taille hatte. Mama musste sich ein anderes Mädchen vorgestellt haben, als sie im Laden stand.
»Das passt nicht«, sagte ich.
»Tut es wohl«, sagte sie.
»Das zieh ich nicht an.«
»Tust du wohl.«
»Aber es ist zu kalt.«
»Dazu gehört eine Strickjacke. Schau mal.«
Ich streifte mir das Kleid über den Kopf, konnte den Reißverschluss mit eigener Hand bis fast nach ganz oben hochziehen. Am Ende zog ich die Strickjacke über, und dann betrachtete ich mich. Das Kleid hatte schön ausgesehen, als es auf dem Bett lag, aber jetzt, als ich es anhatte, war es nicht mehr schön. Das Kleid machte mich ganz plump. Ich stand da und schwoll förmlich vor dem Spiegel an. Mama musste begreifen, dass ich so nicht herumlaufen könnte, wie eine Puppe, die niemand anfassen durfte.
Ich lief in ihr Schlafzimmer und warf die Strickjacke aufs Bett.
»Hier. Nimm das blöde Ding.«
»Was soll das denn heißen, Elin?«
Papa stand in der Tür zur Ankleidekammer. Er trug eine helle Baumwollhose, auf dem Bett lag ein Pullover, der war für später, falls es kalt würde.
»Sie schmollt, weil ich ihr ein reizendes Kleid gekauft habe, das sie jetzt anziehen muss«, sagte Mama.
»Ich zieh das nicht an«, sagte ich.
»Das tust du wohl.«
»Nein.«
»Was willst du denn anziehen, Elin?«, fragte Papa.
»Das Gleiche wie Vegard und Thomas. Hose und Hemd.«
»Du hast aber keine schöne Hose«, sagte Mama.
»Hab ich wohl.«
»Wenn du auf das Fest gehen willst, dann ziehst du das Kleid an, und dabei bleibt’s.«
»Dann bleib ich eben zu Hause, du blöde Kuh.«
Mamas Augen sprangen auf wie zwei Deckel, sie konnte nicht einmal reagieren, da stand schon Papa vor mir, packte meinen Arm und drückte zu.
»So redest du nicht mit deiner Mutter. Ist das klar?«
»Okay.«
Etwas musste in letzter Zeit mit seiner Hand passiert sein, das merkte ich jetzt. Sie war schwächer, weniger gefährlich. Oder vielleicht war ich einfach größer und stärker geworden.
»Bitte Mama um Entschuldigung.«
»Entschuldigung.«
»Elin! Ernsthaft bitte!«
»Ent-schul-di-gung.«
Ich ging in mein Zimmer und verkroch mich im Bett. Zog mir die Decke über den Kopf und blieb so liegen.
»Warum liegst du im Bett?«, fragte Vegard vom Flur her.
»Ich bleibe zu Hause.«
»Echt jetzt? Mama, bleibt Elin zu Hause?«
»Natürlich nicht.«
»Das sagt sie aber!«
Jetzt stand Mama in der Tür. Ihr Parfüm schwebte durch die ganze Etage. Sie war abfahrtbereit, ihr Kleid war neu, ich konnte mich jedenfalls nicht erinnern, es schon einmal gesehen zu haben. Sie hatte Perlen in den Ohren und flache Schuhe, die Gras vertragen konnten, einen wogenden Sommerhut. Noch aus der Ferne würde man deutlich sehen können, dass sie es war.
»Jetzt reicht es aber, Elin. Zieh die Jacke an. Ich weiß doch, dass du dich auf heute Abend gefreut hast.«
»Du hast gesagt, ich könnte zu Hause bleiben.«
»Das kannst du natürlich nicht. Du bist erst zehn.«
»Ich bleibe zu Hause.«
Sie kam zum Bett marschiert, packte mich und zog mich heraus. Hielt mich fest, als ob sie Angst hätte, sich an mir zu verletzen, es ging hier nicht um mich, sondern um ihre Kleider, die konnten nicht viel vertragen. Ich riss mich los, ließ mich auf den Boden fallen und versuchte, mir das Kleid vom Leib zu reißen, aber der Stoff war viel fester, als ich erwartet hatte. Ein Knopf platzte ab und kullerte in eine Ecke. Am Ende brachte ich einen Riss zustande. Ich sah, wie Mama in sich zusammensank, sie war so hübsch und zerbrechlich, wie sie dort stand.
»Na gut«, sagte sie. »Wir bleiben zu Hause.«
»Das ist nicht dein Ernst, Wenche«, sagte Papa.
»Ich hab wirklich keine Nerven dazu, sie mitzunehmen.«
»Können wir das Kleid nicht einfach vergessen? Lass sie doch eine Hose anziehen, wenn sie das so gern möchte.«
»Das tu ich nicht, Bjørn. Dann lernt sie nichts. Sie darf nicht einfach ein nagelneues Kleid zerreißen, um ihren Willen durchzusetzen, und doch auf das Fest gehen. Wir bleiben hier. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen.«
»Dann lass lieber mich zu Hause bleiben. Du hast dich doch auf das Fest gefreut.«
»Das ist deine Familie.«
»Es ist auch deine.«
»Sie erwarten, dass du kommst. Ich finde, du musst hinfahren. Gerade dieses Jahr vielleicht.«
Papa seufzte. Er streckte eine Hand aus und berührte Mamas Wange. Wie ein kleiner Vogel ließ sich die Hand dort nieder, leicht und freundlich.
»Na gut«, sagte Papa. »Ihr bleibt hier.«
Ich saß am Fenster und sah sie losfahren. Papa, Vegard und Thomas im Kombi, mit leerem Beifahrersitz und noch Platz auf der Rückbank. Sie sagten nicht einmal Tschüs, meine Brüder, sie sahen mich nur resigniert an, während sie ihre Jacken nahmen und sich brav ins Auto setzten, wie ihnen befohlen worden war. Sie erlebten das hier nicht zum ersten Mal. Sie hatten meine Ausbrüche satt, hatten es satt, dass sich alles immer um mich drehte, dass ich mich breitmachte und mehr Platz einnahm, als mir zustand.
Das Kleid lag noch immer auf dem Boden. Mama dachte wohl, es könnte nicht geflickt werden. Sie hatte ihre guten Sachen jetzt ausgezogen, ich hörte sie in der Ankleidekammer, Schranktüren, die zufielen, die Perlen, die mit leisem Knall auf der Glasplatte des Toilettentisches auftrafen. Ich kletterte auf den Schreibtisch und schaute aus dem Fenster, hinüber zur Fabrik, wo Opa gearbeitet hatte, zweimal in der Woche kam ein Schiff in den Sund und legte am Kai an, große Schiffe mit fremden Namen, die auftauchten und wieder verschwanden. Unterhalb der Böschung verlief die E6, südwärts nach Mosjøen und nordwärts nach Mo, jetzt waren dort keine Autos zu sehen. Ich überlegte, wie weit es wohl bis Bjerka war. Fünf Minuten mit dem Auto. Vielleicht eine Stunde zu Fuß.
Unten im Kleiderschrank fand ich ein Paar hellbraune Turnschuhe, die Mama mir per Postversand gekauft hatte. Ich packte eine Windjacke und die Sitzunterlage in den Rucksack, schlich mich vorbei an der Tür zum Wohnzimmer, wo Mama saß, das Licht des Fernsehers im Gesicht, und schlüpfte aus dem Haus, ehe sie irgendetwas bemerkte. Schlug den Weg durch den Wald ein, den, den Vegard, Thomas und ich als Abkürzung nahmen, wenn es trocken war, über die Eisenbahnbrücke, vorbei an den Häusern, die die Arbeiter der Nordlandsbahn aus dem Boden gestampft hatten, diese Häuser waren schlicht und viereckig, wie große Milchkartons am Straßenrand. Unten lagen die Läden mit geschlossenen Türen. Der Supermarkt rechts, Seljelids links, dazwischen Post und Bankfiliale. Das, was wir Zentrum nannten. Wenn wir das sagten, bekamen Leute von auswärts immer einen Lachanfall.
Oben am Hang legte ich eine Pause ein. Schaute zum Wasser hinab, das sich ausbreitete, mit Felseninselchen und Freizeitbooten wie Farbtupfer in Strandnähe. Es gab Postkarten von unserem Dorf, auf denen es wunderschön zwischen Sørfjord und Nordfjord lag, ein Streifen Land mit verstreut stehenden Häusern, der die Hemneshalbinsel mit dem Festland verband. Ganz innen in der Bucht lag der Badestrand, offen und mit seichtem Wasser, fast tropisch, wenn es nicht immer zu kalt zum Baden gewesen wäre. Wir saßen dort an heißen Sommertagen, machten es uns mit Klappstühlen und Campingtisch bequem, manchmal kamen auch Touristen, sie glotzten und schnappten nach Luft, wenn sie aus ihren Autos stiegen, sie fotografierten aus allen Winkeln, ehe sie ihre Kühltaschen holten und sich auf den grauen, trockenen Holzbänken niederließen, die schon immer dort gestanden hatten.
Am Ende des Strandes ruhten die Bagger mit gesenkten Köpfen. Sowie sie fertig wären, würde die alte E6 wieder zur Landstraße werden, ich dachte, dass sie immer ausgesehen hatte wie eine Landstraße, auch mit einem anderen Namen. Sie schlängelte sich am Fjord entlang, verschwand hier und da in kurzen Tunneln, die nur ein Moment der Dunkelheit waren, wenn man hindurchfuhr. Ich folgte ihr mit dem Blick bis Berg, vorbei an dem schleimigen Brackwasser bei Bergsbotn, über die Brücke nach Bjerka, dann hoch zu der Wohnsiedlung, wo das Gartenfest stattfand. Ich wusste eigentlich nicht so genau, wo Papas Vetter wohnte. Ich achtete nie auf den Weg, wenn wir hinfuhren. Aber ich begriff nun, dass es viel weiter war, als ich geglaubt hatte.
Die Sonne hing schwer über dem Hügelkamm. Lag dort wie ein Zierband, warf einen rostigen Schein über das Gras am Straßenrand. Ich merkte, wie müde ich war, erschöpft vom Tragen des Rucksacks, obwohl ich doch kaum etwas eingepackt hatte. Es wäre nicht feige, jetzt kehrtzumachen. Niemand wusste, wo ich war, es brauchte mir nicht peinlich zu sein. Ich ließ den Sørfjord hinter mir und fing an, den Hang wieder hochzusteigen, zurück zu meinem Bett, zu der dünnen Sommerdecke, die ich über mich breiten konnte, sie war gerade warm genug. Ich konnte auch gleich ins Bett gehen. Die Nacht würde einen Schlussstrich unter diesen Tag ziehen. Wenn man wach wurde, hatten die Erwachsenen alles vergessen, was gewesen war. Dann konnte man einen neuen Anfang machen.
Mama saß im Wohnzimmer und sah den Fernsehkrimi. In Miami trug die Polizei Anzüge, die aussahen wie Pyjamas, sie trugen keinen Gürtel und waren barfuß in den Schuhen, die Pistole hing innen in der Jacke, an etwas, das aussah wie Zaumzeug. Ich schlich mich zum Geräusch von quietschenden Bremsen und Pistolenschüssen die Treppe hoch, zog mich aus und verkroch mich unter der Decke, warf einen Blick auf den Wecker. Ich war eine Stunde unterwegs gewesen. Mama hatte rein gar nichts mitbekommen.
Ich merkte, dass ich Durst hatte, nahm mein Glas und ging barfuß durch den Flur. Auf dem Weg ins Badezimmer spürte ich ein schwaches Zittern im Boden. Ein Beben unter meinen Füßen, als ob sich das ganze Haus schüttelte. Es war kein Grund zur Besorgnis, es knallte immer um die Zeit, zu der ich schlafen ging, ein hohles Dröhnen tief im Fels.
Es kam kein Wasser aus dem Hahn. Nur ein gurgelndes Geräusch tief unten in der Leitung, als ob jemand dort unten Atem holte. Ich versuchte es mit der Badewanne, ein kleiner Rest sickerte heraus, dünn und klar, gerade genug für ein Glas. Ich dachte, ich müsste vielleicht Mama Bescheid sagen, aber sie konnte es selbst merken, das Wasser verschwand nicht zum ersten Mal. In meinem Zimmer schlug das Fenster hin und her. Regenschwere Wolken zogen sich am Himmel zusammen und tauchten die Wände in Dunkelheit, als ob irgendwer die Vorhänge zugezogen hätte. Es fing an zu regnen. Gleichmäßiger, sanfter Regen fiel auf Rasen und Blumenbeete, klopfte gegen die Dachrinne, spielte unten in der Schubkarre kleine Melodien.
So schlief ich ein, mit einem halb vollen Glas neben mir auf dem Nachttisch, in der letzten Nacht, in der ich einfach ein Kind war.
Die Halde hinten am Strand, wo die gesprengten Gesteinsmassen abgelagert worden waren, verschwand als Erstes. Sie stürzte ins Wasser, als sich der Boden darunter auflöste, zu einer dünnen Masse zerfloss. Dann folgte der Strand. Die Bäume am Ufer. Der tote Stamm, von dem wir sprangen, wenn wir mutig waren. Der Tanggürtel unten am Wasser, der auftauchte, wenn sich die Flut zurückzog, es dauerte einige Minuten, dann hatte der Fjord alles verschlungen.
Wenn die Leute den Erdrutsch beschrieben, sprachen sie über das Rauschen der Wassermassen, die gegen das Land schlugen, über das Kreischen der Leitplanke, die zerrissen wurde und nach unten kippte. Über Häuser, die von den Tonmassen auf dem Rücken getragen wurden, ehe sie mit dem Schornstein unter Wasser liegen blieben, die E6, die zerbrach und sich wie ein gewaltiger Schlund aufbäumte, ehe sie ins Wasser fiel. Die Bremsgeräusche des schwarzen Autos, das aus dem Tunnel gefahren kam und einen Moment lang in der Luft schwebte, ehe es in die Wellen stürzte und versank.
Aber sie sprachen auch über die Stille danach.
Den Fjord, der sich blank und freundlich über die Tonmassen legte, als sei nichts geschehen.
Meine Brüder wurden im Wasser gefunden. Sie trieben zwischen Trümmerteilen und Asphaltfetzen, in ihren guten Kleidern, Hemd, Hose und Schuhen, beim einen alles eine Nummer größer als beim anderen. Die Suchmannschaften, die sie aus dem Wasser zogen, hatten Vegard und Thomas schon als kleine Kinder gekannt, mussten sie nicht einmal umdrehen, um zu wissen, wer sie waren. Sie wurden auf eine Trage gelegt und gegen Morgen ins Krankenhaus gefahren, schon nach wenigen Stunden wurden beide für tot erklärt. Nicht einmal, als wir informiert wurden, haben wir das begriffen, glaube ich. Wir saßen einfach dort auf dem kalten, hellen Gang, Mama und ich, so still wir nur konnten. Der Lensmann ging vor ihr in die Hocke, sie sagte nichts, rieb nur die Hände aneinander, rieb und rieb, als wären sie Silberbesteck. Ich fragte ihn, ob sie Papa gefunden hätten. Er sagte, das nicht, aber sie hätten eben erst mit der Suche angefangen, es sei noch früh und es gebe noch Hoffnung genug.
So sagte er das. Hoffnung genug, als wäre Hoffnung etwas, das man abwiegen und in passenden Portionen verteilen könnte.
Eine Woche später wurden Vegard und Thomas begraben. Die Särge wirkten klein und kompakt, sie verschwanden fast unter den vielen Blumengestecken. Vegard und Thomas wurden auf dem Friedhof von Bjerka beerdigt, mit Blick auf den Fjord, der sie an sich gerissen hatte, in einer Ecke des Friedhofs, wo der Wind nicht ganz so stark tobt. Ihre Namen bedeckten nur Teile des Grabsteins. Es war noch Platz für weitere. Am Ausgang des Friedhofs standen die Presseleute mit Kameras und Notizblöcken, machten sich ab und zu kurze Notizen. In der Kirche hatte der Bürgermeister über die unfassbare Tragödie gesprochen, die unser Dorf heimgesucht hatte, und über den unmenschlichen Verlust, den sie verursacht hatte, einer der schlimmsten Erdrutsche in der Geschichte Norwegens, hatte er gesagt. Auch im Radio hatte ich diesen Satz von ihm gehört, einer der schlimmsten in der Geschichte Norwegens, seine Stimme war gepresst gewesen, als er das sagte, aber es hatte noch etwas anderes darin gelegen, eine Art Stolz.
In der folgenden Zeit suchten die Hilfsmannschaften nach Papa. Sie gingen mit Spaten und Taschenlampen am Strand entlang, suchten den Meeresboden mit Mini-U-Booten ab, aber die Sicht dort unten war miserabel, denn der Ton hatte alles grau gefärbt. Selbst für die Taucher waren die Verhältnisse in dem trüben Wasser fast unmöglich. Dennoch machten sie weiter, tagein, tagaus, obwohl allen klar war, dass es keinen Sinn mehr hatte, dass sie es nur taten, um uns zu trösten. In den Nachrichten wurde über die Ursachen des Unglücks gesprochen: die Sprengarbeiten, die in diesem Frühjahr ausgeführt worden waren, das Gewicht der Steinmassen am Ufer, den Strom von Lastwagen, der viele Jahre lang von Norden und von Süden gekommen war.
Einige Wochen später wurde uns der Totenschein gebracht. Ein kleines Stück Papier, das uns mitteilte, die Suche sei beendet worden und Papa müsse als umgekommen gelten. Ich saß auf der Treppe und hörte den Lensmann mit Mama reden, sie widersprach nicht, als er das sagte, sie nickte nur und nahm den Totenschein, als wäre der ein ganz normales Dokument. Es könne passieren, sagte der Lensmann, dass jemand nicht gefunden wurde, dass die Natur selbst diese Menschen begrub, auch darin liege eine Art Trost. Papa habe diese Landschaft geliebt, sagte der Lensmann. Nun sei er selbst zu einem Teil davon geworden. Ich saß da und fragte mich, was mit Menschen passierte, die im Meer blieben. Lösten sie sich auf? Trieben sie dicht unter der Oberfläche umher? Oder sanken sie in die Tiefe und blieben dort unten?
Als ich größer wurde, war es leicht für mich, das alles in Erfahrung zu bringen. Menschen können viele Jahre lang im Ton liegen. Sie verschwinden nicht, denn der Ton konserviert den Körper, sorgt dafür, dass er nicht verwest und zu Erde wird. Papa war unversehrt. Er war noch immer dort unten. Aus irgendeinem Grund half es mir, das zu denken. Es kam vor, dass ich am Wasser entlangging und nach Papa Ausschau hielt, an den Rändern des alten Erdrutschgeländes, in der zerfetzten Landschaft, in der ich mich nicht mehr auskannte, in der ich aber doch gern war, weil sie allem ähnelte, was in mir lag. Einige Male lieh ich mir ein Boot und ruderte auf den Fjord hinaus. Die Wellen streichelten freundlich den Bootsrumpf, verrieten nichts davon, was sich dort draußen zugetragen hatte. Ich dachte an meine Brüder, daran, dass sie für mich bereits undeutlich wurden, so, wie sie es in jener Nacht wohl im Ton geworden waren, hinausgesaugt durch das Autofenster, in die Wellen, ehe sie aufgetrieben waren.
Vegard und Thomas trieben auf. Das alte Ehepaar, das dicht beim Strand gewohnt hatte, trieb ebenfalls auf.
Nur Papa sank, kam nie an die Oberfläche, hatte etwas in sich, das ihn schwer machte.
Herbst 2007
Das Haus zu verkaufen beschloss ich zwei Jahre nach Mamas Tod. Eigentlich hatte ich es nach der Beerdigung ausräumen wollen, aber dann hatte ich es doch nicht über mich gebracht, denn Mama hatte niemals etwas weggeworfen, das Haus war vom Keller bis zum Dachboden voll. So war es geblieben, seit dem Tag, als sie vom Krankenwagenpersonal hinausgetragen und zum Krankenhaus von Rana gefahren worden war, dem Krankenhaus, in dem sie mich geboren hatte, ihr drittes Kind, bei einer Geburt, die eine ganz normale Niederkunft hätte werden sollen, die das aber nicht wurde, weil ich so groß war. Das erzählte sie gern, wie groß ich gewesen war; dass die Hebamme mir die Schulter brechen musste, um mich herausziehen zu können, denn wenn sich die Nabelschnur verfangen hätte, hätte die Lage kritisch werden können, möglicherweise Gehirnschaden, schlimmstenfalls Tod. Eine Schulter ist nicht so schlimm, erklärte die Hebamme Mama, so kleine Kinder haben noch keine Knochen, nur Knorpel. Kleine Kinder vertragen so was. Die heilen von selbst.
Ich hatte mich für die Fahrt in den Norden mehr geschminkt als sonst. Bei der Autovermietung standen Leute in Funktionsjacken und Turnschuhen, es war nicht schwer, besser auszusehen als andere. In der Regel passierte es hier, bei dem kleinen Terminal in Bodø, oder in der Ankunftshalle von Mo, dass mir Leute begegneten, die ich seit mehreren Jahren nicht mehr gesehen hatte, Menschen aus einer entfernten Vergangenheit, die mich mit einer Handbewegung anhielten und mich in alles hineinzogen, was ich verlassen hatte. Wie geht es dir, fragten sie dann immer, dieses geht mit einer Andeutung, dass es nicht zwangsläufig besonders gut gegangen war, nicht bei dieser Ausgangssituation, die halbe Familie weggerissen, erst zehn Jahre alt, muss man sich mal vorstellen. Ich wollte, dass es so aussah, wie ich dort stand, mit meiner teuren Handtasche, meinem geraden Pony, als ob ich gut zurechtgekommen wäre, als ob ich es geschafft hätte. Während ich redete, musterten sie mich, meine Kleidung, und ich begriff, dass ich mich auf eine Weise angezogen hatte, die sie glauben ließ, was ich sagte.
Auf dem Parkplatz stand der Mietwagen, vollgetankt und mit gestaubsaugten Sitzen. Ich fuhr in Richtung Stadt, vorbei am Wasserfall Ildgrubfossen, der sich tollkühn in den Ranafjord stürzte; das alte Transportband, das wie ein Gürtel über den Wassermassen lag, ließ die ganze Stadt aussehen wie eine Fabrik. Mo i Rana war mit Stiefmütterchen in ein Beet geschrieben. Beim Hotel Meyergården stand das alte hölzerne Vorratshaus wie eine Kuriosität auf dem Parkplatz.
»Hallo, Elin, da bist du ja.«
Nina beugte sich in ihrer blauen Uniform über den Tresen. Die Jacke war ihr ein bisschen zu groß, ich dachte, die sei sicher für eine andere genäht worden, ein Standardmaß, mit dem die gesamte Hotelkette operierte. Ihr Gesicht war noch so rund wie früher, die Sommersprossen gerade sichtbar, auch der Mund klein und rund.
»Ich hab deinen Namen auf der Gästeliste entdeckt«, sagte sie. »Wir haben dich ja lange nicht mehr gesehen.«
»Ja, ich bin nicht mehr so oft hier oben.«
»Seit Wenches Beerdigung nicht mehr, oder?«
Wir hatten die Gedenkfeier für Mama in diesem Hotel abgehalten. Nina hatte für alles gesorgt, ich hatte keine weiteren Feierlichkeiten dieser Art bei uns zu Hause ertragen können. Rita hatte ihre Hilfe angeboten, sie hatte immer bei uns geputzt, kannte jeden Winkel und jede Nische, hatte sich auch dann noch um alles gekümmert, als Mama schon allein gewesen war. Jetzt stand ihre Tochter vor mir und bediente mich. Ninas Finger waren lang und schlank, sie flogen über die Tastatur, als sie meine Buchung heraussuchte.
»Du wohnst also nicht zu Hause?«
»Nein, ich will das Haus verkaufen. Deshalb bin ich hier. Ich will ausräumen und ein letztes Mal sauber machen.«
»Ja, das ist wohl das einzig Vernünftige.«
»Ich wohne jetzt in Oslo. Und es muss ja renoviert werden.«
»Das habe ich gehört. Das Dach ist undicht, richtig?«
»In dem einen Schlafzimmer.«
»So was lässt sich ja wohl reparieren. Das ist dann die Sache der neuen Besitzer.«
Typisch, dass Nina von den Wasserschäden wusste. Es war durchaus möglich, dass über unser Haus getratscht wurde, um das sich niemand kümmerte, das nur dastand und mit Regenwasser volllief, ganz und gar sich selbst überlassen. Die undichte Stelle war in meinem alten Kinderzimmer. Auch darüber war Nina bestimmt informiert.
»Du wolltest ein Zimmer im alten Gebäude, nicht wahr? Du weißt, dass die Zimmer da kein eigenes Bad haben?«
»Ja, das weiß ich.«
»Das ist deine Entscheidung. Ich habe ein gemütliches Zimmer für dich, mit Aussicht auf den Park. Zehn Tage, ja?«
»Ja. Wenn ich nicht vorher fertig werde.«
Ich schaute in den ältesten Teil des Hotels hinüber, es war eines der wenigen schönen Gebäude in Mo. Die Villa im Schweizer Stil stammte aus der Zeit vor der Eisenhütte, ehe sich Industrie und Bevölkerungszustrom in die alte Hausbebauung hineingefressen und den früher einmal bis zur Eisenbahn reichenden englischen Park verschlungen hatten. Dort lag jetzt Peppes Pizza. Neubau mit Konferenzsaal.
Von der Rezeption aus war die Treppe zum alten Teil gerade noch zu sehen, breit und majestätisch, es machte etwas mit einem, wenn man sie hochstieg. Ich glaubte nicht, dass Nina das begriff, das war das Schöne an der Sache.
»Frühstück gibt es zwischen sieben und neun«, sagte Nina. »Aber das weißt du bestimmt, du bist ja nicht zum ersten Mal hier.«
Sie reichte mir die Schlüsselkarte, warf einen Blick auf meinen Mantel, fragte sich vielleicht, woher der stammte.
»Wir haben übrigens deine Zeitschrift im Abo«, sagte sie und zeigte auf das Gestell vor dem Tresen. »Ich musste lange quengeln, bis der Chef das erlaubt hat. Er findet sie zu oberflächlich.«
»Das ist sie ja auch. Ich meine, es ist schließlich eine Modezeitschrift. Wir versuchen gar nicht erst, es als etwas anderes auszugeben.«
»Nein, natürlich.«
Sie zog eine Schublade heraus und suchte darin nach etwas.
»Du bist sicher viel auf Reisen«, sagte Nina. »Sitzt bei Modenschauen in der ersten Reihe und so.«
Ich lächelte.
»Wir sind nur ein kleines Magazin aus Norwegen. Wir sitzen ziemlich weit hinten.«
Sie sah mich einen Moment lang an, ehe sie einen Parkschein ausstellte, den ich hinter die Windschutzscheibe legen könnte, wenn ich Zeit hätte. Sie sprach noch immer mit breitem Akzent, hatte sicher nirgendwo anders gewohnt, mir war das jedenfalls nicht zu Ohren gekommen. Als ich mit Nina sprach, nahm auch ich den Dialekt wieder an. Die Wörter quollen in meinem Mund auf, wurden groß und üppig, erzählten allen, woher ich kam.
»Was macht Stian?«
»Dem geht’s gut. Er arbeitet jetzt hier in Mo in der Bank. Er wurde hierher versetzt, als die Filiale in Finneide stillgelegt wurde.«
»Ihr seid noch immer zusammen?«
»Verheiratet«, sagte Nina und hob einen Finger mit einem weißgoldenen Ring. »Wir haben letztes Jahr ein Kind bekommen.«
»Gratuliere. Das wusste ich gar nicht. Wie geht es denn Rita? Und Frank?«
»Gut, Papa tritt jetzt ein bisschen kürzer im Schmelzwerk. Hat vor allem Tagschichten.«
»Grüß die beiden bitte von mir.«
»Du kannst doch mal zum Essen kommen, wenn du Lust hast?«
Ich sah Nina an. Dachte daran, wie oft sie mich zu sich nach Hause eingeladen hatte, als wir Kinder waren, in die Zimmer, wo der Zigarettenqualm dick über den Ledermöbeln lag, zusammen mit dem Bratendunst aus der kleinen, praktischen Küche, wo Rita Schellfischfrikadellen briet und wo Frank auf einem Hocker saß und Kippen drehte. Was es bei ihnen zu essen gab, mochte ich nie. Es hatte etwas Ärmliches, gekochte Kartoffeln, geriebene Möhren, die nach nichts schmeckten.
»Ja, das wäre nett.«
»Wie wäre es Mittwoch?«
»Lass uns das im Auge behalten. Bis dahin sehen wir uns ja noch.«
Ich hatte Zeit genug, um eine Entschuldigung zu finden. Ich musste trotz allem ein ganzes Haus ausräumen, es stand nicht fest, dass ich Zeit haben würde, um Besuche zu machen. Ich zog meinen Rollkoffer durch das Foyer, das mit Elchköpfen und Schwertern gefüllt war, durch den Gang, wo die Wandtäfelung aus Mahagoni hinter schweren Lackschichten glänzte, schloss meine Zimmertür ganz hinten auf. Ein Kronleuchter hing an einer schlichten Rosette über dem Bett. In einer Ecke waren ein Waschbecken und ein Spiegel angebracht. Ich ging zum Fenster und schaute hinab auf den Park, wo ein Gärtner damit beschäftigt war, unter einer Hängebirke ein Loch auszuheben. Alles um mich herum war schwer vor Geschichte, aber es war nicht meine Geschichte, und das machte alles leichter.
Wenn jemand fragte, woher ich komme, nannte ich immer den Namen unseres Dorfes und erklärte, wo es lag. Manchmal sagte ich Mo i Rana, das war ein Ort, von dem die meisten schon gehört hatten, aber eigentlich kam ich aus dem Haus auf der Anhöhe über dem Nordfjord. Mein Großvater hatte das Haus bauen lassen, es war von einem lokalen Architekten entworfen worden, der im Ausland gewesen war und sich Bauhaus-Architektur angesehen hatte und der diesen Stil den Wünschen von Menschen anpassen konnte, die nicht so viel von sich hermachen wollten. Kurz vor dem Krieg war das Haus meiner Großeltern fertig, mit drei Wohnzimmern, fünf Schlafzimmern und Eckfenstern zum Fjord hin. Die Innenausstattung war aus Oslo bestellt worden: Stabparkett für die Wohnzimmer, Strohtapete für die Bibliothek, Wasserhähne aus Messing und das erste Wasserklosett im Dorf. Erst als ich nach Südnorwegen umgezogen war, begriff ich, dass es andere Häuser gab, die mit unserem Ähnlichkeit hatten.
Ich stand in der Auffahrt, hatte die Autotür offen, dachte, dass das Haus noch immer schön sei. Es lag allein oben am Hang und sah aus, als ob es eigentlich keine Menschen brauchte. Mamas Name stand noch immer am Briefkasten, im Briefkasten lagen einige Prospekte, von Firmen, die noch nicht registriert hatten, dass sie nicht mehr dort wohnte. Ich ließ alles liegen, schaute hinab auf den Nordfjord, wo die Felsen steil ins Wasser abfielen, tiefer als der Sørfjord, gut geeignet für Fabrikbetrieb und Anlieferung von Waren. Zu Großvaters Zeit wurde Waltran hergebracht. In meiner Kindheit war es Rogen. Die Kaviarproduktion war jetzt eingestellt und nach Trondheim verlagert worden, am Kai standen noch immer Lagerschuppen, aber die Waren wurden mit dem Auto angeliefert. Die Ausfahrt kam direkt hinter dem Tunnel, ein einfaches gelbes Schild teilte den Vorüberfahrenden mit, dass weiter unten Menschen wohnten.
Der Garten war das Projekt meiner Großmutter gewesen, sie hatte Blumen und Sträucher gepflanzt, von denen niemand geglaubt hatte, dass sie so weit im Norden gedeihen konnten, aber sie hatten es geschafft, sie passten sich an und wurden abgehärtet. Ich hatte erwartet, den Garten halb zugewachsen vorzufinden, jetzt, wo sich niemand darum kümmerte, aber so war es nicht, die Kiefernhecke war schön und dicht, der Rasen frei von Löwenzahn, die Zitterpappel schlank und wohlfrisiert, auch wenn sie inzwischen ebenso hoch war wie die Fahnenstange.
Ich steckte den Schlüssel ins Schloss und schob die Tür auf. Eine Wolke aus Staubkörnern hieß mich willkommen. Meine Hand fand den Lichtschalter ganz von selbst. Am Ende des Flurs war die Treppe zu sehen, sie führte in einem sanften Bogen zur Galerie hoch.
»Hallo«, sagte ich.
Das war eine Gewohnheit.
Die Fußspuren der Krankenwagenbesatzung waren auf dem Parkett noch immer zu sehen. Eine Decke war von dem Sessel geglitten, in dem Mama immer gesessen hatte, ein kleiner Fußschemel war ein Stück weit ins Zimmer geschoben worden. Auf dem Tisch lagen Zeitschriften und Bücher, die sie kaufte, wenn sie Onkel Rolf und Tante Barbara in Kalifornien besuchte, immer häufiger, hatte ich gehört, sie hatte auf deren Veranda gelegen und aufs Meer hinausgeschaut, hatte in fröhlichen Pastellfarben gehaltene Shoppingmalls besucht, war mit offenem Verdeck in Tante Barbaras Corvette an den Klippen entlanggefahren, ehe sie nach Finneide zurückkehrte, in einem Widerøe-Flugzeug nach Mo geschaukelt wurde und schließlich nach Hause kam, mit neuen Gegenständen im Gepäck, die sie überall verteilte, obwohl es ohnehin schon voll genug war.
Ich glaube, sie brauchte diese Dinge, irgendwie halfen sie ihr. Sie schafften das, was sonst niemand schaffte, sie trösteten Mama.
Im Wohnzimmer fiel das Sonnenlicht in Vierecken auf das Parkett. Es breitete sich über Couchgarnitur und Fernsehecke aus, über den schmalen Schreibtisch, an dem Papa abends gearbeitet hatte, wo er in ein kleines Aufnahmegerät mit gezackten Rädchen diktierte, das seine Wörter verschlang. Es waren Wörter für Erwachsene. Lange, komplizierte Sätze, manchmal in fremden Sprachen. Noch immer war in der gepolsterten Sitzfläche seines Schreibtischstuhls eine Mulde zu sehen. Ich zog den Stuhl hervor und setzte mich, öffnete eine Schublade und fand da unten Papas Uhr, ein Loch im Riemen war größer als das andere. Er hatte die Uhr immer abgenommen, wenn er nach Hause kam, es war ein festes Ritual, mein Vater, der die Uhr vom Handgelenk löste und in die Schublade legte, als ob die Zeit nur existierte, wenn er im Büro war.
Für uns war es umgekehrt.
Papa existierte nur, wenn er zu Hause war.
Jeden Nachmittag kam er zur Tür herein, in Jacke, Hose und Schlips, den Mantel über dem Arm, den Diplomatenkoffer in der Hand, ehe er den auf den Schreibtisch legte und auf den Verschluss drückte, sodass der Deckel aufsprang. Im Diplomatenkoffer herrschte eine eigene Ordnung, Füllfederhalter, Zirkel, Rechenmaschine und liniertes Papier an genau festgelegten Stellen. Er nahm das heraus, was er brauchte, zog den Terminkalender aus der Innentasche seiner Jacke und legte ihn zusammen mit der Uhr in die Schublade, dann ging er nach oben und hängte die Arbeitskleider in der Ankleidekammer auf, zog etwas Legereres an und kam wieder zu uns herunter.
Der Terminkalender lag noch immer dort. Auf den Einband war die Jahreszahl zusammen mit seinem Namen und dem Logo der Eisenhütte in Gold eingestanzt.
Bjørn Berg.
1985.
Ich nahm den Kalender heraus und blätterte darin, die Seiten waren vergilbt, jedes Blatt hatte eine Ecke, die man abreißen konnte. Das hatte Papa getan, jede Woche, bis das Unglück passiert war. Diese abgerissenen Wochen waren gefüllt mit Verabredungen, und die waren notiert mit grauem Bleistift, manchmal auch mit Tinte, Aktivitäten, die oft mit einem einzelnen Wort in einer Zeile gekennzeichnet waren. Abteilungssitzung. Vorstandssitzung. Personalsitzung. Mittagessen mit Nordisk Stål. Seine Reisen waren mit Pfeilen nach oben und nach unten eingezeichnet, um klarzustellen, dass sie mehrere Tage dauern würden, im Januar ein Abstecher nach Deutschland, im Februar ein Besuch in einem Stahlwerk in Albanien, ein kurzer Urlaub im März. Am Ende kamen eher private Termine, ein Friseurbesuch in Mo, eine Opernaufführung im Kinoteatret, ein Wartungstermin für das Auto.
Das Letzte, was er notiert hatte, waren unsere Ferien im Juli. Nicht, wohin wir fahren würden, nur dieses eine Wort mit spitzen Buchstaben: Ferien.
Dann kam der Herbst. Leere Seiten, auf denen nichts passierte. Die Fortsetzung, die niemals folgte.
So weit war ich gekommen, als ich ein Auto in der Auffahrt hörte. Der Makler kam zehn Minuten zu früh, die Fahrt von Mo hierher ging viel schneller jetzt, wo wir die gute Straße hatten, ganz anders als in den alten Tagen, als sie sich in unendlichen Kurven oberhalb der Bahnlinie entlanggeschlängelt hatte. Ich stand an der Tür, ehe er klingeln konnte, wusste nicht, ob die Klingel noch funktionierte, gab ihm die Hand und bat ihn, die Schuhe anzubehalten. Er war in meinem Alter, er trug einen schmalen, eng sitzenden Anzug, irgendeine schwedische Marke, nahm ich an. Er legte die Aktentasche auf den Tisch im Flur, zog einen Notizblock und einen Kugelschreiber hervor und trat in die Tür.
»Ah ja, nicht schlecht«, sagte er. »Dafür werden Sie einen guten Preis bekommen.«
»Meinen Sie? Hier ist seit Ewigkeiten nicht renoviert worden.«
»Das Haus ist in gutem Zustand. Überall Qualität. Minimale Abnutzung. So etwas gibt es in der ganzen Gemeinde kein zweites Mal, möchte ich behaupten.«
Er ging durch die Wohnräume, vorbei am Esstisch und den Rattanstühlen mit Stahlgestell, die so fein federten, wenn man sich daraufsetzte. Die Schwingtür zur Küche schnellte hin und her, als er sie aufschob.
»Ich habe gehört, dass das Haus hier im Dorf das Schloss genannt wurde?«
»Ja, das war wohl so.«
Er machte sich auf seinem Block Notizen. Warf einen Blick in die Küche, die zwei Jahre vor dem Unglück renoviert worden war, profilierte Türen in Eiche, ein Herd, der damals groß und modern gewesen war, jetzt sah er klein und alltäglich aus. Ich würde ihn entsorgen lassen müssen, niemand wollte noch solche Herde haben.
Im ersten Stock hatte Mama versucht, die Zimmer meiner Brüder auszuräumen. An den Wänden zeigten verschossene Stellen, wo früher einmal Fußballplakate und Bilder gehangen hatten, in Thomas’ Etagenbett lagen noch immer zwei aufgerollte Bettdecken. Ich hatte oft dort übernachtet, wenn Oma zu Besuch war, und auch einige Male sonst, wenn Thomas in der Laune dazu war. Ich hatte ihn dann nie schlafen lassen, hatte immer noch reden wollen, hatte den Kopf über den Rand des oberen Bettes hängen lassen, während er mit hinter dem Kopf verschränkten Händen dalag und zu mir hochschaute. Wenn ich die Augen schloss, konnte ich das Gesicht meines Bruders nicht mehr vor mir sehen, nur die Form seiner Arme, wie sie auf beiden Seiten des Kopfkissens hervorragten, die Ohren, die er selbst zu groß fand. Wir konnten lange so daliegen, die Lampen ausgeknipst, unsere flüsternden Stimmen in der Dunkelheit. Das waren die schönsten Abende, wenn er mit mir redete, als ob ich genauso viel wüsste wie er.
Der Makler ging zum Schreibtisch und hob ein Modellflugzeug hoch. Winzige Soldaten und Panzer, die mein Bruder gesammelt hatte.
»Solche hatte ich auch«, sagte er.
»Die hat Thomas zu Weihnachten bekommen. Zum letzten Weihnachten.«
Der Makler überlegte kurz.
»Das war sicher nicht leicht für Sie und Ihre Mutter, was da passiert ist«, sagte er.
»Haben Sie meine Brüder gekannt?«
»Ein bisschen. Ich bin Ihnen allen ab und zu begegnet, bei Weihnachtsfesten und so, mein Vater hat auch in der Eisenhütte gearbeitet, war zusammen mit Ihrem Vater im Vorstand. Sie können sich bestimmt nicht daran erinnern, es ist so lange her.«
Ich lächelte ihn an. Mir war klar, dass er sich überlegt hatte, was er sagen würde, wollte ihm zeigen, dass ich das zu schätzen wusste.
»War das Ihr Zimmer?«, fragte er mit einem Blick auf die andere Seite des Flurs.
»Ja. Das kleinste im Haus.«
»Aber es ist gemütlich.«
»Es tropft von der Decke. Da oben, sehen Sie?«
Ich zeigte auf die rechte Ecke der Decke, wo sich ein großer dunkler Fleck ausbreitete. Auch die Tapete war schon von der Feuchtigkeit gefleckt, die Tapete, die ich immer schon gehabt hatte, bei Laura Ashley in Oslo bestellt, ich wollte lieber Poster haben, aber Mama sagte Nein. Anfangs fand ich die Tapete albern: eine wogende grüne Landschaft, Reiter mit Zylindern und roten Jacken; später hatte sie mir dann gefallen, es steckte eine solche Energie in diesen kleinen Pferden, sie liefen nicht, sie flogen.
»Haben Sie den Schaden schon von einem Klempner begutachten lassen?«, fragte der Makler.
»Noch nicht. Ich weiß nicht, ob das Dach jemals erneuert worden ist. Es ist vielleicht an der Zeit.«
»Schieferdach, oder?«
»Ja.«
»Nicht das Billigste.«
»Nein, das ist mir schon klar.«
»Es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten.«
Im Schlafzimmer meiner Eltern wurde das Doppelbett von der Herbstsonne beschienen. Im Badezimmer standen Mamas Parfümflaschen am Waschbecken aufgereiht, sie hatte sie gesammelt, solange ich mich zurückerinnern konnte, unterschiedliche Größen und Farben, damit hatte sie in den Jahren angefangen, als sie als Stewardess gearbeitet hatte. Als wir klein waren, hatte sie nicht gewagt, die Flaschen dort stehen zu lassen. Sie hatte Angst, wir könnten sie zerbrechen, ihre Lieblingsflaschen hatte sie versteckt.
»Haben Sie sich schon überlegt, was Sie mit der Einrichtung machen wollen?«, fragte der Makler.
»Verschenken, nehme ich an.«
»Sie wollen sie nicht selbst behalten?«
»Das glaube ich nicht. Eigentlich habe ich alles, was ich brauche.«
»Wenn ein Käufer also einige Möbel übernehmen möchte, wäre das dann möglich? Gegen einen Aufschlag im Preis natürlich.«
»Meinen Sie, es könnte Interesse geben?«
»Davon bin ich eigentlich überzeugt. Es sind schöne Möbel, und sie sind in gutem Zustand. Und in den Wohnzimmern hängt auch einiges an Gemälden und Grafiken. Ich würde Ihnen raten, sich mit einem Auktionshaus in Verbindung zu setzen, ehe Sie sich entscheiden.«
Ich merkte, wie müde ich wurde, als er das sagte. Ich hatte für den folgenden Tag einen Container bestellt, hatte gedacht, ich könnte das meiste hineinwerfen, es sofort wegschaffen lassen.
»Ja, vielleicht«, sagte ich.
Wir gingen nach unten und setzten uns an den Esstisch. Der