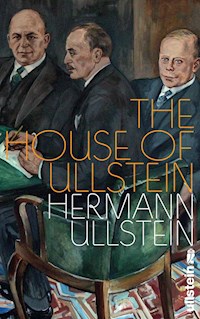19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
In seiner lebendigen Chronik der Jahre 1858 bis 1939 schildert Hermann Ullstein die frühe Geschichte des Ullstein Verlags – von seinem Aufstieg zu Europas größtem Verlagshaus bis zur Enteignung der Familie Ullstein durch die Nazis. Januar 1933: Hermann Ullstein ist gerade mit seiner Familie auf dem Berliner Presseball, als die Nachricht einschlägt wie der Blitz, dass Hitler von Hindenburg zum Reichskanzler ernannt wurde. Er weiß, was das bedeutet: das Ende für seine Familie in Deutschland – und das Ende des größten deutschen Verlages. Immer stärker werden fortan die Repressionen gegen Juden und politisch Andersdenkende, immer spürbarer wird die Unterdrückung der freien Presse. Schließlich wird der Ullstein Verlag 1934 enteignet. Mit zehn Reichsmark in der Tasche verlässt Hermann Ullstein 1939 das Land und emigriert nach New York, wo er seine Erinnerungen niederschreibt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
DAS BUCH
Januar 1933. Auf dem Berliner Presseball ist es noch ein Gerücht, einen Tag später ist es Gewissheit: Hindenburg hat Hitler zum Reichskanzler ernannt. Hermann Ullstein weiß, was dies bedeutet: das Ende für seine Familie in Deutschland – und das Ende des wichtigsten deutschen Verlags. Immer stärker werden die Repressionen gegen Juden und politisch Andersdenkende, immer spürbarer unterdrücken die Nationalsozialisten die freie Presse. 1934 wird der Ullstein Verlag enteignet. Mit zehn Reichsmark in der Tasche verlässt Hermann Ullstein 1939 das Land und emigriert nach New York. Dort verfasst er diese Chronik, in der er die bewegte Geschichte des Verlagshauses Revue passieren lässt.
Die Geschichte einer großen deutschen Verlegerfamilie – sehr persönlich und aus erster Hand.
Spannend und voller Zeitkolorit lässt Hermann Ullstein die frühen Jahre des Ullstein Verlags wieder lebendig werden. Er schildert dessen eindrucksvollen Aufstieg zu Europas größtem Verlagshaus. Und er beschreibt die dramatischen Umbrüche in Deutschland zu Anfang des 20. Jahrhunderts, die zur Enteignung der Familie Ullstein durch die Nazis führten.
DER AUTOR
Hermann Ullstein, geboren 1875, war der jüngste Sohn von Verlagsgründer Leopold Ullstein. 1902 trat er in das Familienunternehmen ein, wo er sich vor allem der modernen Reklame widmete. Sein Motto: »Wer nicht langweilig sein will, muss originell sein.« Nach seinem Ausscheiden aus dem Verlag verfasste er Wirb und werde! Ein Lehrbuch der Reklame. 1939 musste er in die USA emigrieren und ließ sich in New York nieder, wo er 1943 starb.
HERMANN ULLSTEIN
Das Haus Ullstein
Aus dem Englischen von Geoffrey Layton
Mit einem Nachwort von Martin Münzel
In Zusammenarbeit mit dem Herausgeberkreis Deutsches Pressemuseum im Ullsteinhaus e. V. (DPMU).
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel The Rise and Fall of the House of Ullstein 1943 bei Simon and Schuster, New York.
Hermann Ullsteins Buch wurde im Exil aus der Sicht eines Zeitzeugen verfasst. Dies bedingt gelegentliche Ungenauigkeiten, etwa dann, wenn der Autor aus dem Gedächtnis Aussagen von Politikern und Medienberichte zitiert. An manchen Stellen entspricht der Kenntnisstand des Autors nicht der heute bekannten Faktenlage. An wenigen Stellen des Textes wurden in der Übersetzung behutsame Korrekturen vorgenommen. Auf eine wissenschaftliche Kommentierung wurde verzichtet.
ISBN 978-3-8437-0631-5
Abbildungen im Innenteil: Axel-Springer-Unternehmensarchiv, Berlin Vorbemerkung, Kapitel 1, 2, 3, 6, 7ullstein bild, Berlin Kaitel 4, 5, 8
© 1943 by Simon & Schuster, Inc.© der deutschen Ausgabe Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2013Buchgestaltung: ruta_verlagsproduktion, StuttgartUmschlaggestaltung: Sabine Wimmer, BerlinUmschlagmotiv: Willy Jäckel, Die Brüderkonferenz (Kopie von Heinrich Heuser), ullstein bildAutorenfoto: Axel-Springer-Unternehmensarchiv, Berlin
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
eBook: Pinkuin Satz und Datentechnik, Berlin
Für meine Frau
INHALT
Vorbemerkung
Erstes Kapitel Die Nacht, bevor Hitler kam
Zweites Kapitel Im Dritten Reich
Drittes Kapitel Die Geburt eines Verlagshauses
Viertes Kapitel Schneller Aufstieg
Fünftes Kapitel Die Zeit der Konsolidierung
Sechstes Kapitel Der Große Krieg 1914–1918
Siebtes Kapitel Durch die Stürme zu den Sternen
Achtes Kapitel Hitler ante portas
Letztes Kapitel In Hitlers Hölle
Nachwort
Anmerkungen
Textteil
Nachwort
VORBEMERKUNG
Dieses Buch ist bislang nicht in deutscher Sprache veröffentlicht worden. Sein Verfasser, Hermann Ullstein, jüngster Sohn des Verlagsgründers Leopold Ullstein, emigrierte 1939 in die USA und verfasste das Manuskript auf Deutsch. Als das Buch kurz vor Hermann Ullsteins Tod im November 1943 bei Simon & Schuster in New York unter dem Titel The Rise and Fall of the House of Ullstein in englischer Übersetzung erschien, war eine offizielle deutsche Fassung in dem von der NS-Propaganda dominierten deutschen Buchmarkt ausgeschlossen. Der Buch- und Zeitungsmarkt, einst eine Domäne des Ullstein Verlags, befand sich 1943 fest in der Hand des Franz-Eher-Verlags. Dieser Parteiverlag der NSDAP kontrollierte über 80 Prozent des deutschen Pressemarktes. In so einer Konstellation war ein Buch, das die Verlags- und Familiengeschichte Ullsteins als deutsche Presse- und Zeitgeschichte kritisch reflektiert, natürlich unerwünscht, zumal Hermann Ullstein darin anschaulich darlegt, wie das NS-Regime der Verlegerfamilie den seinerzeit größten deutschen Verlag 1934 zu einem Spottpreis abpresste. Das NS-Regime hatte nach der Zwangsenteignung des Verlags versucht, den Namen Ullstein aus dem öffentlichen Bewusstsein zu tilgen: 1937 wurde aus Ullstein der »Deutsche Verlag«, und das Druckhaus Tempelhof, gemeinhin als »Ullsteinhaus« bekannt, hieß fortan bis 1945 »Deutsches Haus«.
Nach 1945 verliert sich die weitere Rezeption dieses Buches von Hermann Ullstein, das bald nur noch antiquarisch erhältlich war. Zu den Hauptaufgaben der Initiative vom Deutschen Pressemuseum im Ullsteinhaus e. V. (DPMU) zählt unter anderem, das für Deutschland pressegeschichtlich bedeutsame Erbe des Ullstein Verlags im Bewusstsein künftiger Generationen lebendig zu halten. Dieses Ziel verfolgte auch Hermann Ullstein mit seinem Buch. Und so war es naheliegend, dass das DPMU der heutigen Ullstein Buchverlage GmbH das Projekt einer deutschen Ausgabe dieses Werkes vorschlug.
Für dieses Projekt konnten wir Vereinsmitglieder des DPMU gewinnen: Das Gründungsmitglied Geoffrey Layton, Urenkel von Hans Ullstein (dem ältesten Sohn von Firmengründer Leopold Ullstein), übersetzt das Buch seines Großonkels Hermann Ullstein zurück ins Deutsche, da Hermann Ullsteins deutsches Originalmanuskript verschollen ist und nur noch die englische Übersetzung vorliegt. Das Werk bleibt somit »in der Familie«. Martin Münzel zeichnet im Nachwort die Entstehung und Rezeption des Buches nach.
Zuletzt hat sich der Herausgeberkreis Deutsches Pressemuseum im Ullsteinhaus konstituiert. Diesem Gremium gehören neben Geoffrey Layton und Martin Münzel noch Rainer Laabs (Leiter Unternehmensarchiv Axel Springer Verlag), Prof. Dr. Bernd Sösemann (FU Berlin, Mitglied des wissenschaftlichen Beirats der DPMU) sowie Holger Wettingfeld (Vorsitzender DPMU) an. Der Herausgeberkreis will künftig die Publikation von pressegeschichtlich relevanten Werken unterstützen, die bislang unveröffentlicht bzw. vergriffen sind. Das Haus Ullstein ist der Auftakt dazu.
Der Herausgeberkreis
Informationen zum Projekt Deutsches Pressemuseum im Ullsteinhaus unter www.dpmu.de
Entwurfszeichnung für die kupferne Eule am Tempelhofer Druckhaus (Ullsteinhaus) von Fritz Klimsch aus dem Jahr 1926
ERSTES KAPITEL
Die Nacht, bevor Hitler kam
In den Festsälen am Zoologischen Garten geht es hoch her. Es ist der letzte Samstag im Januar des unheilvollen Jahres 1933 – ein Tag, der seit eh und je für einen Höhepunkt des Berliner Gesellschaftslebens reserviert ist: den Presseball.
Ganz Berlin – das heißt jeder, der in der Stadt etwas darstellt – ist anwesend. Natürlich dürfen nur geladene Gäste an der glamourösen Veranstaltung teilnehmen, und wer vom Festkomitee nicht für würdig befunden worden ist, eine der eleganten Einladungen zu erhalten, sollte sich ernsthaft Sorgen um seine Reputation machen.
In den weitläufigen, hell erleuchteten Hallen mit ihren Logen längs der Wände befindet man sich in Gesellschaft von Staatsministern und Parlamentsabgeordneten, Politikern und Presseleuten, Künstlern, Dichtern und den führenden Köpfen aus Theater und Film. In dem Gedränge kann man sich nur schrittweise fortbewegen. Die Herren kommen in Uniform oder im Abendanzug mit weißer Krawatte, die Damen in umwerfenden Ballkleidern. Keine Einzige denkt daran, sich dem Diktat der Mode zu widersetzen (der Presseball hat seine eigenen Traditionen), und der Ehrgeiz der Damen wird nicht gestillt sein, bevor sie nicht eine ausführliche Beschreibung ihrer Abendgarderobe aus der Sicht eines Modeexperten in der Morgenzeitung entdeckt haben.
Sehen Sie mal: diese Herren dort in der Ecke. Vier von ihnen sind bekannte Theaterkritiker. Der Herr, der sich gerade zu ihnen gesellt und Hände schüttelt, ist ein Dichter. Treten wir ein wenig näher und hören, was der Kritiker ihm zu sagen hat.
»Ich habe soeben Ihr wundervolles Gedicht im Programmheft des Presseballs gelesen. Ihr Stil, mein Lieber, ist unnachahmlich.«
Wenn das mal nicht seine Eitelkeit kitzelt. Schauen Sie nur, wie er strahlt!
Das Gedränge hier wird zu groß. Es ist ratsam weiterzugehen, obgleich man nur millimeterweise vorrücken kann. Im Nebenraum wird Tango gespielt. Sehen Sie den da! Das ist Max Reinhardt. Wir haben es geschafft. Von hier aus hat man einen besseren Überblick. Da steht Helene Thimig an die Wand gelehnt, mit Felix Hollaender. Und dort ist Professor Liebermann im Gespräch mit Spiro. Er ist alt geworden, nicht wahr?
Wir sind in der Haupthalle angelangt. Nun können Sie … Aber was ist denn das? Die große Loge im Zentrum ist leer. Wo bleiben der Kanzler und seine Minister?
Auf einmal liegt was in der Luft. Eine bedrohliche Spannung. Bruchstücke einer sensationellen Neuigkeit fliegen von Mund zu Mund. »Haben Sie gehört –?« Reichskanzler Schleicher und sein gesamtes Kabinett sollen zurückgetreten sein. Präsident Hindenburg hat bereits dessen Rücktritt entgegengenommen, sagt Staatssekretär Busch. Aber er meint auch, es gäbe keinen Grund zur Panik, denn Hindenburg habe sich erst vor kurzem gegen eine Kanzlerschaft Hitlers ausgesprochen. Solche Stellungnahmen, begleitet von Walzerklängen aus dem angrenzenden Saal, beruhigen die Gemüter. Die Mienen hellen sich wieder auf, die Gruppen zerfallen in Paare, und die Damen lächeln wieder, während sie in die rotierende Menschenmenge eintauchen.
Ja, das ist allerdings wahr: Zu einem anderen Zeitpunkt erfuhr Hitler von Hindenburg eine glatte Abfuhr. Jener erklärte, er könne es »vor Gott, seinem Gewissen und seinem Vaterlande nicht verantworten, einer Partei die gesamte Regierungsgewalt zu übertragen, noch dazu einer Partei, die einseitig gegen Andersdenkende eingestellt sei.« Abgesehen davon ist es erst zwei Monate her, dass die Nazis bei den Parlamentswahlen einen beträchtlichen Rückgang der Stimmen zu verzeichnen hatten. Von ihren 230 Sitzen durften sie nur 196 behalten. Offenbar ist Hitlers Stern im Sinken begriffen. Die Gefahr scheint gebannt. Es handelt sich um nichts weiter als einen Bruderzwist zwischen Schleicher und Papen, die sich um die Vorherrschaft streiten. Auf diese und ähnliche Art wird die Abdankung des Kanzlers kommentiert. Die Menschen lassen sich von Beschwichtigungen einlullen – und der Champagner fließt in Strömen.
Plötzlich richten sich aller Augen auf eine Loge neben der Regierungsloge. Wem sie gehört? Den Ullsteins. Sie wissen sicherlich, dass die Ullstein-Zeitungen die auflagenstärksten in ganz Deutschland sind. Erkennen Sie Remarque? Er wird gerade Mady Christians vorgestellt, Berlins beliebtester Schauspielerin. Sie ist mit Sven von Müller verheiratet, einem von Ullsteins Schriftleitern. Hinter ihr setzt sich gerade Vicki Baum. Ihr letzter Roman war wieder ein Bestseller. Der Herr, mit dem sie sich unterhält, ist Fritz Ross, der Schwiegersohn vom ältesten der Ullstein-Brüder.
Ein Neuankömmling späht durch sein Opernglas und fragt: »Und die Ullsteins selber, wo sind die?«
Die sind nicht hier. Sie zeigen sich nicht gerne in der Öffentlichkeit. Die Politik überlassen sie ihren Redakteuren. Sie selber halten sich lieber im Hintergrund.
Soeben betritt Geheimrat Schäffer die Loge. Er ist vor kurzem zum Generaldirektor des Unternehmens ernannt worden. Davor war er Staatssekretär im Reichsfinanzministerium. Der Herr, der ihn begrüßt, ist der österreichische Botschafter.
Die Band legt einen Zahn zu, und alles drängt zur Tanzfläche. Achten Sie auf den Kerl mit Monokel, der sich da zur Regierungsloge durchkämpft. Das ist Professor Ludwig Stein, ein politischer Beobachter der Vossischen Zeitung, die den Ullsteins gehört. Man kennt ihn auch unter dem Namen Diplomaticus. Kommen Sie, versuchen wir, ein bisschen näher heranzukommen. In der Regierungsloge sitzen nur ein paar Staatssekretäre, die alle recht verängstigt aus der Wäsche schauen. Und was hat unser Diplomaticus zu sagen?
»Keine Panik, meine Herren. Aus zuverlässiger Quelle weiß ich, dass Papen wiederkehren wird. Die Konservativen stehen geschlossen hinter ihm.« Diese gute Nachricht ist bereits durch die Telefon- und Telegraphenleitungen der Firma Ullstein in die ganze Welt hinausgegangen.
»Hindenburg ist loyal. Er bleibt seinen Freunden treu«, sagt einer der Staatssekretäre.
»Wenn ich mich recht entsinne«, entgegnet ein Skeptiker, »hat Hindenburg schon so manchen Freund fallengelassen.«
»Aber Sie werden doch nicht vergessen haben, dass Hindenburg die Präsidentschaftswahl gegen Hitler gewonnen hat. Er wird wohl kaum seine eigenen Wähler düpieren.«
Das klingt plausibel. Der Skeptiker gibt sich geschlagen. Der Tanz geht weiter bis zum Morgengrauen. Kein Wölkchen am Himmel, das die Champagnerlaune trüben möchte.
Um fünf Uhr morgens verlässt Kurt Szafranski, einer von Ullsteins Verlagsdirektoren, vorzeitig das Fest und begibt sich heim. Er fühlt ein Fieber nahen. Seine Frau bringt ihn zu Bett, wo er für 24 Stunden in einen Tiefschlaf fällt. Als er aufwacht, richtet er sich auf und schaut seine Frau an. »Was gibt’s Neues?«, fragt er.
»Nicht viel«, lautet die sarkastische Antwort. »Hitler ist zum Kanzler ernannt worden.«
Hermann und Margarethe Ullstein, 1933
ZWEITES KAPITEL
Im Dritten Reich
Am nächsten Tag, dem 31. Januar 1933, ist die Stimmung im Verlag an der Kochstraße sehr angespannt. Geregelte Arbeit scheint unmöglich. Die Leute stehen in den Korridoren herum, reden miteinander, streiten sich. Die Pessimisten sagen das Ende des Verlags voraus. Die Optimisten betrachten Hitlers Sieg als ein Zwischenspiel vor seinem nahen Sturz.
Unser Diplomaticus gehört jetzt zu den Pessimisten – er verschwindet in einem der Automobile, die jederzeit am Haupteingang für ihn bereitstehen. »Zur Reichskanzlei«, ruft er dem Fahrer zu. Die Fahrt dauert höchstens zehn Minuten, aber mit jeder Sekunde werden die Aussichten düsterer. Zwei Tage zuvor auf dem Presseball hatte er noch verkündet, dass Hitler von Hindenburg abgelehnt werde, dass Papen ein Comeback bevorstehe und dass man die Nerven behalten solle. Alle seine Voraussagen waren falsch. Hatte er auf einmal seinen politischen Spürsinn verloren? Er wird es gleich erfahren.
Der Wagen hält vor der Reichskanzlei. Diplomaticus steigt aus und schickt sich an, das Gebäude zu betreten.
»Halt!«, ruft der Portier. »Ausweis vorzeigen!«
Diplomaticus steht starr vor Schreck. »Aber Kessler«, ruft er dem Portier zu, »das ist doch nicht dein Ernst. Wir kennen uns doch!«
»Für Sie immer noch Herr Kessler. Wo wollen Sie hin?«
»Zum Staatssekretär selbstverständlich.«
»Das ist nicht möglich.«
Diplomaticus fängt an, sich unwohl in seiner Haut zu fühlen. »Wollen Sie mir etwa sagen, guter Mann, dass Sie in höherem Auftrag handeln? Sie wissen doch, dass ich jeden Tag komme, um die Regierungserklärungen entgegenzunehmen.«
Der Pförtner schneidet ihm das Wort ab. »Nur, wer einen Passierschein von der Parteizentrale vorweisen kann, bekommt Zutritt.«
Deprimiert kehrt Diplomaticus ins Büro zurück. Es stellt sich heraus, dass es seinem Kollegen von der B.Z. am Mittag ähnlich ergangen ist. Alle Verbindungen zur Regierung sind abgerissen.
Der Kollege Reiner macht sich darüber lustig, dass Diplomaticus den Kopf so hängen lässt. »Du musst nicht immerzu schwarzsehen, lieber Herr Professor. Ich bin überzeugter Optimist.«
»Und worauf gründet sich dein Optimismus?«
»Auf die Tatsache, dass die Gemäßigten genauso in Hitlers Regierung sitzen werden, wie sie es schon bei Papen getan haben. Sie werden alle Schlüsselpositionen in der Verwaltung besetzen. Papen wird Vizekanzler, und die Ministerien des Äußeren und des Inneren, das Finanzressort, das Verteidigungsministerium und die Landwirtschaft werden allesamt von seinen Freunden besetzt. Also was kann Hitler schon groß tun? Gar nichts!«
Das war Diplomaticus neu, aber er lässt es sich nicht anmerken. Jetzt spielt er seine Trumpfkarte aus. Trotz der Informationssperre ist es ihm gelungen, eine wichtige Mitteilung aufzuschnappen. »Um vier Uhr nachmittags«, weiß er zu berichten, »wird Hitler seine Jungfernrede als Kanzler im Radio halten. Da werden wir ja sehen, wie weit er sich aus dem Fenster lehnt.«
»Natürlich nicht besonders weit«, erwidert Reiner. »Als Kanzler muss er Verantwortungsgefühl demonstrieren. Da kann er nicht länger wüten wie auf einer seiner Massenkundgebungen. Er wird die Dinge nun aus einem anderen Blickwinkel beurteilen.«
Um vier Uhr nachmittags steht alles still im Ullsteinhaus und lauscht. So hatte es Clausner, der Anführer der nationalsozialistischen Betriebszelle, angeordnet. Das gilt für alle Angestellten, auch für die Redakteure. Befehl ist Befehl.
Die Betriebszelle hat sich quasi über Nacht in eine Art Schattenregierung verwandelt und kontrolliert nun, ganz nach russisch-bolschewistischem Vorbild, das Tagesgeschäft, Angestellte und die Geschäftsleitung. Sie ist zu einem Machtfaktor geworden, mit dem man rechnen muss.
Auf ihre Initiative hin werden überall Lautsprecher angebracht, damit die Stimme des Führers auch von jedem gehört werden kann. Niemand darf seinen Arbeitsplatz verlassen, bevor der Führer zu Ende gesprochen hat. Und überhaupt: Nun ist das erste Mal vom »Führer« die Rede. Beklommenheit macht sich breit in den Büros und Werkhallen.
Plötzlich ertönt ein Gong. Dann kommt die Stimme des Radioansagers. Aber es ist keine der gewohnten Stimmen. Es ist eine unangenehm schrille Stimme, die uns die Ankunft des Führers verkündet. Wilde Begrüßungsschreie – »Heil« – verstummen auf einen Schlag, als der Führer seine Rede beginnt.
»Volksgenossen! 15 Jahre lang hat eine unfähige Regierung auf unserem Land gelastet. 15 Jahre lang durften die Juden das deutsche Volk ausbeuten. Acht Millionen Arbeitslose sind das traurige Resultat dieses Irrtums, der Volk und Staat in den Ruin getrieben hat. Von nun an werden sich die Dinge ändern. Denn nun halte ich die Zügel in Händen.«
Was für eine Arroganz! Kein Kanzler zuvor hatte gewagt, über seine Vorgänger mit so viel Verachtung zu sprechen!
»Binnen vier Jahren wird die Arbeitslosigkeit überwunden sein. Gebt mir diese vier Jahre, und ich werde Ordnung schaffen.«
In einem Wort: ein Vierjahresplan, ganz ähnlich dem, den Stalin 1928 einführte, als er versprach, in fünf Jahren die Landwirtschaft zu verstaatlichen. Jetzt hebt Hitler die Stimme: »Ich werde streng sein. Ich werde weder Kritik dulden noch irgendwelche Opposition. Ich fordere –«, und hier überschlägt sich seine Stimme, »nichts als Gehorsam!«
Wir starren uns an. Wie verträgt sich diese Forderung nach Gehorsam mit der Reichsverfassung, auf die er vereidigt worden war? Von blindem Gehorsam steht dort nichts, dafür aber von freier Meinungsäußerung. Was werden seine deutschnationalen Minister zu so einer Ankündigung sagen? Bei dem Wort »Gehorsam« schrie er, so wie auf seinen Massenveranstaltungen. »Gott steh uns bei«, murmeln wir, während wir dasitzen und auf das Ende der Suada warten.
Irgendwann hört sie tatsächlich auf. Viele von uns stehen sprachlos da, unfähig, sich zu rühren – als wartete man auf einen Befehl, wieder an die Arbeit zu gehen. Einer will sich kritisch äußern und wird sofort zurechtgewiesen. Erst jetzt wird uns klar, wie massiv die Propaganda im Untergrund tätig war – auch hier bei Ullstein, wo freiheitlich-demokratische Zeitungen gedruckt werden. Ein Drittel der Belegschaft gehört bereits der Hitlerpartei an, sie wagen es erst jetzt, sich dazu zu bekennen, die einen verschämt, die anderen schon offensiv. Die Mehrheit hält den Mund. Die kleinste kritische Bemerkung landet sofort in Clausners Zelle.
Ein paar Tage nach Hitlers Rede hatte ich eine Unterredung mit Kappusch, einem unserer Redakteure, der mir stets mit Ehrerbietung begegnet war. Bei keiner Gelegenheit versäumte er, mich daran zu erinnern, wie sehr ich ihm und seiner Familie einst aus der Not geholfen hatte. Nun schlug er andere Töne an. »Jetzt werden sie alle ankommen«, sagte er, »jetzt wollen sie plötzlich alle Parteimitglieder sein. Aber das ist eine Ehre, die man sich verdienen muss. Ein jeder muss beweisen können, dass sein Herz für die Partei schlägt.«
Ich gab meiner Verwunderung Ausdruck: »Kappusch, wie reden Sie denn? Seit wann gehören Sie zu den Nationalsozialisten?«
»Seit dem Beginn der Bewegung 1923.«
»Und dennoch sind Sie in diesem demokratisch orientierten Verlag geblieben?«
Hierauf entließ er eine dröhnende, humorlose Lachsalve, die mir das Blut in den Adern gefrieren ließ. Erst in diesem Moment erkannte ich, dass wir schon seit Jahren von Feinden umgeben waren. Zweifellos führten sie schon seit langem geheime Dossiers über die unverbesserlichen Demokraten. Von nun an blühte das Denunziantentum, und es herrschte eine Atmosphäre der Angst. Clausner war allgegenwärtig und omnipotent.
Ein paar Tage nach dem Gespräch mit Kappusch klopfte es laut an meine Tür. Clausner trat ein, flankiert von zwei Kollegen. Er kam gleich zur Sache: »Wir fordern die Entlassung von Direktor Ross. Er muss die Firma unverzüglich verlassen.«
Ich war überrascht: Fritz Ross war nicht nur der Schwiegersohn meines ältesten Bruders, sondern auch der Bruder von Colin Ross, einem prominenten Nationalsozialisten, der als Reisejournalist auch schon für Ullstein unterwegs gewesen war. Seine Nähe zu einem Parteimitglied schien ihn nicht zu schützen.
»Warum sollte Direktor Ross entlassen werden?«, fragte ich.
»Wir haben in Erfahrung gebracht, dass er mit einem gewissen Wendriner Umgang pflegt, der seinerseits mit dem Kommunisten Tucholsky befreundet ist.«
Ich konnte mir das Lachen nicht verkneifen. »Meine Herren, ich fürchte, Sie sind das Opfer eines bedauerlichen Irrtums geworden. Der Wendriner, mit dem Direktor Ross Umgang pflegt, ist weit davon entfernt, Kommunist zu sein. Er ist ein pensionierter Hauptmann der Reichswehr. Und bei dem Wendriner von Tucholsky handelt es sich um eine satirische Erfindung.«
Den drei Herren blieb die Spucke weg. Clausner fand als Erster die Sprache wieder. »Aber ist nicht der Schriftsteller Tucholsky ein Kommunist?«
»Mag sein. Vielleicht im Herzen. Ich kann es wirklich nicht beurteilen. Jedenfalls sind seine Wendriner-Geschichten völlig unpolitisch.«
Clausner entschied sich dafür, Großmut zu demonstrieren: »Diesmal wollen wir es durchgehen lassen, aber seien Sie gewarnt und geben Sie die Warnung auch an Ross weiter.«
Damit verzogen sie sich. Ich ließ meinen Neffen Ross kommen und erzählte ihm die Geschichte. Anfangs war er schockiert, aber als er begriff, dass er Opfer einer albernen Verwechslung geworden war, brach er in schallendes Gelächter aus.
Ansonsten gab es wenig zu lachen. In den Redaktionsräumen regierte der Terror – das Recht auf freie Meinungsäußerung blieb nur auf dem Papier unangetastet, im Grunde wusste jeder, dass Recht und Ordnung in Deutschland aufgehört hatten zu existieren. Die Verfassung konnte ihre Bürger nicht mehr schützen. Gleich nach Hitlers Machtergreifung hatte Hermann Göring erklärt, dass die Juden rechtlos und geächtet seien. »Warum sollte sich meine Polizei um ein paar Juden sorgen, die zusammengeschlagen oder umgebracht wurden?«
Den Kommunisten erging es nicht besser. Sie wurden ebenso wie die Juden in neu errichtete Konzentrationslager gesteckt, wo sie gefoltert wurden. Man schlug ihnen die Zähne aus und traktierte ihre Köpfe mit Eisenstangen. Alte Leute wurden am frühen Morgen gezwungen, zur Arbeit zu rennen, und wenn einer hinfiel, erging es ihm schlecht. Universitätsprofessoren wurden auf Bänke gefesselt und auf den nackten Hintern geschlagen.
Von diesen Lagern, die wie Pilze aus dem Boden schossen, war Dachau in Bayern das berüchtigtste. In Oranienburg bei Berlin gingen ähnlich erschreckende Dinge vor sich. Es war des Führers erklärter Wille, dem Abschaum der Erde – so nannte er die Lagerinsassen – Gehorsam beizubringen. Die Angst vor solchen Lagern genügte, wie man sich leicht vorstellen kann, um jede öffentliche Kritik im Keim zu ersticken.
Die Parlamentswahlen waren auf den 5. März gelegt worden. Diesmal war niemandem danach zumute, Wetten abzuschließen. Der Terror, der die Menschen lähmte, schien einen Sieg der Hitlerpartei unvermeidlich zu machen. Nichtsdestotrotz lag eine Spannung in der Luft, als ob sich eine weitere Katastrophe anbahnte. Erstaunlich genug, dass sich nach einem Monat von Hitlers Herrschaft die Erde noch nicht aufgetan hatte und uns der Himmel noch nicht aufs Haupt gefallen war.
Plötzlich, am Abend des 27. Februar, hörten wir die schrillen Alarmsirenen der Feuerwehr. Brigaden von überallher rasten Richtung Brandenburger Tor. Ein Angestellter hatte vom Dach unseres Hauses aus dicke schwarze Wolken über dem Reichstagsgebäude gesichtet.
Die Reporter stürzten in die Korridore und die Treppen hinab. Über Fernsprecher kam die Meldung, dass der Reichstag in Flammen stehe. Das Wort »Brandstiftung« machte die Runde.
Kaum hatten wir diesen Gedanken ausgesprochen, wurde auch schon der Presse mitgeteilt, dass die Kommunisten das Feuer gelegt hatten. Diese Flammen – so die offiziellen Verlautbarungen – sollten das Fanal für den kommunistischen Umsturz darstellen.
Ein Putschversuch vonseiten der Kommunisten?
Warum? In letzter Zeit hatte es keinerlei Anzeichen dafür gegeben. Dann hörten wir, dass ein junger Holländer namens Marinus van der Lubbe gefasst worden war, während er noch mit nacktem Oberkörper dabei war, das Feuer anzufachen. Als Nächstes hieß es, er sei von Hintermännern zu der Tat angestiftet worden, und schon bald darauf wurde der kommunistische Parteiführer Torgler zusammen mit drei Bulgaren – allesamt stadtbekannte Kommunisten, wohnhaft in Berlin – als Hauptverschwörer verhaftet. Viel Wert wurde auch auf die Tatsache gelegt, dass der Führer in Begleitung von Göring und Goebbels zur Brandstätte geeilt sei, um selbst im Kampf gegen die Feuersbrunst Hand anzulegen.
Eigentlich zweifelte niemand daran, dass Hitler und seine Leute den Brand selbst gelegt hatten. Aber da standen sie nun und heuchelten Entrüstung. Hitler bellte: »Verlasst euch darauf, dass ich den Schuldigen köpfen lasse!«
Einmal mehr missachtete er die Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit und das deutsche Gesetz, das lediglich Mord mit der Todesstrafe ahndete. Als Strafe für Brandstiftung waren Zwangsarbeit und Zuchthaus vorgesehen. Er nahm jedoch die Gelegenheit wahr, ein Gesetz durchzubringen, das Vaterlandsverrat zum Kapitalverbrechen erklärte. Und in diesem Fall handelte es sich um eine Kombination aus Hochverrat und Brandstiftung. Als ob es rechtens wäre, jemanden nach Gesetzen zu verurteilen, die es zum Zeitpunkt des Verbrechens noch nicht gab! Aber was kümmert einen Mann wie Hitler Recht und Gesetz? Und was machte es ihm aus, ob der eigentliche Täter geköpft wurde oder ein armer Narr, der zum Tatort geschleppt worden war, um dort als Sündenbock gefasst zu werden?
Hitlers und Görings Motive für die Brandstiftung lagen klar zutage. Kurz vor den Reichstagswahlen galt es, die Angst vor dem Bolschewismus zu schüren. Es hieß: Hitler wählen oder sich dem Teufel ergeben. Für die Nazis hatte der Reichstagsbrand nur von Neuem bewiesen, welch kriminelle Energie im Kommunismus steckte. »Wenn die Kommunisten an die Macht kommen«, so schrie Hitler, »dann werden sie euch alles wegnehmen, was ihr habt« – und unterstellte ihnen damit das, was er selber vorhatte. »Sie werden eure Frauen und Töchter vergewaltigen, und sie werden euch eures Vermögens berauben und all der Dinge, die ihr unter so großen Mühen erworben habt. Vor der bolschewistischen Sturmflut könnt ihr und ganz Europa von keinem anderen gerettet werden als von mir, Hitler. Wer mich nicht wählt, ist ein Dummkopf.«
Ein schlauer Trick? Keineswegs. In Deutschland zweifelte nicht eine Seele daran, dass Hitler und Göring den Reichstag selbst in Brand gesetzt hatten. Man meinte auch deutlich, die Handschrift von Goebbels zu erkennen, weil alles so plump eingefädelt worden war.
Seit jenen Tagen bin ich oft gefragt worden, ob ich mich nicht glücklich geschätzt hätte, Goebbels in der Reklameabteilung unseres Verlags sitzen zu haben. Auch angesichts all seiner Erfolge habe ich das immer verneint. Ein Mann, dessen Lügen so kurze Beine haben, würde einen jämmerlichen Verkäufer abgeben. Niemand glaubte ihm, aber keiner wagte es, das zuzugeben. Es ist keine Kunst, Leute mit Gewalt zur Kooperation zu zwingen.
Die Ersten, die das Märchen von den kommunistischen Tätern zu schlucken hatten, waren wir Zeitungsleute. Wir bekamen den Befehl, zu berichten, dass nur die Wachsamkeit des Führers den Ausbruch einer kommunistischen Revolution verhindert habe. »Nehmt euch in Acht vor der kommunistischen Gefahr« war der Slogan der Nazis, der am 5. März die Bevölkerung zu den Wahlurnen trieb.
Mittlerweile war durchgesickert, wie der Reichstag in Wirklichkeit in Brand gesetzt worden war. Natürlich war es nicht das Werk eines Einzelnen gewesen. Wie hätten sonst die Flammen gleichzeitig an verschiedenen Enden des Gebäudes gelegt werden können? Ein Trupp der SA hatte sich durch einen unterirdischen Gang, der das Präsidialamt mit dem Reichstag verbindet, Zutritt verschafft. In unseren Redaktionen traf die Nachricht ein, ein Feuerwehrmann habe Mitglieder der SA-Standarte Horst Wessel auf frischer Tat ertappt.