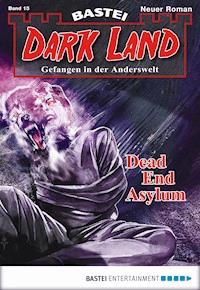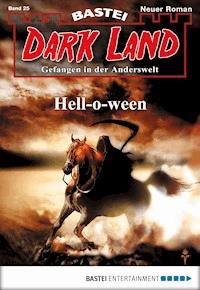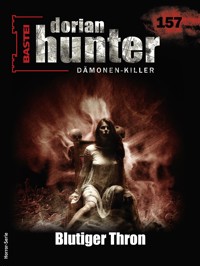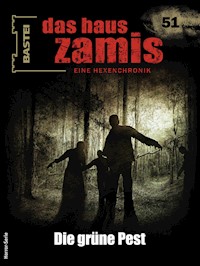
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Das Haus Zamis
- Sprache: Deutsch
Jurij schrie unterdrückt auf. Die Spitze der Hacke war vom Felsgestein abgerutscht und hatte sein Schienbein getroffen.
Seine Kameraden hielten sich weiter vorn im Stollen auf und hatten nichts von dem Unfall mitbekommen. Sie bemerkten auch nicht, wie Jurij auf einmal stutzte. Er griff nach der Petroleumlampe.
Er hatte sich nicht geirrt. Aus dem Geröll zu seinen Füßen ragte die Hand einer Frau ...
Ambrosius Seth hat Coco hintergangen, auf Miniaturgröße geschrumpft und in den magischen Kubus gezwungen! Als sie kurz darauf in einer unbekannten, unwirtlichen Umgebung erwacht, ist Ambrosius verschwunden. Schneeflocken tanzen vor Cocos Gesicht, und zwischen ihnen erblickt sie Menschen, die sich ihr nähern ... Es sind Menschen, die sich auf grausame Weise verändert haben, denn sie tragen die grüne Pest in sich!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 153
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Cover
Was bisher geschah
DIE GRÜNE PEST
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
mystery-press
Vorschau
Impressum
Coco Zamis ist das jüngste von insgesamt sieben Kindern der Eltern Michael und Thekla Zamis, die in einer Villa im mondänen Wiener Stadtteil Hietzing leben. Schon früh spürt Coco, dass dem Einfluss und der hohen gesellschaftlichen Stellung ihrer Familie ein dunkles Geheimnis zugrundeliegt. Die Zamis sind Teil der Schwarzen Familie, eines Zusammenschlusses von Vampiren, Werwölfen, Ghoulen und anderen unheimlichen Geschöpfen, die zumeist in Tarngestalt unter den Menschen leben.
Die grausamen Rituale der Dämonen verabscheuend, versucht Coco den Menschen, die in die Fänge der Schwarzen Familie geraten, zu helfen. Ihr Vater sieht mit Entsetzen, wie sie den Ruf der Zamis-Sippe zu ruinieren droht. So lernt sie während der Ausbildung auf dem Schloss ihres Patenonkels ihre erste große Liebe Rupert Schwinger kennen. Aber das Glück ist nicht von Dauer. Auf einem Sabbat soll Coco zur echten Hexe geweiht werden. Asmodi, das Oberhaupt der Schwarzen Familie der Dämonen, hält um Cocos Hand an, doch sie lehnt ab. Asmodi kocht vor Wut und verwandelt Rupert Schwinger in ein Ungeheuer.
Seitdem lässt das Oberhaupt keine Gelegenheit aus, gegen die Zamis-Sippe zu intrigieren. So schickt Asmodi den Dämon Gorgon vor, der Wien und alle seine Bewohner zu Stein erstarren lässt – und die Stadt komplett aus dem Gedächtnis der Menschheit löscht. Nur Coco kann im letzten Augenblick entkommen, allerdings hat sie jede Erinnerung an ihre Herkunft verloren ... Kurz darauf wird Coco in einem geheimnisvollen Labyrinth mit Teilen ihrer Erinnerungen konfrontiert: In einer Vision findet sie sich in Wien wieder und steht ihrer versteinerten Familie gegenüber. Mehr denn je fühlt Coco sich nun verpflichtet, etwas gegen Gorgons Fluch zu unternehmen.
Ein erster Hinweis führt sie zum Schloss Laubach in Deutschland, wo sich eine uralte Dämonenbibliothek befindet. Coco stößt auf die Dämonenvita ihres Vaters, ein magisches Buch, das von einem affenartigen Wesen unter Verschluss gehalten wird. Diese Kreatur – der Bibliograf – verfasst die Lebensläufe unzähliger Dämonen für die umfangreiche Schlossbibliothek. Coco gelingt es, das Buch an sich zu bringen und das Vertrauen des Bibliografen zu gewinnen. Woher stammen die Zamis? Bisher weiß Coco nur, dass ihr Vater einst aus Russland nach Wien emigrierte und dort rasch eine herrschende Rolle innerhalb der Schwarzen Familie einnahm. Doch weshalb ist Michael Zamis überhaupt aus Russland geflohen? Je länger Coco sich in die Zamis-Biografie vertieft, desto klarer werden die Zusammenhänge zwischen damals und heute.
Inzwischen setzt auch Asmodi alles daran, in den Besitz der Dämonenvita zu gelangen. Er zerstört Schloss Laubach. Zwar kann Coco im letzten Augenblick entkommen, doch kurz darauf tappt sie in eine Falle, die Asmodis Helfershelfer Ambrosius Seth ihr gestellt hat. Coco wird auf Miniaturgröße geschrumpft und findet sich in einer unbekannten Umgebung wieder ...
DIE GRÜNE PEST
von Logan Dee
Jurij rieb sich den Schlaf aus den Augen.
Wie jeden Morgen war er um fünf Uhr aufgesprungen, um pünktlich um sechs seine Schicht im Bergwerk zu beginnen. Normalerweise war der Zweimeterhüne sofort hellwach, doch diesmal war es anders gewesen.
Er war neben Tanja, der Wirtstochter, erwacht. Selbst jetzt noch, während er die Hacke schwang, durchliefen ihn wohlige Schauer, wenn er an die vergangene heiße Liebesnacht dachte.
Tanja war ein Vollblutweib, drall und fleischig, mit großen Brüsten und ausladenden Hüften. Seine rauen Hände hatten jeden Quadratzentimeter ihres Körpers erforscht, und sie hatte ihm mit ihren Lustschreien zu verstehen gegeben, wo sie seine Pranken am liebsten hatte.
Sie hatten es die ganze Nacht getrieben, und nachher war er so erschöpft, dass er wie ein Stein geschlafen hatte.
1. Kapitel
Das Poltern der Männer unten im Schankraum hatte ihn geweckt. Seit einigen Nächten schlief niemand mehr allein in seiner Hütte. Sämtliche Männer des Dorfes versammelten sich vor Sonnenuntergang in der einzigen Kneipe des Ortes, betranken sich bis zum Umfallen und verbrachten dann den Rest der Nacht in der Wirtsstube.
Iwan, der Wirt, hatte nichts dagegen. Solange sein Geschäft florierte. Und das tat es, denn die Furcht ließ seine Gäste noch tiefer als sonst ins Glas gucken.
Doch Jurij dachte nicht an die Angst, er dachte noch immer an die himmlischen Wonnen, die Tanja ihm bereitet hatte. Und dafür hatte er nicht zahlen müssen.
Einen Augenblick hatte er nicht aufgepasst. Die Spitze der Hacke rutschte von dem Felsgestein ab und fraß sich tief in sein Schienbein.
»Blin!«, fluchte er. Gleichzeitig spürte er den Schmerz. Sein linkes Bein gab nach, und er sackte auf die Knie. Seine Kameraden waren zu weit entfernt, als dass sie den Unfall mitbekommen hatten. Daher bemerkten sie auch nicht, dass Jurij plötzlich stutzte und dann mit den Händen vorsichtig etwas ausbuddelte. Die Entdeckung, die er soeben gemacht hatte, ließ ihn jeden Schmerz augenblicklich vergessen.
In dem Geröll, das sich die letzten Tage über hier unten angesammelt hatte, war eine Hand zum Vorschein gekommen.
Jurij schob die Petroleumlampe näher heran. Eindeutig: Es handelte sich um eine Frauenhand! Vorsichtig legte er sie vollständig frei. Die Hand war schlank und grazil und wies weder Risse noch Schwielen auf. Es war keine Hand, die harte Arbeiten hatte verrichten müssen. Sondern eine, die ausschließlich dafür geschaffen war, einen Mann zu verwöhnen. Sofort musste er wieder an Tanja denken.
Zum Glück konnte es sich nicht um Tanja handeln, die hier begraben lag. Tanjas Hände hatten trotz ihrer bewiesenen Geschicklichkeit stets mit anpacken müssen.
Aber wer lag dann hier unter dem Geröll? In ganz Brsk gab es keine weitere Frau. Brsk war nicht mehr als ein Arbeiterlager. Keine Frau außer Tanja hatte es hier lange ausgehalten. Also musste die Tote aus einem der Nachbardörfer stammen.
Die Tote? Wer sagte ihm überhaupt, dass sie tot war? Ihre Hand fühlte sich weich und sogar noch etwas warm an. Sein eigener Schmerz war nun vollends vergessen. Rasch grub er weiter, räumte Geröll und Dreck beiseite und schaufelte den gesamten Arm frei. So wie es schien, trug die Frau keine Kleider. Jurij spürte, wie sein Herz schneller schlug bei dem Gedanken, ihren nackten Leib zu erblicken. Lebendig oder – tot!
Er verdrängte diesen Gedanken jedoch sofort wieder. Schließlich war er kein verdammter Leichenschänder! Umso wichtiger war es, dass die Frau unter ihm lebte.
Er grub weiter, ging jedoch sanfter dabei vor, als könnte er den Leib, dessen Konturen er unter seinen Fingern spürte, verletzen. Nach und nach legte er den Hals, die Schultern und die kleinen Brüste frei. Beim Anblick der Letzteren musste er schlucken. Obwohl er vergangene Nacht nun wahrlich auf seine Kosten gekommen war, hatte ihn selten zuvor ein Anblick derart erregt.
Die festen, weißen Brüste der Frau mit den deutlich abgesetzten dunklen Warzenhöfen starrten ihm einladend entgegen. Er spürte, dass er schwitzte.
»He, Jurij! Träumst du von Tanja, oder was ist los mit dir?«, hörte er die Stimme seines Kameraden zur Linken. Einen Augenblick lang dachte Jurij daran, seine Entdeckung preiszugeben. Es wäre die natürlichste Sache der Welt.
Doch er handelte nicht rational, sondern rein nach seinem Gefühl, und dieses sagte ihm, dass er diese Frau für sich haben wollte. Ganz allein. Keiner der anderen würde sie bekommen! Also wiegelte er ab: »Nein, nein, Wladimir, ich bin nur nach der letzten Nacht etwas schlapp, wie du dir denken kannst. Dieses Weibsstück hat den Teufel im Leib ...«
Er hörte Wladimirs raues Lachen. Das waren genau die Worte, die dieser hatte hören wollen. Doch er musste vorsichtiger sein, damit die anderen nichts von seinem Fund mitbekamen. Rasch bedeckte er den freigelegten Oberkörper, Arme und Gesicht wieder mit dem losen Schutt. Dabei nahm er das eigenartige grüne Leuchten wahr. Er fuhr zurück und bekreuzigte sich.
Doch dann hörte er die Stimme in seinem Kopf. Sie beschwor ihn, jetzt nicht den Verstand zu verlieren, sondern seine ganze Schlauheit auszuspielen.
Jurij schnappte sich erneut die Hacke und fuhr mit seiner eigentlichen Arbeit fort. Er konnte es kaum erwarten, dass die Schicht zu Ende ging.
Ich hatte das Gefühl zu ersticken. Es war, als würde eine unsichtbare Riesenhand meinen Körper umfassen und gnadenlos zudrücken. Die Angst, zerquetscht zu werden, ließ mich aufschreien. Verzweifelt versuchte ich, einen Gegenzauber anzuwenden. Es war zwecklos. In der Umgebung, in die Ambrosius mich hineinkatapultiert hatte, schienen meine Kräfte völlig zu versagen. Ein dunkler Schleier trat vor meine Augen. Ich schmeckte Blut in meinem Mund.
Ambrosius tauchte als titanengroße Gestalt vor mir auf. Er wirkte grotesk verzerrt – als würde ich ihn durch ein Prisma betrachten. Ich sah, wie sich seine Lippen zu einem höhnischen Lachen verzogen. Doch kein Geräusch drang an mein Ohr. Außer einem Rauschen, das immer stärker wurde und eher dem Druck auf meinen Körper zuzuschreiben war.
Dann plötzlich änderten sich Ambrosius' Gesichtszüge. Entsetzen über seine Miene. Er schrie etwas, doch kein Laut kam bei mir an.
Gleichzeitig spürte ich, wie der Schmerz in meiner Brust schier unerträglich wurde. Eine Faust schien mich zu packen und durch die Luft zu wirbeln. Mir schwanden die Sinne ...
Als ich erwachte, war Ambrosius' Gesicht verschwunden, und ich hatte das Gefühl, mich wieder in der Wirklichkeit zu befinden. Doch etwas stimmte immer noch nicht. Diese Umgebung war mir unbekannt. Es war kalt, und Schneeflocken tanzten vor meinen Augen. Ich dachte an Ambrosius verzerrte Fratze. Er hatte mich hintergehen wollen, aber etwas war schiefgegangen. Wahrscheinlich war ihm sein eigener Zauber außer Kontrolle geraten!
Wo befand ich mich? Ich streckte meine Hand nach den Schneeflocken aus, doch sie lösten sich vor meinen Augen auf. Meine Hand stieß gegen undurchdringliches Glas. Ich war gefangen!
Enttäuscht setzte ich mich nieder. Auch der Boden schien aus Glas zu bestehen. Durch ihn hindurch sah ich darunter die Schneedecke, ohne dass ich sie berühren konnte.
Es dauerte, bis ich begriff, dass ich mich in dem magischen Kubus befand. Aber wie war das möglich? Und wie kam der Kubus in diese Umgebung?
Ich tastete nach der Dämonenvita. Ich trug sie immer noch bei mir! Also hatte Ambrosius zumindest in dieser Hinsicht sein Ziel nicht erreicht ...
Wenigstens bekam ich genug Luft.
Lange Zeit geschah nichts, während es mir immer kälter wurde. Ich fragte mich, wie lange ich in diesem Zustand würde ausharren können. Stunden schienen zu vergehen, ohne dass ich hätte sagen können, wie viele es waren. In meinem Gefängnis hatte ich jegliches Zeitgefühl verloren.
Dämmerung setzte ein.
Da senkte sich ein riesiger Schatten auf mich nieder.
Erschrocken fuhr ich herum. Ein bis in den Himmel ragendes Pferdegespann raste auf mich zu. Der Boden erzitterte wie bei einem Erdbeben. Kurz vor dem Kubus stoppten die Pferde. Jemand hatte sie zum Halten gebracht.
Dieser Jemand näherte sich nun ebenfalls mit Riesenschritten. Er bückte sich nach mir – eine gewaltige Pranke umfasste den Kubus und hob ihn hoch. Ich fühlte mich ordentlich durchgeschüttelt. Ein Monsterauge tauchte vor mir auf, aber offensichtlich erkannte es mich nicht in dem Kubus.
»Ein seltsames Kleinod«, murmelte eine männliche Stimme. »Aber auch wenn es ein Werk des Teufels scheint, werde ich es an mich nehmen. Vielleicht lässt es sich ja zu klingender Münze machen.«
Dann senkte sich Finsternis über mich.
Aus der Dämonenvita des Michael Zamis
Irgendetwas stimmt hier nicht. Ich sehe es den Leuten an der Nasenspitze an. Als ich den Gastraum des Schwarzen Ochsen betrete, betrachten sie mich, als sei ich der Teufel.
Wie recht sie haben.
Meine Reise, die mich von St. Petersburg bis in diese unwirtliche Gegend verschlagen hat, hat Spuren an mir hinterlassen. Ich fühle mich wie ein Tier, das zuallererst seine elementaren Bedürfnisse befriedigen muss. Ein paar Kanten Brot zum Essen, aber auch schon mal einen Hahn, dem ich bei lebendigem Leib den Kopf abbeiße, um sein kräftigendes Blut zu trinken. Hier und da bitte ich um einen Becher Wasser, um nicht zu verdursten, aber ich bin auch dem Wodka nicht abgeneigt, den mir manche schöne Hand reicht.
Und die Hand nehme ich dazu.
Die letzten drei Tage und Nächte bin ich ununterbrochen gewandert. Zuvor habe ich mich in Wolowak umgesehen, doch schnell hat es mich weitergetrieben, nachdem ich ein paar wohlhabenden Händlerfrauen zum Leidwesen ihrer Männer allzu deutlich den Hof gemacht habe. Mit der Erinnerung an einen orgiastischen Abschied und einem prall gefüllten Geldbeutel fiel mir der Abschied umso leichter.
Und nun also Brsk. Ich habe nie von diesem Dorf gehört und hätte den Namen auch nie zur Kenntnis genommen, wenn es nicht auf dem zerfallenen Schild am Ortseingang gestanden hätte.
Die meisten Hütten wirken zerfallen. Nirgendwo sehe ich Licht. Das Dorf hat bessere Tage gesehen.
Genau wie ich. Dem ununterbrochenen Marsch verdanke ich das Aussehen eines Wilden. Meine Haare sind fettig und verfilzt, meine Kleidung stinkt nach Dreck und Kot, und in meinem ausgemergelten Gesicht glänzen zwei fiebrige Augen.
Mögen sie mich allesamt für einen Streuner halten: Die Gäste, die hier im Schwarzen Ochsen versammelt sind, sehen in der Mehrzahl nicht gepflegter aus. Ich vermute, dass es sich um Bergleute handelt. Ihre Gesichter sind so schwarz wie meins.
»Dobry vecher«, grüße ich laut genug, dass mich alle hören, und sehe dabei den mir am nächsten sitzenden Männern fest und selbstbewusst in die Augen. Sie senken den Blick, kaum dass sie den meinen treffen. Einige erwidern leise murmelnd meinen Gruß.
Zum Teufel, auf was für einen Haufen Verlierer bin ich hier gestoßen?
Erst nachdem auf diese Weise die Machtverhältnisse hergestellt sind, bequeme ich mich, die schwere Tür hinter mir zu schließen. Ein rauer, kalter Wind ist mit mir hereingefegt gekommen. Erst jetzt fällt mir auf, dass die Tür mit mehreren schweren Riegeln von innen gesichert werden kann.
Verlierer und Angsthasen, denke ich abfällig und stampfe Richtung Theke, die sich am anderen Ende des Raumes befindet. Fast habe ich den Eindruck, als weichen die Gäste vor mir zurück, als ich an ihnen vorbeigehe. Jedenfalls beeilen sie sich, mir nicht im Wege zu stehen.
Der Gastraum ist so niedrig, dass ich mehrmals den Kopf einziehen muss, wenn ich auf einen Deckenbalken stoße. Die Gäste, die hier sitzen, rauchen und trinken, sind allesamt kleiner als ich. Ihre gebückte Haltung verdanken sie wahrscheinlich jahrelanger Schinderei im Bergwerk.
Der Wirt sieht mir verängstigt entgegen. Ich registriere, dass seine Hände leicht zittern.
»Willkommen in meinem bescheidenen Hause«, begrüßt er mich beflissen. »Was kann ich für Euch tun?«
»Zunächst einmal befeuchtet die durstende Kehle eines weit gereisten Pilgers«, verlange ich, und der Wirt beeilt sich, mir einen gefüllten Krug zu kredenzen. Tatsächlich scheint es mir, als habe ich seit einer Ewigkeit keine Flüssigkeit mehr zu mir genommen. Ich setze den Krug an, schmecke den Alkohol, nehme einen tiefen Schluck – und spucke ihn in einem Strahl wieder aus.
»Was wagst du mir für ein Gebräu anzubieten?«, schreie ich und packe den Wirt über die Theke hinweg am Kragen. »Willst du mich vergiften?«
»Aber das trinken sie alle hier!«, verteidigt er sich röchelnd.
»Wahrscheinlich haben deine Gäste davon ihre krummen Glieder!«
»Ich werde Euch meinen besten Tropfen herbeiholen«, japst mein Opfer. »Er wird euch garantiert besser munden.«
Ich lasse den Schwächling los, und er stürzt fort. Ich nutze die Gelegenheit, um mich umzublicken. Doch die anderen Gäste geben sich so, als hätten sie von dem Vorfall nichts mitbekommen. Sie unterhalten sich leise und spielen Karten, als sei nichts geschehen. Ein alter, zahnloser Mann untermalt die Tristesse mit einer rührseligen Melodie auf seiner Balalaika.
Der Wirt kommt wieder herangestürzt, unter dem Arm ein hölzernes Fässchen. Seine Wangen glühen vor Eifer. »Dieser Tropfen wird Euch munden, Herr. Er stammt aus St. Petersburg.«
Ich speie abermals aus. »Da komme ich her«, sage ich. »Und glaub mir, ich kann einen guten Wein von einem schlechten unterscheiden. Wehe dir, wenn du mich wieder reinzulegen versuchst!«
Rasch schlägt er ein Loch in das Fass und fängt das hervorsprudelnde rote Gold mit einem Becher auf. »Trinkt und urteilt selbst!«, sagt er stolz. »Ihr werdet nicht enttäuscht sein!«
»Bin ich eine Maus, die sich mit einem Fingerhut begnügt?« Ich schlage ihm den Becher aus der Hand und greife nach dem Fass. Ich schätze sein Volumen auf fünf Liter. Ich hebe es hoch und presse meine Lippen an das Spundloch. Dann lasse ich den süffigen Roten meine Kehle hinuntersprudeln. Der Wirt hat nicht zu viel versprochen.
Nachdem ich mir auch den letzten Tropfen einverleibt habe, setze ich das Fass ab. Der Wirt sieht mich ungläubig an. Mir ist es egal, was er von mir denkt, mein Durst ist zumindest gestillt, und Hunger verspüre ich keinen.
Wohl aber den Hunger der Neugier. Mehr denn je sagen mir meine magischen Sinne, dass im Schwarzen Ochsen etwas nicht stimmt. Die Angst derer, die sich hier versammelt haben, kann ich geradezu riechen.
Und diese Angst hat nicht mit meinem Erscheinen zu tun. Bevor ich jedoch eine Frage stellen kann, tritt aus der Kammer hinter dem Schankraum ein junges Mädchen hervor. Es wirft mir nur einen beiläufigen Blick zu und geht hocherhobenen Hauptes an mir vorbei.
Ich drehe mich nach ihr um und betrachte wohlgefällig ihren wiegenden Gang. Sie ist noch sehr jung, doch ihr Körper bereits mit allen Attributen gesegnet, die ein Mann an einer Frau zu schätzen weiß. Ihre prallen Brüste heben sich nur allzu deutlich unter ihrer dünnen Baumwollbluse ab. Ihr blondes, dichtes Haar trägt sie als Zöpfe gebunden.
Was meine Aufmerksamkeit jedoch noch mehr erregt, ist der Korb, den sie unter dem Arm trägt und aus dem sie nun kleine tönerne Drudenfüße und andere Dämonenbanner fischt. Diese bringt sie vor den Fenstern und Türen an.
»Was soll dieser Firlefanz?«, fahre ich den Wirt an. Ich spüre, dass mir die Banner nicht sehr behagen.
»Verzeiht meiner Tochter, aber wir müssen uns auf diese Weise schützen. Es ist das Einzige, was hilft.«
»Gegen wen wollt ihr euch schützen?«, frage ich ungeduldig. Selbst auf die Entfernung hinweg verursachen die Dämonenbanner ein leichtes Unwohlsein bei mir. Sie können mir nicht wirklich schaden oder mich davon abhalten, jemandem, der mir einen Drudenfuß entgegenhält, die Kehle durchzuschneiden. Aber sie sind lästig.
»Gegen die Teuflischen«, sagt der Wirt nun. »Wir nennen sie so, weil wir sicher sind, dass sie direkt der Hölle entstammen.« Er speit aus, um seine Verachtung zu demonstrieren.
Allmählich verstehe ich. Daher also ist die versammelte Männerschar derart verängstigt.
Ich rülpse. Der Rote ist gut, aber vielleicht doch ein wenig zu viel gewesen nach den vielen Tagen der Abstinenz. »Erzählt mir mehr«, verlange ich. »Was wollen diese Teuflischen von euch?«
»Was mögen sie schon wollen: unsere Seelen«, plappert der Wirt. »Ein paar von uns haben sie schon verschleppt, aber seitdem wir uns allabendlich hier zusammenfinden und die Drudenfüße aufhängen, kommen sie seltener. Wahrscheinlich traktieren sie stattdessen lieber die Nachbardörfer. Hier jedenfalls haben sie kein Glück.«