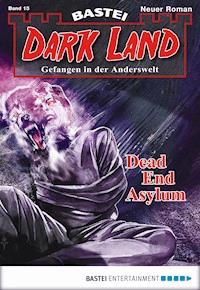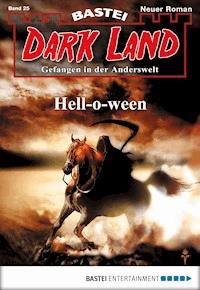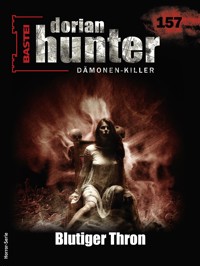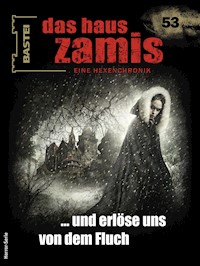
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Das Haus Zamis
- Sprache: Deutsch
Aus der Dämonenvita des Michael Zamis
Sieben Tage und Nächte bin ich durchmarschiert, nur unterbrochen von kurzen schwarzmagischen Meditationen, um aufzutanken. Vor mir taucht ein Dorf auf. Bisher habe ich jede größere Ansammlung von Häusern bewusst gemieden - und nein, ich suche fürwahr die Menschen nicht. Doch ich weiß, wo immer es Menschen gibt, existieren unter ihnen die Dämonen.
Die Schwarze Familie.
Meine Familie.
Coco hat Dolorus unschädlich gemacht und einen Hinweis auf einen weiteren Tungusku-Splitter erhalten, der helfen könnte, den Bann über Wien aufzuheben. Auf dem Weg nach Zwickau liest sie erneut in der Vita ihres Vaters - und bemerkt zu spät, dass Traudel Medusas Wagen von dämonischen Kräften manipuliert wird. Auf einmal findet sie sich in einem schwarzen Tunnel wieder, der in eine andere Dimension zu führen scheint ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 140
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Cover
Was bisher geschah
... UND ERLÖSE UNS VON DEM FLUCH
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
mystery-press
Vorschau
Impressum
Coco Zamis ist das jüngste von insgesamt sieben Kindern der Eltern Michael und Thekla Zamis, die in einer Villa im mondänen Wiener Stadtteil Hietzing leben. Schon früh spürt Coco, dass dem Einfluss und der hohen gesellschaftlichen Stellung ihrer Familie ein dunkles Geheimnis zugrundeliegt. Die Zamis sind Teil der Schwarzen Familie, eines Zusammenschlusses von Vampiren, Werwölfen, Ghoulen und anderen unheimlichen Geschöpfen, die zumeist in Tarngestalt unter den Menschen leben.
Die grausamen Rituale der Dämonen verabscheuend, versucht Coco den Menschen, die in die Fänge der Schwarzen Familie geraten, zu helfen. Ihr Vater sieht mit Entsetzen, wie sie den Ruf der Zamis-Sippe zu ruinieren droht. So lernt sie während der Ausbildung auf dem Schloss ihres Patenonkels ihre erste große Liebe Rupert Schwinger kennen. Aber das Glück ist nicht von Dauer. Auf einem Sabbat soll Coco zur echten Hexe geweiht werden. Asmodi, das Oberhaupt der Schwarzen Familie der Dämonen, hält um Cocos Hand an, doch sie lehnt ab. Asmodi kocht vor Wut und verwandelt Rupert Schwinger in ein Ungeheuer.
Seitdem lässt das Oberhaupt keine Gelegenheit aus, gegen die Zamis-Sippe zu intrigieren. So schickt Asmodi den Dämon Gorgon vor, der Wien und alle seine Bewohner zu Stein erstarren lässt – und die Stadt komplett aus dem Gedächtnis der Menschheit löscht. Nur Coco kann im letzten Augenblick entkommen, allerdings hat sie jede Erinnerung an ihre Herkunft verloren ... Kurz darauf findet sie sich jedoch in einer Vision in Wien wieder und steht ihrer versteinerten Familie gegenüber. Nach und nach gewinnt sie ihre Erinnerung zurück und fühlt sich mehr denn je verpflichtet, etwas gegen Gorgons Fluch zu unternehmen.
In einer Bibliothek auf Schloss Laubach in Deutschland stößt Coco auf die Dämonenvita ihres Vaters. Bisher wusste sie nur, dass ihr Vater einst aus Russland nach Wien emigrierte. Aus der Dämonenvita erfährt sie, dass er zuvor über Jahre hinweg seinen Halbbruder Rasputin bekämpft hat. Coco wird klar, dass die damaligen Ereignisse für die Rettung ihrer Familie von elementarer Bedeutung sein könnten.
Aus diesem Grund setzt auch Asmodi alles daran, die Dämonenvita in seinen Besitz zu bringen, und schleudert Coco mit Hilfe des Antiquars Ambrosius Seth in die Vergangenheit. Dort begegnet sie nicht nur ihrem Vater Michael Zamis, sondern auch dessen Vater Dorghai – in der Tunguska-Region, die vom Einschlag eines Meteoriten zerstört wurde. Offenbar wohnen den Splittern des Meteoriten magische Kräfte inne, die helfen könnten, Gorgons Bann zu brechen. Mit Hilfe eines solchen Splitters gelingt Coco die Rückkehr in die Gegenwart – in Begleitung von Dorghai! Allerdings wird der Splitter während der Reise zerstört. Kurz darauf erhalten Dorghai und Coco von der Dämonin Traudel Medusa den Hinweis, dass sich in einem Museum in Zwickau ein weiteres Exemplar befinden könnte. Aber steht Traudel wirklich auf ihrer Seite ...?
... UND ERLÖSE UNS VON DEM FLUCH
von Logan Dee
Aus der Dämonenvita des Michael Zamis
Sieben Tage und Nächte bin ich durchmarschiert, nur unterbrochen von kurzen schwarzmagischen Meditationen, um meine Kräfte wieder aufzutanken. Vor mir taucht ein Dorf auf. Der Beschriftung auf dem Schild am Ortseingang entnehme ich, dass es sich um Novograd handelt. Es ist anders als Brsk. Größer, nicht nur eine Ansammlung armseliger Hütten der Bergwerksleute. Es gibt eine Einkaufsstraße mit hübschen Läden, eine Schule, und sogar eine Kirche entdecke ich. Um Letztere mache ich einen großen Bogen.
Obwohl Novograd herausgeputzt ist, spüre ich, dass hier etwas nicht stimmt. Es schneit, aber auch das scheint mir kein triftiger Grund zu sein, dass alles derart verwaist ist. Zumal heute, am letzten Tag des Jahres. Der Altjahresabend steht bevor.
Bisher habe ich jede Ansammlung von Häusern gemieden. Ich suche die Menschen nicht. Doch ich weiß, wo immer es Menschen gibt, existieren unter ihnen die Dämonen.
Die Schwarze Familie. Meine Familie.
1. Kapitel
Unser Vater hat uns über unsere Herkunft aufgeklärt und auch erzählt, was es mit der Schwarzen Familie auf sich hat, zu der wir uns zusammengeschlossen haben. Unser Oberhaupt ist Asmodi, der Fürst der Finsternis, aber nur die mächtigsten Sippen stehen in direktem Kontakt zu ihm.
Auf meinem siebentägigen Marsch ist mir mein Ziel immer bewusster geworden: Ich möchte Asmodi dienen. Ich möchte mächtig werden und eine einflussreiche Sippe gründen. Und ist es vermessen, den Gedanken zu hegen, selbst in ferner Zukunft den Thron der Finsternis besteigen zu wollen?
Doch zuvor muss ich beweisen, dass meine Kräfte denjenigen meiner Widersacher überlegen sind. Rasputin wird der Erste sein, der meine neue Macht zu spüren bekommen wird.
Doch ich denke nicht nur an zukünftige Kämpfe. Ich bin neugierig auf meine Familie. Ich will sie alle kennenlernen, die Vampire, Werwölfe, Hexen und anderen Geschöpfe der Nacht. Zwar habe ich schon in St. Petersburg mit einigen von ihnen Bekanntschaft gemacht, aber nie daran gedacht, in ihnen potenzielle Verbündete zu sehen.
Ich verweile vor einem Hutgeschäft. Ein Hutgeschäft in dieser Gegend kommt mir einigermaßen grotesk vor. Aber dann entdecke ich in dem Schaufenster neben modischem Zierrat auch praktische Fellmützen, Handschuhe und dergleichen Accessoires mehr, die vor der strengen Kälte schützen.
Meine große Gestalt spiegelt sich in dem Schaufenster. Ich sehe aus wie jemand – nun, exakt wie jemand, der einen siebentägigen Gewaltmarsch hinter sich hat. Meine Wangen sind hohl, meine Augen liegen in tiefen Schattenseen.
Ich schaue durch die Scheibe hindurch an meinem Spiegelbild vorbei in den Laden. Eine einzige Frau steht dort hinter der Kasse. Sie hat mich ebenso erspäht wie ich sie. Sie wirkt erschrocken.
Ich begebe mich zur Tür, drücke die Klinke hinunter und trete ein. Ein harmonisch klingendes Glockenspiel empfängt mich. Ich verziehe das Gesicht. Meine Zuneigung gilt eher der disharmonischen Musik.
Ich erinnere mich an einen verrückten Komponisten, den ich vor Jahren getroffen habe. Er hat eine Musik entwickelt, die so schrecklich in den Ohren der Menschen klang, dass es mir ein reines Vergnügen war, ihr zuzuhören. Er nannte sie Zwölftonmusik und sprach von einer großen Erfindung. Weil die Menschen in Russland seine Musik verabscheuten, entschloss er sich, nach Wien auszuwandern, in die Stadt, in der einst Mozart gewirkt hatte. Auch auf mich übt diese Stadt eine besondere Anziehung aus. Ich habe schon viel von ihr gehört. Ich weiß nicht, was aus dem fremden Musikus geworden ist, aber vielleicht werde ich eines Tages ebenfalls nach Wien reisen und ihn ausfindig machen.
Die Verkäuferin hinter der Theke schaut mich ängstlich an. Ich bin sicher, wenn sie könnte, so würde sie vor mir zurückweichen. Doch direkt hinter ihr befindet sich eine Regalwand. Wahrscheinlich wirke ich auf sie wie ein sibirischer Waldgeist.
Sie ist hübsch. Jung. Höchstens zwanzig. Ihr schwarzes Haar trägt sie zu einem Pferdeschwanz gebunden. Ihr Kleid schmiegt sich um einen fraulichen Körper. Der Busen hebt und senkt sich unter ihrer aufgeregten Atmung.
Mir wird bewusst, dass ich lange keine Frau mehr gehabt habe. Mein abschätzender Blick, in dem wahrscheinlich so etwas wie Gier lodert, macht sie noch ängstlicher. Ich vermag ihre Angst nachgerade zu riechen. Doch sie braucht keine Furcht zu haben. Ich bin mir bewusst, dass es mir nicht die geringste Befriedigung verschaffen würde, ihr etwas anzutun. Mein Hunger ist anderer Natur.
»Guten Tag«, sage ich. »Verzeihen Sie einem weit gereisten Wanderer, dass er einfach so hier hereinschneit. Ich bin auf dem Weg nach St. Petersburg.«
Sie atmet sichtlich auf, entspannt sich und erwidert den Gruß.
»Ich habe seit sieben Tagen keine Menschenseele mehr gesehen«, fahre ich fort. »Der Lichtschein in Ihrem Geschäft ist der erste, den ich erblicke. Keine Angst, ich will keine Almosen. Aber können Sie mir sagen, wo ich hier für eine Nacht unterkommen kann? Ich zahle gut!«
»Es tut mir leid, Herr, aber es gibt kein Hotel in Novograd. Die letzte Herberge hat vor zwei Wochen geschlossen.«
»Aber irgendwo wird es doch einen Ort geben, an dem ich übernachten kann«, wundere ich mich. »Ich bin auch mit einem Stall zufrieden, wenn nur der Strohballen trocken und weich ist.«
Sie verschränkt die Arme, ihre Gesichtszüge wirken plötzlich abweisend. »Es gibt hier keinen Stall. Sie müssen zum nächsten Ort wandern. Er ist nur drei Fußstunden entfernt.«
Ich könnte sie jetzt mit einem Wimpernschlag vernichten. Ich könnte sie zwingen, alles für mich zu tun. Mich für eine Nacht aufzunehmen, wäre noch das Geringste. Doch ich spüre hinter ihrer schroffen Art ihre Angst. Ich spüre ein Geheimnis. Sie interessiert mich. Ich beschließe, Novograd erst wieder zu verlassen, wenn ich dieses Geheimnis ergründet habe.
Ich nicke, gebe mich scheinbar geschlagen und verabschiede mich. Noch während ich mich umdrehe, höre ich sie fragen: »Wie heißen Sie?«
»Mein Name ist Mikhail Zamis«, höre ich mich antworten. Jetzt hat sie mich doch verblüfft. Offenbar ist ihre Neugierde größer als ihre Angst. »Warum wollen Sie das wissen?«
»Nur für den Fall, dass sich jemand nach Ihnen erkundigt. Wenn Sie verloren gehen ...«
»Sie meinen, wenn mir auf dem Weg zur nächsten Stadt etwas passiert?«
Sie nickt, schweigt aber und wendet sich ihren Hüten zu. Abermals will ich es dabei bewenden lassen, als mir noch etwas einfällt. Eigentlich wäre es Zufall, aber ich will die Frage dennoch stellen: »Ist vor zwei Jahren ein Mann namens Rasputin hier durchgekommen?«
Sie wankt zurück, bekreuzigt sich, das Gesicht aschfahl. Dann fällt sie in Ohnmacht.
Als sie wieder erwacht, schaut sie mich mit großen, ängstlichen Augen an. Sie will schreien, aber ich beruhige sie. »Es ist alles in Ordnung«, sage ich so sanft, wie es mir möglich ist. Dabei verfluche ich mich im Stillen. Ich benehme mich wie ein Mensch! Immer noch ...
Ich habe sie in das Hinterzimmer getragen und auf ein Bett gelegt. Anscheinend wohnt sie hier. Es ist bescheiden und karg eingerichtet, mit kaum mehr als dem Nötigsten. Ich habe den Ofen angezündet und für eine behagliche Wärme gesorgt. Sogar Tee habe ich gekocht.
Sie beruhigt sich allmählich. Dann spricht sie. »Entschuldigen Sie, aber als Sie diesen Namen erwähnten ... Er hat alles Leid in Novograd verursacht. Bevor er kam, war dies ein blühendes Dorf. Ich lebte bei meinen Eltern und Geschwistern in ihrem großen Haus. Jetzt wohnen dort die Ratten. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis niemand mehr hier ist ...«
»Was ist passiert? Und was hat Rasputin damit zu tun?« Diesmal fällt sie nicht in Ohnmacht. Sie sagt: »Ich kann Sie nicht zwingen, Novograd zu verlassen. Meinetwegen also bleiben Sie, auf Ihre eigene Verantwortung.«
Als ich sie verlasse, schließt sie hinter mir ab. »Klopfen Sie dreimal, dann weiß ich, dass Sie es sind, Mikhail«, verabschiedet sie mich. Ich weiß mittlerweile ihren Namen, Sabinija, doch viel mehr weiß ich nicht über sie. Sie schweigt beharrlich. Einmal ertappe ich mich dabei, dass ich sie hypnotisieren will, um das Geheimnis zu ergründen, aber meine Vermutung, dass Rasputins Einfluss auf das Mädchen zu groß ist, bestätigt sich. Also muss ich es auf andere Weise versuchen.
Obwohl mich Sabinija gewarnt hat, will ich noch einmal einen Rundgang durch Novograd machen.
Der Schneefall ist heftiger geworden. Überall entlang der Hauptstraße blitzen die erleuchteten Schaufenster der Geschäfte wie die Perlen an einer Kette. Auch ein Rathaus, eine Schule und ein Wirtshaus mache ich aus. Im Gegensatz zu den Wohnhäusern wirken diese wenigstens lebendig.
Meine Schritte lenken mich in das Wirtshaus. Unwillkürlich muss ich daran denken, dass ich, nachdem ich das letzte Mal eines betreten habe, eine Reihe ungewöhnlicher Abenteuer erlebte. Das war in Brsk.
Ich öffne die Tür zum Schankraum. Zwei Dutzend Köpfe wenden sich mir zu. Männer, Frauen und Kinder. An meinen Schuhen kleben Schnee und Eis, aber das stört mich nicht.
»Schnell, schließen Sie die Tür!«, ruft der eilig herbeilaufende Wirt. An seinem Blick erkenne ich, dass es nicht die Kälte ist, die er fürchtet. Die ganze Situation kommt mir immer mehr wie damals in Brsk vor, als die Grüne Pest wütete.
Die Männer und Frauen weichen zurück, als ich näher trete. Allmählich werde ich wütend. »Habe ich die Pest an mir?«, schreie ich. »Ich bin sieben Tage und Nächte gewandert und will nichts weiter als ein Quartier!«
»Wir haben kein Quartier«, antwortet der Wirt.
»Warum feiert ihr nicht? Es ist der letzte Abend des alten Jahres. Warum geht ihr nicht einfach nach Hause zu euren Familien?«
»Heute geht niemand nach Hause«, flüstert einer der Gäste, ein alter Mann mit einem zu zwei Zöpfen geflochtenen Bart. Er ist betrunken. Speichel rinnt aus seinen Mundwinkeln. »Heute kommen die Wurdelaks!«
»Halt dein Maul, Alter!«, ruft ein anderer Gast. »Du rufst sie noch herbei mit deinem Gerede!«
»Die Wurdelaks«, spotte ich, aber ich bin auch neugierig geworden. »Sprecht ihr von Vampiren?«
»Gehen Sie!«, bedrängt mich der Wirt. »Sie dürfen diesen Namen nicht aussprechen. Er bringt Unheil!«
Ich lasse meine Blicke schweifen und sehe erst jetzt, dass überall Knoblauchknollen hängen. Die werden euch kaum helfen, denke ich.
»Ich gehe, wenn ihr mir reinen Wein einschenkt«, gebe ich scheinbar nach. »Glaubt ihr, ich will in einem Dorf übernachten, in dem es Wurdelaks gibt? Da laufe ich lieber heute Nacht die drei Stunden zum nächsten Dorf!«
»Dann sollten Sie ich schnell auf den Weg machen«, rät mir der Wirt. »Sie kommen erst zur Mitternachtsstunde. Noch ist also Zeit zu fliehen ... Sie wollen wissen, weshalb wir uns hier in Furcht zusammengerottet haben? Vor zwei Jahren kam ein Fremder in unser Dorf. Wir nahmen ihn in aller Gastfreundschaft auf, aber er dankte es uns schlecht. Sein Name war Rasputin. Er verführte unsere Frauen und Kinder, säte Zwietracht, wo er nur konnte.«
»Warum habt ihr ihn nicht vertrieben?«
Einige der Männer lachen höhnisch auf.
»Wir haben es versucht«, erklärt der Wirt, »aber Rasputin betete den Teufel an. Er stand mit ihm im Bunde! Ein paar der mächtigsten und kräftigsten Männer taten sich zusammen und jagten ihn aus der Stadt. Wir dachten, ihn los zu sein, doch nach einer Woche kam er wieder. In seiner Begleitung befand sich ein Wurdelak. Der Wurdelak wütete entsetzlich unter uns. Fast jede Nacht fand er ein neues Opfer, während Rasputin sich in diesem Gasthaus einrichtete und uns selbst die Tage zur Hölle machte.« Die Stimme des Wirts ist jetzt vor Wut verzerrt. »Er ließ sich unsere schönsten Töchter bringen, um sich mit ihnen zu vergnügen. Familien, die sich weigerten, schickte er den Wurdelak.«
»Ihr hättet ihn einfach töten sollen«, sage ich gedankenverloren. Das jammervolle Schicksal der Menschen interessiert mich nicht besonders.
»Du kennst Rasputin nicht«, sagt der Wirt mit bitterer Miene, »sonst würdest du anders reden.«
»Wo ist Rasputin jetzt?«
»Schließlich wurde ihm der Aufenthalt langweilig. Ich hörte mit eigenen Ohren, wie er davon sprach, dass in St. Petersburg weit schönere Frauen und größere Reichtümer auf ihn warteten. Bevor er verschwand, mussten wir ihm unser Bargeld aushändigen. Außerdem belegte er Novograd mit einem Fluch, damit wir ihn nie vergessen würden.«
»Was für ein Fluch?«
»Zunächst wussten wir es auch nicht. Als Rasputin verschwand, ging auch der Wurdelak. Wir atmeten auf. Doch vor genau einem Jahr, ebenfalls am Altjahresabend, während wir alle in unseren Häusern feierten, klopfte es an die Türen. Draußen standen unsere engsten Verwandten – jene, die der Wurdelak ein Jahr zuvor getötet hatte. Sie alle waren längst begraben worden. Dass sie nun um Einlass begehrten, konnte nur eines bedeuten: Sie waren ebenfalls Wurdelaks. Und wie alle Untoten zog es sie in ihr Haus zurück ...«
»Ihr habt sie hoffentlich vernichtet.«
»Es waren unsere Schwestern und Brüder! Nur wenige von uns brachten es übers Herz, das Richtige zu tun. Die meisten aber waren so gelähmt vor Schreck und Freude, dass sie die Wurdelaks in ihr Haus baten.«
Ich ahne, was dann geschehen ist. Wer einen Wurdelak über die Schwelle seines Haus bittet, der wird von ihm angefallen und ausgesaugt.
»Es gab drei Dutzend Opfer!«, schreit einer der Männer an der Theke erbost. »Jetzt wissen wir, wie Rasputins Fluch lautet!«
Ich lache auf. »Ihr glaubt also, dass die Wurdelaks am letzten Tag eines jeden Jahres wiederkehren – so lange, bis sie jede Menschenseele in Novograd ausgerottet haben?«
»Sie sind ein Fremder«, sagt der Wirt. »Wir können es Ihnen nicht übel nehmen, dass Sie uns nicht glauben.«
»Wenn sie euch zu Hause nicht vorfinden, werden sie nach euch suchen.«
»Für diesen Fall haben wir vorgesorgt«, schaltet sich einer der Wartenden ein. Ein Hüne von Mann, der sogar mich überragt. Er deutet auf die Knoblauchgirlanden. »Damit schlagen wir sie in die Flucht!«
Jetzt kann ich mich kaum mehr halten vor Lachen. Knoblauch. Diese Männer sind echte Helden. »Die Knoblauchzehen werden euch nicht helfen. Ich habe die alten Bücher studiert. Es gibt nur ein Mittel, einen Wurdelak zu töten: mit einem spitz zugefeilten Pfahl, den man mitten durch sein Herz treibt. Aber es darf nicht irgendein Pfahl sein – er muss von einer Schwarzdornhecke stammen!«
Der Hüne zieht die Stirn in Falten. »So, studiert haben Sie. Doch wer sagt uns, dass Sie uns nicht an der Nase herumführen wollen? Vielleicht sind Sie ja selbst ein Wurdelak!«