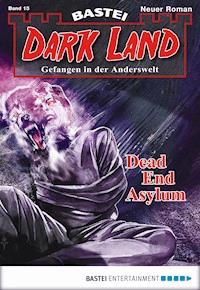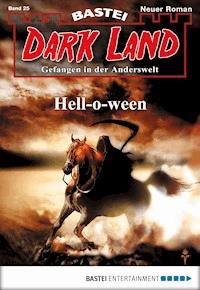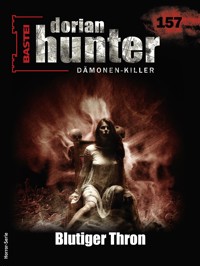Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Zaubermond Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Das Haus Zamis
- Sprache: Deutsch
Coco Zamis steht vor den Trümmern ihrer Vergangenheit. Um endgültig mit allem abzuschließen, verlässt sie ihre Heimatstadt Wien und reist einem unbekannten Ziel entgegen. Als der Zug auf offener Strecke hält, trifft sie auf sechs weitere Reisende, die fortan ihr Schicksal bestimmen. Denn niemand ist der, der er zu sein vorgibt ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 253
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Allem Anfang wohnt das Böse inne
Band 64
Allem Anfang wohnt das Böse inne
von Logan Dee und Michael Marcus Thurner
nach einem Exposé von Uwe Voehl
© Zaubermond Verlag 2022
© »Das Haus Zamis – Dämonenkiller«
by Pabel-Moewig Verlag GmbH, Rastatt
Titelbild: Mark Freier
www.Zaubermond.de
Alle Rechte vorbehalten
Was bisher geschah
Die junge Hexe Coco Zamis ist das weiße Schaf ihrer Familie. Die grausamen Rituale der Dämonen verabscheuend, versucht sie den Menschen, die in die Fänge der Schwarzen Familie geraten, zu helfen. Auf einem Sabbat soll Coco endlich zur echten Hexe geweiht werden. Asmodi, das Oberhaupt der Schwarzen Familie der Dämonen, hält um Cocos Hand an. Doch sie lehnt ab. Asmodi kocht vor Wut – umso mehr, da Cocos Vater Michael Zamis ohnehin mehr oder minder unverhohlen Ansprüche auf den Thron der Schwarzen Familie erhebt.
Nach jahrelangen Scharmützeln scheint endlich wieder Ruhe einzukehren: Michael Zamis und seine Familie festigen ihre Stellung als stärkste Familie in Wien, und auch Asmodi findet sich mit den Gegebenheiten ab. Coco Zamis indes hat sich von ihrer Familie offiziell emanzipiert. Das geheimnisvolle »Café Zamis«, dessen wahrer Ursprung in der Vergangenheit begründet liegt und innerhalb dessen Mauern allein Cocos Magie wirkt, ist zu einem neutralen Ort innerhalb Wiens geworden. Menschen wie Dämonen treffen sich dort – und manchmal auch Kreaturen, die alles andere als erwünscht sind.
Die intriganten Spiele, auch innerhalb der Zamis-Sippe, gehen unvermindert weiter. Dabei erfährt Coco Zamis einen ganz besonderen Exorzismus: Ihre böse Seite gewinnt die Oberhand. Mit wessen Hilfe Michael Zamis das geschafft hat, bleibt erstmal sein Geheimnis.
Coco wird unterdessen aufgewiegelt, dass ihre Halbschwester Juna ihr das Café streitig machen wolle. Kurzerhand versetzt Coco sie mithilfe des Zwerges Ficzkó in die Vergangenheit – in die Dienste der berüchtigten Blutgräfin.
Doch Juna taucht in der Gegenwart wieder auf – als Puppe. Georg Zamis, der inzwischen seine Gefühle für Juna entdeckt hat, entführt sie kurzerhand und versteckt sich mit ihr im Haus der Callas. Coco findet es heraus und zwingt Ficzkó, Juna erneut auf magische Weise in die Vergangenheit zu entführen. Sie bringt Ficzkó einen Zauber bei, den dieser anwenden soll, sobald er Junas habhaft wird. Von Georg verfolgt, flüchtet Ficzkó in einen Schrank und versetzt sich und Juna in die Vergangenheit. In letzter Sekunde springt Georg hinzu. Alle drei werden von dem Sog erfasst und gelten seitdem als verschollen.
Doch etwas ging schief: Fortan ist ein Durchgang zu anderen – höllischen – Dimensionen entstanden. Ein neuer Dämon taucht so in Wien auf: Monsignore Tatkammer. Niemand weiß, woher er stammt, doch er sät Böses, wo immer er ist. Noch ist die Schwarze Familie nicht auf ihn aufmerksam geworden, sodass er ungehindert wirken kann.
Unterdessen wird der verschwundene Schiedsrichter der Schwarzen Familie, Skarabäus Toth, in Wien gesichtet. Michael Zamis hatte ihn, um ihn loszuwerden, in ein Chamäleon verwandelt. Offensichtlich aber hat Toth eine Möglichkeit gefunden, zumindest als Geistererscheinung auf seine verzweifelte Lage aufmerksam zu machen. Michael Zamis will ihn daher endgültig loswerden und beauftragt dafür Coco.
Sie macht sich widerwillig auf die Reise und lässt den Sarg mit Toth über dem Ätna abwerfen.
Auftrag erledigt, doch sie zieht es nicht sofort nach Wien zurück, denn dort warten weitere Probleme auf sie. Nicht zuletzt ein Dämon namens Youssef, dem sie ihr Café »verkauft« hat.
In Italien lernt sie Alessandro Wolkow kennen. Als Sohn einer weißen Hexe und eines schwarzblütigen Dämons ist er eine zwiegespaltene Persönlichkeit. Die beiden verlieben sich ineinander, auch wenn Coco bewusst ist, dass sie ihre magischen Fähigkeiten dadurch zum großen Teil verliert. Dafür erkennt sie, warum sie sich so sehr verändert hat: Ihr Vater hat die Neiddämonin Invidia auf sie angesetzt. Doch gegen die Liebe ist auch die Neiddämonin machtlos – und verschwindet. Coco hofft, sie für immer los zu sein, und flüchtet mit Alessandro nach Frankreich.
Unterdessen finden sich Georg Zamis, Juna und Ficzkó im Jahr 1888 in Paris wieder. Sie sind getrennt worden, und Georg macht sich auf die verzweifelte Suche nach Juna. Dort treffen sie auf den damals noch jungen Michael Zamis, mit dessen unfreiwilliger Hilfe sie wieder in die Gegenwart gelangen – genau in die Arme einer Pariser SEK, die von der Existenz des Übersinnlichen – und vor allem von den Mächten und Machenschaften der Schwarzen Familie – weiß. Beide, Georg und Juna, werden seitdem verhört und in Gefangenschaft gehalten, haben jedoch ihr Gedächtnis verloren.
Währenddessen verbringt Coco mit ihrem Liebhaber Alessandro entspannende Wochen an der Côte d’Azur. Nach Wien zieht es sie nicht mehr. Sie ahnt nicht, dass die Zeit des Friedens bald vorbei sein wird. Jemand hat einen dämonischen Kopfgeldjäger auf sie angesetzt: den berüchtigten Charles Axman und seine Rocker-Crew! Cocos Liebhaber stirbt, als er in die Fänge eines fluchbeladenen Hauses gerät und dieses ihn verschlingt. Coco selbst entkommt dem Inferno und erblickt erneut Invidia – als habe die Neiddämonin nur auf den passenden Moment gewartet, sich Coco erneut zu nähern.
Unterdessen schart ein mächtiger Dämon weltweit Jünger um sich: Abraxas. Niemand weiß, was genau er bezweckt, doch selbst Asmodi, der amtierende Fürst der Finsternis, sieht in ihn einen gefährlichen Gegenspieler.
Inzwischen ist ein ganzes Jahr vergangen, in dem Coco vor Invidia auf der Flucht war und versucht hat, sie abzuschütteln.
Der geheimnisvolle Monsignore Tatkammer wird indes wie magisch von dem Café Zamis angezogen. Und vor allem von dem Gemälde mit den darin verbliebenen Todsünden.
Sein Herr, der Dämon Abraxas, offenbart ihm seinen Werdegang. Tatkammer selbst hat das Gemälde als junger Mönch vor vielen Jahrhunderten in Abraxas’ Auftrag erschaffen – und geriet dabei immer stärker in dessen Bann.
Unterdessen ist Coco Zamis in Hamburg angekommen. Sie ist in der Welt umhergereist – auf der Flucht vor ihren Erinnerungen und der Neiddämonin Invidia, die jedoch inzwischen von Michael Zamis wieder in das Gemälde verbannt wurde. In Hamburg lernt sie Merle kennen, die sich als ihre Halbschwester entpuppt. Da erreicht Coco der Todesimpuls ihrer Geschwister – Adalmar und auch Lydia werden Opfer von Tatkammers Intrigen.
Nun ist Coco gefragt, ihren Eltern beizustehen und den Tod der Geschwister zu rächen.
Sie tötet Monsignore Tatkammer, doch Abraxas erweckt ihn wieder zum Leben – wovon die Zamis aber nichts ahnen …
In Wien kommt es zum Showdown. Mit Abraxas’ Macht im Rücken gelingt es Tatkammer, Coco wie eine Marionette zu benutzen und sie zu zwingen, die Villa Zamis in Brand zu setzen. Ihre Eltern kommen in den Flammen um. Ob sich Georg und Juna haben retten können, ist nicht bekannt, jedenfalls sind sie spurlos verschwunden. Genauso wie Dorian Hunter, der sich ebenfalls in dem Haus aufgehalten hatte.
Schwer verletzt erwacht Coco in einem Krankenhaus. Sie wird von dämonischen Schwestern und Ärzten gesund gepflegt und wohnt schließlich der Beerdigung ihrer Eltern bei, deren Seelen in einem Scheingrab auf einem Friedhof, der sich in einer anderen Dimension befindet, beigesetzt werden.
Wien scheint nun, so hört man, in Abraxas’ Hand zu sein. Wie überall immer mehr Mitglieder der Schwarzen Familie zu Abraxas überlaufen.
Coco hat von allem genug. Sie will nur noch ihren Frieden.
Sie setzt sich in einen Zug und fährt einem unbekannten Ziel entgegen …
Erstes Buch: Allem Anfang wohnt das Böse inne
Allem Anfang wohnt das Böse inne
von Logan Dee
nach einem Exposé von Uwe Voehl
Kapitel 1
»Du, Tochter, hast uns auf dem Gewissen! Für unseren Tod bist allein du verantwortlich. Dafür sollst du büßen – bis ans Ende deiner Tage! Wir verfluchen dich, Coco!«
Drohend, mit hasserfülltem Gesicht, stand mein Vater vor mir. Oder vielmehr sein Geist. Er schwebte eine Handbreit über dem Friedhofsboden. Seine Gestalt war durchsichtig und waberte in dem leichten Wind, der nach Fäulnis und Verwesung roch.
Neben ihm erschien nun auch der Geist meiner Mutter. Weniger hasserfüllt als vielmehr anklagend, warf auch sie mir nun vor: »Du warst stets unser Sorgenkind. Das weiße Schaf in unserer Schwarzen Familie. Ich hatte immer Hoffnung, dass du dich eines Tages besinnen wirst, Coco. Stattdessen hast du unsere Familie zerstört!«
Ich wusste nicht, wie ich hierhergekommen war, auf diesen dämonischen Friedhof, auf dem das Kenotaph meiner Eltern hoch in den nachtschwarzen Himmel ragte.
Was sie mir an den Kopf warfen, war nur die halbe Wahrheit, und das sagte ich ihnen auch: »Vater, Mutter, ich kann eure Wut und euren Kummer verstehen, doch ich stand unter Tatkammers Einfluss. Er zwang mich, unsere Villa anzuzünden …«
Mein Vater tat es mit einer herrischen Handbewegung ab. »Dann warst du also zu schwach, dich seiner zu erwehren! Das allein ist eine Schande und keinesfalls eine Entschuldigung. Du hast versagt, also komm mir nicht mit Ausreden.«
Selten im Leben – in seinem Leben – hatte ich meinen Vater so zornig gesehen. Aber noch nie hatte ich mich derart vor ihm gefürchtet wie jetzt. Als Kind hatte ich die größte Angst vor ihm gehabt. Ich war in ständiger Furcht aufgewachsen. Erst als Teenager hatte ich mich nach und nach gegen seine Willkür gewehrt – oft waren drakonische Strafen die Folge gewesen. Je älter ich wurde, desto mehr emanzipierte ich mich. Nicht nur von ihm, sondern von meiner gesamten Sippe. Was wiederum ihm überhaupt nicht gepasst hatte. Immer wieder hatte er in schwierigen Situationen darauf bestanden, der Stimme des Blutes zu gehorchen und in den Schoß der Familie zurückzukehren. Mehr oder weniger hatte ich mich stets gefügt.
Aber jetzt war ich frei! Endgültig! Das wurde mir selbst jetzt, in meiner jämmerlichen kleinen Angst, bewusst.
Ich straffte den Oberkörper und warf den beiden Geistern entgegen: »Was wollt ihr von mir? Mir nur ein schlechtes Gewissen machen? Mich am Boden sehen? Soll ich etwa vor euch kriechen?«
Die milchige Gestalt meines Vaters waberte auf mich zu. Er verzog die Lippen zu einem bösartigen Grinsen. »Nein, Tochter, damit würdest du zu billig davonkommen …«
Auch meine Mutter schwebte näher heran. »Dein Vater hatte als Bestrafung für dich das grausamste Schicksal vorgesehen, das einem Mitglied der Schwarzen Familie geschehen kann …«
»Du meinst …« Meine Schutzmauer aus vorgegebener Selbstsicherheit brach zusammen.
Mutter nickte: »Michael war festen Willens, dich in einen Freak zu verwandeln: in ein krötenähnliches, warzenübersätes Etwas, dessen schuppige Haut eine einzige schmerzende eiternde Wunde wäre. Ich konnte ihn überreden, Milde walten zu lassen.«
»Milde?« Ich sah meinem Vater in die noch immer vor Zorn blitzenden Augen. »Du lässt mich also gehen?«
»Milde, meine Tochter bedeutet in diesem Falle, dass ich dir die Schmerzen erspare, die deine Existenz als Freak bedeutet hätte. Stattdessen werde ich dich einfach nur – töten!«
Das letzte Wort stieß er wie einen vergifteten Pfeil hervor, und gleichzeitig zischte aus seinem Rachen ein lodernder Feuerstrahl auf mich zu. Er hätte mir das Gesicht verbrannt und vielleicht sogar meinen ganzen Körper in Brand gesetzt. Instinktiv hatte ich einen unsichtbaren Schutzwall entstehen lassen, an dem die Flammenlanze abprallte.
Zeit, um mir zu überlegen, wie ich meinem Vater entkam, blieb mir nicht. Denn schon erfolgte die nächste Attacke. Er stand direkt vor der Wand. Aus seinen Fingern wuchsen messerscharfe Krallen, mit denen er nun den Schutzwall bearbeitete. Dabei entwichen seiner Kehle uralte Worte der Magie, mit denen er einen weiteren Zauber gegen mich wirkte.
Ich schrie auf vor Schmerz, als mir klar wurde, was er da tat: Die von mir magisch erzeugte Schutzwand war letztendlich mit mir verbunden – war ein Teil von mir. Vaters Magie bewirkte, dass ich die Krallen, die er über die Wand gleiten ließ, spürte, als würden sie in meinem Körper tiefe Furchen ziehen.
Ich krümmte mich und konnte mich kaum noch auf den Beinen halten. Aber ich sah, dass der Zauber auch meinem Vater eine enorme Kraft abverlangte. Schweißtropfen standen ihm auf der Stirn, und die Worte kamen ihm immer abgehackter über die Lippen.
Ich sank auf die Knie, vor Schmerzen kaum mehr fähig, einen klaren Gedanken zu fassen. Allein mein Überlebensinstinkt ließ mich handeln. Nicht dass ich es bewusst tat. Eher war es wohl mein Unterbewusstsein, dass ich mich des alten Spiels erinnerte, zu dem wir als Kinder gegriffen hatten, wenn es galt, etwas auszulosen: Wir nannten es Kugel, Dolch und Leichentuch und stellten die entsprechenden Symbole mit den Fingern dar. Mit der Kugel war die Kristallkugel gemeint. Jeder Dolch zerbrach daran. Das Leichentuch vermochte die Kugel jedoch zu bedecken, während der Dolch wiederum das Tuch zerschneiden konnte.
Die Wand, die ich erschaffen hatte, wurde von einem Moment zum anderen unzerstörbar – so wie eine Glaskugel. Vaters Messerkrallen zerbrachen daran. Er wankte fluchend zurück. Schwarzes Blut spritzte aus den gebrochenen Krallen hervor. Jetzt war er es, der sich vor Schmerzen krümmte, während meine eigenen von einem Moment zum anderen verschwunden waren.
Ich rappelte mich auf und lief blindlings davon.
Es war stockdunkel auf dem Friedhof, auf dem die Gräber unzähliger Dämonen lagen. Die Grabsteine und Grüfte ähnelten dabei nur entfernt denen auf menschlichen Friedhöfen. Zumeist stellten sie höllische Kreaturen dar oder den Fürsten der Finsternis, Asmodi. Auf manchen Bildnissen hatten sich die Dämonen selbst verewigt – zumeist in beeindruckenderer Gestalt als zu Lebzeiten. Und nicht alle waren nur in Stein gemeißelt. Manche schwebten als dreidimensionale Avatare über ihren Gräbern und gaben selbst im Tod noch schaurige Laute von sich.
Ich hastete in das Gräberlabyrinth hinein, in dem es keinerlei geordnete Wege oder Pfade gab. Meine Hoffnung war, mich dort so lange zu verstecken, bis mir entweder ein Ausweg einfiel oder Vaters Wut auf mich versiegte. An das Letztere glaubte ich weniger, denn noch während ich flüchtete, gellten mir seine wütend ausgestoßenen Flüche hinterher.
Schließlich aber verstummten sie – oder vielmehr war ich so tief in das Labyrinth eingedrungen, dass ich seine Tiraden nicht mehr hörte. Wie durch ein Wunder war ich bisher nirgendwo gegengestoßen oder gestolpert. Meine Hexensinne hatten mich davor bewahrt, obwohl ich so gut wie nichts sah. Der Himmel, so es denn einen gab in dieser Dimension, war pechschwarz. Weder Sterne noch ein Mond waren zu sehen. Allein die über manchen Gräbern schwebenden gespenstischen Avatare verbreiteten ab und zu einen schwachen Schimmer. Manche von ihnen verhöhnten mich oder riefen mir obszöne Beleidigungen zu.
Ich zuckte kurz zusammen, als von der Seite ein Avatar wie ein Springteufel auf mich zugeschossen kam. Er trug ein rüschenbedecktes, mit Erde verschmiertes Leichenhemd und hatte das widerwärtige Aussehen eines aufgedunsenen Greises, dessen feistes Gesicht mit krabbelnden spinnenartigen Insekten bedeckt war. Zwei lange spitze Vampirhauer ragten über die wulstigen Lippen. Seine Hände, die nach mir grabschten, fuhren durch mich hindurch.
Er lachte grölend, als er mein Erschrecken wahrnahm. »So eine schöne Frau will vor mir davonlaufen? Wie wär’s mit einem Fick in meiner Gruft? Ich beschere dir schmerzhafte Wonnen der einmaligen Art …«
Sein Geschwafel widerte mich an. Andererseits brachte er mich auf einen Gedanken. Anhaben konnte er mir eh nichts, aber vielleicht konnte ich mich in seiner Gruft verstecken, bis die Luft rein war.
»Ich wette, du bist nur ein aufgeblasener Angeber!«, stichelte ich.
Sein Gesicht verzog sich zu einer wütenden Fratze. »Soll ich es dir auf der Stelle besorgen, du Schlampe?«
»Das könnte dir so passen. Gerade hast du noch von einer Gruft geschwafelt!«
»Du zweifelst daran? Es ist eines der imposantesten Denkmäler hier weit und breit. Wisse, du Hure, dass meine Sippe eine der bedeutendsten in ganz Italien war. Mein Name ist Antonio di Riviera!«
Ich hatte nie von ihm gehört. Sicherlich übertrieb er, so wie alle Dämonen. Allerdings mochte er auch nicht ganz unbedeutend sein, sonst hätte er auf diesem Friedhof, auf dem nur hochrangige Mitglieder der Schwarzen Familie ihre mehr oder weniger letzte Unruhe fanden, kein Grab und erst recht keine Gruft zugewiesen bekommen. Und ohne seine Einwilligung war mir der Zutritt zu seiner Gruft – so wie jedem Unbefugten – sicherlich versperrt oder gar mit tödlichen Fallen bestückt. Also musste er mich schon hineinbitten.
»Also schön, zeig mir, dass du dich nicht nur aufbläst!«, forderte ich ihn auf.
»Du wirst entzückt sein!«
Er schwebte voran. Der Eingang zu seiner Gruft befand sich nur wenige Meter entfernt. Sie war unterirdisch angelegt und war mehr eine Art Erdhöhle. Er verschwand darin, und ich zwängte mich hindurch. In dem schmalen Gang kam ich mir vor wie in einem Kaninchenbau.
Der Hauptraum war kaum erhebender. Ich musste in der Hocke verweilen, um nicht gegen die niedrige, mit schlichten Holzbohlen verstärkte Decke zu stoßen. Aus den Wänden heraus drang ein schwacher, giftig-grüner Glimmerschein, der das Innere wenigstens etwas erhellte.
»Nun, habe ich dir zu viel versprochen?«, fragte Antonio heischend.
»Ich habe hier schon gewaltigere Grabstätten gesehen.« Ich dachte an die sich bis in den Himmel erstreckenden Scheingräber meiner Eltern.
»Nun ja, das mag sein, aber dafür habe ich dir etwas zu bieten, was du sonst hier nirgendwo findest.«
»Da bin ich aber gespannt. Und was?«
»Mich!«
Mit einem Satz sprang er mich an und riss erwartungsvoll das Maul auf. Obwohl er nur eine Geistererscheinung war, spürte ich, als er mich berührte, seine klebrige Substanz, die sich um meinen ganzen Körper legte und mich einkleisterte. Ich wollte ihn mir vom Leib halten, indem ich nach ihm schlug, verhedderte mich aber noch mehr in ihn. Mit beiden Händen riss ich an ihm, erreichte aber nur, dass er sich verformte. Es war, als würde ich versuchen, Honig zu zerteilen. Zugleich fühlte ich seine Lippen an meinem Hals. Die Saugzähne waren zwar ebenfalls nicht wirklich feststofflich, aber sie mochten mir dennoch gefährlich werden, zudem sie – ich kann es nicht anders beschreiben – kristallisierten, die zuvor klebrige Substanz also fester wurde. Entweder gewann Antonio seine Stärke dadurch, dass er allein durch die Berührung von meiner Lebenskraft zehrte, oder es war dieser Ort, an dem er mehr und mehr seine Geisterexistenz abstreifte. Vielleicht auch beides.
Wie auch immer, ich hielt es an der Zeit, ihm Grenzen zu setzen.
»Schluss jetzt!«, schrie ich ihn an. Ich wirkte einen Zauber, der einen Schwall kochend heißes Wasser auf ihn niederregnen ließ.
Er kreischte auf, als sich seine klebrige Masse auflöste und wie verflüssigter Sirup zu Boden rann und nur mehr mehrere Lachen bildete, die kaum mehr an Antonio erinnerten.
Ich hätte ihn nun endgültig vernichten können, beließ es aber dabei.
Die Lachen krochen aufeinander zu, vereinigten sich. Die Konsistenz verstofflichte sich wieder, bis schlussendlich Antonio in seiner Geistererscheinung vor mir hockte.
Er schaute mich mit hasserfüllten Augen an. »Das wirst du mir büßen, puttana!«, fauchte er.
Das Fluchen hatte er offensichtlich nicht verlernt, wenngleich es bei der Drohung blieb.
»Wenn ich eine Hure bin, bist du ein alter geiler Hurenbock, der auf Blut aus ist. Und jetzt hör mir zu!«
»Einer puttana? Wer bist du, dass du einem Antonio di Riviera Befehle erteilen willst?«
Ich verdrehte die Augen. »Soll ich dir eine weitere Lektion erteilen?«
»Also schön, was willst du?«
»Wie lange weilst du schon hier?«
Er überlegte kurz. »Fast zweihundert Jahre müssten es sein. Meine mächtige Sippe …«
Ich winkte ab. »Lass gut sein! Zweihundert Jahre also. Dann kennst du dich hier doch bestimmt gut aus.«
»Es ist sozusagen mein ureigenes Reich.«
»Ja, ist klar. Folglich weißt du bestimmt auch, wie man hier wieder rauskommt, oder?«
»Niemand kann diesen Friedhof je verlassen. Wir alle sind an unsere Gräber gebunden. In der wahren Welt existieren wir nicht mehr. Nur hier …«
»Ich existiere aber noch! Ich bin nicht gestorben und daher auch kein Geist. Also muss es für mich hier irgendwo einen Ausgang geben.«
Er schien zu überlegen, denn seine Drohgebärde war in sich zusammengefallen. »Ich könnte dir vielleicht helfen, aber du weißt ja: Nichts ist umsonst. Ich will zumindest ein paar Tropfen deines herrlich warmen Blutes kosten.«
»Ich werde mit dir nicht schachern. Du weißt, dass ich dich mit einem Fingerschnippen ins endgültige Nirwana schicken kann. Also?«
Er seufzte theatralisch. »Ab und zu verirren sich Menschenseelen oder schwache Dämonen hierher. Entweder weil sie sich den Zugang durch verbotene Zauber verschaffen oder durch Traummagie. Die meisten sind – wie du – leichte Beute und daher willkommene Abwechslung. Nur wenigen gelingt es wieder zu entkommen …«
»Schwafle nicht rum! Wie komme ich hier weg?«
Er warf mir einen scheelen Blick zu. »Und dann lässt du mich unbehelligt ziehen.«
»So lautet der Deal, ja.«
Ich wusste durch meinen ersten Aufenthalt anlässlich der Bestattung meiner Eltern, dass es mindestens einen Ausgang geben musste – auch wenn mir die Erinnerung genommen worden war. Ich hatte auf dem Kutschbock neben Jenseit, dem dämonischen Bestatter, Platz genommen, und er war losgefahren. Zunächst hatten wir uns noch in Wien befunden und waren zum Zentralfriedhof gefahren. Von dort aus hatten wir diesen Dämonenfriedhof erreicht. Es musste also einen geheimen Zugang zu dieser Dimension geben. Und wo ein Zugang war, war auch ein Ausgang.
»Nun, zufällig weiß ich von dem einen oder anderen Dämonentor. Wie gesagt, uns Geistern ist es nicht vergönnt, sie zu benutzen, aber für dich dürfte es kein Problem sein. Eines ist sogar ganz in der Nähe.«
»Dann führ mich auf der Stelle hin!«, verlangte ich. Meine Hoffnung, der Rache meines Vaters zu entgehen, wuchs. Wenn ich das Dämonentor erst einmal betreten hatte, würde er mir nicht mehr folgen können.
»Na gut. Und du willst wirklich nicht noch etwas bleiben? Weißt du, manchmal ist es ziemlich einsam hier unten. Du könntest mir erzählen, wie es um die mächtige Riviera-Sippe steht. Wir waren schon immer Asmodis Günstlinge …«
»Tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen, aber ich habe nie von ihnen gehört. Wahrscheinlich sind sie in irgendwelchen Sippenscharmützeln längst vor meiner Geburt ausgelöscht worden.«
»Du lügst, du Hure!« Seine Hände fuhren krallengleich vor. Die mächtigen Hauer zitterten vor Erregung.
»Fang nicht wieder an, dich mit mir messen zu wollen!«; warnte ich ihn. »Und jetzt lass uns aufbrechen!«
Grollend fügte er sich. Er kroch voran, und ich folgte ihm durch das feuchte Erdreich.
Als ich endlich wieder im Freien stand, atmete ich erstmal tief ein und aus, aber der Gestank von Moder und Fäulnis, der mich in der Gruft umgeben hatte, ließ sich nicht so einfach abschütteln und verfolgte mich auch noch, als mich Antonio durch das unüberschaubare Gräberlabyrinth führte. Immer wieder wurden wir von den Geistern des Friedhofs behelligt, aber Antonio übernahm seine Rolle als mein Beschützer und vertrieb die meisten Gestalten mit zornigen Flüchen und Beschimpfungen. Es erfüllte ihn offenkundig mit sichtlichem Stolz, sich vor all den anderen Geistern an meiner Seite zu zeigen. Die zwei, drei Geister, die sich dennoch nicht abschrecken ließen, vertrieb ich mit Feuerkugeln, vor denen sie offenbar gehörigen Respekt hatten, sodass sie sich verflüchtigten.
Endlich hatten wir eine Stelle erreicht, an der sich nur ein morscher Baum befand. Er war in der Mitte gepalten, sodass eine enge Öffnung entstanden war.
»Das ist das Dämonentor?«, fragte ich zweifelnd.
»Traust du mir etwa nicht?«
Ich sparte mir eine Antwort. Seit wann konnte man einem Dämon wirklich vertrauen? Dennoch hoffte ich, dass ich ihn zuvor genügend eingeschüchtert hatte, sodass er mir keine Falle stellte.
Zögernd näherte ich mich der Baumhöhle. Als ich genau davorstand und mir der finstere Eingang entgegengähnte, schickte ich ein Irrlicht hinein. Bisher hatte ich darauf verzichtet, eines zu entzünden, aus Sorge, meine Eltern könnten darauf aufmerksam werden. Nun aber schien es mir angebracht zu sein.
Allerdings wurde es, kaum dass es in dem Spalt verschwunden war, von der Dunkelheit darin verschluckt.
Nun, zumindest diese absolute Schwärze sprach für ein Höllentor, wie die Dämonentore auch genannt wurden. Es gab sie an vielen Punkten der Erde: magische Kraftfelder, durch die man mittels eines einzigen Schritts große Entfernungen überbrücken konnte – und in diesem Fall von einer fremden Dimension wieder zurück in meine ureigene Welt. Die Kräfte, die solche Dämonentore speisten, kamen angeblich aus dem centro terrae und konnten vermutlich von den dort lebenden Dämonen auch gesteuert werden. Kurz kam mir die entsetzliche Befürchtung, es könne mich dorthin verschlagen.
Ich schüttelte den Gedanken ab, und dennoch war es mir nach wie vor nicht geheuer, allein auf Antonio zu vertrauen. Aber ich hatte keine andere Wahl. Vorsichtig setzte ich einen Fuß hinein.
Nichts geschah.
Zumindest nichts vor mir.
Stattdessen vernahm ich direkt hinter mir ein Geräusch.
Als ich herumfuhr, stand meine Mutter da. Sie hielt einen Opferdolch in der Hand, auf dessen gekrümmter Schneide ich magische Zeichen erkannte, die in diesem Moment rot aufglühten.
»Du glaubtest nicht wirklich, uns entkommen zu können?«, sagte Thekla Zamis. Im Gegensatz zu meinem Vater, den ich nirgendwo entdecken konnte, zeigte sie ihren Zorn auf mich nach wie vor nicht derart ungezügelt wie er. Es war eher eine kalte, berechnende Wut, die aus ihrer ganzen Präsenz sprach. Eine Kälte, die mich erneut schaudern ließ.
»Ich bin nicht schuld an eurem Tod«, beteuerte ich abermals, aber ich merkte selbst, wie resigniert ich klang. Meine Eltern wollten es einfach nicht begreifen, dass ich nur ein Werkzeug Tatkammers gewesen war.
Sie trat einen Schritt näher. »Bringen wir es hinter uns. Kurz und schmerzlos.«
»Warte, Mutter«, sagte ich. »Ich … ich möchte mich wenigstens von dir verabschieden, dich noch einmal … berühren.«
Das war ernst gemeint. Ich hatte nicht vor, sie in irgendeiner Weise anzugreifen. Denn ich wusste, dass es zwecklos gewesen wäre.
»Du bist und bleibst ein sentimentales weißes Schaf«, sagte sie verächtlich. »Was bedeutet schon eine Berührung? Hinterher willst du mich noch umarmen, blödes Kind!«
Sie hatte mich nie umarmt. Dämonenkinder wuchsen ohne Liebe und Zärtlichkeit auf. Beides hatte ich bisher nur bei Menschen gefunden. Bei wenigen Menschen – wie Dorian Hunter.
Ja, ich war sentimental. Wenigstens einmal noch wollte ich meine Mutter berühren, bevor sie mir den Todesstoß geben würde.
Vorsichtig streckte ich den Arm aus. Meine Hand berührte ihre – und fuhr durch sie hindurch.
Verblüfft zog ich die Hand zurück.
»Du … du kannst mir nichts antun!«, stellte ich fest. »Du bist nach wie vor nur ein Geist!«
»Sie ist erst seit Kurzem hier bei uns«, schaltete sich Antonio ein. »Erst nach und nach gewinnen wir an Substanz – so wie ich!« Er warf sich in die Brust. »Zweihundert Jahre bin ich …«
»Schweig, du Freak!«, herrschte meine Mutter ihn an. Dann wandte sie sich wieder mir zu.
»Er hat recht«, sagte sie. »Aber genau deshalb bin ich nicht mit leeren Händen gekommen.« Sie grinste teuflisch.
Im nächsten Moment zuckte die Hand mit dem Dolch auf mich zu. Ich hatte es kommen sehen, und dennoch war ich für einen Moment zu überrascht, um zu reagieren. Vielleicht auch zu bestürzt, weil es doch meine eigene Mutter war, die mir nach dem Leben trachtete.
Da bekam sie einen Stoß. Antonio hatte ihr einen Schubs gegeben, der sie zur Seite schleuderte. »Von wegen Freak! Sucami la minchia, du dummes Stück!«
Sein feistes Gesicht war eine Fratze der Wut. ›Freak‹ war eines der schlimmsten Schimpfworte, die man einem Dämon an den Kopf werfen konnte!
Und seine Wut war meine Rettung! Ich warf mich herum und sprang in die Baumhöhle hinein –
Und verlor augenblicklich den Boden unter den Füßen …
Kapitel 2
Als ich die Augen öffnete, erwartete mich der nächste Albtraum. Ich befand mich in einem Zugabteil und starrte direkt in ein auf mich gerichtetes Messer. Der junge Mann, der direkt neben mir saß und es in der Hand hielt, grinste mich an. Aber es war nicht das Messer, das mir Panik bereitete – sondern der Wahnsinn, der in seinen Augen glitzerte. Die Schmerzen, die ich angesichts seines Irrsinns verspürte, waren unbeschreiblich.
Im nächsten Moment raste das Messer auch schon auf mich zu. Instinktiv hatte ich den Kopf zur Seite gedreht. Die scharfe Spitze durchstach die Sitzlehne hinter mir und drang tief darin ein. Die Faust des Unbekannten hielt das Heft noch immer fest umfasst.
Trotz der irrsinnigen Schmerzen wirkte ich einen Zauber – mehr aus purer Verzweiflung, als dass ich lange darüber nachdenken konnte, wie ich mich am wirksamsten zur Wehr setzte.
Der Mann schrie gellend auf. Das Messer war so heiß, dass die Klinge rot glühte. Es war offensichtlich, dass der Mann es loslassen wollte, aber das verhinderte meine Magie. Das Heft brannte sich tief in seine Haut ein. Es qualmte und zischte und stank nach verbranntem Fleisch. In seiner Verzweiflung versuchte er, die andere Hand zu Hilfe zu nehmen, um die versehrte Hand von dem Heft zu lösen, erreichte aber nur, dass nun auch diese wie festgeklebt an der brennend heißen Waffe klebte.
Mir war es unterdessen unter Aufbietung meiner letzten Kräfte gelungen, von ihm wegzurücken. Die Bank, auf der ich saß, war breit genug, dass zwischen uns gut und gern noch eine dritte Person hätte sitzen können.
Obwohl der Mann fast ohnmächtig sein musste vor Pein, ruckte sein Kopf zu mir herum. In seinen Augen stand jetzt nicht mehr nur der Wahnsinn, sondern lodernder Hass.
Ich erkannte, dass mir nur zwei Möglichkeiten blieben: zu flüchten – oder ihn zu töten. Und da ich mich offensichtlich in einem fahrenden Zug befand, war Flucht keine wirkliche Option, selbst wenn er die Hände wohl nicht mehr würde gebrauchen können, um ein Messer zu halten. Sein Wahnsinn war es, der die wirkliche Gefahr für mich darstellte. Wir Dämonen haben nur zwei natürliche Feinde auf der Welt – abgesehen davon, dass wir uns oft gegenseitig das Leben zur Hölle machen: Dämonenkiller wie Dorian Hunter und dem Irrsinn anheimgefallene Menschen.
Über meine Entscheidung brauchte ich also nicht lange nachzudenken. Zumal die brennenden Schmerzen nicht mehr nur in meinen Eingeweiden tobten, sondern sich bis hoch zu meinem Kopf emporschraubten, sodass ich schon jetzt kaum mehr einen klaren Gedanken fassen konnte.
»Sieh mich an!«, fauchte ich.
Er tat es und grinste mich erneut höhnisch an – trotz der wahnsinnigen Schmerzen. Sein Irrsinn drohte mich erneut zu überschwemmen. Dennoch gelang es mir, seinen Blick zu bannen. Das Grinsen erstarb; er war jetzt nur noch meine Marionette, der ich meinen Willen aufzwang.
Seine Hände waren noch immer mit dem glühenden Messer verbunden.
Ich ließ ihn das Messer aus dem Polster ziehen. Dann befahl ich ihm, seinem Leben damit selbst ein Ende zu setzen. Ohne zu zögern, stieß er sich die brennend-heiße Klinge bis zum Heft ins Herz.
Mit seinem Tod verschwanden meine Schmerzen augenblicklich, wenngleich mich die Auseinandersetzung mehr Kraft gekostet hatte, als mir lieb war. Vor allem deshalb, weil ich mit einer weiteren Attacke rechnete. Es konnte doch kein Zufall gewesen sein, dass – kaum war ich dem Dolchstoß meiner Mutter in letzter Sekunde entkommen – ein weiterer Messerangriff auf mich erfolgt war. Nur wie passte das zusammen?