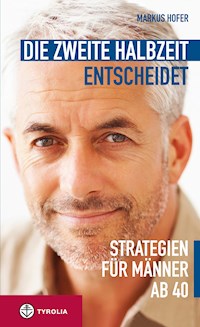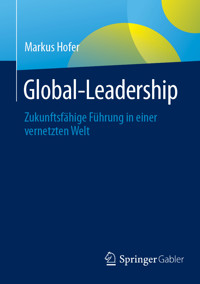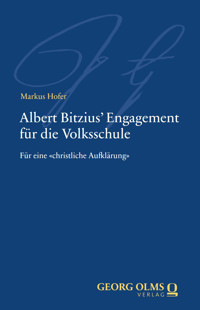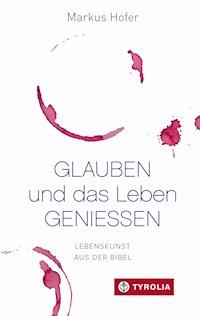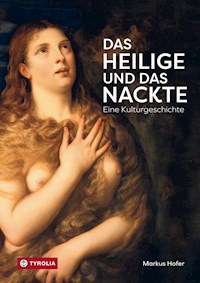
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Tyrolia
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Das Spiel von Verhüllung und Enthüllung Je mehr Moral beim Sex desto mehr Erotik in der Kunst Heilig ist heilig – und nackt ist nackt. Doch der Versuch, Sexualität aus der Religion und dem religiösen Erleben zu verbannen, scheitert unweigerlich. Zu stark ist die Sexualität als sich Wege bahnende Kraft. Und dabei hat das Moralisieren noch nie viel genützt, sondern macht die Sache erst interessant! In seinem– durchaus auch humorvollen – Gang durch die Kulturgeschichte erläutert der Autor pointiert und doch fundiert die vielen Gesichter des immerwährenden lustvollen Spannungsverhältnisses zwischen diesen beiden, den Menschen so bestimmenden Bedürfnissen. Von der Venus von Willendorf arbeitet er sich über göttliche Kurtisanen und barbusige Ägypterinnen vor zu der idealisierten Nacktheit der Griechen. Von der Lustfeindlichkeit des Augustinus gelangt er ins gar nicht so finstere Mittelalter der stillenden Marien oder bis in die gar nicht so aufgeschlossene, von Syphilis, Hexenwahn, Reformation und Gegenreformation gepeinigte Neuzeit. Dabei zeigt er deutlich: Je rigider die Sexualmoral einer Gesellschaft, desto nackter werden die Heiligen in der katholischen Bilderwelt, umso mehr blitzt der Busen der büßenden Maria Magdalena oder posed leidend der entblößte Sebastian. Gab es das Goldene Zeitalter der Unschuld und ist Scham eine gesellschaftliche Erfindung? Welchen Zweck erfüllte Kleidung und war die Tempelprostitution nur ein Mythos? Wie war das mit den unbekleideten Männern des Michelangelo und wie mit der Ekstase der heiligen Theresa? Markus Hofer macht sich auf die Suche nach den nackten Wahrheiten biblischer Stoffe und stöbert in aristokratischen Privatgemächern lustvolle Werke der berühmtesten Künstler auf. Er zeigt, wie sehr die Kunst zur Versinnlichung des Glaubens beigetragen hat und wie die frühere Sehnsucht nach der Schönheit heute oft zum Geschäft mit Sexualität und Selbstdarstellung verkommen ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 255
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Markus Hofer
DAS
HEILIGE
UND DAS
NACKTE
Eine Kulturgeschichte
INHALT
Heilig oder nackt oder beides
Und sie erkannten, dass sie nackt waren
Die Phantasie vom Goldenen Zeitalter
Soziologen, Ethnologen und Bordelle
Das Tier, das sich schämt
Warum wir uns schämen
Zwischen „Praline“ und „Bergdoktor“
Der aufrechte Gang und seine Folgen
Das Spiel von Verhüllung und Enthüllung
Die Sache mit dem Säbelzahntiger
Vom Feigenblatt zur Unterhose
Der heilige Raum und das Nackte
Exkurs: Der Mythos der Tempelprostitution
Geschlechtertrennung im Kirchenraum
Synagoge und Moschee
Kultische Reinheit: Eine ausgeschlossene Sache
Kultische Nacktheit: Nackt ins Bad der Wiedergeburt
Sardinien und der Ursprung des Lebens
Nacktheit in den alten Kulturen
Die erste nackte Lady
Ischtar – die göttliche Kurtisane
Das ägyptische Oben-Ohne
Rituelle Nacktheit
Minoer und Mykener: Kultische Ausnahmen
Homer: Nur nicht nackt!
Die ideale Nacktheit der Griechen
Venus: Liebesgöttin mit negiertem Schoß
Aktueller Zwischenstopp: Mohammed und die Ministerpräsidentin
Nacktheit in der Bibel
Das Christentum und die Lustfeindlichkeit
Augustinus, die Lust und die Tränen der Mutter
Das gar nicht so finstere Mittelalter
Die stillende Gottesmutter
Exkurs: Die vermeintliche Macht der Kirche
Das Nackte neben dem Heiligen
Die Renaissance: Das folgenreiche 16. Jahrhundert
Am Anfang war die Syphilis
Eine Reformation mit Folgen
Der Puritanismus und die nackte Kunst
Die Nackten in den geheimen Kabinetten
Am Beispiel der nackten Judith
Michelangelo und seine nackten Männer
Das Konzil und die Hosenmaler
Die Hexenverfolgung und der sexuelle Wahn
Vom nackten Überdruss
Barocke Malerei zwischen Nacktheit und Prüderie
Kunst als Versinnlichung des Glaubens
Bernini: Die Ekstase der heiligen Teresa
Caravaggio und Rembrandt: Der neue Realismus
Rubens: Grenzgänger zwischen Nacktheit und Prüderie
Das Rokoko und das Schäferstündchen
Die Prüderie der beginnenden Moderne
Keine gute Zeit für das Heilige
Die Badenden und die Moderne
Nackte Heilige
Nackt im Paradies: Adam und Eva
Der betrunkene Noah
Lot und seine Töchter
Die Geschichte vom unverführbaren Josef
Als sogar David nackt wurde
Exkurs: Das Heilige und das Schöne
Bathseba im Bade
Susanna und die Lüstlinge
Göttliche Nacktheit
Michelangelo und das Hinterteil des Schöpfers
Maria Magdalena als Pin-up verbotener Schaulust
Sebastian und die versuchte Versöhnung des Heiligen und Nackten
Unheilige Nacktheit – ein aktuelles Resümee
Literatur
Namensregister
Bildnachweis
HEILIG ODER NACKT ODER BEIDES
Das Heilige und das Nackte: Auf den ersten Blick scheinen sich die beiden Bereiche auszuschließen. Wer in Strandbekleidung einen italienischen Dom besuchen will, merkt sofort: Geht nicht! Lange Zeit saßen in katholischen Kirchen Männer und Frauen in verschiedenen Bänken und wenn die muslimischen Männer in andächtig kauernder Haltung Gott verehren, dann ist das nur mit Geschlechtertrennung denkbar. Auf orthodoxen Ikonen ist alles würdevoll zugeknöpft, wie es sich gehört, und nicht zuletzt ist die legendäre Tempelprostitution vermutlich auch nur ein Mythos. Das Heilige ist das Heilige und das Nackte ist das Nackte.
Doch so sauber lassen sich im Leben die Dinge nicht trennen. Die Sexualität ist eine starke Kraft, die man nicht unterschätzen darf. Um es vorwegzunehmen: Je rigider die Sexualmoral einer Gesellschaft, umso nackter werden die Heiligen in der katholischen Bilderwelt, umso mehr blitzt der Busen der büßenden Maria Magdalena unter ihren langen Haaren hervor. Irgendwo muss es ja hin, ist man vermeint zu sagen. Und die biblischen Stoffe geben dafür reichlich Vorwand.
Es ist ein frustrierendes Geschäft für die Moralisten der Jahrhunderte, doch die meisten dürften gar nicht gemerkt haben, dass Moralisieren nichts nützt, sondern die Sache erst interessant macht. Das Unterdrücken und Verdammen hat die Sexualität nicht zum Verschwinden gebracht. Die meisten Moralisten haben eher das Gegenteil dessen erreicht, was sie eigentlich erreichen wollten. Je strenger die Moral nach außen, umso kurioser werden die Erscheinungen im Hinterzimmer bis hin zur viktorianischen Zeit, in der sich aristokratische Damen sogar aufblasbare Brüste aufs Dekolleté setzten, denen dann manchmal unter der Preisgabe verdächtiger Geräusche während des Dinners die Luft ausging.
Es war nicht das vermeintlich finstere Mittelalter, das so seltsame Auswüchse zeigte. Es ist vor allem das 16. Jahrhundert – der Beginn der Neuzeit, des Humanismus und der vorgeblichen Überwindung des Mittelalters –, das neben dem Hexenwahn in der Abfolge von Syphilis, Reformation und Gegenreformation die Krägen hoch und steif verschloss. Die Sexualmoral wurde in dieser Zeit sogar verstaatlicht. Aber auch das nützte nicht viel, in den privaten aristokratischen Kabinetten türmten sich die Gemälde mit nackten römischen Göttinnen, gemalt von den berühmtesten Malern der Zeit, die ihren wohlhabenden männlichen Auftraggebern lieferten, was diese gern betrachteten. So begleitet der sonst in allen Dingen sehr streng katholische König Philipp II. von Spanien eigenhändig die nackte Venus auf einer Hausorgel. Lustvoll sich anbietend räkelt sich die Göttin auf ihrem samtenen Bett, während der junge Philipp auf einer kleinen Orgel spielt, seinen Blick aber auf die weibliche Schönheit gerichtet hat. Das Bild hatte ihm kein Geringerer als Tizian gemalt, ist über zwei Meter breit, prächtig anzusehen, hing aber verborgen hinter Vorhängen der Privatgemächer im Escorial. Es ist eindeutig: Je strenger die Moral, umso abgrundtiefer wird die Doppelmoral.
Nicht unbedingt sehr bußförmig kauert Maria Magdalena in ihrer Höhle.
Francesc Masriera: Büßende Maria Magdalena, 1890
Diese Zeiten sind vorbei – den nackten Darstellungen sind heute kaum mehr Grenzen gesetzt. Die mediale Bilderflut an Nacktheit ist unüberschaubar und Ästhetik scheint nicht mehr das zentrale Thema zu sein. Die nackten Männer des Michelangelo, die lasziv sich räkelnden Göttinnen eines Tizian oder Rubens folgten einem idealisierten Verständnis von Schönheit. Heute steht das Geschäft mit der Sexualität und die Selbstdarstellung im Vordergrund und nicht mehr die Sehnsucht nach Schönheit. Im Blick auf die Nackt-Selfies, die über soziale Medien verschickt werden, befällt einen vielmehr das schale Gefühl einer Banalisierung der Nacktheit. Die Reizüberflutung gerade für junge Männer ist enorm und vermutlich hat es damit zu tun, dass sie heute die wichtigsten Konsumenten von Viagra sind, die Zielgruppe der älteren Herren schon längst hinter sich gelassen. Ist das nicht doch ein verstecktes Plädoyer für die Moralisten?
Vermutlich liegt des Pudels Kern wieder einmal in der Mitte. Vielleicht waren es schon auch die Moralisten, die den Reiz des vermeintlich Verbotenen kreierten und uns, gewollt oder nicht, bewusstwerden ließen, dass banale Nacktheit sehr bald ihren Reiz verliert. Das raffinierte Spiel von Zeigen und Verbergen macht eigentlich erst die Erotik aus, die menschlich kultivierte Form dessen, was früher einfach Fortpflanzung war, und die so das Menschenleben um vieles reicher macht.
Das Heilige und das Nackte: Auf den zweiten Blick tut sich ein interessantes Thema auf, ein Spannungsfeld von menschlichen Konstanten, das äußerst reizvoll ist. Es zeigt, wie sich die Kraft der Sexualität Wege bahnte und wie immer wieder versucht wurde, sie zu kultivieren. Es reicht von der Frage nach der Scham im Ursprung der Menschheit, über kultische Nacktheit bis zu religiöser Pornografie. Es geht um homosexuelle Künstler, denen die Darstellung männlicher Heiliger die Verbildlichung ihrer Sehnsüchte ermöglichte, und um die vielen Gemälde oft barbusiger heiliger Frauen, die ein legitimiertes Ventil in sittlich strengen Zeiten bildeten. Nicht zuletzt haben diese Bilder in den ästhetisch ansprechenden Werken auch einiges zur Versinnlichung des Glaubens beigetragen. Das Heilige und das Nackte sind keine zwingenden Gegensätze, vielmehr ist es ein reizvolles Spannungsfeld, das einige Fragen beinhaltet, denen sich jede Zeit erneut stellen muss.
Das Nackte ist eindeutig, mit dem Heiligen ist es nicht so einfach. In diesem Buch wird es vorwiegend im Kontext des christlichen Abendlandes um heilige Orte gehen, um Räume des religiösen Erlebens, die offensichtlich in Kontrast stehen zum Nackten. Es wird auch um heilige Schriften gehen, vor allem das Alte Testament, das äußerst lebendige Geschichten rund um Nacktheit und Sexualität enthält, Geschichten, die dann zum Vorwand für Nacktheit in der religiösen Kunst wurden. Neben den biblischen Figuren spielen aber auch die Heiligen als verehrte Personen eine Rolle und da bieten sich exemplarisch Maria Magdalena für die Frauen und Sebastian für die Männer an. Über die Orte, Schriften und Personen hinaus soll der Begriff des „Heiligen“ aber bewusst offengehalten werden. Es geht auch um das Numinose, das verehrte Geheimnisvolle, das erlebt, aber nur schwer beschrieben oder definiert werden kann. Das Heilige steht meist im Kontrast zum Profanen, doch auch hier kann es ein kreatives Spannungsfeld geben, in dem das Profane das Heilige erdet und das Heilige dem Profanen Würde verleiht.
Ist die Spannung zwischen dem Heiligen und dem Nackten nur eine spätere kulturelle Erscheinung? Gab es vor der offiziellen Moralisierung „natürliche“ Verhältnisse, von denen manche heute noch träumen, eine Nacktheit ohne Regeln? Ist die Scham tatsächlich eine spätere Entwicklung? Um diesen Fragen näherzukommen, gilt es, sich zumindest gedanklich in die menschlichen Anfänge zu begeben. Sogar die Bibel beginnt bereits mit diesem Thema.
UND SIE ERKANNTEN, DASS SIE NACKT WAREN
Lange dauerte für Adam und Eva die Freude am Paradies nicht, da kam schon die Herausforderung mit dem Baum der Erkenntnis, an der sie scheiterten. Die Schuld dafür schob man schön brav weiter: Adam auf Eva und Eva auf die Schlange. Die Folgen aber waren menschlich existentiell: „Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zum Erdboden zurückkehrst; denn von ihm bist du genommen, Staub bist du und zum Staub kehrst du zurück.“ (Gen 3,19) Die paradiesischen Zeiten waren damit vorbei.
Die Geschichte vom Sündenfall (Gen 3) ist eine sehr komplexe, deren Alter und Entstehung durchaus umstritten sind. Teile dürften aus dem 7. Jahrhundert v. Chr., einzelne Verse auch jüngeren Datums sein. Im Kern ist es sogar möglich, dass noch ältere orientalische Mythen hineingespielt haben. In der Endfassung, wie sie uns vorliegt, ist sie eine Erklärungsgeschichte, die den gegenwärtigen Zustand des Lebens in der Welt begreiflich machen will, die Mühen des Lebensunterhalts, die Spannungen unter den Geschlechtern, Leid und Tod, letztlich all die weniger erfreulichen Dinge des Lebens, die Gott so nicht erschaffen hat. Es ist keine Erklärung im naturwissenschaftlichen Sinn, was schon der orientalischen Denkweise widersprechen würde, sondern vielmehr eine Erzählung, die sinnstiftend ist und existentielle Fragen des Menschseins vom Ursprung her deutet.
Warum schämen wir uns? Und war das immer schon so? Diese Fragen dürften sich die Menschen schon in Urzeiten gestellt haben, wobei es vor allem um die sexuelle Körperscham geht. In der Schöpfungsgeschichte wird das Zusammenleben von Adam und Eva im Paradies nicht ausführlich beschrieben, aber aus dem Nachfolgenden wird klar: Sie waren nackt und machten sich nichts daraus. Das Problem begann offensichtlich mit dem Verbot Gottes, von dem einen Baum in der Mitte des Paradieses zu essen. Die böse Verführerin in der biblischen Erzählung ist zwar die Schlange, aber das Thema selbst beginnt mit einem Verbot, das deshalb nicht eingehalten wird, weil es zu verführerisch ist. Was sich später quer durch die christliche Kunst zeigt, scheint in dieser Ursprungserzählung schon angelegt: Das Verbot bewirkt die Übertretung.
Adam und Eva essen von den verbotenen Früchten und sofort geschieht etwas Entscheidendes: „Da gingen beiden die Augen auf und sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich einen Schurz.“ (Gen 3,7) In weiterer Folge fallen sie damit aus dem Paradies, anders gedeutet hieße es: Ab jetzt sind sie eigentlich Menschen. Auf dem Weg vom paradiesischen zum irdischen Menschsein steht demnach die Scham und so gesehen gehört das Feigenblatt zur Nacktheit wie der Mensch zur Erde.
Eine zusätzliche Pointe erhält die Stelle durch die Worte „sie erkannten“, denn „erkennen“ hat im Hebräischen mindestens zwei Bedeutungen. Einmal ist es das Erkennen beispielsweise von Gut und Böse, wie es in der Erzählung vom Sündenfall beschrieben wird. Gleichzeitig kann das Wort „erkennen“ auch für den Vollzug des Geschlechtsaktes stehen. Ob damit bereits ein solcher Akt angedeutet ist, sei dahingestellt, aber eine sexuelle Note kommt mit ins Spiel. Im ersten Vers nach der Geschichte vom Sündenfall heißt es nämlich: „Adam erkannte Eva, seine Frau; sie wurde schwanger und gebar Kain.“ (Gen 4,1) Die Geschichte von Mann und Frau, die zuerst als Abbild Gottes erschaffen worden sind, beginnt gleichsam nochmals neu mit dem gemeinsamen Erkennen, mit der Nacktheit und dem schamhaften Feigenblatt – und sie beginnt mit dem Übertreten reizvoller Verbote.
Die Phantasie vom Goldenen Zeitalter
Das gemeinsame Zusammenleben zwischen Adam und Eva im Paradies wird in der Bibel nicht geschildert und das Alte Testament geht dieser Frage gar nicht weiter nach; das tut dann folgenreich der Kirchenvater Augustinus. In der griechischen und römischen Antike gab es als Parallele dazu den Mythos vom Goldenen Zeitalter, einem friedlichen Idealzustand der Menschen in der Urzeit noch vor dem zunehmenden moralischen Verfall. In den antiken Erzählungen ist es eine paradiesische Zeit ohne Nöte, ohne Hunger und Arbeit, ohne Krieg und Verbrechen, frei von Kummer und Plagen. Die Schilderungen des „Goldenen Geschlechts“ bei Hesiod (8./7. Jahrhundert v. Chr.) haben noch keinerlei sexuelle Note, sondern dienen dazu, die Menschen seiner Zeit zu ermahnen und ihnen den moralischen Verfall vorzuhalten. Platon erwähnt zumindest, dass sich die Menschen unbekleidet in der Natur bewegten, da das Klima entsprechend warm gewesen sei. Der römische Dichter Tibull (1. Jahrhundert v. Chr.) deutet immerhin schon an, dass die Menschen der Urzeit einander überall geliebt hätten, offensichtlich eine Praxis der freien Erotik.
Die Phantasie erotischer Freizügigkeit im Urzustand des Menschen
Lucas Cranach der Ältere: Das Goldene Zeitalter, um 1530
In der frühen Neuzeit lebte das Motiv des Goldenen Zeitalters in den Phantasien der Dichter und Maler erneut auf. Jetzt wird es gleichsam zum erotischen Schlaraffenland, indem ein freizügiges Ideal von körperlicher Unbefangenheit phantasiert und ausgemalt wird. Cranachs einschlägige Eingebungen beispielsweise blühten bei diesem Thema richtig auf. Solche Phantasien sind eine Art sexuelle Projektionsfläche in einer sittlich zunehmend strengen Zeit, die Vorstellung einer quasi heiligen Freizügigkeit. Diese Phantasien kanalisieren eine gewisse Sehnsucht in einer doch ziemlich zugeknöpften Zeit und sie erlauben den Malern Bilder, die anders nicht möglich gewesen wären.
Lucas Cranach der Ältere, einer der bedeutendsten Künstler der deutschen Renaissance, hat gleich drei Versionen des Goldenen Zeitalters gemalt. In der Variante, die in der Alten Pinakothek in München hängt, halten sich hinter einer Mauer in üppiger Vegetation die nackten Menschen paarweise auf oder tanzen als gemischte Gruppe in einem Reigen um einen Baum. Man wäre fast gewillt zu sagen, es sei der paradiesische Baum der Erkenntnis, von dem sie noch nicht genascht haben. Der Mythos wird hier zum erotischen Vorwand. Solche Bilder sind tatsächlich auch ein Versuch, sich hinter den biblischen Sündenfall ins vermeintlich ursprüngliche Paradies zurückzubegeben und dort die eigenen erotisch-sexuellen Phantasien zu platzieren. Bemerkenswert ist allerdings, dass dieses Thema die Bibel noch gar nicht interessiert hat und solche Bilder erst am Beginn der Neuzeit aufkommen. Nicht weniger bemerkenswert ist umgekehrt, wie sich Cranach bei aller Freizügigkeit doch nicht ganz hinter das Feigenblatt zurückgewagt hat. Die Popos sind frei sichtbar, doch vor jedem Genitalbereich, männlich wie weiblich, wächst zufällig ein Blatt oder ein Ast. Zumindest ein Minimum an Genitalscham scheint sich Cranach selbst in seiner Phantasie zu wahren. Das Feigenblatt bleibt also trotzdem.
Soziologen, Ethnologen und Bordelle
Nun also: Warum schämen wir uns? Und war das immer schon so? Diese Fragen stellten sich nicht nur Menschen in antiker Zeit, noch in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entbrannte darüber ein Streit unter deutschen Wissenschaftlern. Der Soziologe Norbert Elias veröffentlichte 1939 seine beiden Bände „Über den Prozess der Zivilisation“, in denen er vom Frühmittelalter bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts einen fortwährenden Prozess der Verfeinerung der Sitten beschreibt, den er die Zivilisierung nennt. Meist beginnt es in den oberen Schichten, die dann von den unteren imitiert werden, worauf die oberen ihre Sitten nochmal verfeinern. So beschreibt er das allmähliche Sinken der Gewaltbereitschaft, die zunehmend stärker kontrollierte und unterdrückte Sexualität, die Tabuisierung der Ausscheidungsfunktionen, die zunehmend dem Blick anderer Menschen entzogen wurden, und nicht zuletzt die Tischsitten, die immer strenger und feiner wurden. In diesem Prozess, so beschreibt es Elias, werden die Zwänge von außen (Regeln, Verbote) zunehmend zu Selbstzwängen und die Körperscham ist dann das Ergebnis der verinnerlichten gesellschaftlichen Verbote. Auch wenn es Elias nicht ausdrücklich so behauptet, läge damit die Vermutung nahe, dass es vorher eine quasi schamfreie Gesellschaft gegeben habe, bevor der Prozess der Zivilisation einsetzte.
Sein Werk wurde erst wirklich populär, als es 1969 der Suhrkamp Verlag als Taschenbuch neu herausbrachte. Das rief um eine Generation zeitversetzt den deutschen Volkskundler Hans Peter Duerr auf den Plan, der in einem monumentalen fünfbändigen und materialreichen Werk die Thesen Elias’ zu widerlegen suchte. Duerr greift sicher manches an, was Elias so nicht behauptet hatte, und ein wenig wird auch aneinander vorbeigeredet, doch umgekehrt waren die Angriffe auf Duerr aus dem Elias-Lager äußerst aggressiv und manchmal auch aus der unteren Schublade. Jedenfalls hat die Frage der Scham vor einigen Jahrzehnten noch die Gemüter heftigst erregt.
Sicher ist, dass der Prozess der Zivilisation nicht so linear verlaufen ist, wie es bei Elias zeitweilig klingen mag, und dass in der Abstraktion manch anderes auch übersehen wurde. Material hat Duerr zweifellos viel mehr verarbeitet als Elias und er zeigt, dass Elias und Forscher in seiner Tradition ihr Material mitunter etwas beliebig verwendet haben. Ein Beispiel ist das bekannte Bild eines spätmittelalterlichen Badehauses mit nackten Männern und Frauen in den Badezubern, die sich gegenseitig auch sexuell berühren. Oft galt dieses Bild als Beleg für die Offenheit oder Schamlosigkeit des Mittelalters, während Duerr zeigen konnte, dass das Bild kein Bad, sondern ein Bordell darstellt. Die mittelalterlichen Städte kümmerten sich oft um die Errichtung von Bordellen für die Vielzahl unverheirateter Männer, die schon aus finanziellen oder Standesgründen gar nicht heiraten durften, und zum Schutz der Frauen. Nicht selten fanden sich solche Bordelle neben den Badehäusern und geschäftstüchtige Bader kümmerten sich um beide Geschäfte. Es dürfte auch recht praktisch gewesen sein, dass man vor oder nach dem Bordellbesuch auch noch im Badehaus einkehrte. Trotzdem darf man nicht das Bild eines Bordells als Darstellung eines Badehauses ansehen, um dann Schlussfolgerungen zum sittlichen Zustand einer Gesellschaft zu ziehen. Darauf macht Hans Peter Duerr immer wieder aufmerksam: Man muss genau hinsehen und sich zuweilen vielleicht auch von ideologischen Überfrachtungen lösen. Der Philosoph Ludwig Wittgenstein formulierte den Ansatz noch pointierter: „Denk nicht, sondern schau.“
In der Elias-Duerr-Kontroverse spielte die Eingangsfrage eine zentrale Rolle: Schämte man sich immer schon oder gab es vor der so genannten Zivilisation eine schamfreie Zeit, vielleicht sogar das rückwärts ersehnte Goldene Zeitalter? Gab es nicht! Das volkskundliche Material von Hans Peter Duerr ist in dieser Frage schlagend. Der Ethnologe hat eine große Fülle von Beispielen zusammengetragen, die klarmachen: Es gibt keine für uns beschreibbare Kultur, die schamfrei gewesen wäre. Besonders eindrücklich sind seine Beispiele von kaum bis wenig bekleideten Naturvölkern auf der ganzen Welt; die Volkskunde bemühte sich schon seit dem 19. Jahrhundert, solche Kulturen zu beschreiben und zu dokumentieren. Überall und wenn auch noch so dezent sind Schamregeln zu beobachten, meist in der Form von Blickregeln, die vorgeben, wohin man schauen darf und wohin nicht, und dabei geht es vorwiegend um den Genitalbereich. Daneben wurden auch Interaktionsregeln beschrieben, die den Umgang miteinander und das Sprechen über schambesetzte Dinge ordneten. Selbstverständlich setzen später durchaus solche Prozesse der Zivilisation ein, wie sie Norbert Elias beschrieben hat, wenn Schamgrenzen vorrücken und zunehmend durch restriktive Sittengesetze überformt werden. Doch die Vorstellung eines ursprünglich schamfreien Zusammenlebens ist und bleibt aus vielerlei Gründen eine Fiktion.
Das Tier, das sich schämt
Die empirischen Belege Hans Peter Duerrs schließen einen quasi natürlichen Zustand ohne Scham aus. Das erotisch-goldene Zeitalter ist eine menschliche Utopie und als solche ein kulturelles Produkt der beginnenden Neuzeit. Die Frage nach der Scham wurzelt noch ein Stockwerk tiefer. Schon die Erzählung vom Sündenfall hat gezeigt, dass das irdische Menschsein mit dem Erkennen der Nacktheit beginnt. Eine vorkulturelle Nacktheit, die den Betroffenen gar nicht bewusst ist, wäre vermutlich keine menschliche. Natur und Kultur können nicht so sauber unterschieden werden, schon allein, weil logischerweise das Unterscheiden selbst eine sprachliche und damit bereits kulturelle Angelegenheit ist – wir sind immer mitten drin. Insofern hat die Bibel einfach Recht: Das Erkennen kommt vor dem Nacktsein. Erst mit der Scham wird die Nacktheit bewusst. Alles andere ist allerhöchstens spätere bildliche Phantasie oder literarischer Mythos.
Man kann es also drehen wie man will, Nacktheit ist von Anfang an ein kulturelles Phänomen und damit auch die Scham. Das Diktum vom „nackten Affen“ erhält damit eine noch umfassendere Bedeutung. Die Nacktheit ist ausschließlich menschlich und damit von Anfang an Kultur. Wolfgang Reinhard hat es sehr schön auf den Punkt gebracht: „Das Tier kennt keine Scham, der Mensch aber ist das Tier, das sich schämt.“1 Die Scham ist daher kein Endprodukt der Zivilisierung, sondern vielmehr der Ausgangspunkt des Menschseins: „Und sie erkannten, dass sie nackt waren.“
1Reinhard, Lebensformen Europas, S. 63.
WARUM WIR UNS SCHÄMEN
Es war also immer schon so, um auf die Eingangsfrage nach der Scham zurückzukommen. Die Frage nach dem Warum bleibt aber im Raum, auch wenn es auf diese Frage keine definitive Antwort geben kann, höchstens eine plausible. Ein fiktiver Blick in die Geschichte des Homo sapiens könnte einiges erhellen. Vergleicht man den Menschen mit anderen höheren Säugetieren – die Affenarten seien jetzt einmal ausgenommen, da sich hier schon manches vermischt –, so zeigt sich ein essentieller Unterschied in Bezug auf die Sexualität. Im höheren Tierwesen ist die Sexualität ausschließlich auf die Fortpflanzung fokussiert und spielt sich nur in diesem Zusammenhang ab. Befindet sich das Weibchen in der fruchtbaren Phase, scheidet es sexuelle Lockstoffe aus, die Pheromone, die das Männchen in die Nase bekommt und entsprechend erregt. Ist es dasjenige, das sich das Weibchen erwählt hat bzw. das Alpha-Männchen, das im Revierkampf gesiegt hat, kommt es entsprechend zum Zug. Schon hier ist das Paarungsverhalten ein Stück rituell überformt, doch der eigentliche Reiz geht über die Nase. Dieses tierische Reiz-Reaktions-Schema ist aber ausschließlich auf die Befruchtung selbst begrenzt.
Irgendwann in der langen Entwicklung zum Menschsein hat sich die Sexualität allmählich verselbständigt, quasi vom zwingenden Zusammenhang der Fortpflanzung emanzipiert. Menschliche Sexualität ist nicht mehr abhängig von der weiblichen Fruchtbarkeit und Menschenfrauen sind grundsätzlich durchgehend zur Paarung fähig. Da das auch für die Männer gilt, stellt sich die Frage, woher dann nun der Reiz kommt, nachdem die Pheromone weitgehend ausgedient haben; schon unsere Nase hätte nicht mehr diese Empfindlichkeit. Das sexuelle Reiz-Reaktions-Schema hat sich von der Nase des Männchens in die Augen des Mannes verlegt. Der erste Impuls geht allerdings immer noch vom weiblichen Gegenüber aus. Bestimmte Formen des weiblichen Körpers springen dem Mann quasi ins Auge, gehen dann ins Gehirn, das dann je nachdem „die sexuelle Hydraulik“ in Gang setzt, um es einmal etwas animalisch zu formulieren. Selbstverständlich ist dieser Ablauf inzwischen stark kulturell überformt, doch das Grundschema ist nach wie vor dasselbe.
Zwischen „Praline“ und „Bergdoktor“
Der italienische Soziologe Francesco Alberoni hat 1986 in seinem Buch „Erotik“ die Unterschiede von männlicher und weiblicher Erotik sehr treffend charakterisiert. Manchmal wird an plakativen Beispielen ein Unterschied erst deutlich und so beginnt Alberoni mit einem traditionellen Zeitschriften-Kiosk. Da gab es früher den Zeitschriftenständer mit der Literatur, die vorwiegend Männer, und jenen mit der Literatur, die vorwiegend Frauen gekauft haben. In dem einen steckte alles von „Praline“ bis „Playboy“ und auf der anderen Seite das Spektrum vom romantischen Bergdoktor über den Fürsten-Roman zu den Promi-Magazinen.
Das erotische Muster der Männer ist stark visuell strukturiert, weshalb die Literatur auf dieser Seite von Bildern bestimmt ist. Es gibt viel zu schauen und eher wenig zu lesen. Umgekehrt verhält es sich mit der Literatur auf der anderen Seite, da gibt es oft kaum etwas zu sehen, aber viel zu lesen. Das erotische Muster der Frauen dürfte um einiges komplexer sein. Da geht es nicht vorrangig um einen knackigen Po, sondern um Beziehungen und Geschichten, um Status und gesellschaftliche Symbole. Da spielt sich vereinfacht gesagt das ab, was sich ursprünglich auch beim Pheromone streuenden Weibchen abspielte bis klar war, welches Männchen zum Zuge kommt.
Auf der Männerseite kommen hingegen keine Fürstinnen oder Oberärztinnen vor, weil das für die männliche Erotik keine Rolle spielt, wenn die Kurven entsprechend präsentiert sind. Auf der Frauenseite, blättert man die Promi-Magazine durch, dürfte das Aussehen dieser Alpha-Männer nicht unbedingt entscheidend sein und Nacktheit braucht es schon gar nicht. Die erotische Aufmerksamkeit der Frauen ist breiter gestreut als die der Männer. Schon vor Jahren erklärte der österreichische „Hormonpapst“ Johannes Huber, die Forschung für ein weibliches Viagra werde eingestellt, da die weibliche Sexualität zu komplex sei. Da gäbe es nicht einfach einen Punkt, an dem man etwas einwerfen könne, damit alles funktioniere.
Durch das männliche visuelle Reiz-Reaktions-Schema ergibt sich zwischen Männern und Frauen ein komplementäres Muster von Zeigen und Schauen. Ganze Industriezweige von der Kosmetik über die Modewelt bis zur Chirurgie leben von der weiblichen Präsentation. Es ist das zutiefst menschliche Grundmuster der Erotik, das in diesem Spiel von Zeigen und Verbergen, von Präsentieren und Schauen, eben von visuellem Reiz und Reaktion besteht. Es ist ein lustvolles Spiel zwischen dem eher exhibitionistischen Zug der Frau und dem eher voyeuristischen Zug des Mannes – und noch dazu ein Spiel, das jederzeit möglich ist, unabhängig von fruchtbaren Tagen der Frau. Theologisch gesehen klingt das schon eher nach einem kreativen Schöpfergott als nach dem Werk des Teufels, wie es die Moralisten später bezeichnet haben.
Der aufrechte Gang und seine Folgen
Nicht nur die Verlagerung des sexuellen Reaktionszentrums von der tierischen Nase in die männlichen Augen hatte Folgen, sondern in Verbindung damit auch der aufrechte Gang: Die Sichtbarkeit der körperlichen Reize veränderte sich. In der Körperhaltung der Affen ist vor allem die Gesäßgegend optisch bedeutsam, auch die weibliche Genitalgegend ist gut sichtbar. Im aufrechten Gang jedoch verkleinert sich das Hinterteil, das weibliche Genital verbirgt sich fast zur Gänze zwischen den Beinen, dafür aber treten die Brüste erst richtig hervor. Das Ergebnis sehen wir am Kiosk in der Männerabteilung. Übrigens dürfte hier auch die Evolution mitgespielt haben, denn die Menschenfrau ist die einzige, die permanente Brüste hat und damit grundsätzlich permanent mögliche Signale aussendet. Bei den höheren Säugetieren bildet sich nämlich das Drüsengewebe nach dem Stillen wieder zurück.
Noch größere Folgen hat der aufrechte Gang aber für die Männer. Im aufrechten Gang treten nämlich die männlichen Genitalien offen hervor, fast wie zur Schau gestellt. Zum einen sind diese wichtigen und teilweise äußerst schmerzempfindlichen Organe jetzt viel weniger geschützt und damit mehr gefährdet. Penisfutteral und Hodenschutz gehören deshalb zu den ältesten Teilen von Bekleidung, wie sie auch bei Naturvölkern noch beobachtet wurden. Das Ganze steigert sich dann bis zur Schamkapsel, dem auffällig gestalteten Hosenlatz des 15. und 16. Jahrhunderts, der die Potenz symbolisieren sollte.
Es kommt aber noch ein ganz anderer Aspekt hinzu: Die Penisse werden vergleichbar und darum nicht ungern versteckt. Dass die Größe des Penis das Entscheidende sei, ist ein uralter und Männer verunsichernder Mythos, der bis heute am Werk ist. Die Penisfutterale, die wir kennen, sind als Schutz nicht allzu tauglich, aber sie verbergen die Größe des Penis, womit auf dieser Ebene zumindest keine Rivalitäten mehr ausgetragen werden können. Und noch etwas kommt im aufrechten Gang zum Tragen: Erektionen werden sichtbar, was je nach Umstand unerwünscht oder sogar gefährlich sein könnte. Bei einigen Naturvölkern wurden Penisfutterale beobachtet, die deshalb sogar nach oben auf den Bauch gebunden wurden. Solche unwillkürlichen sexuellen Reaktionen zu verbergen, war vermutlich für ein friedliches Zusammenleben in einer Gemeinschaft nicht unwichtig.
Jetzt kann auch die Scham im Prozess der menschlichen Entwicklung entsprechend verortet werden. Der sexuelle Impuls geht von Körperreizen der Frau aus und springt dem schauenden Mann ins Auge. Da aber die Sexualität im Prinzip jederzeit verfügbar ist und es ständig etwas zu sehen gäbe, braucht es für ein geordnetes Zusammenleben dringend ein Regulativ: die Scham! Wie es Hans Peter Duerr bei den Naturvölkern beschrieben hat, gab es vermutlich immer schon Schamregeln, die das Schauen ordneten, die bestimmten, wohin man und wann schauen darf oder eben nicht. Vermutlich gab es sehr umfassende Regeln der Interaktion im Bereich des Genitalen und zwar als Schutz für sich selber und Schutz vor anderen.
Letztlich sind Reste davon bis heute in der Sauna zu beobachten. Männer sitzen meist breitbeinig auf den Brettern mit gut sichtbaren Genitalien. Das ist kein Machogehabe, da es für Männer einfach unangenehm bis schmerzhaft ist, den Genitalbereich durch übereinandergeschlagene Beine zu verbergen. Obwohl es heute Frauen niemand mehr verbieten würde, sitzen sie in der Sauna meist so, dass ihr Schambereich nicht eingesehen werden kann, mit engen, überkreuzten oder angezogenen Beinen.
Die dem Menschen regelmäßig verfügbare Sexualität hat schon früh zur Entstehung sozialer Verbände und zum gemeinschaftlichen Zusammenleben beigetragen, genau deshalb musste sie aber reguliert werden. Letztlich musste das öffentliche Zusammenleben immer wieder auch entsexualisiert werden. Die Sichtbarkeit selbst ist und bleibt eine grundsätzliche Herausforderung, will man im anderen Extrem Frauen nicht hinter vergitterten Körperzelten verstecken. Die sexuelle Körperscham ist aber schlussendlich nichts weniger als eine Form der Kultivierung des Menschen. Vielleicht lugt an dieser Stelle bereits ein erstes Mal das Nackte hinüber zum Heiligen, das im Animalischen Wurzelnde hinüber zu dem, was menschliche Würde ausmacht.
DAS SPIEL VON VERHÜLLUNG UND ENTHÜLLUNG
Die Sache mit dem Säbelzahntiger
Im dunklen, urwaldähnlichen Gebüsch der afrikanischen Savanne lauert ein Säbelzahntiger, der Reflex seiner Augen blitzt zwischen den Blättern hervor. Er riecht noch nicht, dass sich im Gegenwind hinter ihm ein früher Homo sapiens versteckt, ein wilder Krieger mit einer zwar primitiven Lanze, die aber bei richtiger Anwendung für ihn doch tödlich sein kann. Unserem Vorgänger rinnt der Schweiß über den noch leicht behaarten Rücken. Gelingt es ihm, den Säbelzahntiger zu erlegen, das weiß er, dann hat er die zumindest fleischliche Nahrung für seine Sippe eine Zeit lang gesichert. Er weiß auch, dass es sehr viel Kraft brauchen wird, den Tiger richtig zu treffen. Er weiß auch, wie gefährlich es ist, wenn er nicht nahe genug hinkommt, wenn er den richtigen Moment nicht erwischt. Und er weiß, dass es jetzt Mut braucht, mehr vielleicht, als ihn seine Kollegen aus der Sippschaft aufbringen würden. Ein bisschen Stolz regt sich schon in ihm, hilft ihm, seine ganze Muskulatur in Spannung zu bringen.
Als unser früher Homo sapiens gegen Abend zu seiner Sippschaft zurückkehrt, hätte er sich das Tier am liebsten stolz um den Hals gehängt, um so seinen Auftritt zu haben und damit alle sehen, was er geleistet hat. Doch das Tier ist so schwer, dass er es mit Müh und Not in sein Lager bringt, auch wenn die Freude darüber groß ist. Inzwischen hatten sie entdeckt, dass man nach der mühsamen Enthäutung der Tiere das Fell abschaben und trocknen konnte. Darauf freut sich unser Vorgänger schon, denn das Fell dieses Säbelzahntigers wird seine Trophäe sein und mit geschwellter Brust wird er sie sich über die Schulter hängen, um anschließend durch das Lager zu stolzieren. Schließlich hat er auch einiges dafür geleistet.
Der Mensch ist bekanntlich das einzige Wesen, das sich bekleidet. Bei der Frage nach dem Ursprung der Kleidung denkt man vordergründig schnell