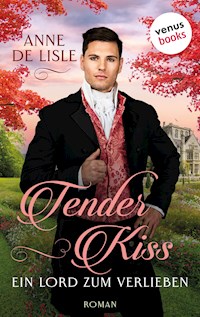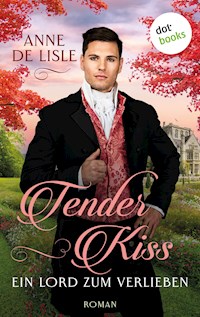Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine stürmische Liebe – und eine finstere Bedrohung ... Der historische Liebesroman »Das Herz des Lairds« von Anne de Lisle als eBook bei dotbooks. Darf er sie lieben – oder muss er sie fortschicken? Als Rory MacLeod eine junge Schönheit aus den Klauen einer Bande Wegelagerer rettet, ahnt der Highlander noch nicht, auf was er sich eingelassen hat: Die Engländerin Cate Denning, die ihn gerade noch um seine Hilfe bat, sie vor einer erzwungenen Ehe zu retten, stellt sich bald schon als dickköpfig und verwöhnt heraus. Obwohl es Rorys Pflicht wäre, sie an ihren Verlobten auszuliefern, kann er nicht verhindern, dass die temperamentvolle Cate sein Herz berührt. Aber bringt er mit dieser verbotenen Liebe seinen eigenen Clan in Gefahr? Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der romantische historische Liebesroman »Das Herz des Lairds« von Anne de Lisle. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 563
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Darf er sie lieben – oder muss er sie fortschicken? Als Rory MacLeod eine junge Schönheit aus den Klauen einer Bande Wegelagerer rettet, ahnt der Highlander noch nicht, auf was er sich eingelassen hat: Die Engländerin Cate Denning, die ihn gerade noch um seine Hilfe bat, sie vor einer erzwungenen Ehe zu retten, stellt sich bald schon als dickköpfig und verwöhnt heraus. Obwohl es Rorys Pflicht wäre, sie an ihren Verlobten auszuliefern, kann er nicht verhindern, dass die temperamentvolle Cate sein Herz berührt. Aber bringt er mit dieser verbotenen Liebe seinen eigenen Clan in Gefahr?
Über die Autorin:
Anne de Lisle lebt mit ihrem Ehemann in einem angeblichen »Geisterhaus« in Maryborough. Ihre Romane sind international erfolgreich.
Anne de Lisle veröffentlichte bei dotbooks bereits die historischen Liebesromane »Die Leidenschaft des Lairds«, »In den Händen des Schotten« und »Tender Kiss – Ein Lord zum Verlieben«.
***
eBook-Neuausgabe Februar 2023
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 2006 unter dem Originaltitel »The Black Highlander«. Die deutsche Erstausgabe erschien 2006 unter dem Titel »Der schwarze Highlander« bei Lübbe.
Copyright © der englischen Originalausgabe 2006 by Anne de Lisle
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2006 by Verlagsgruppe Lübbe GmbH & Co. KG, Bergisch Gladbach
Copyright © der Neuausgabe 2023 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © Period Images sowie © shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ae)
ISBN 978-3-98690-418-0
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Sie werden in diesem Roman möglicherweise Begrifflichkeiten, Weltanschauungen und Verhaltensweisen begegnen, die wir heute als unzeitgemäß und diskriminierend empfinden, unter anderem dem Begriff »Zigeuner«.
»Zigeuner« ist die direkte Übersetzung des im englischen Originaltext verwendeten Begriffs »Gypsy«, und es ist nicht möglich, dieses Wort in Titel und Text durch die heute gebräuchlichen Eigenbezeichnungen »Sinti und/oder Roma« zu ersetzen, weil sie inhaltlich nicht passen würden. Zur Handlungszeit im frühen 19. Jahrhundert war »Zigeuner« die gängige Fremdbezeichnung für die Sinti und Roma, wobei dieser Begriff seit dem 18. Jahrhundert vielerorts mit einem zunehmenden stigmatisierenden Rassismus verbunden war. Die Sinti und Roma lehnen die Bezeichnung »Zigeuner« daher heute zu Recht ab.
Bei diesem Roman handelt es sich um ein rein fiktives Werk, das vor dem Hintergrund einer bestimmten Zeit spielt und von uns ohne nachträgliche Eingriffe neu veröffentlicht wird. Anne de Lisle hat keinen Roman im Sinne der völkisch rassifizierten Nazi-Nomenklatur geschrieben, sondern verwendet Begrifflichkeiten so, wie sie aus ihrer Sicht zu der Zeit, in der ihr Roman spielt, verwendet wurden; Klischees werden hier bewusst als Stilmittel verwendet. Keinesfalls geht es in diesem fiktionalen Text aber um rassistische Zuschreibungen oder die Verdichtung eines aggressiven Feindbildes.
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Das Herz des Lairds« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Anne de Lisle
Das Herz des Lairds
Roman
Aus dem Englischen von Britta Evert
dotbooks.
Kapitel 1
Glen Garry, Schottland, 1651
Eine einsame, in einen Umhang gehüllte Gestalt stand am Rand der Schlucht von Linnhe Dubh, hinter sich ihre Stute, ein schlankes, geschmeidiges Tier, das aber auf einem Bein lahmte und den Kopf unter dem starken Regen duckte. Es goss seit Tagesanbruch, die Sicht war schlecht, und die Gestalt in dem Umhang wirkte unschlüssig, als scheute sie davor zurück, die Brücke zu überqueren, die von dem dichten Nebel und strömenden Regen förmlich verschluckt wurde. Schließlich setzte sie sich in Bewegung, indem sie ihre Stute mit schmeichelnden Worten über den rutschigen Boden lockte und vorsichtig neuerlichen Güssen auswich.
Das plötzliche Klappern von Hufen brachte sie aus dem Gleichgewicht. Sie hielt sich mit einer Hand an der Stute fest und starrte mit zusammengekniffenen Augen durch den Nebel, der über der Schlucht hing. Eine Anhäufung düsterer Schatten war zu erkennen, verschwommene Gebilde, formlose Erscheinungen, die übergangslos zu gleitenden, beinlosen Gestalten verschmolzen. Sie versuchte zu erkennen, wie viele es waren und wie weit sie entfernt waren. Einen Moment lang waren sie verschwunden, und sie blieb ganz still stehen, mit fest verschränkten Händen und stockendem Atem. Nebelfetzen wehten um ihre Füße. Ihre Stute wieherte ihr leise ins Ohr. Das Klappern von Hufen wurde stetig lauter, und auf einmal waren sie wieder da, größer und näher, bedrohliche schwarze Schatten, die unvermittelt aus dem Nebel brachen.
Gleich darauf nahmen sie menschliche Gestalt an, drei Männer in zerschlissenen Plaids, den traditionellen karierten Umhängen der Schotten aus dem Hochland, die mit bloßen Beinen auf stämmigen, kleinen Pferden saßen – eine Bande von Strauchdieben, wenn sie nicht alles täuschte. Sie dachte an Flucht, zögerte aber. Sie ritten schnell, und mit ein bisschen Glück würden sie direkt an ihr vorbeipreschen. Sie warf einen Blick über die Schulter. Vielleicht wäre es doch klüger gewesen zu fliehen. Der Pfad, den sie genommen hatte, war schmal, mit einer steilen Böschung, gefährlich und schlüpfrig, aber ... Wieder sah sie zu den Männern. Nein, es war zu spät, um jetzt noch etwas zu unternehmen. Sie hatten sie fast schon erreicht. Unmerklich schmiegte sie sich ein wenig enger an die Flanke ihrer Stute.
Der Anführer der Schar zügelte sein Pferd und blieb stehen. Seine schlammbespritzten nackten Knie waren auf einer Höhe mit ihren Augen. »Ach was«, sagte er in breitem Schottisch. »Ein elender Tag, um draußen unterwegs zu sein.« Seine dunklen Augen wirkten verschlagen, und als der zweite Reiter neben ihm stehen blieb, warf er seinem Gefährten einen viel sagenden Blick zu. »Aber besser, als wir gedacht hatten, was, Fergus? Ganz schön weit weg von daheim, was, Mädchen?«
»Nicht so weit«, antwortete sie schnell. Unruhig trat sie von einem Fuß auf den anderen, spürte dabei den glitschigen Schlamm unter ihren Füßen – und dass sie sich in mehr als einer Hinsicht auf unsicherem Boden bewegte. Sie wusste, dass sie eine leichte Beute darstellte, und ihr wurde plötzlich bewusst, wie dumm es war, sich in dieser Kleidung sehen zu lassen. Die Spitze an ihrem Kragen war kostbar, und die gute Qualität ihres Kleides war unter dem durchnässten Saum ihres Umhangs deutlich zu erkennen. Sie setzte ihre Kapuze auf, um sich so gut wie möglich zu verhüllen. Sie musste alles einsetzen, was sie an Verstand und Geistesgegenwart besaß, um diese Männer davon zu überzeugen, dass sie nicht allein war.
»Wir haben Jagd auf einen Hirsch gemacht, meine Freunde und ich, aber er ist uns entkommen. Sagen Sie«, fragte sie mit einer Stimme, die so klar und unbefangen war, dass niemand, der sie hörte, vermutet hätte, wie heftig ihr das Herz in der Brust klopfte, »haben Sie vielleicht einen Hirsch gesehen – ein großes, kraftvolles Tier –, bevor Sie die Brücke überquerten?«
»Ein Hirsch, sagen Sie?« Der Highlander schüttelte den Kopf mit dem struppigen Haar und schwang ein Bein über sein Pferd, um abzusteigen.
Das Mädchen verkrampfte sich. Der Mann war Abschaum und schmutziger als jeder andere Mensch, der ihr je begegnet war. Sein Haar war ebenso wie sein Bart eine verfilzte, übel riechende Masse, und seine Augen musterten sie auf eine Art und Weise von oben bis unten, die nahe legte, dass Raub nicht alles war, was ihm vorschwebte.
Sie hob das Kinn. »Nein? Dann warte ich lieber. Meine Freunde werden mich bald einholen. Vielleicht spüren wir noch etwas auf, bevor es dunkel wird. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag.«
Ihre hoffnungsvollen Worte wurden vom Wind verweht. Keiner der Männer rührte sich oder sagte etwas. Einige Augenblicke verstrichen. In ihren Ohren rauschte es. Der zweite Reiter schwang sich vom Pferd. Er hatte flammend rotes Haar und war viel größer als seine Gefährten, ein rothaariger Hüne. Er kam auf sie zu. Der dritte Reiter folgte ihm. Wie ein Rudel Wölfe kreisten die drei sie ein.
Sie verharrte regungslos, aber ihr Atem ging schwer. Ihr Instinkt drängte sie zur Flucht, doch sie saß in der Falle; es gab keinen Ausweg. Der rothaarige Hüne trat einen Schritt näher. Sein Gestank nahm ihr den Atem. Er brummte: »Ha’m Sie vielleicht ’n bisschen Geld für einen Mann, der seit Tagen nichts zu essen gehabt hat?«
Ihr Herz schlug wie ein Gong, und das Wenige, was ihr an Mut geblieben war, löste sich schnell in Luft auf. Geld? Sie würden es ohnehin nehmen, alles, was sie hatte, und vielleicht noch mehr. Sie war wie gelähmt vor Angst. Wo war ihr flinker Verstand, wenn sie ihn am meisten brauchte? »Ich kann Ihnen etwas Geld geben«, antwortete sie und tastete langsam nach dem Gürtel, der sich um ihre Taille schlang. Ihre Finger zitterten, als sie sich um den Lederbeutel schlossen. Es fiel ihr schwer, einen klaren Gedanken zu fassen, einen Ausweg zu finden.
Eine massige Hand schloss sich um ihr Handgelenk und zerquetschte ihr beinahe die Knochen. »Wär keine gute Idee«, warnte der rothaarige Hüne, »nach was anderem als Ihrer Börse zu langen.«
»Und Sie wären schlecht beraten, mir etwas anzutun«, gab sie zurück und maß ihn mit einem strengen Blick. »Meine Freunde haben sehr viel Macht. Sie werden Sie verfolgen und zur Strecke bringen!« Mit einem plötzlichen Ruck riss sie ihren Arm unerwartet hoch, sodass sich der schmerzhafte Griff lockerte und die Münzen aus ihrem Beutel funkelnd auf den matschigen Boden fielen.
Die Männer stürzten sich sofort darauf und krallten ihre Finger fieberhaft um eine Hand voll Gold. Sie wirbelte herum. Das Pferd des großen Mannes war am nächsten. Im Nu war sie dort, griff nach dem Zaumzeug und raffte die Röcke, um aufzusteigen. Sie kostete einige wenige Sekunden von Freiheit aus, genug, um Hoffnung zu schöpfen, bevor sich kräftige Arme um ihre Taille schlangen und ihr Rücken gegen den Mann hinter ihr prallte wie gegen eine Mauer.
Sie warf sich nach vorn und versenkte ihre Zähne in dem Arm, der sie hielt, obwohl sich ihr bei dem gallebitteren Geschmack von Schweiß und Dreck und ungewaschener Haut der Magen umdrehte. Sie biss fester zu, schmeckte Blut. Ein Schmerzensschrei war zu hören, der Griff lockerte sich, aber auch Lachen erklang, und gleich darauf lag sie im Schlamm. Sie schlug und trat vor Wut um sich und kämpfte um etwas, das in ihren Augen kostbarer war als ihr Leben.
Aber sie waren drei gegen eine und hatten bald ihre Hände und Füße eingefangen und hielten sie fest. Ihre Handgelenke brannten, und jeder Muskel tat ihr weh. Überwältigt vor Ekel, lag sie auf den Boden gepresst, in ihren Augen mischten sich Regentropfen und Tränen, ihr dunkles Haar klebte wie Seetang an ihrem Gesicht. Hände zerrten an ihren Röcken, kalte Luft stach ihre Schenkel. Sie schnappte nach Luft, als sie unter einer schweren, gierigen Masse begraben wurde und das Bewusstsein zu verlieren drohte. Ihr wurde schwarz vor Augen, aber immer noch nahm sie durch das Dröhnen in ihrem Kopf verschwommen das Gelächter der Männer wahr.
Plötzlich war sie von dem Gewicht befreit, ebenso von dem schmerzhaften Griff um ihre Handgelenke. Einen Moment lang glaubte sie, dass sie ihr Spiel mit ihr trieben und ihre Qualen verlängern wollten, und sie blieb wie erstarrt liegen, blind, mit angespannten Muskeln. Wenn sie sich rührte, würde der grauenhafte Angriff von neuem beginnen. Dann endlich ertönte wie aus weiter Ferne das schwache, aber unverkennbare Geräusch von Stahl auf Stahl. Es drang langsam in ihr Bewusstsein, wurde laut, eindeutig und real. Sie rollte sich auf die Seite und zog sich die Röcke über ihre bloßen Beine.
Neben ihr lag, der Länge nach ausgestreckt, der dunkelhaarige Mann. Er war tot, und das Blut, das aus einer Wunde am Hals quoll, strömte rasch über den feuchten Boden auf sie zu. Mit einem kleinen Laut des Widerwillens fuhr sie zurück. Als sie ihren Blick auf den Ort des Geschehens richtete, entdeckte sie verspätet ihren Retter. Ein einzelner Mann, dessen Plaid wie ein Wirbel heller Gelbschattierungen durch die Luft wehte, machte ihre Angreifer nieder. Immer wieder fand sein Schwert sein Ziel. Gerade ging der rothaarige Hüne in die Knie.
Sie rappelte sich hoch und schlang ihren Umhang fest um sich. Der Boden schwankte bedenklich unter ihr. Geschunden, erschüttert von dem Kampf und jetzt von dem Schock über so viel Blutvergießen, drohten ihre Beine und ihr Kopf den Dienst zu versagen. Sie holte einige Male tief Luft, um sich zu beruhigen. Sie wusste, dass sie nichts Schlimmeres als ein paar blaue Flecken davongetragen hatte, und dafür schuldete sie diesem Fremden Dank. Sie wischte sich ihre schmutzigen Hände an ihrem ebenso schmutzigen Rock ab und ging zaghaft auf ihn zu.
Als er ihre Schritte hörte, drehte sich der Fremde um. Sein dunkles Gesicht war wild, und sein Atem ging schwer vor Anstrengung. Augen so schwarz wie ein Bergsee hefteten sich mit einem so grimmigen Ausdruck auf sie, dass sie unsicher stehen blieb. Hatte er diese Männer beseitigt, um sich selbst mit ihr zu vergnügen? Er mochte allein sein, doch nach der Leichtigkeit zu urteilen, mit der er sich der anderen drei entledigt hatte, war ihr klar, dass sie gegen ihn nicht mehr Chancen hätte als die drei Männer. Nein, nicht drei, stellte sie fest, als ihr Blick auf die Leichen fiel, nur zwei, einer war entkommen, aber dennoch ... Ihr Retter wirkte so Furcht erregend, dass es ihr die Sprache verschlug.
Der Mann senkte das blutige Schwert, bis seine Spitze den nassen Boden berührte. »Sind Sie verletzt?«, fragte er.
Sie schüttelte den Kopf. Der Regen reinigte seine Klinge bereits, und die Tropfen, die langsam hinunterrannen, färbten die Pfütze zu seinen Füßen rötlich. Sie fand ihre Stimme wieder. »Aber ich wäre es, wenn Sie nicht gewesen wären.« Sie versuchte zu lächeln, doch seine schwarzen Augen fixierten sie immer noch unverwandt, und tief in ihrem Inneren regte sich ein Widerhall der ausgestandenen Angst. Der Gedanke an Flucht wurde wieder in ihr wach, und sie spähte verstohlen zur Brücke.
»Sie sind allein?«
Die Worte schienen dicht an ihr Ohr zu schwingen, melodische Laute, die Stimme eines Highlanders. Sie fuhr herum, aber der Mann hatte sich nicht von der Stelle bewegt. Eine Laune des Windes. Sie fröstelte. Wenn sie nicht so durchnässt wäre, so müde und durchgefroren, würde ihr eher einfallen, was sie tun oder sagen könnte.
»Nun?«
»Ja«, bekannte sie. »Ganz allein, bis ... bis diese Männer kamen.«
Seine schwarzen Augen wurden schmal. »Wo sind Ihre Leute?«
Sie fing an zu zittern, eine Reaktion auf das soeben Erlebte, und verschränkte krampfhaft ihre Hände ineinander. Ihre Leute. Hysterisches Lachen drohte sie zu überwältigen. Sie betrachtete ihren Samariter – wenn er denn einer war. Obwohl er genauso verwahrlost wirkte wie die Männer, die sie überfallen hatten, verriet seine Miene nichts von der Verschlagenheit und Gier, die sie auf den Gesichtern der anderen gesehen hatte, keine Gefühlsregungen außer Zorn und Verdruss, weil sie ihm Unannehmlichkeiten bereitet hatte. Für jemanden in ihrer Situation war das eine ungeheuer befreiende Erkenntnis. Sie spürte einen Funken Hoffnung in sich aufflammen, und das war mehr, als sie seit Tagen erlebt hatte.
Sie hob das Gesicht, sodass ihre Kapuze zurückrutschte und den Blick auf ein sehr junges Gesicht freigab. »Ich habe niemanden bei mir«, gestand sie. »Ich reise nach Norden. Allein.«
»Allein?«, wiederholte der Highlander und trat näher zu ihr. Wasser lief in dünnen Rinnsalen über sein Gesicht und seinen Hals und verschwand unter dem durchnässten Kragen seines Hemdes. Er schien davon ebenso unberührt wie von jedem anderen Missgeschick zu sein. »Bist du nicht ganz bei Trost, Mädchen?«
Ihre Dankbarkeit nahm rasch ab, und sie wich einen Schritt zurück. Er mochte ihr das Leben gerettet haben, doch das gab ihm nicht das Recht, so dreist mit ihr zu reden oder sie gar zu kritisieren. Genau das brauchte sie, um ihr angeschlagenes Selbstbewusstsein wiederherzustellen. Sie richtete sich auf und blinzelte den Regen aus ihren Augen. »Auch wenn ich Ihnen für Ihre Hilfe dankbar bin, Sir, muss ich Sie darauf hinweisen, dass Sie kein Recht haben, meine Handlungsweise zu kritisieren.«
Wieder verengten sich die schwarzen Augen. »So ist es«, gab er zurück und wandte sich zu seinem Pferd um. »Geh nach Hause, Engländerin.«
Plötzliche Panik befiel sie. Sie hatte nicht vergessen, dass dort, wo drei Männer gewesen waren, jetzt zwei tot auf der Erde lagen. Und genauso wenig hatte sie vergessen, dass sie sich verirrt hatte und ihre Stute lahmte. Sie befand sich in einer Situation, die verzweifelte Maßnahmen erforderte. Hastig lief sie ihm nach. »Warten Sie!«, rief sie, während sich ihre Gedanken überschlugen. »Könnten Sie mich nicht ein kleines Stück führen? Ich würde gut dafür bezahlen.«
Der Highlander blieb stehen und drehte sich so abrupt um, dass sie beinahe gegen seine Schulter geprallt wäre. Seine Gesichtszüge waren starr vor Ärger und seine Augenbrauen so dicht zusammengezogen, dass sie eine einzige strenge Linie bildeten. Hatte sie ihn beleidigt? Sie war sich nicht sicher, aber sie durfte sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen. Er war ein Hoffnungsstrahl, der erste, den sie erblickte, seit sie die Grenze passiert hatte. »Wenn es Ihnen nichts ausmacht«, fuhr sie höflicher fort, »würde ich Sie gern als Führer anstellen.«
Er musterte ihre nasse und verschmutzte Erscheinung. »Ich weiß nicht, wer Sie sind«, entgegnete er, während sein Blick von der Kapuze ihres pelzgefütterten Umhangs zu den Spitzen ihrer eleganten und erstklassig gearbeiteten Stiefel wanderte, »und es interessiert mich nicht sonderlich. Was ich getan habe, nämlich diesen Abschaum zu beseitigen, hätte ich für jedes andere Lebewesen, ob Mensch oder Tier, genauso getan. Aber jetzt muss ich gehen. Ich habe etwas zu erledigen, das nicht warten kann.« Er steckte sein Schwert in die Scheide, nahm die Zügel seines Pferdes in eine Hand und schickte sich an aufzusitzen.
Sie zögerte, da sie es hasste, bitten zu müssen, aber Verzweiflung war eine starke Triebfeder. Sie trat näher. »Bitte«, drängte sie. »Einer der Männer ist geflohen, die Pferde sind bis auf meines alle durchgegangen, und meine Stute lahmt. Außerdem habe ich mich verirrt.«
Die Hände des Highlanders verharrten auf den Zügeln. Sie redete sich ein, dass er über ihren Vorschlag nachdachte. Da ihr der Wert ihrer englischen Guineen sehr wohl bewusst war, zeigte sie auf die Stelle, wo sie die Goldmünzen hatte fallen lassen. »Sehen Sie, ich habe Geld, viel Geld! Da drüben! Warten Sie ... ich hebe es auf!«
Sie lief zu der Stelle, wo sie überfallen worden war, und kniete sich auf den Boden. Die Schotten waren arm, das wusste jeder. Das Gold würde ihn in Versuchung führen, sei es auch nur, um sie in die Nähe einer Stadt zu bringen, wo sie einen zugänglicheren Menschen für diese Aufgabe finden könnte. Aber als sie mit den Händen durch den nassen Schlamm fuhr, wurde ihr Eifer schnell zu fassungslosem Entsetzen. »Er hat es mitgenommen«, murmelte sie, »der Mann, der Ihnen entkommen ist. Er muss vor seiner Flucht alles an sich gerafft haben.«
»Dann brauchen Sie ihn nicht zu fürchten«, meinte der Highlander. »Wenn er Ihre Börse hat, hat er bekommen, was er wollte.«
Sie sprang auf. »Aber ich habe mich verlaufen! Mein Pferd lahmt!«
Der Highlander zuckte mit seinen breiten Schultern. »Sie haben Beine, wie ich sehen konnte. Gute, kräftige Beine. Gehen Sie zu Fuß.«
Einen Moment lang lähmten seine Worte sie, genau wie es vermutlich seine Absicht gewesen war. Aber angesichts des Verlustes ihres Geldes war dieser Mann alles, was zwischen ihr und dem Untergang stand. Sie lief zu ihm. »Helfen Sie mir«, bat sie, »und mein Großvater wird Sie belohnen, das schwöre ich.«
Der Highlander ließ die Zügel durch seine Finger gleiten. Er schien zu zögern, unschlüssig zu sein. Es reichte aus, um ihr neue Hoffnung zu geben. Flehend hob sie den Blick zu ihm. »Reisen Sie nach Norden?« Sie hatte das Karo seines Umhangs und die mit Mustern verzierte Schließe erkannt, die er auf einer Schulter trug. Es war an der Zeit, ihre Trumpfkarte auszuspielen. »Sie sind ein MacLeod, nicht wahr?« Er gab keine Antwort, doch sie zögerte nicht hinzuzufügen: »Ich heiße Cate, und ich bin auch eine MacLeod.«
Falls er überrascht war, verbarg er es gut. Er erwiderte nur: »Wo wollen Sie hin, englische MacLeod?«
»Ich bin unterwegs nach Skye.«
»Und können Sie schwimmen? Oder verlassen Sie sich darauf, dass Ihr lahmes Pferd das Schwimmen übernimmt?« Seine Augen wanderten zu der kleinen kastanienbraunen Stute. Er runzelte die Stirn und ging zu ihr. Poppy, die ihren Namen der lebhaften Färbung ihres Fells verdankte, blieb still und unbewegt stehen, als der hoch gewachsene Fremde sich hinkniete und ihr linkes Vorderbein in beide Hände nahm.
Cate war nicht so gelassen. Kaum im Stande, ihre Gereiztheit zu unterdrücken, sah sie zu, wie der Highlander den Knöchel der Stute behutsam abtastete, dann aufstand und eine Pistole mit langem Lauf aus seinem Gürtel zog. »Nein!«, begehrte sie auf. »Was haben Sie vor?« Sie rutschte auf dem glitschigen Boden aus, als sie zu ihm stürzte und sich mit beiden Händen an seinen Arm hängte.
Aber der Highlander wehrte sie ab und hielt seine Pistole hoch. »Seien Sie keine Närrin«, brummte er. »Dieses Tier ist zum letzten Mal gelaufen.«
Tränen strömten über Cates Gesicht. »Sie dürfen ihr nichts tun«, rief sie. »Hören Sie? Tun Sie ihr nichts!«
»Wollen Sie sie lieber den Wölfen überlassen?«
»Aber sie ist mindestens noch zwei Meilen gelaufen, seit das passiert ist!« Cates Griff um seinen Arm lockerte sich. Sie zitterte, bekam kaum Luft, erstickte beinahe an ihren Worten. »Es kann nicht so schlimm sein!«
»Das Bein ist gebrochen.«
»Gebrochen!« Alle Farbe wich aus Cates Gesicht, und sie schüttelte benommen den Kopf. Als sie versuchte, etwas zu sagen, blieben ihr die Worte im Hals stecken. Sie trat einen Schritt zurück und legte beide Hände an ihre Wangen. Er legte die Waffe an. Poppy, die sich keiner Gefahr bewusst war, stand genauso still wie zuvor.
Der Highlander seufzte unmutig wie jemand, der mit seiner Geduld am Ende war. »Wenn es Sie belastet, drehen Sie sich um«, meinte er und zog dann den Abzug seiner Pistole.
Cate blieb kaum Zeit zurückzutreten, bevor ein Schuss durch die Schlucht hallte. Sie taumelte zurück, nur von dem Gedanken beherrscht, sich so weit wie möglich von dieser Szene des Grauens zu entfernen.
Regentropfen vermischten sich mit den Tränen auf ihrem Gesicht, als sie auf unsicheren Beinen zur Brücke hastete und dabei beinahe über den niedergestreckten Körper eines ihrer Angreifer gestolpert wäre. All das hatte sie sich selbst eingebrockt, sich und der armen Poppy, die ihr Leben lang nichts anderes als die friedlichen Koppeln von Bellingham Park gekannt hatte. In ihrer Selbstsucht hatte sie die sanfte Stute unerbittlich durch unbekanntes Gelände getrieben, Tag und Nacht, ihre geduldige Poppy, die nie etwas verweigert hatte, was man von ihr verlangt hatte. Und all das nur, um in diesem schroffen, unzugänglichen Hochland einen gewaltsamen Tod zu finden.
Der Regen nahm zu und fiel in dichten Strömen, die erbarmungslos Cates bloßes Gesicht peitschten. Sie wischte sich mit dem Saum ihres Umhangs die Augen ab und tastete dann nach dem Geländer der Brücke, um ihren Weg über die unsicheren Planken zu finden. Sie hatte die Mitte der Brücke erreicht, als die tiefe Stimme sie innehalten ließ.
»Ich begleite Sie nach Skye«, rief der Highlander MacLeod ihr mit seiner ausdrucksvollen Stimme zu, die mühelos das Tosen der Elemente übertönte, »weil ich selbst dorthin will. Aber jemand, der sein Pferd zu Schanden reitet, hat es verdient, zu Fuß zu gehen. Sie gehen zu Fuß.«
Cate wandte langsam den Kopf. Durch den Schleier von Tränen in ihren Augen sah sie, wie er aufstieg und sich dann von der Brücke abwandte, um die Zügel eines zweiten Pferdes aufzunehmen, das tief im Schatten einer Esche verborgen stand.
Geh mit ihm, sagte sie sich. Es ist das, was du wolltest. Aber ihre Füße waren schwer wie Blei. Ihre frühere Verzweiflung war nach diesem letzten und niederschmetternden Schlag völliger Hoffnungslosigkeit gewichen, und sie konnte sich nicht von der Stelle rühren. Sie lehnte sich an das Geländer und starrte einen Moment lang blicklos in das wilde Wasser unter sich. Ein Kummer wallte in ihr auf, der sie zu überwältigen drohte. Genauso hatte es an dem Tag geregnet, als ihr Vater gestorben war, ein plötzliches Unwetter, das sämtliche Schindeln vom Dach des Taubenschlags gefegt und die Furt bei Cannobie Lee überflutet hatte. Sie schloss die Augen, weil sie sich auf einmal so klein und unbedeutend fühlte wie nie zuvor. Niemals zuvor hatte sie ihre eigene Sterblichkeit so stark empfunden. Was war aus ihrem Kampfgeist geworden? Wo waren ihre Ausdauer, ihre Widerstandsfähigkeit, ihr Wille zum Überleben? Schließlich hob sie den Kopf. Poppys Tod war kaum Grund genug, die Waffen zu strecken und auf einer einsamen Brücke zu sterben. Sie würde mit diesem Mann gehen, der auf dem Weg nach Skye war. Hatte er ihr nicht beigestanden, als sie es am nötigsten gebraucht hatte?
Sie stieß sich vom Geländer ab und kehrte um. Vielleicht wollte er sie für das, was in seinen Augen eine unverzeihliche Nachlässigkeit war, bestrafen, aber sie konnte nicht glauben, dass er seine Drohung, sie zu Fuß gehen zu lassen, wahr machen würde. Nicht bei so grauenhaftem Wetter. Nicht auf so trügerischem Boden. Er hatte ein zweites Pferd; sicher würde er sie aufsteigen lassen.
Aber als Cate näher kam, konnte sie erkennen, welche Last das zweite Pferd bereits trug. Sie blieb wie angewurzelt stehen. Ein zugedecktes Bündel lag quer über dem Sattel, mit einem dicken Tau festgebunden. Es war ein Toter.
Mit einer fast unmerklichen Bewegung seiner Knie trieb der Highlander sein Pferd an. Cate wich zurück und presste sich an das Geländer, als er vorbeiritt, das zweite Pferd mit seiner schaurigen Last mit einem langen Seil an seinem Sattel festgebunden. Der Mann sprach nicht und schaute sie auch nicht an, und Cate wusste, dass er jedes einzelne seiner schroffen Worte ernst gemeint hatte: Er überließ es ihr, sich in seinem Kielwasser durch diese Wildnis aus Nebel und Schlamm zu kämpfen. In diesem Augenblick hasste sie ihn. Sie hasste ihn für das, was er Poppy angetan hatte, sie hasste sein Schweigen und seine Anmaßung und mehr als alles andere hasste sie es, dass sie ihm folgen musste. Gute, kräftige Beine. Cate biss die Zähne zusammen und marschierte los.
Kapitel 2
Wirbelnde Nebelfetzen wehten um die Bergkämme, und das Tal erstrahlte nach dem Regen in sattem Smaragdgrün. Es war eine märchenhafte Szenerie, umrahmt von Farnen und mit wildem Fingerhut durchsetzt, aber Cate war zu erschöpft, um es wahrzunehmen. Nur der Stolz der Highlander, den sie von ihrer Mutter geerbt hatte, erhielt sie aufrecht. Sie kämpfte sich weiter durch nassen Adlerfarn, rutschte auf moosbewachsenen Steinen aus und erklomm einen steilen Hügel nach dem anderen. Sie war dem Land ihrer Vorfahren näher als je zuvor, aber der brennende Schmerz in ihren Füßen war so groß, dass sie ihrer Umgebung kaum einen Blick gönnte, nichts anderes tun konnte, als hinter der stummen, brütenden Gestalt, die voranritt, herzutrotten.
Ihre Augen wanderten zu den breiten Schultern unter dem karierten Umhang. Ein MacLeod-Highlander, genau wie sie, zur Hälfte von ihrem Blut. Er verriet mit keinem Anzeichen, dass ihm ihre Gegenwart noch bewusst war, sondern ritt unermüdlich weiter, indem er sein Pferd mit dem leisesten Druck seiner bloßen Knie lenkte. Es schien ein so geringer Kraftaufwand zu sein, dass ihre eigenen Strapazen umso schwerer zu akzeptieren waren, und es kostete sie angesichts dieser barschen Behandlung einen schweren inneren Kampf, sich in Erinnerung zu rufen, dass sie dem Mann in jeder Hinsicht Dank schuldete.
Wild entschlossen humpelte sie weiter. Die Schatten wurden länger, als der Tag in die Abenddämmerung überging. Wollte er die ganze Nacht hindurch reisen? Cate war fast am Ende ihrer Kräfte. Bald würde sie ihn ansprechen müssen oder sich einfach auf den Boden legen und auf diesem Bett aus feuchten Kiefernadeln und Farn sterben. Als sie eine Felswand erreichten, die von dünnen Rinnsalen klaren Wassers durchzogen war, blieb sie stehen und lehnte sich mit einer Hand an die Felsen. Ihr Kopf sank nach vorn. Sie konnte nicht mehr weiter. Wenn sie ihn jetzt nicht anrief, würde er verschwinden. Sie hob das Kinn. Er hatte sein Pferd gezügelt. Endlich. Ohne ein Wort ließ sie sich auf den Boden sinken.
Jede Sehne, jede Faser ihres Körpers tat weh, ihre Brust war wie zugeschnürt, und ihre Füße brannten. Sie lehnte sich an die Felsen und nahm nur vage wahr, dass ihr Gefährte sich bewegte, etwas aus seiner Satteltasche nahm und die Pferde versorgte. Ein Schatten glitt über sie, und ihre Lider hoben sich. Wortlos nahm sie das Plaid, das er ihr reichte. Er roch nach Pferd und Holzfeuer, aber die gewebte Wolle war dick und wunderbarerweise trockener als sie selbst. Zitternd kuschelte sie sich in die Decke. Der Regen mochte aufgehört haben, doch sie war bis auf die Knochen durchgefroren.
Mit angezogenen Knien betrachtete sie das Tal und fragte sich, wie oft ihre Mutter wohl so dagesessen hatte, die Farben ihres Clans auf den Schultern und mit einem Gefühl von Zugehörigkeit, das ihre Tochter nie gekannt hatte. Und sie wünschte, wie sie es sich fast jeden Tag ihres kurzen Lebens gewünscht hatte, Alanna MacLeod wäre noch am Leben und sie hätte eine Mutter, mit der sie reden und lachen, der sie ihr Herz ausschütten könnte.
Sie biss sich fest auf die Lippen und blinzelte die Tränen zurück, wehrlos vor Erschöpfung. Cate tastete mit einer Hand nach dem Band um ihren Hals und zog Alannas Ring aus ihrem Mieder. Es war ein fein gearbeiteter goldener Reif ohne Stein, aber für Cate kostbarer als alles andere auf der Welt. Es war das Einzige, was sie noch von ihrer Mutter besaß, und würde ohne das Eingreifen dieses Highlanders jetzt vermutlich den Bestien gehören, die sie an der Brücke überfallen hatten.
Sie hob den Kopf und sah zu, wie er den Toten vom Pferd hob. Er sah viel jünger aus, als sie anfänglich vermutet hatte. Älter als sie natürlich, doch das war jeder. Er stand sehr aufrecht und gerade, beinahe bedrohlich, war aber offensichtlich erschöpft, auch wenn er sich große Mühe gab, es sich nicht anmerken zu lassen. Er trug ein Hemd, das an mehreren Stellen zerrissen und verschmutzt war. Durch die Risse sah man einen Verband um seine Mitte, der schmutzig und dunkel von getrocknetem Blut war. Cate fragte sich, wo er gewesen war und was er hinter sich hatte.
Wahrscheinlich hatte es einen Kampf gegeben. Dafür sprachen sowohl die Anwesenheit seines toten Gefährten als auch die Wunde an seinem Bauch, die ihm mit Sicherheit große Schmerzen bereitete. Aber als er das in Decken gehüllte Bündel auf die Erde legte, lag ein Ausdruck auf seinem Gesicht, der jenseits von Schmerz war. Mitleid regte sich in ihr. Sie räusperte sich und fand ihre Stimme wieder. »Darf ich fragen, wer er ist?«
MacLeods schmales Gesicht verriet mit keinem Anzeichen, dass er sie gehört hatte. Allein mit sich und seinem Leid, dachte sie und verstand ihn gut, denn sie hatte selbst erfahren, was Leid bedeutet. Was sie nicht verstehen konnte, war der offenkundige Wunsch des Mannes, sie zu bestrafen.
»Er war mein Bruder«, antwortete MacLeod.
Die knappen Worte ließen Cate hochfahren und aus dem Funken Mitgefühl wurde eine Woge. Jetzt wunderte sie sich nicht mehr über den ungezügelten Zorn und den Mangel an Geduld. Oder das grimmige Gesicht. Auf einmal schienen ihre eigenen Unannehmlichkeiten belanglos zu sein. Sie fragte sich, ob sein Bruder durch die Hand englischer Soldaten gefallen war. Ihr war nur zu gut bekannt, wie sehr Cromwells Handlanger, General Monck, sich darum bemühte, dieses Land im Norden zu verwüsten und zu unterwerfen, indem er all diejenigen niedermachte, die dem toten König die Treue hielten.
Sie begann, die Blätter und kleinen Zweige abzuzupfen, die an ihren Röcken hingen. Zweifellos ging wie üblich ihre Fantasie mit ihr durch. Wahrscheinlich hatte er nie mit einem Engländer die Klingen gekreuzt, wahrscheinlich war sein Bruder von einem Mitglied eines rivalisierenden Clans getötet worden. Derartige Scharmützel waren in den Highlands durchaus üblich, Clan gegen Clan. Zumindest hatte sie das gehört. Ein gewalttätiger Menschenschlag, hatte ihr Cousin oft zu ihr gesagt, und du bist von ihrem Blut, Cate. »Es tut mir Leid«, wisperte sie, »wirklich sehr Leid, dass Sie Ihren Bruder verloren haben.«
Die Hände des Highlanders verharrten auf dem Bündel, das er gerade auspackte. Seine Miene war düsterer denn je, und seine Augenbrauen zogen sich zu der geraden, strengen Linie zusammen, die ihr allmählich vertraut war. »Leid?«, stieß er hervor. »Wie können Sie vorgeben, um einen Mann zu trauern, den Sie nie gekannt haben?«
Es war unvernünftig, sich von dem Zorn eines Fremden verletzt zu fühlen, aber dennoch trafen seine Worte sie. Sie kuschelte sich in das geliehene Plaid und wandte sich ab. Jedes Mal, wenn sie etwas sagte, schien sie seinen Zorn hervorzurufen. Besser, sie hielt den Mund. Besser, sie dachte an ihre hoffnungsvolle Zukunft, an den Clan ihrer Mutter, an ihren Großvater MacLeod. Hamish MacLeod. Sie liebte diesen Namen, seit sie ihn zum ersten Mal gehört hatte. Wie anders er klang, wie unenglisch. Hamish ... Hamish MacLeod, es ging so angenehm über die Zunge, eine köstliche Erinnerung an ihr fremdes Blut. Hamish MacLeod von Creag Mhor Castle. Cate MacLeod von Creag Mhor.
Hamish hatte seine einzige Tochter geliebt – er hatte Alanna so sehr geliebt, dass er erbittert darum gekämpft hatte, ihre Ehe mit dem englischen Adligen, den sie geheiratet hatte, annullieren zu lassen. Ganz sicher würde er Alannas Tochter nicht wegschicken, nicht, wenn sie Gelegenheit gehabt hatte, den Grund für ihre überstürzte und dramatische Flucht zu erklären. Das Blut seines Clans floss in ihren Adern. Ihre Hand schloss sich um Alannas Ring. Wie müde sie war; sie konnte kaum noch die Augen offen halten. Das Blut seines Clans. Bestimmt würde es ausreichen.
Cate erwachte unter einem wolkenlosen Himmel. Mit einem Ruck fuhr sie hoch, bereute die abrupte Bewegung aber sofort. Es schien, als hätten die Strapazen des vergangenen Tages nicht einen einzigen Teil ihres Körpers unversehrt gelassen. Vorsichtig stand sie auf und zuckte zusammen, als ihre bestrumpften Füße ihr Gewicht trugen.
Von dem Highlander war nichts zu sehen, aber da beide Pferde in der Nähe standen und der in Decken gehüllte Bruder immer noch auf der Erde lag, war Cate sicher, dass er sich nicht weit entfernt hatte. Sie hob ihre Stiefel auf und humpelte zu der klaren Quelle, die aus dem Felsgestein sprudelte. In tiefen Zügen trank sie aus ihren zusammengelegten Händen und spritzte kaltes Wasser über ihr Gesicht. Nachdem sie sich mit einem raschen Blick vergewissert hatte, dass sie immer noch allein war, setzte sie sich hin und zog behutsam die Strümpfe von ihren Beinen.
Sie klebten an den offenen Stellen ihrer geschwollenen Füße, und Cate biss sich auf die Lippen, als sie die Seide von der Haut löste. Schließlich hatte sie es geschafft, schwang ihre Füße über die Felsenkante und tauchte sie in das erfrischende, eisige Wasser. Allmählich ging der Schmerz in ihren Füßen in ein taubes Gefühl über, und sie zog ihr Haar über eine Schulter nach vorn und versuchte, die wirren Strähnen zu so etwas wie einer Frisur zu flechten.
Aber als sie MacLeod zurückkommen hörte, sprang sie hastig auf. Er schien sie nicht zu bemerken, sondern kniete sich neben das kleine Feuer, das er entzündet hatte. Schweigend beobachtete Cate, wie er einen Klumpen Hafermehl in ein Stück Metall presste. Sie hatte Angst, ihn zu verärgern, Angst, er könnte sein Angebot, sie zu führen, zurückziehen. Was dann aus ihr werden würde, war ihr klar. Aber der Duft der Haferküchlein war unwiderstehlich, und nach einer Weile ging sie langsam zu ihm. »Was machen Sie da?«, fragte sie.
»Bannocks«, antwortete er, ohne den Kopf zu heben. »Wir essen etwas, dann brechen wir auf. Ziehen Sie Ihre Stiefel an.«
Cate zögerte. Sie befürchtete, wenn sie ihm gestand, in welchem Zustand ihre Füße waren, würde das seine Vermutung nur bestätigen: dass sie in jeder Beziehung ungeeignet war, durch diese Berge zu wandern. Aber es schien keine andere Möglichkeit zu geben. Sie richtete sich kerzengerade auf, die Wangen leicht gerötet vor Verlegenheit, und bekannte: »Ich kann meine Stiefel nicht tragen.«
MacLeod blickte auf. »Nicht?«
»Nein.«
»Warum nicht?«
»Meine Füße sind völlig zerschunden.«
»Lassen Sie mal sehen«, meinte er und sprang auf.
Cate wich hastig einen Schritt zurück. »Das wird nicht nötig sein«, sagte sie. »Ich bin durchaus im Stande, selbst zu beurteilen, ob ich meine Stiefel tragen kann oder nicht.« Aber auf seinem Gesicht lag wieder jener Ausdruck von Zorn und Ungeduld, den es auch gezeigt hatte, als er ihre Stute getötet hatte. Schon wieder ein Ärgernis, das ihn aufhielt. Erst ein lahmes Pferd, jetzt ein lahmes Mädchen. Er gab keine Antwort, doch Cate hatte das bestimmte Gefühl, dass er ihre Füße auf jeden Fall begutachten würde, ob sie nun zustimmte oder nicht, deshalb blieb sie nach einigen Schritten nutzlosen Rückzugs stehen und ließ sich auf die weiche Moosdecke sinken.
»Darf ich zu hoffen wagen«, fragte sie, während sie ihm ihre bloßen Zehen hinhielt, »dass Sie lahmen Frauen eine barmherzigere Behandlung zuteil werden lassen als lahmen Pferden?«
Er antwortete nicht, sondern langte nach ihrem einen Fuß, indem er beide Hände um Ferse und Knöchel legte und ihn hochhob.
Plötzlich hatte Cate nichts mehr zu sagen. Sie betrachtete den dunklen Kopf, der so tief gesenkt war, dass sie MacLeods Gesicht nicht sehen konnte, und spürte die sanfte Berührung seiner Hände. Nie zuvor hatte ein Mann ihre Haut so berührt. Es war überwältigend und verwirrend. Sie riss abrupt ihren Fuß zurück und erkundigte sich atemlos: »Haben Sie gesehen, was Sie wollten?«
Er blickte auf. »Wie lange sind Sie schon unterwegs, Cate MacLeod?«
»Mein Name ist nicht MacLeod«, gab sie zurück und zog ihre Röcke über ihre Zehen. Sie war sich der unangenehmen Tatsache bewusst, dass ihr Benehmen zu wünschen übrig ließ, und warf einen verstohlenen Blick auf sein Gesicht. So ein dunkles Gesicht. Schwarzer Kelte, hätte ihre Tante Harcourt ihn genannt. Er hatte so schwarze Haare wie der Zigeuner, den sie einmal auf der Straße nach Hexham gesehen hatte. Aber dieser Mann war kein Zigeuner. Er war gebaut wie ein Krieger und auch so bewaffnet. Kein Wunder, dass sie sich in seiner Nähe unbehaglich fühlte. Nicht, dass er sie hätte fühlen lassen, wie verletzlich sie als Frau war. Er hatte ihr nicht einen einzigen verschlagenen oder lüsternen Blick geschenkt. Im Gegenteil, er hatte sich benommen, als könnte er ihren Anblick kaum ertragen, hatte sie schlechter als einen Hund behandelt ... bis er ihren Fuß in seine Hände genommen hatte.
Erst jetzt kam ihr der Gedanke, dass sein Verhalten vielleicht bewusst darauf abzielte, ihr das Gefühl zu geben, vor jener Art unwillkommener Aufmerksamkeit gefeit zu sein, vor der er sie vor kurzem bewahrt hatte. Ermutigt von diesem Gedanken, richtete sie erheblich mildere Augen auf sein Gesicht und erklärte mit weit mehr Höflichkeit, als sie ihm gegenüber bisher bewiesen hatte: »Meine Mutter war eine MacLeod. Ich trage den Namen meines Vaters. Denning.« Da sie nur ungern mehr preisgeben wollte, als nötig war, zögerte sie, bevor sie hinzufügte: »Ich bin von Northumberland mit dem Boot bis Loch Linnhe gefahren. In Glen Gour hat man mich abgesetzt.«
Er sah sie scharf an. »Und Sie haben den weiten Weg ganz allein zurückgelegt?«
»Ja.« Ihre Stimme schwankte leicht, als sie sich daran erinnerte, wie heftig er am Vortag auf diese Information reagiert hatte.
Aber jetzt hob er weder die Stimme, noch durchbohrte er sie mit einem vernichtenden Blick. Er fragte nur: »Wovor laufen Sie davon, Cate Denning?«
»Wie kommen Sie darauf, dass ich weglaufe?« Sie wusste, dass sie trotzig klang, aber er war der unerfreulichen Wahrheit zu nahe gekommen. »Es gibt eine ganze Reihe von Gründen, warum ich nach Skye will. Zum Beispiel möchte ich meinen Großvater besuchen.«
»Ach ja, und Ihre Leute lassen Sie allein durchs Land ziehen?«
Sie verstummte. Er wartete auf eine Erklärung, doch sie wollte und konnte sie ihm nicht geben.
Mit einer für einen Mann seiner Größe bemerkenswerten Geschmeidigkeit richtete er sich auf. »Es war dumm von Ihnen, sich die Füße so wund zu laufen. Warum haben Sie nicht schon gestern etwas gesagt? Jetzt wird es Tage dauern, bis Sie wieder Stiefel tragen können.«
Sie sprang auf und starrte ihn an, froh, dass die Befragung offensichtlich vorbei war. »Ach«, meinte sie, »ich bin also dumm?«
»Ja. Und mit Ihrer Dummheit bereiten Sie nicht nur sich selbst, sondern auch anderen Unannehmlichkeiten und Ärger.«
Angesichts der Ungerechtigkeit dieser Beleidigung platzte Cate der Kragen. »Ich habe keinem Menschen Ärger gemacht! Diese ... diese Männer gestern haben Ärger gemacht! Und Sie ... Sie haben freiwillig eingegriffen! Ich habe Sie nicht darum gebeten!« Ihr war heiß vor Zorn und von dem unerklärlichen Verlangen, die Oberhand über seine Arroganz und Anmaßung zu gewinnen. »Was meine Füße angeht«, fuhr sie fort, »was hätten Sie gemacht, wenn ich es Ihnen erzählt hätte? Mich zurückgelassen? Oder mich mit ihm auf den Knien auf das zweite Pferd gesetzt?«
Das Gesicht des Highlanders verdüsterte sich Unheil verkündend. »Halten Sie gefälligst meinen Bruder aus Ihrem albernen Gezänk heraus!«
»Ach ja?«, fuhr sie ihn an. »Und warum, bitte sehr, sollte ich das tun, Mr. MacLeod? Mir scheint, dass Sie die Toten wesentlich besser behandeln als die Lebenden.«
Plötzlich war er vor ihr. Er schien aus jeder Pore seines kraftvollen Körpers Zorn zu verströmen. MacLeod packte sie bei den Armen, so fest, dass er sie auf die Zehenspitzen zog. Cate, die überzeugt war, ihr letztes Stündlein hätte geschlagen, schloss die Augen. Aber plötzlich schleuderte er sie von sich; sie verlor das Gleichgewicht und landete hart auf dem Boden. MacLeod ragte vor ihr auf, so nahe, dass seine Stiefel den Saum ihres Kleids streiften. Cate, die spürte, dass er einen inneren Kampf von ungeheuren Ausmaßen ausfocht, wich zurück. Sein Gesicht war dunkel und bedrohlich vor Wut, und seine Beherrschung hing an einem seidenen Faden. Das Schweigen schien kein Ende zu nehmen, aber schließlich stieß er zwischen den Zähnen hervor: »Hüten Sie Ihre böse Zunge, oder ich lasse Sie zurück. Haben Sie mich verstanden? Wenn Sie noch ein Mal den Mund aufmachen, können Sie allein nach Hause finden. Wenn Sie das schaffen.«
Sie erreichten die Küste bei Glenelg spät am Tag, als der Blick über das Wasser schon halb von der Abenddämmerung verschluckt wurde. MacLeod ließ Cate unter einem einsamen Baum zurück, wo die Schatten sehr schwarz waren und das Wasser nah genug war, dass sie das rhythmische Schlagen der Wellen ans Ufer hören konnte.
Sie ließ sich von seinem großen Pferd gleiten und sank auf den Boden. Warten Sie hier, hatte er gesagt, also wartete sie. Es war ein weiterer langer Reisetag gewesen, und sie war müde und hungrig. Seit den Bannocks am Morgen hatten sie nichts zu sich genommen. Aber sie durfte sich nicht beklagen, denn sie war geritten, während er zu Fuß gegangen war. Den ganzen Tag war er ohne Pause marschiert, mit weit ausholenden Schritten, die eher ein Laufen als ein Gehen waren, und hatte dabei das Pferd seines gefallenen Bruders geführt. Sie betrachtete das Bündel, das einmal sein Bruder gewesen war, leicht beklommen bei dem Gedanken, mit einem Toten allein in der Abenddämmerung zu sein, und doch froh über seine Anwesenheit, denn sie war der Garant dafür, dass MacLeod zurückkommen würde.
Die Dunkelheit nahm zu, und die Temperatur sank. Cate fing an zu frieren. Ihre Arme waren fest um ihre Brust geschlungen, und ihre Augen starrten angestrengt durch die dunkle Nacht in die Richtung, in die MacLeod verschwunden war. Seit ihrer hitzigen Auseinandersetzung am Morgen hatten sie kein Wort mehr miteinander gewechselt. Er hatte sie nichts gefragt, und sie hatte nicht gewagt, auch nur einen Laut von sich zu geben, da sie keine Ahnung hatte, ob er sie tatsächlich in dem Moment, in dem sie den Mund aufmachte, im Stich lassen würde. Den Mund verboten zu bekommen war demütigend, doch angesichts dessen, wie weit sie gekommen war und wie viel auf dem Spiel stand, war es ein Preis, den sie zu zahlen bereit war.
Sie senkte den Kopf, sodass ihr Kinn auf ihren angewinkelten Knien ruhte. Die Erschöpfung forderte ihren Tribut. Sie konnte fühlen, wie ihre Lider schwer und sämtliche Gliedmaßen taub wurden. Das Blätterdach über ihrem Kopf hing schlaff und völlig still herab, und das einzige Geräusch war das rhythmische Klatschen der Wellen. Cate setzte sich aufrechter hin. Sie wollte auf keinen Fall, dass MacLeod sie schlafend vorfand und niemand die Pferde oder den Leichnam seines Bruders bewachte. Wieder wanderte ihr Blick zu dem stillen Bündel, nicht mehr als ein Schatten, der die Umrisse des Pferdes verzerrte. Den weiten Weg nur, damit er für immer in der Erde ruhen durfte, die ihm gehörte.
Sie schlang das geliehene Plaid um sich und wandte ihre Aufmerksamkeit dem Mond zu, der gerade über dem Wasser aufging. Es fiel ihr schwer, wach zu bleiben. Ihr Kopf sank nach vorn. Plötzlich schrak sie hoch. Jemand kam. Mit angehaltenem Atem und gespitzten Ohren starrte sie in die Nacht, bis eine vertraute Silhouette aus der Dunkelheit trat. Cate sprang auf.
Schweigend nahm MacLeod den Leichnam seines Bruders vom Pferd und trug ihn zu dem leise plätschernden Wasser hinunter. Cate folgte ihm. Sie hatte geschlafen, aber wie lange? Der Mond stand hoch am Himmel. Eine Stunde vielleicht.
Ein kleines Ruderboot mit einem Paar Riemen glitt aus der Finsternis. Der junge Ruderer sprang in das knietiefe Wasser und blieb am Dollbord stehen, während MacLeod seinen Bruder sicher in dem flachen Rumpf unterbrachte. Ein kurzer Wortwechsel zwischen den beiden Männern folgte. Cate konnte nichts davon verstehen, aber sie wusste, dass sie die Sprache ihrer Vorfahren hörte, Gälisch. Ihre Mutter hatte es gesprochen, doch Cate konnte sich nur noch an die weichen Laute und die Sprachmelodie erinnern. Sie würde es lernen, gelobte sie, während sie mit beiden Händen ihre Röcke raffte. Sie würde alles lernen, was erforderlich war, um ein MacLeod zu sein.
Sie war so in Gedanken verloren, dass sich ein Paar kräftiger Hände um ihre Taille schloss, noch ehe ihr bewusst wurde, dass ihr Begleiter sie ins Boot heben wollte. Es war ein Akt der Höflichkeit, den sie weder erwartet noch gewünscht hatte. Aber noch während sie überlegte, ob es ratsam wäre, Einwände zu erheben, verloren ihre Füße den Boden unter sich. Ihre Welt geriet ins Trudeln, und das dunkle Gesicht des Highlanders schwebte beunruhigend nah an ihrem. Er hielt inne, um noch ein paar Worte mit dem jungen Ruderer zu wechseln, eine unnötige Verzögerung, wie Cate fand, die sich durch den unbeugsam festen Griff seiner Hände sowohl körperlich als auch seelisch bedrängt fühlte. Dann waren seine Arme plötzlich verschwunden, und sie fand sich auf den harten Holzplanken des Ruderbootes wieder. Mit einem letzten Winken stieß MacLeod das Boot vom Ufer ab und sprang an Bord.
Kapitel 3
In den Bug des Boots geduckt, kroch Cate vor der Kälte in sich zusammen, den Toten am Heck und den stummen Rücken des anderen als einzige Gesellschaft. Inzwischen war sie hellwach und angespannt. Es war eine ruhige Nacht, und das Wasser teilte sich unter den Ruderschlägen wie schwarze Seide. Sie lehnte sich hinaus und beobachtete, wie sich das Mondlicht auf dem schäumenden Kielwasser fing, bevor es in die Dunkelheit entglitt. Es war ein schönes und freundliches Bild; sie trieb durch die Nacht der Insel Skye entgegen, und es schien die selbstverständlichste, unabänderlichste Sache der Welt zu sein. Der breite Schatten unterbrach den stetigen Rhythmus der Riemen, drehte sich zu ihr um und warf ihr eine Ölhaut zu. »Decken Sie sich zu«, befahl MacLeod. »Es kommt Regen auf.«
Cate sah in den glitzernden Himmel hinauf und hielt den Mann für verrückt. Aber noch bevor sie sich entschließen konnte, ihm das zu sagen, waren die Sterne verschwunden, und der Sturm brach mit einem Zischen über sie herein. Sie verkroch sich unter der Ölhaut und sah zu, wie der Mond und die verbliebenen Sterne vollständig verschwanden. Es war ein raues Erwachen, nachdem sie schon geglaubt hatte, alle Hindernisse lägen hinter ihr, ein Kriegsbeil, das ihnen der Himmel zugeworfen hatte.
Das Boot begann in der aufgepeitschten See auf und ab zu schwanken, und Cate fragte sich, wie MacLeod weiterrudern konnte, obwohl ihm der Regen jede Sicht zu nehmen schien. Sie betrachtete die schattenhaften Umrisse seines Körpers, seinen Rücken und seine Arme, die sich in die Riemen stemmten. Sie hätte ihn gern gefragt, wie weit es noch war, ob er wusste, was er tat, und sie hätte sich gern erkundigt, ob die Wellen, die über den Bug schlugen, höher werden würden, je weiter sie sich von der Küste entfernten. Aber wenn sie den Mund aufmachte, würde er sie vielleicht über Bord werfen, und sie musste allein nach Hause finden. Wenn sie das schaffte.
Wasser sammelte sich im flachen Rumpf des Bootes. Es klatschte mit jedem Heben und Senken hin und her. Cate zog die Knie an und raffte ihre Röcke, in der festen Überzeugung, dass sie, nicht sein toter Bruder, ein feuchtes Grab finden würde, falls MacLeod sich dafür entschied, Ballast abzuwerfen. Aber plötzlich beruhigte sich die See, und kurz darauf erschienen Mond und Sterne wieder am Himmel. Cate sah flackernde Lichter vor sich. Sie waren beinahe am Ziel.
Unvermittelt lag die Insel vor ihnen. Die Insel Skye. Creag Mhor. Hamish MacLeod. Es war kaum zu glauben. Barfuß und hinkend suchte sie sich einen Weg über glitschigen Seetang, indem sie ihrem unwilligen Führer folgte. Cate blieb stehen, als er stehen blieb, und ließ sich dann ein kleines Stück von ihm entfernt auf den Boden sinken, rückte nach einer Weile aber näher.
Er hatte sich hingesetzt und den Kopf in die Hände gelegt. Die Haut seiner bloßen Arme und Beine sah im Mondlicht sehr bleich aus. Er schien völlig versunken in seinen Schmerz zu sein und wirkte seltsam verwundbar auf sie, er, dieser unbeugsame Mann, der die Entschlossenheit und die Kraft besessen hatte, seinen toten Bruder bis hierher zu bringen. Ein Aufwallen von Mitgefühl drängte sie, ihn anzusprechen. Cate öffnete den Mund, zögerte dann aber. Sie hatte seine Drohung nicht vergessen. Galt sie immer noch? Aber immerhin waren sie auf Skye angelangt. Schließlich erkundigte sie sich sanft: »Was ist Ihrem Bruder zugestoßen?«
MacLeod sprang auf, als hätte er einen Schlag bekommen, und lief hin und her, verriet mit jeder Faser seines Seins seine innere Erregung, während er die Stille mit dem Scharren seiner Stiefel auf dem steinigen Grund noch unterstrich.
»Bitte«, murmelte Cate, etwas erschrocken über seine heftige Reaktion. »Ich wollte nicht ...«
»Es war Mord.« Er blieb abrupt stehen, und sein Gesicht verriet ihr kurz all seine Qualen, bevor er sich auf dem Absatz umdrehte und davonmarschierte.
Cate war so benommen, dass es einen Moment dauerte, ehe sie aufsprang. »Warten Sie!«, rief sie. »Wo gehen Sie hin?« Aber er war verschwunden, verschluckt von den Schatten der Nacht.
Mord. MacLeod würde dafür sorgen, dass dieser Mord nicht lange ungesühnt blieb, das fühlte Cate. Sie rieb sich die Arme, strich die feinen Härchen auf ihrer Haut glatt. Von allen Menschen, auf deren Gnade und Barmherzigkeit sie angewiesen war, hatte sie ausgerechnet auf einen wilden Highlander stoßen müssen, der halb wahnsinnig vor Kummer und Rachsucht war. Sie ließ sich wieder auf den Boden sinken und stützte ihr Kinn auf beide Hände. Was ihn auch belasten mochte, er war nach wie vor ihr Bindeglied zu Hoffnung und Leben. Aber sie hatte ihr Schweigen gebrochen. Würde er sie jetzt ihrem Schicksal überlassen? Das war ein beängstigender Gedanke. Sie war nun zwar auf Skye, doch kaum in der Lage zu gehen, geschweige denn, sich ohne Nahrung oder Geld auf die Suche nach einem Ort zu machen, von dem sie keine Ahnung hatte, wo er sich befand. Ihre Augen wanderten zum Ufer, wo sich die Umrisse des Bootes auf dem vom Mond beschienenen Wasser abzeichneten. Er würde zurückkommen. Wegen seines ermordeten Bruders würde er zurückkommen, nicht ihretwegen.
Sie hatte nicht einschlafen wollen und fuhr jetzt abrupt hoch. Die Morgendämmerung war längst angebrochen, und sie war allein. Ohne die Schmerzen in ihren Füßen zu beachten, sprang sie auf und rannte zum Boot, kletterte über Felsen und watete durch das leicht gekräuselte seichte Wasser. Wenn er fort war, musste sie versuchen, ein Dorf zu finden. In der vergangenen Nacht hatte sie Lichter an der Küste gesehen, doch sie war müde gewesen und hatte durch das Unwetter jedes Orientierungsgefühl verloren und weder die Entfernung noch die Richtung abschätzen können. Außerdem war sie sich nicht sicher, ob die Bewohner der Insel bereit sein würden, einem verschmutzten, barfüßigen Mädchen zu helfen. Echte Panik befiel sie, als sie das Boot erreichte. Sie hielt es mit einer Hand fest und spähte hinein.
Das verhüllte Bündel war noch da. Sie atmete erleichtert auf. Er würde zurückkommen. Sie machte kehrt. Das Wasser reichte ihr fast bis zu den Knien, und ihre Röcke, an die sie in ihrer panischen Hast nicht gedacht hatte, trieben wie Blütenblätter auf den Wellen. Plötzlich sah sie ihn. Er saß auf einem Pferd und führte zwei weitere mit sich.
Als sie bei ihm anlangte, war er bereits abgestiegen und zog ein in Tuch eingeschlagenes Päckchen aus seiner Satteltasche. Er wickelte einen Laib derbes Brot aus und reichte ihr die Hälfte. »Essen Sie das«, sagte er. »Dann brechen wir auf.«
Cate sank auf den Boden. Sie war ausgehungert und aß gierig, während MacLeod sich daranmachte, zum Boot hinauszuwaten und seinen Bruder zu holen. Schweigend sah sie zu, wie er den verhüllten Leichnam auf den Rücken eines der Pferde band. Als er fertig war, winkte er ihr ungeduldig zu. »Beeilen Sie sich. Vor uns liegt ein langer Ritt.«
Sie musterte sein dunkles, unnachgiebiges Gesicht. Ein langer Ritt. Woher wusste er, wie lange sie reiten mussten, wenn sie ihm noch nicht einmal gesagt hatte, wo sie hinwollte? Der Gedanke wirkte ernüchternd und reichte aus, neue Zweifel und Ängste zu säen. Ein langer Ritt wohin? Zu seiner eigenen abgeschiedenen Burg? Cate, die ihr ganzes Leben im Grenzgebiet verbracht hatte, kannte nur zu gut die Neigung der Schotten, Geiseln zu nehmen und Lösegeld zu fordern. Das hier war kein Grenzgebiet. Skye war viele Tagereisen von England entfernt. Und dennoch ...
Ihre beschmutzte Kleidung war unverkennbar von guter Qualität. Er wusste, dass sie Gold bei sich gehabt hatte. Glaubte er, auf Kosten ihrer Freiheit ein fettes Lösegeld zu erzielen? War sein Widerwille, sie mitzunehmen, ein raffiniertes Täuschungsmanöver gewesen? Ein Widerwille, der so glaubwürdig wirkte, dass sie Angst gehabt hatte, er könnte sie allein lassen, so große Angst, dass sie nicht einmal gegen seine demütigende Forderung, den Mund zu halten, aufbegehrt hatte. Einem Fremden, der sofort bereit gewesen wäre, ihr zu helfen, hätte sie vielleicht nicht vertraut.
Aber jetzt würde sie sich nicht länger den Mund verbieten lassen. »Das Heim meines Großvaters ist Castle Creag Mhor«, sagte sie, als er ihr beim Aufsteigen half. »Kennen Sie es?«
»Ja«, antwortete MacLeod. »Ich kenne es.« Er bückte sich, um den Steigbügel ihres Pferdes straffer zu ziehen.
Er warf keinen Blick zurück, als er losritt. Cate folgte ihm, aber die Saat des Zweifels war gesät, und wilde Fluchtgedanken formten sich in ihrem Kopf. Sie war zu Pferde, sie hatte die Überquerung des Wassers hinter sich und war nicht mehr allzu sehr auf ihn angewiesen, um zu überleben.
Er ritt ein kleines Stück voraus, die Morgensonne direkt auf seinem Rücken. Es war ein verlockender Gedanke, die Zügel herumzureißen und auf ihrem geliehenen Pferd zu fliehen. Als sie langsamer wurden, um einen kleinen Bach zu durchqueren, ließ sie sich ein Stück zurückfallen, aber er drehte sich im Sattel um. »Trödeln Sie nicht«, befahl er knapp. »Wir haben noch viele Meilen vor uns.«
Die Meilen waren lang und der Pfad, der sich um die Ausläufer der hohen Berge im Westen zog, unwegsam. Minuten wurden zu Stunden. Ein Mal machten sie Halt, um Wasser zu trinken, aber zu essen gab es nichts mehr. Benommen vor Erschöpfung sackte Cate im Sattel in sich zusammen. Es fiel ihr zunehmend schwer, ihr einstiges Gespür für gefährliche Situationen wiederzufinden. Die tagelange Reise forderte ihren Tribut. Ihr war schwindlig, und alles ringsum verschwamm vor ihren Augen. Alles, was sie ersehnte, war das Ende dieser Reise, ein Bett, ein Haufen Stroh, ein Fleckchen Heidekraut, irgendetwas, auf das sie sich betten und eine Woche lang schlafen konnte. Ihre Stute trottete weiter und bahnte sich mit ihren Hufen einen Pfad durch das Gelände. Wenn sie die Hand ausstreckte, konnte sie beinahe den Farn und das Gras berühren.
»Wollen Sie diese Woche noch zu Ihrem Großvater oder erst nächste?«
Sie setzte sich abrupt auf. Er sah sie mit strengem Gesicht scharf an. Sie schluckte, befeuchtete ihre trockenen Lippen mit der Zunge und erwiderte: »Diese Woche wäre mir lieber.«
»Dann legen Sie an Tempo zu, oder suchen Sie sich den Weg allein. Ich werde nicht noch einmal stehen bleiben.«
Seine ungeduldigen Worte brachten sie zur Besinnung, und sie blieb ihm dicht auf den Fersen. Fast kümmerte es sie nicht mehr, wohin er sie brachte, wenn sie bloß einen Monat lang nicht mehr reiten musste oder ein Jahr oder, besser noch, nie wieder. Endlich, als sie fast schon zu müde zum Denken war, hielt MacLeod an und zeigte mit dem Finger irgendwohin. Sie folgte der Richtung, konnte aber außer ein paar gedrungenen Dornenbüschen und kahlen Bergrücken nichts entdecken. »Eine halbe Meile nach Westen, dann finden Sie, was Sie suchen.«
Seine Worte verscheuchten jede Spur von Müdigkeit. Beunruhigt setzte sie sich auf. »Wir haben Creag Mhor erreicht?«
»Ich glaube kaum, dass Sie es von hier verfehlen können.«
Er hatte sie nach Hause gebracht. Ihre Ängste, hervorgerufen durch seine Verschlossenheit, seine schroffe, überhebliche und abweisende Art, waren völlig unbegründet gewesen. Von tiefer Dankbarkeit erfüllt, entgegnete sie: »Ich bin sicher, mein Großvater wird Sie dafür belohnen, dass Sie mich hergebracht haben.« Aber die Worte waren kaum von ihren Lippen, als ihr auffiel, dass er sich entfernte.
Sie lenkte ihre Stute in seine Richtung. »Warten Sie! Was ist mit dem Pferd hier? Wem gehört es?«
Aber MacLeod verriet durch nichts, dass er sie gehört hatte. Einen Moment lang beobachtete Cate, wie er sich immer weiter entfernte, der verhüllte Leichnam seines Bruders ein stummer Schatten. Dann wandte sie sich nach Westen. Nur noch eine halbe Meile. Sie war allein und frei, und Creag Mhor war in Reichweite. Sie trieb die Stute an.
Kapitel 4
Castle Creag Mhor lag auf einer Landzunge, die weit in die See hinausragte, ein großes, schmuckloses Gebäude, das sich ganz und gar in seine raue, zerklüftete Umgebung einfügte. Die Steine waren grau, die umliegenden Berggipfel kahl, und hinter allem schlug der Atlantik tosend an die steilen Felsklippen. Als Cate näher kam, konnte sie durch die violetten Schatten der Dämmerung erkennen, dass die Burg beinahe die ganze Landzunge einnahm. Die Außenmauern wurden von einem großen Turm beherrscht, der sich kantig und ohne jede Verzierung majestätisch und eindrucksvoll in der Mitte des Baus erhob.
Das Fallgitter war hochgezogen, und sie betrat einen gewölbten Gang, der von Kienspanfackeln erhellt wurde. Es war der Augenblick, von dem sie seit langem geträumt hatte, in den sie sich geflüchtet hatte, wenn alles andere sie im Stich zu lassen schien. Hier war Alanna zur Welt gekommen, war über diesen Boden gelaufen, hatte diese Luft geatmet. Es war der Ort, an den Alannas Geist zurückkehren würde, davon war sie überzeugt.