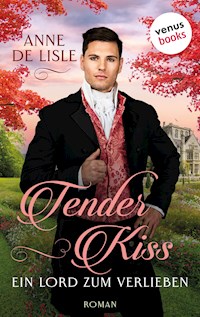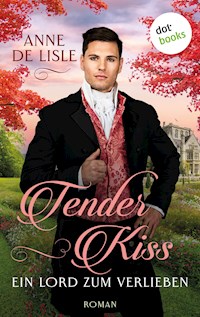Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: venusbooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wenn Liebe zwischen Feinden erblüht: Der Highland-Roman »In den Händen des Schotten« von Anne de Lisle jetzt als eBook bei venusbooks. Sie ist seine Gefangene ... wird er sie ausliefern? Im Jahre 1746 ist der Konflikt zwischen den Jakobitern und den Anhängern der englischen Krone auf seinem Höhepunkt. Die junge Freiheitskämpferin Isabeau MacPherson wird beim Überbringen einer geheimen Botschaft von einer Gruppe feindlicher Soldaten überwältigt. Nun droht ihr der Tod – doch der Anführer Alistair Campbell, ein Schotte wie sie, bringt es nicht über sich. Auf der gefährlichen Reise zu seiner Burg, wo er Isabeau verstecken will, kommen sie sich immer näher. Und obwohl sie sich nicht sicher ist, ob Alistair ihr Vertrauen verdient, kann Isabeau ihre Gefühle für den schneidigen Krieger schon bald nicht mehr leugnen. Aber was, wenn Alistairs Verbündete erfahren, wer die neue Frau in seinem Leben wirklich ist? Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der historische Liebesroman »In den Händen des Schotten« von Anne de Lisle für alle Fans von »Outlander«. Lesen ist sexy: venusbooks – der erotische eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 469
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Sie ist seine Gefangene ... wird er sie ausliefern? Im Jahre 1746 ist der Konflikt zwischen den Jakobitern und den Anhängern der englischen Krone auf seinem Höhepunkt. Die junge Freiheitskämpferin Isabeau MacPherson wird beim Überbringen einer geheimen Botschaft von einer Gruppe feindlicher Soldaten überwältigt. Nun droht ihr der Tod – doch der Anführer Alistair Campbell, ein Schotte wie sie, bringt es nicht über sich. Auf der gefährlichen Reise zu seiner Burg, wo er Isabeau verstecken will, kommen sie sich immer näher. Und obwohl sie sich nicht sicher ist, ob Alistair ihr Vertrauen verdient, kann Isabeau ihre Gefühle für den schneidigen Krieger schon bald nicht mehr leugnen. Aber was, wenn Alistairs Verbündete erfahren, wer die neue Frau in seinem Leben wirklich ist?
Über die Autorin:
Anne de Lisle lebt mit ihrem Ehemann in einem angeblichen »Geisterhaus« in Maryborough. Ihre Romane sind international erfolgreich.
Anne de Lisle veröffentlichte bei venusbooks bereits »Tender Kiss – Ein Lord zum Verlieben«, »Das Herz des Lairds« und »Die Leidenschaft des Lairds«.
***
eBook-Neuausgabe Dezember 2022
Ein eBook des venusbooks Verlags. venusbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, München.
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 1998 unter dem Originaltitel »Isabeau« bei Bantam Australia. Die deutsche Erstausgabe erschien 2000 unter dem Titel »In Leidenschaft verglüht mein Herz« bei Lübbe
Copyright © der englischen Originalausgabe 1998 by Anne De Lisle
Published by arrangement with Dell Publishing, a division of Bantam Doubleday Dell Publishing Group, Inc.
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2000 by Bastei-Verlag Gustav H. Lübbe GmbH & Co., Bergisch Gladbach
Copyright © der Neuausgabe 2022 venusbooks Verlag. venusbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, München.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © Period Images sowie © shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ae)
ISBN 978-3-96898-225-0
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des venusbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »In den Händen des Schotten« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.venusbooks.de
www.facebook.com/venusbooks
www.instagram.com/venusbooks
Anne de Lisle
In den Händen des Schotten
Roman
Aus dem Englischen von Bettina Albrod
venusbooks
Für Mary und Norman
Historische Anmerkungen
August, 1745
Bonnie Prince Charlies Einfall an der Westküste Schottlands war der Beginn seines vergeblichen Versuches, den Thron für seinen Vater James Edward und das Haus Stuart zurückzuerobern.
Loyale Unterstützer seiner Sache sammelten sich um ihn, und zunächst hatte es den Anschein, daß diese Jakobiter (nach Jakobus benannt, der lateinischen Namensform von James) Erfolg haben könnten. Nachdem sie Edinborough praktisch ohne Widerstand eingenommen hatten, marschierten sie nach Süden, wo sie die Truppen des gegnerischen Königs Georg aus dem Hause Hannover in erstaunlichen fünfzehn Minuten bei Prestonpans besiegten. Dann rückten sie weiter nach Süden bis nach Derby vor, das nicht weit von London entfernt lag.
Der Einfall der Jakobiter in England weckte endlich die Aufmerksamkeit der Hannoveraner. Zum ersten Mal ging ihnen auf, daß die Jakobiter nicht nur ›eine Horde nacktärschiger Banditen‹ waren, sondern eine erschreckend erfolgreiche und gut organisierte Armee. König George nahm die Bedrohung endlich ernst, rief seinen kriegshetzerischen Sohn aus Flandern, und mit einer überwältigenden Armee brach der Herzog von Cumberland Richtung Norden auf.
Entgegen der gängigen Auffassung unterstützte die Mehrheit der Schotten die Regierung und kämpfte auf seiten von König George. Sie waren nur zu bereit, sich Cumberland bei dem Versuch anzuschließen, die Jakobiter zu überwältigen. Der Krieg ließ Schotte gegen Schotte stehen, teilte Familien und entzweite Clans. Das Ende kam im April 1746 in Culloden Moor, wo der Herzog von Cumberland einen so vernichtenden Sieg über die Jakobiter-Armee errang, daß es das Leben im Hochland für immer veränderte.
Kapitel 1
Schottland, April 1746
Die Nacht war still und friedlich, und der Mond stand voll und hell über den aufgetürmten Massen des Cairngorms – die denkbar schlechtesten Voraussetzungen für eine Flucht. Zum Glück entdeckte Isabeau den Schein eines Lagerfeuers zwischen den Bäumen, lange bevor jemand sie hätte hören können, und so stieg sie von der Stute und führte sie am Zügel weiter.
Es lag Schnee, nicht viel, aber genug, um ihre Schritte zu dämpfen, und Isabeau hatte vor, ihr Pferd in weitem Bogen um die Männer herumzuführen. Doch als sie näher kam, verengte sich der Paß plötzlich. Isabeau zögerte, hob die Hand und streichelte dem Pferd beruhigend über den Kopf. Wenn sie weiterging, mußte sie ein ganzes Stück näher an den Männern vorbei, als ihr lieb war – das machte ihr angst, denn sie wußte nicht, ob es sich bei ihnen um Freund oder Feind handelte.
Doch dann dachte sie an Robbie und schämte sich ihrer Furcht. Wieder schlich sie leise vorwärts, aber das Pferd war unruhig und nervös, und als sie sich den Männern näherten, warf das Tier den Kopf hoch und stampfte so laut mit den Hufen in den Schnee, daß sie überzeugt war, gehört worden zu sein. Als das Gespräch abrupt verstummte, wurden ihre Befürchtungen bestätigt. Isabeau erstarrte, unschlüssig, ob sie abwarten sollte und hoffen, daß sie das Geräusch für ein wildes Tier hielten, oder ob sie in der Hoffnung fliehen sollte, daß sie sie nicht einholen würden.
Dann hörte sie wieder Stimmen, aber Isabeau ließ sich nicht täuschen. Und tatsächlich löste sich einer aus der Gruppe, ein großer schwarzer Schatten, der mit der Dunkelheit der Bäume verschmolz, rasch gefolgt von einem zweiten.
Isabeau verfluchte ihre Unentschlossenheit, schwang sich in den Sattel und grub dem Pferd die Hacken in die Flanken, wobei sie sich weit vorbeugte, als das Tier losrannte. Doch die Bäume standen zu dicht und behinderten ihre Flucht, und plötzlich brach ringsum Aufruhr los. Isabeau zog an den Zügeln, weil sie umkehren wollte, aber wohin sie sich auch wandte, immer versperrte eine Gestalt ihr den Weg. Sie fuhr herum, suchte verzweifelt nach einer Stelle zum Entkommen und stieß der Stute die Hacken in die Flanken, als sie eine Möglichkeit zu erkennen glaubte.
Doch ein weiterer Mann trat aus den Schatten und fiel ihr in die Zügel. Isabeau trat zu und spürte, wie ihr Stiefel etwas traf – seinen Kopf, wie sie hoffte. – Der Griff um die Zügel lockerte sich, und wieder trieb sie das zitternde Tier an. Einen Moment dachte sie, sie käme frei, aber dann packte eine Hand sie an der Jacke. Isabeau fiel zur Seite, und der Boden schien auf sie zuzurasen.
Isabeau lag auf dem Rücken auf dem gefrorenen Boden und rang nach Luft. Ein dunkler Schatten im Kilt ragte über ihr auf – ein Schotte also –, und dann blieb ihr Blick an der blitzenden Klinge in seiner Hand hängen. Sie mußte sich bewegen, sonst war alles vorbei.
Isabeau rollte sich auf die Seite und stützte sich auf Hände und Knie, aber ehe sie aufspringen konnte, wurde ihr Arm mit eisenhartem Griff umklammert, und sie wurde zurückgerissen. Isabeau griff nach dem Dolch in ihrem Gürtel, zog ihn und wandte sich zu dem Mann um, der sie jetzt zu sich zerrte. Doch der Mond erleuchtete hell den Schnee, ihr Angreifer sah die Waffe und wich aus, als sie nach ihm stieß, wobei er ihr Handgelenk hart umklammerte. »Laß ihn fallen!« kommandierte er. »Laß ihn sofort fallen!«
Isabeau hatte Angst, er würde ihr den Arm brechen, so fest war sein Griff, aber sie ließ die Waffe nicht los. Statt dessen trat sie nach ihm und wurde mit einem Schmerzenslaut belohnt, als ihr Stiefel sein Schienbein traf. Dann zog er sie mit sich zum Stamm einer Kiefer und preßte ihre Hände hart dagegen.
Mit einem Aufschrei ließ Isabeau ihren Dolch in den Schnee fallen und wartete darauf, daß er ihr den Rest gab.
»Hast du ihn, Alistair?« rief eine Stimme aus den Schatten.
»Aye«, keuchte der Mann, der sie festhielt. »Es ist nur ein Junge, der versucht hat, mir mit seinem Dolch Angst zu machen.« Er warf ihr in der Dunkelheit einen scharfen Blick zu.
»Was suchst du zu so einer Stunde hier draußen, Junge? Wo wolltest du hin?«
Isabeau schwieg. Sie konnte nicht viel von dem Mann erkennen, nur seinen dunklen Umriß, der das Mondlicht verdeckte. Sie stand ganz still. Es hatte wenig Sinn, weiterzukämpfen, zumal er ihr Handgelenk immer noch in eisenhartem Griff hielt und ihre Hand von dem Treffen mit dem Baum schmerzte. Wenigstens hielt man sie für einen Jungen – das war etwas, wofür sie dankbar sein konnte.
Eine weitere Gestalt tauchte neben ihrem Häscher auf, ein älterer Mann, der ein wenig gebeugt ging.
»Rumschnüffeln, das ist es, was er getan hat.«
Weitere Gestalten sammelten sich um sie.
Ohne sie loszulassen, bückte sich der Mann, der sie überwältigt hatte, nach ihrem Dolch und steckte ihn hinter seinen Gürtel. »Jetzt will ich mir dich einmal anschauen«, verkündete er dann und begann, sie in Richtung Feuer zu zerren.
Im Mondlicht erhielt der große Schatten Gestalt. Isabeau erkannte auf den ersten Blick, daß er ein Campbell war, die vertrauten bunten Farben seines Kilts waren im Feuerschein deutlich zu erkennen. Sie erkannte auch, daß nicht nur die Dunkelheit ihn so groß hatte wirken lassen. Er stand nahe bei ihr und überragte sie so sehr, daß sie den Verdacht bekam, daß er sie absichtlich mit seiner Größe einschüchtern wollte.
Isabeau zwang sich, ihrem Gegner ins Gesicht zu sehen. Es war schmal, dunkel und grimmig, um so mehr, als sein Blick aus blitzenden dunklen Augen und die wilde Mähne schwarzer Locken seine Ungezähmtheit betonten. Er sah wild und gefährlich aus, und Isabeau mußte sich beherrschen, um nicht vor ihm zurückzuweichen. Als sie sich umdrehte und die anderen Männer ansah, die vorsichtig näher traten, ergriff Alistair Campbell die Gelegenheit, um sie sich näher anzusehen.
Der schlanke blonde Junge in Reithose und Jacke sah verfroren, hungrig und ängstlich aus. Um so besser für ihre Aufgabe. »Wie heißt du, Junge?« wollte Alistair wissen. Schweigen. »Wenn du uns deinen Namen nicht sagen willst, dann kannst du uns vielleicht erklären, warum du zu dieser Stunde um unser Lager herumschleichst?«
In dem darauf folgenden Schweigen konnte Alistair nur schlecht seine Ungeduld verbergen. Als er keine Antwort bekam, befahl er: »Durchsuche ihn, Patrick, und sieh, was du finden kannst.«
Als ein alter Mann vortrat und Isabeaus Taschen zu durchsuchen begann, begann sie erneut zu kämpfen. Doch ihr Gegner hielt ihr die Arme auf dem Rücken fest, so daß Patrick, solange er ihren Tritten auswich, in der Lage war, eine Reihe von Dingen aus ihren Jackentaschen zu holen – ein Medaillon an einer Silberkette, zwei glatte, flache Steine, die Schultemadel eines Hochländer-Plaids, die bei genauerer Inspektion die Zeichen des Macpherson-Clans zeigte, ein zerdrücktes Taschentuch und zuletzt und am interessantesten ein gefaltetes Stück Papier.
Dieser Zettel wurde an einen anderen weitergereicht, denn Patrick Macphee konnte nicht lesen, so daß es Ian Campbell war, der sich neben das Feuer kniete, das Papier so hielt, daß Licht darauf fiel, und die ersten Zeilen des schicksalsschweren Briefes las.
Als er fertig war, sah er seinen Bruder an und sagte: »Lies das besser Alistair, denn ich habe noch nie etwas so Verräterisches gesehen!«
Alistair hatte immer noch alle Hände voll mit seinem Gefangenen zu tun. Er wandte sich erneut an Patrick. »Such etwas, womit wir ihn fesseln können.« Der alte Mann zog ein Stück Schnur hervor, und Alistair drehte Isabeau schnell herum und band ihr die Handgelenke auf dem Rücken zusammen. Dann übergab er sie in Patricks Obhut, kniete sich neben das Feuer, nahm Ian das Dokument ab und begann zu lesen:
Es ist meine Überzeugung, daß sich der Herzog aus strategischen Gründen dazu entschlossen hat, sich in Aberdeen Zeit zu lassen. Er wartet in der Hoffnung, daß wir uns bei dieser und anderen Sachen erschöpfen. Ich werde mich darum bemühen, die Mittel zu erlangen, um ihm nahe zu kommen, und sobald ich in Aberdeen bin, werde ich die Tat ausführen, und zwar ohne Bedauern, denn ich glaube, daß sie die Moral seiner Männer signifikant senken wird, so daß sich der Ausgang des Kampfes sicher wandelt.
Als Alistair zu Ende gelesen hatte, faltete er den Brief zusammen und erhob sich mit aschfahlem Gesicht. Die Worte, die er gerade gelesen hatte, und ihre offensichtliche Bedeutung schockierten ihn zutiefst, denn die Absicht des Schreibers war eindeutig – er wollte ein Attentat auf den Herzog von Cumberland begehen, den Sohn des Königs, einen Mord und Akt des Hochverrates.
Mit seiner Stimme, die von einer Gefaßtheit zeugte, von der er weit entfernt war, sagte er: »Wir müssen dafür sorgen, daß Cumberlands Leute in Aberdeen das bekommen. Donald, du bringst es im Morgengrauen hin.«
Dann schwang er plötzlich zu Isabeau herum. Sein Blick wurde hart, als er auf sie zutrat und ihren Dolch hervorzog. »Und jetzt will ich wissen, wer dieses schurkische Stück Papier geschrieben hat.«
Isabeau stand schweigend vor ihm, als er bedrohlich auf sie zutrat. »Warst du es?«
Isabeau zuckte ein wenig zusammen, als er die Frage hervorstieß, aber sie schwieg. Alistair hob den Dolch, so daß die Spitze ihr Kinn berührte. »Du bist gut beraten, es mir jetzt zu sagen, Junge, denn am Ende wirst du es mir ohnehin verraten.«
»Das werde ich nicht!« schrie sie plötzlich auf, »und ihr könnt zum Teufel gehen, die ganze Verräterbande von euch …«
Ihre Stimme ließ ihn innehalten. Der Junge war jünger, als er gedacht hatte. Aber jetzt war nicht die Zeit für Gefühlsduselei. Er mochte ja jung sein, aber er war alt genug, um seine Wahl getroffen zu haben. Alistair trat näher, so daß die Spitze des Dolches jetzt den Hals des Jungen berührte. In der kleinen Vertiefung am Grund der Kehle konnte er den wild flatternden Puls sehen, aber er preßte ungerührt den Dolch in die weiche Haut unter dem Kinn und sagte: »Ich werde es erfahren, Junge.«
Eine dünne Blutspur erschien auf der weißen Haut. Alistair fiel auf, daß der Junge den Schmerz bemerkenswert gut ertrug. Auch wenn er die Lippen zusammenpreßte und die Augen geschlossen hielt, gab er keinen Laut von sich. Es sah auch nicht so aus, als wenn er reden wollte.
»Oder bist du nur ein Bote? Wenn ja, für wen war die Nachricht bestimmt?«
In dem darauf folgenden Schweigen war sich Isabeau bewußt, daß sich Schweiß auf ihrer Haut bildete und in ihrem Magen das vertraute Gefühl von Übelkeit wuchs, das sie so verachtete, denn es zeugte von ihrer beklagenswerten Feigheit. Aber der große Mann, ein Campbell, ragte so bedrohlich vor ihr auf, und sie wußte genau, daß dieser Clan zu allem fähig war. Der Druck seines Dolches ließ ein wenig nach, aber ihre Kehle schmerzte noch immer, und sie spürte die Wärme des Blutes, das über ihre kalte Haut rann. Sie dachte schon, sie würde in Tränen ausbrechen, und kniff die Augen noch fester zusammen. Robbie, flehte sie innerlich, bitte gib mir die Kraft, mich ihnen zu widersetzen.
»Dieser Brief ist Beweis genug, um dich des Verrats zu überführen«, bellte er, »egal, wie jung du bist. Weißt du, was sie mit Verrätern machen, Junge?«
Isabeau spürte die Spitze des Dolches jetzt an ihrem Puls, und ein weiterer Blutstropfen machte sich auf den Weg den Hals hinunter. Sie hob den Blick zu dem dunklen Gesicht ihres Folterers. »Aye, das weiß ich nur zu gut, aber ich werde mit reinem Gewissen sterben, du Mörder …« Jetzt liefen ihr Tränen über das Gesicht, und beschämt wandte sie den Kopf ab.
Ian Campbell trat einen Schritt näher. »Bring es zu Ende, Alistair. Wir haben immerhin die Nachricht, und sie wird niemanden weiter erreichen. Töte ihn.«
Alistair zögerte. Der Junge sah ihn wieder an, diesmal trotzig, fast, als wollte er ihn herausfordern. Er war nur einer von vielen, einer von vielen Jakobitem, denen er in diesem entsetzlichen Kampf schon das Leben genommen hatte, also warum sollte er dann zögern, auch noch diesen umzubringen? Er war noch so jung, vielleicht war es das, oder vielleicht hatte er einfach auch genug von dem vielen Töten.
Er ließ den Dolch sinken. »Nein«, sagte er schließlich. »Wir bringen ihn nach Aberdeen und lassen dort entscheiden, wie man einen Attentäter behandelt.« Er sah Patrick an. »Binde ihn irgendwo dran, ganz fest. Falls er entkommt, mache ich dich dafür verantwortlich.«
Isabeaus Beine zitterten so stark, daß sie keinerlei Widerstand leistete, als die Hände sie zu Boden stießen. Mit gesenktem Kopf sank sie zu Boden, während der alte Mann ihr ein Seil um die Handgelenke schlang und es an einem Baum befestigte. Anscheinend fürchtete er den Zorn seines Anführers, denn er zog das Seil so fest an, daß es weh tat, und wickelte es anschließend noch ein paarmal um sie herum. Ihre gefesselten Hände wurden ihr auf den Rücken gebunden und dann an den Baum; eine höchst unbequeme Art, die nächsten Stunden zu verbringen, aber was spielte das schon für eine Rolle?
Tatsächlich wünschte sie, die Sache wäre durch einen Stoß mit dem scharfen Dolch schnell vorbei gewesen. Jetzt dagegen mußte sie sich dem stellen, was die Männer mit ihr vorhatten, wenn sie am Morgen erkannten, daß sie eine Frau war, und das würden sie ganz bestimmt. Zwar verbarg Robbies Jacke ihre Formen, und ihr Haar war geschnitten und nach Art eines Soldaten in einem Zopf zurückgebunden – dennoch war ihre Verkleidung aus der Nähe und im Tageslicht schnell zu durchschauen.
Dann würde sie nach Aberdeen gebracht werden. Dort würde sie sterben, aber nicht schnell. Noch schlimmer aber war das Wissen, daß sie versagt hatte und Robbies Brief direkt an Cumberlands Leute verloren hatte.
Isabeau sah zu, wie ihre Häscher sich für die Nacht niederlegten. Zwei blieben wach, um Wache zu halten, bemerkte sie. Nicht daß es ihr – so, wie sie gefesselt war – etwas genutzt hätte, wenn sie ebenfalls geschlafen hätten oder allesamt gestorben wären. Das Lagerfeuer brannte hell nur wenige Zentimeter von ihren Zehen entfernt. Sie schloß die Augen. In Fort William war es kälter gewesen, nachts so kalt, daß sie nicht hatten schlafen können, auch wenn sie sich eng aneinander gedrängt hatten. Als die Tage verstrichen und die Belagerung anhielt, raubten Erschöpfung und kaltes Wetter ihnen auch die letzte Energie.
Dann hatten sie an einem Morgen einen von ihnen tot vorgefunden – einen Jungeen von erst siebzehn oder achtzehn ohne ein Zeichen von Verletzung. Er war erfroren und lag steifgefroren da, wo er sich am Abend hingelegt hatte. Sein Anblick hatte sie sogar noch mehr schockiert als der des Blutes von denen, die in der Schlacht getötet worden waren. Außer Robbies Anblick. Nichts könnte und würde sie je wieder so erschüttern wie der Anblick von Robbie, als sie ihn an jenem Tag zu ihr gebracht hatten.
Kapitel 2
Sie regten sich im Morgengrauen, zuerst der große Mann, der sie verletzt hatte. Er war jünger, als sie in der Nacht gedacht hatte, vielleicht Ende Zwanzig, und sie entschied, daß er ihr Laird sein mußte, denn sie taten alle, was er sagte. Er trug ein weites Leinenhemd und den grün-blauen Tartan der Campbells, eines Clans, den sie noch mehr haßte als die Engländer – sie und alle Schotten, die sich auf die Seite des Usurpators geschlagen hatten.
Wachsam sah sie zu, wie er sich aus seiner Decke wickelte und sich dann bückte, um mehr Holz aufs Feuer zu werfen. Dann sah er zu ihr herüber, und rasch wandte sie den Blick ab. In der letzten Nacht hatte sie gemerkt, wie skrupellos diese Männer waren, und jetzt hatte sie wirklich Angst.
Bald waren alle auf und rollten ihre Decken mit einer Geschwindigkeit zusammen, die ihr zeigte, daß sie an das Schlafen unter freiem Himmel gewöhnt waren. Der alte Mann, Patrick, beugte sich über das Feuer, und schon bald stieg der betörende Duft nach heißem Hafergebäck und Eiern in die Luft. Wie lange war es schon her, daß sie etwas Warmes zu essen gehabt hatte, seit sie wirklich satt gewesen war?
Alistair nahm sich ein frisches Brot aus dem Feuer und dann ein zweites, ehe er zu seinem Gefangenen ging. Er kniete sich neben sie. »Bist du hungrig, Junge? Es gehört nicht zu unseren Gepflogenheiten, unsere Gefangenen verhungern zu lassen, wie schlecht ihre Absichten auch sein mögen.«
Er streckte die Hand aus und drehte ihr dünnes, blasses Gesicht zu sich. Im Morgenlicht hob sich das getrocknete Blut deutlich von der weißen Haut ab, und die Haut war so glatt und weich wie die einer Frau. Da ging es ihm auf, und er wunderte sich, daß er es nicht eher gemerkt hatte, selbst in der Dunkelheit – die Stimme hätte es ihm verraten müssen.
Alistair ließ ihr Kinn los und begann, die Fesseln zu lösen, die sie an den Baum banden, während er ein wenig ungeduldig fragte: »Warum hast du letzte Nacht nichts gesagt? Ich führe keinen Krieg mit Frauen.«
Isabeau antwortete nicht und senkte den Blick, aber ihr schwaches Erröten verriet ihm sehr gut, warum sie geschwiegen hatte. Er konzentrierte sich darauf, Patricks feste Knoten zu lösen. Sie hatte geglaubt, sie wäre in die Hände von Vergewaltigern gefallen.
Das Seil löste sich, und er warf es beiseite. »Gib mir jetzt deine Hände.«
Isabeau wußte nicht, was er vorhatte, aber gleichwohl wandte sie ihm den Rücken zu, so daß er sie losbinden konnte, und noch während er das tat, trat Patrick mit einem mißbilligenden Ausdruck in den Augen zu ihm. »Was glaubst du, was du da machst, Mann, der haut doch gleich ab.«
Alistair sah auf. »Kein der, Alter, hast du denn keine Augen im Kopf?«
»Ein Mädchen?« Patrick trat näher und spähte ihrem Gefangenen ins Gesicht. »Och, das glaube ich nicht, Alistair, er sieht mir wie ein Junge aus, wenn auch wie ein halb verhungerter.«
Jetzt kamen auch die anderen neugierig näher – Donald Campbell kniete sich vor sie, um sie genauer anzusehen. »Wenn du willst, daß wir sichergehen«, lächelte er, »das ist leicht«, und er streckte die Hand nach den Knöpfen an Isabeaus Jacke aus.
Sie trat nach ihm, aber er lachte nur und hielt sie an den Stiefeln fest.
»Rühr mich nicht an, du schmutziger Bastard!« kreischte sie, riß einen Fuß los und trat damit hart nach seiner Hand. »Ich bring dich um, hörst du, ich bring dich um, wenn du mich anfaßt!«
»Laß sie in Ruhe, Donald.« Alistair hatte mittlerweile auch ihre Hände befreit, und sie verschränkte die Arme vor der Brust und zuckte zusammen, als das Blut wieder durch die Adern strömte. Doch ihr mißtrauischer Blick ließ Donald Campbell nicht los.
»Du brauchst keine Angst zu haben, daß sie dich anfassen«, beruhigte Alistair sie. »Meine Brüder mögen schlechte Manieren haben, aber sie tun, was man ihnen sagt.« Er bot ihr das Brot an. »Iß das jetzt.«
Sie hätte am liebsten abgelehnt, ihn angespuckt und das Essen beiseite gestoßen, aber ihr Hunger war zu groß, größer als ihr Stolz, und so streckte sie die Hand aus und nahm das Brot von ihm an.
Alistair erhob sich. Er erlebte das seltene Gefühl von Unentschlossenheit. Sie war zwar eine Frau, aber auch eine aktive jakobitische Rebellin. Der Brief, den sie bei ihr gefunden hatten, reichte mehr als aus, um sie an den Galgen zu bringen. Um dafür zu sorgen, brauchte er sie nur nach Aberdeen zu bringen, wie er es in der Nacht vorgehabt hatte, als er sie noch für einen Jungen gehalten hatte. Dann ging ihm auf, daß ein weiblicher Feind vielleicht noch gefährlicher war. Diese hier war ganz sicher dazu fähig, einen Dolch in die Brust eines seiner Männer zu rammen – hatte sie nicht genau das in der vergangenen Nacht bei ihm versucht? Doch er spürte auch Schuld. Er wußte genau, daß sie sie nicht so hart behandelt hätten, wenn sie in der Nacht schon gewußt hätten, daß sie eine Frau war. Beschämt betrachtete er das Blut an ihrem Hals, das er verschuldet hatte.
Er hörte immer wieder Geschichten davon, wie Gefangene von den Soldaten schlecht behandelt wurden, und ihr Fall war ernst. Ein Anschlag auf den Herzog von Cumberland – zumindest die Verschwörung dazu. Wenn er sie jetzt ansah, konnte er es kaum glauben. Wenn er den Brief nicht mit eigenen Augen gesehen hätte, würde er es auch nicht glauben. Die Oberen würden sie bestimmt verhören, vielleicht sogar foltern, um zu erfahren, was sie wissen wollten, und wenn sie jemand ganz und gar Skrupellosem in die Hände fiel, würde er sie sicherlich vergewaltigen.
Er sah zu, wie sie an ihrem Brot knabberte. Sie sah noch sehr jung aus, nicht älter als siebzehn, und trotz des Mutes, den sie nach außen hin zeigte, erkannte er ihre Furcht. Er verachtete die Jakobiter und ihre närrische, blutige Sache, aber dieses Kind konnte er nicht in den sicheren Tod schicken. Andererseits konnte er sie auch nicht gehen lassen und ihr damit ermöglichen, ihre verräterische Nachricht doch noch zu überbringen.
Er wandte sich an Patrick. »Ich werde ihr Pferd führen. Setze sie drauf und binde sie fest.«
Patrick nickte, und als er Isabeau am Arm ergriff, stand sie wackelig auf. Aber Patrick ließ sich nicht täuschen, er hatte letzte Nacht genug gesehen, um zu wissen, daß sie jede Chance zur Flucht nutzen würde, und so hielt er sie sehr fest. »Ich würde nicht an Flucht denken, Mädchen. Er kriegt dich doch, und dann hast du wirklich Ärger.«
Sie antwortete nicht. Mit gesenktem Blick ließ sie sich von ihm zu ihrem Pferd führen. Der alte Mann hatte recht. Sie wartete auf ihre Chance zur Flucht. Gefängnis bedeutete den Tod. Viel lieber würde sie hier draußen sterben, die Flucht versuchen, als in einem Verlies zu verfaulen oder zu hängen. Wenn sie außerdem auf den richtigen Zeitpunkt wartete, bestand immer noch die Chance, daß sie vielleicht doch entkam.
Aber jetzt war nicht die Zeit dafür. Die Hand, die sie hielt, war zwar dünn, der Körper zu alt, um sie zu verfolgen, aber es waren mindestens sechs Männer um sie herum, den flammenhaarigen Donald eingeschlossen, der nach ihr gegriffen hatte und der sie immer noch ansah, und dieser andere – Ian hatten sie ihn genannt –, der ihren Brief gelesen und dann seinen Bruder gedrängt hatte, sie umzubringen. Dieser Ian trat ohne ein Lächeln zu seinem Hengst, und seine schwarzen Augen maßen sie von Zeit zu Zeit, so daß sie es für sehr wahrscheinlich hielt, daß er sie gerne tot sähe. Bei so vielen wachsamen Augen würde sie sich Zeit lassen.
Als sie ihr Pferd erreichte, war der Anführer Alistair bereits auf seinen Hengst gestiegen und hielt ihre Zügel fest in der Hand. Isabeau setzte einen Fuß in den Steigbügel und schwang sich in den Sattel. Unglücklich sah sie zu, wie Patrick mit dem langen Seil auf sie zukam, mit dem sie schon in der Nacht gefesselt worden war.
»Ihr braucht mich nicht zu fesseln«, sagte sie. »Wenn ich an diesen großen Gaul gebunden bin, werde ich ja wohl nicht weit kommen, nicht wahr?«
Patrick sah fragend zu Alistair hinüber. »Sagen Sie es ihm«, wandte sich Isabeau an ihn, »es besteht kein Grund, mich zu fesseln.«
Aber Alistair blieb umgerührt. »Fessele sie«, befahl er kurz, »und dann wollen wir los.«
Isabeau sah wieder zu Patrick hinunter. »Nun, wenn es nicht anders geht, muß es wohl sein.« Sie rollte ihre Ärmel auf und streckte ihm die Hände hin. »Allerdings habe ich nach der Nacht nicht mehr viel Haut übrig.«
Der Anblick ihrer schlanken Handgelenke, die zerschrammt und wund waren, ließ den alten Mann innehalten. »Vielleicht könnten Sie mich hier fesseln«, schlug Isabeau vor und deutete auf ihre Taille. »Fesseln Sie mich an den Sattel, wenn es schon sein muß.«
Wieder sah Patrick Alistair an, der ihm zustimmend zunickte. »Dann halt still und heb die Arme.«
Isabeau gehorchte, und Patrick band sie rasch am Ledergurt ihres Sattels fest.
Es war ein wunderschöner Morgen, die Sonne schien und ließ den Schnee hell auffunkeln. Die Pferde bewegten sich vorsichtig in einer langen Reihe, in der nur Donald Campbell fehlte, der bereits mit dem Brief nach Aberdeen aufgebrochen war.
Alistair ritt ziemlich weit hinten, kurz vor Isabeau, und die Zügel ihres Pferdes hatte er sich fest um eine Hand gewickelt. Ab und zu drehte er sich nach ihr um. Sie saß ganz still, klammerte sich an den Sattelknauf und war anscheinend friedlich.
Bald ritten sie in einen dichten Kiefernwald, wo die Bäume sich unter der Last des Schnees beugten, der ab und zu von einem Zweig herunterfiel und die Pferde erschreckte.
In diesem Teil des Landes kannte Isabeau sich aus, und aufgeregt und ungeduldig wartete sie jetzt auf ihre Chance. Sie wußte, daß ein Stück weiter vorne der Weg schmaler und steiler werden würde, und dann folgte eine Kurve mit einer Senke.
Nun hatten sie den Anfang der Steigung erreicht, und wie sie gehofft hatte, war ihr Häscher gezwungen, seine Aufmerksamkeit auf den Weg vor sich zu konzentrieren. Ganz langsam löste Isabeau eine Hand vom Sattel und ließ sie in ihren linken Stiefelschaft gleiten, wo sie sich um den knöchernen Griff eines Dolches schloß, den sie immer bei sich trug. Vorsichtig zog sie den Dolch aus dem Stiefel. Die scharfe Klinge machte kurzen Prozeß mit dem Seil um ihre Taille, und rasch steckte sie den Dolch wieder zurück.
Als sie den Gipfel des Hügels erreicht hatten, glitt sie aus dem Sattel und rannte durch die Bäume davon.
Er war sofort hinter ihr, wie sie es sich gedacht hatte. Sie wußte aber auch, daß sein Pferd ihr durch das Dickicht nicht folgen konnte. Er mußte also absteigen und sie zu Fuß verfolgen. Zu Fuß war sie schnell. Die Furcht machte sie noch schneller, und sie flog durch den Wald wie der Wind.
Isabeau rannte auf den Abhang zu, wo er am steilsten war, sprang über den Rand und rollte in einer Schneewolke nach unten. Sie wagte es nicht, über die Schulter zurückzusehen, weil sie ihn hinter sich hören konnte, wie er ihr mit jedem Schritt näher kam. Unten sah sie, daß der Teich noch nicht gefroren war, also lief sie über die steinige Fläche, wo Wasser über ihre Stiefel spritzte und sie durchnäßten.
Isabeau merkte, daß sie ermüdete, und er kam schnell näher. Sie bildete sich ein, seine Hände schon an ihrer Jacke zu spüren, seinen warmen Atem an ihrem Nacken, und der Gedanke erfüllte sie mit Panik. Er war fast bei ihr, aber auch die Stelle, nach der sie gesucht hatte, die Stelle, wo der Boden sich in Felsen verwandelte und der Berg fünfzig Meter tief steil abfiel.
Isabeau schrie auf, als er sie einfing und sein Gewicht sie mit voller Wucht und Gesicht voran auf die harte Erde schleuderte, wo er auf ihr lag, so daß sie kaum atmen konnte. Sein keuchendes Atmen gab ihr zumindest die Befriedigung, daß sie ihn erschöpft hatte. Das war besser als gar nichts für diesen Bastard in Übergröße, und nun mußte er sie auch noch den ganzen Weg zurückschleifen. Sofern er das schaffte.
Sein Gewicht hob sich, aber noch ehe sie sich rühren konnte, ergriff er ihre Handgelenke und hielt sie hart über ihrem Kopf zusammen, preßte ihr ein Knie in den Rücken, um sie am Boden zu halten, und begann sie zu durchsuchen. Er atmete noch immer schwer, aber sie hörte ihn ärgerlich murmeln: »Wo ist er, du kleine Teufelin, wo versteckst du ihn?« Er griff in ihre Jacke, um nach verborgenen Taschen zu suchen, befühlte ihren Gürtel und klopfte dann ihre Beine ab bis hinunter zu den Stiefeln.
Ehe er sie losließ, warf er den Dolch in hohem Bogen in den Schnee, dann drehte er sie auf den Rücken.
»Jetzt sind wir beide naß«, knurrte er angespannt, »und der Weg zurück ist lang. Ich nehme an, daß dir das gefällt.«
Sie antwortete nicht. Sie erkannte die Wut in seinem dunklen Gesicht und in der Art, wie er den Mund zusammenpreßte. Sie wünschte, er würde von ihr runtergehen und sie aufstehen lassen. Aber er saß quer auf ihr, die Knie im Schnee, und schaute finster auf sie hinunter, und sie war nicht in der Lage, seinem Blick mit dem Trotz zu begegnen, den sie ihm gerne gezeigt hätte. Er war so groß und breit und stark, hatte lange Beine und große Hände, die ihre Arme vollkommen umfassen konnten. Allein mit ihm hier draußen fühlte sie sich noch verletzlicher als unter all seinen Männern. Die Leute taten schlimme Dinge, wenn es keine Zeugen gab.
Dann glitt plötzlich ein Klumpen Schnee von einer Kiefer hinter ihnen und landete dicht neben ihnen. Das lenkte sie beide ab, und Isabeau schaffte es, einen Arm loszureißen. Sie griff sich eine Handvoll Schnee und schleuderte sie ihm in die Augen, und in dem Moment, den er brauchte, um sich davon zu befreien, hatte sie schon seinen Dolch aus dem Gürtel gerissen.
Es war schwer, damit auszuholen, weil er immer noch auf ihr saß, aber ihr Arm beschrieb einen weiten Bogen, der Dolch schnitt durch sein Hemd und drang in seinen Bauch ein.
In dem folgenden Kampf spürte sie seine wilde Wut in dem schmerzhaften Griff um ihr Handgelenk und in dem wilden Kampf. Blut färbte den Schnee. Dann traf sie etwas am Kopf, ihr Blick trübte sich, und dann war alles schwarz.
Kapitel 3
Als Isabeau wieder zu sich kam, brauchte sie einen Moment, um sich zu erinnern, wo sie war. Er hatte sie vor sich im Sattel sitzen, und da sie die Landschaft rundum nicht kannte, mußte sie eine ganze Zeit lang ohnmächtig gewesen sein.
Isabeau versuchte sich aufzusetzen, um den Kontakt mit seinem Körper zu vermeiden, aber er legte den Arm nur fester um sie und zog sie zurück an seine Brust.
»Dann bist du also doch noch aufgewacht«, bemerkte er. »Ich dachte schon, ich hätte dich umgebracht.«
Alistairs Ton war leicht, aber in den letzten Stunden hatte er ernsthaft befürchtet, daß er ihr Schaden zugefügt hatte. Er hatte sie nur betäuben wollen, um sie ohne weitere Kämpfe den Hügel hochbringen zu können, aber sie hatte fast fünf Stunden leblos in seinen Armen gelegen.
Sie hatte ihn so wütend gemacht, das war das Problem. Nicht, weil sie ihn verletzt hatte, obwohl sein Bauch höllisch brannte, sondern weil sie es mit seinem eigenen Dolch getan hatte. Sie hatte ihn bei einer Nachlässigkeit erwischt und ihn mit seiner eigenen Waffe verwundet. Ein Mädchen, noch dazu eine halbverhungerte Jakobiterin, hatte die Oberhand über ihn gewonnen. Und nun wand sie sich, um von ihm wegzukommen.
»Sitz still!« befahl er kurz. »Wir haben noch viele Meilen vor uns, und du machst es für keinen von uns einfacher, wenn du dich die ganze Zeit windest. Ich will dich nicht wieder betäuben müssen«, setzte er hinzu, »aber wenn es sein muß, werde ich es tun.«
Isabeau gehorchte, nicht, wie sie sich versicherte, weil sie Angst vor ihm hatte, sondern weil sie nicht wieder bewußtlos sein wollte und damit ihre Chance zu erneuter Flucht verloren wäre. Ihr Kopf schmerzte an der Stelle, wo er sie geschlagen hatte. Am besten verhielt sie sich für eine Weile ruhig.
Die Gegend, durch die sie ritten, war ihr vollkommen fremd, und obwohl es ihr widerstrebte, mit dem ruchlosen Campbell zu reden, wollte sie wissen, wo sie hinritten. »Das ist nicht die Straße nach Aberdeen«, sagte sie deshalb nach einiger Zeit, »wo bringt ihr mich hin?«
»Nach Morayshire«, erwiderte er.
Isabeau schwieg. Kein Wunder, daß ihr die Gegend fremd war. Sie war weiter im Osten von Iverness, als sie je gewesen war. Ihre Hoffnung auf Flucht schwand. Sie fragte sich, warum sie nicht nach Aberdeen gebracht wurde, wie es doch vorgesehen war.
Vor ihr waren die anderen Reiter. Sie zählte fünf und merkte, daß einer fehlte, nach dem sie sich jetzt umdrehte. Da ritt der schwarzäugige Schurke, eine Vorkehrung für den Fall, daß sie noch einmal zu fliehen versuchte. Sie fragte sich, ob sie sich geschmeichelt fühlen sollte, weil man sie für fähig hielt, diesem Schurken zu entkommen, der sie so festhielt. Aber das Umdrehen des Kopfes weckte den Schmerz erneut, und ihr Blick verschwamm. Isabeau schloß die Augen und saß ganz still da.
Sie ritten ein weites Stück, bis jemand sprach, und diesmal war es Alistair, der das Schweigen brach. »Sag mir, wie du heißt«, begann er. »Nur den Vornamen«, setzte er hinzu, »wenn du immer noch deine Identität verbergen willst.«
Isabeau ärgerte sich über den leicht neckenden Ton in seiner Stimme und überlegte, ob sie ihm überhaupt antworten sollte. Doch dann fuhr sie zu ihm herum.
»Isabeau«, sagte sie. »So heiße ich. Ich bin eine Macpherson of Gairloch, und es kümmert mich nicht, wer das erfährt.« Stolz und verteidigend fügte sie hinzu: »Und Sie wissen schon, wo meine Loyalitäten liegen.«
»Aye, du mißgeleitete kleine Närrin, weißt du denn nicht, wie hoffnungslos deine Sache ist?«
»Ach, deshalb kämpfen Sie für den Usurpator«, höhnte sie. »Aber die Campbells waren ja immer schnell darin, sich auf die stärkere Seite zu schlagen.«
Das Letzte, was Alistair sich im Moment wünschte, war eine politische Diskussion mit dem Mädchen, aber sie verletzte seine Ehre und die seines Clans, was er nicht hinnehmen durfte. »Ich«, sagte er scharf, »kämpfe für meinen König, den rechtmäßigen König dieses Landes, und das würde ich auch dann tun, wenn deine Rebellenfreunde zehnmal soviele Leute hätten.«
Er las die Skepsis in ihrem Blick und wurde wütend.
»Was ist mit Sheriffmuir?« forderte er sie heraus, »wo viermal soviel Leute gegen die Campbells standen, sind sie da weggelaufen? O nein, das sind sie nicht.«
Isabeau dachte bei sich, daß es Alistair ähnlich sah, dreißig Jahre zurückzugreifen, um seinen Standpunkt zu vertreten.
Sie wandte ihm den Rücken zu, eine kleine, starre Gestalt, aber erst, nachdem Alistair die Verachtung in ihrem Blick gesehen hatte. Er betrachtete sie wütend und überlegte, ob er Ian rufen sollte. Mal sehen, wie lange sie sich noch Beleidigungen ausdachte, wenn sie eine Weile mit ihm geritten war. Aber nein, das Mädchen wäre sicher froh, wenn es wüßte, wie sehr es ihn verletzt hatte, und würde das als Sieg ansehen. Er hatte sich entschieden, sie mit auf sein Pferd zu nehmen, und auf seinem Pferd würde sie bleiben. Den ganzen Weg bis nach Hause.
Sie ritten schweigend dahin, und Alistair war sich die ganze Zeit dessen bewußt, wie sehr sie sich bemühte, sich nicht an ihn zu lehnen, als bedeutete die geringste Berührung ihre Kapitulation. Langsam und widerwillig begann er, ihr Verhalten zu bewundern. Er wußte, daß sie vollkommen erschöpft sein mußte, und wahrscheinlich schmerzte ihr Kopf dort, wo er sie geschlagen hatte. Ganz offensichtlich war sie unterernährt – die Knochen ihres Gesichts traten scharf hervor, und ihre Gelenke waren sehr dünn. Den Rest konnte er wegen der dicken Jacke schlecht einschätzen, aber als er sie ohnmächtig zu seinen Männern zurückgetragen hatte, war sie federleicht in seinen Armen gewesen. Schließlich fragte er: »Wie alt bist du, Isabeau Macpherson?«
»Was geht Sie das an?« erwiderte sie frech, ohne ihn auch nur anzusehen.
»Ich bin neugierig«, erwiderte er, »das ist alles.«
Erst dachte er, sie würde nicht antworten, aber dann sagte sie: »Ich bin zwanzig Jahre alt.«
»Zwanzig?«
»Aye« – sie hob eine Hand an ihren Kiefer, der durch das Gespräch schmerzte. »Was ist daran so verwunderlich?«
»Ich habe dich für jünger gehalten«, erklärte Alistair.
Wieder schwiegen sie. Es wurde langsam dunkel, und Isabeau fragte sich, warum sie nicht anhielten, um ein Lager aufzuschlagen. Sie hätte gerne danach gefragt und noch vieles mehr gewußt, warum sie nach Morayshire ritten, wie weit es noch war, was sie dort mit ihr vorhatten … Aber sie wollte den Mann hinter sich nicht zu einer Unterhaltung ermutigen.
Als die Umrisse eines großen Schlosses in der Dämmerung sichtbar wurden, wußte sie, daß sie fast an ihrem Ziel waren, und Erregung packte sie, die nicht nur Angst war. Das ließ sie fragen: »Wo sind wir hier?«
»Dunlossie Castle. Mein Heim.«
»Und warum haben sie mich nicht nach Aberdeen gebracht?«
Alistair zögerte kurz, ehe er erwiderte: »Ich führe gegen Frauen keinen Krieg, wie ich dir schon einmal gesagt habe.«
»Sie führen keinen Krieg gegen Frauen?« wiederholte sie sarkastisch und drehte sich zu ihm um, um ihm ins Gesicht sehen zu können. »Wie nennen Sie denn dann das und das und das und das?« Sie deutete dabei auf ihren Kopf, die Handgelenke und die Schnitte an ihrem Hals aus der Nacht zuvor.
»Daran bist du selber schuld«, gab Alistair schnell zurück. »Die Art Frau, die sich als Mann verkleidet, verdient so eine Behandlung.«
»Und ich bestimmt, nicht wahr?«
»Aye.«
»Und was ist mit den Frauen, deren Männer Sie getötet haben, deren Häuser verbrannt sind, führen Sie gegen die keinen Krieg? Und nach dem, was ich gehört habe, haben Sie noch Schlimmeres gemacht – ich habe es selber gesehen.«
»Ich habe niemandes Haus angezündet«, wehrte sich Alistair, dessen Sympathien für sie so schnell verschwanden, daß er sich kaum vorstellen konnte, sie überhaupt empfunden zu haben. »Und ich habe auch nichts Schlimmeres getan, wie du es formulierst …«Er unterbrach sich abrupt. Was tat er da eigentlich, verteidigte er sich vor diesem frechen Mädchen, das seine Gefangene war? Ihre Sticheleien verfehlten es nie, ihn zu provozieren. Je eher sie von dem Pferd herunter waren, desto besser für sie beide.
Als sie durch den Torbogen ritten, standen die Sterne bereits hell am Himmel, und die Temperatur war dramatisch gefallen. Sie saßen ab, und Isabeau wartete zitternd im Hof, während Alistair ihren Arm umklammerte und seinen Männern Befehle zurief. Das Schloß ragte düster über ihnen auf, kaum ein heimeliger Anblick mit seinen hohen Mauern und dem massiven Turm.
Im Erdgeschoß fiel Licht aus ein paar Fenstern, so daß Isabeau die hohen Mauern sehen konnte, die den Innenhof umschlossen. Das Haus war eine Festung, und unwillkürlich wich sie zurück, als Alistair sie auf den Eingang zuschob. Doch er hielt sie fest und zog sie mit sich die Treppe hoch und durch den Eingang.
Etwas überwältigt und unsicher, was man jetzt mit ihr vorhatte, blieb Isabeau dort stehen, wo der Campbell sie hingestellt hatte, und sah sich um. Sie waren in eine riesige Halle getreten, über der sich offenbar der Turm erhob. Mehrere Türen führten von hier ab, und durch eine konnte Isabeau in eine reich ausgestattete Kammer sehen. Da erst erkannte sie, daß sie keinem untergeordneten Campbell-Mitglied in die Hände gefallen war, sondern einem Anführer mit einigem Status.
Besorgt sah sie diesen Mann an, Alistair Campbell, die Quelle ihres Unglücks. Er hatte Erfolg gehabt, wo alle anderen versagt hatten, und sie letzte Nacht aus dem Sattel gezogen, und er war es, der sie gefangen hatte, als sie heute morgen fast hätte fliehen können. Ohne ihn wäre sie jetzt schon auf halbem Wege nach Aberdeen. Isabeau betrachtete ihn und spürte, wie all ihr Haß auf sein Haus, seinen Clan und seine Arroganz in ihr erwachten, auf die Ungerechtigkeiten und das viele Töten. Er stand groß und aufrecht da, anscheinend unberührt von der Wunde, die sie ihm beigebracht hatte, und sah seinen Bruder Ian und den grauhaarigen Patrick an.
Sein Hemd war blutig, und darunter erkannte sie eine Art Verband um seine Taille. Rasch wandte Isabeau den Blick ab. Es war eine Sache, sich in Verzweiflung zu verteidigen, aber eine ganz andere, den Beweis dafür zu sehen. Die Männer sprachen über die Reise, aber Isabeaus Erschöpfung war so groß, daß die Stimmen verschwammen. Ihr Kopf schmerzte fürchterlich, und sie hob die Hand an die Augen. Sie fühlte sich seltsam schwindelig, kleine Funken tanzten vor ihren Augen, und sie blinzelte, um wieder klar sehen zu können.
Ihre Unterhaltung schien kein Ende nehmen zu wollen. Noch mehr Männer kamen dazu, und der Saal wurde immer voller. Ihr Herzschlag dröhnte in ihrem Kopf, und dann wurde ihr plötzlich schwarz vor Augen.
Als Isabeau zu sich kam, lag sie zwischen sauberen Leinentüchern in einem großen Bett. Vor ihr stand eine attraktive junge Frau in einem modischen Kleid mit offenen braunen Haaren, die bis auf ihre Schultern reichten.
Als die junge Frau sah, daß Isabeau wach war, verließ sie wortlos den Raum und kehrte wenige Minuten später mit der Person zurück, die Isabeau am wenigsten zu sehen wünschte.
Alistair Campbell stand neben dem Bett und sah zu ihr herab. Er trug noch immer seine verschmutzte Reisekleidung, und der blutige Verband sah zwischen seinem Hemd hervor. Sein Haar war wild zerzaust. Er sah genauso aus wie der Wilde, als den Isabeau ihn betrachtete, und sie wunderte sich, daß so ein Mann Laird über so ein Schloß sein konnte.
Nach einer Weile wandte er sich an die junge Frau neben ihm. »Sieh zu, daß du sie zum Essen bringst, Susan. Patrick wird dir dabei helfen. Und was dich angeht«, wandte er sich an Isabeau, »wenn du irgend jemandem hier in Dunlossie etwas antust, dann ziehe ich dir bei lebendigem Leibe die Haut ab, verstanden? Wenn du auch nur daran denkst …«
Wieder ging die Tür auf, und Patrick Macphee brachte ein Tablett herein. Alistair trat zu ihm, um mit ihm zu sprechen. Sie senkten die Stimme, aber Isabeau hörte ihn trotzdem sagen: »Laß Susan nicht mit ihr allein, Patrick, und schließ immer die Tür ab, wenn du aus dem Zimmer gehst.« Dann sah er Susan an, lächelte und setzte hinzu: »Gesell dich unten zu uns, wenn du fertig bist, Susan. Ian und ich essen, sobald wir uns ein bißchen gesäubert haben.« Damit war er weg.
Als schließlich alle gegangen waren, lag Isabeau wach und starrte an die Decke. Es war schon spät, und sie konnte nicht schlafen. Ihre Gedanken kreisten um Robbie, um ihr Versagen und um ihre Trauer.
Die ganzen schrecklichen Wochen, seit sie ihn verloren hatte, hatte sie der Gedanke daran aufrecht gehalten, daß sie eine Mission erfüllen würde, aber nun gähnte eine so entsetzliche Leere vor ihr, daß sie das Gefühl hatte, hineinzustürzen und nie wieder herauszufinden.
Wenn sie hier so bequem in dem sauberen, warmen Bett lag, fühlte sie sich wie eine Verräterin und wünschte fast, man hätte sie in den Kerker geworfen. Fast. Sie drehte sich auf die Seite und rollte sich zusammen. Im Kamin flackerte hell ein Feuer und verbreitete Wärme und vor allem Trost, weil es Licht und Bewegung spendete, so daß sie sich nicht ganz so allein fühlte.
Susan, die wie eine Engländerin sprach, war freundlich und nett zu ihr gewesen, was angesichts von Alistair Campbells Schroffheit besonders hervorgetreten war. Sie fragte sich, wie lange man sie wohl hier behalten wollte. Nicht, daß sie das konnten. Wenn die verriegelte Tür das einzige war, was zwischen ihr und der Freiheit lag, dann würde sie schon einen Weg finden, um von hier zu entkommen. Sie würde noch ein, zwei Tage warten, um ihre Kraft wiederzuerlangen, und dann würde sie fliehen.
Während Isabeau wach lag und ihre Flucht plante, saß Alistair Campbell mit seinem Bruder Ian und seiner Cousine Susan Fairfax in der Halle beim Abendessen. Die Männer waren tagelang gereist und waren dankbar für ein gutes Essen, aber die Atmosphäre war nicht gerade festlich. Ihre Uneinigkeit über das Schicksal ihrer Gefangenen entzweite sie. Alistair war wütend über die Rolle, die er hier spielen mußte. Er hatte immerhin am meisten Grund, die Rebellen und ihre schändliche Sache zu verachten und zu verdammen. Daß er sich jetzt plötzlich in der Rolle dessen sah, der eine von ihnen verteidigen mußte, hätte schon in normalen Zeiten ausgereicht, um ihn wütend zu machen, aber um so mehr wirkte das jetzt, wo das Thema ihres Streites seinen Stolz so nachhaltig verletzt hatte. Noch nie hatte eine Frau ihn so verletzt. Wenn es ein Mann gewesen wäre … nun, ein Mann wäre jetzt bereits tot.
»Es ist nicht für lange«, beschwichtigte er. »Die Sache ist fast vorbei, das wissen wir alle, und dann kann sie zu ihren Leuten zurückkehren, aber erst einmal muß sie hierbleiben.«
Susan warf ihrem Cousin einen neugierigen Blick zu. Er wirkte in bezug auf das Mädchen sehr entschlossen. »Aber sie wird wahrscheinlich weglaufen, denkst du nicht auch, Alistair?«
»Bestimmt«, warf Ian schnell ein. »Du hättest sehen sollen, wie sie im Wald abgehauen ist. Ein Jammer«, wandte er sich dann an seinen Bruder »daß du sie in der ersten Nacht nicht gleich erledigt oder sie nach Aberdeen gebracht hast, wie du es vorhattest. Es ist nicht richtig, Susan dem Mädchen auszusetzen.«
»Das macht mir nichts, Ian«, versicherte Susan. »Sie ist viel zu schwach, um mir etwas anzutun.«
»Zu schwach?« Ian lachte skeptisch auf. »Hast du nicht gesehen, was sie mit Alistairs Bauch gemacht hat? Sieh dir gut an, was die Hexe mit ihm gemacht hat, und sei auf der Hut.«
Alistair beugte sich vor und stützte die Ellbogen auf den Tisch. »Das reicht, Ian. Ich weiß, daß sie unberechenbar ist. Das weiß ich besser als ihr alle, aber ich werde eine Frau nicht der Armee übergeben und damit ist das Thema beendet«, fügte er entschieden hinzu, als er den Gesichtsausdruck seines Bruders sah.
Er hatte von Anfang an gewußt, daß Ian es nicht billigte, das Mädchen hierherzubringen. Vielleicht mißbilligten das alle – außer Patrick, der ein weiches Herz hatte und dessen Sympathie für die Jakobiter so klar wie die Sonne war, auch wenn er sein Bestes tat, um das zu verbergen. Wahrscheinlich hatten sie sogar recht, denn das Mädchen machte Probleme – sie war unberechenbar, verzweifelt und gewalttätig und konnte jederzeit einen von ihnen angreifen.
Sein Blick wanderte zu Susans Gesicht. Er hätte sie nicht in das Zimmer des Mädchens lassen sollen. Sie war nicht an Gewalt und Feindschaft gewöhnt und deshalb viel zu vertrauensvoll und damit verletzlich. Es war besser, wenn Patrick sich von jetzt an um das Mädchen kümmerte. Erneut fragte er sich, wie Susans Vater es ihr hatte erlauben können, Schottland in so unruhigen Zeiten zu besuchen. Sie war schon acht Monate hier, fünf Monate länger als geplant, aber es war einfach zu gefährlich für ihre Heimreise geworden. Alistair trank sein Weinglas leer. Nun, bald würde sie nach Hause können, denn das Ende der Kämpfe war abzusehen.
Kapitel 4
»Sie können mich doch nicht im Ernst hier einschließen wollen, bis der Krieg vorüber ist.«
»Das wird schneller sein, als du denkst.«
»Oh, wird es das, ja?«
Isabeau stand Alistair gegenüber, ganz Wut und Ungeduld. Sie trag ein schlecht sitzendes graues Wollkleid, das sie für sie gefunden hatten. Nach Monaten schlechter Ernährung war sie noch immer viel zu dünn, so daß der Stoff lose über ihren Schultern hing. Isabeau sah Alistair wütend an, ohne die Furcht, die sie früher bei seinem Anblick immer empfunden hatte. Sie hatten sie ernährt und ihr Kleider gegeben und sich um ihre Bedürfnisse gekümmert, nur aus dem Zimmer wollte man sie nicht lassen, und der Grund dafür stand hier vor ihr, so unbeweglich wie die Granitsäule.
Sein Äußeres hatte sich von dem des Wilden, der sie aufgegriffen und so brutal behandelt hatte, erheblich gewandelt. Seine Figur war sicherlich eindrucksvoll, anders konnte es bei seiner Stärke gar nicht sein, aber nun, in makellosem Hemd und Kilt, glattrasiert und das Haar ordentlich im Nacken zusammengebunden, sah er jeden Zoll genauso aus wie der Laird, der er war.
»Sie waren von Anfang an ein ruchloser Bastard«, schimpfte sie. »Das haben Sie mir ja gleich klargemacht.« Sie drehte sich um, trat zu der niedrigen Truhe am Ende ihres Bettes und ließ sich mit allen Anzeichen von Zorn und Ungeduld darauf nieder. Als sie ihn ansah, bemerkte sie seinen finsteren Gesichtsausdruck. Sie wußte sehr gut, daß er nicht gerne an das erinnert wurde, was er ihr in jener ersten Nacht angetan hatte. Die Wunde an ihrer Kehle war immer noch deutlich zu sehen, und sie hob die Finger an die Narbe. »Aye, Sie haben also gedacht, ich wäre ein Mann, und zwar ein junger, aber welcher Mann foltert denn Kinder?«
Alistair trat auf sie zu und riß sie mit festem Griff auf die Beine. »Ich foltere keine Kinder, du freche Göre! Du warst eindeutig ein Spion, schlimmer noch, ein Attentäter, wenn auch ein junger, das stimmt, aber alt genug, um zu wissen, was du tust. Außerdem«, fauchte er, »glaubst du denn nicht, wenn ich dich brechen wollte, würde ich das schaffen? Dann würdest du mir alles erzählen, was du weißt.«
Unvermittelt ließ er sie los, und seine Arme sanken an den Seiten herab. Sie tat es schon wieder – sie reizte ihn, und er reagierte genauso, wie es ihre Absicht gewesen war. Wie jedesmal in den vergangenen drei Tagen. Jetzt sah sie höchst selbstzufrieden drein, als wenn sie sich gerade etwas bewiesen hätte.
»Hast du vielleicht schon mal daran gedacht«, fuhr er fort, um einen gleichmütigen Ton bedacht, »daß ich dich zu deiner eigenen Sicherheit hier einsperre? Wenn ich dich rauslasse, bist du weg, und was dann? Auch wenn du es schaffen würdest, bei dem Frost bis zu deinen Freunden zurückzufinden, würdest du doch kurz darauf sterben. Es ist fast vorbei, glaube mir, und am Ende wird es keine Gnade geben, schon gar nicht für Verschwörer wie dich. Du solltest mir dankbar sein, weil ich für deine Sicherheit sorge.«
»Dankbar?« wiederholte sie ungläubig. »Ich soll dankbar dafür sein, daß ihr eure Seelen an die Engländer verkauft habt und eure schottischen Landsleute hinschlachtet?« Jetzt war es Isabeau, die die Beherrschung verlor. Sie kam auf ihn zu, rot vor Wut und mit ungeweinten Tränen in den Augen. »Waren Sie in Fort William, Alistair Campbell, bei der Belagerung?«
»Aye«, bestätigte er, »das war ich.«
»Sie sind ein Schotte, um Himmels willen, wie konnten Sie so etwas tun?«
»Ein Schotte, ja, und zwar einer von der Mehrheit, die nicht will, daß euer Betrüger den Thron für sich beansprucht.«
»Aye, Sie sind ja auch ein Campbell«, zischte sie, »ein Sohn von Diarmid.«
Es war schwer, über ihren beleidigenden Ton hinwegzugehen. Er regte sich über ihre Art auf, ihn anzuklagen, als wäre er allein der Verräter gegen ihr Land, und in ihren Augen standen Verachtung und Abneigung. Am liebsten hätte er sie geschüttelt oder noch Schlimmeres mit ihr gemacht, deshalb verließ er einfach wortlos den Raum, ehe er sich der Barbarei hingab, die ihm einfiel. Dabei fragte er sich ärgerlich, ob ein masochistischer Zug ihn dazu trieb, sie jeden Tag zu besuchen, obwohl Patrick sich bestens um sie kümmerte.
Doch als er sich allmählich wieder beruhigte, sagte er sich, daß sein Seelenfrieden die Aufregung wert war. Ihr Anblick, wenn sie schwer atmend und mit roten Wangen vor ihm stand, war etwas, was er gerne im Sinn behielt. Nicht zum erstenmal fragte er sich, ob sie wohl einen Geliebten hatte. Es wäre ein Jammer, wenn jemand mit solchem Feuer und solcher Leidenschaft das nicht hätte.
In seinem Zimmer betrachtete er die Dinge, die sie ihr abgenommen hatten. Er drehte die Steine nachdenklich in der Hand. Sie waren ohne Spuren, und er hätte gerne gewußt, welche Bedeutung sie wohl hatten. Noch mehr interessierte ihn, was die Nadel ihr bedeutete. Es war die Nadel eines Mannes, eines Mitgliedes des Macpherson-Clans – vielleicht ihr Geliebter? Das Medaillon trug innen das Bild einer Dame. Es war nicht Isabeau – die Haare waren dunkel – aber sie war genauso jung und sehr schön. Mit einem Schnappen klappte er das Medaillon zu, ärgerlich über seine Neugier. Er würde sie nicht danach fragen, das gäbe ihr nur die Befriedigung, sich zu weigern, ihm eine Antwort zu geben.
Am nächsten Abend bekam Isabeau ihre Gelegenheit in Gestalt von Susan Fairfax, die sie ohne Begleitung besuchte. Sie kam kurz nach dem Abendbrot in Isabeaus Zimmer. Neugier trieb sie, und nicht zu wenig Eifersucht. Susan hatte bemerkt, daß Alistair sich verändert hatte, seit er die Gefangene nach Dunlossie gebracht hatte. Vielleicht fiel es den anderen nicht auf, aber ihr sehr wohl. Sie würde jede Veränderung in Alistair bemerken, sosehr er auch versuchte, es zu verbergen.
Als Susan die Tür aufschloß und eintrat, fand sie die Gefangene in einem Sessel zusammengerollt am Feuer. Susan hatte Isabeau seit dem ersten Abend, als Alistair sie hochgetragen hatte, nicht mehr gesehen. Wegen der Feindseligkeit des Mädchens hatten sie ihr nicht erlaubt, es zu besuchen. In jener Nacht war sie ein armseliger Anblick gewesen, dünn und bleich wie Wachs und voller Schrammen und Wunden auf der weißen Haut. Susan hätte sich auch keinen Moment lang träumen lassen, daß sie eine Bedrohung sein könnte.