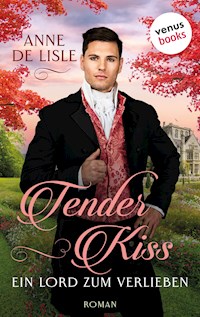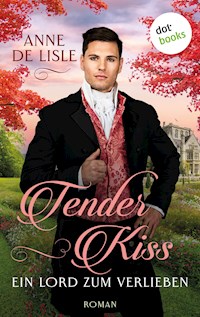
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Er ist ihr Retter, aber liebt er sie auch? Der historische Liebesroman »Tender Kiss – Ein Lord zum Verlieben« von Anne de Lisle als eBook bei dotbooks. Die Liebe ist nie ohne Hindernisse ... Von rauschenden Ballnächten und romantischen Begegnungen mit Lords kann die junge Tabitha nur träumen, denn das Leben ist für die mittellose Waise grau und trostlos geworden, seit sie bei ihrer hartherzigen Tante untergekommen ist. Als deren Sohn Richard sich ihr ungebührlich nähert, scheint alles verloren – doch im letzten Moment wird sie von ihrem Kindheitsfreund gerettet, dem charmanten Dominic Rees. Mit seiner Hilfe beginnt sie in London ein neues Leben als Lehrerin. Obwohl sie sich schon immer zu ihm hingezogen fühlte, scheint er doch unerreichbar, denn als Earl of Huntleigh muss Dominic standesgemäß heiraten. Bleibt Tabitha nichts anderes übrig, als ihre Gefühle zu begraben ... oder kann sie es wagen, um sein Herz zu kämpfen? Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der bewegende Regency-Roman »Tender Kiss – Ein Lord zum Verlieben« von Anne de Lisle. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 349
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Die Liebe ist nie ohne Hindernisse ... Von rauschenden Ballnächten und romantischen Begegnungen mit Lords kann die junge Tabitha nur träumen, denn das Leben ist für die mittellose Waise grau und trostlos geworden, seit sie bei ihrer hartherzigen Tante untergekommen ist. Als deren Sohn Richard sich ihr ungebührlich nähert, scheint alles verloren – doch im letzten Moment wird sie von ihrem Kindheitsfreund gerettet, dem charmanten Dominic Rees. Mit seiner Hilfe beginnt sie in London ein neues Leben als Lehrerin. Obwohl sie sich schon immer zu ihm hingezogen fühlte, scheint er doch unerreichbar, denn als Earl of Huntleigh muss Dominic standesgemäß heiraten. Bleibt Tabitha nichts anderes übrig, als ihre Gefühle zu begraben ... oder kann sie es wagen, um sein Herz zu kämpfen?
Über die Autorin:
Anne de Lisle lebt mit ihrem Ehemann in einem angeblichen »Geisterhaus« in Maryborough. Ihre Romane sind international erfolgreich.
Anne de Lisle veröffentlichte bei dotbooks bereits »In den Händen des Schotten«, »Das Herz des Lairds« und »Die Leidenschaft des Lairds«.
***
eBook-Neuausgabe Dezember 2022
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 1997 unter dem Originaltitel »Tabitha« bei Bantam Australia. Die deutsche Erstausgabe erschien 2000 unter dem Titel »Und fänden nicht das Paradies« bei Lübbe
Copyright © der englischen Originalausgabe 1997 by Anne de Lisle
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2000 by Verlagsgruppe Lübbe GmbH & Co. KG, Bergisch Gladbach
Copyright © der Neuausgabe 2022 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © Period Images sowie © shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ae)
ISBN 978-3-98690-417-3
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Tender Kiss – Ein Lord zum Verlieben« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Anne de Lisle
Tender Kiss – Ein Lord zum Verlieben
Roman
Aus dem Englischen von Bettina Albrod
dotbooks.
Kapitel 1
England, 1804
»Sei ein liebes Mädchen, Tabitha. Gehorche deiner Tante und vergiß nicht, deine Gebete zu sprechen. Das hätten deine Eltern sich gewünscht.«
Tabitha Montecue nickte ernst. Ihr Blick hing unverwandt an Mrs. Morewells Gesicht, denn sie wußte sehr gut, dass es höchst unwahrscheinlich war, dass sie die freundliche Dame jemals Wiedersehen würde.
Mrs. Morewell beugte sich zum Kutschenfenster, öffnete es und drückte dem Kind einen Kuß auf die Wange. »Auf Wiedersehen, mein Liebes. Ich schreibe bald, um zu sehen, wie es dir geht. Gott sei mit dir.«
Tabitha konnte nicht antworten und hob statt dessen eine kleine, behandschuhte Hand, um zu winken, als die Kutsche davonrollte. Sie reckte den Hals, um einen letzten Blick auf Reverend und Mrs. Morewell werfen zu können, die auf den Stufen des Pfarrhauses standen, aber dann bog die Kutsche um eine Kurve, und sie konnte die beiden nicht mehr sehen.
Tabitha lehnte sich in der gepolsterten Kutsche ihrer Tante zurück und wandte ihr Interesse der Frau zu, die ihr gegenübersaß. Sie hieß Houghton. Mrs. Morewell hatte erklärt, dass Houghton eine Dienerin sei, die Tante Montecue geschickt habe, damit Tabitha auf die Reise zu ihr Begleitung hatte. Diese Houghton, entschied Tabitha bei sich, sah nicht allzu erfreut darüber aus, mit dieser Pflicht betraut worden zu sein. Sie saß in ihrem steifen grauen Kleid sehr gerade auf ihrem Sitz, und der mißbilligende Ausdruck ihres Gesichts deutete auf einen Charakter hin, der so unbeugsam war wie ihre Haltung.
Tabitha war immer von Menschen umgeben gewesen, die sie gemocht hatten und freundlich zu ihr gewesen waren. Menschen, die mit ihr sprachen und mit ihr spielten, aber diese Frau hatte kaum ein Wort mit ihr geredet, wenn man davon absah, dass sie sie zur Eile angetrieben hatte, als sie in die Kutsche gestiegen waren.
In diesem Moment beugte Houghton sich vor und ließ das geöffnete Kutschenfenster mit einem Knall zuschnappen. Als wenn sie Tabithas Blick auf sich spürte, betrachtete sie dann das Kind. »Wir werden mindestens zwei Tage unterwegs sein, wenn das Wetter schlecht wird, noch länger, und ich werde es nicht dulden, dass du mich belästigst. Ich hoffe, dass du in der Lage bist, dich selber zu beschäftigen.«
Das alles wurde recht brüsk geäußert, und Tabitha, die ohnehin schon Respekt vor der strengen Houghton hatte, nickte schweigend. Dann faltete sie die Hände im Schoß und sah zu, wie die Frau eine Stickerei aus ihrer Tasche zog, um hastig daran zu arbeiten und nur innezuhalten, wenn die Kutsche über eine besonders unebene Wegstrecke holperte.
Tabitha sah neugierig aus dem staubigen Fenster und bemerkte, dass sie die offene Landstraße erreicht hatten. Sie kniete sich auf den Sitz, zog sich ihr schwarzes Kleid wärmend über die Füße und betrachtete die Winterlandschaft vor dem Fenster. Sie kamen durch einige unbekannte Dörfer und fuhren an anderen Reisenden vorbei, die zu Pferd oder zu Fuß unterwegs waren. Doch allmählich wurde Tabitha müde und sank auf ihrem Sitz zurück. Sie hatte nichts zu lesen oder zu spielen mit, außer ihrer heißgeliebten Lumpenpuppe, die sie unter dem Arm hielt, und ihre Begleiterin war eindeutig nicht zum Reden aufgelegt. Also lehnte Tabitha den Kopf zurück und beobachtete die flinken Bewegungen der Nadel und der Finger der Frau. Nach einiger Zeit wurden ihr die Lider schwer, und sie schlief ein.
Tabitha Mary Montecue war gerade mal sechs Jahre und hatte in ihrem kurzen Leben noch nie eine so weite Reise gemacht. Doch Ereignisse in ihrer jüngsten Vergangenheit hatten ihre Lebensumstände drastisch verändert, und so hatte sie sich nicht beklagt, als Reverend und Mrs. Morewell sie in die Kutsche gesetzt hatten, sie ermahnt hatten, brav zu sein, und sich mit Küssen von ihr verabschiedet hatten. Ihre junge Seele, immer noch aufgewühlt von dem Verlust der beiden Menschen, die sie am meisten auf der Welt geliebt hatte, war gar nicht auf die Idee gekommen, gegen die Entscheidung zu protestieren, die sie der Obhut der Morewells entzog, denn diese Angelegenheit kam ihr angesichts des Verlustes ihrer Mama und ihres Papas nebensächlich vor.
Rupert Montecue war erst zwanzig gewesen, als er Eleanor Litherland kennengelernt und sich Hals über Kopf in sie verliebt hatte; in ein Mädchen, das so schön war wie unpassend als Braut des jüngsten Sohnes von Sir Jasper Montecue. Eleanors Vater, Reverend Litherland, war der verarmte Pfarrer eines benachbarten Sprengels, und obwohl die entzückende Eleanor die Ausdrucksweise und Manieren eines guterzogenen Mädchens besaß, wurde sie von Ruperts Familie als unpassend betrachtet. Der alte Sir Jasper hatte die Verbindung verboten.
Doch Rupert hatte die Anordnungen seiner Familie ignoriert und war davongelaufen, um seine große Liebe zu heiraten, und als Folge davon hatte er seine Verwandten nie wiedergesehen, die ihm verboten hatten, den Familienbesitz Wroxley Manor je wieder zu betreten. Dieses Verbot hatte den jungen Mann nicht allzusehr beeindruckt, da er seinen Eltern ohnehin nicht besonders zugetan gewesen war. Selbst als er erst die Nachricht vom Tod seines Vaters und kurz darauf die vom Tod seines älteren Bruders Henry erfuhr, verspürte er nicht den Wunsch, nach Hause zurückzukehren.
Henrys Frau, die neue Lady Montecue, hatte Rupert als höchst unangenehme Person in Erinnerung, die er nicht Wiedersehen wollte, geschweige denn Eleanor zumuten wollte. Da Mylady so klug gewesen war, einen Erben hervorzubringen, ehe sie Witwe wurde, verspürte Rupert auch nicht die Pflicht, nach Wroxley zurückzukehren.
Nein, er war mehr als zufrieden, dort zu bleiben, wo er jetzt war, und ein einfaches, aber glückliches Leben zu führen, Hunderte von Meilen von Wroxley entfernt und mit bescheidenem Einkommen, das er einer Stellung als Lateinlehrer an einer Jungenschule am Rande von Devizes verdiente. Wenn das Cottage, das Eleanor und er gemietet hatten, nicht das war, woran er gewöhnt war, so war ihre Liebe zueinander mehr als genug Ausgleich für ihn. Sie waren überströmend glücklich miteinander, und als knapp ein Jahr nach ihrer Hochzeit ihre Tochter zur Welt kam, war ihr Glück vollkommen.
Eleanor brachte rasch hintereinander zwei weitere Kinder zur Welt, aber beide überlebten kaum eine Woche, da sie zu früh geboren waren. Allmählich gewöhnten sie sich an den Gedanken, dass Tabitha wohl ihr einziges Kind bleiben würde, und sie wuchs zu so einem entzückenden Mädchen heran, dass sie höchst zufrieden waren.
Tragischerweise war ihnen nur wenig gemeinsame Zeit vergönnt, denn eines Tages brach in Wiltshire die Cholera aus, ergriff auch die Stadt Devizes und forderte nicht nur Eleanors, sondern auch Ruperts Leben mit dem vieler anderer. Trotz ihrer Jugend erkrankte Tabitha nicht und wurde von Reverend Morewell und seiner Frau aufgenommen, die sich lieb um das Kind kümmerten, während sie Nachforschungen nach seinen Verwandten anstellten. Es stellte sich heraus, dass Eleanor keine lebenden Verwandten mehr hatte, denn sie war ein Einzelkind und ihre Eltern waren inzwischen verstorben, doch Ruperts Familie war rasch aufgespürt. Schon bald wurden Gespräche zwischen den Morewells und der verwitweten Lady Montecue aufgenommen, und die Witwe stimmte zu, Tabitha trotz des Zerwürfnisses in der Familie aufzunehmen.
Die Reisenden verbrachten die Nacht in einem komfortablen Gasthaus, aber Tabitha war so müde, dass sie es nur gerade eben schaffte, ihre Mahlzeit aus Brot und kaltem Braten unter den wachsamen Augen der Houghton zu sich zu nehmen, ehe sie ins Bett ging. Nur widerstrebend hatte sie am folgenden Morgen erneut die Kutsche bestiegen, aber mm näherte sich die Reise ihrem Ende.
Die Kutsche bog durch ein hohes Eisentor und rollte die längste baumbestandene Auffahrt entlang, die Tabitha je gesehen hatte. Neugierig vergaß sie ihre Lustlosigkeit und preßte das Gesicht ans Fenster. Sie wußte, dass ihr Papa hier in seinem anderen Leben gewohnt hatte, ehe er Mama kennengelernt hatte – und dass er nie mehr hatte zurückkommen wollen.
Auch wenn Rupert Montecue nur selten von seinem Leben in Wroxley Manor gesprochen hatte, hatte Tabitha doch gemerkt, dass er dort nicht glücklich gewesen war und dass die Leute dort ihre Mutter nicht nett behandelt hatten. Tabitha merkte, dass sie sich plötzlich heftig nach Reverend und Mrs. Morewell zurücksehnte, deren einfacher Haushalt sie an ihr Zuhause erinnert hatte. Es war auch nahe daran gewesen, sie hatte das Cottage noch sehen können. Hier war alles fremd und so weit weg …
Die Kutsche fuhr durch eine Kurve und enthüllte den großen Augen des Kindes das Heim ihrer Vorfahren. Erstaunt blickte Tabitha hin. Sie war an die hübschen, aber einfachen Cottages von Devizes gewöhnt und hatte sich auch in ihren wildesten Träumen nicht vorstellen können, dass es ein Haus wie dieses gab.
Wroxley Manor war im klassischen Stil erbaut, und es mangelte dem Haus das gotische oder barocke Beiwerk, mit dem so viele Häuser dieser Epoche geschmückt waren. Der dunkelrote Stein hob sich deutlich gegen den klaren Winterhimmel ab und verlieh dem Haus ein drohendes Aussehen. Die weiten Wiesen rund um das Herrenhaus waren voller großer alter Eichen und Ulmen und durchaus dazu angetan, die Phantasien eines Kindes zu wecken, aber Tabitha sah sie gar nicht, denn ihr Blick hing unverwandt an dem großen Haus. Es war, entschied sie, ein häßlicher Anblick – dunkel und häßlich. Kein Wunder, dass Papa nicht hatte hierbleiben wollen, wenn er ein hübsches weißes Cottage mit Kletterrosen und Glyzinien hatte haben können.
Diese Gedanken bereiteten dem Kind Unbehagen. Tabitha warf einen Blick zu Houghton und bemühte sich, die Tränen wegzublinzeln. Aber Houghton konzentrierte sich ganz darauf, ihre Stickarbeit wegzupacken, an der sie so unermüdlich gearbeitet hatte.
Die Kutsche kam zum Stillstand. Die Tür ging auf, und der Kutscher hob Tabitha heraus, um sie vorsichtig an der Treppe zum Eingang des Herrenhauses abzusetzen. Ehe Tabitha Zeit hatte, sich umzusehen, ergriff Houghton ihre Hand mit festem Griff und zog sie die Stufen hinauf und durch die Tür. Ein beeindruckender Mann hielt die Tür für sie auf, und Tabitha sah voller Bewunderung zu ihm auf. Er kam ihr ungeheuer groß und prächtig gekleidet vor. An seinem pfauenblauen Rock glänzten goldene Knöpfe, und Hose und Strümpfe waren fleckenlos weiß.
»So, das ist die junge Miss, Lattersby. Master Ruperts Mädchen. Ist Ihre Ladyschaft unten?«
»Das ist sie«, erwiderte der große Mann stolz. »Sie befindet sich im Chinesischen Salon. Die Countess of Huntleigh ist zu Besuch.«
Wieder wurde Tabitha von Houghton weitergezogen. Die Dienerin zog sie durch einen Flur an vielen Türen vorbei, bis sie Stimmen hörten. Die Stimmen verstummten, als Houghton und sie die letzte Tür erreichten, denn diese war geöffnet und erlaubte den Leuten im Zimmer einen guten Blick auf die Neuankömmlinge.
Beeindruckt von der Eleganz ihrer Umgebung, ließ Tabitha Houghtons Hand nicht los. Im Gegenteil, sie umklammerte die Finger der Dienerin nur noch fester. Vorwärts gezogen sah sie sich staunend um und betrachtete die üppige Ausstattung des Zimmers, das noch luftiger war als der Flur. Alles war weiß, golden und blau, von den Samtvorhängen an den Fenstern bis zum Teppich unter ihren Füßen.
Eine der Damen erhob sich von ihrem Stuhl und trat auf das Kind zu. »Ah, Houghton«, sagte sie, »ich habe dich gar nicht so früh erwartet.«
»Nein, Ma’am, aber die Straßen waren trocken und frei, und wir sind heute morgen sehr früh losgefahren.«
»Danke, Houghton«, entließ die Dame die Dienerin. Dann wandte sie sich ähnlich kühl an Tabitha. »Tritt vor, Kind, und laß dich anschauen.«
Tabitha hörte, wie die Tür hinter ihr ins Schloß fiel, und hatte das Gefühl, als wenn jetzt auch die letzte Verbindung mit ihrer Vergangenheit gekappt worden wäre. Auch wenn sie gehorsam auf die Erscheinung in lavendelfarbener Seide zutrat, brachte sie es dennoch nicht über sich, ihr ins Gesicht zu sehen. Sie sah starr geradeaus auf ein Paar plumpe weiße Hände, die üppig mit Ringen geschmückt waren.
»Ich sehe, dass du die Tochter deiner Mutter bist«, begann die Dame in einem Ton, der nicht wie ein Kompliment klang. »Du siehst ihr sehr ähnlich. Von dem armen Rupert ist nichts in deinem Gesicht.«
Dann schwieg sie einen Moment, als dächte sie nach, ehe sie fortfuhr: »Ich bin deine Tante Montecue, Kind, und du wirst jetzt bei uns auf Wroxley Manor leben. Komm, ich stelle dich deinen Cousins und den Gästen vor, denn wir haben heute Besucher hier.«
Sie wandte sich um und winkte ihre Kinder zu sich.
Tabitha hob den Blick und sah einen Jungen und ein Mädchen herankommen.
»Kinder«, erklärte Tante Montecue, »das ist eure Kusine Tabitha, die, wie ich euch schon erklärt habe, bei uns bleiben wird. Tabitha, das ist Amelia, und dies ist Richard.«
Einen Augenblick lang betrachteten sich die Mädchen schweigend. Amelia ist recht hübsch, dachte Tabitha. Sie hatte ihre langen blonden Haare mit einem blauen Band zurückgebunden, und ihr Kleid war wunderschön, blau mit Puffärmeln und mit gelben Bändern verziert. Tabitha schätzte, dass das Mädchen wohl etwas älter war als sie und der Junge noch älter, vielleicht zehn oder elf. Der Junge, groß und kräftig gebaut, war ebenfalls gut angezogen, und zum erstenmal im Leben schämte sich Tabitha ihrer eigenen Erscheinung. Sie trug noch immer das düstere schwarze Trauerkleid, das den Kontrast zwischen ihr und ihren Cousins nur betonte, und Tabitha fragte sich, was sie wohl von ihr denken mochten.
»Ich bin acht«, verkündete Amelia. »Wie alt bist du?«
Nervös und unsicher versagte Tabitha die Stimme, ehe sie antworten konnte. Der Junge, Richard, antwortete rasch an ihrer Stelle. »Ich glaube nicht, dass sie weiß, wie alt sie ist«, kicherte er. »Vielleicht kann sie auch gar nicht zählen.«
»Das reicht, Richard«, wies Lady Montecue ihn streng zurecht, ehe sie ihre Nichte ansah. »Ich glaube, Tabitha ist sechs Jahre alt.«
Tabitha nickte dankbar und sah ihrer Tante zum erstenmal voll ins Gesicht. Dabei sah sie, wie sehr die Kinder ihrer Mutter ähnlich sahen. Lady Montecue war eine robust aussehende Frau mit hellbraunem Haar und frischer Gesichtsfarbe. Sie hielt sich sehr gerade, was auf große Disziplin hindeutete, und sie sah nicht so aus, als wenn sie viel lächeln würde. Sie lächelte auch jetzt nicht, als sie Tabitha am Arm ergriff und sie zu einer Dame führte, die auf einem der blau-weißen Stühle saß, die um den Kamin herum standen.
»Wie du sehen kannst, Tabitha«, begann Lady Montecue, »haben wir heute Gäste. Dies ist Lady Huntleigh, deren Besitz an Wroxley angrenzt. Mach einen Knicks, Tabitha.«
Tabitha gehorchte und blieb dann schweigend stehen, während ihre Tante mit der Dame sprach.
»Das ist Ruperts Tochter. Ich glaube, ich habe dir die Geschichte erzählt. So eine Tragödie. Aber wie auch immer, sie haben offenbar geheiratet, so daß das Kind legal eine Montecue ist und ganz sicher auch als solche erzogen werden wird.«
»Ich habe keinen Zweifel daran, dass du das tun wirst, Minerva«, erwiderte die Dame. Dann sah sie Tabitha an, lächelte und sagte: »Willkommen in Warwickshire, Tabitha. Ich nehme an, dass du nach einer so langen Reise müde bist.«
Tabitha nickte. Die hübsche Dame gefiel ihr. Sie mochte ihre sanfte Stimme und das dunkle Haar – Haare so dunkel, wie die von Mama gewesen waren. Auch wenn ihr kirschrotes Kleid genauso prächtig war wie das ihrer Tante, kam sie ihr insgesamt doch weniger einschüchternd vor und viel freundlicher in ihrer Art. Als sie Tabitha jetzt anlächelte, lächelte das Kind scheu zurück.
»Dies sind meine Kinder«, erklärte die Countess. »Lucy ist sechs, so wie du, deshalb denke ich mir, dass ihr Freundinnen werdet, und Dominic ist zwölf.«
Tabitha betrachtete neugierig ihre Altersgenossin, und was sie sah, gefiel ihr nicht schlecht. Das Mädchen war blond, noch blonder als Kusine Amelia, und trug ein rosa Kleid, das genauso hübsch war wie Amelias blaues. Aber wichtiger noch, das Mädchen lächelte sie an und machte Platz auf dem Sofa.
»Willst du dich neben mich setzen?« fragte Lucy. »Es ist Platz genug.«
Tabitha sah ihre Tante rasch an, und als sie nichts dagegen zu haben schien, nickte Tabitha. Sie umklammerte ihre Puppe und kletterte zwischen Lucy und Dominic aufs Sofa.
Dann warf Tabitha dem Jungen einen Blick zu und sah, dass er seiner Schwester nicht im geringsten ähnelte. Seine Haare waren so dunkel wie ihre eigenen, und er sah schon recht erwachsen aus, noch älter als Richard. Tabitha dachte, dass er so aussah, als wäre er lieber woanders als im Salon ihrer Tante, und sie fragte sich, ob auch er sich durch die prächtige Ausstattung eingeschüchtert fühlte.
»Wirst du für immer hier wohnen?« fragte Lucy.
Tabitha warf ihrer Tante einen unsicheren Blick zu, ehe sie antwortete. »Ich weiß nicht …«
»Natürlich wirst du das, Kind«, warf Lady Montecue prompt ein. »Ich weiß nicht, wo du sonst leben solltest. Das ist jetzt dein Zuhause.« Dann wandte sie sich an ihre Gäste. »Pamela, ehe du gehst, lassen wir die Kinder vielleicht kurz allein. Ich möchte dir das Porträt zeigen, für das wir Henry Raeburn letztes Jahr gesessen haben. Er hat es endlich fertig, und jetzt hängt es in der Bibliothek.«
Lady Huntleigh lächelte und erhob sich. »Ich hoffe, dass es dir gefällt, Minerva. Es heißt, dass Raeburn recht frei mit seinen Modellen umgeht.«
»Das stimmt«, erwiderte Lady Montecue. »Auch wenn ich glaube, dass er sich nicht bemüht hat, uns zu schmeicheln, gefällt mir das Bild gut.« Sie wandte sich an die Kinder. »Richard, Dominic, paßt einen Moment auf die Mädchen auf. Wir sind gleich wieder da.«
Als die Damen gingen, sah Tabitha, dass sie zwar gleich groß waren, dass ihre Tante aber viel kräftiger gebaut war. Lady Huntleigh war so schlank und anmutig, wie ihre Mutter es gewesen war, und Tabithas Herz flog ihr zu. Als sie sah, wie sie im Nebenzimmer verschwand, wäre Tabitha ihr am liebsten nachgelaufen und hätte ihr Gesicht in den Falten ihres Rockes vergraben.
»Hast du Hunger, Tabitha?« Lucys Worte rissen sie aus ihren Gedanken. »Wir haben schon Kuchen gegessen, aber es ist noch etwas da. Richard hat am meisten gegessen. Er ißt mehr als Dominic.«
»Das tue ich nicht, du Lügnerin!« fuhr Richard ärgerlich dazwischen. Er sah Lucy finster an. »Außerdem ist es nicht dein Haus«, setzte er gehässig hinzu, »und es ist nicht deine Aufgabe, ihr Kuchen anzubieten. Wenn sie Kuchen will, soll sie uns fragen, nicht dich.«
Ohne auf ihn zu achten, hatte Lucy bereits selbstbewußt nach einer Platte mit Fruchttörtchen gegriffen, um sie Tabitha anzubieten. »Versuch diese«, lud sie ein, »die mag ich am liebsten.«
Tabitha hätte gerne gleich mehrere gegessen, denn sie sahen so lecker und appetitlich aus, und sie hatte Hunger. Sie wählte sich eines aus. »Danke«, sagte sie und lächelte scheu.
»Ist das deine Puppe?« fragte Lucy.
Tabitha nickte, den Mund voller Kuchen.
»Darf ich sie mir einmal ansehen?«
Tabitha zögerte kurz und reichte ihr dann die Puppe, schluckte rasch und ermahnte Lucy: »Sie vorsichtig.«
»Das werde ich. Sie ist sehr hübsch. Von wem hast du sie?«
»Von meiner Mama.«
»Kann ich sie auch sehen?« fragte Amelia.
Ehe Tabitha nicken konnte, beugte sich Richard vor, entriß Lucy die Puppe und warf sie seiner Schwester zu.
»Nicht!« Tabitha sprang auf. »Tu das nicht!«
Aber Amelia, mitgerissen von der Idee ihres Bruders, warf sie ihm wieder zurück. Tabitha sprang vom Sofa, lief zu Richard und versuchte entschlossen, aber vergeblich, ihren wertvollen Besitz zurückzubekommen.
»Gib sie ihr zurück, Richard, sonst wirst du es bereuen.«
Tabitha sah sich um und sah Lucys Bruder neben sich stehen. Dominic, der sehr wohl erkannte, dass Richard nicht daran dachte, entwand ihm die Puppe mit Gewalt.
»Du bist gräßlich, Richard Montecue«, rief Lucy. »Ich hasse dich!«
»Ich habe nur Spaß gemacht. Außerdem weiß ich ohnehin nicht, was sie darin sieht. Das Ding ist doch so schäbig.«
Mittlerweile gab Dominic Tabitha die Puppe zurück, und sie dankte ihm scheu.
»Gerne geschehen«, erwiderte er und warf Richard einen Blick zu, der Bände sprach. Tabitha erkannte, dass die beiden einander nicht ausstehen konnten.
Tabitha kletterte wieder aufs Sofa, froh, Lucy und Dominic bei sich zu haben. Sie mochte Richard nicht. Er war gemein, und seine Schwester war nicht viel besser.
Lucy kicherte, und Tabitha wandte sich um, um zu sehen, was ihre neue Freundin so amüsierte.
»Du siehst aus wie ein Kätzchen mit großen grünen Augen«, sagte Lucy und lachte wieder, und Tabitha lachte auch, weil das Mädchen so freundlich zu ihr war.
Dann kehrten die Damen zurück, ohne etwas von den Ereignissen in ihrer Abwesenheit zu ahnen. Die Countess trat auf ihre Kinder zu. »Dominic, Lucy, wir müssen jetzt gehen. Ich will zu Haue sein, ehe es dunkel wird.« Sie ergriff ihr Täschchen und einen Hut. »Danke für den guten Tee, Minerva. Die Kinder freuen sich, wenn sie Gesellschaft haben. Ich übrigens auch. Auf Wiedersehen, Richard und Amelia.« Dann wandte sie sich an Tabitha, beugte sich hinunter und sagte freundlich: »Auf Wiedersehen, Tabitha. Es freut mich, dich kennengelernt zu haben. Vielleicht kommst du mal zur Abtei rüber und spielst mit Lucy?«
Tabitha nickte.
»Gut, wir machen etwas aus.«
Nachdem Dominic und Lucy sich verabschiedet hatten, folgten sie ihrer Mutter hinaus, und Tabitha war zum erstenmal mit ihren Verwandten allein. Sie saß sehr still da, die Hände im Schoß gefaltet, und fragte sich, was wohl als nächstes geschehen würde.
Lady Montecue zog an der Klingelschnur, und fast sofort erschien ein Mädchen.
»Ah, Potter. Ich nehme an, dass meine Nichte nach der Reise müde ist. Begleite sie auf das Zimmer, das Houghton vorbereitet hat, bade sie und bring sie ins Bett. Falls sie Hunger hat, soll sie auf ihrem Zimmer essen. Das ist alles.«
Tabitha hörte zu und glitt ohne Zögern vom Sofa, um dem Mädchen zu folgen, dankbar, ihren Cousins entkommen zu können.
Als sie dem Mädchen die Treppe hoch folgte, nutzte sie die Gelegenheit, um sich umzusehen.
Der Flur war durch viele Kerzen erhellt. Die Wände waren mit Eiche getäfelt, und alles wirkte schwer, düster und ernst, nur die goldgerahmten Bilder funkelten im Kerzenlicht. Tabitha fragte sich, ob die Rahmen wohl aus echtem Gold waren. Sie hätte gerne die Dienerin danach gefragt, wollte aber ihre Unwissenheit nicht zeigen. Sie war zutiefst verunsichert von diesem neuen Leben zwischen lauter fremden Leuten.
»Jetzt sind wir gleich da, Miss Tabitha«, verkündete das Mädchen fröhlich. »All diese Stufen machen die Beine müde, nicht wahr?«
Tabitha, die in der Tat sehr müde war, konnte aus vollem Herzen zustimmen.
»Ja, aber ich nehme an, dass ich mich daran gewöhnen werde.«
Verity Potter sah auf das Mädchen neben sich herab. Sie kannte ihre Geschichte – alle Diener kannten sie –, und das arme, kleine Mädchen tat ihr leid. Ihre Ladyschaft war kein mitleidiger Mensch – nein, von ihr dürfte das Kind keinen Trost zu erwarten haben.
Schließlich hielt Verity an und führte das Kind in ein Zimmer, das sicher so groß war wie das, was sie in Devize gehabt hatte. An einer Wand stand ein Bett, daneben eine Kommode aus dunklem Holz. Ein Schaukelstuhl und ein Tisch neben dem Kamin bildeten den Rest der Einrichtung in dem einfachen Zimmer, aber Tabitha war nicht enttäuscht. Sie mochte die blaßgelben Wände, die hübschen Vorhänge und vor allem die Tatsache, dass es nur ein Bett gab und sie ihr Zimmer nicht, wie sie befürchtet hatte, mit Amelia teilen mußte.
Ihre Reisetasche war bereits ausgepackt worden, und Tabitha sah sich um, ratlos, was sie als nächstes tun sollte.
»Ihre Ladyschaft sagt, dass ich dich baden soll, und da hier keine Wanne ist, müssen wir in die Halle runter. Dort gibt es ein leeres Zimmer mit einer Wanne. Aber ich hole dir erst etwas zu essen. Hast du Hunger?«
»Ja, bitte.«
»Was möchtest du denn haben?« fragte Verity.
»Ich weiß nicht.« Tabitha sah die Magd unsicher an. »Was darf ich denn essen?«
Verity lachte. »Was du willst, denke ich. Da gibt es die Diener und die Familie. Du kannst sagen, was du haben möchtest.«
»Nun …« Tabitha dachte gründlich nach. »Ich hätte gerne etwas Toast mit Butter. Oh, und einen von den kleinen Kuchen von vorhin.«
»Gut. Warte hier, während ich Bescheid sage und die Wanne fülle. Es dauert nicht lange.«
Als Tabitha allein war, sah sie sich erst einmal gründlich um. Sie öffnete jede Schublade am Ankleidetisch und sah, dass ihre Sachen ordentlich weggepackt worden waren. Dann trat sie ans Fenster. Doch das Fenster lag zu hoch für sie, als daß sie es hätte erreichen können, und so schob sie den kleinen Tisch darunter, nur um zu entdecken, dass es zu dunkel war, um draußen etwas sehen zu können. Enttäuscht kletterte sie wieder hinunter und setzte sich aufs Bett, um auf das Mädchen zu warten. Ihr wurde kalt, und sie fragte sich, ob man sie vergessen hatte, als das lächelnde Mädchen mit einem Tablett eintrat.
Verity machte sich im Zimmer zu schaffen, während Tabitha ihr Abendbrot aß, und sprach mit ihr.
»So, und wenn du jetzt fertig bist«, sagte sie schließlich, »kümmern wir uns um dein Bad.«
Kurz darauf saß Tabitha in einer Wanne mit heißem Wasser, und Verity hatte die Ärmel aufgerollt und schrubbte sie gründlich ab.
»Es ist schrecklich, was mit deiner Ma und deinem Pa passiert ist«, sagte das Mädchen. »Das hat uns allen hier sehr leid getan.« Ohne auf das Schweigen des kleinen Mädchens zu achten, fuhr Verity fort. »Das war natürlich vor meiner Zeit, aber die Diener, die sich an Master Rupert erinnern, sagen, dass er der Beste von allen war. Und deine Ma – was für ein reizendes Mädchen. Sie sagen, du siehst genauso aus wie sie.«
Bei diesen Worten hob Tabitha ihre großen Augen zum Gesicht der Dienerin.
»Ja?« hauchte sie. »Wirklich?«
»Nun, ich habe sie selbst nie gesehen. Aber es muß wohl so sein. Lattersby, das ist der Butler, sagt, du seiest ihr wie aus dem Gesicht geschnitten, und er hat sie damals gekannt.«
Tabitha lächelte wehmütig, und dann rollten ihr zu Veritys Bestürzung Tränen über die Wangen.
»Oh, Miss! Ich wollte dich nicht aufregen, du armes Ding! Komm, ich trockne dich ab, und dann geht es ins Bett.« Sie wickelte Tabitha in ein großes Handtuch und trug sie in ihr Zimmer hoch, zog ihr ein Nachthemd über und deckte sie und die Puppe dann gut zu.
»Es wird schon alles gut werden«, tröstete sie Tabitha dabei. »Sie werden gut zu dir sein, und dann wirst du wieder fröhlich.« Verity drückte dem Kind die Hand, blies die Kerze aus und wandte sich zum Gehen. Verity Potter war ein freundliches Mädchen, und die Kleine tat ihr leid. Sie hätte gerne gewartet, bis Tabitha eingeschlafen war, aber sie wußte, dass sie unten gebraucht wurde. Die Herrin würde nicht wollen, dass sie hier oben trödelte. Also schlüpfte sie aus dem Zimmer und hoffte, dass die Kleine schnell einschlafen würde.
Doch Tabitha konnte nicht einschlafen. Sobald Verity weg war, schwappte eine gewaltige Welle der Einsamkeit über sie hinweg, und sie begann zu weinen. Sie weinte um ihren Vater und um ihre Mutter, vor allem aber um sich selbst, weil sie dazu verurteilt war, an diesem kalten, unfreundlichen Ort zu leben, zusammen mit ihren feindseligen Verwandten. Sie wußte, dass Amelia und Richard sie nicht mochten – sie konnte den Haß in Richards Augen sehen. Sie wußte, dass er vorhin nur aufgehört hatte, weil er Angst vor den Gästen gehabt hatte, und sie fürchtete sich vor dem, was er tun könnte, wenn er sie allein erwischte. Tabitha rollte sich im Bett zusammen, umklammerte ihre Puppe und schlief erschöpft ein.
Kapitel 2
Die Sonne schien heiß, selbst für Mitte Juli, und die Landschaft war satt und grün. Seit Wochen hatte keine Wolke den blauen Himmel getrübt, und die Temperatur stieg mit jedem Tag höher.
Tabitha lag auf dem Bauch und streckte die Hand aus, bis sie das Wasser gerade eben berühren konnte. Langsam ließ sie ihre Finger im Wasser hin und her gleiten und fragte: »Glaubst du, dass sie uns bis hierher folgen können?«
»Das ist mir egal«, erwiderte ihre Begleiterin sorglos, »denn ich lasse sie nicht mitmachen, wenn ich nicht will. In meinem Haus müssen sie mir gehorchen, und das hier ist unser Spiel.«
Lucy Rees lag ebenfalls lang ausgestreckt auf der kleinen hölzernen Brücke. Sie hatte die Ärmel aufgerollt und zupfte an einer Seerose, um sie näher an sich heranzuziehen, denn eine Libelle war darauf gelandet, und sie wollte sie genauer betrachten.
»Ich hoffe, dass morgen wieder die Sonne scheint«, murmelte Tabitha schläfrig. Sie hatte die Augen geschlossen und lag fast dösend da. »Es wird Unmengen von Erdbeeren geben, und Mrs. Glastonbury bereitet einen speziellen Punsch zu. Ich bin froh, dass du diesen Sommer nicht weg bist, Lucy«, fuhr Tabitha dann fort. »Ohne dich und Dominic wäre es nur halb soviel Spaß.«
»Nun, wenn du nicht auf Wroxley wärst, würde ich morgen nicht kommen wollen, Tabby, und das ist die Wahrheit«, erwiderte Lucy gefühlvoll. »Amelia ist so eine Langweilerin, und oh! Sie ist weg.« Lucy schlug ärgerlich aufs Wasser.
»Was war das?« Tabitha saß jetzt hellwach da und spähte in das trübe Wasser.
»Eine Libelle.«
»Sieh doch, Lucy!« rief Tabitha aus. »Kaulquappen! Ich wünschte, wir hätten etwas, worin wir sie fangen könnten.«
Lucy setzte sich auf und zog Schuhe und Strümpfe aus. »Wenn wir im Flachen bleiben, können wir vielleicht ein paar mit der Hand fangen. Komm, Tabby!« rief sie ungeduldig, die Füße bereits im Wasser.
Doch Tabitha, notgedrungen vorsichtiger, zögerte. »Sollen wir wirklich? Was ist, wenn jemand kommt?«
Lucy sah auf. »Wen kümmert es, was sie denken?« fragte sie trotzig, viel zu geliebt und verwöhnt, um zu verstehen, was hinter der Sorge ihrer Freundin stand. »Komm schon, Tabby. Es lohnt sich, auch wenn wir hinterher ausgeschimpft werden.«
Tabitha wußte nur zu gut, was ihre Tante Montecue sagen würde, wenn sie sie mit bloßen Beinen im See erwischen würde, aber die Damen tranken auf der Terrasse der Abtei Tee, und die Aussicht auf das kühle Wasser war zu verlockend …
Mehr als zwei Jahre waren vergangen, seit Tabitha voller Kummer und Verwirrung im Haus ihrer Tante eingetroffen war, und seit jenem ag hatte sie keinen Grund gehabt, den ersten Eindruck, den sie von ihren Verwandten gehabt hatte, zu korrigieren. Ihre Tante Montecue hatte sich als genauso streng erwiesen, wie Tabitha es von Anfang an vermutet hatte. Streng, diszipliniert und ohne eine Spur Geduld für jedes Kind, das nicht ihres war, hatte sie Tabitha niemals auch nur einen Funken Wärme entgegengebracht. Tabitha hatte es gelernt, damit zu leben, und auch wenn sie sich zuweilen nach einer mütterlichen Frau in ihrem Leben sehnte, so hatte sie doch auch gelernt, dass sie, wenn sie ihrer Tante aus dem Wege ging – was nicht schwer war, denn Lady Montecue zeigte keinerlei Verlangen danach, ihre Nichte um sich zu haben – und wenn sie sich brav zeige, Ermahnungen und härteren Strafen entgehen konnte.
Nein, nicht ihre Tante war ihr Hauptproblem. Die Geißel ihres Lebens hier war Richard. Richard war boshaft und grausam, und sein Einfallsreichtum kannte keine Grenzen, wenn er ihr Harm zufügen konnte. Das Schulzimmer war noch sicher – unterband hier doch die Gegenwart der Gouvernante Miss Plumridge ärgere Streiche und Gemeinheiten –, aber sobald der Unterricht vorüber war, war Tabitha verletzlich.
Sie versuchte, Richard soviel wie möglich aus dem Weg zu gehen, blieb im Schulzimmer und las, während Miss Plumridge nähte oder Briefe schrieb. Aber wann immer Richard Tabitha unbewacht und ohne Erwachsene in der Nähe antraf, quälte er sie. Manchmal ragte er nur drohend über ihr auf und sprach davon, was er ihr alles antun wolle, und seine grausamen Worte ließen Tabitha zurückschrecken, als hätte er ihr wirklich Gewalt angetan. Dann wieder tat er ihr wirklich weh. Er packte ihr Haar und wand es sich um die Hand, bis ihr die Tränen in die Augen traten, oder er schubste sie und stieß sie zu Boden.
Tabitha hatte rasch gemerkt, dass Amelia ihr nicht helfen würde, denn sie zog sich sofort zurück, wenn sie Ärger ahnte, so daß Tabitha sich so gut sie konnte selbst verteidigen mußte. Immer wieder wurde Tabitha zu ihrer Tante gerufen, wo sie sich eine Predigt darüber anhören mußte, wie undankbar sie war, mit Frechheit die Güte zu vergelten, dass ihre Familie sie aufgenommen hatte. Auf diesen Vortrag folgten gewöhnlich zwei Schläge mit einer Ledergerte auf die Handfläche, und danach wurde Tabitha auf ihr Zimmer geschickt. Nein, es war besser, nicht von Richards Benehmen zu sprechen. Das machte die Dinge nur noch schwieriger.
Doch Tabithas Leben barg nicht nur Härte und Unterdrückung. Ihre Besuche auf Breckenbridge Abbey und ihre Freundschaft mit Lucy waren Balsam für ihre Wunden. Die junge Lady Lucy war witzig und offen, und Tabitha betete sie an. Und sie betete Dominic an.
Dominic war nur in den Ferien zu Hause, aber in seiner Gegenwart empfand Tabitha allergrößte Sicherheit. Denn Richard, das hatte Tabitha schnell gemerkt, hatte vor Dominic mehr Angst als vor irgend jemand sonst. Außerdem war alles, was ein sechs Jahre älterer Junge tat, für Tabitha interessant. Er hatte ihr beigebracht, wie man Vogelnester in den Hecken vor dem Haus fand, wie man fischte und Kaulquappen fing. Er hatte sogar erlaubt, dass Lucy und sie mit ihm Kricket spielten. Dieses Spiel mochte sie am wenigsten, denn insgeheim fürchtete sie den harten Ball, wenn er mit kräftigen Schlägen über den Boden befördert wurde, aber sie hätte noch ganz andere Dinge ertragen, wenn sie dafür in seiner Gesellschaft sein durfte. Und so wurde Tabitha, wann immer sich die Gelegenheit dazu ergab, Dominics Schatten.
Deshalb geschah es auch ohne das geringste Zögern, daß Tabitha Dominic heftig zuwinkte, als sie mit gehobenen Röcken bis zu den Knien im Wasser stand und er zwischen den Bäumen hervortrat.
»Was zum Teufel macht ihr da?« rief Dominic.
»Wir haben von der Brücke aus Kaulquappen gesehen«, erklärte Tabitha.
»Nun, ihr kommt besser mit. Alle suchen nach euch.«
»Noch nicht«, bat Lucy. »Wir haben noch gar keine gefangen.«
Ihr Bruder grinste. »Ihr schafft es höchstens, dass ihr sie alle verjagt. Wißt ihr denn gar nichts?«
»Kannst du uns nicht helfen, Dominic?« flehte Lucy gekonnt. »Bitte?«
Dominic dachte einen Moment nach, doch dann fiel sein Blick auf Tabitha.
»Heute nicht. Wie gesagt, sie suchen euch schon.«
Lucy öffnete den Mund, um zu widersprechen, aber Dominic hatte sehr entschieden geklungen, und sie wußte, dass es keinen Sinn hatte, darauf zu beharren. Gehorsam machten sich die Mädchen auf den Weg zum Ufer. Sie waren fast dort, als Lucy, die voranging, etwas im Wasser wirbeln sah und die Balance verlor. Lucy schlug um sich, griff instinktiv nach Tabithas Schulter und ging mit ihr zusammen zu Boden. Sie waren nur eine Sekunde unter Wasser, ehe sie prustend und spuckend erst auf die Knie und dann wieder auf die Füße kamen. Eher erschrocken denn verletzt begann Lucy zu weinen, und Tabitha schob rasch ihre Hand in die ihrer Freundin.
»Nicht, Lucy«, bat sie, »weine doch nicht.« Sie hatte Lucy noch nie zuvor aufgeregt erlebt, und der Anblick verstörte sie. »Sieh, dort ist Dominic, er wird dir helfen.«
Immer noch schluchzend ließ Lucy es zu, dass ihr Bruder sie hochhob und an Land trug.
»Sag mal! Was habt ihr denn angestellt?« durchschnitt da Richard Montecues Stimme die Stille. Er erschien mit den Händen in den Hosentaschen am Ufer und betrachtete die kleine Gruppe voller Schadenfreude.
Tabitha zuckte beim Klang seiner Stimme zusammen, was Dominic nicht entging, der Lucy absetzte und sich neben Tabitha kniete. »Geht es dir gut?«
Sie nickte.
»Gut. Keine Sorge, um Richard kümmere ich mich. Geh mit Lucy und suche deine Schuhe, dann wartet auf mich.«
Richard trat einen Schritt auf sie zu. »Jetzt bekommst du aber Ärger, Dominic Rees. Solltest du nicht auf sie aufpassen?« Seine Stimme klang lässig, aber seine Augen verrieten seine Genugtuung. Es war immer riskant, Dominic zu reizen, was Richard sehr wohl wußte.
»Nein, ich kann mich nicht erinnern, dass man mich darum gebeten hat«, erwiderte Dominic kalt. »Aber gut, dass ich es getan habe, nicht wahr? Wer die Probleme haben wird, bist du, wenn du Ärger machst, verstanden?«
Richard wurde durch die Rückkehr der durchnäßten Mädchen einer Antwort enthoben. Lucys Tränen waren versiegt, und sie sah wieder fröhlich drein, aber Tabithas Augen, groß in ihrem blassen Gesicht, sprachen von einer anderen Stimmung, und Dominic empfand plötzlich Hilflosigkeit. Selbst wenn er Richard soweit brachte, das Mädchen in Ruhe zu lassen, würde es eine strenge Strafpredigt von ihrer unbeugsamen Tante ertragen müssen.
Und er hatte recht. Sobald sie an der Abtei eintrafen, wo die Damen auf der Terrasse Tee getrunken hatten, hob Lady Montecue beim Anblick ihrer Nichte entsetzt die Hände und befahl dem zitternden Kind, sofort in die Kutsche zu steigen.
Auf dem kurzen Weg nach Hause wurde kein Wort gesprochen, aber sobald sie im Haus waren, wandte Lady Montecue sich an ihre Nichte und sagte in ihrer kalten Art: »Ich will dich sofort in meinem Salon sehen.« Dann wandte sie sich an ihren Sohn und fuhr fort: »Da du wohl Zeuge dieses Debakels warst, sollst du auch kommen. Vielleicht kannst du mir sagen, was sich in Wahrheit abgespielt hat.«
Als Tabitha kurz darauf in nassen Kleidern vor ihre Tante und Richard erschien, verließ sie auch der letzte Rest Mut.
»Nun, Miss, was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen?« begann Lady Montecue.
Tabitha ertrug es nicht, die kalte Wut im Gesicht ihrer Tante zu sehen, und hob den Blick nicht vom Boden, während sie verzweifelt überlegte, was sie sagen sollte. Sie wußte, dass ihre Tante ihr das Waten im Wasser nicht erlaubt hätte, aber sie hatte gehofft, unentdeckt damit davonzukommen. Aber das wäre Verrat gewesen, und Verrat mußte bestraft werden. Das hatte Reverend Hall erst letzten Sonntag in seiner Predigt gesagt. Warum war nur alles verboten, was Spaß machte?
Lady Montecues scharfe Stimme unterbrach ihre Überlegungen. »Tabitha scheint nicht die Absicht zu haben, etwas zu erklären oder sich zu entschuldigen. Vielleicht kannst du mir eine Erklärung geben, Richard.«
»Ja, Ma’am. Tabitha und Lucy waren beide im Wasser. Tabitha muß Lucy hineingestoßen haben, denn sie hat geweint, und Dominic mußte ihr heraushelfen …«
»Nein! So war es nicht!« stieß Tabitha hervor, als Richards Ungerechtigkeit ihr den Mut verlieh, für sich selber zu sprechen. »Sie – sie hat geweint, weil sie untergegangen ist. Wir sind beide untergegangen.«
»Aber du hast nicht geweint«, warf Richard ein. »Du hattest keine Angst. Du hast sehr zufrieden mit dir ausgesehen.«
»Nein! Das stimmt nicht!« Tabitha sah ihre Tante verzweifelt an. »Es tut mir leid, Tante Montecue. Wir sind nur gewatet, und ich weiß, dass ich das nicht hätte tun dürfen, aber ich wollte nicht hineinfallen – es war ein Versehen.«
»Ich denke, ich habe genug gehört«, entgegnete Lady Montecue schließlich. »Da ich dich kenne, hätte ich etwas Derartiges erwarten können. Ich hätte dir nie erlauben dürfen, auf Beckenbridge herumzustreifen und Lucy zu verderben. Ich bin selbst schuld, aber du hast uns nicht nur vor den Augen der Countess blamiert, sondern mich auch vor einer Freundin beschämt. Ich hoffe um deinet- und um Lucys willen, dass sie dadurch nicht krank wird. Wenn man naß wird, kann man sich sehr leicht erkälten. Wir können nur beten, dass das nicht geschieht.« Sie schwieg und wandte sich dann an ihren Sohn. »Du kannst jetzt gehen, Richard.«
Als sich die Tür hinter ihm geschlossen hatte, ergriff sie die Lederpeitsche und sah Tabitha an. »Streck die Hand aus.«
Tabitha gehorchte nur mit leichtem Zögern, denn sie wußte, dass die Folgen noch viel schlimmer waren, wenn sie sich weigerte zu tun, was ihre Tante von ihr verlangte. Dann schloß sie die Augen und wappnete sich gegen den Schmerz, den ihre Tante ihr gleich zufügen würde.