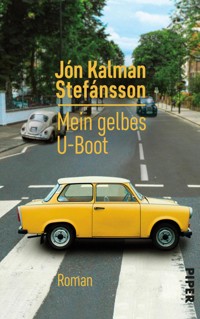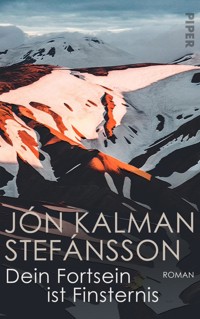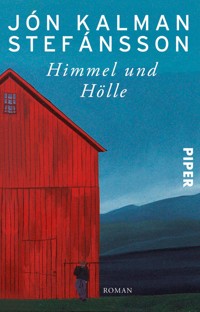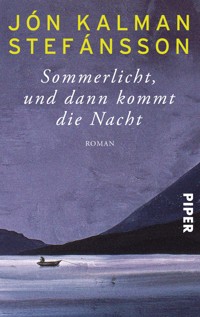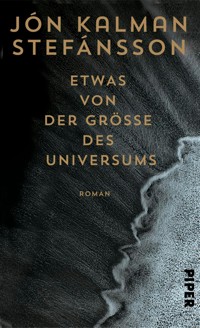11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Jón Kalman Stefánsson gehört zu den wichtigsten isländischen Gegenwartsautoren. Sein neuer Roman »Das Herz des Menschen« erzählt die Geschichte des "Jungen", seines sensiblen, aufmerksamen Helden, der nach einem dramatischen Unglück in einem Fischerort wieder zu sich kommt: Während vor der Küste auf dramatische Weise ein großes Handelsschiff versinkt, widmet er sich voller Neugier den Romanen von Charles Dickens und wird bei erster Gelegenheit von der leidenschaftlichen Ragnheidur verführt. Als er aber zwei rätselhafte Briefe von der rothaarigen Alfheidur erhält, macht er sich mit dem Boot auf zu ihr, um herauszufinden, was sie ihm wirklich sagen will. »Jón Kalman Stefánsson schreibt Geschichten wie das Leben selbst, mit großer Meisterschaft gelingt ihm ein großes Werk. Sein Roman ist wie der Rhythmus des Herzens – der Anfang von allem.« Morgunbladith
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Die Romantrilogie Himmel und Hölle, Der Schmerz der Engel und Das Herz des Menschen ist den Schwestern Bergljót K. Þráinsdóttir (1938–1969) und Jóhanna Þráinsdóttir (1940–2005) sowie María Karen Sigurðardóttir gewidmet
Übersetzung aus dem Isländischen von Karl-Ludwig Wetzig
Die Originalausgabe erschien 2011 unter dem Titel »Hjarta Mansinns« bei Bjartur, Reykjavík. Die Verse von Walt Whitman in Kaptitel XVIII sind folgender Ausgabe entnommen: Walt Whitman, »Grasblätter«, Carl Hanser Verlag, München 2009.
Dieser Abdruck erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Carl Hanser Verlags.
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
1. Auflage 2013
ISBN 978-3-492-96168-4
© Jón Kalman Stefánsson, 2011 Deutschsprachige Ausgabe: © 2013 Piper Verlag GmbH, München Published by agreement with Leonhardt & Høier Literary Agency A/S, Kopenhagen, Dänemark. Umschlaggestaltung: Cornelia Niere, München Umschlagabbildungen: bridgeman archives / Boissegur, Beatrice Datenkonvertierung: CPI – Clausen & Bosse, Leck
Das sind die Geschichten, die wir erzählen sollten
Der Tod ist weder Licht noch Dunkelheit, er ist nur alles andere als Leben. Manchmal stehen wir Sterbenden in ihrer letzten Stunde bei und sehen zu, wie das Leben aus ihnen weicht; jedes Leben ist ein Universum, und es tut weh zu sehen, wie es verschwindet, wie es sich von einem Moment auf den anderen in Nichts verwandelt. Jedes Leben verläuft anders, flach und ereignislos bei den einen, reich an Abenteuern bei anderen, und dennoch ist jedes einzelne Bewusstsein eine Welt, die von der Erde bis in den Himmel reicht. Wie aber kann etwas so Großes einfach verschwinden, zu einem Nichts werden, von dem nicht einmal Schaum oder wenigstens ein Echo zurückbleibt? Es ist schon lange her, dass jemand zu unserer Schar gestoßen ist, wir sind blutleere Schatten, nein, weniger als Schatten, und es ist furchtbar, tot zu sein und dennoch nicht sterben zu dürfen, das ist für niemanden gut. Immer wieder haben einige von uns versucht, sich davonzumachen, haben sich vor immer größer werdende Autos geworfen oder wollten sich von wütenden Hunden zerfleischen lassen, aber die Hundezähne schnappten durch uns hindurch wie durch Luft. Wie kann man denn weniger als nichts sein und sich gleichzeitig an alles erinnern, tot sein und sich doch lebendiger fühlen als je zuvor? Abends siehst du uns auf dem Friedhof hinter der Kirche kauern, die sich seit einem Jahrhundert an dieser Stelle befindet, wenn es auch verschiedene Gebäude waren – unsere Kirche, in der Pastor Þorvaldur leider ohne großen Erfolg versucht hat, Vergebung für seine Schwächen zu finden, denn die Stärke eines jeden Menschen wird ausschließlich an seinen Schwächen gemessen, daran, wie sie sich an ihnen bewährt. Inzwischen ist die mit Wellblech verkleidete Kirche aus Holz längst verschwunden, und an ihre Stelle ist eine andere aus Stein getreten, dem Baumaterial aus den Bergen, was sehr gut passt, denn an solchen Orten sollte man eine Kirche entweder dem Himmel oder den Bergen nachbilden. Die einzigen Momente, in denen wir einen Anflug von Frieden finden, sind die auf dem Friedhof. Hier glauben wir das Murmeln der Toten unten in der Erde zu vernehmen, einen fernen Nachklang guter Gespräche. So kann die Verzweiflung einen täuschen. Diese friedlichen Augenblicke sind nach und nach mehr geworden, sie scheinen auch länger zu dauern, sind von Sekundenbruchteilen auf Sekunden angewachsen. Es geht uns nicht direkt gut, aber die Worte halten uns warm, sie geben uns Hoffnung; denn wo es Worte gibt, da gibt es auch Leben. Empfange sie, und es gibt uns. Nimm sie auf, und es gibt Hoffnung. Das sind die Geschichten, die wir erzählen sollten. Geh nicht weg!
In einem alten arabischen Buch der Heilkunst heißt es, das menschliche Herz bestehe aus zwei Kammern, von denen die eine Glück heißt und die andere Verzweiflung. Welcher sollen wir glauben?
I
Wo hören die Träume auf, wo fängt die Wirklichkeit an? Die Träume kommen von innen, sie sickern aus der Welt hervor, die wir alle in uns tragen, wahrscheinlich verdreht und verzerrt, aber was ist nicht verdreht, was ist nicht schief? Heute liebe ich dich, morgen hasse ich dich – wer immer derselbe ist, belügt die Welt.
Der Junge liegt lange mit geschlossenen Augen da, unsicher, ob Tag oder Nacht herrscht, ob er wacht oder schläft. Er und Jens sind auf etwas Hartes gestoßen. Erst haben sie Hjalti verloren, den Knecht, der sie von Nes begleitet hat. Sie haben den Sarg mit Ásta über Berge und Heiden geschleppt. Dann waren Jens und der Junge auf etwas Hartes gestoßen. Wie viel Zeit ist seitdem vergangen? Wo befindet er sich? Zögernd öffnet er die Augen, denn man weiß nicht sicher, was einen nach dem Schlafen erwartet, Welten ändern sich in einer Nacht, Leben erlöschen, der Abstand zwischen den Sternen wächst, und das Dunkel breitet sich aus. Er öffnet zögernd und vorsichtig die Augen und liegt in einem von Mondlicht erhellten Zimmer, liegt in totenbleichem Mondlicht da, und auch das Gesicht von Hjalti, der auf einem Stuhl sitzt und den Jungen reglos ansieht, ist unangenehm bleich. Neben dem Bett steht Ásta, und ein kühler Hauch geht von ihr aus.
Du kommst wohl immer mit dem Leben davon, sagt Hjalti langsam.
Ja, es gibt immer jemanden, der bereitsteht, ihm wieder auf die Beine zu helfen, sagt Jens. Er sitzt im Bett neben dem des Jungen, und das Mondlicht hat ihm eine Totenmaske geschneidert.
Aber jetzt hilft dir keiner, sagt Ásta.
Nein, sagt Jens, er hat es auch nicht verdient.
Was hätte er auch vorzubringen, welches Recht hat er, zu leben?, fragt Hjalti.
Der Junge öffnet den Mund, um zu antworten, um etwas zu sagen, aber etwas Schweres lastet auf seiner Brust, so schwer, dass er kaum sprechen kann, und dann beginnen sie zu verschwinden, sie lösen sich langsam auf, das Mondlicht wird zu endlosem Schnee und das Zimmer zu einer kalten Heide, die die Welt ausfüllt. Der Himmel ist eine dicke Eishöhle über allem.
II
Lassen sich die Augen gefahrlos öffnen? Vielleicht hat er gar nicht geschlafen, vielleicht dauert nur das Sterben so lange. Er hört weder den Wind noch das Pfeifen über den Schneewehen, und er spürt auch die Kälte nicht. Ich bin wohl im Schnee eingeschlafen, das ist der Schlaf, der zum weichen, tröstenden Tod wird. Ich kann nicht mehr gegen ihn ankämpfen, denkt der Junge, und jetzt hilft mir auch keiner mehr. Ásta hat ja recht, warum kämpfen, wenn das Beste sowieso vorbei ist? Aber ich soll doch Unterricht bekommen. Gísli, der Schulrektor, soll mir etwas beibringen, ist es da nicht Verrat, zu sterben? Muss ich nicht doch weiterkämpfen? Und liegt er nicht in einem Bett? Es fühlt sich an wie ein weiches Bett, komisch. Vielleicht liegt er in seinem Bett in Geirþrúðurs Haus und hat alles nur geträumt, den ganzen Marsch mit Jens durch Sturm und Schnee, aber kann man so viel Schnee wirklich träumen, so viel Wind, so viele Leben und Tode, sind Träume groß genug für all das? Er kann die Augen nicht öffnen, die Lider sind schwer wie Steinplatten. Er versucht, seine Umgebung zu ertasten, schickt die Hände auf Entdeckungsreise, aber die sind genauso nutzlos wie die Augen, er fühlt sie nicht einmal, vielleicht sind sie tot, abgestorben, die Kälte hat sie abgefressen, und sie liegen wie ein Haufen kleiner Stöcke im Schnee. Jens, wo bist du?, denkt oder murmelt er, sinkt dann wieder in Schlaf zurück, wenn es denn Schlaf ist und nicht der Tod, sinkt in Ruhe, sinkt in Albträume.
III
Hast du dir überlegt, ob du leben oder sterben willst?, fragt sie. Die Frau oder das Mädchen hat rote Haare, die Toten sind rothaarig.
Ich weiß es nicht, antwortet er, ich bin mir nicht sicher, ob ich den Unterschied kenne, und ich weiß auch nicht, ob er überhaupt so groß ist.
Ich werde dir einen Kuss geben, sagt sie, dann spürst du den Unterschied. Wenn du bei dem Kuss nichts fühlst, bist du ganz sicher tot.
Sie tritt nah an ihn heran, beugt sich über ihn, ist so rothaarig, dass es kaum wahr sein kann, und ihre Lippen sind warm und weich. Wo ist Leben, wenn nicht in einem Kuss?
IV
Halbdunkel herrscht um den Jungen, als er aufwacht, eigentlich kaum mehr als Dämmerlicht. Er liegt in einem weichen Bett unter einer warmen Decke, die nach Frühlingsluft duftet. Da sind auch seine Hände, sie warten treu und geduldig auf ihn, die Kälte hat sie nicht abgefressen, er kann sie anheben und die Finger bewegen, ein wenig steif sind sie, wie taube Greise, aber dort, wo sie hingehören.
Bestens, murmelt er.
Hinter Gardinen zeichnen sich zwei Fenster ab, und ganz in der Nähe hört er tiefe Atemzüge. Er sammelt Mut und Kraft, um sich auf die Ellbogen zu stützen und sich dann umzublicken. Er befindet sich in einem recht geräumigen Zimmer, in dem ein weiteres Bett steht. Darin liegt ein Mann und atmet, es ist Jens. Sie haben also beide überlebt. Doch wie findet man heraus, dass man lebendig und nicht tot ist? So offensichtlich ist das nicht immer. Er denkt nach, hebt dann den Zeigefinger der Rechten, beißt fest hinein und fühlt, dass es wehtut. Demnach sollte der Finger am Leben sein; das ist doch schon mal was. Bedeutend schwerer fällt es ihm aufzustehen, ihm wird schwindlig, und er sollte besser liegen bleiben. Der Mensch hat einen grundlegenden Fehler begangen, als er sich auf die Hinterbeine aufrichtete; damit hat das Tauziehen zwischen Himmel und Hölle angefangen. Der Fußboden ist kalt, und der Junge geht steifbeinig zu Jens hinüber, beugt sich über ihn, beobachtet seine Atemzüge und setzt sich dann beruhigt auf die Bettkante. Gut, dass dieser schwierige, schweigsame Mensch am Leben ist, da wird seine Schwester nicht bei fremden Leuten angebunden und getreten.
Der Junge hört jemanden kommen, und eine kleine Frau tritt ein. Ihr Gesicht ist so streng, als würde sie nichts Gutes vom Leben erwarten.
Du bist wach, stellt sie fest. Könnte sie die Frau aus dem Traum sein, die ihn geküsst hat, trotz ihrer strengen Miene und obwohl sie mindestens zwanzig Jahre älter ist?
Was bin ich?, fragt er.
Woher soll ich das wissen?
Ich meine, wo?
Im Haus des Arztes in Sléttueyri. Wo solltet ihr denn sonst sein?
Das ist nicht die Stimme aus dem Traum. Diese Frau ist kein Traum, sondern eher ein Strick, fest und hart.
In Sléttueyri, wiederholt er langsam, wie um den Geschmack dieses Namens zu prüfen, zu dem sie zwei Tage und Nächte unterwegs waren, und die Ruhe nach dem Sturm. Er hat es also geschafft. Er und Jens haben es geschafft. Und Hjalti?
Sie stützt die Hände in die Hüften, ihre Augen stehen eng beieinander, und sie wirkt ungeduldig, vielleicht weiß sie, wie kurz das Leben eines Menschen ist; der Himmel wechselt die Farbe, und schon ist er tot.
Wir haben es also geschafft, sagt der Junge, als würde er mit sich selbst reden.
Sieht so aus, sagt die Frau.
Aber wie sind wir hier hereingekommen und … ins Bett? Ich meine, Jens und ich. Ich erinnere mich an nichts.
Du erinnerst dich nicht? Dafür hast du aber viel geredet.
Ich habe geredet?
Hast angefangen, sobald du ins Warme gekommen bist. Zu verstehen war kaum etwas, und obendrein wolltest du wieder raus in die Kälte, und zwar splitterfasernackt. Wir mussten dich festhalten. Ja, ihr wart nackt. Wir mussten euch doch die steif gefrorenen Sachen ausziehen und euch warm rubbeln.
Sie ist an die Fenster getreten, zieht mit einer raschen Bewegung die Vorhänge auf, und das Tageslicht strömt herein.
Wo ist Hjalti?, fragt der Junge, als er sich halbwegs an die Helligkeit gewöhnt hat.
Hjalti, wiederholt sie auf dem Weg nach draußen. Ich habe keine Ahnung. Dein Gerede hat zehn Männer in die Nacht hinausgejagt, und sie sind nur knapp einer Lawine entgangen.
Warte, ruft der Junge, als sie ihm den Rücken zudreht.
Als ob ich dafür Zeit hätte, sagt sie und geht.
Sie lässt die Tür angelehnt, ihre kurzen, schnellen Schritte entfernen sich, kurz darauf sind leise Stimmen zu hören. Jens atmet so flach, dass man es Stille nennen könnte, als wäre der große Mann endlich mit dem Leben versöhnt. So kann uns der Schlaf täuschen. Wie lange haben sie geschlafen? War es Nacht, als sie auf das Haus stießen? Der Junge steht vorsichtig auf, die Beine tragen ihn, aber sie fühlen sich nicht gut an, sind beträchtlich gealtert, das rechte bestimmt um Jahrzehnte. Draußen ist es einigermaßen hell, es dürfte auf Mittag zugehen, das heißt, er hat mindestens zwölf Stunden geschlafen, kein Wunder, dass er so benommen ist. Es ist bedeckt, weiterer Schneefall scheint aber nicht bevorzustehen, es ist windig und kalt, hier und da lässt der Wind den Schnee aufstieben, wie zum Zeitvertreib, aber in keiner Richtung ist die Sicht verdeckt, da liegt das Meer, bleigrau und schwer, und wälzt sich zwischen den Bergen. Er schaut nach rechts, wo sich der offene Ozean ausbreitet, weniger aufgewühlt in seiner Unendlichkeit. Die Berge sind weiß, zu weit weg, um bedrohlich zu wirken, völlig weiß, bis auf einige Felsgürtel, die pechschwarz sind wie Tore zur Hölle. Er fährt sich leicht mit der Fingerspitze über die Lippen, als wollte er einem Kuss nachspüren. War das nur ein Traum, der Kuss, die Stimme, die roten Haare, die Wärme?
Es ist kalt am Fenster. Frost und Schnee hauchen durch die dünne Scheibe. Er sieht ein paar schneeverklebte Gebäude, kalte Gehäuse, die Leben enthalten. Er beugt sich vor, und da kommt die Kirche ins Blickfeld. Ob Ásta da drin liegt und darauf wartet, endlich unter die Erde zu kommen? Und wo mag Hjalti sein? Der Junge späht nach draußen, als hoffe er, Hjalti zwischen den verschneiten Häusern herumhuschen zu sehen, vielleicht auf der Suche nach Bóthildur.
Das Leben dreht sich darum, einen anderen Menschen zu finden, mit dem man zusammenleben möchte, und anschließend diesen Fund zu überleben, heißt es in einem berühmten Buch, und das hört sich geistreich an, aber es greift zu kurz, denn es muss doch viel schwerer sein, allein zu leben als mit einem anderen Menschen. Wir kommen allein zur Welt, und wir sterben allein, da wäre es schrecklich, auch noch allein zu leben.
Der Junge versucht an Ragnheiður zu denken, die Tochter von Friðrik, der Tryggvis Handelsniederlassung führt. Sie wollte im Sonnenschein ausreiten. In diesem Moment kommt jemand mit schweren Schritten die Treppe herauf. Der Junge will schnell ins Bett zurück, unter den Schutz der Decke, bleibt aber stehen, will wieder zum Fenster, hält doch wieder inne und steht mitten im Zimmer, als ein Mann mittleren Alters eintritt. Die Dielen knarren unter seinem massigen Leib, er ist recht beleibt, hat eine Halbglatze, aber mächtige Koteletten, trägt ein Wolljackett samt Weste, die Nase ist auffällig gerötet, die stahlblauen Augen liegen tief in den Höhlen und lassen die Nase noch größer erscheinen.
Es stimmt also, du bist aufgewacht, stellt er fest. Seine Stimme klingt dunkel, ein bisschen verbraucht oder abgenutzt, und er seufzt müde.
Gut, dass du dich ausruhen konntest, sagt eine Frau, die an die Seite des Mannes tritt. Sie ist einen Kopf kleiner und bedeutend jünger als er, vielleicht zwanzig Jahre. Sie ist schlank, hat üppiges, blondes Haar und eine so offene Miene, dass der Junge gleich wieder an Sonnenschein, Sommer und helle Juninächte denkt. Ob die noch einmal wiederkommen? Die andere Frau, die so hart ist wie ein Strick, lehnt am Türrahmen und verschränkt die Arme über ihrem üppigen Busen. Na, scheint ihr Augenausdruck zu sagen, da seht ihr’s. Und was jetzt?
Einige Augenblicke steht der Junge ungeschützt in der Mitte des Zimmers, in der wollenen Wäsche eines anderen, die ihm viel zu groß ist; das Leben scheint sich alle erdenkliche Mühe zu geben, ihn kleinzumachen. Der Mann schiebt den Daumen in den Hosenbund, macht Jaja, und die blonde Frau sagt: Ruh dich aus. Da trottet er zum Bett und legt sich hin.
Du hilf mal bei der Suppe, sagt sie, ohne den Blick von dem Jungen zu wenden. Die andere Frau öffnet die verschränkten Arme und verschwindet, es sind nur noch ihre Schritte zu hören, die sich entfernen.
Und du solltest am besten liegen bleiben, sagt die blonde Frau zu dem Jungen, nimmt auf der Bettkante Platz und altert mit dem Näherkommen. Kleine Fältchen wie Spuren von den Krallen der Zeit in ihrem Gesicht.
Ólafur möchte dich kurz untersuchen, anschließend darfst du uns gern von eurer Wanderung erzählen und von der armen Ásta. Die Leute denken und sprechen kaum von etwas anderem, seit ihr mit einem Knall, wie man wohl sagen darf, hier im Dorf erschienen seid, du und der andere Mann. Sie wirft schnell einen Blick zu Jens hinüber.
Mich untersuchen?, fragt der Junge und weiß nicht recht, wie er liegen soll.
Entschuldige, du kennst uns ja gar nicht, sagt die Frau. Das ist Ólafur, der Arzt hier in der Gegend und mein Mann. Sie hebt den einen Arm fast wie einen Flügel in seine Richtung, und der Mann verneigt sich kurz und lächelt, während sein Blick den Jungen forschend durchdringt.
Ich bin Steinunn, sagt sie und steht auf, um ihrem Mann Platz zu machen. Er setzt sich schwerfällig aufs Bett, stöhnt leise, als würde ihm das aufrechte Stehen schwerfallen, dieses ewige zermürbende Tauziehen, und beginnt dann damit, den Jungen abzutasten. Er stellt ihm knappe, zielgerichtete Fragen.
Ja, ich kann die Füße bewegen. Nein, die Hände fühlen sich nicht taub an. Ja, ich habe Schmerzen im Hals. Müde? Ja, und schlapp.
Gut, sagt Steinunn schließlich, und ihr Mann erhebt sich, um ihr wieder den Platz zu überlassen.
Der Knabe ist so jung, sagt er, der hält noch so gut wie alles aus. Ruhe, ordentliches Essen, Wasser, Kälte meiden – und in einer Woche oder zehn Tagen wird er wieder ganz auf dem Damm sein.
Du bist so jung, sagt Steinunn.
Jung sein ist schön, sagt Ólafur, dauernd Veränderungen. An einem Tag ist man so, am nächsten ganz anders. Wir sollten alle jung sein und niemals altern, uns nie von der Zeit ins Bockshorn jagen lassen.
Du magst doch gar keine Veränderungen, sagt seine Frau und schüttelt leicht den hellen Kopf.
Ist mit Jens alles in Ordnung?, fragt der Junge leise und kraftlos.
Jens. Der Lange heißt also Jens, stellt Ólafur fest. Nun ja, er ist übler dran als du, das kann man nicht bestreiten. Er hat Erfrierungen.
Übler dran?, fragt der Junge zögernd. Er ist also nicht außer Gefahr?
Außer Gefahr? Wann ist der Mensch je außer Gefahr?, fragt Ólafur. Ich habe getan, was ich konnte, aber er wird sicher hinken. Vielleicht Schlimmeres.
Schweigen macht sich breit. Als würden sie die letzten Worte überdenken: Vielleicht Schlimmeres. Was bedeutet das, wie schlimm ist Schlimmeres, wie weit ist das Leben vom Tod entfernt?
Der Junge zögert und fragt dann: Hjalti habt ihr nicht gefunden? Er traut sich endlich zu fragen, denn Menschen leben, solange wir die Frage nicht stellen, Schweigen ist nicht gefährlich; aber wir kommen auf etwas zu sprechen, und schon ist jemand gestorben.
Hjalti, sagt Ólafur, blickt schnell seine Frau an, dann zum Fenster hinaus. Du hast viel von diesem Hjalti geredet. Darum haben wir die Männer in den Sturm geschickt. Zehn Mann alles in allem. Álfheiður hat sie ganz schnell zusammengeholt. Nacht und Sturm und Lawinen – so hat’s ausgesehen, sagt er, sieht den Jungen an und wiederholt: So und nicht anders hat’s ausgesehen.
Als ob er das nicht wüsste, sagt seine Frau leise und sieht den Jungen ebenfalls an. Schöne Augen hat sie, wie alte, warme Sterne. Es waren doch dieselbe Nacht und derselbe Sturm, durch die sie hergekommen sind.
Ólafur holt einen Stuhl von der Wand und setzt sich, nickt: Ja, natürlich, du hast recht, sie wurden ja förmlich hier hereingeweht, und ich bin so erschrocken, dass ich das letzte Glas Sherry dieses Winters verschüttet habe. Weg ist der gute Tropfen, dahin der leckere Geschmack!
Er trommelt mit seinen eher kurzen Fingern auf sein Knie und pfeift vor sich hin.
Ólafur und ich, sagt Steinunn erklärend, waren noch wach und haben Korrespondenz erledigt, und dann kamt ihr …
Und zwar mit Getöse, wirft Ólafur ein.
Getöse kann man es nennen, stimmt sie zu.
Bum, sagt Ólafur und haut sich auf den Schenkel. Der Junge zuckt zusammen.
Doch aus dem, was du gesagt hast, ließ sich schließen, dass ihr beiden nicht allein unterwegs wart, und darum haben wir die Männer in die Berge hinaufgeschickt.
In ein Wetter, das außer Rand und Band war, wirft Ólafur ein, aber sie haben Ásta von Nes gefunden, einen Schlitten und die Überreste eines Sarges, mehr jedoch nicht.
Unter einem plötzlichen Schwächeanfall schließt der Junge die Augen. Er sieht das Bild von Hjalti auf dem Hof von Nes vor sich, es füllt sein ganzes Bewusstsein aus, wie er einen großen Schneeball vor sich her wälzte, wie er den Kleinsten unter dem Arm trug wie einen Sack und die anderen Kinder neben ihm herhüpften. War es denkbar, dass dieser große, wenn auch etwas niedergedrückte Mann umgekommen war? Der kommt schon durch, hatte Jens gesagt, und Jens weiß so etwas. Er muss es wissen. Vielleicht war Hjalti einfach zu den Kindern zurückgegangen; da, in der Bucht hinter der Welt, da war sein Platz. Die Kinder brauchen ihn, die Welt kann doch nicht so gemein sein, ihnen diesen großartigen Mann zu nehmen.
Jetzt solltest du etwas essen, sagt Steinunn. Ihre Stimme klingt angenehm, so als würde sie einen in den Arm nehmen. Manche Menschen brauchen nur bei einem zu sitzen und mit einem zu reden, mit ihrer Stimme über Müdigkeit und Wunden zu streichen.
Er schlägt die Augen auf. Die kleinere Frau, das Stück Strick, ist wieder da, mit einem Tablett, von dem Dampf aufsteigt. Sie muss wohl diese Álfheiður sein, die die Männer zusammengeholt hat, um nach Hjalti zu suchen. Und nach Ásta, obwohl sie tot war und es nichts bringt, nach Toten zu suchen, denn man sucht nicht nach dem, was nicht mehr existiert. Von unten hört er Kinderlachen heraufdringen, das Leben lacht weiter, dem Tod zum Trotz, es ist nicht auszuhalten, geschmacklos, es ist so wichtig, unser Halt.
Steinunn bittet ihn, sich aufzusetzen, und sie steckt ihm ein Kissen hinter den Rücken. Diese Álfheiður setzt das Tablett mit dampfender Suppe auf seinem Schoß ab und beugt sich über ihn, um es zurechtzurücken. Ein schwerer, leicht süßlicher Duft steigt aus ihrem Ausschnitt auf. Der Junge starrt lange auf den Teller.
Iss nur, Junge, sagt Steinunn.
Hjalti, sagt er, während er löffelt, arbeitet als Knecht bei Bjarni und Ásta oder vielleicht besser: arbeitete. Er kommt mit den Zeiten durcheinander, soll er nun in der Gegenwart oder in der Vergangenheit von ihm sprechen? Stirbt Hjalti, wenn er in der Vergangenheit von ihm redet?
Ich kann mich an keinen Hjalti erinnern, sagt Steinunn, ich bin aber auch sehr vergesslich, was Namen angeht, und bei Menschen auch. Es gibt Menschen, an die kann man sich einfach nicht lange erinnern.
Die Menschen sind verschieden, sagt Ólafur.
Und Álfheiður: Ich kannte mal einen, der so hieß, aber der ist vor vielen Jahren ertrunken.
Ólafur: Im Meer, du meine Güte, ist das furchtbar! Hatte er Familie?
Álfheiður: Eine Frau und vier Kinder.
Da sieht man’s mal wieder, sagt Ólafur und seufzt leise. So etwas dürfte es doch gar nicht geben.
Álfheiður: Es gibt also doch Gerechtigkeit auf dieser Welt, hat seine Frau gesagt, als man ihr davon berichtete.
Wie bitte?, sagt Ólafur.
Über seine Suppe gebeugt, sagt der Junge entschieden: Hjalti ist nicht ertrunken. Er war … ist Knecht bei Bjarni und Ásta … war, denn sie ist ja tot.
Die Suppe ist dick, heiß und kräftig. Er löffelt sie achtlos, als wäre er betäubt.
Álfheiður nimmt ihm das Tablett weg, wieder dieser warme, süßliche Geruch. Soll ich ihm auch Kaffee bringen?
Bring uns gern eine ordentliche Portion Kaffee, liebe Þórdís, antwortet Ólafur.
Der Junge blickt rasch auf, denn es ist komisch, wenn Menschen so plötzlich einen anderen Namen bekommen. Þórdís brummt irgendwas kaum Verständliches, der Junge schließt die Augen und sieht Hjalti deutlich vor sich, unerträglich deutlich, er sieht seine Augen, von Enttäuschung oder vielleicht Trauer gezeichnet, er hört Hjaltis letzten Satz, bevor der Schlitten mit dem Sarg davonglitt und die drei sich aus den Augen verloren: Hol’s der Teufel, Männer, wird man denn nur in diese Welt geboren, um zu verrecken?
Er schlägt die Augen wieder auf und fragt: Können wir nicht noch einmal nach Hjalti suchen lassen?
Was? Noch einmal?, sagt Ólafur. Zum dritten Mal?
Wieso zum dritten Mal?, fragt der Junge.
Sie haben schon gestern ein weiteres Mal nach ihm gesucht. Das war das zweite Mal. Das Wetter war ein wenig besser, aber sie haben nichts gefunden. Wir haben uns gedacht, dass ihr nicht nur zu zweit mit der Leiche unterwegs wart. Man braucht schon mehr als zwei Mann, um einen Sarg über den Berg zu schaffen.
Wir waren bei der Schlucht, sagt der Junge.
Steinunn sieht ihren Mann an. Jetzt wäre es immerhin möglich, aufrecht zu stehen und sich umzusehen, sagt sie, und der Arzt erhebt sich schwerfällig, geht zur Tür und ruft mit dröhnender Stimme: Álfheiður, ruf ein paar Männer zusammen und sag ihnen, sie sollen nach diesem Hjalti suchen. Sag ihnen, sie sollen an der Schlucht entlanggehen. Und dass sie es mit mir zu tun bekommen, wenn sie murren. Freuen werden sie sich nicht, die Burschen, sagt er noch, als er zurückkommt.
Man kann nicht immer nur Freude haben im Leben, meint Steinunn.
Nein, stimmt ihr Ólafur zu, das wäre auf Dauer ganz schön niederschmetternd.
Traust du dir zu, uns die Geschichte eurer Reise zu erzählen?, fragt sie den Jungen.
Oh ja, sagt Ólafur, es wäre schön, eine Geschichte zu hören. Da kommt auch der Kaffee, setzt er hinzu, als Þórdís mit dem Kaffee für alle drei erscheint. Dem Jungen wird klar, dass er wohl kaum darum herumkommen wird, zu erzählen. Es wird von ihm erwartet.
In einem der Häuser hier, sagt er, soll eine Frau namens Bóthildur wohnen.
Bóthildur? Nein, eine Frau dieses Namens ist dem Ehepaar unbekannt. Wieso?
Vor drei Jahren muss sie hier gewesen sein.
Wir leben seit zwanzig Jahren hier und haben nie eine Frau mit diesem Namen gesehen, sagt Ólafur. Warum fragst du?
Ach, nur so, meint der Junge und merkt, wie ihm wieder ein bisschen übel wird. Er schaut zu dem Postboten hinüber und sieht, wie sich die Bettdecke im Rhythmus seiner Atemzüge hebt und senkt. Wer atmet, ist am Leben, was das auch heißen mag. Dann beginnt er zu erzählen. Guðmundur der Hilfsbriefträger war krank, damit hat es angefangen.
V
Jens erwacht um die Abendzeit.
Der Junge war eingedöst, erschöpft von seiner Geschichte, denn es kann anstrengend sein, sich vergangene Ereignisse in Erinnerung zu rufen. Wir merken dabei, dass das Leben kein sich kontinuierlich abspulender Faden ist, sondern manchmal von Zufällen bestimmt wird, die ebenso grausam wie schön sein können. Manche Dinge gehen spurlos durch uns hindurch, ohne dass etwas zurückbleibt, andere durchleben wir wieder und wieder, weil das, was da vergangen ist, noch in uns steckt, den Tagen eine gewisse Färbung verleiht oder in die Träume hineinwirkt. Die Vergangenheit ist so dicht mit unserer Gegenwart verwoben, dass sich nicht immer zwischen beiden unterscheiden lässt. Sätze, die du heute fallen lässt, holen dich in fünf Jahren wieder ein, kommen wie ein Blumenstrauß zu dir, wie ein Trost oder wie ein blutiges Messer. Und was du morgen hörst, verwandelt einen früheren, liebenden Kuss in die Erinnerung an einen Schlangenbiss.
Er hatte erzählt, die Ereignisse noch einmal durchlebt, aber er hatte nicht alles preisgegeben, Jens nicht bloßgestellt, weder seinen Zusammenbruch im Boot erwähnt noch seine Äußerungen über Halla und ihren Vater, so offenherzig erzählte er nicht, wohl aber sprach er von dem kleinen Mädchen von der Winterküste, das so schrecklich hustet, dass sein Lebensfaden um ein Haar reißt. Er hatte auch vom Pastor in Vík berichtet.
Der arme Kjartan, hatte Ólafur gemurmelt.
Und die ärmste Anna erst, hatte Steinunn gesagt, ist doch schrecklich, das Augenlicht zu verlieren.
Noch schlimmer aber ist es, die Lebensfreude zu verlieren, hatte Ólafur zurückgegeben.
Bist du dir sicher, hatte Steinunn gefragt, dass das Dunkel um Anna herum nicht eher von fehlender Liebe als von nachlassender Sehkraft herrührt?
Unsinn! Der Mensch verliert sein Augenlicht nicht durch Lieblosigkeit, das ist ausgeschlossen. Blindheit ist etwas Biologisches, das ist Wissenschaft.
Was wissen wir denn davon?, fragte Steinunn. Was wissen wir schon vom Menschen?
Alles in allem vielleicht nicht sehr viel, hatte Ólafur zugegeben, und der Junge hatte weitererzählt, vom Schnee, vom Sturm, von der Hochebene, von dem Mann und dem anderen Jungen oben auf der Heide, dass er Jens verloren hatte und ihm Ásta da geradezu erschienen war und ihn durch den blindwütigen Sturm zu Jens geführt hatte. Vielleicht war es nur Einbildung, hatte der Junge gesagt, als er den Gesichtsausdruck seiner Gastgeber gesehen hatte. Wann soll sie denn beerdigt werden?
Morgen oder übermorgen, hatte Steinunn geantwortet. Je nachdem, wie es Séra Gísli geht und ob die Männer es schaffen, ein Grab auszuheben. Das ist nicht so leicht, wenn der Boden gefroren ist.
Wie tief graben sie denn?, hatte der Junge mit leichtem Unbehagen gefragt, aber auch aus der unbestimmten Vorstellung heraus, je tiefer sie liege, desto größer sei die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann Ruhe finden könne.
In anderthalb bis zwei Metern kommt Fels, hatte Ólafur erklärt. Hier liegen die Toten nicht tief, aber wir werden im Sommer hoffentlich noch etwas Erde aufschütten.
Hoffentlich?
Im Sommer wird so manches vergessen, junger Mann, wenn die Vögel singen, die Fliegen und die Fische kommen. Es fällt einem nicht leicht, an die Toten zu denken, wenn die Sonne scheint, und vielleicht ist es auch gar nicht nötig.
Gegen Ende seiner Geschichte war Þórdís mit einer frischen Wärmflasche für Jens zurückgekommen.
Wer bist du überhaupt?, hatte Ólafur den Jungen gefragt, nachdem er zugesehen hatte, wie Þórdís die Wärmflaschen auswechselte, und beide Frauen hatten den Jungen direkt angesehen.
Er schwieg. Was hätte er auch antworten sollen? Wie erklärt man seine Existenz? Wer bin ich? Sind wir das, was wir tun, oder das, was wir träumen?
Als vom Jungen nichts kam, hatte Steinunn gesagt: Du hast uns nämlich ganz schön Kopfzerbrechen bereitet. Du hast gute und teure Schuhe gegen die Kälte getragen, bestimmt aus Norwegen, und auch ordentliche Kleidung. Du hast aus Büchern zitiert; nicht alles war zu verstehen, vielleicht nur der kleinste Teil, aber ich glaube Shakespeare wiedererkannt zu haben, und den kennt nicht jeder auswendig. Andererseits beweisen deine Hände, dass du schwere Arbeit verrichtet hast.
Entweder taugen Männer was oder nicht, hatte Þórdís gesagt und das Kinn ein wenig gehoben.
Ich lebe bei Geirþrúður, hatte der Junge darauf geantwortet, als würde das etwas erklären.
Geirþrúður, hatte Ólafur wiederholt. Meinst du die Geirþrúður, die Frau von Guðjón?
Der Junge hatte genickt.
So, so, hatte Steinunn gestaunt, hat sie dich als Pflegesohn aufgenommen?
Nein, hatte der Junge erwidert und schneller, als er denken konnte, hinzugesetzt: Ich mag auch lieber sensible Frauen wie dich.
Ich würde dir eine langen, wenn du nicht schon liegen würdest, hatte Þórdís gesagt.
Nachdem die anderen gegangen waren, schlief der Junge ein, die Müdigkeit von der langen Wanderung steckte wie ein tiefes Summen in ihm, ein tief sitzender Schmerz, der nach oben stieg, nachdem er ihn beim Erzählen noch einmal durchlebt hatte. Er nickte ein und schlief.
Als er wieder zu sich kommt, ist es Abend.
Jens steht am Fenster, blickt nach draußen, und sein kantiges Gesicht ist totenblass. Lange traut sich der Junge nicht, etwas zu sagen, denn Worte können ans Licht bringen, wer am Leben und wer tot ist. Ein Wort, und Jens löst sich auf und liegt als Leichnam im nächsten Bett. Aber wir müssen Bescheid wissen, müssen den Unterschied zwischen Leben und Tod kennen, und darum sagt er: Wir sind in Sléttueyri.
Jens reagiert nicht, als hätte er nichts gehört. Was müssen wir sagen, damit uns die Toten hören, damit Gott uns hört?
Ich weiß, sagt Jens schließlich.
Im Haus des Arztes, ergänzt der Junge, so gut er kann, denn sobald er Jens’ Stimme hört, spürt er einen Kloß im Hals, der die Stimmbänder blockiert.
Ich weiß, sagt Jens bloß und schaut weiter in eine Welt voller Mondschein. Dieser große Mann braucht nicht gegen Tränen anzukämpfen, er ist einfach nur da. Stimmen dringen von draußen herein, Männerstimmen. Sicher von den Männern, die losgegangen sind, um nach Hjalti zu suchen, ein drittes Mal, sagt der Junge, nachdem er eine Weile gelauscht hat, um vielleicht etwas zu verstehen.
Ich weiß, sagt Jens.
Wir haben das Haus hier erreicht und die Leute geweckt, die schon schliefen, und den Übrigen haben wir einen ordentlichen Schrecken eingejagt.
Jens schweigt.
Es war knapp, sagt der Junge, ganz leise.
Ja, bestätigt Jens und lehnt sich wieder an den Fensterrahmen, um das Gewicht zu verlagern und allein stehen zu können, mit eigenen Muskeln und Knochen und mit den Erinnerungen, Enttäuschungen und Überlegungen, was ihm vielleicht noch bevorstehen mag. Sie hören leichte Schritte kommen, sehen sich kurz in die Augen, und Steinunn tritt ein, stockt einen Moment, als sie den groß gewachsenen Mann am Fenster sieht.
Du bist ja nicht nur aufgewacht, sondern auch gleich aufgestanden, sagt sie mit dieser Stimme, die so weich ist wie warmes Wasser.
Jens sieht zu ihr hin. Weiß nicht, sagt er ein wenig mürrisch und hinkt dann zum Bett zurück. Ihr habt niemanden gefunden, sagt er, als er wieder im Bett sitzt, er sagt es ganz ruhig, unterdrückt den Schmerz, die Erschöpfung, die Niederlage, dass er nicht aufrecht gehen und kaum allein stehen kann.
Nein, sagt sie. Die Sicht war gut, aber es hat viel geschneit, und es lässt sich kaum sagen, was unter dem ganzen Schnee liegt.
Der Junge blickt vom einen zum anderen. Steinunn redet jetzt anders, so, als würde sie ihre Worte genau abwägen. Wir sind nicht immer gleich, die Anwesenheit anderer verändert uns, zieht jeweils andere Register in uns und nur höchst selten alle auf einmal, in jedem Menschen gibt es verborgene Welten, und manche von ihnen kommen nie zum Vorschein.
Er wird kaum nach Nes zurückgelaufen sein, meint Jens.
Wir wollen das Beste hoffen, sagt sie und sieht weder Jens noch den Jungen an.
Hoffnung ist eine gute Sache, stimmt Jens zu, aber einem völlig erledigten Mann in einem Sturm hilft sie wenig.
Das weiß ich, guter Mann, sagt die Frau und schaut Jens an, der den Blick senkt, als wäre sein Kopf auf einmal unerträglich schwer geworden.
Jens bekommt Grütze und Innereien vorgesetzt und frischen Kaffee.
Wie sieht es mit den Erfrierungen aus?, fragt er Ólafur, der gleich nach Þórdís eingetreten ist. Nun stehen alle drei Hausbewohner da und sehen Jens an, was den nicht im Geringsten zu beeindrucken scheint.
Hässlich, antwortet Ólafur.
Erfrierungen sind nie schön, sagt Jens mit belegter Stimme.
Ich weiß, ich weiß, sagt der Arzt.
Heilt das wieder?
Ich habe schon schwärzere Stellen gesehen.
Dazu sagt Jens nichts, sieht dem Arzt aber fest in die Augen. Ólafur schlägt den Blick nieder und zuckt mit den Schultern. Heilen! Was heilt schon wirklich? Ein Mann bekommt einen Schlag ins Gesicht, das Gesicht vergisst den Schlag vielleicht, der Mann nicht.
Jens fängt an zu essen, als könne er dem Arzt nicht länger in die Augen sehen.
Er hat dich wohl kaum um philosophische Weitschweifigkeiten gebeten, wirft Steinunn ein, sondern um eine klare Aussage, ob er all seine Gliedmaßen ohne Schäden behalten wird.
Da hast du recht, sagt Ólafur und räuspert sich. Die Aussichten stehen nicht ganz schlecht, dass du alle Glieder behalten kannst. Mehr als nicht ganz schlecht aber nicht. Bei einigen Zehen bin ich mir noch nicht sicher, vielleicht ein, zwei Finger, das könnte davon abhängen, was für ein Patient du bist. Es gibt so vieles, was man nicht vorhersagen kann.
Gegen Erfrierungen hilft immer noch am besten, zweimal täglich durch Schnee zu laufen, wirft Þórdís ein. Das war noch immer das beste Heilmittel. Von Weichlichkeit wird keiner stark.
Und trotzdem bist du stark, sagt der Junge.
Dem bringe ich kein Essen mehr, sagt Þórdís und bohrt ihre hellblauen Augen in den Jungen.
Steinunn murmelt nur etwas und tritt ans Fenster, um nach draußen zu blicken.
Hjalti hatte etwas Besseres verdient, sagt der Junge, als sie wieder allein sind und der Himmel draußen vor dem Fenster den Mond hält wie eine matte Lampe.
Ja, sagt Jens, sonst nichts, doch dieses eine Wort, das zuweilen nicht einmal ein Wort, sondern eher eine Art Seufzer oder noch weniger, nur ein Atemzug ist, kommt auf eine solche Weise aus Jens heraus, dass der Junge erst eine Weile seine ganze Kraft aufwenden muss, um ein Schluchzen zu unterdrücken. Eines der schlimmsten Dinge, die wir einem anderen Menschen antun können, ist, in seiner Gegenwart zu weinen, und deshalb weinen wir am liebsten allein, in einem Versteck, als würden wir uns schämen, dabei gibt es wahrscheinlich kaum etwas Reineres auf dieser Welt als ein aus Sorge entsprungenes Weinen. Die Anstandsregeln lassen uns schon komische Dinge tun.
Was wird jetzt aus den Kindern auf Nes?, fragt der Junge schließlich. Und aus Bjarni?
Darauf antwortet Jens gar nichts – oder doch, wahrscheinlich brummt er Hmm, was etwa so viel bedeuten könnte wie: Das Leben ist ein schwieriger Berg. Er hat die Augen geschlossen, und dann ist er eingeschlafen. In diese Welt hineingesunken, die so tief ist, dass sie fast bis an den Tod hinabreicht. Er schläft und ballt unbewusst die Fäuste in den Verbänden, wehrlos in der Traumwelt.
VI
Es ist Tag, ein stiller, heller Tag, und Jens ist nicht im Zimmer. Der Junge sitzt lange am Fenster und schaut hinaus. Er sieht einer Horde schreiender, lärmender und lachender Kinder zu, die zwischen den Häusern spielen. Sie haben im Schnee einen großen Kreis gezogen, und drei der Größten versuchen die anderen in den Kreis zu zerren. Der Junge sieht ihnen lange zu, denkt an das Vergangene und reibt sich die Brust, unter der das Herz sitzt, das schneller altert als andere Organe, abgesehen vielleicht von den Augen. Die Zahl der Kinder im Kreis wächst, sie hüpfen darin herum und rufen den anderen, die sich noch außerhalb befinden und von den drei Stärksten gejagt werden, Warnungen und Anfeuerungsworte zu.
Einmal waren wir alle Kinder, die Sommer waren noch länger und wärmer, die Welt lag vor uns, unbegreiflich und voller Verlockungen. Das war einmal. Ich habe einmal gelebt. Du hast mich einmal geliebt. Es war einmal. Gibt es einen traurigeren Satz als diesen? Es war einmal, ja, aber es ist nicht mehr. Ich war einmal Kind. Einmal waren die Tage Märchenschlösser. Dann versanken sie in einen dunklen Wald, verschwanden, und wir ließen es geschehen. Wir lassen es geschehen. Lassen das Leben erstarren. Leben, wohin gehst du, wo bist du, Liebes?
Es ist noch jemand im Raum. Der Junge dreht sich um und blickt in die Augen einer schlanken Frau in dunkler, abgetragener Kleidung, Jacke und Rock, und einem braunen Kopftuch, das jedes Haar verhüllt. Abgesehen von diesem Braun ist keinerlei Farbe an ihr, bis auf die Blässe ihrer Haut und das Grün ihrer Augen.
Ich wollte sehen, ob du gestorben bist, sagt die Frau.
Wo ist Jens?, fragt der Junge und vermeidet es, in diese grünen Augen zu sehen.
Unten.
Hat er es bis nach unten geschafft?
Sonst wäre er wohl kaum da.
Die Kinder draußen rufen laut, und der Junge möchte etwas über Jens oder über die Kinder sagen oder irgendwas über diesen Tag, aber stattdessen rutscht ihm heraus: Du hast grüne Augen.
Du sollst nach unten kommen, zum Essen.
Heißt du vielleicht Álfheiður?
Ja, sagt Álfheiður. Sie hat Sommersprossen, die sich wie ein Sternengürtel quer über ihr Gesicht ziehen, über die Nase und über die Wangen.
Du hast Sommersprossen, sagt er, als würde er etwas Peinliches aussprechen. Als sie darauf nichts antwortet, fährt er fort: Warst du es, die mich geküsst hat?
Ich dachte, du lägest im Sterben.
Lag ich aber nicht, sagt er fast entschuldigend.
Macht nichts, sagt sie, und es ist nicht ganz klar, ob sich das auf den Kuss oder auf sein Überleben bezieht. Du sollst nach unten kommen, wiederholt sie und geht voraus.
Bei uns in Sléttueyri werden langsam die Vorräte knapp, sagt Steinunn.
Der Junge ist nach unten gekommen, und da sitzt Jens, vorgebeugt, abwesend, eine leere Kaffeetasse vor sich.
Es ist noch genügend da, nur die Auswahl ist etwas eingeschränkt. Iss, so viel du magst, Junge, an Milch fehlt es uns jedenfalls nicht, fährt Steinunn fort. Weder Ólafur noch Þórdís sind zu sehen. Þórdís hat draußen zu tun. Zum Haus des Arztes gehört ein Bauernhof mit zwei Kühen, dreißig Schafen und acht Hühnern. Das macht genügend Arbeit. Álfheiður deckt für den Jungen den Tisch, und einmal streift sie ihn dabei, Arm berührt Arm.
Die großen Ereignisse der Welt stehen auf den Titelseiten der Zeitungen: Noch immer Spannungen zwischen Japan und China, Japan hat kräftig aufgerüstet.
Die Weltbevölkerung beträgt eine Milliarde, 479Millionen, 729-tausend und vierhundert Menschen.
In Sléttueyri, Island, berühren sich zwei Arme.
Sie hat rote Haare. Das Kopftuch bedeckt sie fast vollständig, aber bei den Ohren kommen ein paar unter dem Tuch hervor. Sie setzt ihm geräuchertes Geflügel vor und zieht sich zurück, er isst von dem Geflügel und kaut. Rote Haare, grüne Augen, geräuchertes Geflügelfleisch, Hjalti tot, atmet nicht mehr, denkt nicht mehr, fühlt nichts mehr, muss nie wieder pinkeln, spucken, weinen.
Steinunn legt die Zeitung weg und seufzt. Sicher ist es das zehnte, elfte oder gar zwölfte Mal, dass sie diese Ausgabe liest, Zeitungen werden erst spät und unter viel Mühe zugestellt, der Winter verlangsamt alle Neuigkeiten. Es gibt viele Menschen auf der Welt, sagt sie.
Ich komme ohne Hilfe nicht wieder nach oben, sagt Jens, als sie allein in der Küche sind.
Du wärst besser gar nicht nach unten gegangen, sagt der Junge.
Das habe ich erst mitten auf der Treppe gemerkt.
Warum bist du nicht umgekehrt?
Man dreht nicht um, sagt Jens.
Dann gehen sie zur Treppe, quälen sich die Stufen hinauf; zweimal muss der Junge eine Pause machen, Jens stützt sich schwer auf ihn, keucht und flucht ihm ins Ohr, dann liegt er im Bett, der Junge lehnt sich an den Fensterrahmen und erholt sich von der Anstrengung und der Belastung seiner schmerzenden Beine.
Er kommt also nicht mehr wieder?, fragt der Junge ins Helle hinein.
Nein, sagt Jens.
Vielleicht hat er sich in den Schnee eingegraben, so das Schlimmste überstanden und ist dann zurückgegangen.
Vielleicht.
Aber nicht sehr wahrscheinlich?
Jens antwortet nichts, und der Junge schaut aus dem Fenster, es tut gut, ins Helle zu sehen, dahin sollten wir alle blicken, aber es bringt trotzdem niemanden ins Leben zurück. Sie schweigen gemeinsam. Es gibt vielerlei Arten des Schweigens. Manchmal schweigen Menschen zusammen, weil sich im Leben etwas ereignet hat, das sich mit Worten nicht benennen lässt, etwas, woran Sprache nicht zu rühren vermag, und auf diese Weise schweigen die beiden jetzt. Der eine von ihnen steht, der andere liegt, der Dritte befindet sich draußen und ist tot, ist im Schnee eingeschlafen – er ist das Schweigen. Uns wird so vieles genommen, am Ende alles. Der Tod scheint unser Leben manchmal zu umgeben wie das schwarze Weltall die Erde, diesen blauen Planeten, diesen hellblauen Ruf im unendlich weiten Raum, den Ruf nach Gott, nach Sinn.
Mir tun die Kinder leid, sagt der Junge und bricht das Schweigen. Die auf Nes, fügt er hinzu.
Ja.
Hier kennt niemand eine Bóthildur.
Nein.
Vielleicht hat er sich mit dem Namen vertan, ihn nicht richtig behalten.
Bóthildur. Bei einem solchen Namen vertut man sich doch nicht.
Was dann?
Was weiß ich.
Vielleicht, sagt der Junge sehr zögerlich, hat es sie gar nicht gegeben. Er guckt dabei aus dem Fenster. Jens antwortet nichts, die Scheibe und das Tageslicht schweigen ebenfalls. Ich kannte einmal eine Frau namens Bóthildur, und sie hat mich geküsst. Warum erfinden Menschen solche Lügen? Weil wir anders nicht leben könnten? Oder lügt am Ende die Realität, und der Mensch sagt die Wahrheit?
Er schaut nicht länger aus dem Fenster, es hat sich draußen auch zugezogen, als wären weitere Niederschläge im Anzug. Jens scheint zu schlafen. Der Junge setzt sich aufs Bett, es wird ihm guttun, von hier wegzukommen, diese endlos lange Reise zwischen Leben und Tod und noch ein Stück darüber hinaus zu beenden, wieder in den Ort zu kommen, in Geirþrúðurs Haus, natürlich wagt er nicht zu denken: nach Hause. Ein Zuhause ist ein viel zu großes Wort, es hat schon viele Menschen in den Stürmen des Lebens gerettet. Wer ein Zuhause hat, gibt nicht so leicht auf.
Ich will mich nur einen Moment hinlegen, die Augen schließen und an Ragnheiður denken, an die weichen Lippen, wie sie gezittert hat. Er schließt die Augen und reißt sie gleich wieder auf, denn auf einmal ist Álfheiður da und spricht mit Jens, der also gar nicht geschlafen hat, es sei denn, er ist von diesen grünen Augen aufgewacht, was gar nicht so unwahrscheinlich ist, denn wie könnte man in ihrer Gegenwart schlafen? Das hat jetzt aber gar nichts zu sagen, er denkt an Ragnheiður, die zitterte und bei gutem Wetter reiten wollte, besser macht er währenddessen die Augen zu, denn wer die Augen schließt, ist verschwunden.
Dann steht er aber doch am Fenster, und sie redet noch immer mit Jens, der Arzt hat dies und der Arzt hat jenes. Diese braun gekleidete und blasse Person trägt den Kopf vielleicht ein wenig hoch, ja, schon, und es könnte sein, dass das eine gewisse Wirkung hat. Aber vergessen wir nicht, dass es stolze Frauen auf der ganzen Welt gibt, allein in China muss es eine Unmenge solcher Frauen geben – vielleicht einige Millionen, was kommt es da auf ein mageres Hausmädchen in abgetragenen Kleidern im Obergeschoss eines Hauses an, das am äußersten Rand der Welt balanciert; wenn die Welt niest, fallen sie sowieso alle runter. Er lehnt sich an den Fensterrahmen, verschränkt die Arme und wünscht sich von hier weg. Der Arzt macht einen Hausbesuch, kommt am Abend oder in der Nacht nach Hause und sagt, Jens solle sich ausruhen.
Ist gut, meint Jens und setzt noch etwas hinzu, kann auf einmal reden, ja, vielleicht lächelt er Álfheiður sogar an.
Ist mit dir alles in Ordnung?, fragt sie und meint den Jungen, der ganz ruhig ein Jaja zurückgibt. Warum aber hat er die Arme nicht mehr verschränkt, und was soll er jetzt mit ihnen anfangen? Er kann sie doch nicht einfach so dämlich an den Seiten hängen lassen, so unbeholfen und schwerfällig wie jetzt gerade. Sollte er nicht besser das Fenster aufmachen und sie rauswerfen?
Das Fenster lässt sich nicht öffnen, es ist festgefroren, sagt sie, als der Junge wütend daran rüttelt und etwas von schlechter Luft brummt. Es sei denn, du schlägst die Scheibe ein, meint sie lächelnd.
Schnell blickt er zu ihr hinüber. Sie scheint einigermaßen gesunde Zähne zu haben, einige stehen nur schief wie müde Menschen, die sich Halt suchend aneinanderlehnen. Er steckt die Hände unter die Achselhöhlen, und solange er sie da hält, tun sie nichts Dummes.
Es gibt Menschen überall auf der ganzen Welt, sagt er, besonders in Russland und in China, und mancherorts wachsen Bäume.
Jens liegt, sie steht, aber beide gucken ihn an, nichts weiter, und darum setzt er noch hinzu: In China bauen sie Tee an … Und in den Bergen regnet es manchmal … auch auf die Mäuse … und auf die Hände der Menschen … Ist aber nicht schlimm, wenn du in China bist, denn da ist der Regen manchmal warm.
VII
Es fühlt sich seltsam an, in ruhiges, klares Wetter hinauszugehen, aus dem Haus zu treten, ohne sich in Lebensgefahr zu begeben; verständlich, dass es gar nicht so einfach ist, in dieser Windstille das Gleichgewicht zu halten. Er folgt einem Weg, der an Schneewehen vorbei zu den nächsten Häusern führt. Der Junge sieht sich um und ist am Leben. Die Ortschaft besteht aus vierzig bis fünfzig Häusern, verstreut in einem großen Kreis, auf einem flachen Hügel in seiner Mitte thront die Kirche. Das Haus des Arztes steht oberhalb davon nahe der Felswand mit dem steilen Abhang, den er und Jens hinabgesaust sind, und noch weiter oben spaltet die Schlucht die Wand wie eine dunkle, offene Wunde. Zweihundert Meter tief hinab bis zu einer ersten Ansammlung von Gebäuden. Der Junge bleibt stehen, bevor er sie erreicht, dreht sich um und blickt den Berg hinauf. Sechs Tage sind vergangen, seit er aufgebrochen ist, seit er im Beisein von Rektor Gísli und Marta vor dem Hotel Sodom den Kahn ins Wasser geschoben hat? Ist das wirklich erst sechs Tage her? Nicht sechshundert?
Als er so bewegungslos dasteht, schleicht sich die Kälte an. Vielleicht hätte er das Haus nicht verlassen sollen. Er ist ungesehen nach unten getappt, hat Þórdís’ Stimme gehört, hart wie Stein, dann die weiche Stimme von Steinunn, vielleicht hätte er sich wirklich noch ausruhen, schlafen und Kräfte sammeln sollen, aber Jens ist rasch eingeschlafen, nachdem Álfheiður gegangen war. Ihre Augen, dieses Grün hat sie mitgenommen. Jens hat der Regen in China nicht interessiert, ob Regen überhaupt warm sein kann, und nach den Mäusen hat er auch nicht gefragt. Der Junge hat gelauscht, wie sich Álfheiðurs Schritte entfernten, und danach hat Jens gesagt: Das war meine letzte Tour als Postbote. Darauf gab es ein langes Schweigen, als hätte der Junge die Erklärung nicht gehört oder, was wahrscheinlicher ist, als wäre ihm das egal. Was bedeutet es ihm denn schon, ob Jens mit Post zwischen den Bergen herumläuft oder nur bei sich zu Hause sitzt? Das Leben eines Menschen geht einen anderen nichts an. Jens hat die Augen geschlossen. Jeder trägt die Verantwortung für sein Leben und sollte sie nicht auf andere abwälzen. Wozu hat der Mensch schließlich seine Beine, wenn er nicht allein auf ihnen stehen kann?
Ist es wegen Salvör?, hat der Junge aus dem Schweigen gefragt, in das er sich zurückgezogen hatte, und Jens ist zusammengezuckt wie nach einem Messerstich.
Das geht dich nichts an, hat er schnell und hart erwidert, und vor zwei, drei Tagen hätte das völlig gereicht, aber jetzt liegt zu viel Schnee, zu viel Wind, zu viel Berg und zu viel Tod, Ungewissheit und zerbrechliches Leben aus den letzten vierundzwanzig Stunden zwischen ihnen. Darum hat der Junge nachgebohrt: Mag sein, aber ich frage trotzdem. Und es war gut, dass er das getan hat. Wenn niemand nachfragt, schließen wir uns in unserem Schweigen mit all seinem Schmerz ein, das sich mit den Jahren in Einsamkeit, Bitternis und einen schweren Tod verwandelt. Jens hat geflucht und sich mühsam aufgerichtet wie ein alter Mann. Du siehst doch, was mit mir los ist. Als ob das als Erklärung reichen würde, aber der Junge hat noch ein drittes Mal gefragt, als kenne er keine anderen Worte oder würde nichts kapieren: Ist es wegen Salvör?
Jens hat geschwiegen. Was sollte er auch sagen, wie hätten denn Worte all das ausdrücken können, was in ihm tobte? Der Junge stand noch immer am Fenster, gegen den Rahmen gelehnt, und wartete ganz ruhig ab. Er hat gewusst, dass er warten musste.
Ihr Mann hat getrunken und sie misshandelt, hat Jens schließlich gesagt und auf seine Hände geblickt. Wie kann man Hände, die so etwas tun, von solchen unterscheiden, die so etwas nie tun würden? Wie unterscheidet man einen Menschen, der einen hintergeht, von einem, der einem treu bleibt?
Der Junge schaut zur Schlucht hinauf, er ist allein im Freien, Schweigen über allem, die Kinder sind verschwunden, mit ihnen die Stimmen, die Lebensfreude und vielleicht auch das Licht, scheint die Luft über den Bergen dunkler zu werden? Wind stöbert im Schnee, wirbelt ihn auf, dreht Schleier aus ihm, die gleich wieder zu Boden sinken.
Ich kenne dich, du durchsichtiger Teufel, sagt der Junge laut zum Wind. Er lässt den Blick über die Berge Richtung Nes schweifen, wo vier Kinder Ásta und Hjalti vermissen und auf den warten, der nicht mehr zurückkehren wird, wo Bjarni auf dem Bett sitzt, sich eine Handarbeit vornimmt oder seine Mutter wäscht, die so viel verloren hat, ihren Mann, Freunde, Geschwister, die Kindheit, fast das ganze Leben, Erinnerungen, das Gedächtnis. Sie öffnet den Mund, dieses schwarze Loch, wenn ihr Körper nach Essen verlangt, und ein schwacher Schauer durchläuft ihn, wenn sie sich an etwas erinnert, auch wenn sich unter der Bürde des Gedächtnisverlusts das Bewusstsein kurz zurückmeldet, zittert sie leise. Genauso aber zittert sie, wenn sie abführen muss, wenn sie Kaffee haben möchte oder Bjarni sie anhebt wie ein Bündel altes Heu. Er hat starke Arme und kann in schwerem Wetter und auf See Menschenleben retten, aber sie sind nicht kräftig genug, um seine Kinder zu umarmen, nicht stark genug, um zu trösten.
Der Junge hat die Häuser erreicht, acht Gebäude, jedes für sich, aber alle doch so nah beieinanderstehend, dass sie den Wind abbremsen und dafür sorgen, dass sich der Schnee zu Wehen anhäuft. Die Häuser sind klein und so von Schnee verklebt, dass die Fenster kaum zu sehen sind, und sie erinnern an groteske Tiere, die im härtesten Winter im Freien gelassen wurden. Eines hebt sich jedoch von den anderen ab, es ist etwa so groß wie das Haus des Arztes, hat auch zwei Stockwerke, steht ganz unten am Ufer, und Eiszapfen hängen wie lange Reißzähne von seiner Traufe. Der Junge sieht das rot gestrichene Schild erst, als er auf seinem Weg zum Strand nah am Haus vorbeigeht, er bleibt stehen, als er über dem Eingang gelbe Buchstaben durch eine Schicht Schnee schimmern sieht: KAUFLADEN. Da fällt ihm der Zettel von María an der Winterküste wieder ein. Bücher für fünf Kronen solle er, der Junge, aus dem Kaufladen von Sléttueyri mitnehmen und anschreiben lassen. Was heißt, der Zettel ist ihm eingefallen? Natürlich hat er ihn nicht vergessen. Wie hätte er María vergessen können, ihren Hunger nach Büchern und auch, wie sie ihren Mann Jón betrachtete, als wäre die Welt schön, solange sie ihn ansah. Wie kann die Welt aber schön sein, wenn das eigene Leben unter Schnee begraben liegt, wenn ein Kind gestorben ist und das andere hustet, viel zu viel hustet? Kann die Welt unter solchen Umständen schön sein? Woher nimmt sie die Kraft, sich nicht unterkriegen zu lassen? Er aber hat den Zettel verloren. Ihm wird etwas Wichtiges anvertraut, und er verliert es!
Er geht am Haus entlang weiter zum Ufer, bleibt an seinem Rand stehen und schaut über den Strand. Es ist ein Kiesstrand, günstig für eine Landung, denn es ist leicht, die Boote aufs Trockene zu ziehen. Zwei Sechsruderer liegen da, ein paar kleinere Boote, von denen einige in der Nacht oder in der Frühe auf See gewesen sind. Eine Schar Möwen streitet sich um die wenigen Reste, die vom Ausnehmen der Fische noch zwischen den Steinen liegen. Eine der Möwen fliegt auf, schwebt in der Höhe und kreischt zweimal. Das Meer wirft unter den Windstößen weiße Gischt auf, und der Junge erblickt ein auf ihn zuhaltendes Schiff, wahrscheinlich ist es ein Kutter, aber noch zu weit entfernt, um das mit Sicherheit festzustellen, und es wird mindestens noch eine Stunde dauern, bis es Land erreicht. Er schaut übers Meer, das schwer zwischen den Bergen atmet – dahinten jenseits von Meer und Bergen warten sie auf ihn, Geirþrúður, Helga und Kolbeinn, der blinde Kapitän, und sie machen sich womöglich Sorgen. Seine Fahrt mit Jens hat viel mehr Zeit in Anspruch genommen, als sich jemand vorgestellt hat. Sie gerieten in einen Sturm, verirrten sich und nahmen auch noch den längeren Weg, weil Jens nachdenken musste. Dann ist Hjalti ums Leben gekommen.
Die Möwe kreischt noch einmal. Irgendwo steht geschrieben, wer da draußen ums Leben komme, sterbe nicht voll und ganz, sondern verwandele sich in eine Möwe, werde zu einem Schrei im Wind. Der Junge steht wieder vor dem Kaufladen, Zettel hin oder her, er muss ein paar Bücher für María aussuchen und sie ihr bei nächster Gelegenheit schicken lassen, wann immer die sich ergeben mag. Er drückt gegen die Tür.
Sie klemmt. Er muss die Schulter zu Hilfe nehmen und Kraft einsetzen, es erfordert einen festen Willen, dort einzutreten, und es bleibt keinem verborgen, wenn tatsächlich jemand kommt. Jetzt werde ich beobachtet, denkt er, nachdem er die Tür aufgedrückt hat und im Laden steht. Mit erstaunlich wenig Kraftaufwand lässt sich die Tür wieder schließen. Der Junge sieht sich um, aber es ist niemand da. Das Geschäft ist nicht groß für jemanden, der Tryggvis Laden kennt und für diesen Sommer sogar Arbeit in Leós Landhandel annehmen wollte, doch dann vergaß Bárður seinen Anorak, und die Welt war nicht mehr dieselbe. Wir wissen nie, was im Leben als Nächstes kommt, wer den Tag noch bis zum Ende erlebt und wer stirbt, wir wissen nicht, ob der letzte Gruß ein Kuss, ein bitteres Wort, ein schneidender Blick sein wird, ob jemand nicht aufpasst, vergisst, nach links oder rechts zu gucken, und schon kann es zu spät sein, ein böses Wort zurückzunehmen, zu spät, sich zu entschuldigen, zu spät, noch über das wirklich Wichtige zu reden, über das, was wir eigentlich sagen wollten, was aber aus Verärgerung, Alltagsmüdigkeit oder Zeitmangel nie zur Sprache gekommen ist. Du vergisst, nach rechts zu gucken, und ich sehe dich nie wieder, das, was du mir gesagt hast, setzt sich in mir fest und brennt da bis ans Ende meiner Tage und Nächte, der Kuss, den du hättest bekommen sollen, vertrocknet auf meinen Lippen und wird zu einer Wunde, die jedes Mal aufbricht, wenn mich jemand anders küsst.
Der Junge zieht die Nase hoch, wie um die Stille zu durchbrechen. Von der Tür zur Theke sind es kaum drei Meter, die Regale stehen ziemlich leer da. In einer dunklen Ecke rechts vom Jungen gibt es einen kleinen Tisch mit vier Stühlen. Auf einem davon sitzt ein Mann und fixiert den Jungen unverwandt, der erschrickt, denn er hatte beim Eintreten nur den Tisch und die leeren Stühle wahrgenommen. Der Mann sitzt bewegungslos da, den Stuhl hat er nach hinten gekippt, sodass die vorderen Stuhlbeine vom Boden abgehoben sind, er hat dunkelbraunes Haar und trägt braune Kleidung in der gleichen Farbe wie die Wand hinter ihm.
Guten Tag, sagt der Junge, als er sich halbwegs von seinem Schreck erholt hat, und wiederholt es noch einmal, als der Mann seinen Gruß nicht erwidert. Guten Tag.
Der Mann hat die Augen offen, sein spärliches Haar ist sorgsam in der Mitte gescheitelt, er trägt einen dicken, nach unten hängenden Schnauzbart, sorgfältig gestutzt; er wirkt lang und hager, obwohl man die Figur eines Sitzenden nur schwer einschätzen kann, aber sein Hals ist ungewöhnlich lang, als ob der Kopf mit scharfen, fast gemeißelten Gesichtszügen auf einem Stiel säße.
Guten Tag, versucht der Junge es ein drittes Mal. Keine Reaktion. Kann es sein, dass der Mann gerade gestorben ist? Der Junge traut sich keinen Schritt näher, beugt sich aber vor, und nein, die Augen sind nicht gebrochen, wirken aber seltsam starr.
Sie haben …, beginnt der Junge. Ich habe gehört, Sie verkaufen auch Bücher? Zuckt da nicht ein Augenlid? Der Junge tritt unwillkürlich einen Schritt näher, und der Boden unter ihm knarrt. Manche Dielen sind gesprächiger als andere und plärren jede Bewegung aus. Die Mundwinkel des Mannes zucken, aber sonst verharrt er so reglos wie zuvor. Der Junge schluckt, er schwitzt unter seinen warmen Sachen. Es ist ihm unangenehm, so große, braune Augen leblos, aber nicht gebrochen auf sich geheftet zu haben und nicht zu wissen, was er tun soll. Soll er ins Arzthaus zurücklaufen und Hilfe holen? Vielleicht schwebt der Mann in Lebensgefahr, der Tod greift nach ihm, und er fragt ihn, ob er Bücher verkaufe!
Soll ich Hilfe holen?, fragt er, beugt sich vor und blickt nun direkt in die stieren Augen. Stimmt mit Ihnen etwas nicht?, erkundigt er sich dann wie ein Idiot, denn ganz offensichtlich stimmt mit dem Mann etwas nicht.
Nein, antwortet eine Frauenstimme, das wäre zu viel behauptet.
Sie steht in der Tür hinter der Ladentheke, der Flur dahinter ist so dunkel, als käme sie direkt aus dem Totenreich.
Entschuldigung, sagt der Junge, noch immer von ihrem Erscheinen erschreckt. Guten Tag, setzt er hinzu.
Bist du sicher, dass er so gut ist?, fragt die Frau und tritt vor. Sie ist groß, von schwerem Körperbau, und ihr Gesicht ist zu grobknochig, um schön zu sein; es liegt ein harter Zug darin. Der Junge antwortet nichts, weiß auch nicht, was er darauf sagen sollte.
Du bist wohl einer von den beiden, die mit der Post gekommen sind.
Er nickt.
Und jetzt fragst du nach Büchern.