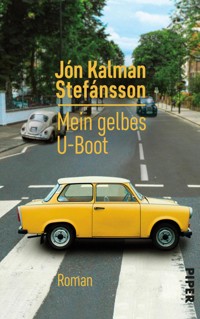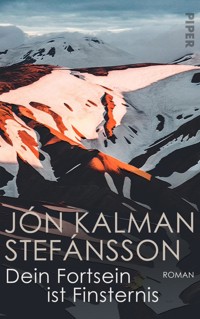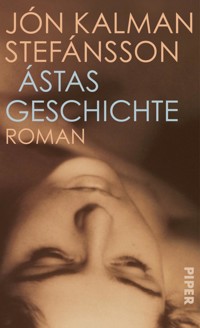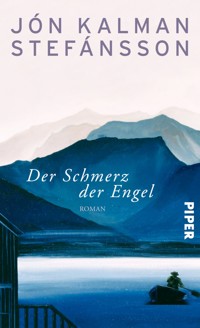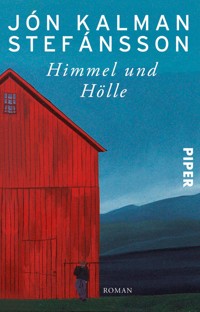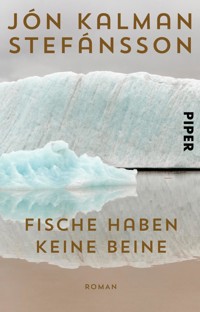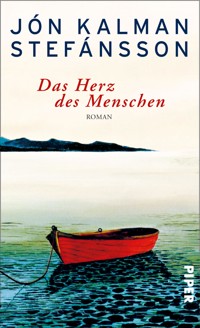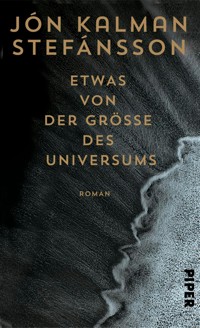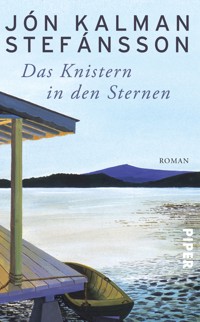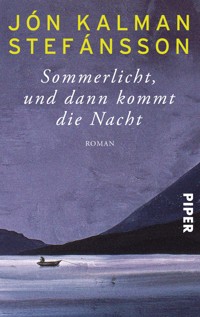
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wie nur erträgt man die langen dunklen Winter dicht am Polarkreis auf der Suche nach ein bisschen Leben und Liebe? Eine Frage, mit der sich auch die Bewohner eines kleinen 400-Seelen-Orts im äußersten Westen Islands konfrontiert sehen. Stets sind sie in Gefahr, in Kleinstadtlethargie zu verdämmern – und so müssen sie selbst dafür sorgen, dass ihre Tage aufregend werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Übersetzung aus dem Isländischen von
Karl-Ludwig Wetzig
Die Arbeit an dieser Übersetzung wurde vom Fund for the Promotion of Icelandic Literature, Reykjavík, gefördert.
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
1. Auflage 2013
ISBN 978-3-492-96121-9
© 2005 Jón Kalman Stefánsson
Titel der isländischen Originalausgabe:
»Sumarljós og svo kemur nóttin«, Bjartur, Reykjavík 2005
© der deutschsprachigen Ausgabe: 2008 Philipp Reclam jun., Stuttgart
Umschlaggestaltung: Cornelia Niere, München
Umschlagabbildung: Beatrice Boissegur (Contemporary Artist)/Bridgeman Archives
Datenkonvertierung E-Book: Kösel, Krugzell
Was für eine armselige Welt wäre das ohne sie?
Jetzt hätten wir beinah geschrieben, dass die Besonderheit des Örtchens darin bestand, keine Besonderheit aufzuweisen, aber das ist nicht ganz richtig. Sicher gibt es auch andere Orte, in denen die allermeisten Häuser nicht älter als neunzig Jahre sind, Orte, die sich nicht mit irgendwelchen Berühmtheiten schmücken können, mit Menschen, die sich im Sport oder in der Politik hervorgetan haben, im Wirtschaftsleben, in der Literatur oder in der Welt des Verbrechens. Eins scheinen wir anderen Orten dieser Art aber vorauszuhaben: hier gibt es keine Kirche. Und auch keinen Friedhof. Dabei hat es wiederholt Versuche gegeben, diese Sonderstellung zu ändern, und eine Kirche hätte der Umgebung zweifellos eine andere Wirkung verliehen, leises Geläut von Kirchenglocken kann deprimierte Menschen wieder aufrichten, Glocken tragen uns Neuigkeiten aus der Ewigkeit zu. Und auf Friedhöfen wachsen Bäume, in denen Vögel sitzen und singen. Sölrün, die Leiterin der Vorschule, hat schon zweimal versucht, Unterschriften für drei Dinge zu sammeln: für eine Kirche, für einen Friedhof und für einen Pfarrer. Das Höchste, was sie zusammenbrachte, waren dreizehn Namen, und das reicht nicht für einen Pastor, geschweige denn für eine Kirche oder gar einen Friedhof. Wir sterben selbstverständlich wie andere auch, aber viele von uns erreichen doch ein hohes Alter, prozentual gibt es nirgends im Land mehr Menschen über achtzig, was sich vielleicht als Besonderheit Nummer zwo anführen lässt. Etliche unserer Mitbürger gehen auf die hundert zu, der Tod scheint sie vergessen zu haben, und wir hören sie in den Abendstunden kichern, wenn sie auf dem Platz hinter dem Altersheim Minigolf spielen. Bis jetzt hat noch niemand eine Erklärung für dieses hohe Durchschnittsalter gefunden, aber ob es nun an der Ernährung, der Einstellung zum Leben oder der Ausrichtung der Berge liegen mag, unbedingt haben wir unsere hohe Lebenserwartung jedenfalls dem Umstand zu verdanken, dass es weit bis zum nächsten Friedhof ist; und deswegen zögern wir, Sölrüns Liste zu unterschreiben, insgeheim überzeugt, dass der, der das tut, sein eigenes Todesurteil unterzeichnet und den Tod geradezu herbeiruft. Das ist bestimmt blanker Unsinn, aber wenn der Tod im Spiel ist, können selbst wilde Spekulationen überzeugend wirken.
Ansonsten gibt es nichts Bemerkenswertes über uns zu sagen.
Ein paar Dutzend Einfamilienhäuser stehen hier herum, die meisten mittelgroß und von uninspirierten Architekten oder Ingenieuren entworfen. Schon merkwürdig, was für geringe Anforderungen wir an Menschen stellen, die derart unsere Umgebung prägen. Außerdem gibt es drei Reihenhäuser mit je sechs Wohnungen und ein paar hübsche Holzhäuser aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, das älteste ist achtundneunzig Jahre alt, 1903 erbaut und so morsch, dass große Autos lieber ganz langsam daran vorbeifahren. Die größten Gebäude sind der Schlachthof, die Molkerei, der Genossenschaftsladen und die Strickfabrik, keins von ihnen sieht ansprechend aus, dafür gibt es aber eine kurze Mole, die vor fünfzig Jahren ins Meer hinausgebaut wurde. Nie legen dort Schiffe oder Boote an, aber es macht Spaß, von der Mole zu pinkeln, hört sich lustig an, wenn der Strahl aufs Meer plätschert.
Der Ort liegt ungefähr in der Mitte des Bezirks, im Norden, Süden und Osten von verstreuten Bauernhöfen umgeben, im Westen vom Meer. Es ist schön, über den Fjord zu blicken, auch wenn es darin seit eh und je keinen Fisch gibt. Im Frühjahr lockt der Fjord fröhliche und zuversichtliche Watvögel an, manchmal liegen Muscheln am Strand, und in der Ferne erheben sich Tausende kleiner Inselchen wie eine lückenhafte Zahnreihe aus der See; abends verblutet die Sonne daran, und dann denken wir an den Tod. Du bist vielleicht der Ansicht, es sei nicht gesund, an den Tod zu denken, es ziehe den Menschen herab, mache ihn fertig, erfülle ihn mit Verzweiflung, belaste das Herz-Kreislauf-System, wir aber behaupten, man müsse buchstäblich schon tot sein, um nicht an den Tod zu denken. Hast du andererseits schon einmal darüber nachgedacht, wie viel vom Zufall abhängt? Vielleicht alles. Das kann ein verdammt unangenehmer Gedanke sein, Zufallsereignisse haben selten Hand und Fuß, und unser Leben ist kaum etwas anderes als ein zielloses Herumtreiben, dieses Leben, das sich in alle Richtungen auszudehnen scheint und dann mitten in einem Satz abbricht – vielleicht wollen wir dir genau darum Geschichten aus unserem Ort und der umliegenden Gegend erzählen.
Wir wollen nicht vom ganzen Ort berichten, nicht Haus für Haus durchgehen, das würdest du gar nicht aushalten; aber wir berichten sicher von der Lust, die Tage und Nächte miteinander verknüpft, von einem glücklichen Fernfahrer, von Elisabets dunklem Samtkleid und von dem, der mit dem Bus kam; von der hochgewachsenen Puridur, die voll heimlicher Sehnsucht steckt, von dem Mann, der die Fische nicht zählen konnte, und der Frau mit den schüchternen Atemzügen; von einsamen Bauern und einer viertausend Jahre alten Mumie. Wir erzählen von alltäglichen Begebenheiten, aber auch von solchen, die unser Verstehen übersteigen, weil es für sie vermutlich einfach keine Erklärungen gibt; Menschen verschwinden, Träume verändern ein Leben, fast zweihundert Jahre alte Menschen scheinen auf sich aufmerksam zu machen, anstatt ruhig da zu liegen, wo sie hingehören. Und natürlich wollen wir dir von der Nacht erzählen, die über uns hängt und ihre Kraft tief aus dem Weltraum zieht, von den Tagen, die kommen und gehen, von Vogelgezwitscher und letzten Atemzügen; bestimmt werden es viele Geschichten. Hier im Ort fangen wir an und werden auf einem Hof nördlich davon enden, und jetzt fangen wir wirklich an, jetzt geht‘s los, Freude und Einsamkeit, Bescheidenheit und Unsinn, Leben und Traum – ach ja, Träume.
Das All und ein dunkles Samtkleid
Eines Nachts begann er auf Latein zu träumen. Tu igitur nihil vidis? Es blieb lange unklar, um welche Sprache es sich handelte, er selbst glaubte, es sei eine ganz eigene, selbstgebastelte, in Träumen gibt es schließlich mancherlei und so weiter. Damals sah es hier im Ort noch ziemlich anders aus, wir bewegten uns langsamer, und die Genossenschaft hielt alles zusammen, er hingegen war Chef der Strickfabrik, gerade dreißig geworden. Er hatte Erfolg auf der ganzen Linie und war mit einer so gutaussehenden Frau verheiratet, dass manch einem innerlich ganz anders wurde, wenn er sie sah. Die beiden hatten zwei Kinder, und wir gehen davon aus, dass eines von ihnen, Davið, hier auf diesen Seiten noch Vorkommen wird. Der junge Chef schien ein geborener Siegertyp zu sein, er und seine Familie wohnten im größten Einfamilienhaus des Orts, er fuhr einen Range Rover und ließ sich seine Garderobe maßschneidern, wir anderen nahmen uns neben ihm alle ziemlich grau aus, doch dann begann er auf Latein zu träumen. Es war der alte Doktor, dem am Ende aufging, um welche Sprache es sich handelte, leider starb er bald darauf, als dieses Mistvieh von Guöjön ihn kläffend anfiel; das alte Herz blieb vor Schreck stehen. Wir haben den verdammten Köter gleich am nächsten Tag erschossen, hätten wir’s nur früher getan. Guöjön drohte mit einer Anzeige und schaffte sich einen neuen Hund an, der noch schlimmer ist als der vorige. Manch einer von uns hat schon versucht, ihn zu überfahren, aber das Biest ist schnell. Der alte Doktor konnte so gut wie kein Latein, nur ein paar Worte und die Bezeichnungen von Organen, aber das reichte, als sich der Fabrikleiter endlich den oben zitierten Satz merken konnte.
Wer anfängt, auf Latein zu träumen, ist wohl kaum aus alltäglichem Holz geschnitzt. Englisch, Dänisch, Deutsch, meinetwegen Französisch und sogar Spanisch, es ist gut, ein paar dieser Sprachen zu können, die Welt in einem wird größer, aber Latein, das ist ganz was anderes, das ist so viel mehr, dass wir uns kaum trauen, es uns weiter auszumalen. Der Geschäftsführer aber war ein Mann der Tat, den hielt wenig auf, er wollte alles um sich herum im Griff haben, und daher irritierte es ihn mächtig, als sich seine Träume mit einer Sprache füllten, von der er kein Sterbenswörtchen verstand. Dagegen gab es nur eins: in die Hauptstadt zu fahren und einen zweimonatigen Privatintensivkurs in Latein zu absolvieren.
In jenen Jahren trat er noch großartig, ja, fast großspurig auf. Er rauschte in seinem Range Rover nach Süden und kaufte für seine Frau einen neuen Toyota Corolla, Automatik, damit sie ihre schönen und schlanken Beine nicht überstrapazieren musste, während er sich in der Stadt aufhielt, was allerdings vollkommen überflüssig war, denn manch einer hätte sich nur zu gern freiwillig erboten, sie durch alle Straßen des Ortes und über alle Stufen des Lebens zu tragen. Er aber rauschte in seinen maßgeschneiderten Anzügen mit entschlossener und ungeduldiger Miene in die Stadt, das Gesicht wirkte selbstsicher, aber tief in ihm – doch das wussten wir damals selbstverständlich nicht – breiteten sich stille Träume aus wie ein weiter See, und am Ufer erwartete ihn ein Kahn.
Zwei
Wir hätten es schon ganz gut gefunden, eine Erklärung oder Erklärungen für die gewaltige Veränderung, ja, diesen Persönlichkeitswandel des Fabrikleiters zu bekommen. Denn er fuhr in die Stadt und kam völlig verändert zurück, als ein Mann, der dem Himmel näher war als der Erde. Ja, er kam aus dem Süden zurück und brabbelte Latein, was uns zunächst Sand in die Augen streute, wir bemerkten seine Verwandlung anfangs nicht, er fuhr ja auch noch den Range Rover, die Kleidung sah allerdings schon ein wenig vernachlässigt aus, seine Stimme klang leiser, die Bewegungen waren langsamer und außerdem schien er neue Augen bekommen zu haben. Der unbeirrbar feste Blick war verschwunden und etwas anderes an seine Stelle getreten, für das wir keinen Namen hatten, vielleicht Geistesabwesenheit oder Verträumtheit, zugleich aber machte es den Eindruck, als würde er alles durchschauen, das ganze Theater, das Gerede und den Lärm, die unser Leben kennzeichnen, Sorgen um Übergewicht, Geld, Falten, Politik oder die Frisur. Vielleicht hätten wir alle in die Stadt fahren sollen, um Latein zu lernen und diesen neuen Blick, dann hätte unser Ort wahrscheinlich abgehoben und wäre in den Himmel geschwebt. Aber natürlich fuhren wir nicht, du weißt, wie das ist, jeder steckt im Sumpf seiner Gewohnheiten unverrückbar fest. Und genau die, diese monotone Ansagerinnenstimme des Alltags, gewöhnte uns sehr schnell an die neuen Augen, an die hudeligen Klamotten, das andere Auftreten. Die Menschen verändern sich doch sowieso andauernd, entwickeln neue Interessen, färben sich die Haare, gehen fremd oder geben für immer den Löffel ab; völlig aussichtslos, da stets auf dem Laufenden zu bleiben, und außerdem haben wir genug damit zu tun, das Summen im eigenen Kopf wahrzunehmen. Ein gutes Jahr nach dem Lateinkurs des Fabrikchefs traf in der Post eine Sendung aus dem Ausland ein, ein Paket mit der Aufschrift »Vorsicht« in neun Sprachen. Agüsta, die einzige Postangestellte, war so beeindruckt, dass sie die Verpackung nicht zu öffnen wagte, und wir mussten also etliche Tage warten, bis wir erfuhren, was es enthielt. Wie du dir vorstellen kannst, wurde heftig spekuliert, und es kursierten verschiedene Theorien, die sich aber alle als abwegig herausstellten, denn in dem Paket befand sich nichts weiter als ein Buch, immerhin ein altes und weltberühmtes: Sidereus nuncius oder Sternenbotschaft von Galileo Galilei. Es handelte sich um die Erstausgabe, was ja nicht wenig heißt, denn das Werk ist vor gut 400 Jahren erschienen, auf Latein, und an einer Stelle heißt es:
»Ich ließ irdische Erwägungen fahren und wandte mich Himmlischem zu.«
Besser kann man die Veränderungen unseres Fabrikleiters nicht beschreiben, den alle, nachdem der Inhalt des Pakets erst bekannt geworden war, nach einem alten, vor vielen Jahren gestorbenen Sonderling nur noch den Astronomen nannten. Ursprünglich natürlich als Spottname gedacht, setzte sich die Bezeichnung sogleich durch, und ebenso rasch verlor sich der Spott. Es war seine Frau, die uns von dem Buch erzählte, es schien ihr ein wirkliches Anliegen zu sein, so viel wie möglich über die Veränderungen ihres Mannes mitzuteilen, und du darfst uns glauben, dass viele bereit waren, ihr zuzuhören. Oft benutzte sie schwarzen Lippenstift, wenn du sie nur hättest sehen können in ihrem grünen Pullover, dermaßen schön und so sexy, sie kam in unseren Träumen vor, und manch einer wie zum Beispiel Simmi, der mittlerweile auf die fünfzig zuging, Junggeselle und totaler Pferdenarr, besaß ein Dutzend Pferde, war völlig hin und weg von ihr und erwog schon, aus der Gegend fortzuziehen, um anderswo sein Gleichgewicht wiederzufinden. Er ritt jeden Morgen aus und nicht selten an ihrem Haus vorüber in der Hoffnung, wenigstens einen ganz kurzen Blick auf sie werfen zu können. Eines Tages sattelte Simmi seinen Rappen, ritt los und sah, wie sie aus dem Haus gerannt kam.
Erst schlug er einen großen Bogen, um ihr dann geradewegs entgegenreiten zu können, und sie begegneten sich, sie mit diesen schwarzen Lippen, diesem fein geschnittenen Gesicht, den roten Haaren, der Nase wie eine Träne, die Augen so blau, und unter ihrem flatternden Anorak trug sie den grünen Pullover – eine Schönheit, eine Offenbarung, und keiner weiß, wie es passieren konnte, aber Simmi, dieser geübte Reiter, fiel vom Pferd. Die Schönheit hat mich aus dem Sattel gehauen, pflegte er später zu sagen, aber manch einer behauptete, er habe sich einfach fallen lassen, in einem Anfall rasender Verzweiflung oder spontaner Verrücktheit. Er brach sich einen Oberschenkel und prellte sich einen Arm, und so lag er dann da, kein Arzt im Ort, der alte war gerade drei Tage zuvor gestorben, verdammter Hund, dieser dämliche Guöjön, und ein neuer würde nicht vor Ablauf einer Woche eintreffen, bis dahin hatten wir gefälligst gesund zu bleiben, Herzkranke sollten es ruhig angehen lassen, und da fällt dieser Simmi vom Pferd. Sie läuft zu ihm, beugt sich über ihn, die Augen blauer als sonst was. Eigentlich hätte man ihn ins Krankenhaus in der Hauptstadt bringen müssen, aber solchen Aufwand und derartiges Brimborium mögen wir hier nicht, und so sprang der Tierarzt ein und machte seine Sache gut, Simmi hinkt heute nur noch ganz wenig. Jene Minuten aber, in denen sie sich über ihn beugte und ihn mit ihrem süßen und warmen Duft anhauchte, sind nach wie vor die kostbarsten in seinem Leben, Augenblicke, die er sich wieder und wieder ins Gedächtnis ruft. Sie dagegen denkt wahrscheinlich nicht gern an den Vorfall zurück, denn es war der Zeitpunkt, an dem sie erfahren hatte, dass ihr Mann für die Sternenbotschaft von Galileo den Range Rover und auch den Toyota verkauft hatte. Ihm erschien das so vollkommen selbstverständlich, dass er ihr nicht einmal davon erzählt hatte, was vermutlich das Allerschlimmste an der Sache war, jedenfalls hatte sie zu toben begonnen, so wütend und verzweifelt, dass sie kaum Luft holen konnte, ihre Welt zerfiel um sie her, und da kam dieser Reiter angehoppelt.
Es zerreißt etwas in dir, zum Beispiel eine Saite deines Herzens, wenn der Mensch, den du in- und auswendig zu kennen meinst, der dich innerlich in Brand gesteckt hat, den du geheiratet, mit dem du Kinder bekommen, ein Heim gebaut hast und mit dem du viele Erinnerungen teilst, eines Tages urplötzlich wie ein Fremder vor dir steht. Natürlich ist es Unfug, zu glauben, man würde einen anderen wirklich in- und auswendig kennen, immer gibt es noch irgendwo einen tief im Schatten verborgenen Winkel, ganze Gelasse womöglich, aber gut, sie also war mit einem noch leidlich jungen Mann verheiratet, der über gesellschaftlichen Einfluss verfügte, der zu den Stützen der Gesellschaft zählte, ein ziemlich aussichtsloses Unternehmen blühte unter seiner Leitung auf und warf sogar Gewinn ab, er war ein Vorbild, er war ein Hoffnungsträger, doch dann fing er an, auf Latein zu träumen, fuhr in die Stadt, um diese Sprache zu lernen, kam mit neuen Augen zurück und verkaufte im nächsten Jahr seine Autos, um damit ein paar alte Schwarten zu bezahlen. Verglichen damit ist der Fall eines Reiters vom Pferd eine Lappalie, und doch ist das alles erst der Anfang. Die Tage erhoben sich im Osten und versanken im Westen, der Astronom wurde in der Strickfabrik kaum noch gesehen, und Agüsta legte nicht selten den Weg von der Post zum Privathaus dieses Paares zurück und überbrachte neue Sendungen, manche mit Vorsicht in neun Sprachen gekennzeichnet.
Drei oder vier Wochen, nachdem der Italiener Galileo die Eheleute um ihre beiden Autos gebracht hatte, erhielt der Astronom ein noch älteres Buch. De revolutionibus orbium coelestium oder Über die Kreisbewegungen der Weltkörper von Nikolaus Kopernikus, erschienen 1543. Es kostete ein kleines Sümmchen, das Eigenheim der beiden hätte gerade so gereicht, aber die Geduld derjenigen, nach der sich manch einer sehnt, reichte nicht mehr und sie riss endgültig, als ihm die Schriften Johannes Keplers zugestellt wurden, die Rudolfinischen Tafeln, die Weltharmonik in fünf Büchern und Somnium oder Der Traum. Schon bevor sie in der Postfiliale eintrafen, hatten etliche versucht, den Astronomen zur Räson zu bringen, der Filialleiter der Bank, der Landrat, der Schulrektor, der Betriebsrat der Strickereibelegschaft. Sie hatten ihn gefragt: Was machst du eigentlich mit eurem Leben, du lässt es für Bücher vor die Hunde gehen, du löst eure Sparbücher auf, verlierst das Haus, du verspielst dein Leben, krieg dich wieder ein, nimm Vernunft an! Aber es war völlig umsonst, er schaute die Leute bloß mit seinen neuen Augen an, lächelte, als würde er sie bedauern, und sagte etwas auf Latein, was kein Mensch verstand. Das Weitere muss nicht eigens ausgeführt werden, fünfzehn Jahre sind seitdem vergangen, mittlerweile besitzt er rund 3000 Bücher, und es werden noch mehr, sie bedecken die Wände des kleinen Hauses, nicht wenige sind auf Latein geschrieben wie die meisten von denen, die ihn um Schönheit, Luxus und Familienleben brachten.
Kurz nachdem Agüsta das Paket mit den Schriften Keplers zugestellt hatte, zog die Frau mit der Tochter nach Reykjavik, Davið hingegen blieb bei seinem Vater, der das zweigeschossige Holzhaus hier gleich oberhalb des Ortskerns kaufte, das seit dem Tod der alten Bogga leer gestanden hatte, von dem niemand etwas ahnte, bis der Wind drehte und der Gestank über die Häuser bis zur Molkerei zog. Auch in kleinen Orten gibt es Einsamkeit. Als der Astronom das Haus erwarb, glich es einem ausgedienten alten Klepper, halbblind und in den letzten Zügen, aber er ließ das morsche Holz durch frisches ersetzen und die gesprungenen Fensterscheiben durch neue stell dir nur einmal vor, wir könnten morsche Weltbilder und sterbende Kulturen ebenso leicht erneuern -, dann ließ er das gesamte Haus pechschwarz streichen, bis auf ein paar weiße Punkte auf drei Seiten und dem Dach. Die Punkte stellten seine Lieblingssternzeichen dar: den Großen Wagen, die Pleiaden, Kassiopeia und Boötes den Hirten oder Bärenführer. Die vierte Seite ist komplett schwarz, sie geht nach Westen, aufs Meer, und bezeichnet das Ende der Welt. Nicht besonders aufmunternd, aber es ist wenigstens die der Straße abgewandte Seite. Wenn man aus den südlichen Tälern kommt, ist das Haus des Astronomen das Erste, was man von unserem Ort sieht; tagsüber wirkt es, als sei ein Stück des Nachthimmels zur Erde und auf unseren Ort gefallen. Im Dach des Hauses befindet sich ein großes, zu öffnendes Fenster, und spätabends lugt oft ein Teleskop heraus, ein Auge, das die Fernen zu sich heransaugt, Dunkelheit und Licht. Mittlerweile lebt er allein im Haus, Davið ist mit siebzehn in ein anderes Haus mitten im Ort gezogen, und zuweilen lauscht er dem Geräusch, mit dem das Winterdunkel gegen die Fensterscheiben der Häuser drück.
Drei
In den besten Zeiten waren bei Prjónastofa, der Strickerei, zehn Mitarbeiter beschäftigt, was für einen Ort von vierhundert Einwohnern nicht wenig ist. 1983 war sie in drei Monaten erbaut worden, 380 Quadratmeter auf zwei Stockwerken. Wer im Obergeschoss aus dem Fenster schaut, blickt über das Dach des Schlachthofs hinweg auf den Fjord. Die Fabrik wurde vom Staat errichtet, und derartige Gebäude wachsen so langsam und zögerlich, dass man den Eindruck bekommt, der Bau könne jeden Tag eingestellt werden, und allmählich vergessen die Leute den ursprünglichen Bestimmungszweck des Bauwerks. Doch so vieles ist vom Zufall abhängig. Die Farben auf den Bergen, der Frühjahrsschnupfen, das Bautempo von Häusern. In dem Fall lag es an zwei Parlamentsabgeordneten und einem Besäufnis. Der eine war aus der konservativen Fortschrittspartei, der andere aus dem ehemaligen Sozialistenbündnis. Im Lauf der Nacht schlossen sie eine Wette darauf ab, wer von beiden in seinem Wahlkreis schneller ein Unternehmen mit zehn Angestellten in neuen Räumlichkeiten aus dem Boden stampfen könne. Dem verdankt Prjónastofa ihre Entstehung. Unter der tatkräftigen und eifrigen Leitung des blutjungen Geschäftsführers, der eigentlich gerade auf dem Sprung stand, die Welt zu erobern, als ihm der Mann von der Fortschrittspartei den Job anbot, nahm die Fabrik im Herbst 1983 den Betrieb auf. Es folgten zehn helle und erfolgreiche Jahre. Im Erdgeschoss tickten die Maschinen, im Obergeschoss lagen Kantine, Toiletten und sogar eine Dusche, und dem Jungmännerverein des Orts war dort für seine Aktivitäten ein Raum überlassen worden. Gute Jahre; uns kamen sie vor wie der Anfang von etwas Großem, wir waren überzeugt, dass unser Dorf nicht ausbluten würde wie so viele andere. Wir sahen zum Fabrikleiter auf und fühlten uns sicher. Die Maschinen klickten, und ein Strom von Strümpfen, Pullovern, Mützen und Handschuhen wuchs aus ihnen hervor. Es gab schöne Momente, da kam man in den Genossenschaftsladen und sah fünf Bauern im Gespräch beieinanderstehen, die alle Kleidung aus unserer Strickfabrik trugen. Damals gab es noch Schönheit und Harmonie in der Welt, und wir vermissen diese Zeiten. Aber alles geht einmal zu Ende, und das ist die einzige Gewissheit, auf die man sich in diesem Leben verlassen kann. Tu igitur nihil vidis. Der Fabrikleiter träumt auf Latein und verwandelt sich in einen Sterngucker, der Geländewagen, Haus, Frau, Familienleben und eine glänzende Zukunft aufgibt und sich dafür den Himmel und ein paar alte Bücher einhandelt. Eines Tages Mitte der neunziger Jahre wurden die Maschinen aus dem Erdgeschoss auf einen großen Laster verladen, und es begannen schwere Monate, Sonne und Mond schienen durch die Fenster in eine leere Fabrikhalle.
Es wäre ungerecht von uns, den Traumgespinsten eines einzigen Mannes diese schlimmen und bedrückenden Veränderungen zuzuschreiben; du würdest darüber wahrscheinlich den Glauben an die Richtigkeit unserer Darstellung und sogar an unsere Glaubwürdigkeit verlieren, und wozu sollten wir dann noch weitererzählen? Die Maschinen der Strickerei wurden anderswohin verfrachtet, in einen Ort im Osten, in dem sie dringender gebraucht wurden, wo noch mehr Wählerstimmen arbeitslos herumliefen. Sicher hätte es etwas geändert, wenn sich der Geschäftsführer dagegen ausgesprochen hätte; es fällt schon ins Gewicht, wenn umfassende Kompetenz, ein neuer Geländewagen und maßgeschneiderte Anzüge Widerstand leisten. Wir wissen nicht mehr ganz genau, wie lange das Erdgeschoss der Fabrik leer stand, aber ein ganzes Jahr lang kassierte der Astronom noch als Geschäftsführer eines Geisterhauses seine üppigen Bezüge. Die einfachen Mitarbeiter hingegen landeten gleich auf der Straße, neun Angestellte, sieben Frauen und zwei Männer. Die Männer fielen auf die Füße, sprachen mit ein paar alten Kumpeln aus dem Fußballverein, aus der Schule oder dem Rotaryklub; diese Welt ist doch eine Männerseilschaft. Der eine, Gunnar, wurde Assistent unseres Elektrikers Simmi, der andere, Asgrimur, aber Ossi genannt, wurde Gehilfe von Klempner, Maurer und Schmied, teilt seine Arbeitszeiten zwischen ihnen auf und hat sich mit der Zeit zu einem vielseitigen und gefragten Handwerker entwickelt. Ossi dankt der Vorsehung täglich, dass sie die Strickmaschinen anderswohin geschickt hat, näher zum Sonnenaufgang.
Von den sieben Frauen sind fünf noch immer arbeitslos, obwohl inzwischen fünf Jahre vergangen sind. Fünf arbeitslose Frauen, das macht zusammen zehn beschäftigungslose Hände. Die beiden anderen Frauen hatten mehr Glück. Von Elisabet berichten wir später mehr, die andere, Helga, sitzt fünf Tage die Woche zwischen 8 und 17 Uhr am Telefon.
Wahrscheinlich hat unsere Schulleiterin, Sólrún, Helgas Stelle geschaffen. Sólrún machte sich seit langem Sorgen über den Stress, das Übel unserer Zeit, über das Tempo, die Belastung, das Leben. Sie zog irgendwo im System an den Strippen, schrieb Briefe, redete mit maßgeblichen Leuten, und man setzte Helga ans Telefon, wo sie noch heute sitzt. Ihre Arbeit, die eine Art Projekt oder Innovation darstellt – wir kennen uns mit den Begriffen nicht so aus -, besteht darin, ihren Anrufern zuzuhören, hier und da ein Wort einzuwerfen, vielleicht auch mal einen ganzen Satz, und ansonsten aber unter allen Umständen die Ruhe zu bewahren. So einfach ist das; dabei ist es vielleicht gar nicht so einfach. Manche Leute rufen bloß an, um ein Schwätzchen zu halten, fühlen sich allein, wollen nur einmal jemand anderen atmen hören, andere hingegen müssen einmal alles loswerden, all das Nichtauszuhaltende, die ganze Unruhe und Zappeligkeit, die unsere kurzatmige Gegenwart in uns aufwühlt. Sölrun behauptete, Helgas Arbeit würde Leuten den Stress abnehmen, anderen die brennende Einsamkeit erleichtern. Stress nannte sie in einem der von ihr geschriebenen Briefe »ein Phänomen, das sich in uns aufstaut und das ab und zu einmal abgelassen werden muss«.
Helga ist um die vierzig, unverheiratet, hat ein Kind und einen schönen, weichen Hals. Der Vater ihres Kindes, ein Bauer im Süden des Landkreises, denkt oft an sie und an den Hals, den er in Gedanken oft küsst; genau wie wir vielleicht. Sie mag ihre Arbeit, sie vertieft sich in dicke Wälzer über Psychologie, liest Bücher, die versuchen, unsere Zeit zu deuten, viele von ihnen sind auf Englisch, und Helga ist oft dankbar, dass sie den Job in der Strickfabrik los ist. Natürlich gibt es auch schwierige Tage, an denen Leute anrufen, die dermaßen fertig sind vom Stress, dass sie nur noch brüllen können, oder sie sind so aufgeregt und wütend, dass sie Helga beschimpfen, das erleichtert. Nach einer Weile geht es ihnen besser, aber von Helgas Ohren kräuselt abends noch leichter Brandgeruch auf, wenn sie für sich und ihre Tochter den Tisch deckt. Einzelnen tat es hinterher so leid, dass sie am Telefon die Beherrschung verloren hatten, dass sie ihr Dinge schickten, die man als Zeichen des Bedauerns, der Dankbarkeit oder Wiedergutmachung verstehen kann. Anton, der Taxifahrer im Ort, schickte ihr schon Blumen, Pralinen, Rotwein, einen Sechserpack Bier, eine Flasche Wodka, ein Buch, einen kleinen Welpen und einmal ein dunkles Lamm mit Augen, in denen sich der Himmel spiegelte. Aus dem Welpen wurde ein echter Vorzeigehund, aus dem Lamm ein ausgewachsenes Schaf, das seine besten Tage in Helgas Garten verbringt. Es ist schön, sie durch den Ort gehen zu sehen. Wir schließen sie in unsere Abendgebete ein und sagen: Sorge dafür, dass die üblen Beschimpfungen nicht Helgas schönen Kopf platzen lassen.
Mit den Beschimpfungen meinen wir nicht nur das, was ihr Leute, verstört und fertig von der Gegenwart, durch den Telefonhörer an den Kopf werfen, wir denken dabei vor allem auch an die fünf Frauen oder zehn Hände, die keine Arbeit mehr gefunden haben. Seit dem Tag, an dem die Maschinen aus der Strickerei auf den LKW verladen wurden, treffen sie sich zweimal die Woche, leisten einander Gesellschaft und füllen die Leere aus, die die Arbeitslosigkeit hinterlässt. Zehn Hände in einem Wohnzimmer, zehn arbeitslose Hände, die einmal Teile eines Kreislaufs waren, die zum täglichen Leben beitrugen, aber sieh sie dir jetzt an: welch eine Verschwendung von Händen, und die Zeit vergeht. Sie sprechen nicht immer gut von Helga, sie würden ihre Arbeit besser machen, den ganzen Quatsch beiseitelassen, die Psychologiebücher, das dunkle Schaf, und sie würden ein rotes T-Shirt über schwarzen Jeans anziehen, und ihre zehn Hände fuchteln herum wie ein Bienenschwarm. Mittlerweile rufen Helga nämlich auch Kerle an, um über ihre Ehe zu reden, sich über ihre Frauen zu beschweren, über nicht genügend Sex. Witwer, Geschiedene und Unverheiratete rufen an und reden von der Einsamkeit. Wir sollten uns beim Sozial- und Familienministerium beschweren, sagt eine von ihnen, oder fällt so eine Arbeit in die Zuständigkeit des Gesundheitsministers? Sie sind sich nicht sicher, und Monate gehen ins Land, die fünf Frauen verfolgen die Serie Einblick/Ausblick, Kochsendungen, Talkshows, und eigentlich ist es ein Fulltimejob, das Fernsehprogramm und das Ortsleben im Auge zu behalten, auch wenn es in den letzten Jahren immer schwieriger geworden ist, zwischen beiden noch zu unterscheiden. Aber da sind zehn arbeitslose Hände, ein Wohnzimmertisch voller Kuchen, Gebäck, Kaffeekannen, Rezepten, Ratgebern und Bestsellerromanen, es ist Sommer, es ist Winter, leuchtendes Sommerlicht und pechschwarze Nächte.
Vier
Hier am Ende der Welt ließe sich kaum leben, wenn der Winter nicht so lang und der Himmel nicht so dunkel wäre. An den Winterabenden stromert der Astronom ums Dorf und hat die Augen zum Himmel gerichtet; manchmal mit einem starken Fernglas, und wenn er nicht draußen unterwegs ist, hockt er an seinem großen Teleskop, das die Fernen auf den Ort herabsaugt, oder er sitzt über Bücher gebeugt, manche von ihnen in dieser alten Sprache, Latein, geschrieben, oder er sieht etwas im Computer nach und denkt viel. Sein Haar wird grau, er ist sehr klug, versteht vieles im Dasein, das wir nicht begreifen. Einige von uns haben ihn gefragt, ob er Gott gesehen habe da oben, aber der Astronom spricht nicht von Gott, vielleicht reicht es, den Himmel und Latein zu haben, die Sterne lassen einen nie im Stich, und das lässt sich von Gott leider nicht behaupten. Die Sterne sind unendlich nah, wenn auch wir Alltagsmenschen Sterne und Nähe nicht leicht unter einen Hut bringen. Reykjavik ist ja schon ein gehöriges Stück weit weg, Sydney in endloser Ferne, und doch ist es nur ein Katzensprung im Vergleich zum Mars, dem nächsten Planeten, in 230 Millionen Kilometern Entfernung. Dahin wäre der Astronom mit seinem alten Mazda, der es – allerdings nur bergab mit Rückenwind – gerade mal auf 110 Stundenkilometer bringt, ganz schön lange unterwegs. Aber natürlich verhält sich alles ganz anders und genau entgegengesetzt, die meisten Wörter haben so viele Seiten, dass uns schwindlig wird, der Mensch, mit dem du zusammenlebst, kann zum Beispiel gleichzeitig noch viel weiter von dir entfernt sein als der Mars, und kein Teleskop und kein Raumschiff können den Abstand zwischen euch überbrücken. Aber keiner lebt vom Himmel allein, es ist Jahre her, seit die Strickfabrik geschlossen wurde, seit bald neun Jahren bekommt der Astronom kein Geschäftsführergehalt mehr, und wovon lebt er jetzt? Das Leben ist nicht billig, auch wenn man nicht auf Hochdruckreiniger, einen größeren Fernsehapparat oder eine neue Kücheneinrichtung erpicht ist. Wir machen uns so unsere Gedanken, trauen uns aber nicht, den Astronomen direkt danach zu fragen, der über die Oberfläche der Erde wandelt, groß und schlank, mit dichtem grauem Haar und abgrundtiefen grauen Augen, etwas Heiliges liegt über ihm, in seiner Nähe senkt man unwillkürlich die Stimme und versucht, nichts Kleinkariertes oder Gemeines zu denken. Also fragen wir ihn nach Sternen, dem Himmel und Kopernikus, aber wenig nach anderem und schon gar nicht nach Geld. Sogar die alte Lara lässt ihn mit ihren Geschichten in Ruhe – wenn wir doch auch nur einmal so ungeschoren davonkämen. Aus der Ferne betrachtet sieht sie aus wie ein kleines fettgedrucktes r und bewegt sich total langsam, aber sie ist verdächtig flink darin, uns im Laden, in der Bank oder im Gesundheitszentrum den Weg zu verlegen und uns ohne Umschweife ihre Lebensgeschichte aufzutischen; meist fängt sie sogar mitten in einem Satz an. Ihr Leben ist mittlerweile ganz schön lang geworden, wenn man die Jahre wie ein Maßband ausrollen könnte, würden sie wahrscheinlich bis zum Jupiter reichen, jedoch kaum wieder zurück. Aber ungebildet und dumm, wie wir sind, und obendrein bis zu den Ohren im dumpfen Alltagstrott versunken, warum sollten wir da einen Mann belästigen, der das Himmelsgewölbe in seinem Kopf trägt und in jedem Jahr Dutzende Briefe aus dem Ausland erhält, alle auf Latein.
Fünf
Es gibt noch immer Menschen, die sich die Mühe machen, Briefe zu schreiben. Und damit meinen wir, auf die alte Weise: Wörter auf Papier schreiben oder sie in den Computer tippen und dann ausdrucken, in einen Umschlag stecken und zur Post bringen, obwohl der Empfänger sie frühestens am Tag danach erhält, oft sogar noch beträchtlich später. Ist das nicht gleichbedeutend mit dem Festhalten an vergangenen Zeiten, Konservatismus, dem Versuch, in erloschene Glut zu blasen? Wir haben uns doch an Geschwindigkeit gewöhnt, man haut ein paar Worte in die Tasten, drückt aufs Knöpfchen, und schon sind sie beim Empfänger eingegangen. Das nennen wir zügig. Wozu da noch einen Brief mit der Post schicken? Für derart Schwerfälliges bringen wir doch kaum noch die Geduld auf; als würde man die Kutsche nehmen, obwohl man ein Auto zur Verfügung hat. Die Wörter in einem Computer haben es allerdings so an sich, zu verschwinden, sich aufzulösen, sich in unzugänglich gewordenen veralteten Programmen zu verbarrikadieren oder gelöscht zu werden, wenn der Computer abstürzt, und so verschwinden unsere Gedanken und Werke im Orkus. In hundert und erst recht in tausend Jahren weiß kein Mensch mehr, dass es uns einmal gegeben hat. Natürlich sollte uns das egal sein, wir leben schließlich hier und jetzt und nicht in hundert Jahren, aber eines Tages fällt uns ein alter Brief in die Hand, irgend etwas passiert in uns, wir meinen einen Faden, eine Verbindung von uns ausgehen zu spüren, die sich in der Vergangenheit verliert, es ist der Faden, der die Zeiten miteinander verbindet:
London, 28. Mai 1759
Eile, aus diesem lächerlichen Krieg nach Hause zu kommen, mach schnell und wärme mich. Ich bin nichts, ohne dich bin ich verloren.
Die Briefe, die wir per Mail versenden, existieren schon nach wenigen Jahren nicht mehr, und der Gedanke, das Gefühl nagt an uns, dass wir den Faden abreißen lassen, dass er noch bis zu uns reicht, von uns aber nicht weitergeführt wird; wir produzieren eine Textlücke, die nie gefüllt werden wird. In erster Linie möchten wir unserer eigenen Zeit treu und verantwortlich sein und nicht irgendeiner möglichen Zukunft, aber trotzdem sitzen wir mit Gewissensbissen da, als würden wir etwas Kriminelles tun, dabei geht es uns doch sonst glänzend damit, Gewissensbisse nur so zu sammeln. Wir haben ein schlechtes Gewissen, weil wir nicht genug lesen, zu selten Kontakt zu unseren Freunden halten oder mit unseren Kindern zu wenig Zeit verbringen oder mit den Älteren. Wir sind permanent auf Achse, anstatt uns mal hinzusetzen, dem Regen zuzuhören, einen Kaffee zu trinken und uns zu wärmen. Und wir schreiben nie einen richtigen Brief.
Doch, bei uns, die wir weitab von der Nationalstraße 1 leben, kommt es vor, dass wir uns hinsetzen, einen Brief schreiben und ihn zur Post bringen. Damit machen wir Agüsta eine Freude und nehmen sie wichtig, außerdem durchrieselt uns ein angenehmes Gefühl wie damals, als wir Cola durch ein Lakritzrohr tranken, oder wie wenn wir ins Heimatmuseum gehen oder eine alte Tante besuchen: wir erweisen damit einer vergangenen Zeit Treue und Wohlwollen.
Sechs
Früher war das Postamt einer der Mittelpunkte des Ortes, Briefe und Pakete strömten ein und aus, für die, die über die Bezirksgrenze hinaus telefonieren mussten, gab es zwei Telefonzellen, und dienstags bildeten sich oft Schlangen vor ihnen. Es war der Stichtag, um in der Hauptstadt Alkohol für das nächste Wochenende zu bestellen. Heute sind die Telefonzellen abmontiert und die Tage längst vergangen, an denen Agüsta den Hörer ans Ohr pressen konnte. Wir haben sogar unseren eigenen Alkoholladen im Dorf, geöffnet dienstags und donnerstags von 13 bis 14.30 Uhr. So ändert sich eben alles im Leben.
Vor dreißig Jahren waren noch vier Frauen im Postamt beschäftigt, da war Agüsta blutjung und trug einen so roten und dicken Lippenstift, dass er wie ein Stoppschild wirkte, vielleicht ist sie deswegen noch immer unverheiratet, obwohl sie inzwischen schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Aber vier Frauen vor dreißig Jahren und heute nur noch Agüsta, abgesehen von den Briefträgern, einem, der im Ort austrägt, und vier anderen, die das Umland beliefern. Wenn im Dezember die Päckchenflut anschwillt, hat sie zwei Nichten, die ihr aushelfen, noch so jung, dass sie alles in Aufruhr versetzen, die Jungen kommen auf einmal mit Briefen und Ansichtskarten, schicken irgendwem irgendwas, Hauptsache, sie können sie ansehen. Agüsta und die Post gehören zusammen wie ein Arm und der Ärmel. Ihre Postboten dirigiert sie mit eiserner Disziplin, dabei ist sie klein und zierlich, leicht wie eine Feder, wenn der Wind über 12 Meter pro Sekunde zunimmt, schwebt sie in Lebensgefahr, andererseits ist sie heiser und verrunzelt, wie es nur Kettenraucher werden, und ihre Hände erinnern manchmal an kleine Hündchen.
Den Vergleich mit den Hunden haben wir uns gut ausgedacht, denn Agüsta ist enorm neugierig, und es fehlte nur wenig und ihre Vorwitzigkeit hätte sie den Job und ihren guten Ruf gekostet, sie wurde sogar abgemahnt, blieb aber immer standhaft, ließ sich nicht auf Abwege locken und blieb sich selbst treu. Das alles fing Mitte der siebziger Jahre an, als die Welt noch anders war, als es noch die Beatles gab, man ein Flugzeug bestieg, ohne an Terroristen zu denken, die Straßen nach dem Winter erst spät wieder befahrbar wurden und noch mehr Schlaglöcher hatten, die Abstände noch größer waren und die Welt daher größer erschien, und als die Post noch zu den Knotenpunkten im Miteinander der Menschen gehörte. Agüsta arbeitete seit drei, vier Jahren bei der Post, war wohlgelitten und ausgesprochen tüchtig, aber irgendetwas brodelte in ihr, eine innere Unruhe, sie war nicht richtig zufrieden, etwas fehlte im Leben; und da öffnete sie eines Tages einen Brief, den sie eigentlich weiterbefördern sollte, und las ihn. Das tat gut, wie der erste Zug an der Zigarette nach langer Abstinenz, ein Wonnegefühl rieselte ihr durch den Körper, und Agüsta seufzte. Eins kam zum anderen, sie öffnete noch einen Brief, ein Päckchen, ein Paket, und wurde so allmählich zu einer der bestinformierten Nachrichtenquellen im Ort, sie versorgte uns mit großen und kleinen Neuigkeiten, klatschte über Hoffnungen und Enttäuschungen, deckte zwei Seitensprünge auf und steckte dreimal Eltern, dass ihre Sprösslinge laut Schreiben an ihre Brieffreunde kurz davor standen, auf die schiefe Bahn zu geraten. Es mag dir komisch vorkommen, dass die Leute hier es hinnahmen, wenn Agüstas Hände wie zwei neugierige Hündchen die Post durchstöberten, genau wussten, wer was bekam, wer Pornoheftchen abonniert hatte oder Schmuddelblätter, wie sie das damals nannte. Du darfst aber nicht vergessen, dass der Winter hier lang sein kann, lang und ereignislos; wir sind nur wenige, die Straßen sind verschneit, und der Wind pfeift zwischen den Häusern. Da hilft es schon, sich eine kleine Besorgung auf der Post auszudenken, Agüsta gegenüber eine entsprechende Bemerkung zu machen und anschließend mit Neuigkeiten versorgt wieder nach Hause zurückzukehren, Kleinigkeiten, etwas Klatsch, den man genüsslich bei einer Tasse Kaffee noch einmal durchkauen kann, um etwas Zeit totzuschlagen. Aber es fehlte halt nur wenig, vielleicht ein Fingerbreit, und Agüsta hätte ihre Arbeit und ihr Ansehen verloren, man warf ihr vor, die Privatsphäre zu verletzen und Vertrauen zu missbrauchen, man nannte sie eine Tratschtante, ein Schandmaul, Giftspritze, Hexe. Damals schnellte ihr Zigarettenverbrauch von einem Päckchen täglich auf über zwei und ist seitdem auf diesem Niveau geblieben, sodass man auch sagen kann, die Anwürfe, die bösen Worte hätten Agüstas Leben um einige Jahre verkürzt, da hätte sich manch einer ganz schön was aufs Gewissen geladen. Aber entlassen wurde sie nicht. Die Aufregung legte sich einfach. Mit der Zeit lernte sie es, die Dinge geschickter anzugehen, sie drückte sich so aus, als hätte sie die Neuigkeit von anderen erfahren, damit täuschte sie natürlich niemanden, aber man gewöhnt sich an alles, am Ende wird alles irgendwie normal und selbstverständlich. Außerdem waren ihre Hinweise zweifellos oft von Nutzen, Agüstas Neugier hat Ehen gerettet und Menschen aus aussichtslosen Beziehungen befreit, wir haben uns die Umstände zunutze gemacht, manchmal bloß deswegen Briefe aufgegeben, damit etwas herauskäme, aber die Zeiten ändern sich, es gibt immer weniger Postämter, sie werden geschlossen oder in Lebensmittelgeschäften in die Ecke gequetscht und verlieren dort ihren eigenen Charakter, das nennt man Rationalisierung, und E-Mails machen Postboten arbeitslos. Agüstas Bedeutung für unsere Gemeinde hat nachgelassen, sie steht nicht mehr im Mittelpunkt, und erst als der stete Strom der Briefe und Päckchen für den Astronomen einsetzte, merkten wir, wie sehr wir auf Agüsta angewiesen waren, auf ihre Neugier und ihre Findigkeit. Du kannst dir vielleicht ihr Unzulänglichkeitsgefühl vorstellen, als sie die ersten Briefe öffnete und sah, dass sie alle auf Latein geschrieben waren. Agüsta hatte es immerhin geschafft, sich durch englische Briefe zu buchstabieren oder solche, die in einer skandinavischen Sprache verfasst waren, schließlich besaß sie gute Wörterbücher. Aber was mache ich jetzt, dachte Agüsta und drehte den ersten Brief in ihren tabakgelben Fingern. Am Tag danach traf der zweite ein, dann der dritte, innerhalb einer Woche waren es sechs geworden. Agüsta nahm das richtig mit, sie bekam Ringe unter den Augen, wirkte niedergeschlagen, wir merkten es ihr an, vielleicht hat sie Krebs, dachten wir und verfluchten das Rauchen. Aber Agüsta gehört nicht zu denen, die die Flinte ins Korn werfen, sie ist resolut und beharrlich, ein Kämpfer, und sie sprach mit Jakob dem Fernfahrer, der ihr einige Tage später ein lateinisch-isländisches Wörterbuch mitbrachte. Doch es war nicht leicht, Zugang zum Lateinischen zu finden, außerdem waren die Briefe alle mit der Hand geschrieben und die Schreiber schienen sich in ihren Sauklauen überbieten zu wollen. Schmierfinken, sagte Agüsta. Wir waren alle enttäuscht, als hätte Agüsta versagt, und sie spürte es und ließ manchmal ohne Grund den Kopf hängen. Mehr Briefe trafen ein, doch allmählich ließ Agüsta davon ab, sie überhaupt zu öffnen, Schweigen breitete sich über ihnen aus, ein geheimnisvolles Schweig.
Sieben
Was mag er wohl denken, fragten wir manchmal und meinten natürlich den Astronomen, wie geht es ihm, was geht in Menschen wie ihm vor, die alles aufgegeben haben, die dem Wohlstand, der Familie und dem Alltagsleben den Rücken gekehrt haben? Das brannte uns auf den Nägeln, war ein ergiebiges Gesprächsthema an den langen Winterabenden, wenn uns die Welt vergessen zu haben scheint und sich nichts ereignet, als dass der Himmel die Farbe ändert. Es gab dementsprechend großes Aufsehen, als Elisabet im Kaufladen an der gleichen Stelle, an der der alte Geir und später Kiddi seit dreißig Jahren ihre Filmvorführungen ankündigen, einen Aushang anschlug:
Worauf es ankommt Vom nächsten Mittwochabend an wird der Astronom jeden Monat im Gemeindezentrum einen Vortrag darüber halten, worauf es ankommt. Die Vorträge beginnen pünktlich um 21 Uhr, dauern, mit Lichtbildern, etwa 40 Minuten und werden vom Nordischen Ministerrat gefördert. Im Anschluss werden Fragen beantwortet. Kaffee gratis.
Das Gemeindezentrum war bis auf den letzten Platz besetzt, der Besuch reichte an die größten Kassenschlager der Filmvorführungen Kiddis heran, James Bond oder Die Hard. Davið und Elisabet hatten alle Hände voll zu tun. Kaffee und Schmalzkringel austeilen, Garderobe annehmen, Plätze anweisen, es war ein großer Abend, und wir alle hatten ein Kribbeln im Bauch, denn jetzt war es so weit, bald würden wir erfahren, was im Kopf des Astronomen vor sich ging, was in diesen Büchern stand. Wir schlürften Kaffee, mümmelten Gebäck, probierten misstrauisch die kleinen Häppchen, waren vergnügt und sagten: Worauf es ankommt, ist, dass Arsenal Meister wird, dass ich heute Abend einen hochkriege, dass es Goggi nicht zu früh kommt, worauf es ankommt, ist, sich am Wochenende mal wieder richtig abzufüllen. Währenddessen stand der Astronom die ganze Zeit oben auf dem Podium hinter dem Pult und blickte vor sich hin, als ginge ihn das alles nichts an, unser Raunen und Gemurmel, die gespannte Erwartung, dieser Abend, der Vortrag, als würde er durch Wände und Dach des Hauses hindurchsehen und den Abendhimmel mustern, der mit Fortschreiten des Herbstes zwischen den Sternen heraufdunkelte. Der ist über alles erhaben, dachten wir, genießt höchsten Respekt, denn er ist ein Weiser. Dabei verhielt es sich in Wahrheit so, dass sich der Astronom am Rednerpult festklammern musste, um nicht umzufallen, das überlebe ich nicht, dachte er. Davið warf hin und wieder einen Blick hinauf zur Bühne, das überlebt er nicht, wisperte er Elisabet zu, die ein schwarzes Samtkleid trug, das sich eng um ihre Figur schmiegte, manche kauten an den Nägeln oder bissen sich auf die Fäuste über dieses schwarze Samtkleid, das allein zählte. Du erinnerst dich, dass auch EHsabet in der Strickerei gearbeitet hat, nicht lange, nur die letzten beiden Jahre, aber obwohl sie noch kaum richtig erwachsen war, stieg sie bald zu einer Art inoffizieller Assistentin des Geschäftsführers auf, dieses Luder, dachten auch die fünf Frauen, die weit vorn saßen und sie nicht aus den Augen ließen. Nur gut, dass Blicke nicht töten können. Elisabet dämpfte das Licht im Saal und fuhr stattdessen die auf die Bühne gerichteten Scheinwerfer hoch, sie und Davið nahmen ganz vorn direkt vor dem Podium Platz, und das Licht der Scheinwerfer hüllte sie ein wie Sprühregen. Das Herz des Astronomen pochte wie ein kleines Tier in der Falle, er schlotterte am ganzen Leib und seine Hände zitterten. Wir schauten auf die Bühne, die Minuten verstrichen, er schwieg, guckte bloß Löcher in die Luft, und einige von uns begannen schon zu glauben, er habe uns hier zusammengerufen, um uns mit dem Schweigen bekannt zu machen, darauf komme es an, und seine Bücher seien voller Schweigen. Ja, klar, unser Geplapper, unser Tratsch und Gewäsch gehen ihm auf den Geist, tagein und tagaus reden wir über nichts als Belanglosigkeiten wie die Länge von Gardinen und die Größe von Autoreifen, und dann sterben wir.
Ende der Leseprobe
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: