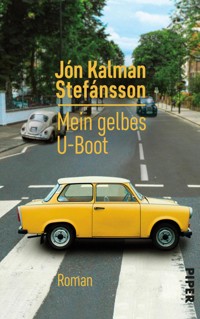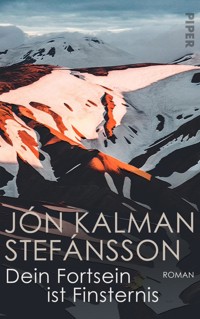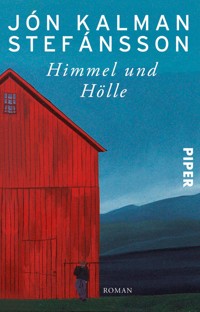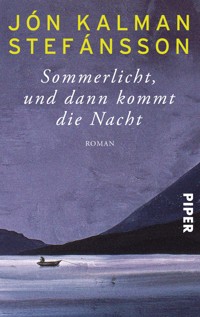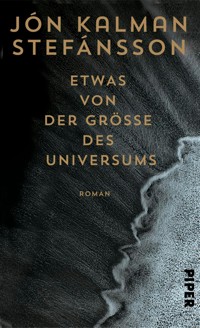11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Gerade hat der kleine Junge seine Mutter verloren, da nimmt eine fremde Frau ihren Platz ein, die Stiefmutter. Während sich sein Vater in seine Arbeit auf der Baustelle stürzt, flieht der Junge mit seinen Zinnsoldaten in eine märchenhafte Parallelwelt. Geborgenheit findet er nur bei seiner Großmutter, die ihm abenteuerlich-bunte Anekdoten von ihren eigenen Eltern erzählt und ihn so aus der einsamen Düsterkeit seines Alltags befreit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Übersetzung aus dem Isländischen vonKarl-Ludwig Wetzig
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
1. Auflage 2013
ISBN 978-3-492-95960-5
© 2003 Jón Kalman Stefánsson
Titel der isländischen Originalausgabe:
»Snarkið í stjörnunum«, Bjartur, Reykjavík 2009
Deutschsprachige Ausgabe:
© 2006, 2008 Philipp Reclam jun., Stuttgart
Published by agreement with Leonhardt & Høier
Literary Agency A/S, Kopenhagen, Dänemark
Umschlaggestaltung: Cornelia Niere, München
Umschlagabbildung: Bridgeman archives/Boissegur, Beatrice (Contemporary Artist)
Datenkonvertierung E-Book: Kösel, Krugzell
Teil I
1
Ich wohne in einem Block. Er steht in der Stadt Reykjavik als oberster in einer Reihe von vier Blöcken. Ich wohne im Erdgeschoss links, Hauseingang Nr. 54, in einer Dreizimmerwohnung mit fensterlosem Abstellraum, Balkon und Keller. Vor dem Block liegt ein Parkplatz, und wer abends oder vielleicht auch sonntags aus dem Fenster guckt, kann vor unserem Küchenfenster einen Trabant stehen sehen und auf sein rotes Dach hinabblicken; auf dem Beifahrersitz liegt eine Maurerkelle.
Schräg gegenüber steht eine zweigeschossige Ladenzeile mit der Reinigung Björg, einer Buchhandlung und einem Frisiersalon mit großen Fenstern im Untergeschoss, die sich bis um die Ecke ziehen. An warmen Sommertagen steht der kahlköpfige Friseur in der Tür und klopft mir mit einer zusammengerollten Zeitung auf den Kopf, wenn ich vergesse, Guten Tag zu sagen. An den Friseurladen schließt sich ein kleines Geschäft mit Kinderbekleidung an, und daneben gibt es so etwas wie eine Grotte oder Höhle mit einer Luke davor. Das ist Söbekks Kiosk. Keine Tür, nur diese Luke, und wer erst sieben ist, muss sich auf die Zehenspitzen stellen, um nach drinnen zu linsen. Ein paar Schritte neben der Luke befindet sich die Eingangstür zu Söbekks Kiosk, dann kommt das Milchgeschäft und am Ende Bödvars Bäckerei. Bödvar hat eine Glatze wie der Friseur, ist aber so groß und kräftig, dass manche Schiss vor ihm haben. Dabei kann es ihm einfallen, dir ein ofenwarmes Wienerbrot zu schenken, das dir im Mund zergeht, während er mit seinen roten und traurigen Augen dein Mienenspiel beobachtet. Bödvar schläft nie; es ist viele Jahre her, seit er das letzte Mal geschlafen hat. Jede Nacht starrt er in seinen glühenden Backofen und denkt an etwas Trauriges. Die Schlaflosigkeit, die vom Ofen ausstrahlende Hitze und seine traurigen Gedanken machen seine Augen so rot. Man weiß nie, was in Bödvars Broten stecken mag: ein Löffel, ein Spießchen, ein Stück Plastik, ein Korken. Die Frauen im Stoffgeschäft Vogue zischeln missbilligend oder tuscheln über den Bäcker und vergießen auch schon mal ein Tränchen seinetwegen. Vier oder fünf sind es, alle gutmütig. Sie erinnern an leicht muffelnde Islandpullover. Über ihrer Eingangstür hängt eines der Weltwunder, eine leuchtende Riesenschere von der Größe eines Automobils, wenn nicht gar eines Krokodils. Die Schere schneidet lautlos jeden Tag. Klipp, klapp, und zerschneidet doch nichts, außer vielleicht diese Erinnerungen; denn wenn ich abends zu Bett gehe, nicht mehr sieben Jahre alt, sondern bald vierzig, und der Schlaf sich dichter um mich legt wie Dunkelheit, dann sehe ich die Schere tief in den Nebel der Zeit schneiden.
Die Schere
Nächtens schneidet die Riesenschere von Vogue das Erdgeschoss links aus der Zeit, und die Wohnung schwebt durch die Leere des Alls wie ein Planet auf der Suche nach einer Sonne. Die Schere schneidet die Maurerkelle meines Vaters aus, mich, über meine Spielzeugsoldaten auf dem
Fußboden im Wohnzimmer gebeugt, sie schneidet eine Frau aus, die aus dem Schlafzimmer kommt, Peter mit den empfindlichen Händen und zwei Brüder, Urgroßmutter mit ihrem Kopf wie eine Kartoffel, sie schneidet und schnippelt, schneidet meine Mutter aus, die mich unter fürchterlichen Schmerzen zur Welt brachte, meinen Vater auf dem Weg den Hügel von Skaftahlið hinab, Großvater, der gerade ein Malergerüst aufstellt, und Großmutter, die aus Norwegen stammte. Sie schneidet schneller und schneller, schneidet die Vesturgata aus und Uroma, siebzehn Jahre alt und duftend wie ein Berghang voller Heidekraut. Sie schneidet und schneidet tief in den Nebel der Zeit, schneller und schneller, sie schneidet die Halbinsel von Snæfellsnes aus, einen rothaarigen Schiffer, einen Großkaufmann, eine Kellerwohnung und sie schneidet Urgroßvater aus der Zeit.
Urgroßvater
»Er war ein staatser Mann«, sagte meine norwegische Großmutter über meinen Urgroßvater mütterlicherseits, aber es gab eigentlich keine Bestätigung dafür.[1]
Urgroßvater wuchs in Akureyri auf, wo er das Druckerhandwerk lernte. Mit zwanzig kommt er nach Reykjavik, findet Arbeit in der Druckerei Isafold und mietet sich ein kleines Zimmer. Dort erhält er Brief um Brief von seiner
Mutter, die will, dass aus ihm etwas Anständiges wird, er soll eine Familie gründen und überhaupt ein Muster von einem Mann werden. Nichts liegt ihm ferner. Ich weiß nicht, woher es kam, ob eine tiefe innere Unruhe dahintersteckte oder die Abenteuerlust eines jungen Mannes, jedenfalls sollte Reykjavik für ihn nur eine Durchgangsstation sein. Er hatte sich vorgestellt, dort ein paar Jahre zu arbeiten, zwei oder drei, Geld zu sparen, damit nach Kopenhagen zu gehen und von dort hinaus in die große, weite Welt. Er wollte auf einem Frachtschiff anheuern oder auf einem Walfänger, einen großen Strom hinauffahren und Urwälder durchstreifen. Ein Abenteurerleben führen und als alter Mann nach Island zurückkehren und ein Buch schreiben wie seinerzeit Jon der Indienfahrer. Tatsächlich aber arbeitet er in einer Druckerei, und die Jahre gehen dahin. Es dauert lange, die Reisekasse zu füllen, und er verdient sich ein paar Extragroschen, indem er bessergestellte Bürger auf ihren Wochenendausritten begleitet. Auf einer dieser Touren lernt er den späteren Großkaufmann Gisli Garðarsson kennen.
Der Herbst ist nicht mehr weit, und als die Reitertruppe unterhalb des Berges Ulfarsfell angekommen ist, sinkt besagter Gisli von seinem Pferd, zu betrunken, um sich noch im Sattel zu halten. Es ist noch warm, die Sonne überstrahlt den halben Himmel. Vergeblich versuchen die Ausreitenden, Gisli wiederzubeleben. Sie geben es schließlich auf und setzen ihren Ausflug fort, während sie Urgroßvater beauftragen, sich um den Mann zu kümmern, ihn irgendwann aufzuwecken und nach Hause zu bringen. Kaum ist der Trupp verschwunden, setzt sich Gisli auf. Sicher ist er betrunken oder vielmehr ziemlich angeheitert.
Er greift in die Jackentasche, zieht einen Flachmann hervor und reicht ihn Urgroßvater.
»Diese Leute«, sagt er und winkt mit dem Kopf in Richtung der Davongerittenen, »kennen keinen Ehrgeiz und keine Hingabe. Sie trauen sich kaum, zu leben. Bei dir scheint mir das anders zu sein. Trink!«
Auf dem Heimweg legen sie auf zwei Bauernhöfen Rast ein und enden im Hotel Island, wo der Rausch längst all die üblichen Hemmungen zwischen erwachsenen Menschen weggeschwemmt hat und Uropa von seiner Kindheit erzählt. Sein Vater war ein armer Handwerker, der so gut wie nie aus seiner Lethargie erwachte, seine Mutter eine Tochter des Pastors auf Glaumbær, eine stolze und ehrgeizige Frau. Sie hatten nur zwei Söhne, und die Mutter war bereit, alles zu opfern, um anständige Männer aus ihnen zu machen. Fast die gesamte Habe ging für die Ausbildung des Ältesten drauf, der es so bis in die höhere Schule in Reykjavik schaffte. Er war ein begabter Schüler, begann aber zu trinken, wurde im letzten Schuljahr der Schule verwiesen und ertrank im Stadtteich – würdelos und sturzbesoffen.
Der Pfarrer von Glaumbær verzieh seiner Tochter nie, dass sie einen armen Schlucker aus dem einfachen Volk geheiratet hatte; er hatte sich einen Propst, einen Großbauern oder einen Bezirksrichter vorgestellt und verschmähte und verachtete seinen Schwiegersohn.
»Einmal habe ich meinen Großvater gesehen«, sagt Uropa zu Gisli und hebt einen Finger. »Ein einziges Mal. Und weißt du, was dieser Mann Gottes auf die Nachricht vom Tod meines Bruders gesagt haben soll? ›Es war ja nichts anderes zu erwarten.‹«
Es ist eine Spätsommernacht, sie stoßen miteinander an, Uropa und jener Gisli, der zu Geld kommen, sich vor anderen hervortun und einmal Großkaufmann werden soll. Er will einmal als der bedeutendste Mann Reykjaviks durch die Straßen flanieren.
»Die Straßen von Reykjavik!«, sagt Urgroßvater und schnaubt. Dann beugt er sich über den Tisch, sieht seinem neuen Freund tief und gerade in die Augen und wiederholt dessen Äußerungen über den Ehrgeiz und den Wagemut, zu leben.
»Und da wusste ich, dass wir zusammen noch etwas erleben würden.«
»Vergiss Reykjavik, dieses gottverlassene Nest! Geh mal auf den Skölavördfu-Hügel und schau über das Meer! Dahinter wartet die ganze Welt auf uns. Warum sollten wir unser gesamtes Leben hier verbringen? Wir haben doch nur ein Leben, und das sollten wir dazu nutzen, die Welt zu bereisen. Nur der hat gelebt, der einmal in Italien eingeschlafen und in Griechenland aufgewacht, der im Mittelmeer nach Schätzen getaucht und im Stillen Ozean an die Oberfläche gekommen ist. Wenn du unbedingt anstoßen willst, dann bring ein Prosit darauf aus!«
Urgroßvaters Leidenschaftlichkeit ist so ansteckend, dass Gisli mitgerissen wird. Es ist Nacht, die beiden sind jung, so jung und so sternhagelvoll. Sie schwören einander, gemeinsam ins Ungewisse aufzubrechen.
»Aber erst einmal müssen wir dir eine gute Arbeit besorgen«, sagt Gisli entschieden, »und wir brechen erst auf, wenn du genug gespart hast, denn man sollte sich nur mit ausreichend Proviant in ein solches Abenteuer begeben.« »Afrika! Pazifik!«, gröhlen sie den Rest der Nacht und beruhigen sich erst, als die Sonne den östlichen Horizont in Brand steckt.
Wenige Tage später wird Urgroßvater von einem Immobilienmakler als Assistent eingestellt und scheint für diese Tätigkeit wie geschaffen zu sein. Das kommt von seiner Beredsamkeit, seiner Überzeugungskraft und einer gehörigen Portion Unverschämtheit. Bald hat er seinen eigenen Arbeitsbereich und inseriert in den Tageszeitungen:
Größtes Angebot und reichhaltigste Auswahlan Immobilien, Baugrundstücken, Häusern(besonders in Reykjavik)und Grundbesitz in sämtlichen Landesteilen(vor allem im Süd- und im Westland).
Nicht selten trinkt er mit Gisli ein Bier, sie machen im Hotel Island eine Flasche Whisky nieder – dem dazu geeignetsten Haus des Landes – und beenden die Nacht mit dem Kriegsruf des Lebens: Afrika! Pazifik!
Der Aufbruch lässt allerdings auf sich warten. Gisli heiratet, und Urgroßvater wird vom Einerlei des Alltags gefangen gehalten.
Ein Giebelzimmer in der Vesturgata
Wie andere Immobilienmakler gegen Ende des neunzehnten Jahrhunderts und zu Beginn des zwanzigsten profitiert auch Urgroßvater manchmal vom Unglück anderer. Er kauft Menschen, die in Schwierigkeiten geraten sind, Wohnungen oder Häuser ab und verkauft sie wieder mit gutem bis anrüchigem Gewinn. Aber das stört ihn nicht sonderlich; er genießt es, zu den vornehmeren Einwohnern der Stadt gerechnet zu werden und hochgewachsen und schlank in einem Cut einherzustolzieren, wobei seine zierlichen, wohlgepflegten Hände einen Stock mit Silberknauf kreisen lassen. Dazu trägt er eine Lorgnette und auf dem dichten, fast schwarzen Haar einen Hut aus Tweed. Doch trotz bester Vorsätze fällt es ihm schwer, die Rolle des ehrbaren Bürgers zu spielen. Dem steht so manches entgegen. Ich nehme nur sein Zuhause als Beispiel. Ein Mann in seiner Position sollte im Besitz einer eigenen Wohnung mit gediegenen Möbeln sein; Urgroßvater aber mietet bloß ein – wenn auch geräumiges – Giebelzimmer in der Vesturgata beim Hafen. Einmal gibt er allerdings dem Druck seiner Umgebung und seiner Kundschaft nach und kauft tatsächlich eine kleine Wohnung in der Bergstadastrati auf dem Hügel der Wohlhabenden, stattet sie mit passenden Möbeln, Bücherregalen und einem Klavier aus. Dann gehen ein paar Wochen ins Land, und jede Nacht träumt Uropa, er liege in großer Tiefe auf dem Grund des Faxafloi, die Wohnung wie ein riesiges Senkblei an sein rechtes Bein gebunden. Bleiche Fische knabbern von seinem Gebein. Mit Anbruch der siebten Woche gibt er auf, verkauft die Wohnung, packt die Bücher in Kartons und zieht zurück in seine Dachkammer.
2
Spielzeugsoldaten sind klein und brauchen wenig Schlaf. Meist schlafen sie erst gegen Morgen ein, wenn die Berge aus der Nacht hervortreten und in der Dämmerung bläulich schimmern. Dann erwache ich, setze mich im Bett auf, schaue vor mich hin und lausche auf Füße, die draußen im Wohnzimmer über den Teppichboden gleiten. Zum Glück brauchen Spielzeugsoldaten kaum mehr als eine Viertelstunde Schlaf, manchmal reicht es sogar, dass ich intensiv an sie denke, und schon wachen sie auf, vergessen ihre internen Streitigkeiten, sammeln sich um mich, richten die Läufe ihrer Waffen auf die Tür, und wir warten, bis nichts mehr zu hören ist, außer dem Schlagen unserer Herzen. Wenn ich schon eine Weile wach bin, klingelt drinnen bei Papa der Wecker; so laut und plötzlich, dass es sich wie eine Explosion anhört. Vater wirft sich herum, schlägt auf der Suche nach dem Wecker in sämtliche Richtungen um sich, und das mit einer Miene, als ob man ihn vom Dach unseres Blocks stürzen wolle. Oft stehe ich in der geöffneten Tür und sehe mir das an. Bemerkenswert, wie sich ruhiger Schlaf in Sekundenschnelle in verzweifeltes Erwachen verwandeln kann. Ein paar Minuten später geht Vater aufs Klo. Dann ist er schon dabei, zu einem Maurer mit einem weißen Trabbi mit rotem Dach zu werden.
Das Durcheinander in meinem Kopf
So war es früher: Papa, ich und die Spielzeugsoldaten, die sich in britische und deutsche Streitkräfte teilten, die Letzteren zahlenmäßig deutlich unterlegen. Das alles änderte sich an jenem Frühlingsmorgen, an dem die Frau aus dem Schlafzimmer meines Vaters kam und in die Küche ging. Ich sitze im Wohnzimmer auf dem Fußboden, blicke der Frau nach und traue mich nicht, mich zu rühren, die britische Armee und die kümmerlichen Reste der deutschen Wehrmacht ebenso wenig.
Vater und ich leben seit geraumer Weile allein. Wir waren auch noch allein, als ich am Vorabend schlafen ging, und jetzt ist auf einmal diese Frau da, kommt aus dem Schlafzimmer und geht in die Küche. Wasser läuft, der Kessel wird auf die Herdplatte gestellt, Besteck klappert. Ich schlucke, Zeit vergeht, und aus dem Schlafzimmer ist kein Ton zu hören. Es ist Samstag, und ich halte mich schon eine ganze Weile im Wohnzimmer auf, bin wie gewöhnlich im ersten Morgengrauen aufgewacht und habe mich mit meinen Soldaten ins Wohnzimmer geschlichen, wo gerade eine heftige Schlacht tobt, als diese Frau erscheint und alles verstummt. Jetzt wird der Kessel vom Herd genommen, und die Frau kommt mit versteinertem Gesicht aus der Küche auf mich zu. Einen Meter vor mir bleibt sie stehen. Das Schweigen ist so drückend, dass sich die Fensterscheiben biegen. Sag was, denke ich, und da sagt sie etwas:
»Die Hafergrütze ist fertig.«
Die Stimme klingt rau. Es ist das erste Mal, dass in dieser Wohnung im Erdgeschoss links Hafergrütze gekocht wurde; doch da ich schon viel herumgekommen bin und in anderen Haushalten Hafergrütze zu essen bekam, weiß ich, dass sie in meinem Leben völlig überflüssig ist. Trotzdem fällt es mir nicht ein, die Frau auf diese unumstößliche Tatsache hinzuweisen, diese Frau, die plötzlich und überraschend wie der Blitz eingeschlagen hat, doch an Stelle des Donners räuspert sich Vater im Schlafzimmer. Ich erhebe mich, und schwere Schritte tragen mich schleppend der Hafergrütze entgegen. Die Frau geht voraus, die Royal Army erwacht aus ihrer Starre und geht gnadenlos zum Angriff gegen die Deutschen über. Und während ich – trotz heftiger Proteste meines Halses und obwohl mein Magen Kopf steht – steife Hafergrütze in mich hineinstopfe, irren die Deutschen kopflos über den Fußboden. Manche rufen mich, ihre dünnen Stimmen fordern Gerechtigkeit, es sei unfair, sie seien doch viel weniger.
»Stimmt genau«, sage ich. »Sobald ich die letzten Reste der verfluchten Hafergrütze runtergewürgt habe, mache ich euch zu Partisanen. Dann könnt ihr in die Berge fliehen, aber passt auf die Trolle auf! Tagsüber verwandeln sie sich in Felsen, unter denen man gern ein Nickerchen hält.« »Kannst du nicht gleich kommen?«
»Nein. Ihr kapiert auch überhaupt nichts. Ihr habt nicht diese Frau über euch. Sie hat fürchterliche Augen. Schrecklich. Sogar Söbekk würde zusammenzucken, wenn er die sehen würde.«
»Wie sind sie denn?«
»Ich weiß nicht. Sie sind einfach irgendwie. Ich bin gerade mal sieben. Ich habe Probleme mit Mengenlehre, weiß nicht, welche Länder an Frankreich grenzen, erst recht nicht, welche an die Schweiz. Ich habe keine Worte dafür, wie man Augen beschreibt. Haltet die Klappe und versucht, am Leben zu bleiben. Vielleicht kann ich die Grütze bald vernichten.«
Aber ich kämpfe noch immer gegen die Grütze und einen revoltierenden Magen, als Vater auftaucht. Er geht aufs Klo und macht die Tür hinter sich zu. – Es ist seit langer Zeit das erste Mal, dass jemand diese Tür schließt. Sie ist sicher dankbar dafür, hat so lange offen gestanden, dass sie leise quietscht, als Papa sie zumacht. Trotzdem ist sein Pinkeln in der Küche deutlich zu hören; wie der Strahl in die Kloschüssel plätschert. So ist es gewesen, seit ich denken kann: Ein schwerer Strahl ins Wasser und ein dumpf prasselndes Geräusch.
Ich glaube, Papa hat eigentlich wenig für Hafergrütze übrig. Jedenfalls isst er jeden Tag Graubrot mit Butter und kalte Kartoffeln zum Frühstück. Jetzt aber löffelt er wortlos Grütze. Wir hocken über unsere Teller gebeugt, die Frau steht an der Spüle, die Arme verschränkt, und starrt nach draußen. Schweigen füllt die Küche wie Watte; erst angenehm, dann wird es schwer, zu atmen. Papa räuspert sich, er will etwas sagen, stottert, sagt zehnmal Ähemm, klopft mir auf die Schulter, ziemlich vorsichtig, als wäre ich zerbrechlich, und bringt dann einen einzigen Satz raus, ehe ihn der Tag draußen verschluckt: »Äh, ja, am besten, ich mache mich auf den Weg, die Arbeit ruft.«
Damit ist er verschwunden.
Unten stottert der Trabant los, und die Maurerkelle auf dem Beifahrersitz fängt an zu rappeln. Dann ist endlich die gesamte Grütze in meinem Magen angekommen, einem gedemütigten Magen, und die Frau steht noch immer an der Spüle. Ich düse ins Wohnzimmer, organisiere die Reste der deutschen Wehrmacht zu einer frischen und kühnen
Partisanentruppe um und mache mich, die bitteren Vorwürfe der Engländer wie eine dichte Schneewolke im Rücken, aus dem Staub: »Willst du uns hier an so ausgesetzter Stelle ohne Deckung zurücklassen? Was machen wir, wenn diese Frau kommt? Ihr Schweigen ist wie eine Zeitbombe in unseren Köpfen. Sie respektiert uns sicher nicht. Sie glaubt bestimmt, wir wären nur ein paar lächerliche Spielzeugsoldaten. Sie ...«
Ich achte nicht darauf, sehe zu, dass ich nach draußen komme, die Treppen hinab, durch die Haustür, und dann nimmt mich der Tag in Empfang. Er ist größer, als ich ihn mir vorstellen konnte.
Ich gehe den Block entlang, durchquere die Baumreihe, die den ganzen Hang hinabführt und in der Ferne verschwindet. Ich stehe da und sehe Autos die Miklabraut entlangfahren. Es sind viele. Da ist ein Moskwitsch, da ein Volvo und da sind zwei amerikanische Straßenkreuzer, so groß und breit, dass der Trabant in ihren Kofferraum passen würde. Ich beobachte sie lange. Ich denke nach. Ich versuche Worte für das Durcheinander in meinem Kopf zu finden.
Als wenn jemand sie verloren hätte
So ist es seitdem: Statt dass die Uhr die Zeit zerstückelt und Papa sich im Bett räkelt, kommt die Frau aus dem Zimmer, kocht Hafergrütze, und dann erst fängt Vater an, sich im Bett zu rühren.
Ich weiß nicht, wo sie herkommt, aber sie muss wohl in einem Moment drinnen bei Papa erschienen sein, der zwischen dem Einschlafen der Soldaten und meinem Aufwachen lag; darum haben wir keinerlei Verdacht geschöpft, deshalb hat sie eingeschlagen wie der Blitz und daher glauben wir, dass sie ein Ungeheuer oder ein Trollweib ist. Nein, ich habe keine Ahnung, woher sie gekommen ist, weiß nur, dass sie jetzt da ist, dass Hafergrütze eklig schmeckt, dass sie Vater die Butterbrote schmiert und dass das Essen, das sie abends kocht, sehr anders ist als das, was Vater und ich das letzte Jahr über gegessen haben – offen gestanden sogar anders als alles, was ich bisher gegessen habe. Ich unternehme lange Spaziergänge und denke nach. Rede mit niemandem. Doch am dritten Morgen, nachdem die Frau aus dem Schlafzimmer gekommen ist, gehe ich rüber zu Petur. Er wohnt im nächsten Haus, Nummer 56, im Erdgeschoss rechts. Ich suche ihn auf und berichte ihm von der Frau.
»Sie hat einen Gesichtsausdruck, der ist härter als der vom fiesen Frikki«, erkläre ich.
Petur ist ein Jahr jünger, schmaler und kleiner als ich. Man sieht auf den ersten Blick, dass ich älter und viel stärker bin. Wenn wir nebeneinander stehen, bin ich größer und breiter in den Schultern. Glücklicherweise sieht man nicht, dass Petur eine ganze Menge mehr weiß als ich. Er kann völlig unvermittelt herausplatzen: »Kolumbus entdeckte Amerika im Jahr 1492. Hast du das gewusst?«
Entweder schweigt man dazu oder tritt ihm kräftig vors Schienbein. Man weiß vermutlich noch, dass Amerika jenseits des Ozeans liegt, der im Schulatlas Atlantik heißt. Man weiß, dass in Amerika Indianer leben, die manchmal »Jippyjeh!« rufen und sich unheimlich leise anschleichen können, aber ich hatte keine Ahnung, dass sie verloren gegangen waren, bis dieser Kolumbus sie wiedergefunden hat. Das lässt einen ja fast traurig werden, muss doch schlimm sein, so verloren zu gehen. Die Indianer haben sich gefürchtet; gut von diesem Kolumbus, sie wiederzufinden. Diesmal aber bringt mich Petur mit seinem Wissen nicht aus dem Konzept. Diesmal ist er deutlich ein Jahr jünger, er staunt und sieht mich fragend an. Er bittet mich, alles noch einmal von Anfang an zu erzählen. Ich tu’s und senke die Stimme, als ich in dem langen, dunklen Flur vor Peturs Zimmer ein geblümtes Kleid auftauchen sehe. Es ist seine Mutter. Sie trägt immer geblümte Kleider und macht meist ein sorgenvolles Gesicht. Peturs Vater ist kein Maurer; ich weiß eigentlich nicht so recht, was er ist. Jedenfalls steigt er jeden Morgen in einer blauen Kordjacke mit einer dünnen Tasche unter dem Arm in ein uraltes Auto, sein Haar ist wie eine graue Wolke, aus der Schnee auf seine blauen Schultern rieselt.
Ich senke die Stimme noch mehr und sage zu Petur: »Du bist noch zu klein. Es gibt so vieles, was du nicht verstehst.« Und ich erzähle noch mehr von der Frau. Ich rede und rede und gestikuliere.
Dann gehen wir zu mir.
Petur sagt, in der Tschechoslowakei werde viel Kohle abgebaut. Er sagt, es gebe eine Stadt namens Moskau, die unheimlich weit vom Meer entfernt liege. Und außerdem behauptet er, es gebe diese Frau sicher gar nicht, ich würde mir das ausdenken. Da wäre gar keine Frau und auch keine so steife Hafergrütze, dass man sie kauen müsste. Wenn es sie aber doch gebe, sei sie bestimmt eine ganz gewöhnliche Frau, spreche wie andere auch, trüge ein Kleid und ihre Hände suchten ständig einen Lappen zum Abwischen.
»Wart nur ab«, sage ich.
Wir betreten den Hauseingang, gehen die Treppen hinauf. Ich öffne die Tür, ich triumphiere.
Die Frau steht im Wohnzimmer und schaut aus dem Fenster. Zu meinem Entsetzen hält sie einen Lappen in der Hand. Sie hat schwarzes Haar, das an einen schläfrigen Raben erinnert. Sie ist fast genauso groß wie Papa, und obwohl eklig viel Fett an dem Fleisch ist, das sie aus dem Topf angelt und das ich am Abend zuvor am liebsten wieder ausgespuckt hätte, bis ich Vaters flehenden Blick auffing, ist sie selbst kein bisschen fett. Sie ist sogar schlank, sehe ich jetzt in dem Tageslicht, das das Fenster einlässt. Sie ist dünner als andere Frauen in unserem Block. Sie schaut aus dem Fenster und scheint Petur und mich nicht zu bemerken. Es ist seltsam, sie jetzt zu betrachten. Es sieht aus, als wenn jemand sie verloren hätte. Ich sehe aus den Augenwinkeln, wie sich Petur aufrichtet und ein Lächeln über sein Gesicht huscht. Wahrscheinlich habe ich sie so beschrieben, dass er sich auf ein grauenerregendes, drei Meter großes Ungeheuer mit behaarten Armen und scharfen Zähnen von der Größe eines Fleischermessers gefasst gemacht hat. Ich hasse Peturs aufgerichteten Rücken. Ich hasse sein Grinsen. Da dreht sie sich um, und Petur duckt sich, sein Grinsen rutscht ihm zurück in den Hals und bis in den Magen. Sie dreht sich um, und ihre Miene ist härter als ein Fluch. Es ist, als würde sie etwas von uns fordern, und das Schweigen öffnet sich vor uns wie ein schwindelerregender Abgrund.
Petur ist verschwunden.
Ich strecke meine rechte Hand nach ihm aus, um ihn in mein Zimmer zu ziehen, doch er ist weg. Petur ist das Geräusch trampelnder Füße, die die Treppen hinablaufen, er ist das Zuschlagen der Haustür. Ich gehe langsam und vorsichtig in mein Zimmer, ihre Augen verfolgen mich wie zwei Büchsenläufe. Ich setze mich zu meiner britischen Armee. Petur hat jetzt die Hosen voll, obwohl sie in der Tschechoslowakei viel Kohle abbauen. Später gehe ich noch einmal zu ihm rüber, und bald spricht es sich herum, dass jeden Morgen diese Frau aus Vaters Schlafzimmer kommt, die furchteinflößender ist als der schlecht gelaunte Griesgram auf der zweiten Etage, als die saftigen Flüche des Alten auf der dritten und geheimnisvoller als Söbekks Frau, die nie aus ihrem Range Rover steigt und lediglich ein Schatten hinter beschlagenen Scheiben ist. Bald werde ich berühmt, und ein Mädchen, das im ersten Stock links wohnt, wirft mir Blicke zu. Es heißt Gunnhildur und ist wie ein Komet, der von der Sonne kommt.
Die Macht des Schweigens
Das Schweigen der Frau ist ein weites Meer, das man nur schwer überwinden kann. Papa räuspert sich am Abend und lobt das Essen. Papa räuspert sich am Abend und lobt das Wetter. Papa räuspert sich am Sonntag und verkündet, er brauche eine neue Wasserwaage. Papas Räusperer sind kleine Steine, die das Meer verschluckt, seine Worte Vögel, die unstet über der Meeresoberfläche flattern und in der
Ferne verschwinden. Manchmal nickt die Frau mit dem Kopf, und man glaubt, sie habe eine Rede gehalten. Es hat wirklich eine besondere Bewandtnis mit diesem Schweigen. Ich komme langsam auf den Gedanken, es könne manchmal ganz gut sein, zu schweigen. Mir dämmert allmählich, Schweigen verleihe einem Macht. Also gehe ich in einen neuen Tag hinaus und schweige; die anderen Jungen weichen vor meinem Schweigen zurück. Da kommt der fiese Frikki, der schon elf ist und mindestens drei Jungen pro Tag verprügelt. Er packt mich, dreht mir den Arm um und spuckt mir in die Haare, ich aber blicke ihn nur unbewegt und schweigend an. Völlig verwirrt lässt er mich los. Ich nehme mir vor, viele Tage lang zu schweigen. Das Schweigen ist eine Eisenkeule. Der Teufel erhebt sich mit seiner schrecklichen Fratze aus dem Boden. Ich aber stampfe ihn mit meinem Schweigen zurück in die Erde.
Kaum etwas ist so erfreulich wie ein gefüllter Beutel
Dann klingelt das Telefon.
Ich bin allein zu Hause. Tage sind vergangen.
Sie sind zu Wochen geworden, und doch ist es noch weit bis zum Herbst, noch dauert es ziemlich lange, bis der Rektor die Eingangstür zur Schule aufschließen wird. Ich überlege, ob ich für den Rest des Sommers verstummen und mit der eisernen Keule meines Schweigens bewaffnet in der Schule aufkreuzen soll. Ich kann es kaum erwarten, die erste Stunde Werken zu haben und etwas auszufressen. Der Kunstlehrer wird hämisch grinsen, mich packen, hochzerren und mit mir Richtung Keller marschieren, der fensterlos und dunkel unter der Schule kauert. Da geistert ein verstorbener Lehrer lautlos und mit stieren Augen umher. Ja, ich sehe es schon vor mir, wie der Kunstlehrer mich vom Stuhl zieht und droht: »Das bedeutet Keller.«
Zu seiner grenzenlosen Enttäuschung wird aber kein heulender, flennender Junge an seinem Arm zappeln, sondern das Schweigen selbst, tödliches Schweigen. Der Lehrer wird mein Schweigen ebenso ratlos aufnehmen wie Frikki und keine Ahnung haben, was er tun soll.
Das einzige Problem ist, dass es so schwer fällt, die Klappe zu halten.
Nach ein paar Stunden brummt einem die Zunge wie eine dicke Fliege im Mund, der Mund füllt sich mit Worten, und wenn man sich weigert, sie herauszulassen, schmelzen sie im Schweigen. Sie werden zu Spucke, und dann fängt man an zu sabbern wie ein Baby. Ich begreife nicht, wie diese Frau so hartnäckig schweigen kann. Ich begreife diese Frau nicht. Andere Frauen stehen im Treppenhaus und halten ein Schwätzchen. Wenn sich zwei Frauen begegnen, fangen sie unweigerlich an, miteinander zu reden; das ist ein Naturgesetz. Wenn eine Frau in die Waschküche geht, um Wäsche aufzuhängen, gesellt sich eine zweite dazu und wirft eine Maschine mit Wäsche an; das ist ein Naturgesetz. Und wenn der Mann aus der ersten Etage ihnen begegnet, lächelt er und behauptet, sie seien so schön wie dieses oder jenes. Dann verwandeln sich die Frauen augenblicklich in große Mädchen und fangen an zu kichern; das ist ein Naturgesetz.
Es gibt, mit anderen Worten, Verschiedenes, das die Frauen im Block gemeinsam haben und das sie einander so ähnlich macht, dass man sie manchmal nicht unterscheiden kann. Ebenso wenig wie die Männer, die allesamt jeden Morgen mit müden Gesichtern zur Arbeit fahren und abends müde nach Hause kommen. Wir Kinder sind ihnen bloß im Weg, sie grüßen nicht, sondern lassen den Kopf hängen und sehen einander so ähnlich, dass man sie nicht auseinander halten kann. Selbst der Griesgram von der zweiten Etage ist genau wie alle anderen, wenn er mit dieser Leichenbittermiene und den müden Händen aus seinem Wagen klettert.
Aber es sind Tage vergangen, haben sich zu Wochen angesammelt, und das Telefon klingelt.
Ich bin allein zu Hause.
Das Telefon gefällt mir. Es verwandelt Erwachsene in weiche Stimmen, zu denen man eigentlich alles sagen kann. Ich nehme den Hörer ab, sage Hallo und bin förmlich wie ein Major.
Eine schrille Frauenstimme ruft: »Ein Gespräch« und weiter nichts. Ich bin so verwirrt, dass ich auf der Stelle zum Leutnant werde – eine große Degradierung. Erst herrscht Schweigen, dann kommt eine andere Stimme, aus weiter Ferne, als rufe jemand hinter einem Berg hervor. Die Stimme ruft einen Namen, ich weiß, dass er mit der Frau zu tun hat, die nicht zu Hause ist, und da ich nicht sie bin, bleibe ich stumm. Das Schweigen im Draht ist erfüllt von Rauschen, voll fremdartiger Ferne.
Die Stimme: »Wer ist am Apparat?«
Ich: »Ich.«
Die Stimme wiederholt den Namen der Frau. Die Stimme klingt dünner als andere am Telefon, sie erinnert mich an die Stimmen meiner Spielzeugsoldaten, wenn ich sie in den Hosentaschen mit mir herumtrage und sie mich von da aus rufen. Ich kichere.
Die Stimme: »Wo ist sie?«
Die Stimme ist nicht mehr dünn, sie hat sich in eine Stahlsaite verwandelt. Ich weiß, was eine Stahlsaite ist, ich habe schon eine angefasst. Eine Stahlsaite ist hart und kalt. Ich bin kein Leutnant mehr, ich bin nicht einmal Soldat, sondern nur ein kleiner Junge, und mir gefällt das nicht. Die Stahlsaite befiehlt mir, die Frau zu holen. Ich lege den Hörer weg und habe schon eine Hand an der Türklinke, als ich zögere. Nicht, dass es mir zu viel wäre, die Frau zu suchen. Sie ist einkaufen gegangen, bei Söbekk, im Milchgeschäft, bei Vogue oder im Fischladen. Doch ich denke, es wäre höflich, Stahlsaite das alles genauestens auseinander zu legen. Es ist mir auf einmal wichtig, höflich zu erscheinen. Also nehme ich den Hörer noch einmal auf und möchte erklären: Sie ist einkaufen gegangen und so weiter, doch da erinnere ich mich, dass Stahlsaite aus großer Entfernung anzurufen scheint, womöglich liegt der ganze Atlantik zwischen uns. Es wird also nicht reichen, einfach zu sagen: Sie ist nur eben bei Söbekk was einkaufen oder sie ist da und da. Nein, das muss ich ausführlicher angehen, eine Art Lageplan der Umgebung entwerfen. Ich lasse mich also auf dem Stuhl am Telefon nieder und atme tief durch. Ich hatte mir schon zurechtgelegt, mit dem Parkplatz vor dem Block zu beginnen, dem großen Fußballplatz oberhalb der Garagen, dem Wartehäuschen an der Bushaltestelle und so weiter, aber dann lasse ich es und beschreibe bloß, wie die Frau, die die Stimme einfach bei einem Namen nennt, als wäre nichts selbstverständlicher, ihren braunen Mantel übergezogen, den traurig leeren Einkaufsbeutel genommen und das Haus verlassen hat. Dann beschreibe ich den Weg und Söbekk, hebe besonders hervor, dass sein Nacken an ein Wolkenpolster erinnert, weil ich auf dieses Wort ungeheuer stolz bin: Wolkenpolster, und ich betone es sehr nachdrücklich. Ich erkläre auch, dass man erst gar nicht zu versuchen braucht, in Söbekks Kiosk etwas zu klauen. Denn selbst wenn er in seinem Büro hinter einer Wand sitzt, die von hohen Stapeln Klosettpapier verdeckt wird, bekommt er jede Bewegung in seinem Laden mit. Weiter berichte ich von Vogue und der Schere und gehe dann zu dem Mann im Fischgeschäft über, der manchmal böse ist wie ein Chinakracher am Silvesterabend. Da kommt es mir allerdings allmählich so vor, als würde mich ein Schweigen im Hörer unterbrechen. Ich lausche und kann in der Ferne schwere Atemzüge unterscheiden, wie ein Unwetter, das sich hinter dem Horizont zusammenbraut. Ich lege den Hörer weg, setze mich aufs Sofa und warte. Eine ganze Weile vergeht, dann öffnet sich die Tür, die Frau tritt ein, ein Kleiderbügel im Schrank bekommt den Mantel umgehängt und der Einkaufsbeutel wandert in die Küche. Kaum etwas ist so erfreulich wie ein voller Beutel, ein leerer hat dagegen etwas Trostloses an sich. Die Frau geht mit ein paar Rollen Toilettenpapier ins Bad.
Ende der Leseprobe