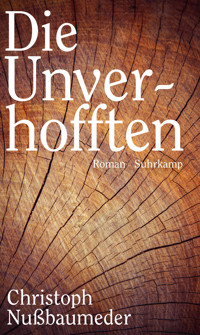21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Johannes Gottstein flieht 1796 nach New York. Der junge Pfarrer war zu freigeistig, wurde exkommuniziert. In den frisch gegründeten USA soll «John» eine Expedition des vermögenden Oliver Hancock begleiten, der das «American Incognitum» aufspüren will – ein Mammut in einem unzugänglichen Landstrich, dessen Entdeckung Reichtum, ja ewigen Ruhm verheißt. Dreizehn Männer ziehen los, ein bunter Haufen. Sie erleben Eisstürme, Überfälle, begegnen Natives. Die waghalsige Reise fordert bald ihre Opfer. Und sie stellt alle auf die Probe, den Humanisten John genauso wie den träumerischen Idealisten Hancock, der doch Sklaven besitzt. Tiefe Konflikte brechen auf: Wem gehört die Welt? Was darf der Mensch in ihr tun? Bei den Lakota stößt die Truppe auf riesige Stoßzähne, auch hören sie von einem mysteriösen Tal. Doch je weiter sie in dieses verborgene Herzland vordringen, desto tiefer geht es auch ins Unbekannte der Seele. Nach dem erfolgreichen Debüt «Die Unverhofften» nun der neue Roman von Christoph Nußbaumeder: Auf der legendären Lewis-und-Clark-Expedition fußend, erkundet er den Geist von Freiheit und Menschlichkeit – in einem packenden, funkelnden Abenteuer.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 564
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Christoph Nußbaumeder
Das Herz von allem
Roman
Über dieses Buch
Johannes Gottstein flieht 1796 nach New York. Der junge Pfarrer war zu freigeistig, wurde exkommuniziert. In den frisch gegründeten USA soll «John» eine Expedition des vermögenden Oliver Hancock begleiten, der das «American Incognitum» aufspüren will – ein Mammut in einem unzugänglichen Landstrich, dessen Entdeckung Reichtum, ja ewigen Ruhm verheißt. Dreizehn Männer ziehen los, ein bunter Haufen. Sie erleben Eisstürme, Überfälle, begegnen Natives. Die waghalsige Reise fordert bald ihre Opfer. Und sie stellt alle auf die Probe, den Humanisten John genauso wie den träumerischen Idealisten Hancock, der doch Sklaven besitzt. Tiefe Konflikte brechen auf: Wem gehört die Welt? Was darf der Mensch in ihr tun? Bei den Lakota stößt die Truppe auf riesige Stoßzähne, auch hören sie von einem mysteriösen Tal. Doch je weiter sie in dieses verborgene Herzland vordringen, desto tiefer geht es auch ins Unbekannte der Seele.
Nach dem erfolgreichen Debüt «Die Unverhofften» nun der neue Roman von Christoph Nußbaumeder: Auf der legendären Lewis-und-Clark-Expedition fußend, erkundet er den Geist von Freiheit und Menschlichkeit – in einem packenden, funkelnden Abenteuer.
Vita
Christoph Nußbaumeder, 1978 in Eggenfelden geboren, ist ein preisgekrönter, viel gespielter Dramatiker und Autor. Er studierte Rechtswissenschaften, Germanistik und Geschichte in Berlin. Seine Stücke wurden unter anderem an der Berliner Schaubühne, am Schauspielhaus Bochum und am Schauspiel Köln uraufgeführt. «Die Unverhofften», sein erster Roman, ausgezeichnet mit dem Grimmelshausen-Preis, fand große Beachtung beim Publikum. Die FAZ schrieb: «Mit dem Gespür des Dramatikers, der Zeitsprünge in symbolträchtigen Szenen und zwischenmenschlichen Begegnungen pointieren kann, hat Nußbaumeder ein Familienepos geschrieben, das eine große literarische Überraschung ist.» Christoph Nußbaumeder lebt in Berlin.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, August 2025
Copyright © 2025 by Rowohlt · Berlin Verlag GmbH, Berlin
Covergestaltung Anzinger und Rasp, München
Coverabbildung The Oxbow (Ausschnitt). Gemälde von Thomas Cole, 1836. Sammlung Metropolitan Museum of Art, New York.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cole_Thomas_The_Oxbow_(The_Connecticut_River_near_Northampton_1836
ISBN 978-3-644-02346-8
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Wenn wir uns finden, so finden wir alles.
Jacob Böhme
Als Georges Cuvier 1796 seine erste Vorlesung im neu eröffneten Institut National de France in Paris hielt, ahnte niemand von uns, was der junge Naturforscher herausgefunden hatte.
Cuvier referierte über Mammuts und Mastodonten, er wies nach, dass sie weder zur Spezies des Indischen noch des Afrikanischen Elefanten gehörten, sondern eine eigenständige Gattung bildeten. Diese Gattung sei mittlerweile jedoch ausgestorben. Er sagte tatsächlich ausgestorben. Cuviers Befund versetzte die Anwesenden in Empörung. Aussterben, das gab es nicht in ihrem Bewusstsein, es rüttelte an der Urangst des Menschen vor dem Nichts. Denn falls das mit diesen Tieren wirklich geschehen war, könnte es auch ihnen oder ihren Nachkommen irgendwann einmal widerfahren: das endgültige Verschwinden vom Erdball.
Die Leute glaubten fest an ein von Gott vollständig eingerichtetes Universum, dem nichts hinzugefügt und aus dem nichts entfernt werden konnte. Aussterben, das war ein Skandalon ersten Ranges. Und was nicht sein durfte, das konnte auch nicht sein. Gott hatte in der Genesis die Welt erschaffen, so wie sie sich uns offenbarte, und selbst in der nicht christlichen Hemisphäre war man sich seit Platon einig darüber, dass die große Kette der Wesen unverbrüchlichen Bestand habe und vom kleinsten Insekt bis zum gewaltigsten Geschöpf hinaufreiche.
Der junge Franzose stellte dieses schöpferische Prinzip indessen schonungslos infrage. Noch Jahre später war Cuvier als Wirrkopf verschrien, man warf ihm vor, nicht die redliche Wissenschaft zu vertreten, sondern eine krude Außenseitermeinung zu verkünden. Dabei hatte Georges Cuvier die Wahrheit ausgesprochen.
Da wir just im selben Jahr zu unserer Expedition aufbrachen, um in den Black Hills das American Incognitum zu finden, hatten auch wir keine Kenntnis von ausgestorbenen Tierarten. Niemand von uns hatte je davon gehört. Hätten wir dies gewusst, hätte es die Expedition vielleicht nie gegeben, und mein Leben wäre ganz anders verlaufen.
Die Ereignisse, über die ich schreibe, dokumentieren meine Reise ins «Herz von allem» als Aufbruch in eine fremde Welt und Rückkehr in eine neue Heimat. Seither sind vierzig Jahre vergangen, einige Dinge erkenne ich heute wesentlich klarer als damals, da ich vieles über das Land und seine Einwohner noch nicht wusste. Manches dagegen wird mir wohl bis zu meinem Lebensende rätselhaft bleiben. Die folgende Geschichte ist jedoch wahr, ich weiß es deshalb, weil sie mir so wirklich wie ein Traum erschienen war.
John Stone, Philadelphia 1836
Erster Teil
1. Ankunft in Amerika
Auf den letzten Meilen strahlte uns ein gelbliches Leuchtfeuer entgegen, zunächst sehr verschwommen, dann klarer mit allmählich schärfer werdender Kontur. Tränen stiegen mir in die Augen, mein Herz schlug wild, gleichzeitig fühlte ich mich erhaben, wie jemand, den weniger eine glückliche Fügung als eine göttliche Vorsehung hierhergespült hatte. Ich faltete die Hände, senkte mein Haupt und holte tief Atem.
Wie so oft während der vierzigtägigen Überfahrt stand ich an Deck der «Aurora», nur dieses Mal schon bevor die Sonne den Tag zurückgeholt hatte. Schließlich hob ich wieder meinen Kopf, und für einen Moment war mir, als träte ein riesiges Tier auf der Landzunge hervor und betrachtete mich mit schmalen, glimmenden Augen. Gleich darauf stach die Morgensonne die ersten Häuser aus dem Dunst heraus und machte den Hafen von New York kenntlich. Dutzende Passagiere polterten vom Zwischendeck herauf und drängten an die Reling, doch anstatt des erwarteten üblichen Radaus breitete sich eine knisternde Stille aus. Selbst die flegelhaftesten unter ihnen brachten keinen Ton hervor. Alle, wirklich alle staunten, manche mit offenem Mund, andere mit geschlossenen Augen, und niemand sagte für Minuten auch nur ein Wort. Vor uns lagen tatsächlich die Gestade der Vereinigten Staaten von Amerika.
All die Wochen über war ich wie berauscht gewesen; von meinen Gedanken, meinen Hoffnungen, vom Blick aufs Wasser, das mir in der Weite grenzenlos erschien, und ließe man sich hineinfallen, würde man wohl nie mehr aufhören zu sinken. An sonnigen Tagen tanzten Myriaden von Spieglein auf der Meeresoberfläche, die mir winzige Blitze zuwarfen. Mit jedem Tag auf hoher See wuchs meine Vorfreude auf die Ankunft in diesem jungen, verheißungsvollen Staat, während die alte Heimat, wo man die Ungerechtigkeit der Unordnung vorzog, in mir zerbröckelte wie morsches Holz.
Ich machte mir aber nicht nur Illusionen, sondern rechnete durchaus mit Enttäuschungen und Hindernissen – und dennoch: Ich erhoffte mir zumindest eine Insel des befristeten Gelingens, auf der Gerechtigkeit und Ordnung einhergingen, für nicht viel weniger als für die Länge eines Traums, der meine restliche Lebenszeit andauern sollte. Ich war damals dreißig Jahre alt und hatte bereits ein Leben hinter mir.
Der Dreimaster hatte schon eine Weile im Lee der Lagerhallen und Bootsschuppen geschlingert, bis uns endlich ein resoluter Kommandoruf die Genehmigung erteilte, an Land zu gehen. Schwere Taue sowie riesengroße Knäuel von Fischernetzen lagen verstreut auf dem Kai, an einer Bretterwand prangte unübersehbar die rot-weiße, mit fünfzehn Sternen besetzte Flagge der Vereinigten Staaten. Ich ließ die anderen Ankömmlinge an mir vorüberziehen, die den direkten Weg zu den Aufnahmequartieren einschlugen.
Oliver Hancock hatte mir in seinem letzten Brief mitgeteilt, dass er abseits des Piers bei den schmiedeeisernen Toren auf mich wartete. Sobald die «Aurora» in Sichtweite käme, würde ein Hafeninspektor einen Laufburschen nach ihm aussenden. Ich bräuchte mich nirgends anzumelden, alles sei bereits erledigt und in guten Händen. Ich solle lediglich meine Einreisedokumente griffbereit halten, beim Anblick seines Siegels würde man mich durchwinken, und ich könne davon ausgehen, zuvorkommend behandelt zu werden. Und in der Tat, nach der Kontrolle meiner Papiere wies mir ein freundlicher Herr von der staatlichen Behörde den Weg zum Hafenausgang.
Ich wand mich an aufgetürmten Gepäckburgen vorbei, ehe ich eine lang gestreckte Anlegestelle entlanglief, wo unter meinen Füßen der Unrat des Welthandels lag, Gewürzkrümel, Tee und Kaffeebohnen, zu Boden gefallene und zerquetschte Orangen und in fast regelmäßigen Abständen Lachen von Branntwein oder Essig, um deren Ränder sich dicke Fliegen sammelten. Am Ende der Lände begann der ansteigende Weg zu den Toren, der von dunkelroten Sandsteingebäuden gesäumt war. Meinen schweren Koffer schleppte ich abwechselnd mit der rechten und linken Hand. Auf einmal drangen grelle Stimmen an mein Ohr. Schräg gegenüber, vor einer Taverne, schienen vier Männer irgendetwas unter sich auszumachen. Sie standen im Halbkreis, und der lauteste schwenkte eine Flasche, als klopfte er seine Worte in die Luft, dabei geriet sein schmaler Körper arg aus dem Gleichgewicht. Die vier waren ziemlich heruntergekommen, wirkten ausgezehrt und gingen dennoch wüst miteinander um, offenbar waren sie schwer betrunken. Sie hatten alle eine dunkle Hautfarbe sowie pechschwarzes, nackenlanges Haar. Jetzt erst begriff ich, dass diese Männer amerikanische Ureinwohner waren. Ich hielt an, um mir ein genaueres Bild von ihnen zu machen, auch um Sprachfetzen aufzuschnappen, doch kaum stand ich still, zupfte mich jemand am Ärmel meines Mantels.
«Kommen Sie mit. Sie sind doch Mr Gottstein, Johannes Gottstein?»
Ich nickte dem Jungen zu, meine Augen wanderten aber sofort wieder zu den Ureinwohnern, von denen einer jetzt seinen Nebenmann anpinkelte, was bei diesem einen heftigen Wutanfall auslöste. Ich empfand es stets als rätselhaft, wenn schwächliche, im Grunde genommen bereits dem Tode entgegentaumelnde Menschen noch immer so viel Zorn aufbrachten. Als revoltierte ihre Seele noch ein letztes Mal vor dem Gang ins Jenseits. Die Indianer fingen an, sich gegenseitig zu stoßen, und der eben noch urinierende Bursche fiel dabei zu Boden, wobei sein Hosenlatz nach wie vor offen stand. Die anderen machten sich prompt einen Spaß und traten nach ihm wie nach einem Baumstamm, der mal da- und mal dorthin rollte. Der Junge ergriff nun mein Handgelenk und zog mich weg. Mit einer Stimme, die tiefer klingen sollte als seine normale Tonlage, appellierte er eindringlich an mich.
«Kommen Sie bitte mit, das sind sittenlose Wilde.»
Jetzt sah ich ihm zum ersten Mal ins Gesicht. Seine sommersprossigen Wangen glänzten im matten Sonnenlicht, seine bläulichen Augen waren von einem Schleier verhangen, aus ihnen sprachen aber auch Eigensinn und Aufsässigkeit. Er stellte sich als Kermit MacGowan vor, er sei von Mr Hancock geschickt worden, um mich abzuholen. Mr Hancock habe noch Geschäfte zu erledigen, würde mich aber am Nachmittag in der Herberge begrüßen. Die Worte purzelten schnell und schludrig aus ihm heraus, dann nahm er mir den Koffer ab, und wir trotteten schweigend zum Tor. Der Junge war zwar ein Schlaks, ein Hänfling mit geflickten Hosen, aber er war drahtig und augenscheinlich sehr kräftig, denn er trug mein Gepäck, ohne es auch nur ein einziges Mal abzusetzen. Über die Indianer verloren wir kein weiteres Wort. Mir fiel nur auf, dass er sich noch einmal nach ihnen umsah und einen giftigen Fluch ausstieß, den ich aber nicht verstanden hatte.
Bei der Kutsche, die mit zwei Pferden bespannt war, wartete der Fuhrknecht auf uns, ein Mann schätzungsweise um die vierzig, der den Namen Sidney trug. Es war das erste Mal, dass ich einem Schwarzen so nahe kam, ihm sogar die Hand schüttelte. Das allererste Mal hatte ich zwei Jahre zuvor welche in Frankreich gesehen, eine Schar Sklaven auf einer Baustelle, mit zerrissenen Kleidern und zerschundenen Leibern. Sidney war Olivers Hausdiener, er hatte einen sauberen, dunklen Zweireiher an, und ehe er mir die Tür öffnete, erkundigte er sich nach meinem Befinden und wie die Reise verlaufen sei. Anders als Kermit schien Sidney ein gefälliger Charakter zu sein, seine warme Ausstrahlung erleichterte umgehend mein Herz.
Während der Fahrt saß mir der Junge schweigend gegenüber. Nur manchmal schnalzte er leise mit der Zunge. Ich verbrachte die Zeit damit, Straßenszenen zu beobachten, denn in einer so großen Stadt war ich vorher noch nie gewesen, selbst München kam mir viel kleiner vor, von Basel und Zürich ganz zu schweigen. Die Kutsche klapperte über die Insel Manhattan, wir fuhren auf den Broad Way, passierten die Universität und die mit ihr verbundene Trinity Church, dann bogen wir auf die Wall Street, und ich sah die Federal Hall, wo sieben Jahre zuvor die «Bill of Rights» angenommen worden war. Von dort ging es auf die William Street, auf der wir eine Weile geradeaus fuhren. Hier war es nicht anders als in Europa: Sobald sich ein junges Jahr dem Frühling zuneigt, tummeln sich die Leute auf den Gassen. Ich sah viele Sklaven neben ihren Herren einhergehen, einige sahen arg gedrückt aus, anderen machte die Gefangenschaft, so mein Eindruck, weit weniger aus, sie wirkten gar stolz und würdevoll. Armut und Unfreiheit schienen in dieser Stadt keine Schande zu sein, Elend und Glanz nicht miteinander auf Kriegsfuß zu stehen. Bisweilen steckten wir für Minuten im Verkehrsgetümmel fest, die Kutscher schalten sich gegenseitig mit derben Schimpftiraden, sichelbeinige Kavalleristen, die zu Fuß unterwegs waren, schmetterten patriotische Lieder, Fisch- und Gemüsehändler fochten, so schien es, einen Wettstreit aus, wer am lautesten sein Angebot herauszubrüllen imstande war. Ich spürte eine Kraft, die alle diese vielen Menschen zu einer tatkräftigen Herde zusammengetrieben hatte. Die Passanten bewegten sich sehr schnell, als wären sie unentwegt bestrebt, auf den nächsten, vielversprechenderen Moment zuzulaufen. Ich sah aber auch Menschen in feinem Zwirn, Damen wie Herren, die mit gesenkten Häuptern über Plätze schritten, ihre Augen unablässig auf Handspiegel gerichtet, die sie vor sich hertrugen wie aufgeschlagene Gebetsbücher.
Alles war aufregend und neuartig, und ich konnte es nicht fassen, dass mich die Lotterie des Lebens tatsächlich hierher verschlagen hatte. Drei Jahre zuvor war ich noch ein verzweifelter Pfarrer gewesen, der sich mit Feldmessen ein paar Dukaten dazuverdient hatte, um sich die Flucht aus dem Kloster zu finanzieren, jetzt war ich plötzlich ein willkommener Einwanderer, dem man die Überfahrt von Le Havre nach New York bezahlt hatte und der nun mit einer Kutsche zu seiner Herberge chauffiert wurde. Ich lächelte Kermit an, doch der Junge nahm mich gar nicht wahr, er starrte mit leeren Augen vor sich hin.
Mrs Hunter, meine Kostwirtin, war eine äußerst elegante Erscheinung, sie nahm mich herzlich auf und servierte mir anschließend ein warmes, schmackhaftes Mahl in der dazugehörigen Schankstube; gesottenes Rindfleisch mit Kartoffeln, Bohnen und einen Becher Kaffee. Jetzt erst merkte ich, wie durchgefroren ich war. Mrs Hunter bemerkte dies ebenfalls, und mein Reisegestank war ihr sicherlich auch nicht entgangen, also setzte sie flugs Wasser auf, um mir ein heißes Bad anzurichten. Ihr Dienstbote, der trotz seines durchhängenden Kreuzes, als hätte er sein Leben lang schwere Steine schleppen müssen, flink und wendig war wie ein Flussotter, befüllte eilends einen Holzzuber im Waschraum.
Nach dem genossenen Bad ging ich die Stufen hoch auf mein Zimmer, das nicht nur sehr geräumig war – noch nie hatte ich einen so großen Raum für mich allein gehabt –, sondern auch vornehm eingerichtet, mit einem breiten Himmelbett und herrschaftlichem Mobiliar. Ich schlüpfte in mein Nachthemd und packte noch schnell meinen Koffer aus. Dabei fiel mir die kuriose Wirkungsweise der zwei Trumeaus auf, die hier einander gegenüberstanden. Wenn ich mich vor einen der Spiegel stellte, wurde mein Bild von zwei Spiegeln zurückgeworfen, dieses wieder vom ersten und so weiter, sodass ich mich in ewiger Wiederholung sah. In meinem Rücken schlug eine mächtige Standuhr zwölf Uhr Mittag. Ihr brauner Korpus war an den Leisten golden verziert, wie auch das Ziffernblatt hoch über meinem Kopf. Die Zeit schwebte also über mir, dachte ich umgehend. Möge sie auch auf meiner Seite sein.
Ein vehementes Klopfen weckte mich aus meinem bleiernen Schlaf. Ich riss die Augen auf, wusste aber nicht gleich, wo ich mich befand. Ich wunderte mich nur, warum nichts um mich herum schwankte und alles so ruhig war. In Gedanken sah ich das Unterdeck der «Aurora», wo sich zwischen Kojen, Waren und Gepäck meist Familien niedergelassen hatten, die sich oft zankten oder über irgendetwas klagten. Prompt vermeinte ich den Geruch von Kohl und Stall in der Nase zu haben. Obgleich ich mich nach weiterem Klopfen ruckartig aufrichtete und «Ja» sagte, dauerte es ein wenig, bis ich in der Lage war, die neue Umgebung zu erfassen.
Ich vernahm nun die Stimme Mrs Hunters, die mir durch die Tür mitteilte, dass unten in der Gaststube Gesellschaft auf mich wartete. Nun kam ich zu mir, bestimmt Oliver Hancock, dachte ich. Zwar war ich todmüde und spürte noch jeden einzelnen meiner Knochen, nichtsdestotrotz überwog die Vorfreude, ihn zu sehen. Ich bat Mrs Hunter, sie möge ausrichten, ich würde in zehn Minuten erscheinen. Die Uhr verriet, dass ich gut drei Stunden geschlafen hatte. Ich kleidete mich um und warf mir meinen Benediktinerhabit mitsamt dem Skapulier über, außerdem zog ich neue Stiefel an, die ich noch in Europa hatte machen lassen. Oliver sollte mich ruhig in meiner Mönchskutte zu Gesicht bekommen, schließlich bestand er ausdrücklich darauf, mich als Mann Gottes dabeizuhaben und nicht als Chronisten oder Astronom. Er hatte mich aus Gründen strenger Geheimhaltung nicht in seine genauen Pläne eingeweiht, aber ich wusste zumindest, dass es ins Landesinnere ginge, in die von der Zivilisation noch unberührte Wildnis. Vielleicht, so spekulierte ich, wollte er dort im Namen Gottes und im Dienst der Aufklärung Eingeborene missionieren, oder er beabsichtigte, einen geeigneten Ort zu finden, um eine neue Stadt zu erbauen. Ohne blutdurchtränktes Fundament, auf reiner Vernunft gegründet und im Geiste Jesu verwirklicht. Anhand seiner Andeutungen hielt ich derlei Dinge durchaus für möglich. Nun war ich sehr gespannt, worum es tatsächlich gehen würde.
Als ich den Saloon betrat, wo ich vorher noch alleine gespeist hatte, fand ich eine Schar Männer vor, die sich um den großen Tisch herumgruppiert hatte. Durch die Fensterscheiben drang eigentlich genug Licht herein, dennoch saßen sie bei Kerzenschein. Oliver befand sich nicht unter ihnen, stattdessen erblickte ich Kermit, der mich aber einfach nur mit lauernden Augen anglotzte.
Ich grüßte scheu in die Runde, doch niemand äußerte sich, alle maßen mich von oben nach unten, ähnlich abschätzig, wie ich es aus deutschen Landen von den Mienen der Adeligen her kannte. Dabei machte dieser neunköpfige Haufen alles andere als einen blaublütigen Eindruck auf mich. Manche hatten sich schon die Nasen rot gesoffen, andere sahen aus wie graugesichtige Gauner.
«Ich habe eigentlich Mr Hancock erwartet», sagte ich in die aufgeladene Stille hinein.
«Wenn man irgendwo neu ist, sollte man sich erst einmal vorstellen. So ist es bei uns Sitte.» Der Mann, der dies von sich gab, sprach betont langsam und mit einer hellen Stimme, er trug einen Dreispitzbart und funkelte mich aus tief sitzenden Augen an. Instinktiv ging ich auf ihn zu, und mir stieg sofort ein abgestandener Maiglöckchenduft in die Nase, den er verströmte. Der Geruch des Todes, dachte ich auf Anhieb. Ich entschuldigte mich, verwies auf meine Müdigkeit sowie auf die ungewohnte Umgebung.
«Mein Name ist Johannes Gottstein, aber nennen Sie mich ruhig John, ich bin ein katholischer Pfarrer, wurde jedoch von meiner Abtei im Staat Kurpfalz-Bayern exkommuniziert. Die vergangenen zwei Jahre verbrachte ich in der Schweiz, wo ich zuletzt Redaktor einer Zeitung war. Dort habe ich auch Mr Hancock kennengelernt, vor gut einem Jahr. Er lud mich ein, ein Teil der Expedition zu werden. Nun bin ich hier.» Ich breitete die Arme aus und setzte ein ergebenes Lächeln auf.
«Gut gemacht, Pfarrer John», sagte der Dreispitz und schlug mir gönnerhaft auf die Schulter. Er stellte sich als Joe Scheider vor, ebenfalls deutschstämmig und von Beruf Arzt. Dann nannte er im Uhrzeigersinn die Namen der anderen. Damals konnte ich sie mir nicht sofort merken, aber wenn ich heute die Runde vor meinem inneren Auge wachrufe, so war die Anordnung folgendermaßen: Paul Rickover, Jerome Drouillard, Tom Pueyo, Steven Twitty, Kermit MacGowan, Lawrence Wilkerson, Gustaf Billstrom und Jack Sullivan.
Ich fragte mich kurz, warum Mrs Hunter nicht zugegen war. Diese Leute waren der lebendige Kontrast zu ihrem schmuck eingerichteten Lokal.
«Mr Hancock wird schon noch kommen», ergriff nun Rickover das Wort direkt neben Scheider, über dessen linke Wange eine markante Narbe verlief. Er strich sich drei Strähnen aus seiner Stirn und setzte ein verschmitztes Lächeln auf.
«Genehmigen Sie sich einen Whiskey und erzählen Sie uns noch ein wenig aus Ihrem bewegten Leben. Wo haben Sie die englische Sprache so gut gelernt?»
Ich wollte diese Männer mit einer gewissen Gewitztheit für mich gewinnen und bekundete, dass ein Deutscher dem Begriff nach jemand sei, der weder Latein noch Griechisch spreche, weshalb ich mir neben diesen beiden Sprachen die englische und die französische angeeignet habe, mit der Absicht, gewissermaßen das Gegenteil eines Deutschen zu werden. Als daraufhin niemand etwas erwiderte, schob ich hinterher, es sei mir ein dringendes Bedürfnis gewesen, nach meiner Schulzeit Englisch und Französisch dazuzulernen, um den Vereinigten Staaten wie auch Frankreich als den zwei Ländern der Revolution meine Hochachtung entgegenzubringen. Scheider kommentierte dies mit einem «Bravo» und klopfte mit den Fingerknöcheln auf den Tisch. Ich wusste allerdings nicht, ob er es spöttisch oder anerkennend meinte. Paul Rickover bemerkte lapidar, mein Englisch sei sehr gut, aber grausam anzuhören. Er wies mir einen Platz neben sich zu, und rasch hatte ich auch ein satt eingeschenktes Glas Whiskey in der Hand. Rickover hob das seine und sprach: «Auf unseren Gottesmann, möge ihm die neue Heimat wohl bekommen.»
Alle stürzten ihr Glas hinunter, also tat ich es ihnen gleich. Das Zeug war so scharf, als hätte man meiner Kehle Rizinusöl verabreicht. Es schüttelte mich, und ich keuchte wie ein heiserer Hund. Lautes Gelächter brandete über mich hinweg, am längsten und schallendsten lachte Rickover selbst, dergestalt, dass ich sein Gaumenzäpfchen immer noch sah, nachdem mein Hustenanfall schon wieder abgeklungen war. «Humor ist hier ein anderer Name für Religion», raunte er mir zu und schwang mir seine Pranke ins Kreuz. «Willkommen in Amerika!»
Alle schienen plötzlich heiter und aufgeweckt, wenn auch nicht unbedingt freundlicher mir gegenüber. Jack Sullivan, ein bulliger und – seiner schiefen Nase nach zu urteilen – auch streitlustiger Kerl, fragte mich, ob ich überhaupt reiten und rudern könne, ob ich Angst vor wilden Tieren und Indianern hätte oder ob ich mir vor unbekannten Monstern in die Hosen machen würde … Er zog seine Augenbrauen zusammen und grinste mich fratzenhaft an. Was hatten diese Leute bloß gegen mich, fragte ich mich erschrocken. Mochte es damit zu tun haben, dass ich ein Katholischer war? Dabei war ich doch einer von ebendieser Kirche Ausgestoßener … Ich goss mir Whiskey ein, leerte das Glas in einem Zug, worauf ich wieder husten musste, allerdings nur ein- oder zweimal.
Ja, gab ich schließlich zu, ich hätte Angst. Aber was sei schon meine Angst, verglichen mit der von Jesus in den Stunden vor seiner Kreuzigung. Gott erlege uns allen Prüfungen auf, und nur wer diese aufrichtig bestreite und durch alle Ängste hindurchgehe, werde wirklich frei.
Draußen vor der Tür schnalzte eine Peitsche, Pferde wieherten, Hunde bellten. Alle beäugten mich mit einem schalen Blick, als wäre ich ein Spinner. Scheider, der Arzt, räusperte sich und sagte, meine Antwort sei interessant, doch leider neigten viele Menschen dazu, sich zu überschätzen. Sich mit Christus zu vergleichen, sei jedenfalls sehr vermessen.
«Ein Beispiel an ihm nehmen und sich in Demut üben, das habe ich gemeint!», brach es aus mir hervor.
«Demütig kommen Sie mir nicht gerade vor», versetzte Rickover gallig, «was haben Sie überhaupt auf so einer Expedition zu suchen? Wir haben keinen Pfaffen nötig. Oder wollen Sie Gott in den Wäldern auf der anderen Seite des Mississippi finden?» Ich hörte, wie einige belustigt auflachten. Rickover lehnte sich behäbig zurück. «Nun, was haben Sie dazu zu sagen?»
«Nichts», sagte ich unwirsch, «nur so viel: Ich habe nicht vor – Gott sei gelobt –, ihn in der Wildnis zu suchen. Man erkennt Gott im Herzen, egal, auf welchem Boden man steht. Und ich wurde von Mr Hancock persönlich gebeten, als Geistlicher mitzukommen. Meine Anwesenheit ist ausdrücklich erwünscht, aus diesem Grund habe ich einen Ozean überquert und alles zurückgelassen, alles!» Ich spürte die Erregung in meiner Brust, mit zitternden Händen glättete ich meinen Habit. Aus dem Augenwinkel beobachtete ich, wie Scheider Sullivan ein Zeichen gab, worauf dieser unverzüglich das Wort übernahm.
«Schon mal nachgedacht, welche Gefahren für einen Kirchenmann in der Wildnis lauern? Bei manchen Stämmen gibt es Weiber mit Riesenbrüsten und solchen Ärschen, die scheren sich einen Dreck um deine Keuschheit oder Gelübde, die pflanzen sich einfach auf dich drauf und drücken dich platt.»
Wieder lachten sie, diesmal dumpf und räudig.
«Dort draußen», und Sullivan wies mit ausgestrecktem Finger nach Westen, wo die Sonne gerade glutrot hinterm Horizont versank, «da gibt es keine Friedhöfe. Wer umkommt, endet nicht in geweihter Erde, sondern als ein von Rothäuten Massakrierter oder als Mahlzeit in einem hungrigen Magen.»
Mrs Hunter kam aus der Küche in den Saloon getippelt und kündigte an, bald werde aufgetischt, Mr Hancock würde ebenfalls bald da sein. Kaum dass sie wieder verschwunden war, schwang auch schon die Tür auf, ein kalter Wind fegte durch den Raum und löschte das Kerzenlicht. Olivers Gesicht lag im Dunkeln, aber man konnte sehen, wie sich sein Mund zu einem breiten Grinsen ausdehnte. Er verharrte kurz im Türrahmen und lupfte seinen Hut, ehe er mit der ihm eigenen patrizischen Sicherheit eintrat. Ihm folgte ein bärtiger, mürrisch dreinblickender Mann. Er hatte zwar einen aufrechten Gang, doch ihm haftete etwas Schwerblütiges an, als spürte er die Zukunft in seinen Knochen. Nach ihm kam Sidney herein, der die Tür umgehend hinter sich zuzog und verriegelte.
Alle erhoben sich, und Oliver schüttelte reihum jedem die Hand. Ein verbindendes Ritual, das ich von einem Anführer noch nie gesehen hatte. Mir drückte er die Hand besonders lange, hieß mich herzlich willkommen. Er entschuldigte sich übertrieben, dass er mich nicht persönlich abholen hätte können. Er hoffe jedoch, ich sei gut empfangen worden, was ich schmallippig bejahte. Sodann nahm er auf einem grün gepolsterten Sessel Platz, den man aus einem Nebenzimmer für ihn herbeigeschafft hatte, und begann, mich mit Lobeshymnen zu übergießen, Sentenzen des Dankes und der Wertschätzung prasselten auf mich ein. Er stellte mich als einen ehrbaren Illuminaten vor, ferner verwies er auf meinen heroischen Mut und berichtete davon, wie ich gegen die katholische Kirche aufbegehrt und daraufhin Flucht und Repressalien auf mich genommen hatte. Für die Expedition strich er explizit meine Nützlichkeit als Seelsorger heraus, der auch dazu berufen sei, die Letzte Ölung zu spenden. Ich geriet in Verlegenheit und war zu erschöpft, sie zu verbergen. Lobhudelei war mir seit jeher suspekt, aber in diesem Fall war mir völlig schleierhaft, wie ich seinen Vortrag einzuordnen hatte. Gerade noch wurde ich von seinen Leuten einem gehässigen Verhör unterzogen, nun kürte er mich vor ihnen zum Heiligen. Oliver bat mich, ein paar Worte an die Gruppe zu richten. Mir wurde heiß und kalt zugleich, die Adern pochten mir unter der Haut. Dabei hatte ich mich auf meine Vorstellungsrede vorbereitet. Ich wollte über die unausrottbare Sehnsucht nach Freiheit sprechen sowie über die Tugend der Zuversicht, die für solche Expeditionen unabdingbar sei – gleichwohl, es half nichts. Ich brachte kein Wort davon über die Lippen. Außerdem wusste ich nach wie vor nicht, wohin die Reise gehen sollte, vom Zweck ganz zu schweigen. Ich stand also auf und sagte mit gesenktem Blick: «Ich werde mich stets bemühen, euch ein vertrauensvoller Seelsorger zu sein. Und ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen.» Ich setzte mich wieder, mit dem kläglichen Bewusstsein im Nacken, versagt zu haben, doch Oliver klatschte in die Hände und sagte so etwas wie «Wunderbar, vielen Dank, John!».
Nach dem Essen – es gab das gleiche wie zur Mittagszeit – erteilte Oliver seinem bärtigen Begleiter das Wort. Er war Franzose und hieß Lucien Bodard. Die anderen kannten ihn bereits, allerdings nicht sonderlich gut, wie ich manchen Äußerungen entnahm. Bodard saß ebenfalls in einem grün gepolsterten, aber etwas kleineren Sessel als Oliver. Seinen mürrischen Gesichtsausdruck hatte er nicht abgelegt, wie ein zusammengeknautschtes Laubblatt kauerte er auf seinem Platz und nickte einmal in die Runde, er gab sich insgesamt wenig Mühe, Anklang zu finden. Rickover hatte mir während der Mahlzeit erzählt, dass Bodard mit den Gegebenheiten westlich des Mississippi bestens vertraut sei, er sei ein unabhängiger Fallensteller, der bereits mehrmals in den Rocky Mountains gejagt habe.
Bodard ließ sich von Sidney eine Landkarte aushändigen, die er auf dem Tisch ausrollte. Die meisten hier, begann er, würden die Route bereits kennen, aber da wir heute zum ersten Mal vollzählig seien, wolle er allen noch mal den Plan erläutern. Lucien Bodard war unser Expeditionsleiter. Mir kam er von Anfang an vor wie einer, der wusste, wie man aus jeder Lebenslage unbeschadet davonkam.
Sein linker Daumen hing im Knopfloch seiner Weste, mit dem Zeigefinger seiner Rechten deutete er auf verschiedene Markierungen auf der ansonsten weitgehend unbeschriebenen Karte und gab dazu spärliche Kommentierungen ab. Alles in allem würde die Wegstrecke von New York aus rund eintausendsiebenhundert Meilen betragen. Bodard zeigte auf verstreute Handelsposten bis hinauf zum oberen Missouri, er verwies auf Siedlungen sowie auf einige Missionsstationen. Plötzlich hob er den Kopf und funkelte mich an.
«Pfarrer John, sollten Ihnen irgendwann die Kräfte versagen, laden wir Sie einfach auf einer Mission ab und sammeln Sie auf dem Rückweg wieder ein.» Halbherzig lächelte ich zurück, von den anderen äußerte niemand etwas, sie blickten erwartungsvoll zu Oliver, der aber so tat, als hätte er nichts gehört. Dann machte Bodard auf wichtige Streckenabschnitte aufmerksam. «In dem Bereich setzen wir über den Mississippi, und ungefähr hier wollen wir den Missouri überqueren.»
Zwischen den beiden Strömen erstrecke sich ein endloses Grasmeer voller riesiger Bisonherden. Er schwenkte seinen Finger weiter nach links. «Da ist der Gebirgszug, die Black Hills, den die Lakota Pahá Sápa nennen. Doch wirklich interessant wird es hier», sagte er nun mit einer verschwörerischen Note in der Stimme und kreiste mehrmals um einen kleinen Punkt, bevor er den Finger darauf absetzte.
«Hier ungefähr ist der Eingang zur Unterwelt. In dieser Gegend der Black Hills befindet sich das verborgene Tal, wo das Incognitum lebt.» Bodard richtete sich auf und wischte sich mit der Hand über den Mund. «Entweder wir finden den Höhleneingang selbst, oder die Lakota werden uns helfen, mit denen kann man gut kooperieren.»
«Aber wir haben nicht die Spur einer Chance gegen die und keine Garantie, dass sie uns nicht abmurksen.»
Die lallende Einlassung kam von Kermit, der sich dabei aufplusterte und leicht nach vorne kippte. Oliver schnappte nach Luft, Blut schoss ihm in den Kopf.
«Ich habe euch schon tausendmal gesagt: Wer dort draußen den Indianern friedlich begegnet, der muss nicht um sein Leben fürchten!»
«Genauso ist es», pflichtete ihm Bodard bei, «die Lakota sind zwar mächtig, wenn man ihnen aber Respekt entgegenbringt, wird uns nichts passieren.»
Bodard rollte die Karte wieder ein, während ich mich ernsthaft fragte, ob ich die Worte «Unterwelt» und «Incognitum» richtig vernommen hatte. Ich wagte aber keine Nachfrage, da ich mich nicht blamieren wollte. Für die anderen schien das Genannte jedenfalls nichts Ungewöhnliches zu sein. Auf einmal wurde ich von Kermit angerempelt, er hob schlaff die Hand und torkelte weiter zu seinem Stuhl. Jetzt kam er mir doch vor wie ein tumber Tunichtgut, wie jemand, dem das Leben arg mitgespielt hatte und der nun danach trachtete, das Erlittene dem Erstbesten heimzuzahlen. Rickover stand neben mir, und als hätte er meine Gedanken gelesen, meinte er, ich müsse nachsichtig sein mit den jungen Burschen. In einer Woche ginge es ins Ungewisse, da wollten sie jetzt noch einmal den Branntwein und die Sinnesfreuden auskosten, das sei normal, ein Geistlicher könne das wahrscheinlich nicht nachvollziehen.
«Doch, doch», wiegelte ich ab, nichts Menschliches sei mir fremd. Rickovers Umschwung ins Verträgliche war mir nicht ganz geheuer, gehörte er doch vorhin zu meinen drei Inquisitoren. Gleichwohl war er der Einzige aus der Gruppe, der sich überhaupt mit mir unterhielt.
«Was steckt eigentlich hinter diesem Incognitum, was suchen wir da?»
Halb belustigt, halb fassungslos sah mich Rickover an, kratzte sich am Hinterkopf und machte eine gedankenvolle Pause. «Das wissen Sie wirklich nicht … Das Beste wird wohl sein, Sie fragen den Captain selbst.»
«Mr Hancock wollte es mir nach meiner Ankunft mitteilen, aber er hat es wahrscheinlich vergessen …»
Rickover nickte leidlich. «Wahrscheinlich», sagte er tonlos, «so wird es sein.»
Dann bat Oliver noch einmal um unsere Aufmerksamkeit, er wirkte nun herrischer und kein bisschen mehr jovial wie noch vor dem Essen. «Die meisten wissen es, aber damit es keine Missverständnisse gibt, habe ich einen Strafkatalog verfasst, der sich nach den Regeln der Armee richtet.»
Er begann mit der Aufzählung der Vergehen, zu denen Dinge gehörten wie: aufrührerisches Reden, Diebstahl oder Befehlsverweigerung. Die Bestrafung erfolge durch Peitschenhiebe, die Sidney ausführen werde.
«Die wichtigste Regel muss ich euch eigentlich nicht sagen, weil sie wirklich jeder kennt, trotzdem noch einmal für alle: Die Expedition ohne meine Zustimmung zu verlassen, ist nur möglich mit den Füßen voran oder mit den Beinen in der Luft.» Daraufhin johlten manche mit kehliger Stimme, andere stießen spitze Töne aus.
«Was meint er damit, was heißt das?», flüsterte ich meinem Nebenmann zu, in Erwartung, Rickover würde mir antworten. Dann erst drehte ich mich zur Seite und gewahrte statt seiner Bodard. Er bemerkte meine Irritation, sagte aber nur trocken: «Hinrichtung, entweder durch Erschießen oder durch den Strang. Die meisten von denen waren beim Militär, für die ist das nichts Neues.»
«Für mich auch nicht, ich war im Kloster», entgegnete ich ihm ebenso trocken. Bodard zog seine Mundwinkel in die Breite, seine Augen blitzten.
«Im Übrigen wollte ich mich bei Ihnen entschuldigen für die unnötige Spitze von vorhin, die Sache mit der Mission …»
«Welche Spitze?», erwiderte ich mit gespielter Arglosigkeit, «ich kann mich an nichts erinnern.»
Er drückte mir die Hand und dankte es mir mit einem achtungsvollen Blick. Ich registrierte, dass uns Oliver beobachtete. Wenig später teilte er mir mit, dass er mich am übernächsten Tag für eine lange Unterredung auf seinen Landsitz erwarte. Danach ging ich schlafen, und so endete mein erster Tag in Amerika.
2. Behemoth
Ich war froh über den Ausflug aufs Land, nicht zuletzt, weil Mrs Hunter von akuten Fällen von Typhus in der Nähe der Unterkunft berichtet hatte, was mich doch etwas beunruhigte.
Sidney kutschierte mich in aller Frühe zu Olivers Landsitz nach Greenburgh, einem Dorf, gut zwanzig Meilen nördlich von New York, in einem Seitental am Ufer des Hudson gelegen. Kurz hinter der Stadtgrenze erstreckten sich weite Ackerflächen, die teilweise von schmelzenden Schneetupfern bedeckt waren. Noch zeigte sich kein grüner Halm zwischen den glitschigen Erdkrumen, nur ein paar Maisstrünke vom Vorjahr waren hie und da liegen geblieben. Noch nie vorher hatte ich so viel weite Flächen ohne jegliche Bebauung gesehen. Am Himmel entdeckte ich einen Schwarm Möwen, der unsere Kutsche begleitete. Wie durch unsichtbare Fäden verbunden hielten die Vögel einen gleichmäßigen Abstand zueinander, wobei ihre Formation einem riesigen Gabelkreuz glich. Ich grübelte eine Weile, welche Bedeutung ihm die kirchliche Heraldik beimaß, konnte mich aber nicht mehr daran erinnern. Das Interesse der Möwen an uns währte nur kurz, sie landeten am Ufer des Hudson River, während wir den Strom entlang weiter nach Norden fuhren in ein Gebiet namens Tappan Zee. Nach dem gestrigen Regentag floss der Hudson so schnell wie ein bergab rumpelnder Karren. Der Wind blies trocken und strömte kalt durch die Ritzen. Ich begann zu frösteln, als wäre ich wieder auf der «Aurora».
Vor meinem inneren Auge schien das miterlebte Elend der Überfahrt auf. Ein wahrlich wesensechtes Elend, denn das Wort bedeutet im Deutschen ursprünglich die Fremde. Die von Seekrankheiten, von Verstopfungen, Scharbock und dergleichen Gepeinigten starrten mich erneut an. Ihre Beschwerden rührten von alten und äußerst scharf gesalzenen Speisen, auch von unreinem Wasser, wodurch einige jämmerlich verendeten. Deren Leichen wurden unter Wehklagen ihrer Angehörigen ins Meer versenkt. Manch andere fluchten unentwegt oder wünschten sich wieder nach Hause zurück. Welch Wunder eigentlich, dass ich die Überfahrt unbeschadet überstanden hatte. Erst jetzt, nach zwei Tagen an Land, kam mir dieser Gedanke, und ich fing an zu beten. Formeln des Dankes und der Demut, die ich bedächtig, nahezu vorsichtig murmelte, als würde mir sonst Flüssigkeit von den Lippen tropfen und meine Kleidung nässen.
Als ich die Augen wieder öffnete, sah ich die ersten Amerikaner außerhalb von New York. Auf den Feldern standen viele Männer in gebeugter Haltung und traktierten die Erde mit Spaten, Rechen und Eggen, um den feuchten, teils schlammigen Grund auf die Aussaat vorzubereiten.
Oliver hatte die Residenz erst voriges Jahr umbauen und erweitern lassen, hauptsächlich während seines letzten Europaaufenthalts, wie mir Mrs Hunter am Vorabend auseinandersetzte. Zu dieser Zeit hatte ich Oliver kennengelernt. Natürlich war mir damals bewusst gewesen, dass er begütert sein musste, über das Ausmaß seines Reichtums hatte ich mir allerdings keine Vorstellungen gemacht. Olivers Familie, so Mrs Hunter, gehöre zu den einflussreichsten Latifundienbesitzern im Staat New York. Sie hätten schon lange vor der Unabhängigkeit etliche Parzellen ihrer Ländereien an Farmer verpachtet. Die Hancocks, erzählte sie mir, kamen aus dem katholisch dominierten englischen York, der nördlichsten Stadt des einstigen Römischen Reichs, und siedelten sich im siebzehnten Jahrhundert in New York an, nachdem die Engländer den Holländern die Macht entrissen hatten. In Amerika konvertierten sie in zweiter Generation zum Protestantismus, obwohl sie ursprünglich davor geflohen waren. Auf meine Frage, wie sich die Familie vor gut hundert Jahren so viel Land aneignen konnte, wusste Mrs Hunter keine Auskunft zu geben, sie reagierte darauf, als haftete meinem Interesse etwas Unbotmäßiges an. Stattdessen hob sie hervor, dass das Erdreich im Hudsontal leicht und lehmig sei, ideal für Getreide aller Art. Inzwischen kontrollierten Oliver und sein älterer Bruder Andrew über zwanzig Meilen Land. Die beiden gehörten zu derjenigen Elite, die gebildet und belesen war und die sich beständig mit den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen vertraut machte. Ich wusste bereits, dass Oliver Mitglied einer Freimaurerloge war und einen Abschluss von der Yale Universität hatte, nun erfuhr ich auch, dass er sich neuerdings an der Entwicklung einer Baumwollentkörnungsmaschine beteiligte und Sozius einer Waffenschmiede war, zudem wies er offenbar enorme ökonomische Kenntnisse auf, was ihn dafür prädestinierte, erfolgreich an der New Yorker Stock Exchange zu handeln. Für eine unbestimmte Zeit ging er nun in Vakanz. Die laufenden Geschäfte würde er seinem Bruder überantworten, der Anwalt war und eine politische Karriere in der Föderalistischen Partei anstrebte. All dies erzählte mir Mrs Hunter voller Stolz. Es war der Stolz einer Frau, die sich als verlängerter Arm eines bedeutenden Mannes sah und sich als seine Pächterin im Anspruch besonderer Privilegien wähnte. Welchen Zweck die Expedition hatte, konnte oder wollte sie mir jedoch nicht mitteilen. Auch hier vermittelte sie mir den Eindruck, die Frage danach sei unangebracht.
Der Erfolg war Oliver offenbar auf ganzer Linie beschieden. Meine bisherigen Erfahrungen mit ihm ließen auch kaum einen anderen Schluss zu. Bereits nach unserer ersten Begegnung schien mir, dass er nie das naheliegende Machbare, sondern stets das fernliegende Utopische verwirklichen wollte. Derlei Pioniercharakter war mir selbst nicht in die Wiege gelegt worden. Erzogen im Geiste deutscher Untertänigkeit, wurde ich gänzlich anders in die Welt gepflanzt. Im Schatten der Observanz war man in Duldungsstarre gehalten und von Schuldgefühlen durchsetzt. Oliver dagegen hatte Ansehen und Zuspruch offenbar mit der Muttermilch aufgesogen.
Ich wollte gerade in mein Schlafzimmer gehen, da wandte sich mir Mrs Hunter mit vertraulicher Miene zu. Sie legte ihre Hand auf meine und bat mich darum, für Mr Hancock beständig zu beten und ihm allzeit ein schützender Begleiter zu sein. Ich horchte auf und versicherte ihr, dass ich dies gerne tun werde, räumte allerdings ein, dass Oliver gegen die Fährnisse der Wildnis wohl besser gewappnet sei als ich selbst, und er sei, so mein Eindruck, alles andere als ein leichtsinniger Mann. Sie hielt kurz inne, ehe sie sich bedächtig räusperte. «Mr Hancock ist jemand, der immer wieder mit den Dämonen des Versagens zu kämpfen hat.» Sie fügte hinzu, sie wisse nicht genau, woran dies liege, aber vielleicht trage er gerade deshalb diese brennende Leidenschaft in sich. Ein verstocktes Lächeln huschte über ihre Lippen. Ich fragte, ob sie zumindest eine Vermutung habe, woher seine Dämonen rührten. Möglicherweise, sagte sie zögerlich, habe es damit zu tun, dass er als kleines Kind seine Mutter verloren hat. Diese sei eines Tages plötzlich unauffindbar gewesen. Gerüchte und Spekulationen gab es zuhauf, aufgeklärt habe sich ihr Verschwinden nie. Manche vermuteten einen Freitod, andere brachten einen Liebhaber ins Spiel, mit dem sie nach Südamerika durchgebrannt sei. Sie nahm mir das Versprechen ab, mit niemandem darüber zu sprechen.
Ich fand diese Wendung erstaunlich und war überrascht, dass ausgerechnet Oliver mit Dämonen zu kämpfen habe. Dabei erkannte ich damals schon an seiner Stimme, dass sämtliche Schwingungen in ihm wirkten, und insgeheim schwante mir, dass dies zu inneren Kollisionen führen könne.
Nach der Mittagsstunde erreichten wir unser Ziel. Der Wind zerstreute Olivers Begrüßungsrufe, und ich musste beim Aussteigen aus der Kutsche meinen Hut festhalten, um ihn nicht auf Nimmerwiedersehen zu verlieren. Jetzt bemerkte ich die ganze Pracht der zweigeschossigen Landvilla, insbesondere ihre vorgelagerten dorischen Säulen am Eingang, zwischen denen sich Oliver aufgebaut hatte und mich nun zu sich winkte. Eine Architektur mit unverkennbar antiken Anleihen. Die Villa stand aber nicht allein auf freier Flur, sondern war Teil einer Plantage, bestückt mit gemauerten Nutzungsgebäuden; dazu gehörte ein Milchhaus, ein Fachwerkstall und eine Scheune, außerdem gab es noch ein Quellhaus sowie eine große Mühle für Gerste, Weizen und Mais.
Mit dem parolenhaften Befund «Der Wind weht nach Westen» begrüßte er mich auf den Stufen vor dem Portikus und umarmte mich, was mich in Verwunderung versetzte, denn für gewöhnlich umarmten sich Männer nicht in meiner Heimat.
«Ein Zeichen, endlich aufzubrechen, meinst du nicht auch?»
«Wie könnte es anders sein?», pflichtete ich ihm bei, worauf er ein begeistertes Lachen ausstieß und mich abermals herzte. Nun bemerkte ich erneut, welch wohlgeratener Mann er doch war. Groß gewachsen und mit einem ebenmäßigen Antlitz, einer geraden Nase und hohen Wangenknochen. Bis auf die zwei Furchen zwischen den Nasenflügeln und den Mundwinkeln erschien das Aussehen dieses dreiunddreißigjährigen Junggesellen geradezu makellos.
Im Haus nahm mir ein Bediensteter sofort den Mantel ab, und Oliver führte mich die halbkreisförmige Treppe hoch, geradewegs in einen Salon, den er Unterhaltungsraum nannte und von denen es offenbar zwei in der Villa gab. Das Zimmer maß bestimmt sieben mal sieben Meter und war über drei Meter hoch. Der Plafond war schneeweiß gehalten, auf den Wandtapeten überwog ein hellgrüner Pastellton, aus dem dezent goldene Fäden hervorschimmerten. In einem hellen Winkel entdeckte ich eine auf einem Sockel stehende Marmorbüste. Ich nahm sie von Nahem in Augenschein, es war das Abbild eines Jünglings, sein Gesicht war vollkommen symmetrisch und mit hoher Kunstfertigkeit gearbeitet. Kurz fragte ich mich, ob sich Oliver selbst darin verewigt sehen wollte, denn manche Züge glichen den seinen.
«Das ist Antinoos», erklärte er.
«Der aus der Odyssee?»
«Nein, Gott bewahre. Dieser Antinoos war der Gefährte von Kaiser Hadrian.»
Ich hatte von dieser Gestalt noch nie gehört und machte ein beschämtes Gesicht.
«Keine Berühmtheit», lächelte Oliver. «Es ist leider kein Original aus der Römerzeit, sondern eine Nachbildung.»
«Und was hat es mit ihm auf sich?»
Oliver räusperte sich, wahrscheinlich hatte er nicht erwartet, dass sich jemand dafür interessierte. «Antinoos soll von einem Sterndeuter erfahren haben, dass durch seinen Freitod dem Kaiser die ihm noch verbleibende Lebensspanne zugeschlagen wird. Daraufhin soll er sich das Leben genommen haben, indem er sich in den Nil gestürzt hat.»
«Und, hat es sich eingelöst, ist der Kaiser alt geworden?»
«Ehrlich gesagt weiß ich das nicht. Hadrian war aber von der Aufopferung seines Freundes so überwältigt, dass er ihn zur Gottheit erklärt hat. – Mich fasziniert das. Wenn es doch nur mehr solch treues Personal gäbe», sagte er feixend, ehe er mich mit einer Handbewegung an eine ausladende Eichentafel bat. Auf der Tischplatte erstreckte sich eine Landschaft aus Büchern – manche aufgeschlagen, andere gestapelt –, Notizblättern, Skizzen und Landkarten. Oliver rieb sich die Hände, in seinen Mundwinkeln saß ein triumphales Lächeln.
«Nun, John, lass uns über das Wesentliche sprechen … So wie man früher nach dem Stein der Weisen gesucht hat, wollen wir nach dem Tier der Freiheit fahnden. All diese Aufzeichnungen bezeugen seine Existenz.» Als wollte er dem letzten Satz Nachdruck verleihen, schlug er auf eine alte Handschrift, worauf ein paar Staubkörner in die Luft wirbelten. Ich wusste nicht, ob er mich auf den Arm nehmen wollte und was all dies genau zu bedeuten hatte, daher fragte ich einfach: «Was meinst du damit?»
Seine tagblauen Augen weiteten sich, und er trat dicht neben mich. «Wir werden nächste Woche aufbrechen, um das Monster zu suchen, das American Incognitum.»
Draußen klarte es auf. Ein Bündel Sonnenstrahlen brach sich im Reliefglas der oberen Fensterreihe, fiel auf Olivers Haupt und verlieh seinem braunen Haar einen rötlich warmen Schimmer.
«All diese Schriftstücke habe ich in den letzten Jahren zusammengetragen, sie beweisen eindeutig, dass das größte Tier der Welt, eine Art amerikanisches Mammut, tief in den westlichen Wäldern existiert.» Ich machte wohl keine allzu beeindruckte Miene, denn Oliver schob mit dunkel raunender Stimme hinterher: «Wir haben die Mythen, wir haben Zeugen, und wir verfügen über Knochenfunde.» Er sah mich erwartungsvoll an, ich wusste allerdings nichts zu erwidern, in meinem Kopf schwirrten die Begriffe, ich vermochte vor allem nicht zu entschlüsseln, weshalb das Tier der Freiheit ein Monster sein sollte.
«Das ist interessant, sehr interessant», sagte ich schließlich verhalten, «aber was soll sich ein einfacher Pfarrer wie ich darunter vorstellen …»
«Du bist kein einfacher Pfarrer, sonst wärst du nicht hier. Sag mir lieber, was du denkst!»
Ohne meine Antwort abzuwarten, wandte sich Oliver von mir ab und ging zur Tür, wo ein Seilzipfel aus der Wand herauslugte, an dem er zwei-, dreimal zog. Dies setzte offenbar einen Mechanismus in Gang, denn es dauerte keine Minute, ehe uns ein junger Bursche eine Kanne Tee und Gebäck auf einem rollenden Tischlein servierte. Wir nahmen am anderen Ende des Zimmers auf zwei geflochtenen Sesseln Platz. Schweigend aßen wir eine Weile von den Keksen, wobei sich Oliver jedes Mal gleich zwei Stücke in den Mund stopfte.
«Du bist doch ein bibelkundiger Mensch, John», sagte er plötzlich schmatzend mit versöhnlicher Stimme. «Dann weißt du bestimmt auch, dass bei Hiob von Behemoth berichtet wird, dem Landungeheuer, als Gegenpart zu Leviathan, dem Seeungeheuer, so wie es auch bei Thomas Hobbes steht.»
Ich nickte vorgeblich wissend, in Wirklichkeit wusste ich nicht mehr genau, was es mit Behemoth im Alten Testament auf sich hatte, und Hobbes hatte ich nicht gelesen. Vielmehr kam mir die Apokalypse des Johannes in den Sinn, dessen 13. Kapitel. Und derlei Tierwesen, das wusste ich aus der griechischen Mythologie, stehen oft am Anfang mythischer Schöpfungen. Oliver war aber ohnehin nicht daran interessiert, mir seine Deutung der Verse darzulegen oder gemeinsam Bibelexegese zu betreiben. Die Sache an sich – nichts Geringeres als die Existenz des Monsters – schien unbestreitbar für ihn.
In vielen der großen Schriften aus der christlich-mosaischen Tradition, so erläuterte er mir, wie eben der Bibel, dem Talmud oder den Apokryphen wimmele es von chimärischen Bestien mit teils zwar unterschiedlichen Namen und Zuschreibungen, dennoch drehe es sich seiner Überzeugung nach bei den Landungeheuern unzweifelhaft um ein und dasselbe Tier, nämlich um das Mammut. Das American Incognitum, ebenfalls zu dieser Spezies zu zählen, sei hingegen noch größer; es handle sich um ein riesiges Raubtier, das Wildschweine und Hirsche zwischen seinen Fängen zu zermalmen vermöge. Weshalb das Ungeheuer nicht mehr in der Alten Welt existiere, habe einen ganz und gar plausiblen Grund: und zwar die Sintflut, das gewaltige Wasser nach dem endlosen Regen, dem nur Noah auf seiner Arche zu entkommen wusste, da Gott ihn gewarnt hatte.
«Noah galt den meisten als Spinner, sie haben ihn verhöhnt – bis eines Tages der Regen kam.» Er lachte beherzt. «Wie gern hätte ich ihre Gesichter gesehen. Noah hatte jedenfalls von jeder Tierart ein Paar. Nur die Mammuts, stell ich mir vor, waren viel zu groß für sein Schiff, er konnte sie nicht retten … Nun, ich weiß nicht, wie es wirklich war. Ich bin mir nur sicher, dass diese Viecher der Sintflut zum Opfer gefallen sind, die es bei uns, in der Neuen Welt, nicht gegeben hat. Und genau deswegen müssen sie hier sein!»
«Das verstehe ich wohl», begann ich ruhig, prompt fiel mir Oliver mit erhobenem Zeigefinger ins Wort.
«Und nicht nur die Schriften der Alten Welt bezeugen meine These, ich habe Kenntnis von Legenden, in denen von Ungeheuern die Rede ist. Vor allem aber kennen wir Lakota, die das Incognitum schon gesehen haben, und zwar in einem heiligen Gebiet, in einem abgeschiedenen Tal, das man nur über einen Höhleneingang erreichen kann. Denn die Bergkämme drum herum sind für Menschen unüberwindbar.»
Nun begriff ich, was Lucien Bodard zwei Tage vorher mit dem Eingang zur Unterwelt gemeint hatte. Es handelte sich also um einen Höhlengang, der durch oder unter ein Bergmassiv hindurchführt.
«Hat Bodard selbst die Tiere je gesehen? Ich frage nur, weil diese Ungeheuer doch sehr gefährlich sind, und der Franzose scheint mir die Gefahr recht gut einordnen zu können.»
«Ihre Gefährlichkeit ist in der Tat eine Herausforderung. Du kannst aber davon ausgehen, dass wir ausreichend bewaffnet sind, und meine Männer haben hervorragende Jagd- oder Gefechtserfahrungen.»
Damit wusste ich zwar Bescheid, wie man dem Biest begegnen wollte, meine eigentliche Frage hatte er aber nicht beantwortet, ob nämlich Bodard des Monstrums je ansichtig geworden sei. Mir schien es unratsam nachzufragen, denn die kleinste Skepsis, das spürte ich, konnte bei ihm die Schleuse zur Unausstehlichkeit öffnen.
«Mich würde noch interessieren, warum du die Tiere finden willst? Allein schon die Reise ist gepflastert mit vielen Gefahren …»
«Warum? Du willst wirklich wissen, warum?!», ereiferte er sich und schnellte aus seinem Sessel hoch. «Das Incognitum zu finden wäre eine Weltsensation, wir würden in die Geschichte eingehen! Wir hätten das größte Tier der Erde, das größte Tier an Land, das versteht doch jedes Kind!»
Wieder nickte ich verständig, während ich ihn diesmal mit einer Mischung aus Verblüffung und Erschrockenheit anglotzte. Es war ja nicht so, dass ich Olivers Faszination für das American Incognitum nicht nachvollziehen konnte, aber warum musste man es mit einer so kleinen Gruppe in über eintausendsiebenhundert Meilen Entfernung suchen, in einer Gegend, die kaum je ein Weißer zuvor betreten hatte? Wieso sollte ich dafür mein Leben aufs Spiel setzen? Und warum sollte ich als Geistlicher einem Ungeheuer nachjagen, das dort möglicherweise gar nicht existierte? Ich war nach Amerika gekommen, um an guten Entwicklungen mitzuwirken. Doch nun musste ich mich von einem weltlichen Waghals belehren lassen, Noah hätte auf seiner Arche keinen Platz für ein Mammut-Paar gehabt … Herrgott im Himmel!
Oliver hatte stets betont, dass zwischen Freimaurern und Illuminaten kein signifikanter Unterschied bestehe. Beide Bünde würden an vorderster Front der Aufklärung kämpfen mit lediglich unterschiedlichen Methoden und anderen inhaltlichen Ausrichtungen. Die Zielsetzung sei jedoch dieselbe. Ich selbst vermochte damals nicht und vermag immer noch nicht, dies zu beurteilen. Ich kann nur über den Orden der Illuminaten Zeugnis ablegen, wurde ich doch gleich zu Beginn meiner Universitätslaufbahn Mitglied des verbotenen Bundes. Dem Orden wurden zahlreiche Vergehen gegen die Obrigkeit vorgeworfen, dabei hatten wir zu meiner Zeit nie vor, etwas gegen den Staat, das Christentum oder gegen die guten Sitten zu unternehmen, es ging allein um die Erneuerung der Institutionen im Lichte der Aufklärung.
An dieser Stelle muss ich etwas ausholen. Der Begriff Illumination stammt eigentlich von Augustinus. Für ihn erreicht der Mensch das Wissen über die Essenz des Lebens durch die Erleuchtung des Verstandes. In einem solchen Moment der Erleuchtung, so der Kirchenvater, werde dem Verstand die Wahrheit offenbart. Illumination sei jedoch nicht zu verwechseln mit Ekstase oder Verzückung, sie ist im Grunde nur eine Steigerung der Reflexion, auf dass man die Wahrheit frei vom Gang der Gedanken erkenne. Alles, was in diesen Zustand führe, setze die Reinheit des Herzens voraus.
In den Minervalversammlungen der Ingolstädter Illuminaten begnügten wir uns vor allem damit, der Lust des Selbstdenkens nachzugeben. Ich erhielt den Ordensnamen Moses (Mose ist der «Mann des Wortes»), und mit vierundzwanzig wurde ich zum Illuminatus minor initiiert. Von da an verbrachte ich viele Abende im Zirkel wichtiger Mitglieder. Für mich war es auch der Zutritt in gehobene Kreise, wo man die behagliche Untätigkeit zu genießen wusste. Ausflüge nach München schlossen sich an, Abende im Schauspielhaus, Besuche in der Bildergalerie, und nicht unerheblich: Ich machte dort die Bekanntschaft mit anderen Illuminaten und deren Freunden, wie etwa mit Fabian Goller aus Zürich. Goller sollte mir ein paar Jahre später, als ich in Zürich für dessen Zeitung arbeitete, Oliver Hancock vorstellen. Der Verleger war Mitglied einer schweizerischen Freimaurerloge und hatte so Oliver kennengelernt, der wiederum einer New Yorker Loge angehörte.
Oliver eignete etwas Joviales, und er versprühte eine pionierhafte Begeisterung, für ihn schien es keine gedanklichen Grenzen zu geben. Allerdings wehte durch manche seiner Aussagen auch ein eisig deterministischer Hauch. Er hatte Gefühle und Innenleben zu einem menschlichen Defekt erklärt, was mich etwas stutzig machte, doch ging ich seinerzeit davon aus, er hätte dies nur im Scherz gesagt. Von bedeutender Relevanz für unsere Annäherung war eine Unterredung über die menschliche Natur mitsamt der Frage, was den Menschen gut oder böse werden ließe. Meine Einschätzung dazu lautete damals in etwa folgendermaßen: «Der Mensch ist nicht per se gut oder böse, klug oder dumm. Es sind oft nur die Umstände, die ihn zu dem einen oder dem anderen Verhalten geleiten. Nicht selten sind es dabei selbst verschuldete Umstände, auch bei jenen, die klaren Verstandes sind. Einer dieser selbst verschuldeten Umstände ist der Korpsgeist mancher Gruppen, die all ihre Mitglieder dazu treiben, sich selbst zu Konformisten zu machen, also lieber um der ungetrübten Stimmung wegen gemeinsam um das Goldene Kalb einer annehmlichen Lösung herumzutanzen, anstatt zu fragen, ob denn diese Lösung überhaupt die beste sei. Der Mangel an nicht konformen Ideen ist die Nahrung der Überheblichkeit. Die wiederum ist der Vater des fatalen Fehlers, und der wiederum ist die Mutter der Katastrophe.» Nachdem ich dies zu ihm gesagt hatte, fing er an, um mich zu werben, euphorisiert, einem Mann Gottes wie mir begegnet zu sein, der in der Lage war, wirklich kritisch zu denken.
Ich versicherte Oliver, dass es wahrlich eine Weltsensation wäre, das Incognitum zu finden, doch als Freimaurer, der er nun einmal sei, wüsste ich gerne von ihm, welch aufklärerischen Nutzen die Entdeckung habe.
«Auf welche Weise ist es uns denn für die gute Sache dienlich? Oder anders gefragt: Welchen Nutzen hätte es für die Demokratie und die Freiheit, wenn wir des Behemoths habhaft würden?»
Oliver blickte mich beifällig an. «Das ist eine sehr gute Frage. Genau für solch findige Gedanken habe ich dich geholt. Die Antwort ist nämlich unser Ziel.»
Ich fühlte, wie sich meine Stirnfalten kräuselten, denn ich hatte keine Ahnung, was er meinte. «Denk ruhig nach», sagte Oliver vergnügt, gleich darauf klatschte er in die Hände und eilte zielstrebig zur Tür. «Komm mit, ich muss dir was zeigen.»
Wir spazierten über das weitläufige Gehöft, wo ein reges Treiben herrschte. Von irgendwo drangen hämmernde und sägende Geräusche. Ein paar Kinder scheuchten eine Schar Ziegen, Holzknechte kamen gerade mit einem mit Brennholz beladenen Ochsenkarren an. Nahe der Mühle standen mehrere Wagen, auf die Arbeiter Säcke schichteten. Unter ihnen erblickte ich Kermit, der hin und her hastete wie ein Hirtenhund. Wie alle anderen hatte er ein graues Hemd an, aus einer dicken, groben Wolle gemacht. Schließlich sah er mich, worauf ich etwas zögerlich meine Hand zum Gruß hob. Aus seiner Körperhaltung wich die Anspannung, etwas Freundliches zeigte sich in seinem Gesicht. Das scheue Lächeln wich aber schnell von seinen Lippen. Er hielt sich ein Nasenloch zu und jagte aus dem anderen einen Rotzklumpen zu Boden, dann machte er sich weiter an die Arbeit. Die anderen beiden jungen Kerle, Steven Twitty und Tom Pueyo, entdeckte ich nun ebenfalls.
«Hoffentlich sind sie nächste Woche noch gut bei Kräften.»
«Die sind zäh, aber ab morgen haben sie frei, dann bleibt ihnen noch genug Zeit, sich auszuruhen.»
«Arbeiten alle, die mitkommen, für dich?»
«Nein, nein, nur die drei.»
«Und Sidney», ergänzte ich forsch.
Schlagartig fixierte mich Oliver mit strengem Blick. «Sidney arbeitet nicht für mich, er gehört mir.»
Ich öffnete den Mund zum Widerspruch, schloss ihn aber gleich wieder, ehe ich doch, um ein peinliches Schweigen zu umgehen, sagte, dass es mit mir trotzdem vier seien.
«Arbeitest du für mich … Wahrscheinlich könnte man das so nennen.» Er gab ein tonloses Lachen von sich.
«Aber was wäre, wenn ich mich weigerte mitzukommen?», fragte ich freiweg, angewandelt von einem seltsamen Aufbegehren.
«Hast du Angst?»
«Nein, mich interessiert einfach nur, was dann passieren würde?»
Oliver zeigte sich überrascht, blieb aber ruhig. «Nun, wir haben vereinbart, dass du mit deiner Teilnahme an der Expedition die Kosten für die Überfahrt abzahlst. Wenn du nicht mitkommst, bist du mein Schuldner, und ich könnte dich ins Gefängnis werfen lassen, allerdings kriege ich dann mein Geld nicht … Mit deiner Arbeitskraft ist es nicht weit her …» Er taxierte mich mit einem aufgesetzten mitleidigen Blick. «Du könntest vielleicht hier im Dorf im Schulhaus unterrichten und versuchen, den starrköpfigen Holländerkindern was beizubringen. Du solltest nur wissen, dass man ihnen Bildung einprügeln muss. Und die Bauern könntest du noch das Psalmensingen lehren, sie vergelten es dir mit Ackerrettich … Ich schätze, in zehn Jahren hättest du dann deine Schulden getilgt – vorausgesetzt, ich gestatte dir ein zinsloses Darlehen.»
«Oh, gut zu wissen», entgegnete ich scherzhaft, «die Gegend gefällt mir, ich will es mir überlegen.» Oliver tätschelte mir freundschaftlich den Hinterkopf, ehe er mir mit seiner Hand unter meinen Mantelkragen glitt und meinen Nacken umspannte. Ich spürte die Kühle auf der Haut, spürte den leichten Druck seiner Finger.
«John, bitte unterlasse solche Provokationen in Zukunft, das ist nicht gut.»
Auf einmal standen wir vor einer hohen Lehmziegelmauer, ein gutes Stück von der Farm entfernt. Hier war es ruhig und windstill, niemand war zu sehen, nur ein herrenloser Hund trank ein paar Meter entfernt aus einer Pfütze. Auf dem Grundstück hinter der Mauer befand sich ein fünfeckiges Steinhaus, es hatte ein Reetdach und musste aufgrund beachtlicher Ochsenaugen in den Giebelbereichen lichterfüllt sein. Man sah dem Gebäude seine Neuheit an, und mein erster Gedanke war, es würde Oliver wohl als eine Art Refugium dienen, als Nachdenkort für seine Pläne. An der Schwelle gab er mir die Anweisung, die Augen zu schließen, dann nahm er mich am Arm und führte mich ins Innere. Der Geruch von Nussöl und Lack stieg mir in die Nase. Erst ging es nach rechts, schließlich ein paar Stufen nach unten, und nachdem er mich in eine bestimmte Position gedreht hatte, befahl er mir, die Augen aufzumachen.
Der weiß getünchte Raum war ungewöhnlich hell. In seiner Mitte stand auf einem Podest ein gigantisches Skelett. Für einen Moment stockte mir der Atem. Das musste es also sein, das American Incognitum. Es hatte die Gestalt eines Elefanten, nur war es, meiner Einschätzung nach, vier- bis fünfmal größer. Ein signifikanter Unterschied bestand auch darin, dass seine Stoßzähne mit den Spitzen nach unten geschwungen waren. Sein Elfenbein funkelte an manchen Stellen. Das Knochengerüst wurde mit Eisenriemen und Stangen zusammengehalten, dies wirkte auf mich, als läge es in Ketten. Dadurch sah es einerseits tragisch aus, andererseits auch Furcht einflößend. Zwischen zwei Wimpernschlägen vermeinte ich sogar ein unterdrücktes Knurren zu hören. Umgeben von der Aura eines schlafenden, allzeitig zu erweckenden Riesen, kam es mir vor wie ein Kunstwerk aus der Antike der Natur, erhaben, wahrlich erhaben. Oliver machte einen Satz auf das Podest und stellte sich unter den wannenförmigen Brustkorb, der in Form und Umfang einem Ruderboot ähnelte. Er streckte seinen rechten Arm in die Höhe, kitzelte mit seinen Fingerspitzen am Brustbein. «Und schau dir nur mal die Kieferknochen an. Wenn das kein blutrünstiges Ungetüm ist!»
Ich stand da wie angewurzelt, geplättet von der schieren Größe des Tiers. Oliver kam wieder zu mir und trat nah heran, neigte seinen Kopf an mein Ohr.
«Aber», sagte er leise, fast anschmiegsam, «‹Mein Behemoth ist groß und doch sanftmütig, er unterdrückt seine Flamme, solange er nicht gereizt wird.›» Er setzte eine Pause, in der er tief Atem schöpfte, ehe er seinen lyrischen Vortrag fortsetzte:
«Sieh, mit welcher Kraft seine gehärteten Lenden umgürtet sind,
Rundherum undurchdringlich und aller Verwundung verschlossen.
Sein Schweif bewegt sich wie eine Bergzeder!
Und seine durchflochtenen Sehnen werden nimmer schlaff.
Hoch und weit gebaut, übertreffen seine starken Knochen
An Fertigkeit Stäbe von Stahl; seine Rippen sind Rippen von Erz;
Sein majestätischer Gang und seine gerüsteten Kiefern
Geben dem Wald und dem Berge Gesetz.»
Selbstversunken lauschte er den Worten nach. «Edward Young», sagte er schließlich, «aus einem Text über Hiob. Ein Geistlicher wie du. Vor über fünfundsiebzig Jahren verfasst. Göttlich, findest du nicht auch?» Ich nickte knapp. Immer noch stand ich reglos da, verstört wie ein ans Licht gezerrter Maulwurf.
Oliver schien meine Beklommenheit alles andere als zu missfallen.