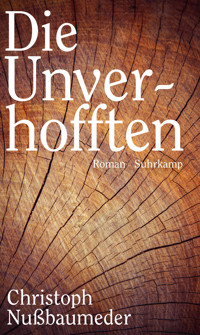
14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Jahrhundert, vier Generationen und eine unbeglichene Schuld
Spätsommer 1900, ein Dorf im Bayerischen Wald. Es brennt lichterloh. Aus Rache für ein ungesühnt gebliebenes Verbrechen hat die junge Maria die Glasfabrik in Brand gesteckt. In dieser Nacht nimmt die Geschichte einer Familie ihren Ausgang, in deren Zentrum der Aufstieg des unehelichen Georg Schatzschneiders zum Lenker eines Großkonzerns steht. Doch wo vordergründig unbändiger Ehrgeiz und unternehmerischer Instinkt zu den Erfolgsgaranten einer atemberaubenden Karriere im erst noch geteilten, dann wiedervereinigten Deutschland werden, begleicht im Hintergrund Generation um Generation dieser Familie eine große, aus einer Notlüge entstandene Schuld, die die Vorfahren Georgs auf sich geladen haben.
Der preisgekrönte Dramatiker Christoph Nußbaumeder erzählt eine packende Familiensaga über vier Generationen - ein Sozial- und Aufsteigerepos, das den ewigen Treibstoff der großen Menschheitsdramen anschaulich macht: Liebe, Verrat und das unstillbare Bedürfnis nach Anerkennung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 893
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Titel
Christoph Nußbaumeder
Die Unverhofften
Roman
Suhrkamp
Motto
Nichts hält uns zuliebe an.Blaise Pascal
Übersicht
Cover
Titel
Inhalt
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
Inhalt
Cover
Titel
Motto
Inhalt
I. Buch (1899-1900)
1 Die wechselhafte Realität
2 Ein Leben in Eisenstein
3 Die Hufnagel-Dynastie
4 Die Versammlung
5 Über den Wellen
6 Ein Grundsatzstreit
7 Gewalt
8 Zerstoßene Hoffnung
9 Die Hütte am Weißen Regen
10 Und gehe das Dorf darüber zugrunde
II. Buch (1945-1949)
1 Das Gefühl zu existieren
2 Corin
3 Ein Feuer mit zwei Gesichtern
4 Ankunft
5 Der blutjunge Frieden
6 Die Einnistung
7 Der Josefplan
8 Die Offenbarung
III. Buch (1964-1966)
1 Freie Hand
2 Über Juttas Tod hinaus
3 Das Gewicht der Luft
4 Zwischen Pflicht und Liebe
5 Ablösungen
6 Der Leichenschmaus
7 Auf der Burgruine
8 Schnee
9 Das Wohnheim
10 Der letzte Sommer
IV. Buch (1973-1975)
1 Zur Krone
2 Das Geständnis
3 Georgs Neuanfang
4 Schwestern
5 Josefs letzter Gang
6 Die Beerdigung
7 Jakob
8 Landshuter Hochzeit
9 Kalte Leugnung
10 Verschmähtes Erbe
V. Buch (1982-1984)
1 Hans
2 Ernas Tod
3 Wachstum
4 Grundrisse
5 Der Brief
6 Der Kauf
7 Das Buch Toskana
8 Das Sommerfest
9 Im wunderschönen Monat Mai
10 Verstiegene Träume
VI. Buch (1990-1994)
1 Sichere Heimat
2 Töchter
3 Albert
4 Zuflucht in Giesing
5 Der Nachklang des Fluchs
6 Das erste Treffen
7 Der verlorene Sohn
8 Spätfrost
VII. Buch (2009/2019/1900)
1 Ein Licht, das nie ausgeht
2 Vom Ursprung zum Ursprung
3 Die Unverhofften
Dank
Fußnoten
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
Nicht einmal die Erde selbst kann sich daran erinnern, wie vor ewigen Zeiten feiner Sand und Ton in ein Urmeer schwappten und sich dort absetzten. In der Tiefe des Schlunds herrschten gewaltige Temperaturen und gigantische Drücke, die das Gemisch in Gneis verwandelten, der schließlich nach weiteren Jahrmillionen als Felsmassiv herausgepresst wurde. Nach einigen Hebungs- und Abtragungsprozessen wurde der Gebirgsstock zum letzten Mal vor 65 Millionen Jahren emporgeschoben. Das Grobrelief der Berge war geboren. Wind und Wetter formten es beharrlich zu einem vollkommenen Gebirge. Und wo in der Erdkruste kleine Risse waren, schürfte das Wasser Schluchten ins Massiv. Diese waren für den Menschen lange Zeit unzugänglich, so entstand ein urwaldartiger, totholzreicher Bergmischwald. In ihm fanden viele Mythen und Legenden ihren Ursprung. Das raue Klima führte dazu, dass in den höheren Lagen Eiszeitrelikte überdauerten, obwohl die letzte Eiszeit vor 11 000 Jahren zu Ende gegangen war.
In diesem Gebiet, auf halber Strecke zwischen München und Prag, am Rand der Welt, liegt die Ortschaft Eisenstein. Dort, am Fuße des Großen Arber, überwiegen die Westwinde, der klirrende »Böhmwind« aber, der oft tagelang aus nordöstlicher Richtung ins Tal zieht, bestimmt die Witterung. Der Wind macht die Stängel der Gräser krautig bis zur Durchsichtigkeit, und der Winter dauert hier so lange, wie ein Mensch ausgetragen wird. Seinen Namen schuldet das Dorf dem Eisenabbau im Mittelalter. Doch nicht nur das Metall, vor allem die Glasfabrikation und die Forstwirtschaft bestimmten das Geschehen entlang der bayerisch-böhmischen Grenze.
Neben den großen Waldungen und Weidenschaften gab es Ende des 19. Jahrhunderts Talauen, Nasswiesen und großflächig verstreute Moostupfer. Zu Beginn des Frühjahrs schimmerten ausgedehnte Buchenbestände aus dem Dunkel der Fichten- und Tannenwälder rötlich braun hervor. Die Anbauflächen waren nicht sonderlich ertragreich. Mit dem Auffüllen der Wiesen und Äcker und mit dem Aufklauben eines jeden Steins sowie mit jedem ausgeworfenen Korn war die Hoffnung verknüpft, dieses Jahr möge ein besseres werden als all die vielen zuvor.
Die Mehrzahl der Menschen verpfändete ihre Kraft, ihren Schweiß und ihr Blut an ein paar Dienstherren, die man im selben Maß fürchtete wie verehrte. Um das Leid zu bändigen, glaubte man an den Allmächtigen samt seinen Helfern. Dennoch befiel die Menschen dieser Region von Zeit zu Zeit ein ausgreifender Zweifel, ob sie zum Leben zugelassen seien. Die Rückkehr in den Mutterschoß war hier eine besonders tief verschüttete Sehnsucht. Eine existentielle Verunsicherung, ob es so etwas Minderwertiges wie sie überhaupt geben dürfe, nagte an allen. Warum das so sein musste, wusste niemand. Nach außen hin aber protzten sie mit ihrer Kraft, sie waren stolz auf ihre baumausreißende Stärke. Vielleicht taten sie sich deshalb schwer, zu lieben. Jeder wusste, dass jedes Rinnsal in der Donau endete. Sonne und Wind, Kälte und Regen kamen aus Gottes Hand. Nur wo das Licht hinging, war es hell, und der Lauf der Zeit glich einem Walzer im Dreivierteltakt.
I. Buch
(1899-1900)
1 Die wechselhafte Realität
Maria sah auf und blinzelte in die Dunkelheit. Ein beißender Geruch hing in der Luft. Noch hatte sie das Dorf nicht verlassen, noch war sie nicht in Sicherheit. Sie zog die Kapuze tiefer ins Gesicht, jetzt begriff sie, dass sie eine Flüchtige war, die sich zwischen einem Nicht-mehr und einem Noch-nicht bewegte. Der Mond strahlte hell und klar, über dem Talkessel leuchteten die Sterne. Auf einmal schmetterte ein wütender Glockenschlag auf die Dächer und in die Gassen herab. Mit einem so frühen Alarm hatte sie nicht gerechnet. Schweißtropfen perlten ihr von der Stirn. Sie setzte ihren Gang fort, erst beim fünften Läuten zog sie das Tempo an. Nun ging auch das Sturmgeläut der Dachreiterglocken von den umliegenden Gehöften los. Einige Wachhunde schlugen an, bald darauf drangen Weckrufe, Warnschreie und Flüche aus den Häusern und schaukelten sich zu einer chaotischen Geräuschkulisse auf. Die Stimmung glich Marias Vorstellung vom Jüngsten Gericht, kurz bevor reitende Engelsscharen auf ihren Feuerpferden ins Dorf einfallen und mit Posaunen und Trompeten die Nacht ohne Morgen ankündigen. Nur war sie es jetzt, die man richten würde, sie war die Verfolgte. Ob Christus oder der Satan, beide würden ihr einen kurzen Prozess machen, genauso wie die Dörfler. Wenn sie dich erwischen, verreckst du im Zuchthaus. Der Gedanke begann sich eben in ihr auszubreiten, da sprang einige Meter vor ihr ein Hund aus dem Gebüsch und belferte sie an. Seine Ohren waren nach hinten gelegt, Geifer tropfte ihm aus dem Maul. Jemand musste ihn losgelassen haben. Doch bei genauerem Hinschauen erkannte sie das Tier, und das Tier erkannte sie. Gott sei Dank, der Nero. Behutsam ging sie auf den Gassenhuberhund zu, flüsterte mehrmals zärtlich seinen Namen, dann zwackte sie etwas von ihrer Wegzehrung ab – ein Stück Brot, das sie in einem Kartoffelsack zusammen mit einer Flasche Wasser mit sich trug – und warf es ihm vor die Pfoten. Mit einem Happs schluckte es das ausgemergelte Tier hinunter. »Und jetzt hau ab. Lauf zu deinem Herrchen, sei brav und beiß ihn tot.« Nero wedelte mit dem Schwanz und verschwand durchs Gebüsch.
Damit sie nicht Gefahr lief, von den Dörflern erkannt zu werden, die jetzt wie aufgeschreckte Ameisen aus ihren Behausungen stoben, entschied sie sich, die Straße zu meiden und über den Gassenhuber'schen Obstgarten das Weite zu suchen. Der Einstieg in das umzäunte Grundstück bereitete ihr keine Probleme, der Mond stand günstig, und sie konnte genau erkennen, wohin sie auf den eingepassten Blattverzierungen zwischen den Rankgittern treten musste. Sie schlich über das weitläufige Areal. Im Haus brannte Licht, sie sah die Umrisse der Gassenhuberin, die am Fenster vorbeihuschte. In Amerika werd ich auch ein schönes Haus haben. In Chicago schlagen die Uhren nämlich anders. Dort wird sich mein Fleiß auszahlen.
Seit sie von Amerika wusste, hatte sie begonnen, sich mehr Leben vorzustellen, mehr als sie wahrscheinlich leben konnte. Sie riss einen unzeitigen Apfel von einem Baum, biss hinein und spuckte die saure Masse in Richtung des Gassenhuber'schen Anwesens.
Als sie das andere Ende des Gartens erreichte, wurde die Nacht schlagartig schwarz. Eine Wolkenfront hatte sich vor den Mond geschoben. Maria tastete den schmiedeeisernen Zaun ab, da begann der Gassenhuberhund von Neuem mit seiner Salve, und eine Frauenstimme wies ihn an, den Garten abzusuchen. »Da ist jemand, fass, Nero!« Jetzt würde sie den Wachhund nicht mehr abwimmeln können. Schnell kletterte sie den Zaun hoch. Einen Fuß hatte sie bereits auf der letzten Querstrebe aufgesetzt, da kam auch schon der Schäferhundmischling angerannt. Gerade noch gelang es ihr, das zweite Bein nachzuziehen, so dass das aufgehetzte Tier gegen das Gitter sprang und ins Leere schnappte. Durch den Schreck verlor Maria das Gleichgewicht, sie rutschte ab und stürzte hinunter auf die andere Seite der Umzäunung, direkt auf den Rand des harten Steinfundaments. Ein stechender Schmerz durchzog sie vom rechten Schienbein an aufwärts, ihr Rücken schmerzte, und ihr Kopf tat weh. Schnell rappelte sie sich auf. Der Köter bellte wie ein Berserker und kratzte mit aller Vehemenz am Eisen. Sie griff nach dem Sack und bemerkte, dass die Flasche zu Bruch gegangen war. Geistesgegenwärtig nahm sie das Brot heraus, das nun feucht und klebrig war, und trennte ein sattes Stück davon ab. Sie knetete es zu einem Klumpen und barg ein paar kleine, scharfkantige Glasscherben darin. In all der Hektik schnitt sie sich beide Hände auf, dann warf sie dem Hund das mit Blut beschmierte Fressen hin. »In Gotts Namen, friss und halt dein Maul.« Nero schien nur darauf gewartet zu haben, er schnappte nach der Mahlzeit und war fortan ruhig.
Ohne sich umzublicken, rannte sie den holprigen Wiesenbuckel hinauf. Je steiler es wurde, desto lauter schnaufte sie. Aufgeputscht von Adrenalin und Angst lief sie in ein Birkenwäldchen, wo es so finster war, dass man die Hand vor Augen kaum sehen konnte. Durch diese gleichsam ägyptische Finsternis tastete sie sich weiter voran und geriet dabei in ein Meer aus Brombeerhecken. Stacheln verhakten sich in ihrem Rock und zerfetzten ihn bei jedem Schritt mehr. An Umkehr war nicht zu denken, zu weit war sie schon vorgedrungen. Mehrmals stolperte sie über die Ranken, die sich ihr zwischen die Füße, manche bis hoch ins Gesicht wanden und es zerkratzten. Jedes Aufrappeln kostete sie viel Kraft, und es war nicht abzusehen, wann die Quälerei ein Ende nehmen würde. Jetzt erst merkte sie, wie erschöpft sie war. Kalter Schweiß trat ihr auf die Stirn. Jeder Atemzug tat weh, jeder Schritt bereitete ihr höllische Schmerzen. Sie musste sich übergeben, versuchte, weder ihre Kleidung noch ihren Sack mit dem Erbrochenen zu beschmutzen, was ihr aber nicht gelang. Sie wusste nicht mehr genau, wo sie war. Ihr ursprünglicher Plan sah einen anderen Fluchtweg vor, jetzt hatte sie die Orientierung verloren. Tränen liefen ihr übers Gesicht, sie weinte lautlos wie ein Tier. Eine Auswanderin wollte sie werden, eine Davonläuferin war aus ihr geworden. Warum nur war sie so versessen darauf gewesen, die offene Rechnung mit dem Hufnagel zu begleichen? Vielleicht hatte der Pfarrer doch recht, wenn er sagte, nur Dulden und Ertragen führe auf Gottes Pfade. Maria sank entkräftet zu Boden. Durstig und durchnässt lag sie auf dem Rücken, ihre Verzweiflung wich der Übermüdung. Den Lärm aus dem Dorf vernahm sie nur noch als undeutliches Rauschen, das sich immer weiter von ihr entfernte. Ihr fielen die Augen zu. Ein paar aufgeschreckte Hasen raschelten im Unterholz. Ein Uhu kreiste über dem Wäldchen. Und ein Mensch von einundzwanzig Jahren lag reglos auf der Erde.
2 Ein Leben in Eisenstein
Der Postzug rauschte vorbei, das welke Friedhofsgras verneigte sich zum Abschied. Ein paar Tauben kreisten über dem Dach des Bahnhofsgebäudes. Nun erfasste auch Maria der Fahrtwind und wehte ihr ein paar Haarsträhnen ins Gesicht. Ihr Blick folgte dem Zug, der aus Eisenstein Richtung Westen abdampfte. Eben hatte sie wieder ein Schreiben von ihrem Cousin aus Amerika bekommen. Seit über einem Jahr war der schon drüben. »Durch Erwin und seine Frau hab ich eine Bestimmungsadresse. Und stell dir vor, es gibt sogar ein Waldler-Viertel in Chicago. Und reiten kann man über die ganze Prärie …« Die letzten Worte kamen Maria schwer über die Lippen, sie hatte nicht damit gerechnet, dass es sie so anrühren würde. Dennoch stand ihr Entschluss fest, im Frühjahr wollte sie nachziehen, was aber auch bedeutete, dass sie nicht mehr das Grab ihres Vaters würde besuchen können. Sie ließ ihren Tränen freien Lauf, es war niemand da, vor dem sie sich hätte genieren müssen.
Der Friedhof war schon ziemlich heruntergekommen. Die Hecken vis-à-vis vom Eingang verwildert, das schlichte Mauerwerk bröcklig, von Pflanzen aufgesprengt. Manche Totenbretter waren umgefallen oder waren umgetreten worden. Nach dem Fortgang der letzten Fremdarbeiter gab es niemanden mehr, der den Friedhof pflegte. Die Einheimischen hatten die Arbeiter nicht ausstehen können, sie nannten die angeheuerten Männer halb verächtlich, halb ängstlich »Baraber«. Und da der Magistrat den Fremdarbeitern keine Bestattung auf dem offiziellen Friedhof gestattet hatte, war ein Extrafriedhof angelegt worden. Ein Provisorium neben der Bahntrasse, das von allen nur »Italienerfriedhof« genannt wurde.
Maria legte eine rote Nelke nieder, dann betete sie das Vaterunser. Sie gab sich Mühe, jedes Wort bewusst zu sprechen. Danach blieb sie noch ein wenig und versuchte, sich alles genau einzuprägen; das Brett, auf dem einst der Leichnam ihres Vaters aufgebahrt worden war, die Verzierungen und Einkerbungen, das Giebeldreieck als Abschluss über dem gemalten Kreuz, die Inschrift darunter: Das was ihr seid / Das war ich einst / Und was ich bin / Werdet ihr noch sein. Weiter unten hatte ein Freund eingeritzt: Gleicher Lohn / Für gleiche Arbeit / Überall auf Erden. Ein anderer hatte am Fuß des Bretts etwas Englisches eingekerbt: Driving the Last Spike, In Memoriam Willi Raffeiner. Unzählige Male hatte sie hier schon gestanden und Gespräche mit dem toten Vater geführt. Sie küsste das rissige Holz, dann ging sie durch das quietschende Holzgatter nach Hause.
Meist reichten Vorschusszahlungen nicht zur Deckung der Löhne, Kostenvoranschläge waren falsch berechnet oder organisierte Streiks brachten die Bauunternehmer in arge Bedrängnis. Sämtliche Arbeiter, angeworben aus verschiedensten Landstrichen, ackerten wie die Ochsen. Ihr Leben war knochenhart, oft nur mit Schaufeln, Spitzhacken und Schubkarren ausgestattet, trieben sie die Stollen in den Berg. Mit ihren breitkrempigen Hüten, die je nach Wetterlage als Regen- oder Sonnenschutz dienten, waren die Bahnarbeiter schon von Weitem gut zu erkennen. Sie verströmten die Aura der Gesetzlosigkeit und brachten pionierhaftes Wildwestflair ins Waldgebiet. Wirtsstuben, Kegelbahnen und Spielhöllen schossen damals im Umfeld der Großbaustellen aus dem Boden. Marketenderinnen boten ihre Dienste feil, doch nicht nur die Fremdarbeiter vergnügten sich mit ihnen, manche Dörfler verprassten viel Geld zwischen den Schenkeln der Frauen und an den Tresen der Tavernen. Als einmal ein Bierbrauer ankündigte, den Preis für eine Maß Bier von achtundzwanzig auf zweiunddreißig Pfennige anzuheben, kam es zu Krawallen und Arbeitsniederlegungen. Dies alles geschah zum großen Leidwesen der Ortsgeistlichen, die ausschließlich die Fremdarbeiter für den Sittenverfall verantwortlich machten. Sonntäglich wetterten sie von der Kanzel gegen die »Saufbolde« und »Hurenmenscher«, die sich nach ihrem Ableben allesamt in der Hölle wiederfinden würden.
Selbst als die Arbeiter schon längst abgezogen waren und den für viele ersehnten Anschluss an die Welt hergestellt hatten, wurde noch immer abfällig über sie gesprochen, am lautesten von jenen, die den größten Reibach mit ihnen gemacht hatten.
Immer wieder ereigneten sich Unfälle auf den Baustellen, wie an jenem Tag, als eine Dynamit-Explosion drei Menschen zerfetzte. Einer davon war Marias Vater Willi. Sechs Jahre zuvor war er aus Kärnten nach Eisenstein aufgebrochen, wo er Arbeit als Tunnelbauer fand. Ein lebenslustiger Mann mit einem herzlichen Gemüt, aber auch einer, der sich schnell ereifern konnte, wenn er Unrecht witterte. Diplomatie war seine Sache nicht. Willi konnte sehr gut singen, in einem anderen Leben hätte er bestimmt das Zeug zu einem Operntenor gehabt, in seiner Zeit hingegen war er als Stimmungssänger in den Wirtshäusern sehr beliebt. Marias Mutter Emma schenkte damals beim Asenbauer aus, einer von drei Gastwirtschaften im Ort. Sie war jung und neugierig. Und sie war die Tochter vom Asenbauer Wirt. Schnell fanden die beiden zueinander, sehr zum Missfallen ihrer Familie. Doch die Liebe war stärker, und Emma heiratete Willi trotzdem. Zwei Kinder kamen zur Welt. Rückblickend war es eine entbehrungsreiche, aber keine schlechte Zeit, denn sie hatten eine Zukunft vor Augen, und die hieß Kärnten. Sobald die Arbeiten abgeschlossen wären, sah ihr Plan vor, würden sie dorthin gehen. Willi wollte sich den Traum einer Pferdezucht erfüllen, es schwebte ihm die Gründung einer landwirtschaftlichen Genossenschaft vor. Emma hätte ihn nach Kräften unterstützt. Beständig hatte er Geld zur Seite gelegt, an Optimismus herrschte kein Mangel. Drei Monate vor Fertigstellung der Bahnstrecke kam Willi ums Leben.
Maria hatte seine dunklen Augen geerbt, drum herum feine, mädchenhafte Gesichtszüge. Sie hatte dichte, dunkelblonde Haare, die rechts und links glatt vom Scheitel abfielen. Um ihren Mund lag meistens ein Lächeln, heute ganz besonders, auf irgendwas schien sie sich zu freuen.
Sie schlenderte die Anhöhe hoch, wo sie am Gassenhuber-Anwesen vorbeikam. Der Hofhund gebärdete sich wie ein Wahnsinniger, er fletschte die Zähne, die Kette spannte bis zum Anschlag, so dass er sich sein Gekeife fast selber abwürgte. Ein schwarzes Ungeheuer, mit etwas Grau abgesetzt, im Rücken höher und in der Brust schmaler als ein reinrassiger Schäferhund. Maria blieb stehen und schaute ihn an. »Was bist du nur für ein dummer Hund?«, sagte sie nachsichtig und nahm ein Stück trockenes Brot aus ihrer Rocktasche, das sie kurz anlutschte, bevor sie es ihm hinwarf. Der ließ sich nicht zweimal bitten und verschlang die kleine Mahlzeit hastig.
Sein eigentlicher Ernährer war der Großbauer Johann Gassenhuber. Zusammen mit dem Glasfabrikanten Siegmund Hufnagel, bei dem Maria inzwischen als Stubenmädchen und früher schon in der Fabrik beschäftigt war, zählte er zu den Granden in Eisenstein, zu denen auch der Zollamtsleiter, der Distriktarzt, der Oberförster, der Bahnamtsverwalter und einige Glasofenbauern gehörten. Allesamt Männer, die viel rauchten, tranken und meinten. Sie waren die Herren über die Arbeitsplätze, an ihnen kam kein Mensch vorbei.
»He! Du sollst ihm nix geben. Hab ich dir schon mal gesagt!«
Maria konnte die Stimme nicht gleich orten, dann aber bemerkte sie den Gassenhuber am rückwärtigen Scheunentor. Er musterte sie mit einem abschätzigen Blick, sein rechtes Bein war gegen das Tor gewinkelt. »Oder hast du so viel, dass du's verschenken musst?«
»Nein, das nicht, aber …«
»Ein vollgefressener Hund ist ein fauler Hund. So einen kann ich nicht brauchen.« Er ging ein paar Schritte auf sie zu, sein linkes Bein zog er leicht nach. »In der Bibel steht, die Sanftmütigen werden die Erde in Besitz nehmen. Was glaubst du?«
»Kann schon sein.«
»Ich glaub, das ist ein Druckfehler, sonst wär's schon längst passiert.«
»Vielleicht passiert's ja noch.«
»Das wäre aber ein grober Fehler. Weil wenn keiner durchgreift, gibt's ein Chaos, und hergelaufenes Gesindel nimmt überhand … Ich glaub, Gott sieht das genauso.« Sein Lachen gab für einen kurzen Moment zwei schiefe Zahnreihen frei, gleich darauf aber verfinsterte sich seine Miene. »Jetzt hau ab, wenn ich dich nochmal erwisch, lass ich den Nero von der Kette.«
Maria schaute noch einmal zum Hund, der sich in der Zwischenzeit hingelegt hatte und trübsinnig sein Fell leckte, dann stapfte sie davon.
Das Häuschen am Nordhang stand etwas schief, mit seiner verwitterten Fassade neigte es sich zum Weg hin. Im Wohnraum standen ein paar wurmstichige Möbel, ansonsten war er mit einem Kachelofen, Brennholz und einer Waschkommode ausgestattet. Wände und Decke waren teils rauchgeschwärzt. Im hinteren Teil führte eine Treppe zu den Schlafnischen unterm Dach, die durch dünne Holzwände voneinander abgetrennt waren. Ebenfalls im hinteren Bereich, nur auf der anderen Seite, ging eine Tür direkt in den Stall, wo sie eine Ziege und ein paar Hühner hielten. Hier hausten sie seit dem Tod des Vaters zu dritt.
Die Ellenbogen auf den Tisch gestützt, saßen Franz und Maria da und blickten aus dem Fenster zu den in ihre Schatten gehüllten Berge. Auf der Ofenplatte köchelte eine Suppe. Irgendwo draußen war eine Droschke zu hören, doch gleich darauf fing es an, zu regnen, und das Geräusch des Vehikels ging im gleichmäßigen Prasseln der Tropfen unter. Wetterumschwünge waren keine Seltenheit, und oft genug brachen sie von einem Moment auf den anderen über die Menschen herein. Knallende Blitze, berstende Bäume, herabfallende Äste. Bisweilen spuckte der Himmel Hagelkörner mit der Wucht von Schrotkugeln auf die Köpfe der Waldler. Und kurz darauf war wieder alles still und der Mond einfach nur groß und schön.
Maria stand auf und tappte über den festgetretenen Lehmboden zum Kachelofen, auf dem ein blecherner Topf stand. »Ich will nicht weg.« Franz' Stimme krächzte, wie es bei sechzehnjährigen Burschen manchmal der Fall ist. Maria rührte die Brotsuppe um. »Jetzt darf sie aber langsam kommen, sonst wird sie pritschnass.«
»Ich hab was gesagt.« Maria drehte sich kurz um. »Ich hab's gehört.« Dann wandte sie ihm wieder den Rücken zu. Auf dem Regal vor ihr standen vier Konserven, drei Tongefäße und ein handgezimmerter Mehlbehälter. Sie würzte die Suppe mit einer Prise Salz nach. Franz blähte seine Nasenflügel. »Wenn man wo ist, wo man nicht hingehört, geht man unter.«
»Aber wenn man wo ist, wo's einem nicht gutgeht, dann muss man gehen«, konterte Maria trocken.
»Nach Amerika fahren ist dumm!«
»Du spinnst. Willst du denn dein ganzes Leben lang Laufbursche sein!?«
»Wir haben alles.«
»Schau dich doch mal an!« Sein Hemd war zerschlissen, seine Hose mehrmals geflickt, seine Stiefel hatten Löcher. »Und jetzt hol Schnittlauch von draußen.«
Gerade wollte Franz widersprechen, da ging die Tür auf, und Emma trat ein. Sie grüßte einsilbig, dann nahm sie zwei Konserven aus ihrem Beutel und stellte sie auf den Tisch.
»Fast hätt's mich richtig erwischt.«
»Das Wetter oder die Aufsicht?« Maria funkelte ihre Mutter an. Draußen regnete es jetzt in Strömen. Emma setzte sich.
»Die Büchsen sind rechtmäßig. Die hat man uns geschenkt, zum Monatsend.«
»Maria will nach Amerika.«
»Das ist nix Neues.«
»Sie will, dass wir mitkommen.«
»Nachkommen«, präzisierte Maria, »ich möchte, dass ihr nachkommt. Hier wird kein Mensch froh.«
»Den Platz in der Fabrik, den werd ich aufgeben, so dumm werd ich sein.« Emma tippte sich mit dem Zeigefinger an die Stirn.
»In Amerika gibt's viel größere Fabriken, den Leuten geht's besser.«
Die kleine Konservenfabrik, in der Emma arbeitete, war erst vor ein paar Jahren gegründet worden. Dort verarbeitete man vor allem Himbeeren und Heidelbeeren. Für das Verschließen der Büchsen war ein Mann, den alle nur den »Maschinisten« nannten, zuständig, sieben Frauen waren mit Ausklauben, Säubern und Abfüllen beschäftigt. Emma hatte das Glück, eine von ihnen zu sein. Als Ausgegrenzte hatte sie selber nicht mehr daran geglaubt, eine feste Arbeit zu finden, aber der »Maschinist«, der auch die Einstellungen vornahm, hatte Mitleid mit ihr und den Kindern, die in seinen Augen nichts dafür konnten. Je nach Bedarf wurden die Arbeiterinnen auch zum Beerenpflücken eingeteilt. Dann hockten sie den ganzen Tag auf der Erde und gaben sich klaglos der beschwerlichen Tätigkeit hin. Die Sonne brannte ihnen auf den Kopf, und der Schweiß lockte Insekten an, die sie in die Haut bissen. In diesen dreizehn, vierzehn Stunden, von sechs Uhr morgens bis zum Abend, sahen die Frauen nur den Boden und grüne Sträucher. Wenn der Staub die Kehle ausdörrte, wurde der Geruch der Erde unerträglich. Ständig wollte man ausspucken, aber der Mund war zu trocken. An Plaudereien war auch nicht zu denken, man konnte es sich nicht leisten, die Kraft für Worte zu vergeuden, und so füllten sie schweigend ihre Körbe und dachten an nichts. Am Ende des Tages waren die Hände der Frauen entweder schwarz oder rot verfärbt, und in der Nacht, wenn die Knochen aufbegehrten, stöhnten sie leise auf, doch die Müdigkeit war so groß, dass sie trotz Schmerzen in einen kurzen, komatösen Schlaf sanken.
Schweigend löffelten die drei Suppe. »Arbeit hast, Mutter, ich auch und der Franz auch, aber wir sind trotzdem arm. Wir sind nur Dienstboten, sonst nix. Das muss einem doch zu denken geben.« Ein gedehnter Donner fuhrwerkte durch den Himmel. Das Gewitter war nun vollständig über die Berge gezogen. »Hör auf zu freveln, andere haben weniger. Uns geht es gut.« Emma streichelte Franz über den Kopf. So gut es ging, hatte sie immer versucht, ihre Kinder vor den Anfeindungen der Dörfler zu schützen. Die zwei wussten das. Deshalb hatten sie ihr so manches verschwiegen.
Als Emmas Mann mit der Idee nach Hause gekommen war, der Arbeiterbewegung beizutreten, hatte sie ihn nicht davon abgehalten, obwohl sie kein gutes Gefühl dabei hatte. Intuitiv misstraute sie den Heilsbringern, von denen Willi so begeistert war. Irgendwas, dachte sie, will jeder an einer Sache verdienen. Uneigennützigkeit gibt es nur in der Sonntagspredigt. Da war sie ganz Wirtstochter, sie kannte die Wirtschaft aus praktischer Erfahrung. Am Schluss zahlt immer einer die Rechnung. Irgendjemand würde auch im Sozialismus einen Profit machen wollen, auch wenn es hieß, niemand solle daran verdienen.
Eines Abends im Frühjahr, die Kinder waren schon im Bett, rüttelte es an der Haustür. Emma machte auf, Willi, auf den sie schon gewartet hatte, stand vor ihr, neben ihm ein Mann, den Willi halb stützte, halb trug. Er sah monströs aus, übel zugerichtet. Seine ganze linke Seite war verwundet, die Arbeitsmontur aufgerissen, Dreck und Blut hatten sich zu einer schwarzen Kruste vermischt. Der Geruch war abstoßend. Der Mann ächzte und stöhnte unter seinen Schmerzen. »Hol das Jod!«, wies Willi sie an, während er Alois auf das Kanapee packte, das sie damals noch besaßen. »In seiner Baracke hat er keine Versorgung. Und ein Doktor kommt erst morgen.« Sie wuschen ihn und gaben ihm neue Kleidung, danach nahm sich Emma die Wunden vor, betupfte sie mit Jod, und Willi flößte ihm warmes Bier ein, anschließend Schnaps, damit er einigermaßen schlafen konnte. Alois war ein Schienenverleger aus der Oberpfalz, ein neuer Arbeiter auf der Baustelle. Wie sich herausstellte, konnte er nicht lesen. Deswegen hatte er auch das Warnschild missachtet und war völlig ahnungslos in das Sprengungsgebiet der Tunnelbauer gelaufen. »Wie viele arme Deppen laufen denn sonst noch rum, die nicht lesen und schreiben können …« Emma hielt Willi an, ruhig zu sein, er würde sonst die Kinder aufwecken. Manchmal war ihr Mann überschäumend, nicht böse, aber vehement, und das Arsen, das er ab und zu von einem steirischen Rossknecht zugesteckt bekam und das er jetzt intus hatte, wühlte ihn noch mehr auf. In kleinen Dosen gab es einem Kraft, die Erdenschwere wurde etwas gelockert, und es verschaffte einem ein befreiendes Gefühl. »Ich bin jetzt aber nicht leise«, schimpfte er los, »ich bin zornig. Noch immer können so wenige lesen und rechnen. Und dann wundert man sich, wenn sowas passiert. Aber die Oberen wollen gar nicht, dass man wirklich was lernt. Und ich kann dir auch sagen warum, weil sich Dumme leichter regieren lassen, die kann man sauber gängeln mit dem Tatzenstecken der Angst!« Emma hörte gar nicht richtig hin, aber sie staunte nicht schlecht, als er plötzlich aufstand und die Treppe nach oben stapfte. Wenig später kam er mit der fünfjährigen Maria auf dem Arm zurück. Er trug sie zum Kanapee, dort weckte er sie auf. Mit schlaftrunkenen Augen schaute sich das Mädchen um, dann sah sie Alois, bekam Angst und fing an zu weinen. »Keine Angst, der tut dir nix. Schau ihn dir genau an«, flüsterte Willi ihr ins Ohr, »der Mann hat sich sehr weh getan. Und das ist nur passiert, weil er nicht lesen gelernt hat. Wenn du in die Schule kommst, versprich mir, dass du gut lernen wirst.« Hätte Emma ihr die Geschichte nicht Jahre danach erzählt, Maria wüsste nichts mehr davon. Sie konnte sich auch nicht erinnern, dass sie ja gesagt hatte, bevor sie wieder einschlief. Dann trug er sie wieder hoch in ihr Bettchen.
Zusammen mit einer Handvoll Gleichgesinnter wollte Willi bessere Arbeitsbedingungen, einen gerechteren Lohn und angemessene Sicherheitsmaßnahmen durchsetzen. Wahrscheinlich war genau das sein Todesurteil. Die genauen Umstände der Explosion wurden nie ergründet. Es gab keine externe Untersuchung, keine Gerichtsverhandlung, keine Entschädigung. Seine Mitstreiter gingen von einer gezielten Aktion aus. Vieles sprach dafür, nur konnte es niemand beweisen, und niemand erhob Anklage. Seither hasste Emma die Arbeiterbewegung. In ihren Augen wiegelte sie die Leute auf, scherte sich aber im Unglücksfall einen Dreck um die Hinterbliebenen. Jedoch war Emma nicht bewusst, dass Bismarcks »Sozialistengesetz« einen entscheidenden Anteil daran hatte, dass der Fall versandete. Zahlreiche Organisationen der Arbeiterbewegung wurden verboten oder gleich aufgelöst, wer nicht willens war, zu kuschen, wurde strafrechtlich verfolgt, so dass auch Willis Freunde befürchten mussten, ins Zuchthaus zu wandern, wenn sie mit Forderungen nach einer Untersuchung des Unfalls auffielen. Stattdessen liefen sie in sämtliche Himmelsrichtungen auseinander, auf dem Weg zu neuen Großbaustellen. Zurück blieb die im Stich gelassene, todunglückliche Witwe samt ihren Kindern.
Auch ohne das politische Engagement ihres Vaters wären die Kinder eines »Barabers« vielen Schikanen ausgesetzt gewesen. Vor allem von jenen Männern, die früher ein Auge auf Emma geworfen hatten. Sie zahlten ihr und seiner Brut die Zurückweisung mit doppelter Münze heim, selbst von ihrer Familie wurde sie verstoßen. Den wohlhabenden Bauernsohn Johann Gassenhuber hatte ihr Vater für sie vorgesehen, aber der war ein Depp, fand Emma, außerdem liebte sie ihren Willi. So einfach war das. Heute dachte sie anders darüber. Manchmal jedenfalls.
Emma hatte keinen Beruf erlernt, und wohin hätte sie auch gehen sollen, mittellos und an jeder Hand ein Kind? Also war sie in Eisenstein geblieben. Bevor sie in der Konservenfabrik anfangen konnte, musste sie manchmal sogar betteln gehen.
Doch trotz der Demütigungen verbitterte sie nicht. Ihre Kinder hatte sie kaum je geschlagen, auch wenn Maria sie mit ihrer Fragerei oftmals zur Weißglut trieb. Emmas Gefühl war darauf ausgerichtet, die Liebe zu geben, die gewollt hatte, dass es die beiden gab. Das unterschied sie von den anderen Müttern im Dorf, die, angehalten von ihren Männern, in ihren Kindern hauptsächlich eine Investition für die Zukunft sahen. Man erzog sie zu Arbeit und Gehorsam, man bläute ihnen ein, den Eltern von Geburt an etwas zu schulden. Emmas Liebe dagegen war bedingungslos.
Einmal allerdings hatte sie die Nerven verloren und der Tochter eine Ohrfeige verpasst, worauf das Kind weglief und einen halben Tag und eine ganze Nacht lang verschwunden blieb. Erst streunte Maria durch den Wald zum Kleinen Arbersee, wo sie vorhatte, sich zu ertränken. Aber es wollte ihr nicht gelingen. Immerzu zog sie den Kopf aus dem Wasser und schnappte nach Luft. Dann lief sie zum Pfarrhaus, um dem Pfarrer den Selbstmordversuch zu beichten. Das Haus war nicht abgeschlossen, also schlich sie hinein und lugte in jedes Zimmer. Im oberen Stockwerk hörte sie schließlich Gemurmel aus einer Kammer dringen. Durch einen Spalt sah sie den Pfarrer, der in dem abgedunkelten Raum neben einem Bett stand. Er hielt ein Kreuz in der Hand und sprach mit leiernder Stimme Gebete. Auf der Matratze lag eine Frau, die von zwei Männern an Armen und Beinen niedergedrückt wurde. Sie wimmerte, immer wieder spannte und verrenkte sich ihr Körper, als litte sie unter Krampfanfällen. Auf einmal stieß sie einen grellen Schrei aus. Maria verstand nicht, was da vor sich ging, sie bekam Angst und rannte davon. Über eine klapprige Leiter stieg sie in den Dachboden eines Nebengebäudes. Dort entdeckte sie eine eingestaubte Bücherkiste, die hinter einem wurmstichigen Schaukelstuhl stand. Maria begann, die Kiste zu durchstöbern und in den Büchern zu blättern. Eines weckte aufgrund des fremd klingenden Namens ihr Interesse, und so kam es, dass sie einen Band mit den Schriften von Voltaire zu lesen anfing. Um über den Schrecken hinwegzukommen, vertiefte sie sich immer mehr in das Buch. Sie las darin, bis es dunkel wurde, dann klappte sie es zu und schloss die Augen, während manche Sätze noch in ihr nachwirkten. Zwar hatte sie die meisten nicht verstanden, aber die Worte klangen geheimnisvoll, und einige brachten sie zum Nachdenken. »Es ist nicht erstaunlicher, zweimal geboren zu werden als einmal« war so einer. Andere leuchteten ihr sofort ein: »Tüchtigkeit, nicht Geburt, unterscheidet die Menschen.« In den kommenden Jahren sollte sie mehrmals erfahren, dass dieser Spruch gefährlich war, demzufolge, würde sie schließen, war er richtig. Beide Sätze aber begleiteten die Zwölfjährige fortan bis zu ihrem Tod. In unterschiedlichsten Lebenssituationen dachte sie mal an den einen, mal an den anderen. Stand der erste Satz für die wundersamen Dinge des Lebens, half ihr der zweite, sich gegen Unterdrückung aufzulehnen. Am nächsten Morgen, ganz früh, stieg sie auf leisen Sohlen wieder hinunter. Niemand hatte sie entdeckt. Zu Hause wurde sie von der Mutter in die Arme geschlossen, die keine Fragen stellte.
Nachdem sie nahezu schweigend gegessen hatten, räumte Emma das Geschirr ab. Die Blechteller schepperten beim Aufeinanderstapeln und Wegtragen. Sie war wütend auf ihre Tochter, rang sich aber schließlich dazu durch, das Gespräch wiederaufzunehmen. »Was Besseres wie beim Hufnagel«, sagte sie in versöhnlichem Ton, »wirst du da drüben nicht finden.«
»Der Erwin schreibt, dass drüben alles besser ist.«
»Was soll denn da besser sein?«
»Der Erwin war schon immer ein Angeber«, versetzte Franz. Darauf zog Maria den Briefumschlag aus ihrer Westentasche. »Hier – alles schwarz auf weiß. Soll ich vorlesen?«
»Nein!« Franz schnellte in die Höhe und warf seine Arme weit auseinander, setzte sich aber gleich wieder, erschrocken über die eigene Unbeherrschtheit. »Du brauchst uns nix vorlesen, wir können selber lesen«, schob er hinterher. »Such dir doch bei uns einen Mann, brauchst nicht so weit weggehen.« Gequält verdrehte Maria ihre Augen. »Mutter, mir geht's doch nicht um einen Mann! Mir geht's um mein Leben, und um euers.«
»Nächstes Jahr werd ich übrigens Knecht beim Hufnagel. Das hat er mir versprochen.« Franz' trotziger Einwurf fand keine Beachtung, ein angestrengtes Schweigen breitete sich aus, man konnte den Regen wieder prasseln hören. »Ich geh auch allein, ich brauch euch nicht!«
»Kind, red nicht so kopflos. Überleg's dir gut.«
»Es gibt nix zum Überlegen!«
Emma schloss die Augen und senkte den Kopf. »Du lasst dir einfach nichts sagen, das war schon immer so. Von klein auf.«
»Weil mein ganzes Leben vordiktiert ist, aber irgendwann langt's!«
»Lass uns in Ruh damit!«, knurrte Franz, als wüsste er bereits, dass er sein ganzes Leben als Knecht verbringen würde, bis es eines Tages verpulvert war.
3 Die Hufnagel-Dynastie
Über einige Generationen hinweg waren die Hüttenbesitzer die unumschränkten Herrscher im Waldgebiet, im sogenannten bayerischen Böhmerwald. Man nannte sie Glasfürsten, die ihre von allen Verkehrswegen abgeschnittenen, unerschöpflich scheinenden Wälder zu vergolden suchten. Darum bauten sie eifrig Glashütten, die mit Holzfeuerung betrieben wurden. Teilweise gaben sie auch, natürlich gegen entsprechende Bezahlung, anderen die Erlaubnis, auf ihrem Gebiet Hütten zu errichten. Diesen gewährten sie dann entweder Holznutzungsrechte, oder sie verkauften ihnen das nötige Holz. So konnte sich über Jahrhunderte hinweg die Hegemonie der Glasfürsten behaupten. Selbst nach der Etablierung der Nationalstaaten im 19. Jahrhundert änderte sich wenig an den bestehenden Strukturen. Denn der Staat hatte für seine Wälder keine bessere Verwendung, als durch die Bewilligung von Steuerfreiheit den Bau von Glashütten zu begünstigen. Und davon profitierten in erster Linie wieder die begüterten Glasfürsten, frei nach Matthäus 25,29: »Denn wer da hat, dem wird gegeben werden.«
Der Aufstieg der Hufnagels kam unorthodox zustande, man könnte ihn auch als märchenhaft bezeichnen. Ursprünglich war die Familie eine alteingesessene, weitverzweigte Handwerkersippe aus Deggendorf, die seit dem Spätmittelalter vorwiegend in Metzger- und Ledererberufen tätig war. Irgendwann aber, gegen Ende des 17. Jahrhunderts, brach der junge Lederergeselle Thomas Hufnagel zu seinen Wanderjahren auf. Am dritten Tag brachte ihn seine Route nach Zwiesel. Kaum angekommen, lernte er an einem Brunnen die Glasmachertochter Martha Haderer kennen. Von der weiten Welt hatte sie bisher kaum etwas mitbekommen, er nicht viel mehr. Im Grunde genommen nur das, was auf dem Weg zwischen Deggendorf und Zwiesel lag. Thomas hatte vor, nach Prag, danach nach Budapest zu wandern, um in beiden Städten sein Handwerk zu verfeinern. Dem Mädchen erzählte er, er würde geradewegs aus Ungarn kommen, er hätte jetzt genug von der Welt gesehen und wäre der Wanderschaft überdrüssig geworden. Nun würde er sich wieder nach der Heimat sehnen. Mit einer kapriziösen Bewegung führte er den Holzschöpflöffel zum Mund und nahm ein paar Schlucke Wasser, ohne dabei zu schlürfen. Es sollte vornehm aussehen, er wollte dem Mädchen imponieren, und er beabsichtigte, auszuprobieren, wie weltgewandt er bereits wirkte. Martha glaubte ihm zwar nicht, allerdings tat sie so, als würde sie sein Geschwafel für bare Münze nehmen, immerhin war er ein fescher Aufschneider, und er hatte sie neugierig gemacht. Wenig später verbrachte sie die Nacht mit ihm, neun Monate darauf brachte sie ihren unehelichen Sohn Georg zur Welt. Nach damaligem Brauch wurde das Kind unter dem Familiennamen seines Erzeugers, den Martha übrigens nie wieder zu Gesicht bekam, in das Zwieseler Taufbuch eingetragen. Als Georg zu einem Buben heranwuchs, erlernte er wie sein Großvater das Glasmacherhandwerk in der Eisensteiner Hütte des Grafen Nothaft. Der vielgehänselte Bastard war wissbegierig und geschickt, zudem verfügte er über eine schnelle Auffassungsgabe. Das entging auch dem Grafen nicht, der die Tüchtigkeit des Jungen förderte. So kam es, dass er in seiner Eigenschaft als kaiserlicher Hofpfalzgraf dem neunzehnjährigen Georg eine Legitimationsurkunde ausstellte, die ihn in den Stand der ehelich Geborenen versetzte. Von da an konnte er als Glasmacher freigesprochen werden. Ein paar Jahre später verpachtete ihm der Graf die Glashütte. Weitere zwölf Jahre später kaufte Georg dem Grafen, den eine Familienfehde in finanzielle Schwierigkeiten gebracht hatte, die riesigen Waldungen am Nordosthang des Arbers ab und begründete dort die »Eisensteiner Glashütte Hufnagel«. Kurz darauf erstand er die »Böhmische Hütte« in Hurkenthal. Dieser kraftvolle und tatkräftige Mann, der aber auch derb, rücksichtslos und schroff gewesen sein soll, war der Begründer einer der bedeutendsten Glasherrendynastien in Mitteleuropa. In ihrer Blütezeit bewirtschafteten Georg und seine Nachkommen über dreißig Glashütten in Böhmen, Mähren, Niederösterreich, Galizien und Kroatien. Als der alte Patriarch im Jahr 1770 starb, erzählte man sich von ihm, noch auf dem Totenbett sei er von unbändigem Stolz erfüllt gewesen, getragen vom Selbstbewusstsein des Emporkömmlings, der es zu Reichtum und Ansehen gebracht hatte. Es schien, als habe er seinen Stolz an alle folgenden Generationen vererbt, denn die Glasfürsten nach ihm sollten zu den selbstherrlichsten ringsherum gehören.
Der Waldboden unter den Hufen seines Pferdes war aufgeweicht und dennoch trittfest. Die tiefverwurzelten Urwaldtannen zogen im Morgenlicht an ihm vorbei. In seinen Augen spiegelten sich schimmernd die herbstlichen Farben der Bäume wider, und die klare Gebirgsluft strömte in seine Lungen. Wann immer er auf dem Familiengut in Eisenstein war, nahm Siegmund sich morgens Zeit, für mindestens eine Stunde auszureiten. Schon als Bub war ihm nichts lieber gewesen. Auf seinem Talerschimmel über die weiten Flure zu galoppieren, befreit von allen Pflichten und fern der lästigen Menschen, war für ihn das pure Glück. Allenfalls ein paar Kinder oder Greise am Wegesrand, die nahe einer Einschicht Laub und Äste sammelten, ansonsten nur unberührte Natur. Während des Ausritts brauchte er sich über nichts Gedanken zu machen. Über abgelegene Pfade ging es bergan und bergab. Wie im wahren Leben, dachte Siegmund, der mittlerweile in die Fußstapfen von Georg getreten war, oder vielmehr: getreten worden war.
Siegmund Hufnagel war der Ururenkel des Glasdynasten, ein gebildeter Unternehmer, sehr musikalisch, ein vorzüglicher Violinspieler und mit den Umgangsformen der Metropolen vertraut. Den Damen der gehobenen Gesellschaft trat er stets zuvorkommend und eloquent gegenüber. Für seine Bediensteten hatte er mitunter ein aufmunterndes Wort oder ein kleines Kompliment parat. Er konnte auch ausgesprochen lustig sein, doch mit der Zeit begriffen seine Untergebenen, dass seine Zusprüche wenig galten, vor allem, wenn es um Abmachungen oder Zahlungsmoral ging. Gute Stimmung konnte sich schnell in Übellaunigkeit verkehren, dazu bedurfte es nur eines winzigen Anlasses. Kam es darauf an, weitreichende Entscheidungen zu treffen, war er verzagt, bei Konflikten suchte er zwanghaft die Schuld bei anderen. Dinge auszusitzen war ihm ein Graus, ihm fehlte die Beharrlichkeit seiner Vorfahren. Haftete allen Hufnagels seit Georg eine klirrende Arroganz an, so kam bei Siegmund ein nicht unerhebliches Maß an Eitelkeit hinzu, stets wollte er gefallen und die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Sein Profilierungsdrang rührte wohl daher, dass sich seine Eltern nicht ausstehen konnten, weshalb seine Mutter all ihre Liebe und Zuwendung dem einzigen Sohn zuteilwerden ließ, während der Vater ihm wenig Wertschätzung entgegenbrachte. Nichts konnte Siegmund ihm recht machen, ständig wurde er von ihm gemaßregelt oder brüskiert. Man könnte sagen, über Siegmund wurde ein Stellvertreterkrieg ausgetragen. So wurde aus ihm ein undankbarer, leicht kränkbarer und ein selten in sich ruhender Mensch.
Siegmund zählte vierunddreißig Jahre, war schlank, großgewachsen und hatte ein symmetrisches Gesicht, aus dem volle Backen und kastanienbraune Koteletten hervorstachen. Zu sämtlichen Anlässen trug er maßgeschneiderte Garderobe und parlierte am liebsten mit Persönlichkeiten aus der Großindustrie oder aus Regierungskreisen. Dann sprach er staatstragend über sein Lieblingskind, den Fremdenverkehr, den er ausbauen wollte und zu revolutionieren beabsichtigte. Dann hielt er Vorträge über das harmonische Verhältnis von Mensch und Natur, über die Notwendigkeit von Erholung in inspirierender Umgebung. Siegmund hatte sich in die Vorstellung vernarrt, ein galanter Hotelier zu werden, ihm schwebte ein Ort vor, wo er gleich einer Sonne im Mittelpunkt stände, während kultivierte Weltbürger als Gestirne um ihn kreisten. Natürlich saß er auch oft mit den wichtigen Leuten aus Eisenstein zusammen, das tat er aber nur, um sich mit ihnen zu arrangieren und einen guten Draht zu halten. Für seine Fremdenverkehrspläne waren sie unabdingbar. Zudem lautete ein alter Familienleitspruch: »Verschmähe keinen, vielleicht brauchst du ihn in der Not.« Da war in der Tat was dran. In Wirklichkeit jedoch war ihm die Eisensteiner Oberschicht zu einfältig und viel zu provinziell.
Auf ein kurzes »Brr« blieb der schweißtriefende Schimmel im Hof stehen. Vor dem Haus waren die Wege zwischen den Blumenbeeten frisch gesandet, Ziersträucher und Hecken befanden sich in gepflegtem Zustand. Siegmund stieg ab, gleich darauf kamen zwei Knechte und nahmen das Pferd entgegen. Am Eingang der Gesindestube stand sein Laufbursche, der spindeldürre Raffeiner Franz, und wackelte mit dem Oberkörper nervös hin und her. Siegmund hatte ihn schon erwartet, er hatte ihn angehalten, am Vorabend zu einer Versammlung ins Wirtshaus Asenbauer zu gehen. Aus verlässlicher Quelle hatte er erfahren, dass seine Glasarbeiter etwas im Schilde führten. Um kein Aufsehen zu erregen, beorderte Siegmund den Jungen in den Hausflur, wo der sogleich lossprudelte. »Eine Gruppe wollen sie bilden, wo alle Fabrikarbeiter mitmachen sollen.«
»Ruhig«, sagte Siegmund, »eins nach dem anderen. Wer will was machen?«
Franz nickte gelehrig, dann atmete er tief durch. »Alle haben sie geschrien und durcheinandererzählt und gesagt, dass das mit der Arbeitszeit und mit dem Lohn, dass das eine Schweinerei ist, eine elendige.« Das überraschte Siegmund wenig. Dankbarkeit oder zumindest gebührenden Respekt konnte er von seinen Angestellten schon lange nicht mehr erwarten. Sie hatten längst vergessen, so seine Sicht auf die Dinge, welche Hand sie fütterte, wer ihnen eigentlich die Butter aufs Brot strich. Ihr Benehmen stieß ihn ab, er verachtete sie, für ihn waren alle Arbeiter Glasmännlein oder Hirnzwerge. Ihre ausgeworfenen Sprachbrocken, ihre bäurisch teigigen Gesichter, stiernackige Männer, dumpfe Weiber, beide Geschlechter meist unterwürfig und aus verschlagenen Augen lugend. Vor allem die Glasbläser, von deren Geschick seine Fabrik abhängig war, hasste er. Leider war er dazu verdammt, sich gut mit ihnen zu stellen, aber am liebsten hätte er gleich alle aus seinem Revier verbannt und stattdessen die große Welt ins kleine Eisenstein geholt, allein ihm fehlte das nötige Geld dazu. Für die Glasmacherei zeigte Siegmund kein besonderes Interesse. Das Herstellungsverfahren, seine Optimierung und alles, was das Gewerbe ausmachte, begeisterten ihn nicht. Er brannte einfach nicht für Glas, die Hütten waren ihm immer nur Mittel zum Zweck. Auch darin unterschied er sich von seinen Vorfahren, die sich mit Leidenschaft der Glasproduktion verschrieben hatten. Stimmten die Einnahmen, war er zufrieden, doch insgeheim schmerzte es ihn, dass sein schöner Wald für das zerbrechliche Produkt geopfert werden musste. Er begriff sich selbst als fragile Natur, weshalb sollte er sich da Tag für Tag auch noch mit Glas befassen, es widerte ihn an. Zusätzlich machte ihm zu schaffen, dass der Umsatz stetig zurückging. Siegmund hatte das Unternehmen an einem Wendepunkt übernommen, wo sich verlässliche Marktgegebenheiten auflösten und ungekannte Risiken wie unheilvolles Wetterleuchten am Horizont aufblitzten.
In früheren Tagen hatten die Hufnagels das grünliche Pottascheglas produziert, ein edles Erzeugnis, das als Waldglas vertrieben wurde. Sie stellten aber auch andere Produkte her, wie etwa Augengläser oder Glasperlen, die für Rosenkränze ebenso benutzt wurden wie als Tauschobjekte im Sklavenhandel: Das hochgeschätzte Hufnagelglas mit seinem scheuen Glanz wurde in alle Welt exportiert.
Für lange Zeit waren die Produktionsbedingungen hervorragend. Die Rohstoffe Holz und Quarz gab es in Hülle und Fülle vor Ort. Doch nach dem Eisenbahnbau – das Schienennetz breitete sich langsam, aber sicher über ganz Europa aus – konnte hochwertiger Quarzsand ohne große Umstände aus der Lausitz, aus Holland oder aus Belgien ins Deutsche Reich eingeführt werden. Hinzu kam, dass die meisten Hütten ihre Öfen auf Kohlefeuerung umstellten. Steinkohle kam jetzt mit der Bahn aus Pilsen und Braunkohle aus dem nordböhmischen Revier. Die Glasherstellung wurde somit standortunabhängig. In immer mehr Kleinstädten schossen Hütten aus dem Boden. Ein Überangebot an Glas flutete den Markt, so dass die Nachfrage nach teurem Waldglas schlagartig nachließ. Durch die neu entstandenen Zugverbindungen vergrößerte sich zwar der Absatzmarkt, doch die neuentstandene Konkurrenz hatte man nicht mit bedacht. Ein Anstieg des Holzpreises tat das Übrige. Da man in manchen Gegenden schonungslos Waldflächen gerodet hatte, herrschte zeitweise ein Mangel an preiswertem Brennmaterial. Dafür gab die eingerichtete Bahnstrecke dem Fremdenverkehr einen Anschub, in kleinen Schritten kam er ins Rollen.
Um nun auf dem veränderten Terrain nicht weiter Geld zu verlieren, trennte sich Siegmund von allen unrentabel gewordenen Glashütten. Den Erlös reinvestierte er aber nicht. Zwar kaufte er Wald, doch den ließ er nicht schlagen. Siegmund war vorsichtig geworden, er wollte abwarten. Die Gründerkrise, entfacht durch den Börsenkrach 1873, wirkte immer noch nach, und auf die neuen, undurchschaubaren Spekulationsgeschäfte wollte er sich nicht einlassen. Geschäftemacherei solcher Art war ihm zuwider. In dieser Hinsicht war er ein Wertkonservativer wie die Alten.
Reduziert auf sein Kerngeschäft, blieben ihm die Stammhütte in Eisenstein und die fast ebenso große im böhmischen Hurkenthal. Des Weiteren beschlossen er und seine Verwalter, sich in beiden Fabriken auf die Produktion von Tafel- und Spiegelglas zu beschränken. Man musste sich, ob man wollte oder nicht, den neuen Gegebenheiten anpassen. Um wieder erträglich wirtschaften zu können, hatte man sich zu spezialisieren.
Als ob er also nicht genug Sorgen hätte, plante die Saubande jetzt also auch noch einen Aufstand. »Sie wollen Minimallohn, und sie wollen, dass es keine Bruchzahlung mehr gibt.« Franz stockte, kniff beide Augen zusammen, so dass sich seine blassen Wangen leicht nach oben schoben. »Und dann wollen sie noch weniger Stunden arbeiten.«
»Sicher?«
»Ja. Also, alles konnt ich nicht verstehen, weil ich hab ja von draußen lusen müssen, bei offenem Fenster. Ich darf da ja nicht hinein.«
»Warum denn das?«, fuhr Siegmund ihn an.
»Na, das Wirtshaus«, sagte der Junge eingeschüchtert, »gehört meinem Onkel, der hat das nicht gern, wenn er mich da sieht …«
»Stimmt, mein Fehler, das hattest du neulich erwähnt.« Siegmund schlug einen versöhnlichen Ton an. »War wahrscheinlich auch besser so, dass du erst gar nicht im Wirtshaus warst. Dann wird dich auch niemand als Auskundschafter verdächtigen. Beim Lauschen hat dich hoffentlich niemand gesehen?«
»Nein. So wahr ich hier steh!«
Kurz schwiegen sie beide. Franz kratzte sich zwischen Hals und Kragen, dann fasste er Mut, noch nie hatte er den Herrn Hufnagel etwas gefragt. »Was ist eine Bruchzahlung?« Väterlich legte Siegmund seinen Arm auf die Schulter des Jungen. »Das heißt, dass die Arbeiter für alle zerbrochenen Gläser aufkommen. Wenn sie eins kaputt machen, müssen sie es bezahlen.«
»Das ist doch richtig so, das muss jeder.«
»Das denke ich auch. Und sowas wollen die aushebeln. Dann könnte ich die Glashütte gleich zusperren. Warum soll ich den Schaden, den die verursachen, auch noch bezahlen?«
»Nein, das geht nicht!«, stimmte Franz überein und schüttelte dabei energisch den Kopf.
»Und sag, wer hat am meisten geredet, wer war ihr Wortführer?«
»Der Dillinger von den Glasmachern, der hat ständig geredet. Das hat man ganz deutlich gehört, weil der spricht ja anders wie die anderen.«
»Dacht ich's mir.« Dann berichtete Franz noch von ein paar weiteren Dingen, die er aufgeschnappt hatte, ungeordnete Bruchstücke, die sich aber für Siegmund mit den anderen Informationen zu einem vollständigen Bild fügten. Am Ende dankte er Franz, schüttelte ihm gravitätisch die Hand und schärfte ihm ein, niemandem von ihrem Gespräch zu erzählen. Der Junge nickte ergeben. Siegmund steckte ihm eine Extramünze in seine Joppentasche – er wollte nicht nochmal dessen feuchtklebrige Hand in seiner spüren – und entließ ihn. »Da ist also was im Aufwind.« Siegmunds Stirn legte sich in Falten. In Stralau bei Berlin hatte sich zwei Jahre zuvor der Zentralverband der Glasarbeiter niedergelassen. Und durch den Halberstadter Kongress gewannen die Gewerkschaftsbewegungen wieder an Bedeutung, wenn auch unter gemäßigteren Vorzeichen. Bismarcks Sozialistengesetz hatte ausgedient, die Arbeiterbewegung witterte Morgenluft.
Gedankenschwer tapste er in den geräumigen Familiensalon. Einsamkeit befiel ihn. Zum Glück würde morgen Maria kommen, der einzige Lichtblick in dieser Ödnis. Nur ihr zuliebe hatte er ihren Bruder als Laufburschen eingestellt. Das war definitiv nicht verkehrt, der kleine Raffeiner entpuppte sich als ein verlässliches Kerlchen. Er griff sich eine Zigarre aus der Kommode und steckte sie sich an, dann wanderte er im Zimmer umher, neigte den Kopf mal zur einen, mal zur anderen Seite. Warum nur, dampfte es in ihm, musste er sich mit dieser Proletariermeute herumschlagen? Warum war es ihm nicht vergönnt, sich ungestört der Liebe hinzugeben?
Siegmund unterhielt regelmäßig amouröse Verhältnisse zu Frauen, meist außerhalb des Waldgebietes – von München bis nach Wien – und nicht selten gleichzeitig, was manchmal dazu führte, dass er Namen und Geschenke durcheinanderbrachte. Dann war die Empörung groß, aber meist auch wieder schnell verflogen. Indem Siegmund eine Ehe und große Besitztümer in Aussicht stellte, schindete er nachhaltigen Eindruck bei den Damen. Er war begierig danach, zu dominieren, den Stolz der Frauen zu brechen und ihre Vornehmheit in zügellose Ausgelassenheit zu wandeln. Zweifelsohne hielt er sich für einen exzellenten Liebhaber. Hatte er schließlich sein Ziel erreicht, war ihm schnell fad. Langsam ließ er die Beziehung ausklingen. Und selbst wenn er sich bisweilen schäbig fühlte, er konnte nicht anders. Außerhalb der Schlafstatt empfand er die meisten Bekanntschaften als unerträglich. Ob sich nun die Frauen berechnend an ihn klammerten oder sich aufrichtig in ihn verliebten, er fand alle gleichermaßen abstoßend. Eine tiefere Bindung ließ er nicht zu, und da er keine Eltern mehr hatte, gab es niemanden, der ihn zur Heirat drängte. Sein Vater und seine Mutter waren in einem Sturm ums Leben gekommen, als ihre Kutsche von einem umfallenden Baum zerschmettert wurde. Seitdem lastete die Bürde des Alleinerben auf Siegmund. Seine beiden älteren Schwestern waren außerhalb des Waldgebietes verheiratet, man lebte auf Distanz, gegenseitiger Besuch fand selten statt.
An Maria reizte Siegmund die geheimnisvolle Art, dieser widerspenstige Stolz in ihren Blicken. Da war eine Vielschichtigkeit, die er von den Hirnzwergen so nicht kannte. Nichtsdestotrotz mussten jetzt Tatsachen geschaffen werden. Jemand der den Sieg im Namen trug, durfte sich nicht von seinen Untergebenen die Spielregeln diktieren lassen. Ihr Lohn war ausreichend, was sollte also dieser sozialistische Unfug. Eigentlich müsste man kurzen Prozess mit ihnen machen, ihnen ihre Hirngespinste so schnell wie möglich austreiben. Nur wie, das war jetzt die Frage. Siegmund trat ans Fenster, das den Blick auf die in einiger Entfernung liegende Fabrik freigab. Sein Restimperium, dessen Herzstück die heimische Glashütte war, schimmerte in der Mittagssonne. Sie warf nach wie vor genug ab. Ob es ihm gefiel oder nicht, er war abhängig von ihr, sie ermöglichte ihm seinen hochherrschaftlichen Lebensstil.
Nicht weniger als achtzehn Wohn- und Produktionsgebäude lagen vor ihm ausgebreitet, darunter eine Pochanlage, eine Spiegelbelege, ein Elektrizitätswerk, eine Tischlerwerkstatt und ein großes Glasofengebäude. Der Schornstein rauchte, die Glasmännlein waren an der Arbeit. Er drückte die Zigarre aus und zog sich zurück.
4 Die Versammlung
»Es ist ein unendlich Kreuz, Glas zu machen« stand als Inschrift über dem Eingang des Gebäudes. Ein nüchterner Satz als Mahnung und Würdigung zugleich. Der alte Georg Hufnagel soll ihn gesagt haben. Im Glasofenbau herrschte ein aufgescheuchtes Stimmengewirr, es pumperte und lärmte aus allen Ecken. Eine gestockte Hitze brütete auf dem Getöse und machte den Ort zu einer Art industriellem Purgatorium. Nach dem dritten Tag aber, sagte man, gewöhne sich jeder daran, so wie sich der Mensch an alles gewöhnt, was ihm einen sicheren Lebensunterhalt beschert.
In der Eisensteiner Hütte gab es drei Öfen mit acht hochfeuerfesten Schmelztiegeln, den sogenannten Hafen. Darin waberte die zu bändigende glühende Glasmasse, die von Zeit zu Zeit grauenhafte Arbeitsunfälle verursachte. Die Glasbläser standen dabei an vorderster Front. Im Wesentlichen bestand ihre Aufgabe darin, Rohglas herzustellen, also ein Gemenge aus Quarzsand, Soda und Kalkspat zu einer flüssigen, möglichst blasenfreien Glasmasse zu erschmelzen.
Ferdinand Dillinger wand sich aus seinem durchnässten Hemd und schlüpfte in ein frisches. Seine Augen brannten vom Schweiß. Er wischte sich mit dem Stoff die Tropfen von der Stirn. Der Kaffee, von dem er letzten Abend, an dem es nicht minder hitzig zugegangen war als jetzt bei der Arbeit, zu viel getrunken hatte, trieb ihm den Schweiß ohne Unterlass aus allen Poren seines athletischen Körpers. Dillinger, den hier jeder nur beim Nachnamen rief, schnappte sich eine über zwei Meter lange, eiserne Pfeife und entnahm mit ihrem Ende eine kleine Menge des flüssigen Glases. Dann blies er in sein Werkzeug, gleichzeitig drehte er es sachte mit der Kraft seiner Fingerspitzen. Kurz darauf tauchte er die Pfeife abermals in die Masse, um noch mehr Glas zu entnehmen, und nachdem er den Vorgang dreimal wiederholt hatte, haftete an der Pfeife eine Glaskugel von etwa fünfzehn Zentimetern Durchmesser. »Nicht träumen, Junge!«, fauchte er seinen Lehrbuben, den Valentin, an. Erschrocken riss der die Augen auf, worauf Dillinger hämisch grinste. »Wach auf, und nimm die Platsch.« Hastig griff der Lehrling nach dem großen ausgehöhlten Holzlöffel und glättete damit die Oberfläche der Kugel, die noch keine gleichmäßige Form aufwies.
»Wer trinken kann, muss auch schaffen können. Wäre besser, gleich mit dem Saufen aufzuhören.« Der Junge war kurz eingenickt, auch er war gestern im Wirtshaus gewesen und hatte den gestandenen Arbeitern, allen voran seinem Meister, beim Debattieren zugehört, dabei hatte er zu tief in den Maßkrug geschaut. Jetzt hatte Valentin nicht nur einen leeren Geldbeutel, sondern auch einen Brummschädel und schwere Augenlider, gleichwohl war es ein unvergesslicher Abend für ihn gewesen, der ihn aus der Alltagsmonotonie herausgerissen hatte. Revolutionäre Töne, noch dazu in der Öffentlichkeit, hörte man hier draußen so gut wie nie.
Die ausgetretenen Holzdielen knarzten unter den schweren Schuhsohlen. Siglinde, die drahtige Kellnerin mit den aschblonden, zu einem Fischgrätenzopf geflochten Haaren, ruckelte noch schnell die hinteren Tische der Gaststube zurecht und stellte die letzten Stühle so hin, wie sie glaubte, dass ein Plenarsaal auszusehen habe. Es war nicht einfach gewesen für die Glasarbeiter, einen geeigneten Ort zu finden. Arbeiterversammlungen galten im Waldgebiet als suspekt, denn wo sich viele Leute für oder gegen eine Sache zusammentaten, waren Scherereien nicht weit. Aber was sollte der Asenbauer Wirt auch machen, sein Geschäft lief schon seit Längerem nicht gut, da nahm er halt den möglichen schlechten Leumund in Kauf. Immerhin hatte man ihm einen Haufen durstiger Leute angekündigt, und das auch noch werktags.
Konrad Meier, ein beleibter Mann, räusperte sich und mahnte mit einem strengen »Psst« zur Ruhe. Dann schob er sein Kinn vor. »Jetzt sag schon, Dillinger, sag einfach, wie wir uns das vorstellen.« Sein markanter Bass war nicht zu überhören. Alle Augen richteten sich nun auf den Angesprochenen. Unruhig ruckelten die Anwesenden hin und her, für sie war eine politische Versammlung völliges Neuland. Der Ruch des Widerrechtlichen haftete ihr an.
Dillinger stand auf und ließ zunächst seinen Blick schweifen, dabei wippte er leicht mit dem Kopf. Dieser großgewachsene, hagergesichtige Mann Mitte dreißig war allen bekannt, aber viele kannten ihn immer noch nicht persönlich. »Unsere Forderungen«, hob er an, »sind keine Hirngespinste. Es handelt sich dabei um reifliche Überlegungen, die meiner Erfahrungswelt und der Erfahrungswelt aller Arbeiter rund um den Globus entspringen. Denn unser Gesellschaftszustand ist kein Naturzustand, sondern etwas historisch Gewachsenes. Aber alles, was wächst, kann man ausreißen wie Unkraut oder neu pflanzen wie einen Obstbaum, der dann Früchte für alle hergibt. Wir, die Arbeiterschaft, haben die Kraft, beides zu tun. Ich sage euch, alle großen Bewegungen sind von kleinen Häuflein Menschen ausgegangen, aller Umsturz fängt unten an. Und auch wenn schwarze Wolken über uns schweben, so haben wir die Pflicht, unsere Ziele durchzusetzen. Politik im Kleinen heißt kämpfen: Schulter an Schulter für die Seelen der Arbeiter!« Er setzte eine kurze Pause, suchte Blickkontakt zu seinem Auditorium. Manche hielten den Kopf gesenkt, und diejenigen, die zu ihm aufsahen, schauten ihn aus ratlosen Augen an. »Männer!«, fuhr er fort und ballte die Linke zur Faust – doch da fiel ihm die junge Dossiererin Paula Fuchs ins Wort: »He, und was ist mit uns, sind wir Weiber Luft für dich?!« Unter den gut fünfzig Männern war sie eine von drei anwesenden Arbeiterinnen und bekannt für ihre forsche Art. »Und überhaupt, du musst deutsch mit uns reden, man versteht ja gar nix von deinem Zeug.« Gelächter brach aus, aber es war kein spöttisches, sondern es war heiter und wirkte erlösend. In den Ohren der Anwesenden klangen Dillingers Worte vorgefertigt und fremdartig. Sie fühlten sich nicht angesprochen, weil er noch keines ihrer realen Probleme benannt hatte. Das Lachen jedenfalls lockerte die allgemeine Anspannung. »Ja, gut«, sagte Dillinger, selbst ein wenig belustigt, »lassen wir die graue Theorie.« Er machte eine wegwerfende Handbewegung, nahm einen Schluck von seinem Kaffee und begann von Neuem. »Männer und Frauen aus Eisenstein, alle, die wir heute beisammen sind, unsere erste Versammlung soll jedem von uns helfen. Unsere Arbeitsbedingungen sind schlecht.«
»Sie sind hundsmiserabel!«, rief einer der Polierer dazwischen. »Wir arbeiten wie die Ochsen, und es langt oft hinten und vorne nicht!«, schnaubte ein kleingewachsener Schürer mit ausgeprägtem Buckel, der in der hintersten Reihe saß. »Ist ja gut, ich hab's verstanden, ich weiß«, beruhigte Dillinger. »Deshalb war ich neulich in Regensburg und habe mich mit dem örtlichen Vorsitzenden vom Glasarbeiterverband getroffen. Sie würden uns unterstützen, wenn wir in einen Ausstand treten.« Einige klatschten zustimmend.
»Aber warum denn gleich streiken?«, warf der Hirlinger Michl ein, ein älterer Schleifer, mit bräunlichen Zahnstumpen und dunkelblau geäderten Nasenflügeln, die sich jetzt unübersehbar wölbten. »Man muss dem Hufnagel sagen, wo der Barthel den Most holt, und dann wird er schon was ändern!«
Den Gedanken griffen einige auf. »Ja, genau, warum gleich streiken?«, murmelten sie beipflichtend. »Seh ich auch so, sowas gehört ausgeredet«, schob ein anderer Schleifer hinterher, »weil der Hufnagel selber weiß ja gar nicht, wies bei uns zugeht. Wie soll er das auch wissen, er muss ja geschäftlich viel unterwegs sein.« Da platzte dem Meier der Kragen. »Ihr Deppen, ihr traurigen, ja glaubt ihr denn, der Siegmund ändert freiwillig irgendwas, wo er ein Geld ausgeben müsst!? Einen Scheißdreck wird er tun!«, plärrte er das Trüppchen nieder und schlug mit der flachen Hand auf den Tisch, dass ein gehöriges Quantum Bier aus seinem Krug schwappte. »Und was heißt schon geschäftlich unterwegs, er ist ein Glasfabrikant, seine Geschäfte macht er mit uns! Er verdient an uns, ihr Hornochsen! Und das nicht schlecht. Dillinger war bei der Gewerkschaft und hat sich kundig gemacht, und jetzt lasst ihn ausreden.« Der rundliche Schmelzer mit dem fettig glänzenden Gesicht, auf dem kleine rote Narben hervorstachen, zog seine Weste gerade und nickte Dillinger auffordernd zu. »Also, Peter Dirscherl, der Mann vom Glasarbeiterverband, hat uns seine Hilfe angeboten.«
»Ja, was jetzt, Gewerkschaft oder Glasarbeiterverein?«, fuhr einer der Polierer patzig dazwischen. »Der Glasarbeiterverband ist die Gewerkschaft für unsere Belange«, ergriff Dillinger wieder das Wort. »Wenn wir uns für einen Ausstand entscheiden, zahlt der Verband jedem elf Mark pro Woche, bei Verheirateten zusätzlich eine Mark pro Woche und Kind.« Ein Raunen ging durch die Menge, Köpfe wurden zusammengesteckt. »Aber was, Dillinger, müssen wir dafür tun?«, wollte Georg Zitzelsberger wissen, ein nicht mehr ganz junger Vizepoliermeister mit bleichem Gesicht und grau-schwarzen Haarbüscheln, die ihm kräuselnd aus Nase und Ohren wucherten. »Dann müssen wir der Gewerkschaft beitreten, oder?«, kombinierte der Zausel, »aber die Glasmachergewerkschaft, Dillinger, so viel weiß ich, das sind die Sozis«, fügte er nicht ohne einen Anflug von Alarmismus hinzu. Ein eisiges Schweigen durchzog den Raum. An Meiers Hals kroch langsam eine Rötung hinauf, er schürzte die Lippen, blickte ratlos zu Dillinger.





























