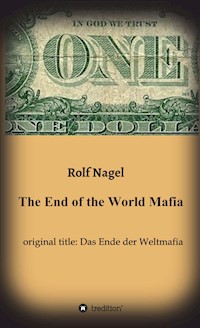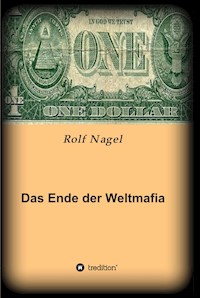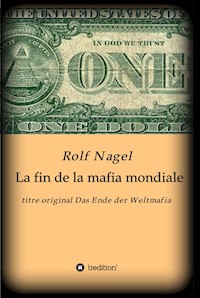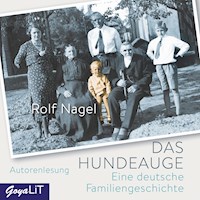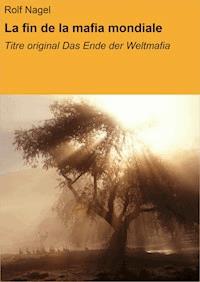18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Insel Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Die Inflation vernichtete die Ersparnisse meiner Familie ... – so beginnen in Deutschland viele Geschichten. Auch die des kleinen Rolf Nagel, der 1929 in eine ganz normale Hamburger Familie hineingeboren wird.
Als die Nazis die Macht ergreifen, ändert sich seine Kindheit. Der Vater tritt in die NSDAP ein. Der Junge erlebt mit, wie Häftlinge ermordet werden, denn die Wohnung der Familie liegt nahe einer Außenstelle des KZ Neuengamme. Der fünfzehnjährige Rolf lässt sich für die »Werwölfe« anwerben. Vorgeblich eine geheime Partisanengruppe Heinrich Himmlers; in Wahrheit nichts anderes als Kanonenfutter.
Kurz darauf endet dann der Krieg. Rolf Nagel wird Schauspieler am Hamburger Thalia Theater, steht neben Harald Juhnke oder Horst Tappert vor der Kamera. Doch das Geschehene lastet auf ihm, genau wie der Blick eines schwarzen Hundeauges, ein Bild, das ihn verfolgt.
Eine Auseinandersetzung mit persönlicher und familiärer Schuld sowie mit der Entscheidung, Rechenschaft über das eigene Tun abzulegen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 363
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Rolf Nagel
Das Hundeauge
Eine deutsche Familiengeschichte
1892 – 1929 – 1945 – 1990 – 2019
Insel Verlag
Für Johanna Maria
Übersicht
Cover
Titel
Widmung
Inhalt
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
Inhalt
Cover
Titel
Widmung
Inhalt
Ein paar Worte vorweg
In meines Vaters Hand
Woher mein Vater kam
Willi und Olli heiraten. Inflation. Hugo wird geboren.
Unser Haus. Warum mein Bruder verprügelt wird. Rolfi erlebt den Beginn des Dritten Reichs.
Mit Mutti im Tietz. Schummerstunde. Hitler und Rolfi.
Rolf lernt lesen. Vati muss das Haus verkaufen.
Die »glückliche Kindheit«. Oma Cordts und die Gelbe Gefahr.
Vati kauft ein Grundstück. Wir ziehen um. Unser Alltag.
Omas Teddy. Die jüdische Schneiderin. Die Pelze in der Alster.
Woher meine Mutter kam
Meine Eltern streiten sich. Mich retten meine Bücher und ein Kino.
Luftschutzkeller. Ich spiele für Kinder. Der Krieg beginnt.
Oberschule. Jungvolk. Plötzlich stirbt Heinzi.
Kinderlandverschickung in Weinböhla
Krank in Meißen. Gesund im Seebad Bansin.
Das Gehirn im Schrebergarten. Krieg mit Stalin. Der Judenstern.
In Ungarn wie im Frieden. In Hamburg fallen die Bomben.
Das Chemiebuch. Operation Gomorra Hamburg. Schlachtfest in Majs.
Heimreise. Gastschüler in Sachsen. Einsatzschule in Hamburg.
Eine
KZ
-Außenstelle hinterm Haus. Eine Frau hängt am Galgen, eine andere wird erschossen.
Ausbildung zum Partisan
Abschied von Vati und Mutti. Zum Einsatz. Hitler erschießt sich. Wir gehen nach Haus.
Meine Mutter hat ihre drei Männer wieder
Entnazifizierung. Die Lenzesfeier.
Neue Zeitungen. Das Abitur.
Ich werde statt Chemiker Schauspieler
Ich bekomme einen zweiten Vater
Theater im Zimmer. Vati baut in Rissen ein Haus. Ich bekomme meine erste Rolle, einen dritten Vater und werde ein Mann.
Der Mantel von Willy Fritsch. Lucky in »Warten auf Godot«. Oper und Fernsehen.
Thalia Theater. Bildende Kunst. Ein Lehrauftrag und ein Mercedes 190
SL
.
Bedingt abwehrbereit. Mein Vater verschwindet aus meinen Albträumen. Die größte Schande meines Lebens.
Mein Hupsi. Fachbereichsleiter. Wieso wird mein Telefon abgehört?
Abschied von meinem vierten Vater
Vatermord an meinem zweiten Vater. Meine Mutter stirbt.
Leningrad. Mein Vater stirbt. Wer waren meine Eltern und mein Bruder?
Vierzigster Jahrestag des Sieges über den Faschismus. Das Ende des Kalten Krieges.
Ich heirate. Warum ich Schauspieler wurde. Ich hole meinen Vater aus dem Schacht des Vergessens.
Ein Dankeschön
Literatur
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
Ein paar Worte vorweg
Vor meinem linken Auge. Ein großes rotes Hundeauge sieht mich an. Ein bisschen rotbraunes Fell mit langen schwarzen Borsten drum herum. Ganz nah, nur das Stück Fell und das Auge. Dann wird das rote Auge ganz dunkel, die Pupille wird tiefschwarz, und ich sacke weg. Unter mir nichts. Ein Abgrund.
Im Fallen wachte ich in meinem Wagen auf. Auf dem Nachhauseweg von einem Drehtag für die ARD-Serie Rote Rosen in Lüneburg war ich für einen Minutenschlaf auf einen Parkplatz neben der Autobahn gefahren.
Das war also das Ende, ab in die Hölle statt in den Himmel. Dabei hatte doch alles so gut angefangen, dachte ich in Erinnerung an das Foto, auf dem ich im Sonnenschein saugend an der Brust meiner Mutter liege. Oder war da was?
Ich begann, darüber nachzudenken, was da gewesen sein könnte, und daraus wurde diese Geschichte; von mir und meinem Bruder, meinem Vater und meiner Mutter, einer Geschichte aus Hamburg und dem Dorf Rissen bei Altona.
Sie beginnt im ausgehenden neunzehnten Jahrhundert und wird im einundzwanzigsten Jahrhundert irgendwann enden. Mitglieder unserer Familie waren an den Kriegen, die zur Gründung des Deutschen Kaiserreichs führten, und am Ersten und Zweiten Weltkrieg direkt oder indirekt beteiligt.
Nach dem Ersten Weltkrieg erlebten meine Mutter und mein Vater die Novemberrevolution, die Ausrufung der Republik mit der Abdankung des Kaisers. Als meine Eltern heirateten und mein Bruder geboren wurde, fand, als Spätfolge des verlorenen Krieges, in der neuen Republik eine Inflation statt, die alle Ersparnisse meiner Großeltern vernichtete.
In meinem Geburtsjahr ruinierte eine internationale Bankenkrise die Wirtschaft des jungen Staates. In den letzten Zügen dieser zusammenbrechenden Republik wählten meine Eltern mit der Mehrheit der deutschen Bürger die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, die die Republik zu einem Einparteienstaat, dem Dritten Reich machte, welches man heute als die Nazizeit bezeichnet. 1933 wählten in Hamburg die Mehrheit der wahlberechtigten Bürger Hitler. Mein Vater und mein Bruder wurden Mitglieder der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, wie fast acht Millionen andere auch.
Ich war noch zu jung, um Mitglied zu sein. Ich kam später mit zehn Jahren ins Deutsche Jungvolk. Meine Mutter und mein Vater, mein Bruder und ich waren deshalb keine Nazis. Wir waren Menschen wie du und ich. Aber durch die Wahl der Nationalsozialisten, die dann diesen Staat regierten, machten sich, bis auf eine Minderheit, die deutschen Bürger der Verbrechen gegen die Menschlichkeit und zahlreicher Kriegsverbrechen mitschuldig. Heute sind in der Zeitung und im Fernsehen immer die Nazis schuld, und nicht die Großeltern, die Großonkel und Großtanten. Wer waren denn dann die Nazis? Es hört sich so an, als ob eines Tages ein Ufo mit lauter Nazis aus dem All in Deutschland gelandet wäre, die dann dieses Deutschland in den Abgrund geführt haben. Es waren nicht die Nazis aus dem All. Wir waren es.
Ich erzähle von der Liebe meiner Eltern, ihrer Ehe, meinem Bruder und mir, den Erlebnissen und Erfahrungen vor achtzig, neunzig Jahren und wie unser Leben durch unsere politischen Entscheidungen entscheidend beeinflusst wurde. Da die Abgründe unseres Verhaltens in den Alltag eingebettet waren, den wir damals, vor knapp einem Jahrhundert lebten, muss ich auch ausführlicher Alltägliches beschreiben, weil sich unser Alltag für den heutigen Leser unvorstellbar verändert hat. Vielleicht könnte so meine Geschichte lehrreich für eine jüngere Generation sein, damit sie sich nicht wiederholt.
Um nicht missverstanden zu werden: Diese Geschichte über mich und meinen Vater, diese Familiengeschichte enthält keine Rechtfertigungen oder Entschuldigungen. Sie schildert, wie einfach ein persönliches Versagen, die Weigerung, sich Rechenschaft abzulegen über die Folgen seines Tuns, zu einer gesellschaftlichen Katastrophe führte. Für dieses Versagen gibt es keine Entschuldigungen. Die Hinnahme der Tötung »unwerten Lebens«, die Unterstützung eines »totalen Krieges«, der so viele Millionen Tote forderte, und die Duldung der systematischen Ermordung eines Volkes sind nicht zu entschuldigen.
Durch das Hundeauge, das mich in einen Abgrund fallen ließ, sind mir während der Jahre, die ich an dieser Geschichte von mir und meinem Vater geschrieben habe, meine Traumata bewusst geworden, mit denen ich bis heute leben muss.
Aber trotz aller Ängste und Abgründe persönlichen Versagens gibt es die Erinnerung an einen geliebten kleinen blonden Jungen, der sich durchs Leben spielt und erwachsen wird. Dass aus diesem Spiel ein Beruf wurde, war nicht geplant. Aber es hat mich wahrscheinlich gerettet und mir ein ungewöhnliches Leben beschert.
In meines Vaters Hand
Bevor ich anfing, dieses Buch zu schreiben, kreiste jahrelang in meinem Kopf eine Art Erinnerungstraum herum, in dem ich zu Beginn fünf Jahre alt war. Meine kleine Hand lag in meines Vaters Hand, während wir über eine Wiese gingen, die nach feuchter Erde, Gras und welken Blättern roch. Ein Geruch, an den sich vierzig Jahre später, als ich mit dem Rauchen aufgehört hatte, meine Nase wieder erinnerte.
Ich liebte diese Spaziergänge. Vati zeigte mir, von welchem Baum die Blätter abgefallen waren, die auf der Wiese lagen, und so lernte ich die Bäume an ihren Blättern und mit ihrem Namen kennen. Ich bewunderte seine Hand, die mein kleines Händchen hielt. Sie war kräftig. Die Fingernägel, die mit diesen seltsamen Riefen aus dem Nagelbett wuchsen, hatte er mit seinem scharfen Taschenmesser immer kurz geschnitten, und sie waren sauber. Mein Vater schliff das Taschenmesser mit etwas Spucke auf dem Abziehstein, sodass er damit ein Stück Papier, das er lose zwischen Daumen und Zeigefinger in der Luft hielt, durchschneiden konnte.
Es war aufregend, ihm dabei zuzusehen, wenn er einem Huhn, das er zwischen seinen Beinen festhielt, mit einem Schnitt den zurückgebogenen Hals durchschnitt, sodass das Blut in Stößen auf die Erde floss. Oder wie er einem Hasen, den er von der Jagd mitgebracht hatte, das Fell an den Hinterläufen löste und mit wenigen kurzen Schnitten über die Ohren zog. Er wusste, wie man es machte, und er konnte mir erklären, warum man es so machte. Wenn er das geschlachtete Huhn ausnahm, zeigte er mir das Herz, die Leber und den Magen und erklärte, warum man vorsichtig mit der Galle sein musste.
Als mein Vater später selbstständiger Architekt war, hatte er sein Büro in unserer kleinen Wohnung, und ich kniete auf einem Stuhl neben seinem Tisch und sah, den Kopf in den Händen, die Ellenbogen neben dem Zeichenbrett aufgestützt, zu, wie mein Vater Häuser entwarf. Er zeichnete den Grundriss, Ansichten und Schnitte mit einem spitzen Bleistift oder Tusche auf Transparentpapier, das er mit Heftzwecken auf das hölzerne Zeichenbrett, das Reißbrett, gespannt hatte. Es gab damals noch keine Computer. Ich fand toll, wie er mit Reißschiene, Winkeln und Bleistift flott hantierte. Von der Zeichnung auf dem Transparentpapier konnte man in der Lichtpausanstalt beliebig viele papierene Lichtpausen machen lassen.
Im Keller des Mietshauses in der Nordmarkstraße, in der wir wohnten, stand eine Hobelbank, und mein Vater hatte sich – nach unserem Umzug wieder alle Werkzeuge zugelegt, die man als Zimmerer und Tischler benötigte. Einmal hat er mir ein Gewehr aus Holz, einem Stück Gardinenstange, zwei Schrauben und einem kleinen Schubladengriff gemacht. Der Gewehrschaft wurde aus einem Kiefernbrett ausgeschnitten, mit dem Putzhobel wurden die Kanten abgerundet und mit Sandpapier geschliffen. Die Gardinenstange war mit zwei Rundkopfschrauben auf dem Schaft befestigt, wobei der Schlitz der hinteren Schraube mit der Dreikantfeile zu einer Kimme erweitert wurde, über die man mit dem vorderen Schraubenkopf als Korn zielen konnte, wie bei einem richtigen Gewehr. Der Schubladengriff wurde der Bügel über dem Abzug.
Die Geschicklichkeit, Zweckmäßigkeit und Leichtigkeit, mit der mein Vater sein Handwerkszeug vom Bleistift über die Tuschefeder, dem Aquarellpinsel, bis zu Säge und Hobel handhabte, waren für mich lustvoll und aufregend. Vati mochte es gern, wenn ich ihm bei der Arbeit zusah. Er genoss meine Neugierde. Er erklärte mir immer, was er da machte, und spürte vielleicht die Bewunderung seines kleinen Sohnes.
Später, als ich selbst für meine Wohnung Möbel anfertigte, war ich ganz glücklich, wenn ich merkte, wie viel meiner Geschicklichkeit ich von meinem Vater geerbt hatte.
Als ich klein war, nahm er mich manchmal mit auf den Bau. Er inspizierte eine Baustelle, für die er als Bauleiter verantwortlich war. So lernte ich Maurer und Zimmerleute, Klempner und Dachdecker, Elektriker, Fliesenleger und Maler am Bau bei ihrer Arbeit kennen. Und meinen Vater.
Mein Vater, Wilhelm Nagel, war bei meiner Geburt siebenunddreißig Jahre alt, ein Bauernsohn. Er hatte eine Zimmermannslehre gemacht, musste 1912 seinen Militärdienst ableisten, und als er damit fertig war, begann der Erste Weltkrieg. Er kam an die Front und wurde durch den Schuss eines belgischen Scharfschützen so schwer verwundet, dass er kein Zimmermann mehr sein konnte. Er bestand die Aufnahmeprüfung an der Hamburger Baugewerkschule und wurde Architekt.
1922 lernte er in einem Freundeskreis eine junge hübsche Buchhalterin kennen, heiratete sie und zeugte einen Sohn, meinen Bruder. Eine heute unvorstellbare Inflation und zeitweilige Arbeitslosigkeit zwangen zur Sparsamkeit. Ein zweites Kind sollte nicht sein. Im Februar 1929 schaffte es dennoch ein Spermium meines Vaters, sich an allen Hindernissen und Fallen vorbeizuschlängeln. Eine glückstrahlende Eizelle meiner Mutter sah es kommen und rief: »Komm rein, mein Junge!« Sein Kopf bohrte sich in dieses glückliche Ei, und ab da begann diese Geschichte.
Im November sollte ich zur Welt kommen, wie man so schön sagt. Ende November 1929 war es in Hamburg ungewöhnlich warm. Meine Mutter schwitzte. Aber ich wollte nicht raus. Nach alldem, was ich so hörte, steuerten wir nach den »Goldenen Zwanzigern« unsicheren Zeiten entgegen. Eine Weltwirtschaftskrise. Und die Weimarer Republik kämpfte immer noch mit den Folgen des 1918 verlorenen Krieges.
Die Freunde meiner Mutter allerdings fanden mich toll, und mein Vater war natürlich stolz über den Erfolg seiner Männlichkeit.
Tante Erna, wie wir die Schulfreundin meiner Mutter nannten, hatte sich schon Gedanken über meinen Namen gemacht. Damals gab's noch keinen Ultraschall, aber alle waren sich einig gewesen, dass ich männlichen Geschlechts sein würde.
Meine Eltern wollten mich Peter nennen, nach meinem Urururgroßvater Peter Nagel, der damals eine Bierbrauerei mit Ausschank in Teufelsbrück an der Elbe hatte.
Tante Erna meinte: »Peter geht nicht! Da sagen nachher die Jungs auf der Straße: ›Peter Pup mit 'n Steen in 'n Buk.‹«
Mein Bruder hieß Hugo Heinrich Wilhelm. »So 'n Name ist viel zu lang, da schreibt sich ja der Standesbeamte jedes Mal die Finger wund.«
»Rolf« wäre kurz und modern.
Als der Arzt drohte, mich mit der Zange rauszuholen, kam ich freiwillig. Der Standesbeamte schrieb »Rolf« in meine Geburtsurkunde. Ich wurde evangelisch getauft. Oma Cordts und Onkel Christoffer Stockhusen aus Tinsdahl waren meine Taufpaten. Der Busen meiner Mutter war groß und voll Milch. Weil ich später fleißig Mondamin-Brei aß, bekam meine Mutter als Prämie einen silbernen Mondamin-Löffel. Vati fotografierte mich. Im von der Mutter gestrickten Strampelanzug mit Mütze, dicken Backen und strahlend blauen Augen war ich ein Musterprodukt.
Vor meiner Geburt hatten meine Eltern und mein Bruder zusammen mit Oma Cordts in der Marienthalerstraße in Wandsbek gewohnt, wo mein Vater bei einem Architekten als Angestellter arbeitete. Es war Anfang 1929 ohnehin schon eng mit drei Personen bei der Oma, und die vierte Person, von der man annahm, dass es wieder ein Junge werden würde, war unterwegs.
Eine Wohnung zu finden, war allerdings nicht einfach. Die Mieten nicht billig. Da lag es nahe, sich einen Traum zu erfüllen.
Mein Vater hatte schon ein Jahr zuvor ein kleines Siedlungshaus entworfen. Jetzt wurde gebaut. Das Geld dafür wurde von Tante Erna und von der Bausparkasse als Hypothek geliehen. Alle Hypothekenverträge waren nicht auf die nach der Inflation eingeführte Reichs- oder Rentenmark bezogen, sondern zur Sicherheit auf den Wert einer Goldmark. So zogen meine Eltern und mein Bruder im September 1929 in das neue Zuhause, und ich wurde im November in das von meinem Vater frisch gebaute Nest gelegt.
In unserem schönen neuen Haus lag ich im Kinderzimmer in meinem vom Vater getischlerten Bettchen im Dachgeschoss unter dem Fenster, durch das die Sonne schien, wenn ich wach war, spielte ich mit der Holzkugel, die am unteren Ende der Gardinenschnur hing. Und juchzte, wenn meine Mutter ins Zimmer gestürzt kam, weil sie dachte, mir sei etwas passiert, weil es so lange so still gewesen war.
Meine Mutter und ich waren oft allein im Haus. Mein Vater machte sich schon früh um sechs auf zur Arbeit, die Baustellen kontrollieren, bevor er ins Büro ging. Mein Bruder war schon in der Schule.
Meine Mutter hat mir die Geschichte mit der Kugel an der Gardinenschnur oft erzählt, deshalb war ich immer der Meinung, ich hätte eine sehr glückliche Kindheit gehabt.
Natürlich kann ich mich an das, was von meiner Geburt bis zu meinem dritten, vierten Lebensjahr geschah, nicht erinnern. Ich muss es aber »erlebt« haben.
Die Psychoanalytikerin Melanie Klein sagt, dass die Erlebnisse der ersten Lebensjahre nicht bewusst erinnert werden können, aber in unbewussten Fantasien das Leben oder Verhalten eines Menschen lebenslang prägen. »Helfen kann solcherart Traumatisierten jedoch, sich mit ihren Gefühlen und Fantasien auseinanderzusetzen, sie zu prüfen und zu vergleichen, um sie besser einordnen zu können und Distanz zu ihnen zu gewinnen.«
Ich versuche es mal.
November bis Januar sind die Monate, in denen es schon sehr früh dunkel wird. Die Westerlandstraße wurde von ein paar Gaslaternen spärlich beleuchtet. Wrumm, wrumm, wrumm-wrumm-wrumm. Was war das? Unheimlich dieses Gewummere, und ich, allein in meinem Bettchen schlafend. Es waren die Trommeln der aus dem nahen Arbeiterviertel durch die enge Straße am Haus vorbeimarschierenden Kommunisten mit ihren roten Fahnen.
Mein Vater und meine Mutter standen unten im dunklen Esszimmer mit meinem Bruder hinter der Gardine. Vati war für Hitler und hasste die Kommunisten. Meine Eltern hatten Angst, die Kommunisten könnten uns die Fensterscheiben einschmeißen. In diesen Jahren prügelten und ermordeten sich Nationalsozialisten und Kommunisten gegenseitig auf offener Straße.
So schön der Busen meiner Mutter war und die Sonne ins Bettchen schien, es war auch Angst im Haus. Zehn Jahre später werde ich selber, wrumm, wrumm, wrumm-wrumm-wrumm, mit Fanfarentönen einer Fahne hinterhermarschieren; ebenfalls in Rot, aber in der Mitte mit einem runden weißen Fleck und einem schwarzen Hakenkreuz darin.
Als ich laufen konnte, spielte ich in der Sandkiste, ganz für mich allein, neben der Treppe zur Küche, in der Mutti arbeitete. Ich baute Berge und Flüsse und war stolz darauf, einen Tunnel durch einen kleinen Sandberg bohren zu können. Und ich liebte Wotan, unseren Schäferhund. Wenn er sich neben mich legte, um mich zu beschützen, legte ich meinen Arm um seinen Hals und schmuste mit ihm, wie wir Hamburger sagen. Manchmal schlief ich ein, meine Ärmchen immer noch um den Hals von Wotan geschlungen. Wotan liebte mich auch und rührte sich nicht von der Stelle.
Eines Tages war Wotan weg. Meine Mutter fand, dass das Geschmuse mit dem Hund gefährlich für meine Gesundheit wäre. Aber Mutti! Meine Mutter schmuste zwar auch mit mir ganz lieb, aber ich musste sie in dieser Beziehung mit anderen teilen. Der Wotan gehörte mir allein.
Irgendwie vergaß ich den Schmerz, dass sie mir Wotan weggenommen hatten, und machte trotzdem alle Kinderkrankheiten durch. Das Bedürfnis zu schmusen ist bis heute unstillbar geblieben.
Meine Mutter brachte mich immer zu Bett. Ich lernte beten. »Ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Amen.« Das war zwar gut gemeint. Ich fühlte mich auch sehr wohl dabei. Aber es stimmte natürlich nicht, dass Jesus da allein drin war. Erstens war meine Mutti, dann Wotan und Vati schon mal mit drin in meinem Herzen. Später wurde es dann unübersichtlicher.
Die Erinnerung an das Gute-Nacht-Gebet ist bis heute immer noch die Erinnerung an einen besonderen Augenblick, wenn mir meine Mutter nach dem Gebet einen »Tüscher« gab. »Gute Nacht, mein Schieter.« Tüscher ist hamburgisch und bedeutet Kuss, es stammt aus der Franzosenzeit von »toucher«, und Schieter ist Plattdeutsch und heißt Scheißer, ist aber im Gegensatz zum Hochdeutschen eine sehr liebevolle Bezeichnung für einen geliebten kleinen Jungen. Wenn meine Mutter mich kleinen Schieter zu Bett gebracht hatte, fühlte ich mich sicher und geborgen.
Es gibt ein Foto, das mein Vater mit seiner Plattenkamera gemacht hat, in unserem Haus in der Westerlandstraße. Mein Bruder kniet hinter dem von der Wand gerückten Diwan, ist neun. Ich bin drei, stehe neben ihm, habe einen hellen Strickanzug an mit Plüschbommeln am Kragen und meinen Arm um die Schultern meines Bruders gelegt. Das Gesicht meines Bruders ist zart, im ersten Augenblick denkt man, er sieht Vati an. Aber seine Augen sehen durch ihn durch, sie ähneln den Augen von Mutti, als sie ganz jung war. Ich bin wohlgenährt, niedlich, wie man in dem Alter zu sein hat, und sehe an der Kamera vorbei, Vati hat gesagt, ich soll dastehen. Meinem Bruder sieht man die Schläge unseres Vaters nicht an, in meinem Gesicht sind die Marschtrommeln in der Nacht und der verschwundene Hund gut versteckt. Rechts unten sind neben meiner Hand, die ich auf den Diwan gelegt habe, die Füße von Omas Teddy zu sehen.
Eine meiner frühesten Erinnerungen – ich war vielleicht gerade dreieinhalb Jahre alt – ist, dass ich einmal meinen Vater begleitete, der zu einer Wahl ging. Ein Lokal am Eingang des Vereinssportplatzes Friedrichshöh. Davor standen Plakate mit Hakenkreuzfahnen. Es muss die Reichstagswahl im März 1933 gewesen sein. Die NSDAP erhielt 38,3 Prozent, die DNVP, die Deutschnationale Volkspartei, die mit der NSDAP kooperierte 8,0 Prozent der Stimmen.
Im Mai 1933 trat mein Vati in die »Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei« ein. Und mein Bruder wurde Mitglied im Deutschen Jungvolk, der Jugendabteilung der Hitlerjugend. Warum wollte mein Vater 1933 Parteigenosse sein, warum wählte auch er Hitler?
Vielleicht sollte ich erst einmal etwas über ihn erzählen, auch wie ich seine Eltern und meine Onkel und Tanten erlebt habe, um besser verstehen zu können, warum er ein Parteigenosse wurde.
Woher mein Vater kam
Rissen war damals ein Heidedorf, westlich von Altona. Es gehörte nach dem Österreichisch-Preußischen Krieg 1866 zum Königreich Preußen, dessen König 1871 nach dem Sieg über Frankeich im Deutsch-Französischen Krieg der Kaiser des Deutschen Reiches wurde.
Das reetgedeckte Bauernhaus mit Stallungen und den Wohnräumen, in dem mein Vater als jüngstes von sechs Geschwistern 1892 geboren und aufgewachsen war, stand zwischen der Wedeler Landstraße und der Dorfstraße. Es wurde 1912 abgerissen, weil der preußische Staat dort eine neue Straße zum Bahnhof bauen wollte, den Vosshagen.
Mein Opa hatte die Landwirtschaft aufgegeben, weil er wahrscheinlich seinem ältesten Sohn, meinem Onkel Hans, nicht zutraute, einen Bauernhof zu bewirtschaften, und die jüngeren Söhne andere Berufe gewählt hatten. Mein Vater wurde Zimmermann und sein Bruder Kapitän auf einem Fischdampfer. An die vier Generationen der Großbauern Nagel, die vom achtzehnten bis Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts hier ihre Ländereien bewirtschaftet hatten, erinnert heute nur noch die Straße Nagelshof in Rissen.
Opa ließ auf dem Rest des Grundstücks, auf dem das alte Bauernhaus gestanden hatte, ein Wohnhaus mit zwei Wohnungen für sich und seinen ältesten Sohn bauen. In einem kleinen Nebengebäude wurden Schweine gemästet, deren Schinken und Würste selbst geräuchert wurden.
Noch heute erinnere ich mich an die geheimnisvolle kleine Räucherkammer mit der eisernen Tür. Aus einem kleinen Häufchen Holzspäne auf dem Zementboden stieg ein dünner blaugrauer Rauch auf, die Wände waren tiefschwarz. Der Geruch der Schinken und des geräucherten Specks ist eine der köstlichsten Geruchserinnerungen, die ich besitze. Der fette Speck bekam durch das langsame Räuchern eine fast goldgelbe Farbe. Mir wurde erzählt, ich hätte diesen Speck als ganz kleiner Junge wie Marzipan genossen und auf die Frage, was ich denn gerne essen wolle, geantwortet: »Beck.«
Die große, ebenfalls reetgedeckte Scheune wurde 1925 verkauft. Bis in die Sechzigerjahre war sie als »Rissener Landhaus« ein beliebtes Ausflugslokal. 1967 wurden das Altenteilerhaus und die Scheune auch abgerissen. Jetzt stehen dort Hochhäuser.
Als ich noch klein war, haben wir am Sonntag, dem einzigen Tag, an dem mein Vater freihatte, öfter Oma und Opa Nagel in Rissen besucht. Sie kamen mir vor wie aus einer anderen Welt. Der Opa immer in einer dunkelgrauen Hose aus dickem Wollstoff, einem weißen Hemd ohne Kragen, nur mit einem kleinen Bund, auf den man bei Bedarf einen steifgebügelten Kragen anknöpfen konnte. Die Weste aus dem gleichen Stoff wie die Hose. Der weiße Vollbart immer gepflegt geschnitten, die Haare kurz. An den Füßen die wollenen Strümpfe und die Pantoffeln. Ob Sommer oder Winter, die Grundausstattung blieb immer gleich. Und die Oma mit den hochfrisierten Haaren, die am Hinterkopf zu einem »Knust« zusammengesteckt waren. Die Stoffbluse mit einem kleinen Stehkragen und langen Armen, der Rock bodenlang.
Beide begrüßten die Schwiegertochter, den Sohn und die Enkel freundlich, aber zurückhaltend. Die Unterhaltung wurde mit Rücksicht auf die Schwiegertochter auf Hochdeutsch geführt, wechselte aber oft ins Plattdeutsche, wenn sie mit ihrem Sohn sprachen. Ich wurde ab und zu geneckt, warum ich nicht auch plattdeutsch spräche. Es gab einen Satz, den ich immer wieder aufgefordert wurde, nachzusprechen: »Harst e'er seggen muss, wenn't 'n Wuss hebben wuss. Min Modder hat jo ne wuss, dat 'n Wuss hebben wuss.« Das war Rissener Platt und heißt auf Hochdeutsch: Hättest eher sagen müssen, wenn du eine Wurst haben wolltest. Meine Mutter hat ja nicht gewusst, dass du eine Wurst haben wolltest.
Jahrzehnte später, als ich Schauspieler geworden war, haben mich dieser auf Plattdeutsch gesprochene Satz und die Erinnerung an den Klang der Sprache meiner Großeltern und meiner Onkel und Tanten in Rissen dazu befähigt, in einem niederdeutschen Hörspiel eine Rolle zu sprechen und dann auch an der Niederdeutschen Bühne in Flensburg den Grafen in De kloke Anna zu spielen, und später am Ohnsorg Theater in Hamburg in einer gelungenen Plattdeutschübertragung des Goethe'schen Urfaust den Mephisto, zusammen mit Heidi Mahler, der Tochter der berühmten Heidi Kabel, als Marthe Rull. Das Niederdeutsche oder Plattdeutsch ist eine wunderbare eigene Sprache. Die Sprache, mit der mein Vater aufgewachsen ist, meine Vatersprache.
Oft gingen wir nach dem Besuch bei Oma und Opa zu Onkel Christoffer und Tante Trina nach Tinsdahl auf den Stockhusen'schen Bauernhof mit Pferden und Kühen. Tante Trina war die Älteste der Geschwister Nagel, mein Vater der Jüngste. Er hatte noch zwei Schwestern. Eine heiratete den Bauern vom Holthof und die Jüngste, Tante Marie, heiratete den Kutscher, der in Livree den Hamburger Kaufmann Godeffroy von Hamburg zu seinen Besitzungen in Rissen kutschierte. Der Kutscher wurde später Hamburger Feuerwehrmann und kutschierte vierspännig die Dampfspritze im Galopp durch Hamburgs Straßen, bis alles motorisiert wurde.
Sie hatten viele Söhne. Bruno, der jüngste, wurde Schornsteinfeger, was mir gewaltig imponierte, weil er gelernt hatte, auf dem Dachfirst zu balancieren, um zu den Schornsteinen zu kommen. Als junger Soldat war er bei der Belagerung Leningrads eingesetzt. Ihm erfroren dabei beide Füße, die man ihm im Lazarett amputierte. Er lernte mit den Prothesen tanzen, heiratete die Krankenschwester, die ihm dabei geholfen hatte, und wurde Uhrmacher.
Mein Vetter Bruno hat mir geholfen, dieses Buch zu schreiben. Er wurde sechsundneunzig Jahre alt.
In dem großen Stall von Onkel Christoffer nisteten Schwalben, die über meinen Kopf sausten. Onkel Christoffer war groß und nett, seine Frau, meine Tante Trina, kleiner, mit so komisch nach außen gebogenen Beinen, weil sie als Kind Rachitis gehabt hatte. Die beiden hatten mehrere Söhne und Töchter. Die Vetter und Kusinen waren für mich wie Onkel und Tanten, weil sie sehr viel älter als ich waren.
Meine Kusine Mariechen nahm mich manchmal mit zum Melken auf die Weide zu den Kühen. Wir fuhren mit Pferd und Wagen, hintendrauf die Milchkannen. Wenn wir bei der Weide ankamen, kamen auch die Kühe zu uns. Meine Kusine setzte sich mit Melkschemel und Eimer fast unter die Kuh, die sich gerne melken ließ. Ich habe immer bewundert, wie sie das machte.
Mit den vollen Milchkannen fuhren wir wieder auf den Hof. Oft waren wir zum Abendbrot eingeladen. Wir saßen alle um den großen Tisch mit mehr als zehn Personen. Eine Welt für sich. Der Bauernhof lag nicht weit vom Leuchtturm Tinsdahl, der oben auf dem Hochufer der Elbe steht und zusammen mit dem Leuchtturm Wittenbergen unten am Elbufer das Richtfeuer für die elbabwärts fahrenden Schiffe ist.
Eine meiner Cousinen wohnte direkt neben dem Leuchtturm. Ich fand das sehr aufregend, neben einem Leuchtturm zu wohnen. Man sah die Schiffe auf der Elbe, der Blick von Tinsdahl bis zur Deutschen Werft auf Finkenwerder, die es heute nicht mehr gibt. Dafür gibt es dort jetzt den Flugplatz Hamburg-Finkenwerder, von dem jeden Tag Airbusse starten, die dort gebaut werden.
Am anderen Ufer sah man das Alte Land, das größte Obstanbaugebiet Europas, wo heute noch die Äpfel wachsen, die ich jeden Abend esse. Dort wurden auch nach dem Hamburger Brand 1842 aus der Tonerde die Ziegelsteine zum Wiederaufbau gebrannt, die Hartbrand-Klinker, mit denen mein Vater noch seine Häuser baute. Als ich später am Theater war und probenfrei hatte, bin ich runter an die Elbe gefahren, zum Leuchtturm Wittenbergen, habe mich auf dem Fähranleger in die Sonne gesetzt und die vorbeifahrenden Schiffe beguckt. So fuhr die Welt an mir vorbei oder kam zu Besuch. Heute höre ich in meiner Wohnung in Rissen manchmal das Tuten der großen Schiffe auf der Elbe. Die riesigen Frachter grüßen mich. Die Leuchttürme stehen inzwischen unter Denkmalschutz. Das Dorf Rissen, Oma und Opa Nagel, die Rissener Bauern waren eine Welt für sich, in der mein Vater aufgewachsen war.
Ein frühes Foto zeigt meinen Vater als Sechs- oder Siebenjährigen mit den Kindern der Rissener Dorfschule im Jahr 1899. Alle acht Klassen zusammen, sechsundvierzig Schülerinnen und Schüler mit ihrem Lehrer, der sie alle in allen Fächern unterrichtete.
Der kleine Simon Wilhelm Nagel sitzt in der ersten Reihe, in der Mitte auf dem sandigen Boden des Schulhofes vor der neu erbauten Steinschule, die die alte Schule in einem windschiefen Fachwerkhaus nun abgelöst hatte. Die Beine nach links ausgestreckt, das linke Bein irgendwie elegant über das rechte gelegt, blickt über die linke Schulter ein blonder helläugiger Junge als einer der wenigen mit einem spitzbübischen Lächeln in die Kamera. Der Oberkörper steckt in einer mit zwei Knopfreihen bis zum Hals geschlossenen Joppe aus dickem Wollstoff. Die Hose aus dem gleichen Material geht bis über die Knie. Absätze! Die Beine stecken in langen, von der Mutter selbst gestrickten Wollstrümpfen. Am rechten Bein ist der Strumpf ein wenig runtergerutscht, und man sieht den weißen Stoff der langen Unterhosen. Die geschnürten Stiefel sind staubig, dreckig wie die der meisten Kinder. Nur der Lehrer hat blank geputzte Stiefel. Er ist in einen schwarzen Gehrock gewandet. Um den Hals trägt er den hohen weißen gestärkten Kragen, vor dem eine große fertiggebundene Krawatte an einem dünnen Band hängt. Der Schnurrbart ist, wie der des Kaisers, mit den Spitzen nach oben frisiert.
Man spürt, dass der kleine Simon Wilhelm Nagel weiß, was ein Foto ist. Er möchte darauf gut aussehen. Deshalb hat er sich in die Mitte gesetzt und lächelt die Kamera an. Es ist etwas gar nicht Braves in seiner Haltung. Er macht den Eindruck, als könnte er jeden Augenblick aufspringen und vor der Kamera herumhüpfen.
Neun Jahre später wird mein Vater wieder fotografiert: »Zur Erinnerung an meine Confirmation 1908«. Jetzt sitzt der Pastor auf einem extra dort platzierten Stuhl in der Mitte des Bildes, vor der ersten Reihe der Konfirmanden. Die rechte Hand, die ein zusammengerolltes Heft wie einen Marschallstab umfasst, liegt auf dem rechten Oberschenkel, der rechte Fuß ist vor den linken gestellt, wie Stand- und Spielbein, obwohl er sitzt, die linke Hand ist hinter der Hüfte verschwunden, die Weste ziert eine Uhrkette, der schwarze Bart ist noch mehr als der des Lehrers in Es-ist-erreicht!-Position getrimmt.
Simon Wilhelm steht in der zweiten Reihe ganz rechts. In seinem Gesicht sind die ersten Züge des jungen Mannes zu sehen. Über der hohen Stirn ist das volle blonde Haar fein nach rechts gescheitelt. Von dem schmalen hohen Kopf stehen die Ohren ab, die ich erben sollte. Zum weißen Hemd mit Stehkragen trägt er eine weiße Fliege. Die einreihig geknöpfte schwarze Jacke macht einen sehr sauberen, soliden Eindruck.
Zwischen diesen beiden traditionellen Erinnerungsgruppenbildern gibt es ein Foto, das meinen Vater bei der Kornernte zeigt, rechts neben ihm ein Knecht und hinter ihm mein Großvater mit der Sense in der Hand. Mein Vater trägt dreiviertellange Hosen und einen Hut aus feinem Stroh mit Band, oben rund, wie ihn die Sommerfrischler an der See zu der Zeit trugen. Er lächelt, es geht ihm anscheinend gut. Ein feines Kerlchen.
Er war der jüngste Sohn, und sein Selbstbewusstsein ist ein Standesbewusstsein. Der Vater ist ein Großbauer, kein Knecht, sondern ein Besitzer von Ländereien, von Häusern, Pferden und Vieh, ein Herr über Land, Vieh und Menschen.
Mein Vater erzählte mir, dass er im Sommer 1906, als Dreizehnjähriger, die Rauchwolke des brennenden Michel, des Wahrzeichens Hamburgs, von Rissen aus sehen konnte. Seine spätere Frau sah den brennenden Turm der Michaeliskirche fast vor der Haustür.
1908 beendete die Konfirmation die Schulzeit. Die Dorfschule hatte ihn lesen, schreiben, rechnen und Geschichte gelehrt. Seine Aufsatzhefte sind blitzsauber, die Schrift gestochen scharf und gleichmäßig, ohne Fehler. Bauer konnte er nicht werden. Der älteste Bruder stand zwischen ihm und dem Erbe, der Vater war neunundfünfzig, er war fünfzehn. Wie lange hätte er auf dem Hof seines Vaters als Knecht arbeiten müssen, bis er das Erbe hätte antreten können? Außerdem hatte mein Vater als Jüngster Probleme mit seinem ältesten Bruder, der ihn verprügelt und wie einen Knecht behandelt haben soll. Wahrscheinlich hat mein Vater meinen Onkel Hans oft geneckt, der war nämlich nicht so helle.
Kein Wunder also, dass der Zimmermeister Körner aus Sülldorf 1908 in der Diele des Nagel'schen Bauernhauses stand und sagte: »Dien Söhn is bi mi.« Mein Vater hatte sich entschieden, eine Zimmermannslehre zu machen. Damals wohnten die Lehrlinge im Haus des Meisters, und dessen Frau kochte für alle. Und da konnte der Großbauer Nagel schlecht Nein sagen, wenn er sein Gesicht behalten wollte.
Auf die Frage, wie man seinen Kindergeburtstag feierte, erzählte mein Vater, dass seine Mutter am Abend, als er schon im Bett lag, zu ihm kam und sagte: »Hess jo hüt ok Geburtstach hatt, gratuleer ok.« (Hattest ja heute Geburtstag, gratulier auch.) Das war alles. Vielleicht war das in anderen Familien anders, aber seine war so. Vielleicht war die Familie des Zimmermeisters Körner anders. Zumindest gab es eine Lehrlingsfreundschaft.
1926 schrieb mein Vater seinem Freund aus Zimmermannstagen zur Geburt seines ersten Kindes ein kleines Gedicht in plattdeutsch:
An meinen Freund – zum frohen Ereignis.
Min leben Fründ Niklas mitsamt dien lütt Froo.
Wie geiht dat in Leben doch wünnerlich too
Vun twee sünd nu dree worn, man schull dat nich glöben.
Jo sowat söcht Adebaar nachts mang de Röben
Un eh'r du di ümdreihst, un eh'r du't begrippst
Dor seggt al de Moddersch: hier hest dien lütt Fips.
Dat is nu joer egen, dat is nu joer All,
wat dat nu in Leven vor Freid afgeven schall.
Wenn de nu erst spattelt, wenn de nu erst kreiht,
denn denk an uns Jungtied, denn denk dran torüch
wie gern unserehn so lütt wesen müch.
Mein lieber Freund Niklas mit deiner kleinen Frau.
Wie geht das im Leben doch wunderlich zu
Aus zwei sind nun drei geworden, man soll das nicht glauben.
Ja, so was sucht Adebaar (der Storch) nachts zwischen den Rüben
Und eh du dich umdrehst und eh du's begreifst
Da sagt schon die Mutter, hier hast deinen kleinen Fipps.
Das ist nun euer Eigen, das ist nun euer Alles,
Was das nun im Leben für Freude geben soll.
Wenn der nun erst strampelt, wenn der nun erst schreit,
Denn denk an unsere Jungszeit, denn denk dran zurück
Wie gern unsereins so klein gewesen sein mochte.
Er schrieb dieses Gedicht, als er seine große Liebe geheiratet hatte, keine Bauerntochter, sondern eine gelernte Buchhalterin und Stenotypistin, eine hübsche schwarzhaarige Frau, die ihm vor zwei Jahren seinen ersten Sohn geboren hatte. Ich bin beim Lesen dieses kleinen Gedichts immer wieder über die letzten Zeilen gestolpert: »denn denk an uns Jungtied, denn denk dran torüch wie gern unserehn so lütt wesen müch.« Das ist es! Die Sehnsucht nach der Kindheit, dem Geborgensein. Die Sehnsucht nach Liebe, die ihn sein Leben lang nicht losließ. Auch wenn seine schwer arbeitende Mutter sich erst beim Zubettgehen an seinen Geburtstag erinnerte, war er doch der Jüngste unter den Geschwistern, ein hübscher Kerl, blond, mit strahlend blauen Augen. Schlank und muskelbepackt, braun gebrannt von der Arbeit als Zimmermann an der frischen Luft sollte das Leben vielversprechend sein.
Der Zimmererlehrling Wilhelm Nagel wurde im Frühjahr 1912 »freigesprochen«. Er war neunzehn und nun ein Zimmergeselle.
Sechs Monate später, am 17. Oktober 1912, wurde aus dem freigesprochenen Zimmergesellen Wilhelm Nagel der »Ersatz-Rekruth« im Preußischen Garde-Grenadier-Regiment Nr. 3 »Königin Elisabeth« in Potsdam. Es war zwar nicht die berittene Garde, in der der Adel Preußens dem Kaiser die Treue schwur, aber immerhin das Garderegiment »zu Fuß«. Eine ganze Klasse besser als sein Vater, der bei der Holsteinischen Infanterie gedient hatte, diente er in Potsdam, in unmittelbarer Nähe seines Kaisers, Wilhelm Zwo, dessen Vornamen er trug und der sich in theatralischer Herrscherpose, in fantasievollen Uniformen, mit einem weißen Adler auf seinem Helm hat malen lassen. Mein Vater hat das geliebt. Er hatte auch einen Hang zum Theatralischen. Vielleicht habe ich das geerbt.
Als der Militärdienst vorbei war und nun der Zimmergeselle Simon Wilhelm Nagel sein erlerntes Handwerk hätte zeigen können, entstand durch die Ermordung des österreichischen Thronfolgers und seiner Frau in Sarajewo durch serbische Terroristen eine kritische Situation, die sich mit kühlem Kopf ohne Krieg hätte lösen lassen. Aber Politiker ohne Übersicht, Militärs ohne Politikverständnis und aufgestaute Ressentiments führten zu riskanten Entscheidungen. Der für seine Unsicherheit und Emotionalität bekannte deutsche Kaiser Wilhelm II. erklärte, auf Drängen seiner Generäle, Russland völlig unnütz den Krieg und hatte damit automatisch dessen Bundesgenossen an der Backe.
Der Satz in der berühmten Ansprache Kaiser Wilhelms an sein Volk: »Mitten im Frieden überfällt uns der Feind« war eine glatte Lüge. Das Deutsche Reich hätte wegen der Ermordung des österreichischen Thronfolgers keinen Krieg mit Frankreich, England und Russland anfangen müssen. Es war die pathologische Sucht des Enkels der großen Queen Victoria, Kaiser einer Großmacht sein zu wollen.
Die preußische Bevölkerung, die Deutschen, liebten jedoch ihren Kaiser und zogen mit Begeisterung in diesen Krieg gegen den »Erzfeind« Frankreich. Die Soldaten, die aus ihren Kasernen zum Bahnhof marschierten, um an die Front zu fahren, wurden mit Blumen und Hurrarufen begeistert gefeiert. Ich weiß noch, dass mein Vater uns Kindern den Spruch einer Propagandapostkarte, »Jeder Schuss ein Russ, jeder Stoß ein Franzos«, mit Engagement zitierte.
Das war die Stimmung, nachdem er Ende Januar 1914 zum Gefreiten ernannt wurde und im August in diesen Krieg zog.
Im Militärpass des Gefreiten Simon Wilhelm Nagel steht:
Datum und Art des Diensteintritts: Am 17. 10. 12 als Ersatz-Rekruth.
Versetzungen: Am 1. 10. 1913 zur 11. Kompanie, 5. Garde-Regiment zu Fuß.
Am 12. 08. 1914 ins Feld.
»Ins Feld« hieß in den Krieg, an die Front. Dieses »ins Feld«, eine damals gebräuchliche Phrase, klang, als ob man sich noch im 18. Jahrhundert befände, in dem die Soldaten mit Trommelschlag und wehenden Fahnen in Formationen auf freiem Feld aufeinander zumarschierten, um sich dann gegenseitig umzubringen.
In Schillers »Jungfrau von Orleans« heißt es: »ein Schlachten war's, nicht eine Schlacht zu nennen«. Der Historiker und promovierte Feldarzt Schiller war da realistischer als die damals gebräuchliche Sprache der Militärs, die mit den »Gefallenen auf dem Felde der Ehre« zerfetzte Leichen in einem Land, in dem sie nichts zu suchen hatten, zu umschreiben suchten.
Weiter heißt es im Militärpass unter Feldzüge, Verwundungen:
Am 22. 08. 14 im Gefecht bei Namur durch G. G. [Gewehr-Geschoss] (Querschläger) durch die Brust verwundet, wobei das Geschoß stecken blieb.
Mein Vater war gerade zehn Tage im Krieg, einundzwanzig Jahre und neun Monate alt, als diese schreckliche Verwundung ihn fast sein Leben kostete. Er stand Wache an der Front, das Gewehr seitlich im Arm haltend, als ein Scharfschütze auf ihn schoss und das Herz verfehlte.
Das Geschoss prallte stattdessen auf das stählerne Schloss seines Gewehres, wobei sich die bleierne Spitze wie ein Flügel einer Schiffsschraube verformte und dann durch die Uniform links unten in den Brustkorb eindrang und dann, sich quer nach oben zwischen Luft- und Speiseröhre und den Arterien, Venen und Nerven einen Weg bahnend, im Brustbereich stecken blieb.
Wer glaubt, dass man 1914 jemanden mit einem Geschoss in der Brust nach Hause schickt, kennt das damalige preußisch-deutsche Militär nicht. Erst zwei Monate später wurde er in ein Heimatlazarett verlegt. Als die Ärzte im Lazarett versuchten, das Geschoss zu entfernen, spritzte ihnen der Eiter beim Öffnen des Brustkorbs entgegen, worauf sie den Schnitt gleich wieder zunähten und den Rest dem lieben Gott überließen, und Gott oder die ungeheure Vitalität meines Vaters taten das ihrige. Er überlebte, eine Zeit lang halbseitig gelähmt, bis dreißig Jahre später das Geschoss sich mit einer Ausstülpung der Haut am Hals unter dem Hemdkragen unangenehm bemerkbar machte und endlich von demselben Dr. Bergmann entfernt wurde, der mir vorher die Polypen aus der Nase operiert hatte.
Es gibt ein Foto meines Vaters, wie er – nach der Operation – im Garnisonslazarett in Erfurt liegt. Am Fußende sitzt eine Krankenschwester, die ihm einen Becher reicht. Der Kopf meines Vaters hochgelagert mit vielen Kissen. Das Hemd beult sich über einem dicken Brustverband, die Hände auf der Decke, und mit einem seltsam durchsichtigen Gesicht, weiß wie das Bettzeug, sehen seine Augen unter halb geschlossenen Lidern in die Kamera.
Wenn ich ihn so sehe, spüre ich die Verlassenheit in der sterilen Umgebung des Lazaretts, die Entfernung vom Elternhaus, die Begegnung mit dem Tod und die unausgesprochene Frage in seinem Gesicht: Nimmt mich vielleicht jemand in den Arm?
Nach sechs Wochen wird er wieder ins Feld kommandiert. Das Feld ist diesmal in Russland. Zehn Tage später wird er krankgeschrieben. Ja, was für ein Wunder! Aber nun schicken sie ihn doch nach Hause? Nein, erst sieben Monate und zwölf Tage später.
Es braucht dann noch weitere zweieinhalb Monate, bis er »als für jetzt dienstunbrauchbar zum Beurlaubtenstande entlassen« wird. Das heißt, er war »für jetzt«, im Augenblick, zu dieser Zeit nicht mehr »brauchbar«, man konnte ihn nicht mehr gebrauchen.
Im Militärpass steht:
Auf Grund der durch Kriegsdienstbeschädigung verursachten Erwerbsunfähigkeit von 70 % ist vom stellv. Generalkommandeur eine von der Jahres-Vollrente für Gemeine von 540 M zuständige Teilrente von 31,50 M, einer Verstümmelungszulage von 27,– M und einer Kriegszulage von 15,– M zusammen 73,50 M monatlich vom 1. 11. 15 ab bewilligt worden.
Das sind heute etwa 335 Euro. Natürlich konnte er nach seiner Entlassung aus dem Militärdienst im Oktober 1915 bei seinen Eltern in Rissen wohnen. Der Weltkrieg ging ohne ihn weiter. Eine Arbeit als Zimmergeselle war wegen der Verwundung unmöglich geworden. Aber vielleicht konnte er sich jetzt einen Traum erfüllen. Eine abgeschlossene Volksschule, dazu eine Zimmererlehre mit dem Besuch einer Berufsschule und der Gesellenprüfung waren alles, was er an Voraussetzungen mitbrachte. Jedenfalls bestand mein Vater 1915 die Aufnahmeprüfung der Baugewerkschule in Hamburg. Er wollte Architekt werden.
Im Militärpass stand weiter:
Die Versorgungslage wird im Jahre 1916 erneut geprüft werden.
Diese Prüfung fand am 29. 4. 1916 statt, mit dem Ergebnis:
Nachprüfung im Jahre 1918 erforderlich (Weiterbewilligung der Versorgungsgebürnisse).
Und so weiter, und so weiter. Es endet mit dem Eintrag:
50 Mk (etwa 175,00 €) einmalige Abfindung gezahlt 30. Mai 1918
Das war's dann. Das Geschoss steckte noch immer in der Brust! Mit fünfundzwanzig Jahren im September 1918 bestand er die Reifeprüfung in der Abteilung Hochbau der Baugewerksschule. Jetzt wurde er Architekt und bekam eine Anstellung als Techniker bei der Braunschweigischen Siedlungsgesellschaft-mbH.
In Kiel revoltierten am 3. November die Matrosen der Kaiserlichen Flotte, zusammen mit den Werftarbeitern, gegen eine Fortsetzung des Krieges und lösten damit eine Revolution gegen den Kaiser aus.
Willi und Olli heiraten. Inflation. Hugo wird geboren.
Am 9. November 1918 wurde die Republik ausgerufen. Der von meinem Vater geliebte Kaiser ging ins Exil nach Holland. Am 13. März 1920 fand ein Aufstand von ehemaligen Offizieren und Soldaten des Heeres und der Marine, sowie der Reichswehr gegen die Regierung der neu geschaffenen Weimarer Republik statt, die im Januar 1920 den Versailler Vertrag unterschrieben hatte.
In Hamburg wurde das Rathaus besetzt. In Harburg wurde der Hauptmann Rudolf Berthold, ein Flieger-Ass des Weltkriegs, an seinem Marsch nach Berlin am 15. März aufgehalten und bestialisch ermordet. Der Putsch scheiterte ein paar Tage später, am 17. März.
Was hat mein Vater dabei empfunden? Ich habe ihn leider nie gefragt.
Am 1. Mai 1920 wurde meinem Vater »Wegen mangelnder Auftragslage und Priorität für verheiratete Kriegsteilnehmer« gekündigt. Wieder zurück bei seinen Eltern in Rissen war er von März bis Juni 1922 beim Magistrat der Stadt Altona im Hochbauamt beschäftigt und führte die Bauaufsicht in der Siedlung Steenkamp, die heute unter Milieuschutz als Musterbeispiel sozialen Siedlungsbaus steht. Vielleicht hat er in dieser Zeit durch Henry S. – einen Beamten im Arbeitsamt – den Freundeskreis der Schulfreundin seiner zukünftigen Frau kennengelernt.
In dieser Zeit, im Mai 1922, heirateten meine Eltern. Von Juli bis Dezember 1922 war mein Vater als Bauführer bei den Architekten Klophaus und Schoch tätig. Dann folgten vier Monate Arbeitslosigkeit. Seine Frau war schwanger.
Am 1. April 1923 bekam er einen Job als Bauführer bei der Tiefbaufirma J. C. Witt. Er hatte die Aufsicht über dreihundert Notstandsarbeiter auf dem Ohlsdorfer Friedhof. In Deutschland tobte eine heute unvorstellbare Inflation. Am 13. Juli wurde mein Bruder geboren. Weil die Inflation das Geld binnen Stunden wertlos machte, lief mein Vater mit dem Tageslohn im Laufschritt in den nächsten Milchladen, um davon noch Milch für seinen Erstgeborenen zu kaufen.
Ende September 1924 war der Job auf dem Ohlsdorfer Friedhof zu Ende. Mein Vater war einunddreißig und wieder arbeitslos. Wir haben als Kinder später mit den inzwischen total wertlosen Banknoten, die unsere Eltern zur Erinnerung aufgehoben hatten, gespielt. Scheine zu fünfzig Millionen oder fünf Billionen Mark wurden Ende 1923 nur noch als Notgeld benutzt, während die Rentenmark wieder eine relativ stabile Währung wurde.