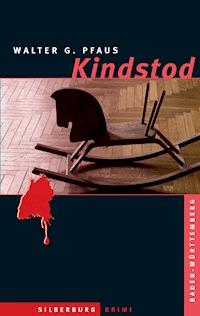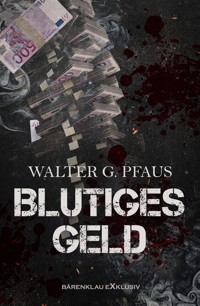3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bärenklau Exklusiv
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Paul Cannella braucht Geld, sehr viel Geld. Andernfalls platzt der Wechsel, und der Ruin seiner Firma wäre besiegelt. Es gibt nur einen Ausweg: die Lebensversicherung seiner Frau!
Aber dazu würde Johanna sterben müssen, und Paul liebt sie abgöttisch. Johanna findet die Lösung! Ihr Plan scheint so genial wie mörderisch.
Mit Eifer geht Cannella ans Werk, die Anweisungen seiner Frau in die Tat umzusetzen. Wahre Liebe ist zu allem fähig, sie macht aber auch blind. Und so bemerkt er erst viel zu spät den vermeintlichen Haken, den jeder noch so geniale Plan in sich birgt.
Ein Kriminalroman mit vielen überraschenden Wendungen und einem furiosen Ende.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Walter G. Pfaus
Das ideale Mörderpaar
Kriminalroman
Impressum
Copyright © by Authors/Bärenklau Exklusiv
Cover: © by Steve Mayer nach Motiven, 2023
Korrektorat: Bärenklau Exklusiv
Verlag: Bärenklau Exklusiv. Jörg Martin Munsonius (Verleger), Koalabärweg 2, 16727 Bärenklau. Kerstin Peschel (Verlegerin), Am Wald 67, 14656 Brieselang
Die Handlung dieser Geschichten ist frei erfunden sowie die Namen der Protagonisten und Firmen. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind rein zufällig und nicht gewollt.
Alle Rechte vorbehalten
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Das Buch
Das ideale Mörderpaar
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
Über den Autor Walter G. Pfaus
Folgende Bände von Walter G. Pfaus sind bereits erhältlich oder befinden sich in Vorbereitung
Das Buch
Paul Cannella braucht Geld, sehr viel Geld. Andernfalls platzt der Wechsel, und der Ruin seiner Firma wäre besiegelt. Es gibt nur einen Ausweg: die Lebensversicherung seiner Frau!
Aber dazu würde Johanna sterben müssen, und Paul liebt sie abgöttisch. Johanna findet die Lösung! Ihr Plan scheint so genial wie mörderisch.
Mit Eifer geht Cannella ans Werk, die Anweisungen seiner Frau in die Tat umzusetzen. Wahre Liebe ist zu allem fähig, sie macht aber auch blind. Und so bemerkt er erst viel zu spät den vermeintlichen Haken, den jeder noch so geniale Plan in sich birgt.
Ein Kriminalroman mit vielen überraschenden Wendungen und einem furiosen Ende.
***
Das ideale Mörderpaar
1. Kapitel
Die Stunde, in der ich sie töten würde, rückte näher. Und je näher diese Stunde kam, desto ruhiger und entschlossener wurde ich.
Es würde leicht sein. Mein Plan war perfekt. Ich hatte nichts dem Zufall überlassen. Jede Kleinigkeit hatte ich berücksichtigt. Ich war sicher, dass ich nichts übersehen hatte.
Ich stützte mich auf die Ellenbogen und betrachtete ihr Gesicht. Sie schlief tief und fest. Ihr Mund war leicht geöffnet, und über ihre Lippen drangen leichte Schnarchtöne. Sie war sehr glücklich; das sah man. Nur glückliche und zufriedene Menschen können so tief und fest schlafen.
Ich beneidete sie um dieses Glück. Ja, ich hasste sie sogar deswegen.
Plötzlich war mir wohler. Jetzt würde alles noch viel leichter gehen. Hass ist der beste Antrieb für einen Mord.
Während meiner langen Vorbereitungszeit hatte ich mir oft die Frage gestellt, ob ich sie so einfach töten könnte. Denn im Grunde hatte sie mir ja nichts getan. Abgesehen von der Tatsache, dass sie da war, dass sie immer um mich herum war und dass ich ihre Gegenwart kaum ertragen konnte. Aber jetzt wusste ich, dass ich es konnte. Es würde mir nicht schwerfallen, sie kaltblütig umzubringen.
Erleichtert atmete ich auf. Dies war der einzige schwache Punkt in meinem Plan gewesen. Nun war auch er beseitigt.
Ich schlug die Bettdecke zurück und stand auf. In meinem Koffer war eine Flasche Whisky. Ich schraubte sie auf und goss ein halbes Wasserglas voll. Der Whisky tat mir gut. Ich trat ans Fenster und schob die Vorhänge auseinander. Draußen wurde es langsam hell. In einer Stunde würde die Sonne aufgehen, und eine Stunde später würden wir das Frühstück einnehmen.
Und dann wird sie höchstens noch zwei Stunden leben, dachte ich. In keinem Fall länger. Sie wird tot sein – und ich um eineinhalb Millionen reicher. Ich warf einen Blick auf das Bett. Sie hatte sich jetzt auf den Rücken gedreht und ihr Schnarchen war lauter geworden.
In Gedanken ging ich noch einmal meinen Plan durch. Ich überprüfte noch mal die kritischen Stellen. In allen Variationen stellte ich mir vor, was auf mich zukommen könnte. Aber ich fand nichts, was ich hätte besser machen können. Ich hatte ganze Arbeit geleistet, jedenfalls bis jetzt. Und nun, nachdem ich bemerkt hatte, dass ich sie sogar hasste, war ich sicher; auch dieser letzte, sicherlich schwierigste Teil meines Plans würde reibungslos verwirklicht.
Ich setzte mich an den kleinen Sekretär, der in unserem Zimmer stand, und zog die Versicherungspolicen heraus. Die Beiträge kosteten mich mein letztes Geld. Unser Haus war ohnehin schon mit drei Hypotheken belastet, und um unser Geschäft vor dem Zusammenbruch zu retten, hatte ich einen Wechsel unterzeichnet, der in drei Wochen fällig wurde. Ich steckte bis zum Hals im Dreck. Wer jemals unter dem Druck eines Viertel-Millionen-Wechsels stand, der weiß, wie einem da zumute ist. Vor allem, wenn man das Geld nicht hat.
Ich hatte es nicht.
Um über den Berg zu kommen, brauchte ich unbedingt eineinhalb Millionen. Aber in weniger als vier Stunden würde ich es geschafft haben. Die größte Hürde war dann genommen. Was mich danach noch von den 1,5 Millionen trennte, waren Formalitäten. Natürlich, ich brauchte gute Nerven. Aber die glaubte ich zu haben. Jedenfalls war ich davon überzeugt, dass ich die Sache durchstehen würde.
Ich las die Policen zum wiederholten Male durch, Wort für Wort, vor allem das Kleingedruckte. Zuerst die Lebensversicherung. Sie war auf Gegenseitigkeit abgeschlossen und lautete auf 600.000 Mark. Bei Unfalltod erhöhte sich die Versicherungssumme auf das Doppelte. Und sie würde durch einen Unfall ums Leben kommen, dafür hatte ich gesorgt. Vier Monate harte, nervenaufreibende Planung waren notwendig gewesen; jetzt aber war alles vorbereitet.
Die Police war in Ordnung. Es gab nichts daran auszusetzen. Ich hatte sämtliche Krankheiten angegeben, so dass es auch in dieser Hinsicht keine Schwierigkeiten geben konnte.
Ich schob die Unterlagen der Lebensversicherung beiseite und nahm die Unfallpolice in die Hand. Sofort fiel mein Blick auf einen bestimmten Passus in diesem Vertrag.
Die Todesfallsumme darf die Invaliditätssumme nicht überschreiten, stand darin. Von neuem stieg der Ärger in mir hoch. Um die noch fehlenden 300.000 DM zu erhalten, war ich gezwungen, eine Versicherung über ebenfalls 600.000 DM abzuschließen. Aber ich beruhigte mich schnell wieder. Die 1.5 Millionen würden mich sehr bald für allen Ärger entschädigen.
Ich steckte die Policen in die Mappe. Danach legte ich sie nicht mehr in den Sekretär, sondern verstaute sie gleich in der Aktentasche, die neben dem Schreibtisch stand. Wenn alles vorüber war, durfte ich sie nicht vergessen. Schließlich waren diese beiden Schriftstücke das Wichtigste an meinem Plan.
Ich schob den Stuhl zurück und stand auf.
Der Stuhl verursachte so viel Lärm, dass Johanna aufwachte. Sie blinzelte, stützte sich auf die Ellenbogen und sah mich an. »Du bist schon auf?«, fragte sie mit verschlafener Stimme.
»Kümmere dich nicht um mich«, antwortete ich leise. Ich versuchte, meiner Stimme einen zärtlichen Klang zu geben. Es gelang mir nur mäßig. Aber ich glaube nicht, dass sie es merkte. »Schlaf weiter, Liebling. Wir haben noch fast zwei Stunden Zeit bis zum Frühstück.«
Sie ließ sich ins Kissen zurücksinken und rekelte sich wohlig. »Wenn du nicht mehr schläfst, will ich auch nicht mehr schlafen.« Sie gähnte.
Blödes Frauenzimmer, dachte ich. Aber ich blieb freundlich. »Ich weiß doch, dass du morgens länger schlafen möchtest«, sagte ich sanft. »Ich bin ein Frühaufsteher, auch im Urlaub. Du musst dich nicht nach mir richten. Schlaf weiter; es wird dir guttun. Wir haben einen anstrengenden Tag vor uns.«
Johanna gähnte wieder und schüttelte den Kopf. »Nein, jetzt bin ich schon wach. Ich kann doch nicht mehr einschlafen.«
Sie setzte sich auf und lächelte mich an. Ich ging zu ihr, legte die Hände auf ihre Schultern, küsste sie auf die Stirn. »Es ist fünf Uhr morgens«, erklärte ich. »Selbst hier, auf dieser Insel in der Karibischen See, steht kein Mensch um diese Zeit auf.«
Ich wollte allein sein um noch etwas nachdenken zu können. Man begeht schließlich nicht jeden Tag einen Mord. Aber Johanna wollte jetzt nichts mehr vom Schlafen wissen.
»Du bist so lieb.« Sie schlang die Arme um meinen Nacken. »Noch nie in meinem Leben hat sich jemand so um mich gesorgt wie du.«
Sanft schob sie mich zurück und stieg aus dem Bett. Dann schlüpfte sie mit einer schnellen, gleitenden Bewegung aus ihrem kurzen Nachthemd und ging zur Badezimmertür.
»Ich bin in ein paar Minuten wieder zurück«, flötete sie. »Ich möchte mich nur ein wenig frisch machen. Dann komme ich, um mich bei dir zu bedanken.«
»Ich kann es kaum erwarten«, antwortete ich.
»Du Schlimmer, du.« Sie drohte mir scherzhaft mit dem Finger. »Du bist nicht nur der beste, aufmerksamste und liebste Mann, den ich jemals kennen gelernt habe, du bist auch noch der unersättlichste von allen.« Und dann stieß sie einen spitzen Jauchzer aus. »Aber ich mag das so und … und ich liebe dich.«
Dann schlug die Badezimmertür hinter ihr zu.
Ich dachte: Natürlich mag sie es. Sie mag es sogar sehr. Im Gegensatz zu mir.
Ich war ganz und gar nicht unersättlich. Ich musste mich fast stets dazu zwingen, obwohl sie sämtliche Raffinessen des Liebesspiels kannte und einzusetzen wusste.
Ich zog meinen Schlafanzug aus und legte mich aufs Bett.
Sie wollte sich bei mir bedanken. O ja, sie konnte sich bedanken. Allerdings hatte ich da meine eigenen Vorstellungen. Sie konnte sich zum Beispiel vor ein Auto werfen. Sie konnte ins Meer hinausschwimmen, einen Krampf bekommen und ertrinken. Um mir ihren Dank abzustatten, konnte sie sich vom Dach des Hotels in die Tiefe stürzen. Natürlich wäre ich auch zufrieden, wenn sie auf der steilen Treppe, die in die Halle hinunterführte, ausrutschen und sich beim Sturz das Genick brechen würde.
Es gab eine Menge Möglichkeiten, sich bei mir zu bedanken. Wenn es nur ein tödlicher Unfall war.
Aber dann ertappte ich mich bei dem Gedanken, dass mir so etwas gar nicht recht wäre. Ich hatte schließlich vier Monate lang jede Minute meiner Freizeit geopfert, um den Mord vorzubereiten. Ich war stolz auf meinen Plan; er war perfekt und ausgefeilt bis in die letzte Einzelheit. Noch nie in meinem Leben hatte ich so intensiv und verbissen an einer Sache gearbeitet. Ich wollte den perfekten Mord begehen.
Mit einem Ruck setzte ich mich im Bett auf. Ja, das war es! Ich wollte den perfektesten Mord begehen, den es je gab.
Die Badezimmertür öffnete sich, Johanna trat heraus. Mit wippenden Brüsten kam sie auf mich zu. Ich legte mich langsam wieder zurück und sah ihr entgegen. Sie war nicht gerade eine Schönheit. Weder ihr schmales Gesicht mit dem breiten Mund noch ihre Figur war dazu angetan, ein Männerherz sofort höher schlagen zu lassen. Trotzdem schaffte sie es immer wieder, mich in Erregung zu versetzen.
Johanna nahm auf der Bettkante Platz. Um ihren breiten Mund spielte ein betörendes Lächeln. Sie roch wieder nach diesem Parfüm, dessen Duft ich so mochte, dessen Namen ich mir aber nie merken konnte.
Vielleicht war es der Duft des Parfüms, vielleicht auch die Art, wie sie mich streichelte, dass ich sofort in Erregung geriet. Ich weiß es nicht. Jedenfalls war ich ihr in diesen Augenblicken hoffnungslos verfallen.
2. Kapitel
Wir frühstückten um dreiviertel sieben. Den Frühstücksraum hatten wir für uns allein. Es waren ohnehin nur sehr wenige Urlauber auf der Insel. Bei meiner Planung hatte ich das berücksichtigt. Wer macht schon im November Urlaub in der Karibischen See, abseits der Touristenströme auf dieser kleinen, fast vergessenen Insel Eutera. Sie war der ideale Platz für meinen Mord.
Das Personal des kleinen Hotels war sehr freundlich und zuvorkommend. Obwohl es normalerweise erst ab sieben Frühstück gab, wurden wir sofort bedient. Man brachte uns Spiegeleier mit Schinken, Kaffee, Weißbrot und ein Glas Orangensaft. Da ich dem jungen schwarzen Ober gleich nach unserer Ankunft ein saftiges Trinkgeld zugesteckt hatte, überschlug er sich fast vor Diensteifer und Aufmerksamkeit.
Um sieben Uhr fünfzehn waren wir fertig. Ich zündete zwei Zigaretten an, gab Johanna eine und lehnte mich zurück.
»Was steht denn heute auf dem Programm?«, fragte sie.
»Ich würde eine Wanderung am Meer entlang vorschlagen«, antwortete ich. Nie entschied ich selbst, was wir gemeinsam unternehmen wollten. Ich gab ihr immer das Gefühl, als könnte sie das bestimmen. Aber sie hatte nie einen anderen Vorschlag gemacht, die ganzen fünf Tage nicht. Sie hatte bisher allem begeistert zugestimmt, was ich vorschlug. Also erwartete ich auch jetzt nichts anderes als Zustimmung.
Johanna schwieg eine Weile, zog an ihrer Zigarette und stieß den Rauch langsam aus. Dann sagte sie: »Bist du mir böse, wenn ich heute nicht mitgehe? Ich bin nicht ganz auf der Höhe. Meine Migräne macht mir wieder zu schaffen.«
Ich muss sie einen Augenblick angestarrt haben, als wollte ich sie auf der Stelle umbringen, denn plötzlich zuckte sie erschrocken zurück.
»Was ist, habe ich dich verärgert?«, fragte sie unsicher.
Ich schenkte ihr mein charmantestes Lächeln. »Nein, es ist nicht der Rede wert. Ich bin nur ein wenig enttäuscht, weil ich mich so auf die Wanderung gefreut habe. Weißt du, der Strand ist herrlich; links das schäumende, brausende Meer mit den riesigen Wellen, rechts die hohen, steilen Klippen. Ich hätte es mir so schön vorgestellt, mit dir allein … Aber du hast recht; wenn du Migräne hast, ist es besser, wir bleiben hier.« Ich strich ihr zärtlich über die langen blonden Haare. »Ich weiß ja, wie sehr dich deine Migräne immer plagt.«
»Du würdest gern gehen, nicht wahr, Liebling.« Jetzt lächelte sie wieder.
Ich nickte. »Ja.«
»Dann werden wir gehen«, entschied sie. »Ich möchte die Klippen auch sehen und das Meer und die Wellen erleben. Es wird bestimmt schön werden.«
»Nein«, widersprach ich. »Du hast Migräne. Es wäre unsinnig, dich zu etwas zu überreden, von dem du dann doch nichts hast. Wir bleiben hier.«
»Wir gehen«, beharrte sie. »Meine Kopfschmerzen sind so schlimm auch wieder nicht. Ich werde eine Tablette nehmen, dann dürfte es bald besser werden. Die frische Luft wird mir bestimmt guttun.«
Ich triumphierte innerlich. So hatte ich es geplant. Sie musste zum Strand wollen, nicht ich. Und ich als liebender Gatte würde ihren Wunsch natürlich respektieren und sie begleiten.
Ich warf einen Blick zu unserem Kellner hinüber; er saß an einem kleinen Tisch und beobachtete uns. Sicherlich hatte er unser Gespräch verfolgt. Es war wichtig, dass er alles mitbekam. Eines Tages konnte ich ihn vielleicht brauchen. Wenn sich jemals herausstellen sollte, dass mein Plan einen Fehler hatte, konnte die Aussage des Kellners für mich von größter Wichtigkeit sein.
Etwas lauter als vorher sagte ich: »Bitte, sei vernünftig, Liebling. Wenn du nicht ganz auf der Höhe bist, sollten wir hierbleiben. Wir können ein anderes Mal zu den Klippen hinausgehen. Morgen oder übermorgen. Wir haben doch noch so viel Zeit.«
»Ich möchte aber.« Sie lächelte mich an. Das war typisch Frau. Sie wollte ihren Kopf durchsetzen. Jetzt sah es fast so aus, als sei es ihre Idee gewesen, zu den Klippen zu wandern.
Ich überlegte, wie weit ich gehen konnte. Sollte ich gleich nachgeben oder sie noch eine Weile hinhalten? Ich entschloss mich zum Hinhalten.
»Ich weiß nicht recht, Liebling.« Ich schüttelte bedächtig den Kopf. »Während du deinen Mittagsschlaf gehalten hast, bin ich schon zweimal draußen gewesen. Es ist einfach herrlich dort. Eine wildromantische Gegend, aber gefährlich. Es führt nur ein schmaler, sehr schlüpfriger Pfad zum Strand hinunter. Man muss alle fünf Sinne beisammen haben. Wenn man wie du …«
»Liebling«, unterbrach sie mich lächelnd. »Du bist ja bei mir. Und außerdem sind meine Kopfschmerzen fast weg.«
»Ich möchte, dass du Freude an dem Spaziergang hast …«
»Es wird sehr schön werden.«
»Bist du ganz sicher?«
»Ganz sicher.«
Jetzt war der Punkt gekommen, nachzugeben.
»Gut«, lenkte ich ein, »du hast mich überzeugt. Aber du musst mir versprechen, dass du immer dicht bei mir bleibst.«
»Ich verspreche es«, gurrte sie. »Ich werde keinen Schritt von deiner Seite weichen.«
Ich erhob mich. »Nimm wenigstens noch eine Tablette«, bat ich fürsorglich, »damit du auch wirklich keine Kopfschmerzen mehr hast. Es wäre schade, wenn …«
»Ich werde eine Tablette nehmen.«
Sie erhob sich ebenfalls, und ich legte einen Arm um ihre Hüfte. Beim Hinausgehen warf ich einen Blick auf den Ober. Er lächelte. Gut so. Er würde sich an diese Szene erinnern.
In unserem Zimmer nahm ich meine Wanderschuhe aus dem Schrank. Sie hatte auch welche, aber sie wollte die Dinger nicht anziehen. Ich hatte damit gerechnet. Es war wichtig, dass sie die Schuhe bei diesem Spaziergang nicht trug.
Ich getraute mich diesmal nicht, die Prozedur aus dem Frühstücksraum zu wiederholen. Es könnte mir passieren, dass sie auf meine Bitte hin die Schuhe tatsächlich anzog. Außerdem war ja jetzt niemand da, der zuhörte.
Johanna zog ihre Sandaletten an. Sie war der Meinung, die Wanderschuhe passten nicht zu ihren schlanken Beinen.
»Du hast recht, die Sandaletten passen besser zu dir«, lobte ich. »In den Wanderschuhen siehst du aus wie eine Kuhmagd.«
»Siehst du«, triumphierte sie. »Jetzt sagst du es auch. Ich wusste, dass diese schweren Klötze nicht zu mir passen.« Und lächelnd fügte sie hinzu: »Ich kann mich ja an dir festhalten, wenn es gefährlich wird.«
»Klar«, bestätigte ich und küsste sie auf die Wange.
Ich griff nach meiner ledernen Umhängetasche. »Nimm deine Tablette«, erinnerte ich sie.
Johanna kramte ihre Schmerzpillen aus der Handtasche. Während sie nach einem Glas Wasser griff, um die Tablette mit etwas Wasser hinunterzuspülen, kontrollierte ich hastig, ob ich alles hatte. Es war alles da: der Fotoapparat, zwei Blitzgeräte, auch das Auslösekabel. Die Kamera war sehr teuer gewesen. Aber ich hatte sie dennoch gekauft. Ich brauchte einen Fotoapparat, auf den ich mich hundertprozentig verlassen konnte. Und dieser war sehr zuverlässig.
Ich schloss die Tasche und sah zu Johanna hinüber, die am Spiegel stand und sich die Lippen nachzog.
»Bist du fertig, Liebling?«
»Gleich.«
Sie drückte den Deckel auf den Lippenstift, presste die Lippen ein paar Mal zusammen und wandte sich um. Ihr Mund wirkte jetzt noch breiter. Das machte sie bestimmt nicht schöner.
»Wir können gehen«, sagte sie, hängte sich bei mir ein und zog mich zur Tür. Ich schloss das Zimmer ab; den Schlüssel gab ich dem jungen Mann, der gerade den grauhaarigen Nachtportier ablöste. Sie wünschten uns grinsend einen schönen Tag. Wir bedankten uns, und ich grinste zurück.
Draußen wehte eine frische Brise vom Meer her. Der Himmel war blau und fast wolkenlos. Es würde ein schöner Tag werden. Nur nicht für Johanna. Für sie würde es der letzte Tag ihres Lebens sein. Wenn sie es gewusst, ja, wenn sie nur irgendetwas geahnt hätte, dann wäre sie mir davongelaufen, so schnell sie gekonnt hätte. So aber hängte sie sich an meinen Arm und himmelte mich verliebt an.
Wahrscheinlich war ich der erste Mann, der sie gut behandelte. Nun musste auch ich sie enttäuschen. Aber es würde die letzte Enttäuschung in ihrem Leben sein.
Wir brauchten zwanzig Minuten bis zu den Klippen. Auf Anhieb fand ich den schmalen Pfad, der zum Meer hinunterführte und den ich für mein Vorhaben ausgesucht hatte.
»Lass uns hier runtergehen«, schlug ich vor. »Dieser Weg ist der bequemste.«
»Du scheinst dich ja hier gut auszukennen«, meinte sie. »Warst du schon einmal hier?«
Ich starrte sie an. »Wie meinst du das?«
»Ich meine, ob du früher schon mal auf dieser Insel gewesen bist.«
»Ich? Nein, natürlich nicht. Wie kommst du darauf?«
»Weil du dich hier so gut auskennst.«
Ich glaubte, so etwas wie Misstrauen in ihren Augen zu lesen. Ahnte sie etwas? Nein, das war völlig ausgeschlossen. Ich hatte bei allem, was ich getan und gesagt hatte, äußerste Vorsicht walten lassen. Sie konnte nichts ahnen.
Und dann fiel mir auch ein, woher das kam. Eine Frau wie sie musste einfach misstrauisch sein.
Ich schenkte ihr mein charmantes Lächeln, von dem ich wusste, dass sie ihm nicht widerstehen konnte. Und so war es denn auch. Das Misstrauen schwand aus ihren Augen.
»Aber Liebling«, sagte ich außerdem beruhigend, »Ich habe dir doch erzählt, dass ich schon zweimal hier draußen war, während du deinen Mittagsschlaf gehalten hast. Da muss ich mich doch ein wenig auskennen.«
Dass ich auch nachts zweimal in den Klippen gewesen war, brauchte ich ihr ja nicht auf die Nase zu binden.
»Nachts warst du auch mal hier«, sagte sie plötzlich lächelnd.
Ich stand wie vom Donner gerührt. Diese verdammte Hexe! dachte ich. Hat sie es also doch gemerkt. Aber ich fasste mich sofort wieder. Die Tatsache, dass sie um meine nächtlichen Wanderungen wusste, war kein Grund zur Panik.
»Ich soll nachts hier draußen gewesen sein?« Lächelnd tippte ich mit dem Finger gegen meine Stirn. »Ich bin doch nicht verrückt. Wer nachts in diesen steilen und scharfkantigen Klippen herumklettert, muss doch lebensmüde sein, und das bin ich bestimmt nicht. Gut, ich bin schon nachts aufgestanden, habe mich angezogen und bin nach unten gegangen, weil ich nicht schlafen konnte. Aber ich war bestimmt nicht hier.«
»Nun reg dich doch nicht auf«, beschwichtigte Johanna. »Ich habe das doch nur so dahergesagt.«
»Ich muss mich schließlich wehren, wenn du der Meinung bist, ich wäre ein Selbstmörder«, erklärte ich.
»Ist doch Quatsch.« Sie hakte sich wieder bei mir unter. »Komm, lass uns runtersteigen.«
»Okay.« Ich ging bis zum Rand der Klippen. Gut fünfzig Meter unter uns rauschte die Brandung. Meterhohe Wellen wurden von spitzen, vereinzelt aus dem Wasser ragenden Felsen geteilt und liefen dann langsam im Sandstrand aus.
»Du hattest recht«, seufzte Johanna hingerissen. »Hier ist es herrlich.«
Ich lachte. »Ich habe immer recht.«
»Natürlich«, erwiderte sie ergeben lächelnd. »Du hast immer recht.«
Vorsichtig betrat ich den Pfad. »Bleib immer dicht hinter mir«, mahnte ich.
Sie krallte sich an meinem Gürtel fest und hinderte mich am Gehen. Nach ein paar Metern wären wir um ein Haar beide abgestürzt, weil sie stolperte und mich nach vorne stieß. Ich konnte mich gerade noch an einer Felsenkante festhalten und riss mir dabei die rechte Hand auf.
Als wir das Gleichgewicht wiedergefunden hatten, war ich plötzlich so wütend, dass ich sie am liebsten geschlagen hätte. Aber ich riss mich zusammen, so gut ich konnte. »Bitte, Liebling, halte dich nicht mehr an mir fest«, sagte ich, »sonst stürzen wir noch ab. Du hast ja eben gesehen, was passieren kann.«
»Ich werde mich nicht mehr an dir festhalten«, versprach sie kleinlaut. »Und ich werde jetzt auch besser aufpassen.«
»Hoffentlich«, knurrte ich.
Wir gingen langsam weiter. Sie blieb immer einen Schritt hinter mir und trampelte mir nicht mehr auf den Hacken herum. An einigen besonders steilen und gefährlichen Stellen drehte ich mich um, reichte ihr meine Hand und half ihr vorsichtig weiter. Sie lächelte mir dankbar zu.
Und dann standen wir an der Stelle, die ich mir ausgesucht hatte, an der alles vorbereitet war. Genau an dieser Stelle musste es geschehen. An keinem anderen Platz der Welt hätte ich sie umbringen können, nur hier.
Ich blieb stehen. Meine Handflächen wurden feucht, und ich wischte sie mit einer fahrigen Bewegung an meinen Hosenbeinen ab. Ich fühlte, dass ich zitterte.
Jetzt musst du etwas sagen, dachte ich. Vielleicht, dass wir hier etwas rasten oder den Ausblick genießen wollen oder so. Einfach irgendwas. Sie könnte sonst wieder misstrauisch werden. Aber ich brachte keinen Ton über die Lippen. Meine Kehle war wie zugeschnürt.
»Was ist los, Paul?«, fragte Johanna hinter mir. »Warum gehst du nicht weiter?«
Ich riss mich zusammen. »Sieh dir mal das Meer an.« Meine Stimme klang ein wenig heiser und gepresst. »Ist es nicht schön?«
»Ja, Paul«, sagte Johanna leise und schmiegte sich an meine Schulter. »Es ist wunderschön hier.«
Jetzt wusste ich, dass sie den veränderten Ton in meiner Stimme nicht bemerkt hatte. Ich spürte, wie mein Zittern nachließ. Jetzt konnte ich mich ihr zuwenden, ohne dass sie eine Veränderung in meinem Gesicht bemerken würde.
Ich hatte sie richtig eingeschätzt. Sie bemerkte nichts. Lächelnd lehnte sie sich an mich, legte ihre Wange an meine Schulter und blickte aufs Meer hinaus.
Ich tat, als bemerkte ich erst jetzt das etwa zwei Quadratmeter große Plateau zu unserer Linken.
»Sieh mal, Johanna!«, sagte ich. »Das Plateau. Das kommt uns wie gerufen. Lass uns ein wenig hierbleiben. Der Blick von hier aufs Meer ist einfach zu schön.«
Sie stimmte sofort zu. Ich zog meine Jacke aus und legte sie auf den blanken Felsen. Wir setzten uns.
Irgendwie musste es jetzt weitergehen.