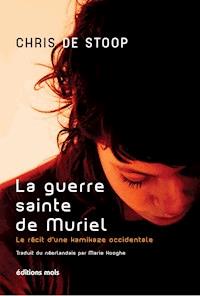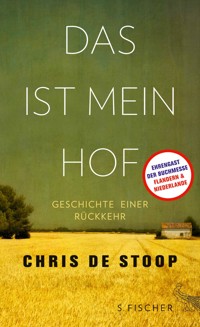
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Chris de Stoop hat mit seinem Buch ›Das ist mein Hof. Geschichte einer Rückkehr‹, ein Bestseller in den Niederlanden, eine brillante literarische Reportage über das Verschwinden der bäuerlichen Lebensform geschrieben. Chris de Stoop verbrachte seine Kindheit auf dem Bauernhof. Er liebte das Herumstromern mit seinem Bruder, den Geruch in den Ställen. Als sein Bruder den Hof übernahm, zog es ihn in die Ferne. Als Journalist war er in der ganzen Welt unterwegs. Doch als sein Bruder stirbt, kehrt er zurück auf den elterlichen Hof. Schmerzlich realisiert er, wie die Welt seiner Kindheit immer mehr verdrängt wurde und ein Leben als Bauer nicht mehr möglich ist. Einfühlsam stellt er diesen Verlust dar, indem er erzählerisch gekonnt zwischen seinen farbigen Erinnerungen und der harten Realität von Zwangsenteignung und Umsiedlung wechselt. Eine ebenso persönliche wie berührende Geschichte von der Sehnsucht nach einem Leben auf dem Land und dem europaweiten Verschwinden kultivierter Landschaften.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 368
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Chris de Stoop
Das ist mein Hof
Geschichte einer Rückkehr
Über dieses Buch
Chris de Stoop verbrachte seine Kindheit auf dem Bauernhof. Er liebte das Herumstromern mit seinem Bruder, den Geruch in den Ställen. Als sein Bruder den Hof übernahm, zog es ihn in die Ferne. Als Journalist war er in der ganzen Welt unterwegs. Doch als sein Bruder stirbt, kehrt er zurück auf den elterlichen Hof. Schmerzlich realisiert er, wie die Welt seiner Kindheit immer mehr verdrängt wurde und ein Leben als Bauer nicht mehr möglich ist. Einfühlsam stellt er diesen Verlust dar, indem er erzählerisch gekonnt zwischen seinen farbigen Erinnerungen und der harten Realität von Zwangsenteignung und Umsiedlung wechselt. Eine ebenso persönliche wie berührende Geschichte von der Sehnsucht nach einem Leben auf dem Land und dem europaweiten Verschwinden kultivierter Landschaften.
Chris de Stoop ist ein genauer, äußerst feinsinniger Beobachter und großartiger Erzähler, sein Bericht ebenso ergreifend wie persönlich.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Chris de Stoop, Jahrgang 1958, ist ein belgischer investigativer Journalist, der bekannt dafür ist, schwierige Themen mit großer Hingabe und Einfühlungsvermögen zu behandeln. ›Das ist mein Hof‹ stand mehrere Wochen auf der Bestsellerliste in den Niederlanden.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de.
Impressum
Dieses Buch wurde mit Unterstützung des Flämischen Literaturfonds herausgegeben (www.flemishliterature.be)
Erschienen bei FISCHER E-Books
Covergestaltung: buxdesign | München nach einer Idee von Brigitte Slangen
Coverabbildung: © Paul Grand/Trevillion Images
Karte: Peter Palm, Berlin
Die niederländische Originalausgabe erschien 2015 unter dem Titel
»Dit is mijn hof« im Verlag De Bezige Bij, Amsterdam / Antwerpen
© 2015 Chris de Stoop
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2016 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-490204-3
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Für meinen Bruder
[Kapitel]
1. Prolog
2. Zaligem. Die Weite
3. Der Phönix
4. Zaligem. Arbeit adelt
5. Verlorene Dinge
6. Zaligem. Fahnenflucht
7. Das Geisterdorf
8. Zaligem. Die Razzia
9. Der Ökozentrismus
10. Zaligem. Das Klappergestell
11. Epilog
Literatur
Für meinen Bruder
»Ich habe mich ein bisschen umgesehen und herumgefragt«, sagte Casy. »Was ist denn hier passiert?
Weshalb jagt man denn die Leute von ihrem Land?«
– John Steinbeck, Früchte des Zorns
1.Prolog
Hier stehen wir nun, mein Bruder und ich, am späten Nachmittag, tief im Schlamm, blau vor Kälte, und rufen die Kühe, »kommt, kommt, kommt«, während hinter uns plötzlich Kugeln auf das Stalldach prasseln. Instinktiv ducken wir uns und schauen uns um. Zwischen übervollen Wassergräben erstrecken sich vor uns die abgesoffenen Felder und Wiesen bis zum Horizont. Das einzig Ungewöhnliche, das wir hinter dem Zaun sehen, ist ein Bulldozer auf der anderen Seite der Weide.
Die älteren Kühe lassen sich willig zusammentreiben. Sie hören noch auf ihre Rufnamen wie Stampffuß, Spitzhorn oder Weißkopf, und sie kennen die Winterzeit im warmen Stall. Behäbig waten sie durch das Gatter in den Hof, vorbei an dem langen, frischen Mais-Silo, aus dem ein bittersüßer Geruch wie nasser Dampf in die Luft aufsteigt. Mit ihren dicken Hintern schwanken sie wackelnd und vor Zufriedenheit brummelnd in den Stall, geradewegs zum Trog, um Heu zu fressen.
Die sieben jungen Färsen mit den noch glänzenden orangefarbenen Chips in den Ohren lassen sich jedoch nicht einmal mit Stockhieben zu dem Gatter hinübertreiben, durch das sie im September zum ersten Mal, gemeinsam mit dem Zuchtbullen, auf die Weide gekommen waren. Mit den Armen fuchtelnd, scheuchen wir sie auf, rufen und zetern, rutschen aus und werden klatschnass. Im nächsten Moment drehen sie sich um und stürmen an uns vorbei. Laut muhend laufen sie in alle Richtungen davon. Und weil es schon seit unseren Kindertagen ausgemachte Sache ist, dass mein Bruder der Stärkere ist, aber ich der Schnellere bin, fällt es wie immer mir zu, hinter ihnen herzurennen.
Der Wind frischt auf, ich springe über die Grasbüschel am Rand einer Riesenpfütze, verliere mein Gleichgewicht und falle der Länge nach in den Schlamm. Erschöpft betrachte ich eine halbe Minute lang die großen Flächen, grau und schwarz, die sich über mir im Himmel ineinanderschieben. Wie oft wir das schon gemacht haben! Ich fand es immer großartig, gemeinsam mit meinem Bruder die Herde in den Stall zu treiben oder sie hinauszulassen. Dafür bekomme ich alle paar Jahre ein Rinderhinterviertel. Nicht von der besten Kuh, die viel Geld wert ist, sondern von der schlechtesten. Ich habe mir extra eine Kühltruhe gekauft und esse manchmal monatelang Rindfleisch, bis es mir zum Halse raushängt – was umso schneller geschieht, wenn ich die fragliche Kuh gut gekannt habe.
Indem wir den Weidezaun an einer anderen Stelle weit öffnen, gelingt es uns schließlich, die Färsen über einen Umweg zum Hof zu treiben – ein oft erprobtes Ablenkungsmanöver. Mein Bruder streut mit der Gabel Heu aus und lockt das Vieh so in den Stall. Als auch das letzte Tier hineingetrottet ist, schieben wir rasch den Riegel vor. Todmüde lehnen wir uns an die Stallwand, von der die untere Hälfte vom Mist ganz schwarz ist. Wir glänzen vor Schweiß und Dreck.
Auch wenn ich schon seit zwanzig Jahren nicht mehr rauche, drehe ich nun eine Zigarette, gemeinsam mit ihm. Eine dünne, denn er ist sparsam mit seinem Tabak und schaut mir auf die Finger. Wir rauchen und röcheln, ohne ein Wort zu sagen.
Das Vieh ist nun weg von der Weide, und nur der Bulldozer bleibt im Regen zurück, der allmählich in nassen Schnee übergeht. Drinnen zwischen den dampfenden Kuhleibern ist es behaglich. Aber dieses Mal plaudern wir nicht wie früher mit Befriedigung über die ganze Aktion, wärmen nicht endlos auf, wie heikel es gewesen ist und wie wild sie waren und wie viel Glück wir hatten, dass wir die Tiere wieder in den Stall bekommen haben, nein.
»Das mit der Landwirtschaft geht zu Ende«, sagt mein Bruder zum x-ten Mal mit einem Gesichtsausdruck zwischen Schrecken und Groll. »Sie wollen uns weghaben.«
»Noch lange nicht«, sage ich.
Wir schweigen wieder und blicken uns im Stall um, in dem sich an den verbogenen Rohren und rostigen Tränken der Verfall immer deutlicher zeigt. Die Kühe haben sich schon hingelegt, dicht beieinander, den schweren Kopf auf dem Bauch der nächsten Kuh. Sie sehen uns mit glänzenden Augen an. Ihr Atem steigt in Dampfwolken auf. Die jungen Färsen sind noch unruhig. Manchmal halten sie die Krätze nicht mehr aus und scheuern sich an den Wänden. Manchmal krümmen sie den Rücken und heben den Schwanz in die Höhe, um plätschernd zu pinkeln und zu scheißen. Es spritzt in unsere Gesichter.
»Brave Tiere«, sage ich verkrampft, um ihn einzuwickeln. »Ein schöner, in sich geschlossener und gesunder Betrieb für die Mutterkuhhaltung. Was will ein Bauer mehr?«
»Sie haben die Scheißerei«, sagt er, »und der Bauernhof läuft nicht mehr.«
Der Betrieb braucht eine neue Umweltgenehmigung, und mein Bruder fürchtet, dass der alte offene Misthaufen zum Problem wird, dass sie sagen werden, die Jauche sickere in den Boden, der Misthaufen sei nicht abgedeckt, die Nachbarn stören sich an dem Gestank. Und wie es mit der Ammoniakemission und der Stickstoffdeposition stehe?
Ich gehe hinaus zum Pinkeln. Nichts ist so entspannend, wie gegen einen Baum oder Strauch zu pinkeln, Eichel im Wind, eins mit der Natur, frei wie ein Vogel. »Die Blumen gehen davon kaputt, ihr Rotznasen«, rief Ma früher. Aber wir Rotznasen mit unseren pickligen Gesichtern taten es, um unser Territorium abzustecken, beim nächsten Mal wieder. Ich war vier, fünf Jahre alt, als mein Bruder mir grinsend vorschlug, auf den Weidedraht zu pinkeln. Ein klassisches, albernes Spiel unter Bauernkindern, das wusste ich wohl. Ein Stromstoß fuhr durch meinen Penis, als hätte der Blitz eingeschlagen.
Jetzt sitzt mein Bruder auf der niedrigen Mauer neben dem alten Schweinestall, seinem Lieblingsplatz, von dem man die Kühe sehen kann, sowohl im offenen Laufstall als auch auf der Weide hinter dem Obstgarten. So hat er im Auge, ob sie brünstig sind oder trächtig oder kurz vorm Kalben. Ich setze mich neben ihn. Zusammen betrachten wir die Tiere. Wie wir da so sitzen, übermannt mich wieder die Wehmut, die manchmal an mir klebt. Ein Gefühl, das viel mehr umfasst als nur Familie, es geht um den Hof und die Felder und die kleinen Wasserläufe, es geht um das Leben, das mit dem Land und der Luft zusammenhängt, es geht um all das Alte und Vertraute, das hier immer schon gewesen ist.
Ich überlege, wie schön es doch ist, mit so großen, gutmütigen Tieren zusammenzuleben, wie man es hier seit Menschengedenken macht, und ich frage mich, ob irgendwann, wenn alle Vegetarier sind, Fleisch im Labor gezüchtet wird oder der letzte Bauer ausgestorben ist, der Tag kommen wird, an dem wir uns nicht mehr vorstellen können, jemals tausend Kilo schwere Kühe als Haustiere gehabt zu haben. Und ob wir das bedauern würden.
Hinter uns im Gebüsch ertönt der heisere Ruf eines Fasans. Ein Vogelschwarm zieht über uns hinweg, sind es Kiebitze? Nein, Tauben.
Wieder fallen Schüsse. Ich springe auf und höre eine Ladung kleiner Schrotkugeln auf dem Wellblech aufschlagen. Ein scharfes, prasselndes Geräusch, als würde ein Eimer Murmeln über das Dach gekippt. Links und rechts fallen angeschossene Tauben vom Himmel, manche gurren noch, andere in Fetzen, durch einen kräftigen Kugelhagel am Flug gehindert.
Natürlich, es ist der Jäger, dieser komische Kauz. Vom Erlenhain aus schießt er auf Ringeltauben. Bekämpft er sie nicht, kann er für den Schaden, den sie anrichten, persönlich zur Rechenschaft gezogen werden. Ma hat ihn früher ein paarmal angerufen, wenn die Tauben im Gebälk des Kuhstalls ihre Nester gebaut und sich wie Ratten vermehrt haben. Sie scheißen alles voll, sogar die Kühe. Die zuvor braunen Gitter und Gatter sind dann weiß vor Taubendreck.
»Es ist eine Schande«, murre ich. »Ein Blutbad.«
Mit großen Schritten geht mein Bruder in das Haus, in dem er schon – bis auf das eine Jahr Militärdienst – sein ganzes Leben wohnt, das aber mit einem Mal anders aussieht und sich anders anfühlt. Jetzt herrscht hier ein Durcheinander. Krimskrams auf dem Tisch, schimmelige Teller im Spülbecken, Spinnweben vor den Fensterscheiben. Denn Ma, die immer für ihn gesorgt hat, liegt nun, festgeschnallt an ein Krankenhausbett, zwischen summenden und brummenden Apparaten. Ma war immer da, um zu reden, über das Wetter und das Vieh, über die Ernte und alle anderen Bauernfragen. Tatsache ist, dass er nun zum ersten Mal in seinem Leben allein ist. Und allein sein ist nichts für ihn, und noch weniger für Ma. Für mich schon, ich bin gut im Alleinsein. Aber er klagt nicht, er hat noch genug Tabak, und die Kühltruhe ist voll.
Regen und Wind peitschen um das alte Bauernhaus, die Dachrinnen klappern, die triefenden Sparren vor dem Fenster wanken und knarzen. Mein Bruder klopft mit dem Fingerknöchel gegen das Barometer, so wie Pa es früher getan hat. Die Nadel springt auf »schlechtes Wetter«. Auch der Wetterbericht im Radio sagt für die kommenden Tage viel Schnee und strengen Frost voraus. Dann könnten die Tränken der Kühe zufrieren, und er muss den Tieren tagelang Wasser mit dem Eimer geben. Es wird ein scheußlicher Winter.
»Eine normale Jahreszeit gibt es nicht mehr«, sagt er.
»Der Wettermann kann sich irren«, beschwichtige ich.
Wir sitzen am Ofen, wie eh und je, mein Bruder halb versunken in seinem schwarzen Ledersofa, eine Hand unterm Kinn, Rauch umhüllt den Kopf. Er tut mir leid.
»Ma ist kaputt«, sagt er. »Das wird nicht mehr. Die kommt nicht mehr wieder.«
»Das wissen wir doch nicht.«
Er drückt seine Zigarette aus und dreht sich sofort die nächste. Dann sagt er etwas, das sich eigentlich nicht bestreiten lässt. »Dies ist ein Familienbetrieb.«
Aber ich bestreite es doch. »Komm schon, das ist dein Hof. Schon seit Jahren.«
»Das ist unser Hof«, sagt er mit Nachdruck, als hätte er es vorher geübt.
»Ja«, gebe ich zu und stehe auf, »so ist es. Es ist ein Familienbetrieb.«
»Sag mal«, fragt er dann mit geschlossenen Augen, »wann fährst du wieder?«
»Übermorgen«, sage ich vorsichtig. »Nach Haiti. Wegen des Erdbebens. Schauen, wie die Kleinbauern dort überleben.«
Er mochte es noch nie, mein Gerede über Reisen. Als wäre schon das eine Form von Fahnenflucht. War es hier etwa nicht interessant genug?
Aber heute kommt kein Wort des Protests. Er nickt, geht nicht darauf ein. Wir sprechen fast nie über meine Welt, immer über seine. Unsere.
Und so lasse ich ihn zurück mit seinem eine Woche alten Stoppelbart, den nikotingelben Fingern und der Stirn voller horizontaler Falten, die aussehen wie Notenlinien. Als ich ins Auto steige, watscheln laut schnatternd ein paar Gänse über den Hof. »Da sind die Frostgänse«, sagte Ma früher. »Haltet euch an den Baumästen fest, denn es gibt Frost, dass es kracht.«
2.Zaligem. Die Weite
Ich habe Ma auf die Toilette gesetzt. Wie ein lahmer Vogel sitzt sie auf der Schüssel, mit einem vor Sorge verzerrten Gesicht. Sie leidet an Konstipation, und wenn ich ihr das glauben soll, sind die Schmerzen schlimmer als bei meiner Geburt. Nach zehn vergeblichen Minuten bittet sie mich, sie in ihr Zimmer zu bringen.
»Der Bauernhof ist verloren«, sagt sie wieder. »Sechzig Jahre habe ich den Hof bewirtschaftet. Und das gerne.«
»Noch mit achtzig die Kälber versorgt«, sage ich.
»Tausende Kälber habe ich aufgezogen. Zehntausende Ferkel. Kühe gemolken. Jeden Tag den Entrahmer und die Melkmaschine gewaschen.«
»Und den Haushalt gemacht.«
»Getreidegarben binden, Kartoffeln lesen, Rüben jäten. In der brennenden Sonne. Im schlimmsten Regen. Bei jedem Wetter.«
»Kein Sitzfleisch besessen.«
»Ein Pferdezahn und eine Frauenhand stehen nie still, lautet ein Sprichwort. Ausgehen gab es nicht, die Tiere gingen immer vor.«
»Und die Kinder.«
»Bis zum Schluss habe ich mich um den Gemüsegarten gekümmert. Jetzt kann ich nichts mehr. Nicht mehr laufen. Nicht mehr aufstehen. Mich nicht mehr waschen.«
Ma fasst sich an den Bauch. »Nicht einmal mehr auf die Toilette gehen.«
Sie sieht mir tief in die Augen. »Ich kann nicht einmal mehr weinen.« Sie hat fast all ihre Körperfunktionen eingebüßt, aber das findet sie im Moment das Schlimmste. Danach sehnt sie sich mit all der Kraft, die sie noch hat. Wieder weinen können.
Sie sitzt beim Balkon, mit Sicht auf die gewaltige Marienstatue auf der Spitze des Kirchturms, im Volksmund wegen der Unmengen an Blattgold Goldmarie genannt. Es ist jetzt ein paar Monate her, seit wir zum letzten Mal die Kühe in den Stall getrieben haben. Es hat tatsächlich starken Frost und Schnee gegeben und auch Ma ist nicht mehr auf den Bauernhof zurückgekehrt. Sie hat jetzt ein Zimmer im Pflegeheim Het Hof, das die Schwestern der Heiligen Familie in der Hofstraat in Sint-Niklaas leiten. Mit viel Wärme und Zuneigung wurde sie von den Nonnen und Pflegerinnen aufgenommen.
Ma, die nie eine Minute stillsitzen konnte, die immer Energie für zwei hatte, ist nun an einen Rollstuhl gefesselt. Die Osteoporose hat sie im Griff. Ihre Knochen sind nahezu entkalkt und brüchig wie Schilfrohr im Winter. Sie ist gestürzt und hat sich die Kniescheibe, die Hüfte und das Becken gebrochen. Mein Bruder hatte ihr an dem Morgen erst beim Ankleiden geholfen und danach die Kühe gefüttert. Als er wieder aus dem Stall kam, fand er sie auf dem Boden. Er hob sie hoch und rief den Doktor an. Als sie aus dem Haus getragen wurde, richtete sie sich auf und rief ihm zu: »Ich komme wieder.« Eine Operation an der Kniescheibe missglückte, und bei dem Rest hat man es gar nicht erst probiert. Nichts verheilt mehr.
»Ich habe seit heute früh alle offiziellen Dokumente zusammen«, sage ich.
»Und?« Sie sieht mich mit glasigen Augen an.
»Ich bin ab heute sozusagen Landwirt im Nebenberuf. Teilzeitbauer. Ich habe eine Firma, die ich auch Het Hof genannt habe. Ich habe eine Betriebsnummer und kann gleich anfangen.«
Das heitert sie auf. Um ihren Mund spielt ein schwaches Lächeln, das sie erst noch vergeblich zu unterdrücken versucht. Das erste Mal seit Monaten. »Du, der immer seine Nase nur in Bücher gesteckt hat. Und nun Bauer?«
»Ja, aber ohne viel Sachverstand.«
»Jede Kuh hat mal als Kalb angefangen.«
»Es ist ja nur für eine Weile, um alles zusammenzuhalten.«
Solange sie noch lebt. Das sage ich nicht, aber das ist der Plan. Ihren Bauernhof und das Land instand halten, zwischendurch schreiben, und endlich wieder in den Polder hinein.
Ma wimmert vor Bauchweh, sie muss dringend auf die Toilette. Ich schiebe sie ins Badezimmer. Als sie fertig ist, ziehe ich schnell mit geschlossenen Augen die Spülung. Kaum wieder beim Balkon sitzend, fragt sie besorgt nach der Farbe ihres Stuhlgangs. Ich bleibe ihr die Antwort schuldig.
»War es viel?«, fragt sie mit Nachdruck.
Ich schweige.
»Ich bin doch deine Mutter«, ruft sie. Lautlos fängt sie zu weinen an, ohne Tränen, aber mit zusammengekniffenen Augen und zuckenden Schultern.
»Ja, Ma, es war viel. Sehr viel, Ma. Es war enorm, Ma.«
»Geh schon«, sagt sie leise und erleichtert. »Geh zu unserem Hof.«
Wenn ich auf dem Weg zum Polder bin, werde ich zum Schrecken der Straße. Sobald die Mauern der Bürogebäude und Firmengelände, die Lastwagenkolonnen mit ihren Containern, die Verkehrsknotenpunkte von Bahn und Schnellstraßen im Hafengebiet hinter mir liegen und ich die Ausfahrt beim Polderhuis nehme, überkommt mich große Freude und Aufregung. Auf dem Schlängelweg durch Verrebroek und Meerdonk bis nach Sint-Gillis nehmen meine Augen alles begierig auf: Felder und Weiden, Grachten und Deiche. Sie haben meine ganze Aufmerksamkeit genau wie die toten Bauernhöfe, die kaputten Stallungen und die aufgerissenen Scheunen. Wie andere Männer Frauen hinterherschauen, so schaue ich sanftmütigen Kühen und wuchtigen Traktoren nach – bis ich von der Straße abkomme und mit einem Rad in einer Böschung oder im Graben lande.
Woher bloß kommt das Verlangen, das diese Landschaft in mir hervorruft? Was ich sehe, ist für mich offensichtlich von großer Wichtigkeit. Weil sie mit mir und meiner Familie zu tun hat? Sofort bin ich wieder Teil von ihr, auch wenn ich schon seit meiner Studentenzeit weg bin. Dann kommt das Polderkind in mir hoch. Dann breitet sich wieder diese Weite in mir aus.
Sehe ich den Zaligempolder, in dem ich aufgewachsen bin, vor mir liegen, ist der Höhepunkt erreicht. Ich genieße es, unser Feld zu begutachten, unter dem das Kloster liegt, das diese Gegend vor knapp tausend Jahren urbar gemacht hat. Und ich genieße es, auf unseren Hof in der Kemphoekstraat zu fahren. Das große blaue Tor mit den weißen Gitterstäben lässt sich quietschend öffnen. Der Briefkasten, eine Milchkanne mit ausgefrästem Schlitz, ist voll mit Werbebroschüren. Der riesige Nussbaum, der zweihundert Jahre wie ein Wachposten neben dem Tor gestanden hat, wurde vor ein paar Jahren gefällt. Er war krank und morsch, und die Feuerwehr beanstandete seine überhängenden Äste. Das tat weh, denn es erschien wie eine Vorahnung vom Ende des Landwirtschaftsbetriebs.
Der Bauernhof hat sich seine traditionelle Hufeisenform bewahrt. Das längliche Wohnhaus steht abgewandt in einiger Entfernung von der Straße. Die Fassade zeigt Richtung Süden, um möglichst viel Sonne einzufangen. Dem Haus gegenüber steht eine gewaltige Scheune, die fast fünfzig Meter lang und zehn Meter hoch ist, mit einem großen Satteldach aus fünftausend roten Ziegeln, grün gestrichenen Toren, Türen und Fensterläden. Eine identische Scheune hat einmal im rechten Winkel zum Haus gestanden, wurde aber bei einem schweren Sturm zerstört und durch eine moderne Lagerhalle ersetzt. Die Straßenseite des Gehöfts ist offen und wird nur von einer dichten Ligusterhecke abgeschirmt, die immer grün und voller Vögel ist.
Ich mache den Ofen sauber, damit er wieder richtig zieht. In seinen Boden haben sich Ruß und Asche eingebrannt. Mit Genugtuung registriere ich, wie mir die Glut ins Gesicht schlägt und wieder Rauch aus dem Schornstein steigt. Der Ölofen steht in einem großen, flämischen Kamin mit schwarzer Holzeinrahmung und gemauerter Innenwand. Vor langer Zeit ist es noch ein offener Kamin gewesen. Als ich klein war, stand hier ein »Löwener Ofen«, ein gusseiserner Ofen, der nicht nur dazu diente, das Haus zu beheizen, sondern auf dem man auch kochen konnte. Abends saßen wir alle um ihn herum, die bestrumpften Füße unter dem glühenden Rohr. Dieser Platz war das Herzstück des Bauernhofs und der Familie, und er ist es noch.
Neben dem Kamin gibt es zwei gefirnisste braune Türen. Die linke führt hinunter zum Gewölbekeller, einer düsteren, feuchten Welt, wo noch immer das Pökelfass steht, in dem früher das gesalzene Fleisch aufbewahrt wurde. Auf dem Regalbrett über der Kellertreppe liegen noch einige Päckchen Tabak von meinem Bruder. Außer den Hosenträgern meines Vaters finde ich dort auch die alte, rostige Haarschneidemaschine, die bei mir einen kleinen Erinnerungsschock auslöst.
Die rechte Tür führt zur Voute, dem immer klammen und kühlen Zimmer im Halbgeschoss über dem Keller, in dem mein Bruder und ich geschlafen haben. Durch die aus dem Keller aufsteigende Feuchtigkeit hatten wir im Winter Eisblumen an den Fenstern. Manchmal legten wir einen erhitzten und in Zeitungspapier gewickelten Backstein ans Fußende, der noch lange Wärme verströmte. Dann lagen wir unter einem Berg aus Decken, die Füße an dem heißen Stein, sicher in unserem stinkenden Nest, und schütteten uns aus vor Lachen, weil mein Bruder wieder irgendwelchen Unsinn verzapfte oder schlüpfrige Bemerkungen machte.
Morgens stand Ma an der Treppe zu unserem Voutezimmer und sang »Auf-wachen, auf-wachen, Zeit zum Weitermachen«, mit Betonung auf der ersten Silbe, die Stimme höher beim Wort »weiter«, dann wieder tief. Ohne Ma hätten wir unsere Abschlüsse nie geschafft. Es war Ma, die uns studieren schickte, und es war der Bauernhof, der uns das Studium finanzierte. Wenn Ma sang, sprangen wir aus dem Bett und wuschen uns im Hinterhaus an der Pumpe. Mit den Händen formten wir eine Schale, füllten sie mit kaltem Wasser, und wie Spatzen in einer Pfütze tauchten wir die Gesichter hinein. Meistens war das Wasser aus der Pumpe klar, aber manchmal war es trüb und hatte einen unangenehmen Geruch. Ab und zu glitten Schnecken durch den Ausguss. Wasserleitungen wurden zuerst in den Ställen verlegt und später dann im Wohnhaus.
Pa, ein nüchterner, starker Mann, war nicht so sehr ein Kopfarbeiter, sondern vielmehr für die praktischen Dinge begabt. Am Küchentisch packte er uns und setzte uns verkehrt herum auf die Stühle, die Rückenlehne vor der Brust. Dann holte er zu unserem Grauen die Haarschneidemaschine aus dem Schrank. So ein mechanisches Ding, das noch wie eine Schere zusammengedrückt wurde. Es tat weh, weil die Haare immer zwischen den Zähnen der Maschine stecken blieben. Mein Bruder, gut drei Jahre älter als ich, wehrte sich am heftigsten, aber da war nichts zu machen. Mit ein paar schnellen, kräftigen Bahnen schor Pa uns so gut wie kahl. »Bürstenschnitt«, lachte er.
In jenen langhaarigen Zeiten schämten wir uns zu Tode, und zogen uns, wenn wir zur Schule radelten, die Mützen tief über die Ohren. Ausgelacht wurden wir trotzdem. »Stachelschweine« war noch eine der freundlicheren Beschimpfungen. Der schlimmste Spötter wurde eines Morgens vom Flachskopf, einem leicht aufbrausenden Lehrer mit blondem Haar, mit der flachen Hand so heftig geschlagen, dass er gegen die Wand rumpelte. In jener Zeit brauchte man auf dem Land noch keine Pillen, um überdrehte Kinder zur Ordnung zu rufen. Ma schlug uns nie, Pa jedoch erteilte uns schon manches Mal die Absolution mit einer schallenden Ohrfeige.
Und jetzt räume ich das Gerümpel im Wohnzimmer auf, schrubbe den Fußboden, fege die Spinnweben von Wänden und Fenstern. Früher hat es noch eine extra »gute Stube« an der Vorderseite gegeben, in der man fast nie sitzen durfte, außer wenn wir Besuch hatten oder ein Fest ausgerichtet wurde. Aber vor langer Zeit wurde die Zwischenwand eingerissen, und so entstand ein einziger großer Wohnraum. Licht fällt von allen Seiten durch die Fenster. Mit nur einer Kopfbewegung blickt man auf den Hof, den Blumengarten, die Straße und die Felder.
Die mit Holzplatten und -brettern verkleidete Decke wird von einem schweren Mutterbalken getragen, ein vollständiger, grob gesägter und schwarz verräucherter Baumstamm. Kopfüber erkennt man die Knorren und Risse in der uralten Eiche. Wenn es lange und stark regnet, tropft manchmal Wasser durch seine Ritzen.
Ich drehe den Ofen auf die höchste Stufe. Ich sitze auf dem schwarzen Sofa, auf dem mein Bruder immer gesessen hat, blicke über den nassen Hof und höre den Vögeln draußen zu. Ein paar Dohlen machen im alten Kirschbaum Rabatz. Eine Amsel zwitschert hoch und hell auf dem Scheunendach. Und hinter dem Kippwagen scharrt piepsend ein einbeiniges Teichhuhn.
Ich genieße die Wärme. Ich fühle mich wie damals. Ich bin wieder da.
Auf unseren Bauernhof waren wir alle mächtig stolz, besonders aber auf den großen Misthaufen, der den Mittelpunkt bildete und die anderen Bauern vor Neid erblassen ließ. Je mehr Mist, umso mehr Kühe im Stall, desto mehr Ertrag auf den Feldern. »Mist ist der Gott der Landwirtschaft«, hat man früher gesagt. Und: »Wer nicht mistet, vermisst.« Eine Quelle des Reichtums also, und wenn man bedenkt, dass eine tüchtige Kuh einige Dutzend Kilo Mist am Tag produzieren kann …
Auch jetzt ist dort wieder ein meterhoher Misthaufen, noch bevor ich teils mit Traktor und Frontlader, teils mit Schaufel und Gabel die Kuhställe gesäubert habe. Der Mist ist fast versteinert. Offenbar wurde viel Mais verfüttert, das sorgt für dicke, trockene Scheiße, die manchmal die Roste und Ablaufrinnen verstopft. Wenn die Kühe nur Gras fressen, ist der Mist weich und grün. Den Gestank merkt man kaum, wenn man damit aufgewachsen ist. Ein alter Knecht hat mir einmal, nachdem er die Senkgrube entleert hatte, schelmisch einen Becher vor die Nase gehalten. »Probier mal, ist wie Likör. Elixir d’Anvers.«
Alles ist so vertraut, so normal, wie Wasser und Brot. Hier finde ich Ruhe, komme zu mir, fühle mich verbunden mit dem Mist und den Boxen und den Trögen und den anderen Dingen um mich herum. Die Welt, die ich hinter mir gelassen habe, muss warten. Ein leidenschaftliches Verlangen nach dem einfachen und rudimentären Leben treibt mich nun an, ohne Internet, Smartphone oder soziale Medien. Bin dann mal offline. Aber ein befreundeter Journalist hat kürzlich auf Twitter von mir berichtet. »Ich twittere, und mein Freund sitzt auf der Mistkarre. Zwei verschiedene Welten.« Stimmt das? Ein Traktor fährt heutzutage auch mit GPS, und es gibt bereits Apps, um die Mistkarre zu programmieren.
Auf dem Hof gab es immer Leben, Menschen, Tiere, Maschinen. Doch nun ist all das Leben weg, seitdem mein Bruder gestorben ist. Die Ställe wurden nach seinem Tod von einem Tag auf den anderen leergeräumt. Wir konnten die Tiere nicht länger versorgen. Sie wurden von einem Viehhändler abgeholt, auch wenn Ma das nicht gewollt hat. Ich war auf Haiti. Das Kettenrasseln und das Hufschaben aber habe ich noch immer im Kopf, auch wenn mittlerweile die einzigen Tiere zwischen den weißgekalkten Mauern und schwarzgeteerten Planken die Tauben sind, die im Dachfirst brüten, und die beiden roten Kater, die Mäuse und Ratten jagen. Es sind die halb verwilderten Hofkatzen meines Bruders, die sich nur von ihm haben streicheln und liebkosen lassen. Ma wollte die beiden Kater nicht im Haus haben, nachdem sie die Nachgeburten auf dem Misthaufen gefressen hatten. Der saftige Mutterkuchen oder »Hausputz«, wie wir es nannten, ist offensichtlich ihre Lieblingsspeise gewesen.
Die Schufterei im Mist erschöpft mich schnell. Schwere körperliche Arbeit ist immer schon eher die Sache meines Bruders gewesen. Aber die Bewegung und die frische Luft tun mir gut, die Arbeit ist befriedigend und lenkt mich ab. Wie bei einer Meditation leert sich der Kopf. Man konzentriert sich auf die Wiederholung der Handlungen. Mit Gabel oder Schaufel in den Mist stechen, die Klumpen und Stücke herausziehen und aufschaufeln, auf die Schubkarre klatschen, Hunderte, wenn nicht Tausende Male hintereinander. Bis man eins wird mit der Mistgabel. Bis an den Händen die Blasen brennen.
Ein Räuspern hinter dem Kipplader. Ich erschrecke. Es kommt vom Pfarrer, ein alter kranker Hirte, der noch immer seine Schäflein besucht, sogar die Schäflein, die schon lange vom Weg abgekommen sind.
Unwillkürlich muss ich an den Priester denken, der mich, den kleinen Jungen, sonntagnachmittags immer abholte, weil er so großen Wert auf meine Gesellschaft legte. Ma gab mich ihm vertrauensvoll mit. Von der Hecke aus winkte sie mir nach. Ach, Ma.
»Ah, auf der Suche nach Inspiration für ein neues Buch?«, lacht der Pfarrer, der selbst gerade ein religiöses Buch in sehr honorigem Ton geschrieben hat. »Sie erbarmen sich Gottes Schöpfung?«
»Eher dem Schöpfen der Scheiße«, sage ich kindisch, und zwinge meinem Mund ein Lächeln ab, um meine Verwirrung zu verbergen.
»Wie geht es Ihrer Mutter? Ihr Wegzug ist ein großer Verlust für unseren geprüften Landstrich. Wie verarbeitet sie die Rückschläge?«
»Sie verarbeitet sie nicht, sie verdrängt sie.«
»Das ist oft der einzige Ausweg aus den Sorgen.«
Ich bitte ihn nicht hinein, biete ihm keinen Likör an, kein Elixir d’Anvers. Ich bleibe verlegen in der Kuhscheiße stehen, in meinen schlabbrigen, verdreckten Kleidern und in Stiefeln, die unübersehbar ein paar Nummern zu groß sind. Ich wische mir die Hände an den Hosenbeinen ab.
»Sagen Sie ihr, dass ich für sie bete und sie nach Pfingsten besuchen komme.«
»Ja, tun Sie das. Sie wird sich darauf freuen.«
Später, als ich am Ofen sitze, bekomme ich zum zweiten Mal Besuch. Es klingelt an der Haustür, was selten geschieht. Bei Bauern kommt man durch die Hintertür und ruft »liebe Leute« oder so etwas. Zwei mir unbekannte Männer stehen auf der Auffahrt. Der eine erweist sich als Landvermesser, der andere stellt sich als der neue Nachbar vor. Er hat das Grundstück hinter unserer alten Scheune gekauft und fängt nächsten Monat mit dem Bau einer Villa an. Aber aus seinem Vermessungsplan geht hervor, dass die Grenze um eineinhalb Meter verlegt werden müsste. Ob das noch schnell geregelt werden könnte.
»Der Bauernhof in seiner heutigen Form ist mindestens zweihundert Jahre alt«, sage ich, »und meines Wissens hat noch nie jemand die Grenzen angefochten.«
»Und doch ist es so«, sagt der dicke Landvermesser, der mich ansieht wie eine Amsel einen Wurm. »Es wurde nachgemessen. Mein Klient hat das Recht, sich den Grund einseitig anzueignen.«
»Bestimmt nicht«, erwidere ich. »Dann rufe ich die Polizei.«
»Und wer gibt mir das Geld für die verlorenen Meter zurück?«, ruft der Nachbar. »Ich habe sie teuer bezahlt.«
»Gehen Sie doch vor Gericht.«
»Und wie lange wird sich das hinziehen?«, schnauzt er. »Soll ich denn warten, bis uns die Dachziegel auf die Köpfe fallen? Ich sehe doch jetzt schon einen Riss in der Fassade.«
Mein Bruder, so fällt mir ein, hat eine schriftliche Beschwerde bei der Gemeinde eingereicht, nachdem der Nachbar eine Baugenehmigung beantragt hatte. Er hat sich gefragt, ob es überhaupt machbar sei, ein Haus in drei Meter Entfernung einer jahrhundertealten Scheune zu bauen, ohne dass diese Schaden nehmen würde. Zudem sei sicher auch zu erwarten, dass sich die neuen Nachbarn binnen kürzester Zeit über die Lärm- und Geruchsbelästigung von den Rindern beschweren würden. Die Gemeinde sah darin kein Problem und wies die Beschwerde ab.
Ich befehle den beiden Männern, unseren Hof unverzüglich zu verlassen, was sie nicht ohne weiteres tun. Ich höre mich daraufhin Kraftausdrücke und Flüche aussprechen, die ich nie in mir vermutet habe. Ich schätze mich glücklich, dass der Pfarrer nicht mehr in der Nähe ist.
In der Abenddämmerung gehe ich hinter dem Haus durch unseren Obstgarten. Die Obstbäume sind schon lange gerodet. Nur eine schiefe Pappel als Grenzpfahl und die große Stechpalmenhecke als Trennlinie sind stehengeblieben. Hier war immer ein Loch in der Hecke, durch das wir uns mit den beiden Söhnen unserer früheren Nachbarn verbrüdern konnten, die in unserem Alter waren. Hier ritten wir auf den Rücken von weißen Schweinen durch die Bäume. Es war die Zeit von Bonanza und anderer Westernfilme im Fernsehen. In der Gracht hinter dem Obstgarten, die später zugeschüttet wurde, fingen wir Kaulquappen und Salamander. Blutegel saugten sich an unseren Beinen fest. Wir holten Maikäfer aus der Hecke, suchten Kiebitznester auf der Weide und kannten den Polder wie unsere Westentasche.
Es war ein bedeutsames Ganzes, in dem alles seinen Platz hatte. Menschen und Tiere und Gebäude passten noch in die Landschaft. Heute aber scheint nichts mehr zu stimmen.
Hinter dem Obstgarten ohne Bäume und der Weide ohne Kühe haben die Arbeiten mächtig Fortschritte gemacht. Vor ein paar Monaten konnte ich noch bis zum Horizont blicken, aber nun wird mir die Sicht von einem gigantischen Tomatenbetrieb mit riesigen Lagerhallen, Vorratstanks, Wasserreservoiren und einem Industriegebäude mit Rohrsystemen und Schornsteinen genommen. Rechts von unserer mittlerweile umzingelten Weide ist ein komplettes Möbelparadies entstanden, das sich immer weiter ausdehnt. Und dahinter verläuft die Nationalstraße, die ein Stück vom Zaligempolder abgeschnitten hat. Und dann noch der Windturbinenpark, der in den kommenden Monaten entstehen soll …
Die Weite ist weg. Definitiv weg, so definitiv wie der Tod. Und wenn die Weite aus der Sicht verschwindet, verschwindet sie auch aus dem Kopf. Dann sieht man das vollständige Ganze nicht mehr.
Wie endlich der Horizont jetzt ist.
Neben dem neuen Treibhauskomplex steht eine mobile Toilettenkabine der Firma Toi Toi. Heutzutage fangen die Arbeiter kein Projekt mehr an, wenn sie ihre Notdurft nicht in Ruhe verrichten können. Als wäre dies die Krönung nach zweihundert Jahren Arbeitskampf. Wenn man irgendwo im Feld ein pastellfarbenes WC-Häuschen stehen sieht, weiß man sofort, dass bald auch die Bagger folgen. Fährt man im Waasland durch die Polder, trifft man nun überall auf diese Dixi-Klos.
Am nächsten Tag spaziere ich im Zaligempolder umher. Ich atme auf. Immer wenn ich hier bin, breitet sich Gelassenheit und Ruhe in mir aus. Der Wind verjagt schlechte Gedanken und bietet Trost. Nichts außer den Feldern, den Wasserläufen, den Tieren existiert noch für mich. Doch bis auf die wenigen Bauern, die nach wie vor das Privileg haben, hier ihre Landwirtschaft betreiben zu dürfen, redet niemand mehr von Zaligem. Aber über die Saleghemkreken, ein Gebiet mit kleinen und großen Flussläufen. Die alten geschichtsträchtigen Namen werden heute von »den Grünen«, wie sie hier immer noch genannt werden, instand gehalten.
Die Sonne kämpft sich durch die Wolken. Sie legt einen feuchten Glanz über den Polder. Die meisten Äcker sind schon gepflügt, bis auf unsere, die als Stoppelfelder daliegen. Unwillkürlich inspiziere ich die Äcker der anderen Bauern, wie ein Metzger, der die Würste seiner Kollegen begutachtet. Die Furchen verlaufen kerzengerade bis zum Wasserlauf. Das ist nicht weiter schwer für einen mit GPS ausgerüsteten Traktor, aber doch immer wieder schön anzusehen. In einem der Gedichte, die man nun auf den Schildern im Polder lesen kann, heißt es: »Sie rühren mich, die frisch gepflügten Äcker: die Seele der Erde bloßgelegt.«
Es kann hier sehr einsam sein. Früher hat man überall Bauern bei der Arbeit gesehen, aber heute reicht ein Mann mit ein paar großen Maschinen, um mit dem ganzen Polder fertig zu werden. Die Zeit der krummen Rücken ist vorbei. Ich hebe die Hand zu einem kolossalen, selbstfahrenden Miststreuer mit Injektionsschläuchen. Heutzutage muss die Jauche nämlich direkt in den Boden injiziert werden, damit sie nicht in Bäche und Wasserläufe geschwemmt werden kann. Ein Falke setzt zum Flug an und schnellt wie eine Rakete auf seine Beute zu. Hier kreisen nun immer Raubvögel, sogar über den Schnellstraßen, was in meiner Jugend undenkbar gewesen ist. In den vergangenen Jahren wurden in der Gegend einige Bussarde vergiftet.
Wenn ich der Nationalstraße den Rücken zukehre, sieht der Zaligempolder in vielerlei Hinsicht noch so aus wie früher. Es ist eine Landschaft, in der Land, Himmel und Wasser auf fließende Weise zusammenkommen. Die Gleise für den Güterverkehr, die quer über unsere Äcker verlaufen sollten und schon vor Jahren geplant waren, sind glücklicherweise noch nicht verlegt. Und überall stehen Schilder der Naturschutzvereinigung Natuurpunt, die die Saleghemkreken verwaltet. »Ruhezone: nicht betreten«, steht auf einem Schild, das mitten im Polder beim langen Schilfsumpf steckt. »Pst … nicht stören.« Doch der Verkehr auf der Nationalstraße, viel dichter als noch vor zehn Jahren, stört sich nicht daran.
Ich klettere auf den Groene Dijk und sehe ein Schild vor dem Tannenwald: »Genießen Sie dieses Stück Natur.« An den Wegesrändern wachsen überall Disteln und Brennnesseln, die ihre Samen im Wind ausschütten. Ich muss ungefähr acht Jahre gewesen sein, als ich auf diesem gerade frisch angepflanzten Tannenacker einen kleinen Baum aus der Erde riss. Wir hatten zu Hause nie einen Weihnachtsbaum, in jenem Jahr aber dann schon. Da ich mich nicht traute, mit meiner im Jutesack versteckten Beute die Kemphoekstraat entlangzulaufen, schlich ich über die Felder, sprang über Wassergräben und kroch durch Stacheldraht, um zu unseren Ställen zu gelangen. Dann stellte ich den Baum unter die Kuckucksuhr und schmückte ihn mit aus Einschlagpapier geschnittenen Girlanden. An seiner Spitze befestigte ich eine schillernde Pfauenfeder.
»Kleiner Blödmann«, sagte mein Bruder lachend.
Jahre später standen wir auf unserem Feld, das an den Tannenwald grenzt, und warteten mit Traktor und Kipplader darauf, das Getreide zum Bauernhof zu bringen. Ein großer gelber Mähdrescher eines Lohnunternehmers mähte und drosch für uns das Korn. Während sie bei der Arbeit waren, kletterte mein Bruder durch eine Wolke aus Spreu und Staub die Leiter zum fahrenden Mähdrescher hoch und ließ sich eine Runde mitnehmen. Ich war ziemlich neidisch. Allerdings hatte die Maschine mittags eine Panne, einer der vielen Rückschläge, die eine Ernte gründlich durcheinanderbringen können. Erst ein paar wenige breite Bahnen hatte der Mähdrescher durch das Getreide gezogen. Die Zeit drängte, denn hier und da bogen sich die reifen Halme schon durch oder waren umgeknickt.
Stunden warteten wir auf dem hohen, grasigen Binnendeich unter einer Doppelreihe Pappeln und blickten über das Bauernland bis zum Horizont, wo der Kirchturm mit seinen siebzig Metern der höchste Punkt weit und breit war. Dort lag unser Acker, vor uns in der Tiefe. Das frohlockende Gelb des Kornfelds war neben dem Dunkelgrün des Tannenwalds im üppigen Licht der Mittagssonne, die senkrecht am Himmel stand, von berauschender Schönheit. Das Gras kitzelte an den Waden. Die Grillen zirpten. Die Spatzen, die lärmend um verlorene Getreidekörner zwischen den Stoppeln kämpften, bewarfen wir mit Erdklumpen.
Es waren Dinge, die wir immer getan hatten, solange ich denken kann. Wir konnten kaum laufen und mussten schon mit aufs Feld, besonders mein Bruder, der wie selbstverständlich ins Bauerndasein hineintrudelte. Mittags nach der Schule war er aus den Ställen nicht wegzukriegen. Mit sieben fuhr er schon Traktor. Die Pedale bediente er mit einer Stange, die Pa ihm extra montiert hatte, weil seine Beine noch zu kurz waren.
Als wir damals auf dem Deich lagen, wurden wir plötzlich aufgeschreckt. Kreischen, Flügelschlagen. Aus der Gracht neben uns schoss ein Gespenst, das mit weitem Flügelschlag, lang ausgestreckten Beinen und vorgerecktem Hals direkt in den Wald hineinflog. Der verwahrloste Tannenwald war vollkommen zugewachsen. Wir drängten durch das Dickicht, schoben Brombeerzweige zur Seite, stapften über einen halbvermoderten Baumstumpf und kamen zu einer Lichtung mit schwammigem dampfenden Boden. Wir blickten hoch und sahen über uns in den Baumkronen rundum Dutzende große Nester. Die Luft war voll von heiseren Rufen und Geflatter, denn die ganze Reiherkolonie flog mit einem Mal auf. Verzückt blickten wir ihnen nach. Es rührte uns, dass wir so etwas Imposantes wie Blaureiher gesehen hatten, denn die hatte man damals fast nie zu Gesicht bekommen.
Jetzt laufe ich den Deich hinunter, über das Feld am Waldrand, folge der matschigen Wagenspur und entdecke einige Reiher in den Tümpeln. Sie schauen kaum auf, als ich mich ihnen bis auf zehn Meter nähere. Reglos wie Betbrüder spähen sie ins Wasser. Sie haben ihre Scheu verloren und sich den Menschen angepasst, und umgekehrt, denn manchmal kann man auch einen Angler dabei beobachten, wie er einem Reiher einen Fisch zuwirft. Diese Tümpel und Wiesen werden gegenwärtig von Natuurpunt verwaltet und heißen Karnemelkputten, Buttermilchgruben. Der Weihnachtsbaumwald ist zu einem Naturschutzgebiet geworden und heißt Reigerbos, Reiherwald.
Ich setze mich auf den Dwarsdijk, der entlang der Grote Geule verläuft, dem langgestreckten Wasserlauf, der durch den gesamten Zaligempolder fließt. Hier schlitterten wir im Winter auf dem Eis mit einem auf Latten gehämmerten Stuhl, den wir Eisstuhl nannten. Hier radelten und badeten wir und beäugten die Bauerntöchter in ihren schicken Badeanzügen. Rechts der Geule waren immer Leute in den auf Pfählen errichteten Anglerhütten. Kleine Jungen mit ihren Angelruten und alte Männer auf Klappstühlen, brüderlich auf den Holzstegen nebeneinander. Ganze Generationen kamen zum Liebesspiel hierher. Der Dwarsdijk war ein richtiger Gemeinschaftsplatz, voll von Geschichten, die sich mit der Landschaft verknüpften.
Ich selbst muss immer an die Geschichte dieses Nachbarjungen denken, der in einem Strudel ertrank. Heldenhafter aber ist die von einem Wilderer aus der Gegend. Es geschah während des Ersten Weltkriegs. Die deutschen Besatzer hatten in dem kleinen Schloss des Ortes ihre Kommandantur eingerichtet. Bei dem Schloss, das ein paar Kilometer von unserem Hof entfernt am Rand des Zaligempolders liegt, habe ich als Kind öfters gespielt, und irgendwann, als es einige Zeit leer gestanden hat, habe ich mich auch eingeschlichen. Ich war sehr erstaunt, als ich entdeckte, dass die Toilette lediglich ein Brett mit einem Loch über der Sickergrube war. Genau wie bei den Bauern. Und dass es bei dem »Schlossherrn« wohl genauso fürchterlich gestunken hat. Heute ist das Schloss das Hauptquartier des Hafenbarons Fernand Huts.
Weil er sein Jagdgewehr nicht hat abgeben wollen, wurde der Wilderer während des Kriegs festgenommen und auf dem Dachboden des Schlosses eingesperrt. Er knotete die Laken zusammen und konnte entkommen. Er rannte quer durch den Zaligempolder. Die Deutschen merkten sofort, dass er weg war, und nahmen mit zwei Spürhunden die Verfolgung auf. Der Wilderer sprang in de Geule, die Hunde schwammen hinterher. Als sie ihn einholten, packte er ihre Schnauzen und drückte sie so lange unter Wasser, bis sie ertranken. Er kam mit heiler Haut über den »Hochspannungszaun«, der Grenze zu den neutralen Niederlanden. Diese Drahtbarriere, die übrigens mit ebenso viel Volt geladen war wie der elektrische Stuhl, sollte verhindern, dass die Leute scharenweise die Flucht vor den Deutschen ergriffen.
Echte Freibeuter sind sie früher in dieser Gegend gewesen. In Groenendijk, einem Weiler aus Bauern, Wilderern und Schmugglern, kümmerte man sich nicht um Gott und seine Gebote, man schlug sich einfach, so wird erzählt, bei der geringsten Kleinigkeit die Köpfe ein, wahrlich ein Ort, »zu dem der liebe Gott niemals kam«. Die Leute lebten zurückgezogen, »für sich selbst«. Wenn sie sich ins Dorf aufmachten, sagten sie, sie gingen »nach Flandern«. Ende des Ersten Weltkriegs lebte dort ein Bauer, der einen Deutschen erschlagen hatte. Alle wussten es, aber keiner hat ihn verraten. Dieser Deichweiler hat sich seither kaum verändert und beschwört durch seine Zeitlosigkeit Bilder der Vergangenheit herauf.
Heutzutage ist die Geule mit Schilf, Wasserlilien und Teichrosen überwuchert, so dass Schwimmen unmöglich ist. Es gibt eine Bank, einen Picknicktisch und eine Infotafel, auf der steht, dass die Grote Geule 1584–1585 entstanden ist, als die Verteidiger von Antwerpen die Scheldedeiche durchstachen, um die spanischen Truppen von Alexander Farnese aufzuhalten. Durch die jahrzehntelange Preisgabe an Ebbe und Flut entstanden tiefe Wasserrinnen, die nach der Wiedereindeichung als kleine Wasserläufe und Tümpel in der Landschaft zurückblieben.
Von dieser Stelle aus ist die Geule zweifellos schöner und idyllischer als früher. Und doch nagt etwas an mir. In gut einem Kilometer Entfernung steht auf zig Schildern, warum man dieses Gebiet so wertvoll zu finden hat. Sie zeigen, wohin man schauen soll, und erklären, was alles zu sehen ist. Sie geben mir das Gefühl, ein Passant, ein Zuschauer zu sein und die Landschaft nur Dekor, wie in einem Disneyfilm. Die Natur ist nicht mehr etwas, was einfach da ist, was außerhalb unseres eigenen Daseins existiert und sich selbst ausgeliefert ist. Nein, heute ist sie einem Konservator anvertraut.
Je mehr Schilder aufgestellt sind, desto mehr verliert die Natur ihre Faszination. Wie viel Entzauberung können Mensch und Natur vertragen? Ja, ich darf sie betrachten und erhalte sachkundige Informationen, aber ich bin kein Teil mehr von der Natur. Der Zaligemkreek war für mich als Kind kein einzigartiges »Paradies für Schleimpilze«, sondern der Ort, an dem ich eine Handvoll Brombeeren pflückte, für meine Mutter Brenntorf aus Kappweiden schaufelte und mit meinem Bruder Kaninchen fing.