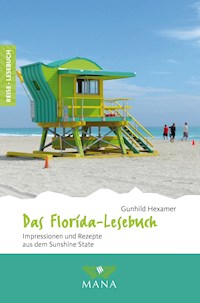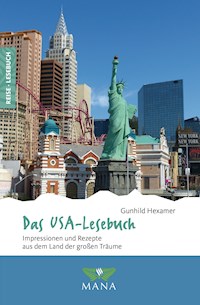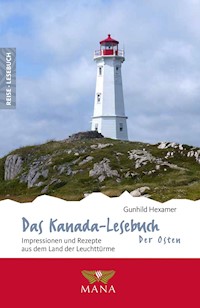Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: MANA-Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Serie: Reise-Lesebuch
- Sprache: Deutsch
Der Westen Kanadas – für Outdoor-Touristen auf der ganzen Welt ist diese Region zum Inbegriff von Freiheit und Abenteuer geworden. Die pulsierende Pazifikmetropole Vancouver und die kanadischen Rocky Mountains mit dem Banff-Nationalpark, dem ältesten Schutzgebiet des gesamten Landes, gelten als Aushängeschilder der Region, daneben existieren jedoch noch unzählige weitere Spots, die nur darauf warten, entdeckt zu werden. Gunhild Hexamer nimmt Sie mit auf eine faszinierende Reise durch den Westen Kanadas und verbindet dabei kurzweilige Reiseanekdoten geschickt mit fesselnden Geschichten aus der bewegten Vergangenheit des Landes. Auf diese Weise präsentiert sie all die verschiedenen Facetten, die den Westen Kanadas so einzigartig machen. Beeindruckende Fotos und mehr als 20 landestypische Rezepte zum Nachkochen machen dieses Lesebuch zu einem Must-have für alle Kanada-Fans.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 228
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gunhild Hexamer
Das Kanada-Lesebuch
Der Westen
Impressionen und Rezepte aus dem Land der Berge und Bären
Die Reise beginnt
Hallo Welt – der Inukshuk
Sauteed Garlic Prawns – gebratene Knoblauchgarnelen
Regenwald und stinkende Schönheiten – Wander Shore Mountains
Clam Chowder – Muschelsuppe
Es grünt so grün – Vancouver, der Geburtsort von Greenpeace
Curried Salmon with Mango Blueberry Chutney – Currylachs mit Mango-Blaubeer-Chutney
Donnervogel und Rabe – die Totempfähle im Stanley Park
Teriyaki Salmon – Lachs in Teriyaki-Soße
Ein Meer von blauen Blüten – die Gründung der Stadt Victoria
Cranberry Apple Bran Muffins – Cranberry-Apfel-Kleie-Muffins
Rebellisch, exzentrisch, rätselhaft – die Künstlerin Emily Carr
Nanaimo Bars – kanadische Donauwelle
Wein aus der Wüste – das Weingut Nk‘Mip Cellars
Spiced Rum Grilled Peaches – gegrillte Pfirsiche mit gewürztem Rum
Lachs in Dosen – die North Pacific Cannery in Port Edward
Salmon Burgers – Lachsburger
Die reichste Frau am Yukon – der Klondike-Goldrausch
Sourdough Waffles – Sauerteigwaffeln
Der Bär ist los – Begegnungen in den Bergen
Puffed Wheat Squares – süße Stückchen aus gepufftem Weizen
Das Werk der Schneeflocken – der Athabasca-Gletscher
Garlic Mashed Potatoes – Kartoffelpüree mit Knoblauch
Der letzte Nagel – die transkanadische Eisenbahn
Pumpkin Pie – Kürbiskuchen
Spuk im Schloss – die Luxushotels in den Rocky Mountains
Granola Bars – Müsliriegel
Besuch im Hörnchenland –Entdeckungen auf dem Rogers Pass
Butternut Squash Soup – Butternut-Kürbis-Suppe
Mit zerschmettertem Schädel – wo die Bisons in den Tod sprangen
Crispy Ginger Beef – knusprige Ingwer-Flank-Steaks
Pferde, Rinder, Cowboys – die Calgary Stampede
Bloody Caesar – kanadischer Nationalcocktail
Schmutziges Öl – die Ölsande in Alberta
Moose Steaks – Filetsteaks vom Elch
Wohnen wie im Mittelalter – das Stone Hall Castle in Regina
Saskatoon Perogies – Piroggen mit einer Füllung aus Saskatoon-Beeren
Die Launen des roten Flusses – die Präriemetropole Winnipeg
Pecan Honey Walleye – Walleye-Filet mit Pekannüssen und Honig
Volksheld und Verräter – Louis Riel, Führer der Métis
Métis Bannock – Fladenbrot nach Art der Métis
Die verzauberte Eule – Cape Dorset, Hauptstadt der Inuit-Kunst
Arctic Char with Sesame and Maple Syrup – Seesaibling mit Sesam und Ahornsirup
Das letzte Wort
Danksagung
Übersichtskarte und Fotos
Kanada – Buchtipp
Die Reise beginnt
Türkisblau schimmert der Moraine Lake im Tal der zehn Berggipfel. Als schroffe graue Zacken streben die „Ten Peaks“ in die Höhe, an ihren Hängen glitzern Schneefelder im Sonnenlicht. Dunkler Bergwald drängt sich bis ganz ans Ufer heran, als gelte es, kein Fleckchen unbewachsen zu lassen. Ein Windhauch kräuselt die Oberfläche des Sees. Auf dem Blau gleitet einsam ein Kanu.
Ein Motiv zum Malen schön. Es ist eines der vielen Bilder, die vor meinem inneren Auge zu leuchten beginnen, wenn ich an die Bergwelt der Rocky Mountains denke. Für die Besucher, die von weither anreisen, sind sie der Inbegriff des kanadischen Westens und das Ziel ihrer Sehnsucht. Gleich sechs Nationalparks gehen hier mehr oder minder ineinander über, oft nur durch einen Bergpass getrennt. Die Landschaft ist so grandios, so unglaublich schön, dass ich beim Betrachten ganz still werde und meine Sinne weit öffne, um all diese Herrlichkeit aufzunehmen.
Gletscher drängen zu Tal, wilde Flüsse strömen, Bäche gluckern, Wasserfälle rauschen, ein jeder in seiner eigenen Tonlage. Wilde Blumen sprenkeln die Bergwiesen, und auf der Passhöhe, gleich neben dem Wanderpfad, entfalten dichte Büschel von Indian Paintbrush ihre üppigen feuerroten Blüten.
Ein Weißwedelhirsch tritt aus dem Wald und beginnt, in Ruhe Gras zu rupfen. Oben am Berg entdecken wir eine Schneeziege, die den steinigen Hang hinunterklettert. Am Rogers Pass kommen die Erdhörnchen keck aus ihren Löchern und schnuppern: Gibt’s hier was zu essen? Die Touristen krümeln doch immer mit Keksen herum. Und dann die Bären! Eine Begegnung mit ihnen kann gefährlich sein, doch uns ist das Glück vergönnt, einen Schwarzbären und einen jungen Grizzly aus sicherer Entfernung beobachten zu dürfen.
Wir, das sind Peter und ich, ein erprobtes Reiseteam seit der Zeit, als wir uns während unseres Studiums in Cardiff, Wales, kennenlernten. Peter kümmert sich zuverlässig um den praktischen Teil der Reise und denkt an fast alles. Geduldig lässt er mich gewähren, wenn ich, hingerissen von den Wundern der Natur, hunderte von Fotos aufnehme – von einem Baum, einem Farnwedel oder einem kleinen Blümchen, das mich bezaubert hat. Gemeinsam sind wir schon tausende von Kilometern durch Kanada gefahren.
Begonnen hat unsere Reise in Vancouver, der grünen Metropole am Pazifik, wo wir zum ersten Mal die geheimnisvollen Totempfähle der Westküsten-Ureinwohner sehen, nur einen Spaziergang entfernt von den Wolkenkratzern der Innenstadt. Das kulturelle Erbe der First Nations wird uns noch an vielen anderen Orten begegnen.
Mit der Fähre setzen wir nach Vancouver Island über. Die schneeweiße Coastal Celebration navigiert auf sicherer Route durch die verzweigte Meerenge der Strait of Georgia, vorbei an kleinen, dicht bewaldeten Inseln, die wie dunkelgrüne Wuschelköpfe aus dem blauen Meer ragen. Auf Vancouver Island liegt Victoria, die Hauptstadt der Provinz British Columbia. Eine halbe Erdumrundung von Großbritannien entfernt – doch die Stadt erscheint so britisch, als wäre Queen Victoria erst gestern im altehrwürdigen Empress Hotel abgestiegen.
Das englische Flair verliert sich schnell, als wir auf dem Trans-Canada Highway weiterfahren, um zur wilden Küste des Pacific Rim National Park zu gelangen. Vom Meer glatt und grau gewaschene Baumstämme stapeln sich am Strand, wie hingeworfen von einem Riesen, der es eilig hatte. Nicht weit entfernt liegt ein kleines Regenwaldgebiet, eines der letzten an der Westküste. Staunend lassen wir den Blick an den Baumgiganten emporwandern. Schon vor Jahrhunderten steckten sie als schmale Jungbäume ihre Wurzeln in diesen Boden, lange bevor die ersten europäischen Entdecker die Insel betraten.
British Columbia ist ein Wunderland voller Gegensätze. Durch das bergige Innere führen Straßen, an denen sich winzige Orte aufreihen, mit Namen wie 70 Mile House, 108 Mile House oder 150 Mile House. Sie wurden im 19. Jahrhundert als Raststationen für die durchziehenden Pioniere und Abenteurer gegründet.
Im Norden grenzt die Provinz an das Yukon Territory, wo die Goldsucher nach dem Klondike-Goldrausch eine neue Stadt zurückließen, Dawson City. Hier lebt man auch heute noch gut von den Erinnerungen an die alten Zeiten, als sich die Goldgräber nach getaner Schürfarbeit in den Bars und Saloons amüsierten.
Jenseits der Rocky Mountains erstrecken sich die Ebenen der drei Prärieprovinzen, Alberta, Saskatchewan und Manitoba. Ihre Geschichte hat 200 Jahre lang die Hudson’s Bay Company geprägt, jene Handelsgesellschaft, die durch den Pelzhandel reich wurde. Und zwar nur deshalb, weil die Herren in Europa Kastorhüte zu tragen pflegten, gefertigt aus den gefilzten Fellhaaren des Bibers.
Die Prärie, die Grassteppe Nordamerikas, war in früheren Zeiten die Heimat der Bisons. Heute grasen in den trockenen Gebieten im Westen die Rinderherden riesiger Ranchbetriebe. Wenn in Calgary weithin vernehmbar Lassos zischen, Stiere brüllen und Pferde wiehern, begleitet von Jubel und Applaus, dann ist die Zeit der Calgary Stampede, der größten Rodeo-Show der Welt. Im regenreicheren Osten ziehen sich Weizen-, Mais- und Rapsfelder bis zum Horizont. Wie Türme in der flachen Landschaft ragen die Getreidespeicher in die Höhe, die Kathedralen der Prärie, wie sie mit liebevollem Spott genannt werden.
Im Norden der Prärieprovinzen schließen sich die Northwest Territories an und Nunavut, das von den Inuit verwaltete Gebiet. Hier, in der Weite der kanadischen Tundra, liegt die kleine Siedlung Cape Dorset, weltweit bekannt durch die Werke der einheimischen Künstler. In ihren Bildern, Grafiken und Skulpturen werden die nordische Natur und die Traditionen der Inuit auf einzigartige Weise lebendig.
Mit einem Besuch in Cape Dorset endet die Reise in diesem Buch. Der kanadische Westen hat uns unzählige Gesichter gezeigt: atemberaubend schöne, liebenswerte, überraschende und bisweilen auch erschreckende. Und lädt uns zu weiteren Entdeckungsreisen ein.
Hallo Welt – der Inukshuk
Michaëlle Jean, die Generalgouverneurin von Kanada, strahlte, als sie vor die Mikrofone trat und verkündete: „Ich erkläre die Spiele von Vancouver für eröffnet, wir feiern die 21. Olympischen Winterspiele!“
Von den 61.000 Zuschauern, die sich am 12. Februar 2010 im BC Place Stadium in Vancouver versammelt hatten, wurden ihre Worte mit anhaltendem Beifall empfangen. Anschließend trat die kanadische Sängerin Kathryn Dawn Lang auf, und das Stadion füllte sich mit den Klängen von Leonard Cohens berühmtem Song „Hallelujah“.
In diesen kalten Februartagen schaute die ganze Welt auf Vancouver, die Stadt im Olympia-Rausch, und die umliegenden Bergregionen, wo die Skiwettbewerbe stattfanden.
Nicht nur die Bilder der glitzernden Metropole und der grandiosen Landschaft gingen um die Welt, nicht nur die Szenen von sportlichen Höchstleistungen, Siegestaumel oder Tränen der Enttäuschung. Auch das Logo und Maskottchen der Olympischen Spiele war überall präsent, auf Fahnen, Bannern, T-Shirts und Kappen, als Schlüsselanhänger oder Aufstellfigürchen oder was der Merchandise-Industrie sonst so einfiel. Ein merkwürdiges Gebilde, das von seiner Form her an einen Menschen erinnerte. Das sei ein „Inukshuk“, so erklärte man den Besuchern.
Das fremdartige Wort faszinierte mich sofort, als ich es, Jahre nach der Olympiade, zum ersten Mal hörte. Eine besondere Magie schien von ihm auszugehen. Denn der Inukshuk, eine geheimnisvolle Figur aus Steinen oder Felsblöcken, ist Teil einer uralten Kultur. Der Kultur jener Völker, die seit tausenden von Jahren die arktischen Regionen besiedeln. In Kanada sind es die Inuit, die im hohen Norden leben. Weil den Steinfiguren in der Tradition eine bedeutende Rolle zukommt, ist auf der Flagge von Nunavut, dem Territorium der Inuit, ein roter Inukshuk zu sehen.
Traditionell lebten die Inuit von der Jagd und vom Fischfang. Wie konnten sich die Menschen auf ihren ausgedehnten Jagdausflügen orientieren, womöglich mitten im Schneegestöber? Wie fanden die Jäger den Weg zurück ins Lager, zu ihren Familien? Hier in dieser eintönigen, von Geröll und Schnee bedeckten Landschaft, wo kein einziger Baum seine Wurzeln in den Boden streckte. Und wo es den sicheren Tod bedeutete, wenn man sich verirrte. In dieser unwirtlichen Umgebung nutzten die Inuit das, was der Boden ihnen zur Verfügung stellte: Steine und Felsen. Und die stapelten sie übereinander, um daraus Figuren und andere Steingebilde zu errichten, die Inuksuit – das ist die Pluralform von Inukshuk.
In Inuktitut, der Sprache der Inuit, bezeichnet das Wort „Inuk“ einen Menschen. Und Inukshuk bedeutet so viel wie „in der Funktion eines Menschen handeln“. Ein Inukshuk soll also etwas mitteilen. Steine, die Informationen vermitteln, und das ohne Schriftzeichen? Klingt seltsam, dachte ich. Aber dann überlegte ich mir, dass wir ja auch Gegenstände mit Stellvertreterfunktion kennen, wie zum Beispiel eine Verkehrsampel, die uns mit ihren Farben und Symbolen Anweisungen gibt.
Aus den Steingebilden entwickelte sich ein ausgefeiltes System der Kommunikation. Die jeweilige Bedeutung hing davon ab, wie die Inuit die Steine und Felsen anordneten. Die Jäger suchten eine seichte Stelle am Fluss, um zum anderen Ufer zu wechseln? Bestimmt fand sich ein Inukshuk als Wegweiser. Wo man auf reiche Jagdbeute hoffen konnte, wo das Eis im Frühjahr gefährlich dünn wurde, wo es ein verstecktes Proviantlager gab – all das zeigten die Inuksuit an. Manche der Steinfiguren waren so gebaut, dass sie ein Fenster bildeten. Schaute man hindurch, sah man den nächsten Inukshuk in der Ferne. Auf diese Weise konnten die Jäger einer längeren Route sicher folgen.
Sind die Inuksuit also nichts anderes als nützliche Hinweisschilder der Marke Steinzeit? Finden wir es heraus.
Olympische Felsbrocken
„Ein Inukshuk – und die olympischen Ringe!“
Wir waren hinauf zum Cypress Provincial Park gefahren. Der Park liegt in einer Bergregion nordwestlich von Vancouver, und da er von der Innenstadt aus schnell zu erreichen ist, haben die Stadtbewohner ihr Wintersportgebiet praktisch vor der Haustür. Das Skigebiet mit dem Namen Cypress Mountain war 2010 der Austragungsort für die Wettbewerbe im Freestyle-Skiing und im Snowboarden. Deshalb also die sichtbare Erinnerung an diese Zeit.
Der Schnee war geschmolzen, die Liftanlagen standen still, und die Skihänge machten einen abgenutzten, strapazierten Eindruck. Die fünf großen Ringe aber, alle in hellgrün gehalten, wirkten wie frisch poliert. Links daneben hatte man auf einem steinernen Sockel eine Figur aufgestellt, die aus fünf grob behauenen Felsblöcken bestand: zwei längliche Blöcke stellten die Beine dar, ein quadratischer Block diente als Leib, ein quer liegendes, längliches Exemplar als Brust und Arme, und oben thronte ein dicker, rundlicher Klotz als Kopf. Die Steinfigur wirkte wie der kleine Bruder des Inukshuks, den wir am Tag zuvor im Uferpark an der English Bay in Vancouver gesehen hatten. Die monumentale Skulptur stammt von dem Inuit-Künstler Alvin Kanak, er hatte sie für die Expo 86 gestaltet.
Ich war nicht die einzige, die sich für den kleinen Bruder interessierte. Während ich ein paar Aufnahmen machte, kam eine junge Frau herbei, vielleicht eine Studentin, hielt ihr Handy hoch und fotografierte die Figur aus allen möglichen Blickwinkeln. Dann folgten ein paar Selfies mit Inukshuk, so als wäre der Steinmann ein guter Freund von ihr, und schließlich musste ihre Freundin noch ein paar Bilder von den beiden zusammen aufnehmen.
Die junge Frau war sehr schlank und hatte lockige schwarze Haare. Zu ihren pinkfarbenen Leggings trug sie ein graues Sweatshirt mit dem Aufdruck einer Collegemannschaft.
Ich beobachtete ihre eifrigen Aktivitäten neugierig. „Sie interessieren sich wohl sehr für den Inukshuk“, bemerkte ich.
Die Freundin grinste. „Ich kann ja nicht verstehen, was Kristin an diesen Steindingern findet, aber glauben Sie mir, es gibt nichts, was sie darüber nicht weiß.“
„Dann können Sie mir vielleicht etwas über die Bedeutung erzählen“, sagte ich zu der jungen Frau mit Namen Kristin. „Ich weiß nur, dass die Inuit sie als eine Art Wegweiser und Informationsträger gebaut haben.“
Kristin nickte. „Richtig, es steckt noch mehr dahinter. Die Steinfigur steht für das Überleben in der Arktis und gleichzeitig für Gastfreundschaft, Hilfsbereitschaft und Kooperation.“ Sie steckte ihr Handy in die hintere Hosentasche und fuhr fort: „Gastfreundschaft, weil der Inukshuk ein Hinweis darauf war, dass sich in der Nähe eine Ansiedlung oder ein Lager befanden. Hilfsbereitschaft, weil der Inukshuk anderen Menschen diente, die später in die Gegend kamen und Orientierung und Informationen brauchten. Und Kooperation, weil er das Ergebnis von Teamwork war. Denn die Felsblöcke sind so schwer, dass einer allein sie gar nicht transportieren und zusammensetzen konnte. Dieser hier“, sie wies auf den Steinmann vor uns, „ist streng genommen kein Inukshuk, sondern ein Inunnguaq. So nennen die Inuit die Figuren, die menschenähnliche Formen haben.“
„Das heißt“, sagte ich, „dass das Logo der Olympischen Spiele eigentlich einen Inunnguaq darstellt.“
„Ja, aber die meisten Leute sagen trotzdem Inukshuk dazu. Das Wort hat sich irgendwie eingebürgert.“ Kristin lachte. „Ist okay, ich seh‘ das nicht so eng.“
Ein Lächeln für Vancouver
Der Inukshuk für die Olympischen Spiele in Vancouver hat einen eigenen Namen bekommen: Ilanaaq, das Wort für „Freund“ in der Sprache der Inuit. Er besteht aus fünf Teilen und gleicht von der Form her der Figur, die wir im Skigebiet Cypress Mountain gesehen haben. Das Logo jedoch ist bunt, angelehnt an die Farben der olympischen Ringe, also gelb, rot, blau, grün, und schwarz wurde durch dunkelblau ersetzt. Und es gibt noch einen wesentlichen Unterschied: Ilanaaq lächelt! Sein eckiger grüner Kopf ist auf der rechten Seite mit einer Einkerbung versehen – ein kleines, aber entscheidendes Detail.
Zum Lächeln hat er allen Grund, denn diesem Inukshuk gelang es, die neunköpfige, international besetzte Jury auf Anhieb zu überzeugen, bei einer Auswahl von 1.600 Gestaltungsvorschlägen. Den Wettbewerb gewann Elena Rivera MacGregor mit ihrem Team von Rivera Design, einer in Vancouver beheimateten Agentur. Das Design ihrer Figur ist so einfach wie genial.
Der Inukshuk steht für urkanadische Werte: Freundlichkeit, Gemeinschaftsgefühl und Teamgeist. Diese Eigenschaften haben sich schon vor Jahrhunderten beim Überleben und Zusammenleben als hilfreich erwiesen, in einem Land, das es den Menschen mit seinem rauen Klima und seiner wilden Natur nicht leicht gemacht hat. Durch ihre arktische Herkunft ist die Steinfigur außerdem mit den Elementen Eis und Schnee verbunden und auf diese Weise wiederum mit den winterlichen olympischen Disziplinen.
Der Clou aber ist das Lächeln. „In dem Moment, als ich das Lächeln hinzugefügt habe, da hat es Klick gemacht“, erzählte MacGregor in einem Interview. „Vorher bestand die Figur nur aus bunten Klötzen, doch mit dem Lächeln wurde sie lebendig. So als hätte ich ihr damit Leben eingehaucht.“
Am 23. April 2005 wurde das Logo im Rahmen einer aufwendigen Show der Öffentlichkeit präsentiert. Für MacGregor fühlte es sich an, als hätten sie und ihre Firma bereits Jahre vor den Olympischen Spielen eine Goldmedaille gewonnen.
Und die Inuit, was hielten sie davon, dass der Inukshuk ein modernes Design erfuhr und in allen möglichen Varianten massenhaft produziert wurde?
Die Meinungen gingen auseinander. Paul Okalik, der damalige Premierminister von Nunavut, sagte, der Inukshuk habe bei ihnen eine lange Tradition, und dass man ihn nun der ganzen Welt zeige, bedeute ihm und seinem Volk sehr viel. Andere sagten, der olympische Inukshuk sei Fake, weil die Inuit nur äußerst selten Steingebilde mit menschlichen Formen errichtet hätten. Und wenn, dann könne dies bedeuten, dass jemand an dieser Stelle gestorben sei, entweder durch Mord oder Selbstmord.
Wenn Motive aus einer anderen Tradition in die populäre Kultur wandern, verlieren sie dabei immer einen Teil ihrer ursprünglichen Bedeutung. Der spirituelle Gehalt eines Inukshuks etwa und dessen Verbindung zu den Vorfahren, die die Figur errichtet haben, bleibt Außenstehenden fremd.
Ein altes Motiv in einem modernen Rahmen kann durchaus ein schönes neues Bild ergeben. Der Inukshuk für die Olympischen Spiele in Vancouver jedenfalls war vor allem ein Symbol für menschliche Wärme und Freundlichkeit. Eine nette Willkommensgeste für die vielen fremden Besucher und gleichzeitig eine Erinnerung für die Kanadier, welche Werte es tatsächlich sind, die Kanada zu einem Land machen, in dem Menschen gerne leben.
Elena Rivera MacGregor brachte es auf den Punkt: „Wenn Besucher euch fragen, was es mit dem Inukshuk auf sich hat, dann erzählt ihnen einfach, dass er für die kanadische Freundschaft steht, das Herz unseres Landes.“
Sauteed Garlic Prawns – gebratene Knoblauchgarnelen
Zutaten für 4 Personen:
12 frische Riesengarnelen
100 g Butter
1 Jalapeño
4 Knoblauchzehen
1 El Öl
4 El Petersilie
½ Bio-Zitrone
Salz und Pfeffer
100 ml Riesling
Salatblätter zum Garnieren
Zubereitung:
Garnelen schälen. Knoblauchzehen schälen und in feine Scheiben schneiden. Petersilie hacken, Schale von ½ Zitrone abreiben. Samen der Jalapeño entfernen, Schote in feine Scheiben schneiden.
Eine große Sautépfanne bei mittlerer Hitze heiß werden lassen, Öl hineingeben und den Knoblauch leicht anrösten. Butter hinzufügen, dann die Garnelen hineinlegen. 1 bis 2 Minuten auf jeder Seite braten, bis das Fleisch rosa wird. Petersilie, Jalapeño und Zitronenschale hinzufügen, dann mit 2 El Zitronensaft und dem Riesling ablöschen. Salz und Pfeffer dazu nach Geschmack. Auf Tellern anrichten und mit Salatblättern garnieren.
Jedes Jahr etwa von Mitte Mai bis Juli werden in British Columbia die wilden „BC spot prawns“, die rotbraunen, weiß gepunkteten Riesengarnelen, gefangen. Mit ihrem feinen süßen Geschmack sind sie unter Gourmets weltweit eine beliebte Delikatesse. In Vancouver feiert man die Saison mit dem jährlichen Spot Prawn Festival. Dann werden die Garnelen ganz frisch vom Boot gekocht oder gebraten – und vor allem in rauen Mengen gegessen.
Regenwald und stinkende Schönheiten – Wander Shore Mountains
Lange Farnwedel wuchern üppig über den Wegrand, an den Ästen der Bäume hängen dicht verwobene Fäden von Moos und Flechten wie die Bärte geheimnisvoller Märchengestalten. Mächtige Baumstümpfe, über und über mit Moos bedeckt, ragen aus dem Waldboden wie die Burgen eines Zwergenvolks. Die Luft ist kühl und feucht, auf Blättern und Nadeln glitzern die Tropfen des letzten Regenschauers. Es lässt sich erahnen, welche Regenmengen übers Jahr diesen Wald tränken, wie die von der Küste heraufziehenden Nebelschwaden für zusätzliches Nass sorgen.
„Ich habe einen Geheimtipp für euch!“, hatte Sarah, die Wirtin unseres B&B in Vancouver, am gestrigen Abend zu uns gesagt. Ihre Großeltern stammen aus vier verschiedenen Ländern und Kulturen, und bei ihr hat sich vor allem das irische Erbe durchgesetzt, in Form von lockigen, kupferroten Haaren.
„Natürlich könnt ihr zur Capilano Suspension Bridge fahren“, fuhr sie fort, „die Hängebrücke über die Schlucht ist eine große Touristenattraktion und sicher einen Besuch wert – wenn man denn bereit ist, über 50 Dollar pro Nase dafür hinzublättern.“ Sie setzte eine verschwörerische Miene auf und senkte ihre Stimme. „Aber im Lynn Canyon Park bekommt ihr etwas geboten, das mindestens genauso schön ist und dazu noch kostenfrei zu erleben: Hängebrücke, Regenwald, Wasserfälle, Wildnis-Trails – was will man mehr?“
Nein, mehr wollen wir nicht, und deswegen sind wir an diesem Morgen schon früh unterwegs. Während der Berufsverkehr in Richtung Stadtzentrum strebt, fahren wir zum Lynn Canyon Park. Der Parkplatz ist noch ganz leer, wir sind anscheinend die einzigen Besucher. Über den Lynn Creek spannt sich eine schmale Hängebrücke aus Holzplanken und einem Geländer aus Drahtgeflecht. Das Schaukeln der Brücke über dem Canyon, der so tief unter uns liegt, als würden wir von einem Hochhaus blicken, beschert uns einen wohligen Nervenkitzel, und lachend wie Kinder laufen wir ein paarmal hin und her, Fotostopp in der Mitte inklusive.
Auf der anderen Seite empfängt uns die schattige kühle Welt des Regenwaldes. Unwillkürlich werde ich ganz still, so als hätte ich eine Kathedrale betreten. Blätter rascheln, Zweige knacken, alte Bäume seufzen, Vögel unterhalten sich vielstimmig, und irgendwo hoch oben klopft ein Specht mit einem deutlich hörbaren Tock-Tock-Tock gegen die Rinde eines Baumes. Der Lynn Creek, ein kleiner wilder Fluss, plätschert über rundgewaschene Steine und um große Felsbrocken herum, die mitten in seinem Bett liegen. Bei den Twin Falls verwandelt er sich in einen zweiteiligen Wasserfall und springt munter zwei große Felsenstufen hinunter, um danach eilig weiterzufließen.
Das Juwel an der nördlichen Peripherie des Großraums Vancouver erscheint wild und ursprünglich, doch Anfang des 20. Jahrhunderts sah es hier noch ganz anders aus. Der Wald mit seinen uralten Bäumen war weitgehend abgeholzt worden, und das Land sollte bebaut werden. Zwei Brüder, die als Projektentwickler tätig waren, wollten die Gegend für Interessenten attraktiver machen und schenkten der Stadt North Vancouver ein paar Hektar ihres Grundbesitzes für einen Stadtpark.
Als besonderer Glanzpunkt wurde dort 1912 die freischwingende Seilbrücke über den Canyon eröffnet, ein spannendes Highlight, das Besucher aus der ganzen Umgebung anzog. Für zehn Cent Eintritt durfte man die Wackelbrücke betreten, um aus 50 Metern Höhe in den Abgrund zu schauen und sich zu gruseln.
Der Geisterbär
Der kleine Stadtpark von damals hat sich zu einem ausgedehnten, ökologisch wertvollen Parkgelände gemausert, das heute 250 Hektar umfasst. Die Bäume, die wir hier sehen, sind „second growth“ und nicht „old growth“, das heißt, sie bilden einen Sekundärwald, da der ursprüngliche Wald dem Kahlschlag zum Opfer fiel. Was macht den Unterschied aus?
In einem von menschlichem Eingreifen weitgehend unberührten Urwald findet man Bäume aller Altersstufen, von den ganz alten Baumriesen bis hin zu den Jungspunden mit ihren dünnen Stämmchen. Hier gelangt viel Licht auf den Waldboden, so dass sich eine dichte und reichhaltige Bodenvegetation bilden kann, die wiederum Lebensräume für viele andere Arten bietet. Beim Sekundärwald, der sich auf abgeholztem oder abgebranntem Terrain ausbreitet, haben alle Bäume ein ähnliches Alter, ihre Kronen bilden zusammen ein Dach, das weniger Sonnenlicht hindurchlässt, zum Nachteil für die Bodenpflanzen. Eine geringere Artenvielfalt ist die Folge.
Im Lynn Canyon Park wachsen vorwiegend Riesenlebensbäume, Douglasien und Hemlocktannen. Sie sind nun 80 bis 100 Jahre alt, und die Baumgemeinschaft hat begonnen, sich wieder in einen Urwald zu verwandeln. Natürlich im Baumtempo, und das ist bekanntlich sehr gemächlich. Bis dieser Wald einen stabilen Urzustand erreicht, kann noch viel Zeit vergehen.
Wenn ich das Wort Regenwald höre, denke ich gleich an einen undurchdringlichen, tropischen Dschungel, den ich in meiner Phantasie noch mit bunten Papageien und kreischenden Affen ausstatte. Doch Regenwälder gibt es auch in den gemäßigten Breiten. An der Pazifikküste Nordamerikas hat sich das Band mit dieser Vegetationsform vom südlichen Alaska über British Columbia bis hinunter nach Nordkalifornien gezogen. Übriggeblieben von dem früheren Reichtum ist heute nur noch eine begrenzte Anzahl von Regenwaldinseln, die aber immerhin einen Schutzstatus genießen.
Die größte dieser Inseln ist der Great Bear Rainforest im nördlichen Teil der Pazifikküste von British Columbia. Er umfasst 6,4 Millionen Hektar, ein riesiges Gebiet, von der Fläche her ungefähr vergleichbar mit Irland. Im Februar 2016 kündigte die Provinzregierung an, 85 Prozent des Waldbestandes in Zukunft vor kommerziellem Holzeinschlag zu schützen – ein Erfolg hartnäckiger Protestkampagnen von Umweltaktivisten weltweit. In der deutschen Greenpeace-Zentrale in Hamburg erinnert noch heute ein sechs Meter hoher Totempfahl an den langen Kampf. Zwei Vertreter der Nuxalk First Nation hatten den Pfahl damals bei ihrem Besuch in Deutschland geschnitzt und als Mahnmal und Zeichen tiefer Verbundenheit übergeben.
Im Great Bear Rainforest mit seinen tausend Jahre alten Riesenlebensbäumen und turmhohen Sitka-Fichten ist eine seltene Tierart zu Hause: der Kermodebär, eine Unterart des Schwarzbären. Die Tiere haben in der Regel einen dunklen Pelz, doch etwa eines von zehn Bärenjungen kommt mit weißem Fell zur Welt. Diese Laune der Natur hat dem weißen Kermodebären einen festen Platz in der Mythologie der Ureinwohner gesichert. „Spirit bear“, so nennen sie ihn. In den Legenden der Tsimshian-Indianer heißt es, der Schöpfer habe einige der Kermodebären mit einem weißen Fellkleid ausgestattet, um an die Zeit zu erinnern, als noch Gletscher das Land bedeckten.
In den Kampagnen der Umweltschützer wurde der weiße Kermodebär zum Gesicht des bedrohten Waldes. Wer die Bäume abholzt, so die Botschaft, nimmt diesen seltenen Bären ihren Lebensraum und hat das Aussterben ihrer Art zu verantworten.
Herr Vancouver und seine Freunde
Das vergleichsweise winzige Regenwäldchen, das wir an diesem Nachmittag besuchen wollen, liegt bei Point Atkinson in West Vancouver. Auch hier folgen wir einem von Sarahs Geheimtipps.
„Ich seh‘ schon“, hatte sie gesagt, „ihr wollt lieber wandern, statt in der City shoppen zu gehen.“ Sie machte ein vorwurfsvolles Gesicht. „Könnt ihr nicht große Tüten mit Zeug aus den Geschäften tragen wie jeder andere normale Tourist? Wanderer sind schlechte Konsumenten und schaden der Wirtschaft!“ Dann lachte sie und sagte, wir sollten den Marine Drive Richtung Westen fahren und nach dem Lighthouse Park Ausschau halten.
Wir versicherten ihr, wir würden nach dem Ausflug noch irgendwo einen Kaffee trinken und auf diese Weise zumindest im Café die Kasse zum Klingeln bringen.
Der kleine, aber feine Lighthouse Park besteht aus einer rund 75 Hektar großen Wald- und Felsenlandschaft. Wir wandern den Trail „Valley of the Giants” entlang, vorbei an mächtigen Douglasien und Riesenlebensbäumen. Dieser Wald ist tatsächlich „old growth“, denn die Baumriesen sind 500 bis 600 Jahre alt. Das heißt, sie hatten bereits eine stolze Höhe erreicht, als Kapitän George Vancouver, der Entdecker und Seefahrer, im Jahr 1792 mit seinem Dreimaster Discovery in den Burrard Inlet segelte. Dieser Fjord reicht weit ins Land hinein, er trennt die flache Burrard-Halbinsel im Süden, wo auch die Stadt Vancouver liegt, von den Berghängen der North Shore Mountains.
In einem weiten Bogen gelangen wir zum Aussichtspunkt Lighthouse Viewpoint. Zwischen den Bäumen ragt der rotweiße Leuchtturm von Point Atkinson auf, dahinter sehen wir das Meer schimmern. Ob Kreuzfahrtschiff, Containerschiff, Öltanker oder Kohlefrachter, ihr Seeweg von und nach Vancouver führt immer an dieser Landspitze vorbei.
Kapitän Vancouver pflegte die Gewohnheit, alle geografischen Besonderheiten, die er unterwegs passierte, nach guten Freunden aus den Kreisen des britischen Adels und Militärs zu benennen. So trägt der Burrard Inlet den Namen von einem Sir Harry Burrard, und Point Atkinson wurde nach Thomas Atkinson benannt, „einem besonderen Freund“, wie Vancouver sich ausdrückte. Normalerweise wären diese Herren längst vom Dunkel des Vergessens verschluckt worden, doch der Kapitän verhalf ihnen zur Unsterblichkeit. Er selbst wurde knapp hundert Jahre später der Namenspate einer Stadt mit großer Zukunft, was auch seinen Bekanntheitsgrad enorm erhöhte.
Unser Rückweg führt in Windungen steil bergauf und bergab, im Dämmerlicht des Waldes, unter hohen Baumkronen und inmitten von regenfeuchtem, üppig wucherndem Grün – volles Urwald-Feeling. Zurück in der Zivilisation kehren wir in einem Café ein und bestellen uns Caffè Latte und Blaubeermuffins. Sarah soll zufrieden mit uns sein.
Lockende Düfte
„Wenn ihr es nicht so eilig habt, in die City zu kommen“, sagt unsere Gastgeberin am nächsten Morgen beim Frühstück, „dann hätte ich ...“
„Noch einen Geheimtipp für uns?“, frage ich sie mit einem Lächeln.